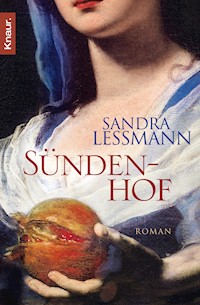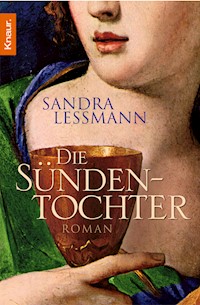5,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Serienmörder treibt in London sein Unwesen 1665: In den Nachwehen des Bürgerkriegs schwelt noch immer überall Gefahr. Auch für den Jesuitenpartner Jeremy Blackshaw, der seiner Profession nicht mehr frei nachgehen kann. Er beginnt, in London wieder als Arzt zu arbeiten, doch als er zu einem Patienten gerufen wird, findet sich Jeremy plötzlich inmitten eines Netzes mysteriöser Anschläge wieder: Sir Orlando, ein angesehener Richter, vermutet hinter dem unerwarteten Tod eines Kollegen einen perfiden Giftmord. Und auch seine eigene Gesundheit ist auf einmal gefährlich angegriffen. Wird London von einem Serienmörder heimgesucht? Pater Jeremy ist fest entschlossen, den Täter zu finden, bevor dieser erneut zuschlagen kann… Erleben Sie mit dem ersten Roman der großen PATER JEREMY-Reihe fesselnde historische Unterhaltung. Fans von Ellis Peters und Oliver Pötzsch werden begeistert sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
1665: In den Nachwehen des Bürgerkriegs schwelt noch immer überall Gefahr. Auch für den Jesuitenpartner Jeremy Blackshaw, der seiner Profession nicht mehr frei nachgehen kann. Er beginnt, in London wieder als Arzt zu arbeiten, doch als er zu einem Patienten gerufen wird, findet sich Jeremy plötzlich inmitten eines Netzes mysteriöser Anschläge wieder: Sir Orlando, ein angesehener Richter, vermutet hinter dem unerwarteten Tod eines Kollegen einen perfiden Giftmord. Und auch seine eigene Gesundheit ist auf einmal gefährlich angegriffen. Wird London von einem Serienmörder heimgesucht? Pater Jeremy ist fest entschlossen, den Täter zu finden, bevor dieser erneut zuschlagen kann…
Über die Autorin:
Sandra Lessmann, geboren 1969, lebte nach ihrem Schulabschluss fünf Jahre in London. Zurück in Deutschland studierte sie in Düsseldorf Geschichte, Anglistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Institut für Geschichte der Medizin; ein Thema, dass sie ebenso wie ihre Englandliebe in ihre historischen Romane einfließen ließ.
Bei dotbooks veröffentlichte Sandra Lessmann ihre historischen Romane »Die Spionin der Krone« und »Die Kurtisane des Teufels« sowie weitere Bände ihrer historischen Krimireihe um »Pater Jeremy«.
Die Website der Autorin: www.sandra-lessmann.de
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/A-R-T, cosma, Luuuusa und einer historische Londonkarte von De Witt
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-201-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandra Lessmann
Die Richter des Köngs
Roman
dotbooks.
Erstes Kapitel
1664
Der alternde Taschendieb Jack Einauge erreichte den verabredeten Treffpunkt in Whitefriars beim zehnten Glockenschlag. Der aufgehende Mond tauchte die Ruinen des ehemaligen Karmeliterklosters in ein silbernes Licht, das hell genug war, so dass man sich auch ohne Laterne zwischen dem herumliegenden Bauschutt und zerbröckelnden Gestein zurechtfinden konnte. Hier war man vor neugierigen Augen so gut wie sicher. Nur ein paar Bettler, die keine andere Unterkunft fanden, hausten in dem zugigen Gemäuer. Irgendwo in einer Ecke des Chors hustete sich einer dieser armen Schlucker die Seele aus dem Leib. Einauge achtete nicht darauf. Ungeduldig rieb er sich die knotigen Hände. Die Zeiten, als seine flinken Finger die Beutel wohlhabender Bürger unbemerkt von deren Gürteln schneiden konnten, waren seit langem vorüber. Das Werkzeug seiner Zunft war nutzlos geworden, und an manchen Tagen gelang es ihm nicht einmal mehr, einen Humpen Ale zu heben. Die Erkenntnis, dass er langsam, aber sicher zum Krüppel wurde, hatte seinen Gaunerstolz gebrochen. Um nicht zu verhungern, übernahm er mittlerweile jede Arbeit, die er kriegen konnte.
»Hast du die Liste?«, fragte unvermittelt eine Stimme aus dem Halbdunkel einer Mauernische.
Einauge fuhr erschrocken herum und musterte die Gestalt, die in einen langen Kapuzenmantel gehüllt war. »Bei Christi Blut! Ihr schleicht wie eine Katze. Hätte mir fast die Hosen nass gemacht!«
»Hasenfuß! Heb dir das für den Tag auf, an dem man dich hängt. Hast du die Namen besorgt?«
»Ja.«
»Dann gib sie mir!«
»Erst das Geld.«
Aus der Nische wurden ihm einige Münzen entgegengeworfen. Er versuchte, sie zu fangen, doch es misslang ihm kläglich. Fluchend kniete er sich auf den Boden und sammelte sie eine nach der anderen ein. Nachdem er sie begutachtet hatte, nickte er zufrieden. »Ihr seid recht freigebig. Ich versteh Euch nicht. Wozu braucht Ihr mich, um die Namen rauszufinden? Es gibt doch Protokolle, wo man so was nachlesen kann.« Der Taschendieb grinste breit »Aber vielleicht wollt Ihr nicht beim Rumschnüffeln erwischt werden. Habt irgendeine Gaunerei vor, was?«
»Das geht dich nichts an, mein Lieber.«
»Offen gesagt will ich’s auch gar nicht wissen. Hier habt Ihr die Liste.«
Einauge griff in seine zerschlissene Kniehose, holte ein schmutziges Stück Papier hervor und legte es in die Hand, die sich ihm entgegenstreckte. Das Mondlicht reichte gerade aus, um das Geschriebene zu entziffern.
»Das sind nicht alle, Einauge. Was ist mit dem Wundarzt?«
»Nichts zu machen. Der Bursche, der mir die Namen aufschrieb, konnte sich nicht erinnern, wie er hieß. Es ist zu lange her. Und ich glaube, einer der Richter ist vor ein paar Monaten gestorben.«
Ohne es zu sehen, ahnte Einauge, dass sich die Lippen, die im Schatten der Kapuze lagen, zu einem kalten Lächeln verzogen.
»Das scheint Euch nicht besonders zu betrüben«, bemerkte er sarkastisch.
»Warum sollte es?«, war die ungerührte Antwort. »Jeder bekommt nur, was er verdient.«
Auch ein abgefeimter Spitzbube wie Jack Einauge konnte sich beim Klang dieser eisigen Stimme eines Schauderns nicht erwehren. Es lag eine unerschütterliche Entschlossenheit darin, die selbst ihm unheimlich war.
Der sommerliche Regenschauer hatte nachgelassen. Ein schmaler Riss in der grauen Wolkendecke gab den Blick auf den blauen Himmel frei. Doch die Sonnenstrahlen erreichten nur vereinzelt die Gassen des Londoner Stadtkerns, die von den weit vorspringenden Giebeln der Häuser beschattet wurden.
Der Wundarzt Alan Ridgeway gab seinem Gesellen noch einige Anweisungen, bevor er seine Chirurgenstube verließ und auf die Paternoster Row hinaustrat. Dabei stolperte er über einen Haufen Unrat, den sein Nachbar auf dem Kopfsteinpflaster zusammengefegt hatte, und stieß einen Fluch aus. Es erforderte schon eine gewisse Behändigkeit, sich in den vom Kehricht und Dung der freilaufenden Schweine verschmutzten Straßen fortzubewegen, ohne sich die Kleider zu ruinieren, besonders wenn der Regen den Dreck in Morast verwandelt hatte.
Da kein Fuhrwerk kam, balancierte Alan vorsichtig über die offene Abflussrinne in der Mitte der Straße und bog in die schmale Ave Maria Lane ein. An der Ecke präsentierte sich ihm ein Schauspiel, das ihn lächelnd im Schritt verhalten ließ. Eine dralle Milchmagd beugte sich gerade vor, um das Joch, an dem sie die Eimer trug, wieder auf ihre Schultern zu heben. Dabei hüpften ihr die runden Brüste regelrecht aus dem Mieder, und Alan konnte nicht widerstehen, sie mit den Händen aufzufangen. Die Milchmagd zuckte nicht zurück, sondern kicherte vergnügt, denn sie war seine forsche Art gewöhnt.
»Aber, aber, Meister Ridgeway«, gluckste sie, während er ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab.
Obwohl schon sechsunddreißig Jahre alt und in der Chirurgengilde fest etabliert, war Alan noch immer Junggeselle. Trotzdem dachte er nicht daran, ein keusches Leben zu führen. Die junge Milchmagd war eine von mehreren willigen Frauen in der Nachbarschaft, mit denen er hin und wieder ein Schäferstündchen verbrachte. Dafür behandelte er sie kostenlos, wenn sie Beschwerden hatten.
Alan wollte eben seinen Weg fortsetzen, als eine vertraute Stimme in seinem Rücken erklang: »Ihr seid wirklich unverbesserlich. Noch immer derselbe Schürzenjäger!«
Überrascht fuhr Alan herum und betrachtete mit gerunzelter Stirn den ganz in schwarz gekleideten Mann, der hinter ihm stand. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein Prediger oder ein Kaufmann mit puritanischen Prinzipien, denn seine strenge dunkle Aufmachung wurde nur von einem schlichten weißen Leinenkragen aufgehellt. Doch der Schein trog. Alan wusste, dass der Mann, wie er selbst auch, dem römisch-katholischen Glauben angehörte, denn er erkannte in ihm einen alten Kameraden aus dem Bürgerkrieg.
»Jeremy! Jeremy Blackshaw! Aber wie ist das möglich? Ich glaubte Euch seit langem tot! Seit der Schlacht von Worcester vor dreizehn Jahren, um genau zu sein.«
»Wie Ihr seht, bin ich am Leben«, erwiderte der andere lächelnd. »Aber ich war lange auf Reisen und bin erst vor zwei Jahren nach England zurückgekehrt.«
Alan strahlte vor Freude über das ganze Gesicht und umarmte seinen lang vermissten Freund. Sie hatten beide in der royalistischen Armee als Feldscher gedient. Nach der Schlacht von Worcester im Jahre 1651, bei der Alan von den Anhängern des Parlaments gefangen genommen worden war, hatten sie sich aus den Augen verloren. Es erschien ihm wie ein Wunder, den Kameraden von damals lebendig wiederzusehen.
»Wo wohnt Ihr?«, fragte Alan wissbegierig.
»Im Moment in der ›Pfauenschenke‹.«
»Dann nehmt morgen früh mit mir dort den Morgentrunk ein. Ich möchte hören, wie es Euch in all der Zeit ergangen ist. Leider bin ich sehr in Eile, sonst hätte ich Euch gebeten, mit mir essen zu gehen. Aber ich muss zu einer Sektion.«
Jeremy Blackshaw zog interessiert die Augenbrauen hoch.
»Eine Anatomievorlesung?«
»Nein, es geht um einen mysteriösen Todesfall. Der Leichenbeschauer hat eine Untersuchung angeordnet.«
»Ich verstehe. Treffen wir uns also morgen in der ›Pfauenschenke‹. Sicher werdet Ihr mir ebenso viel zu erzählen haben wie ich Euch.«
Alan eilte mit einem Lächeln auf den Lippen davon. Er hatte die Neugierde in Jeremys Augen aufblitzen sehen, ein Ausdruck, der ihm vertraut war, denn sein alter Freund hatte schon damals nichts so sehr geliebt wie ein kniffliges Rätsel. Und er hatte auch von jeher eine besondere Begabung gehabt, Probleme allein durch logische Schlussfolgerungen zu lösen.
Die Leichenschau wurde im Hinterzimmer einer Schenke durchgeführt. Hier würde später auch die Anhörung stattfinden, bei der eine Jury nach Betrachtung der Tatbestände über die Todesursache entschied. So war es in England Brauch. Bei Alans Eintreffen waren bereits drei Männer anwesend: ein Chirurg, der ihm zur Hand gehen sollte, ein akademisch ausgebildeter Arzt und der Leichenbeschauer John Turner. Die Medizin teilte sich schon seit mehreren hundert Jahren in zwei Aufgabenbereiche:
Während die handwerklich ausgebildeten und in Zünften organisierten Wundärzte nur äußerliche Behandlungen durchführten, widmeten sich die Doctores, die an der Universität studiert hatten, den inneren Krankheiten. So würde auch bei der Untersuchung des Leichnams Dr. Wilson die Chirurgen nur aus dem Hintergrund beaufsichtigen, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Doch Alan war die Hochnäsigkeit der studierten Ärzte gewöhnt und bemühte sich, sie zu ignorieren. Man wartete nur noch auf den Richter Sir Orlando Trelawney, der darauf bestanden hatte, der Sektion beizuwohnen.
Der Tote lag aufgebahrt auf einem groben Holztisch nahe der Fenster. Alan und der andere Chirurg machten sich daran, ihn zu entkleiden und zu waschen, als der Richter in der Tür erschien. Trelawney war ein ungewöhnlich hoch gewachsener Mann mit kräftigem Knochenbau, dazu war er sehr schlank, was ihn noch größer wirken ließ. Das Gesicht mit den ausgeprägten Zügen, den kühlen blauen Augen und den fleischigen Lippen strahlte Willensstärke und Intelligenz aus. Eine blonde gelockte Perücke umrahmte es wie eine Löwenmähne.
Sir Orlando Trelawney vermied es, den Toten anzusehen, und heftete den Blick stattdessen auf die vier Männer, die ihn erwarteten.
»Seid Ihr sicher, dass Ihr zusehen wollt, Mylord?«, fragte Turner.
Trelawney nickte. Er hatte noch nie einer Leichenöffnung beigewohnt und verspürte bei dem Gedanken daran ein leichtes Grausen. Im Gegensatz zum Kontinent, wo die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., die Carolina, gerichtsmedizinische Untersuchungen vorschrieb, waren in England Sektionen zur Feststellung der Todesursache nicht üblich. Es war Aufgabe des Leichenbeschauers, der gewöhnlich weder über medizinische noch juristische Kenntnisse verfügte, zu entscheiden, ob ein Verbrechen vorlag oder nicht. Und da dieser schlecht bezahlte Beamte keine zusätzliche Vergütung für eine Untersuchung erhielt, nahm er diese nur vor, wenn es bereits einen Mordverdächtigen gab, denn bei dessen Verurteilung fiel dem Leichenbeschauer ein Teil seines Besitzes zu.
Als Richter des Königlichen Gerichtshofs bedauerte Sir Orlando die Rückständigkeit der englischen Verhältnisse. Allein die Zahl der Giftmorde, die aus diesem Grund unentdeckt blieben, war unmöglich abzuschätzen. Im vorliegenden Fall hatte Trelawney ein persönliches Interesse an einer genauen Untersuchung, denn der Tote auf dem Tisch war kein Unbekannter, sondern ein Freund und Kollege: Baron Thomas Peckham, Richter des Finanzgerichts.
»Ihr könnt anfangen«, verkündete Sir Orlando, während er seinen Hut und Umhang über einen Schemel warf.
Dabei schnappte er Alan Ridgeways zweifelnden Blick auf. Dieser war seit langem mit dem Richter bekannt und wusste daher, welch schwere Zeit Trelawney gerade durchmachte. Vor wenigen Wochen erst war seine Gemahlin nach einer Fehlgeburt gestorben. Sie ließ ihn kinderlos zurück. In den fünfzehn Jahren ihrer Ehe hatten sie einen schwächlichen Säugling nach dem anderen zu Grabe getragen. Nun blieb ihm nur noch seine Nichte, eine zänkische Jungfer, die er seit längerem vergeblich zu verheiraten versuchte und die ihm widerwillig den Haushalt führte.
Die Nachricht von Peckhams Tod hatte Sir Orlando in seiner Trauer umso härter getroffen. Der Baron war vor einer Woche an einer milden Kolik erkrankt und von einem Arzt behandelt worden. Obwohl es ihm kurz darauf bereits besser gegangen war, hatte er eines Morgens einen heftigen Anfall erlitten und war nach furchtbarem Leiden noch am selben Abend gestorben. Die Plötzlichkeit seines Todes erschien der Ehefrau so verdächtig, dass sie sich an Trelawney wandte und ihn um Rat fragte. Sie befürchtete, dass der Arzt ihrem Mann ein falsches Medikament verabreicht hatte, und wollte Klarheit gewinnen. Der Richter informierte daraufhin den Leichenbeschauer, der allerdings Zweifel äußerte, ob eine Sektion ein eindeutiges Ergebnis bringen würde. Doch Trelawney war entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen, und entschied sich, bei der Leichenöffnung anwesend zu sein, um dafür zu sorgen, dass sie sorgfältig durchgeführt wurde, auch wenn weder er noch der Leichenbeschauer oder die Chirurgen so recht wussten, wonach sie suchen sollten.
Sir Orlando zwang sich, in das Gesicht des Toten zu sehen, das wie aus Wachs geformt schien. Die Leblosigkeit der Züge machte es dem Richter schwer, in dem Leichnam seinen Amtsbruder wiederzuerkennen. Wie von selbst wanderte sein Blick zu Alan Ridgeway, der das Äußere der Leiche einer genauen Begutachtung unterzog. Trelawney kannte den jungen Mann als begabten Wundarzt, der seinem Handwerk mit Hingabe nachging, aber deutlich an der Unzulänglichkeit seines medizinischen Wissens litt. Gegen die meisten Krankheiten war er machtlos.
Wie gebannt fixierte Sir Orlando Alan Ridgeways Profil mit der geraden Nase und den schmalen Lippen, nur um nicht auf den Leichnam blicken zu müssen. Kohlschwarzes glattes Haar, das nur an den Schläfen von einigen silbernen Fäden durchsetzt war, fiel dem Chirurgen bis auf die Schultern herab, auf Kinn und Wangen lag ein dunkler Bartschatten, der sich von seiner weißen Haut abhob. Sorgfältig drehte er den Toten hin und her, damit ihm kein Hinweis entging. Das einzig Auffällige war die seltsame, nach innen gekrümmte Stellung der Finger und Zehen: Peckham war unter schmerzhaften Krämpfen gestorben.
Trelawney stieß einen tiefen Seufzer aus. Wieder traf ihn ein besorgter Blick aus Alans bleigrauen Augen. Und wieder nickte der Richter störrisch wie ein Kind, das entgegen alle Vernunft seinen Mut beweisen will.
Alan schüttelte missbilligend den Kopf und beugte sich mit einem Messer in der feingliedrigen Hand über den Toten. Zuerst machte er mit der Spitze der Klinge einen Einschnitt in das Bauchfell des Leichnams. Dann schob er zwei Finger in das so entstandene Loch und löste die Bauchdecke von den Eingeweiden, um sie beim Aufschneiden nicht zu verletzten. Als der Bauch auseinanderklaffte, wurde unter der Haut die gelbe Fettschicht sichtbar. Es folgte ein zweiter horizontaler Schnitt, so dass die Form eines Kreuzes entstand.
Der Wundarzt entfernte nacheinander Milz, Nieren, Zwölffingerdarm und Magen und schnitt jedes Organ auf. Im Innern des Magens befand sich ein dunkelgrauer Rückstand, außerdem waren die Wände stark entzündet. Daraufhin öffnete Alan auch den Schlund und die Speiseröhre, die ebenfalls eine auffällige Rötung zeigten. Der Arzt und die Chirurgen kamen überein, dass der Baron unzweifelhaft an einer giftigen Substanz gestorben war, konnten jedoch nicht sagen, worum es sich dabei handelte. Alan nahm eine Probe des Mageninhalts, bevor er die Organe in den Körper zurücklegte und ihn wieder zunähte.
Trelawney hatte schweigend zugesehen und sich in die Diskussion nicht eingemischt. Unter seiner langen blonden Perücke war er so bleich geworden wie der Tote.
Alan fragte sich unwillkürlich, weshalb der Richter sich zugemutet hatte, der Zergliederung eines Freundes zuzusehen, obwohl es nicht zu seinen Pflichten gehörte. Aber Sir Orlando war für seine Gewissenhaftigkeit bekannt. Er überzeugte sich lieber mit eigenen Augen, als sich auf die Aussagen anderer zu verlassen. Trelawney gehörte zu den Menschen, die strenge Prinzipien hatten und diesen auch in schwierigen Zeiten treu blieben. Sein Vater, ein Landedelmann aus Cornwall, hatte ihn als Kind auf die St.-Paul’s-Schule in London und später auf das Emanuel College in Cambridge geschickt. Darauf folgte ein Studium der Jurisprudenz am Inner Temple. Der Bürgerkrieg zwischen König und Parlament machte Trelawneys Laufbahn als Advokat jedoch ein frühzeitiges Ende. Er diente zwei Jahre als Offizier im königlichen Heer, bevor er gefangen genommen wurde und einige Zeit im Tower verbringen musste. Nach der Hinrichtung König Charles’ I. übernahm Oliver Cromwell die Macht und verwandelte England in eine Republik. Als Royalist konnte Trelawney seine Regierung nicht als gesetzmäßig anerkennen und arbeitete fortan zurückgezogen als außeramtlicher Rechtsberater. Bei der Wiederherstellung der Monarchie im Jahre 1660 belohnte der neue König Charles II. diese Loyalität, indem er Trelawney und einige andere Juristen bei den Gerichtsverfahren gegen die Königsmörder zu Vertretern der Anklage berief. Danach wurde er zum Richter des Court of King’s Bench, des Königlichen Gerichtshofs, ernannt und erhielt den Ritterschlag. Seitdem galt er nicht nur in London als unbestechlicher Richter, dem das Schicksal der Angeklagten, die vor ihm erschienen, nicht gleichgültig war – eine Seltenheit in dieser Zeit!
Und aus diesem Grunde schätzte auch Alan ihn sehr.
Zweites Kapitel
Es dämmerte bereits, als Sir Orlando Trelawney sich durch die unbeleuchteten Gassen von St. Clement Danes auf den Heimweg machte. Ein leichter Nieselregen hatte eingesetzt und sprühte ihm ins Gesicht, so dass er seinen Hut tiefer in die Stirn zog und sich enger in seinen Umhang schmiegte. Eine Weile stapfte er tief in Gedanken versunken dahin, bis er bemerkte, dass er in die falsche Richtung ging. Verwirrt blieb er vor einem Misthaufen stehen, auf dem eine tote Ratte lag, und versuchte, sich darüber klar zu werden, wo er sich befand. Es gelang ihm nicht. In seinem Innern herrschte eine quälende Leere, die seinen ganzen Körper lähmte und jede Bewegung zu einer Kraftanstrengung werden ließ.
Der Tod! Überall zeigte er sein höhnisches Gesicht, seine grinsende Fratze. Sicher, die Nähe des Todes war nichts Ungewöhnliches für ihn. In der Zeit, in der er lebte, begegnete man ihm ständig. Kriege, Seuchen, Hinrichtungen – er hatte alles miterlebt. Es gab keine Gewähr, ein hohes Alter zu erreichen, und unter den Schwächsten, den Kindern, hielt der Tod die reichste Ernte. Ja, eigentlich war er daran gewöhnt, Menschen sterben zu sehen, und als Richter hatte er zudem so manches Todesurteil gefällt. Und doch war jetzt alles anders als früher. Erst der Verlust seiner Frau, der leidgeprüften ergebenen Gefährtin, dann seines langjährigen Freundes Peckham, den er seit seiner Studienzeit im Temple gekannt hatte. Es schien ein so sinnloser, grausamer Tod, offenbar verursacht durch das Versehen eines Arztes oder des Apothekers, der die Medizin hergestellt hatte. Aber das blieb noch zu überprüfen.
Er hatte alles verloren, was ihm lieb und teuer war. Nun gab es nichts mehr, was man ihm noch nehmen konnte. Hatte er denn so schwer gesündigt, dass Gott ihn auf diese Weise strafte? Sollte er die Verzweiflung der Einsamkeit kennen lernen? Manchmal beneidete er die abergläubischen Katholiken, die die ständige Gegenwart ihrer Heiligen um sich spürten und unter dem Mantel der Gottesmutter Schutz fanden. Ihm als Protestanten blieb ein solcher Trost versagt. So unvernünftig ihm der römische Glaube auch erschien, in diesem Moment verstand er, weshalb die kleine Gruppe Katholiken, die es in England noch gab, so hartnäckig daran festhielt.
Noch immer starrte Sir Orlando wie verhext auf den Rattenkadaver vor ihm, dem Sinnbild des Todes. Die Leere in seinem Inneren wandelte sich langsam zu einem tiefen dumpfen Schmerz, der ihm die Brust zusammendrückte. Der Gedanke an sein Haus in der Chancery Lane hatte nichts Verlockendes für ihn. Es erschien ihm leer und kalt, trotz seiner reichen Ausstattung. Dort erwartete ihn nur das schrille Gekeife seiner Nichte, die mit ihrem Schicksal haderte und ihn dafür verantwortlich machte, dass er sie nicht gut verheiratete.
Wie ein Schlafwandler setzte Trelawney sich wieder in Bewegung und hielt erst an, als das laute Stimmengewirr zechender Nachtschwärmer die Nähe einer Schenke verriet. Der Richter trat ohne Zögern ein und suchte sich durch die dichten Schwaden blauen Tabakrauchs einen abgelegenen Tisch, um den Schmerz in seiner Brust mit Wein zu betäuben.
Als er erwachte, wusste er nicht, wo er war. Jemand zerrte grob an seinen Kleidern. In dem Glauben, man versuche, ihn zu berauben, begann er instinktiv, sich zu wehren, und schlug orientierungslos um sich. Eine Stimme rief etwas, das er nicht verstand. Er hörte Schritte, die durch den Morast klatschten. Als seine von Trunkenheit verschleierten Augen endlich wieder klarsehen konnten, bemerkte er einen jungen Mann mit zerzausten langen Haaren, der sich über ihn beugte. Er sprach mit einem starken irischen Akzent, dessen fremdartiger Klang ein unbestimmtes Gefühl von Furcht in Trelawney weckte.
»Seid Ihr verletzt, Sir? Braucht Ihr Hilfe?«
Der junge Ire packte ihn am Arm, um ihn auf die Beine zu ziehen. In seinem hilflosen Zustand erlebte Sir Orlando die energische Berührung wie einen Angriff und erwartete jeden Moment einen Schlag mit der Faust oder einen Stich mit dem Messer. Wutentbrannt stieß er seinen Gegner zurück, raffte sich mühsam vom Boden auf und tastete unkontrolliert nach seinem Degen. Bevor er die Klinge aus der Scheide ziehen konnte, hatte sich der Ire jedoch mit einem leichtfüßigen Sprung außer Reichweite gebracht.
Die Stimme des Burschen nahm einen verbitterten, hasserfüllten Ton an, während er wütend die Faust gegen den Richter schüttelte: »Dann verreck doch im Straßenkot, verfluchter Engländer! Was kümmert’s mich!« Im nächsten Moment war er lautlos in der Nacht verschwunden.
Trelawney hielt sich nur mit äußerster Anstrengung auf den Beinen. Er war kein gewohnheitsmäßiger Trinker und daher nur wenige Male in seinem Leben bis zur Besinnungslosigkeit berauscht gewesen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er begriff, dass er in einem Hauseingang gelegen hatte. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, die Schenke verlassen zu haben oder auf dem Heimweg eingeschlafen zu sein. Prüfend fuhr er sich mit der Hand über die Taille und stellte zu seiner Überraschung fest, dass sein Geldbeutel noch da war. Zum Glück war er erwacht, bevor dieser irische Spitzbube ihn ausrauben konnte.
Ein leichter Wind kam auf und ließ ihn frösteln. Trelawney rückte seinen Umhang auf seinen Schultern zurecht, der sich verschoben hatte, und zog den Wollstoff fester um sich. Nachdem er sich in der Dunkelheit orientiert hatte, stapfte er durch den Straßenschlamm in Richtung der Chancery Lane. An seinem Haus angekommen, taumelte er über die Schwelle und stieg schwankend die Stufen zu seinem Schlafgemach hinauf. Seine Nichte und die Dienerschaft schliefen friedlich. Niemanden kümmerte es, ob er da war oder nicht. Abgrundtiefe Müdigkeit überkam den Richter, als er sich auf die Kante des Baldachinbettes sinken ließ und sich umständlich die Schuhe auszog.
Da öffnete sich leise die Tür, und sein Kammerdiener Malory huschte verschlafen herein, um ihm beim Auskleiden zu helfen. Der mitleidige Blick, den Malory seinem Herrn zuwarf, führte Trelawney seine ganze Erbärmlichkeit so schmerzhaft vor Augen, dass er gereizt einen seiner schlammbeschmutzten Schuhe ergriff und nach dem Kammerdiener warf.
»Verschwinde! Lass mich allein!«, brüllte er. »Lass mich allein!«
Malory gehorchte schweigend, jedoch nicht, ohne den Richter mit einem weiteren mitfühlenden Blick zu bedenken. Trelawney barg schluchzend das Gesicht in den Händen. Dann ließ er sich, bekleidet wie er war, aufs Bett sinken und fiel in unruhigen Schlaf.
Ein unangenehmes Jucken am ganzen Körper weckte ihn. Ohne sich dessen bewusst zu sein, kratzte er sich die Haut blutig.
Es war bereits heller Tag. Als Trelawney verwirrt um sich blickte, bemerkte er, dass seine Kleider über Nacht ein Eigenleben entwickelt hatten. Etwas bewegte sich in den Falten des Stoffs, kroch unter sein Wams, dann zwischen sein Leinenhemd und seine Haut, verbiss sich in seinem Fleisch und saugte gierig sein Blut. Mit einem jähen Gefühl des Ekels sprang der Richter vom Bett, zerrte sich Perücke und Kleider vom Leib und schleuderte sie auf den Boden. Jedes einzelne Stück wimmelte vor Läusen.
Trelawney konnte einen saftigen Fluch nicht unterdrücken. Er hasste die kleinen Quälgeister und achtete stets auf Reinlichkeit, um sie sich vom Hals zu halten. Folglich konnte er sich das Ungeziefer nur bei seinem gestrigen Besuch in der Schenke geholt haben. Das war nun die Strafe für seine gottlose Trunkenheit, in der er vergeblich Vergessen gesucht hatte.
Trelawney wollte gerade nach seinem Kammerdiener rufen, als sein Blick an den übereinander geworfenen Kleidern hängen blieb. Vorsichtig zog er Hemd und Wams, die zuoberst lagen, beiseite und betrachtete verwirrt den Umhang. Erst jetzt fiel ihm auf, dass es nicht der seine war, sondern ein fremder. Und da begriff er auch, wie er sich die Läuse geholt hatte. Er musste beim Verlassen der Schenke aus Versehen den Mantel eines anderen Gastes statt seines eigenen mitgenommen haben. Die Dunkelheit und sein benebelter Geist hatten ihn daran gehindert, den Irrtum zu bemerken. Er hatte sich die Unannehmlichkeiten also selbst zuzuschreiben.
Ärgerlich rief er nach Malory und versuchte, das quälende Jucken zu ignorieren, das die Bisse der lästigen Plagegeister überall an seinem Körper auslösten. Doch es war sinnlos. Immer wieder ertappte er sich dabei, wie er sich gegen seinen Willen kratzte, bis seine Haut mit Schrammen bedeckt war.
Drittes Kapitel
Am frühen Morgen machte sich Alan zur »Pfauenschenke« auf. An der Tür blieb er stehen, um nach seinem Freund Ausschau zu halten, und entdeckte ihn schließlich an einem Tisch im hinteren Bereich des Schankraums. Zu Alans Überraschung war er nicht allein, sondern befand sich im Gespräch mit einer Frau, die einen langen Kapuzenmantel trug. Ihr Gesicht war hinter einer schwarzen Samtmaske verborgen. Schon seit längerer Zeit war es für Damen unterschiedlichen Standes Mode, maskiert auf die Straße zu gehen. Einerseits ermöglichte ihnen dies, unerkannt zu bleiben, andererseits schützten sie so ihre Haut vor der bräunenden Sonne.
Als Alan fasziniert nähertrat, wandte sich die Frau gerade zum Gehen. Beim Verlassen des Schankraums streifte ihr Umhang leicht Alans Hand. Dabei nahm er den betörenden Duft eines teuren Parfüms wahr. Und da er immer nur eines im Sinn hatte, vermutete er sogleich, dass sie die Mätresse seines Freundes war, obwohl eine heimliche Liebschaft gar nicht zu Jeremy Blackshaw passte, den er früher nur als Kostverächter gekannt hatte. Außerdem verwirrte es ihn, dass die Maskierte mehr den Eindruck einer vornehmen Dame machte als einer auf Abwege geratenen Bürgersfrau. Brennend vor Neugier trat Alan an den Tisch seines Freundes und setzte sich zu ihm.
»Wie ich sehe, hattet Ihr Besuch. Wer ist die schöne Unbekannte?«
»Woher wollt Ihr wissen, dass sie schön ist?«, meinte Jeremy spöttisch. »Ihr habt ihr Gesicht doch gar nicht gesehen.«
»Dafür habe ich eine Nase«, sagte Alan und tippte sich grinsend an dieselbe. »Allein die anmutige Art, wie sie sich bewegt, und die stolze Haltung. Und ich dachte immer, Ihr seid für die Reize der Frauen nicht empfänglich.«
»Alan, Ihr beobachtet zwar sehr genau, aber leider missdeutet Ihr, was Ihr seht«, belehrte Jeremy seinen alten Kameraden.
»Und Ihr seid ein größerer Narr, als ich dachte, wenn Ihr ein so verführerisches Weib verschmäht«, gab Alan zurück.
Er blickte prüfend in das verschlossene Gesicht seines Freundes und seufzte. Er hatte es noch nie verstanden, darin zu lesen. Es war ein langes, schmales Gesicht mit einer hohen, gewölbten Stirn, tief liegenden Augen, die stets vor Lebendigkeit sprühten, und stark modellierten Wangenknochen. Die Nase erinnerte an den Schnabel eines Raubvogels. Zu beiden Seiten der Nasenflügel zog sich eine Falte bis zu den schmalen Lippen. Darunter sprang ein markantes, spitzes Kinn hervor. Jeremys Körper war ebenso hager wie sein Gesicht. Alan war überzeugt, dass er noch immer so asketisch lebte wie früher. Bis auf die Fächer kleiner Fältchen in seinen Augenwinkeln erschien er fast unverändert. Auch sein glattes, dunkelbraunes Haar, das er wie die meisten Männer lang bis auf die Schultern trug, wies kaum graue Fäden auf.
»Erinnert Ihr Euch noch an den Tag, als wir uns das letzte Mal sahen?«, fragte Alan ein wenig schwermütig, denn die Erinnerung an den Bürgerkrieg, unter dem damals ganz England gelitten hatte, weckte starke Gefühle in ihm. Die Hinrichtung König Charles’ I. nach einem vom Parlament veranstalteten Schauprozess hatte ihrer aller Leben in den Grundfesten erschüttert. Der Sohn des Märtyrerkönigs, der jetzige Charles II, hatte 1651 einen letzten verzweifelten Versuch unternommen, mit Hilfe der Schotten den Thron zurückzuerobern. Vor der Stadt Worcester war sein erschöpftes Heer auf die Truppen Cromwells getroffen und vernichtend geschlagen worden.
»Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, dass Ihr die Schlacht überlebt haben könntet«, bekannte Alan. »Als man mich gefangen nahm, fragte ich jeden meiner Leidensgenossen nach Euch, aber niemand wusste etwas. Wir wurden nach Chester gebracht und dort einige Wochen im Kerker festgehalten.
Schließlich gelang es mir, einen Geleitbrief nach London zu bekommen und hier bei Richard Wiseman zu arbeiten. Zwei Jahre später wurde ich in die Gilde der Barbiere und Wundärzte aufgenommen. Seitdem geht es mir so gut, wie ich es mir nur wünschen kann. Aber nun erzählt endlich, wie Ihr es geschafft habt, aus Worcester zu entkommen.«
Jeremy probierte einen Schluck von der heißen Schokolade, die sie als Morgentrunk zu sich nahmen.
»Ich hatte großes Glück. Ein Soldat, der gerade seine Muskete abgefeuert hatte, schlug mich mit dem Kolben nieder und ließ mich liegen. Ich erwachte mitten in der Nacht unter einem Berg von Leichen. Als ich mich davonschleichen wollte, traf ich auf einen sterbenden Offizier, der mich bat, seiner kleinen Tochter ein Medaillon zu bringen, das er bei sich trug. Ich tat ihm gerne den Gefallen, denn er war Katholik wie ich. Das Mädchen befand sich in der Obhut eines katholischen Gentleman. Zu dem Zeitpunkt, als ich in dessen Haus eintraf, hielt er dort den König versteckt, der nach der Schlacht aus Worcester geflohen war. Cromwells Soldaten suchten überall nach ihm, und man hätte Charles ebenso den Kopf abgeschlagen wie seinem Vater, wenn man ihn gefunden hätte. Es war sein Glück, dass er im Haus eines Katholiken Unterschlupf fand, das über geheime Priesterverstecke verfügte. Sie waren so geschickt angelegt, dass sie auch bei einer gründlichen Haussuchung nicht entdeckt werden konnten. So erfuhr der König am eigenen Leib, wie es unseren Geistlichen ergangen war, als man sie zur Zeit seines Großvaters James wie wilde Tiere jagte.«
»Ihr habt mit dem König gesprochen?«, fragte Alan erstaunt.
»Ja, und ich habe ihn als Mensch schätzen gelernt. Er hat während seiner Flucht Einblick in die Lebensweise der einfachen Leute erhalten. Er hat Hunger und Entbehrung erfahren und im Angesicht der Gefahr heldenhaften Mut bewiesen. Die besten Voraussetzungen, um ein guter König zu werden.«
»Wie ist es Euch gelungen, England zu verlassen? Die Armee hielt doch sicher alle Häfen besetzt.«
»Es war tatsächlich nicht einfach«, gab Jeremy zu. »Zumal ich mich bereit erklärt hatte, das Mädchen, das nach dem Tod ihres Vaters Waise geworden war, zur Familie ihrer Mutter nach Frankreich zu bringen. Ich versuchte es erst von Bristol aus, wo meine Schwester wohnte, konnte aber kein geeignetes Schiff finden. An der Südküste trafen wir durch Zufall den König wieder, der dasselbe Problem hatte. Dort hätten sie ihn um ein Haar erwischt. Aber Gott schützte ihn, und einige Zeit später gelang ihm die Flucht nach Frankreich.«
»Ihr habt mir noch immer nicht verraten, wie Ihr es geschafft habt«, drängte Alan ungeduldig.
Jeremy lächelte bescheiden.
»Als mir klar wurde, dass ich nicht die Mittel besaß, um einen Fischer oder den Kapitän eines Handelsschiffs zu bestechen, seinen Kopf für einen royalistischen Flüchtling zu riskieren, kam mir eine Idee, wie ich die Amtsvertreter überlisten konnte.
Im Ärmelkanal wimmelte es von holländischen Piraten, die die englische und französische Küste unsicher machten. Eines Abends entdeckten wir einen dieser Freibeuter in einer abgelegenen Bucht. Offenbar hatte ein Sturm ihn gezwungen, dort Schutz zu suchen. Ich ging davon aus, dass die Leute der Gegend das Schiff ebenfalls bemerkt hatten, und beschloss, diesen Umstand auszunutzen. Zum Glück sprach ich damals schon fließend Französisch. Wie Ihr wisst, hatte ich eine Weile in Paris studiert. Ich schärfte dem Mädchen also ein, sie solle so tun, als sei sie Französin, und da sie sehr aufgeweckt war, spielte sie ihre Rolle, ohne sich ein einziges Mal zu versprechen.
So begab ich mich mit ihr zum nächsten Dorf, wo uns der dortige Nachtwächter, der uns für Vagabunden hielt, verhaftete und dem Friedensrichter vorführte, wie es seine Pflicht war. Dieser besorgte einen Dolmetscher, als er bemerkte, dass er Franzosen vor sich hatte, und ich erklärte ihm, dass meine kleine Base und ich während einer Bootsfahrt vor der Küste Frankreichs von Piraten aufgebracht worden seien. Das Schiff der Freibeuter sei von einem Sturm nach England abgetrieben worden und habe uns an einem verlassenen Strand abgesetzt. Da man uns alles geraubt habe, hätten wir kein Geld, um nach Frankreich zurückzureisen, und natürlich auch keine Papiere.
Als man dem Friedensrichter die Sichtung eines Holländers vor der Küste bestätigte, nahm er mir meine Geschichte ab. Eigentlich wäre es nun seine Pflicht gewesen, uns nach London bringen zu lassen, wo eine höhere Autorität über unser Schicksal entschieden hätte. Ich rechnete jedoch damit, dass seine Sorge um die Gemeindekasse größer sein würde als sein Pflichtbewusstsein gegenüber dem Gesetz. und ich behielt Recht. Nachdem er die Kosten für unsere Eskortierung nach London im Geiste überschlagen hatte, entschied er, dass es für die Gemeinde billiger wäre, die unerwünschten Franzosen von einem Fischer der Gegend über den Kanal bringen zu lassen. Man sah dem Friedensrichter deutlich an, wie froh er war, uns los zu sein.«
Alan brach in schallendes Gelächter aus. »Cromwell hätte dem guten Mann den Kopf abgerissen. Ihr seid wahrlich ein Teufelskerl, Jeremy!«
»Es ist immer von Vorteil, die Schwächen der Menschen zu kennen.«
»Ihr seid also ins Exil gegangen?«, fragte Alan, während er sich die Lachtränen aus den Augen wischte. »Und was wurde aus dem Mädchen?«
»Ich lieferte sie bei ihrer Familie ab. Dann ging ich nach Italien, um Medizin zu studieren, denn in Frankreich herrschte damals ja auch Bürgerkrieg, und ich hatte vorerst genug von Schlachtfeldern und Gemetzeln. Später verbrachte ich einige Jahre in Indien und lernte sehr viel über die dort praktizierte Medizin, die in mancher Hinsicht der europäischen überlegen ist.«
Alan lauschte interessiert. Er hatte seinen Freund schon früher als überaus klug und wissensdurstig gekannt und sein außerordentliches Gedächtnis für Einzelheiten bewundert. Nun entdeckte er, dass Jeremy seine Talente offenbar ausgiebig genutzt hatte.
»Habt Ihr eigentlich das Mädchen je wiedergesehen?«
»Ja, durch Zufall. Als mit Cromwells Tod die Herrschaft der Puritaner endlich zu Ende gegangen war und unser König Charles wieder auf dem Thron saß, kehrte ich über Paris nach England zurück. Und in Paris begegnete ich ihr im Louvre. Ihre Familie ist zwar recht arm, aber von altem Adel, und so fiel es ihr nicht schwer, am französischen Hof Fuß zu fassen. Und als Charles seine in Frankreich lebende Mutter vor ihrem letzten Besuch bat, ihm einige hübsche Hofdamen mitzubringen, war auch Lady St. Clair darunter. Seitdem sehe ich sie regelmäßig, manchmal am Hof und manchmal hier, so wie eben.«
Alan riss entgeistert die Augen auf.
»Die Dame, mit der Ihr vorhin spracht, war Amoret St. Clair? Die Mätresse des Königs?«
»Ja, bedauerlicherweise«, bestätigte Jeremy mit einem Seufzer.
»Ah, Ihr seid eifersüchtig.«
»Nein, nur besorgt um ihr Seelenheil.«
»Ich bin sicher, ihr Beichtvater erlegt ihr eine Buße auf und erteilt ihr dann die Absolution, auch wenn er ihr Verhalten missbilligt.«
»Was bleibt mir anderes übrig!«
Alan verschluckte sich an seiner Schokolade, als er die Bedeutung der letzten Bemerkung begriff.
»Sie ist Euer Beichtkind? Ihr ... Ihr seid Priester?«, stieß er mit gesenkter Stimme hervor.
Jeremy lächelte amüsiert.
»Seid Ihr überrascht?«
»Wenn ich ernstlich darüber nachdenke... Eigentlich nicht«, stammelte Alan, der die Enthüllung noch nicht ganz verkraftet hatte. »Ihr wart schon immer ein vergeistigter Mensch, der kein Interesse an körperlichen Genüssen hatte. Aber warum genügte Euch das Studium der Medizin nicht? Ihr hättet einen begnadeten Arzt abgegeben.«
»Der nichtsdestoweniger den meisten Krankheiten hilflos gegenübergestanden hätte. Es schien mir wichtiger, mich der Seelen der Menschen anzunehmen, damit sie für das Leben nach dem Tod vorbereitet sind. So ging ich nach Rom und trat dort der Gesellschaft Jesu bei.«
»Ihr wart also als Missionar in Indien. Was Euch nicht hinderte, die dortige Medizin zu studieren.«
»Eine meiner Schwächen, zugegeben«, erklärte Jeremy ohne die geringste Spur von Zerknirschung.
Alans Gesichtsausdruck hatte sich mehr und mehr verdüstert, während ihm die Konsequenzen von Jeremys Handeln bewusst wurden. »Weshalb seid Ihr nach England zurückgekehrt?«, fragte er missbilligend. »Warum setzt Ihr Euch solcher Gefahr aus? Die Gesetze sind offiziell immer noch in Kraft. Ihr könnt von der Straße weg verhaftet und als Hochverräter hingerichtet werden, nur weil Ihr es als katholischer Priester und obendrein als Jesuit gewagt habt, englischen Boden zu betreten!«
»Ihr wisst sehr gut, dass dieses Gesetz seit der Thronbesteigung unseres Königs nicht mehr angewendet wurde«, erinnerte Jeremy ihn gleichmütig.
»Die Zeiten können sich auch wieder ändern. Und gerade hier in London, wo der puritanische Einfluss noch immer stark ist, hat die Bevölkerung eine Heidenangst vor der römischen Kirche.«
»Ich weiß. Deshalb lebe ich hier unter dem Namen Fauconer. Außer dem Wirt dieser Schenke und den Katholiken, die ich betreue, weiß niemand, dass ich katholischer Priester bin.«
»Stört es Euch nicht, ein Leben im Verborgenen führen zu müssen?«
»Nein. Ihr wisst, ich vergrabe mich gerne in meine Studien und mache mir nicht viel aus Gesellschaft. Aber nun haben wir genug über mich gesprochen. Erzählt mir von Eurer Sektion. Habt Ihr die Todesursache festgestellt?«
Alan berichtete in allen Einzelheiten von der Leichenschau und dem Schluss, zu dem die anwesenden Ärzte gekommen waren.
»Ihr habt also eine Probe des Mageninhalts genommen? Habt Ihr etwas dagegen, sie mir zu zeigen? Vielleicht kann ich feststellen, ob sie tatsächlich Gift enthält.«
Alan willigte erfreut ein. »Machen wir uns gleich auf den Weg.«
Sie betraten den Londoner Stadtkern durch das Ludgate, eines der sieben Torhäuser der alten Festungsmauer. In der Paternoster Row versperrten die Kutschen des Adels, der bei den hier ansässigen Seiden- und Spitzenhändlern einkaufte, ständig die Straße, so dass auch für Fußgänger ein Durchkommen zuweilen mühsam wurde. Alans chirurgische Offizin befand sich im unteren Bereich eines dreistöckigen Fachwerkhauses, dessen vorkragende obere Geschosse mit prachtvollem Schnitzwerk verziert waren. Man begegnete dieser Bauweise noch überall in der Altstadt. Dabei wurde zuerst ein Gerüst aus Holz angefertigt und dann die Zwischenräume mit einem Flechtwerk aus Weidenruten ausgefüllt, das mit Lehm beworfen und verputzt wurde. Der spitze Dreiecksgiebel überragte die Straße, so dass man das rote Ziegeldach nur sehen konnte, wenn man von der Seite hinaufblickte. In den bleigefassten Glasscheiben der Erkerfenster spiegelte sich die Sonne wie in den Facetten eines geschliffenen Diamanten. Über der Eingangstür war das Zunftzeichen der Wundärzte befestigt, eine rot-weiß gestreifte Stange, an deren Ende ein Aderlassbecken hing. Vor jedem Laden fand man diese Handwerkssymbole, meist in Form von bemalten Holzschildern, die an schmiedeeisernen Trägern über die Straße ragten, damit auch der Schriftunkundige verstand, was es dort zu kaufen gab.
Jeremy Blackshaw folgte seinem Freund in die Werkstätte im Erdgeschoss, wo ein Lehrling gerade damit beschäftigt war, den Fußboden zu schrubben. Es war ein großer, getäfelter Raum mit einem breiten Holztisch für Operationen, bei denen der Patient liegen musste, sowie mehreren Stühlen mit Armlehnen, einer Fußbank und einem Schrank mit unzähligen Arzneischubladen. Die Wände waren behängt mit blank geputzten Aderlassbecken, ledernen Instrumentenfutteralen und anderen Utensilien. Auf einem hölzernen Gestell reihten sich irdene Salbentöpfe aneinander.
Jeremy, der die einzelnen Gerätschaften mit einem Blick in die Runde in sich aufnahm, war beeindruckt. Es herrschte Ordnung und Reinlichkeit. Zudem sah er zu seiner Befriedigung, dass Alan auf die von manchen seiner Zunftgenossen aus Effekthascherei aufgestellten menschlichen Skelette oder ausgestopften Tiere verzichtete.
»Hier ist die Probe des Mageninhalts«, erklärte Alan, während er einen kleinen Behälter von einem Regal nahm. Der Inhalt war zu einem grauen Pulver eingetrocknet, das der Jesuit mit einem Holzstab vorsichtig vom Boden des Glases abkratzte. Dann bat er um eine Schale aus Zinn, legte mit einer Zange ein glühendes Stück Kohle aus dem Kamin hinein und stellte sie auf den Tisch.
»Gebt Acht, dass Ihr nicht zu nah davorsteht«, warnte Jeremy, bevor er einen Teil des Pulvers auf einen Löffel schüttete und es auf die Kohlenglut rieseln ließ. Es entwickelte sich ein feiner weißer Rauch.
»Riecht Ihr das?«, fragte Jeremy.
»Ein Hauch von Knoblauch«, bestätigte Alan.
»Ihr sagtet doch, der Baron habe unter heftigen Krämpfen und Lähmungserscheinungen gelitten. Außerdem seien nach dem Tod seine Finger und Zehen eigentümlich gekrümmt gewesen. All das deutet auf eine Arsenikvergiftung hin. Die Geruchsprobe ist zwar nicht absolut narrensicher, aber ich denke doch, dass sie dem Richter einen wertvollen Hinweis bei der Untersuchung des Falles liefert.«
»Ich werde es ihm so schnell wie möglich mitteilen«, meinte Alan zustimmend.
Viertes Kapitel
Richter Trelawney verließ nachdenklich die Apotheke und blieb einen Moment unschlüssig auf der Paternoster Row stehen. Der Laufbursche sprang vom Trittbrett seiner Kutsche, um ihm den Schlag zu öffnen, doch Trelawney bedeutete ihm mit einem Wink, dass er noch nicht einsteigen wollte.
Da das Haus von Meister Ridgeway nur wenige Schritte entfernt war, hatte der Richter sich entschieden, dem Wundarzt noch einen Besuch abzustatten. Vor der Tür musste er stehen bleiben und an der Wand nach einem Halt tasten, da sich plötzlich alles um ihn zu drehen begann. Schon den ganzen Tag überkamen ihn immer wieder Anfälle von Schwindel. Dazu folterte ein hämmernder Schmerz seinen Kopf, der ihn fast blind machte. Er sehnte sich nach Ruhe, fand aber seit zwei Nächten kaum noch Schlaf und fühlte sich mittlerweile zu Tode erschöpft. Mühsam überwand er sich schließlich, die Chirurgenstube zu betreten. Alan Ridgeway begrüßte den Richter herzlich, sah ihm allerdings sofort seine Müdigkeit an und schob ihm einen Stuhl zu.
»Ich komme gerade von Meister Bloundel, dem Apotheker«, berichtete Trelawney, während er sich auf den Stuhl fallen ließ. »Er hat für Dr. Whalley die Medizin hergestellt, die dieser Baron Peckham verabreichte. Er schwört, dass sie kein Arsenik enthielt, und zeigte mir sogar das Rezept, das der Arzt ihm schickte. Wie es scheint, ist Dr. Whalley unschuldig. Ich muss Euch danken, dass Ihr mir Euren Verdacht mitteiltet, der Baron könne mit Arsenik vergiftet worden sein. Ich habe die Geruchsprobe von einem unabhängigen Apotheker vor Zeugen durchführen lassen. Arsenik entwickelt tatsächlich einen charakteristischen Knoblauchgeruch, wenn es verbrannt wird. Aber woher wusstet Ihr das?«
»Von einem Freund, einem Gelehrten, der lange Zeit auf Reisen war.«
»Ihr müsst ihn mir bei Gelegenheit vorstellen. Der Tod des Barons erscheint jetzt in einem ganz anderen Licht. Wenn es kein Versehen des Arztes war, dann war es Mord. Jemand hat Peckham absichtlich vergiftet!«
»Habt Ihr eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte?«
»Nein«, antwortete der Richter mit einem Kopfschütteln. »Ich habe die ganze letzte Woche damit zugebracht, jedes einzelne Mitglied seines Haushalts zu verhören, die Familie ebenso wie die Dienerschaft. Es fand sich niemand, der ein Motiv hatte, Peckham umzubringen. Außer seiner Frau und seinen Kindern, die ihn natürlich beerben. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einer von ihnen war.«
»Ihr solltet Euch etwas Ruhe gönnen, Mylord«, sagte Alan eindringlich. »Ihr werdet das Rätsel nicht lösen, wenn Ihr vor Müdigkeit nicht mehr klar denken könnt.«
»Ihr habt Recht. Ich fühle mich sehr matt. Aber diese quälenden Kopfschmerzen lassen mich nicht schlafen. Vielleicht wird es besser, wenn Ihr mich zur Ader lasst.«
»Wir befinden uns gerade in einem günstigen Sternzeichen für den Aderlass«, stimmte Alan zu. »Ich habe heute schon mehrere Kunden bedient. Noch letzte Woche wäre es zu gefährlich gewesen.«
Obgleich Alan der Astrologie eher skeptisch gegenüberstand, richtete er sich wie jeder Wundarzt nach den günstigen Lasszeiten, die in speziellen Kalendern aufgeführt waren.
Wurde ein Mensch in einem bösen Sternzeichen zur Ader gelassen, konnte er gesundheitliche Schäden davontragen. Dieses Risiko wollte Alan nicht eingehen.
Er half dem Richter aus Umhang und Wams und bemerkte dabei, dass Trelawneys Leinenhemd am Rücken und unter den Achseln feucht von Schweiß war, obwohl schon seit Tagen kühles Wetter herrschte. Nachdem Sir Orlando den rechten Ärmel des Hemdes bis über den Ellbogen hochgekrempelt hatte, drückte Alan ihm einen Stock in die Hand, auf den er sich stützen konnte, wenn sein Arm müde wurde. Der eifrige Lehrling war bereits mit einer polierten Messingschüssel zur Stelle.
Nach einem kurzen Blick in das Gesicht des Richters, der vor Schmerz die Augen geschlossen hielt, schnürte Alan seinen entblößten Oberarm mit einer bereitliegenden Wollbinde ab. Dann schlug er mit dem Lasseisen die hervortretende Vene, bis dunkles Blut aus der Wunde quoll und mit einem metallischen Ton auf den Boden der Messingschale tropfte.
Trelawney ließ die Prozedur schweigend über sich ergehen, seinen erschlaffenden Arm auf den Stock gestützt. Als Alan ihm etwa zwölf Unzen Blut entnommen hatte, tupfte er den Einstich mit einem Leintuch ab und verband die Wunde. Der Lehrjunge stellte die Aderlassschale auf eine Bank und beeilte sich, für den geschwächten Patienten stärkenden Wein zu holen, der stets für diesen Zweck in einem Krug bereitstand.
»Ihr braucht jetzt unbedingt Ruhe, Sir«, sagte Alan bestimmt. »Soll ich Euch eine Mietkutsche rufen?«
»Nein, danke, ich bin mit meiner eigenen Kutsche hier«, erklärte Trelawney mit erschöpfter Stimme.
Unendlich langsam erhob er sich vom Stuhl und ließ sich von Alan in sein Wams helfen. Auf seiner Stirn und an den Schläfen sammelten sich schimmernde Schweißperlen. Der Wundarzt sah ihm sorgenvoll nach, während Trelawney sich träge zur Tür hinausschleppte. Er hatte ein ungutes Gefühl.
Am nächsten Tag erschien der Kammerdiener des Richters völlig aufgelöst in Alans Offizin. »Meister Ridgeway, Ihr müsst sofort kommen! Mein Herr ist schwer erkrankt. Alle glauben, er wurde vergiftet!«
Sir Orlando Trelawney ging mit Dante durch die Hölle, entlang dampfender Seen flüssigen Feuers und durch ewiges Eis, über das ein grausamer Wind hinwegfegte. Wie tausend Nadeln bohrte sich die Kälte in seine Haut und ließ ihn frösteln, nur um im nächsten Moment der Glut einer trockenen Wüste zu weichen. Jede Faser seines Leibes brannte, die Augen, die Zunge, die Kehle, die Eingeweide ... Er sehnte sich nach Kühlung, doch um ihn war nur unerträgliche Hitze.
Der junge Ire beugte sich über ihn und lachte ihn aus. In seiner Hand schwenkte er eine rauchende Fackel, deren Flammen über Trelawneys nackten Körper leckten und sein Fleisch versengten. In wilder Panik begann er zu toben, zu schreien, um sich zu schlagen ...
Von allen Seiten griffen Hände nach ihm und drückten ihn nieder. Er kämpfte weiter gegen die Übermacht seiner Feinde an, bis einer von ihnen mit einem Messer auf ihn einstach. Mit dem austretenden Blut verließ ihn allmählich die Kraft, seine Glieder wurden schwer, zu schwer, um sie zu bewegen ...
»Er wird ruhiger«, sagte eine vertraute Stimme. Sie gehörte Alan Ridgeway.
»Ja, der Aderlass zieht das Gift aus seinem Kopf«, erklärte Dr. Hughes, der Arzt. »Sein Körper ist voll von schlechtem Blut.«
Sir Orlando hörte die Worte, die gesprochen wurden, ohne ihren Sinn zu verstehen. Eine Hand hob seinen Kopf an, der Rand eines Gefäßes berührte seine Lippen. Willenlos schluckte er, was man ihm einflößte, obwohl ihm der Geschmack zuwider war. In seinem Innern gärte das Gift, stieg in seine Kehle und ließ ihn würgen. Im nächsten Moment erbrach er sich, doch es war nur schaumiger Gallensaft, der über seine Lippen quoll, denn er hatte längst nichts mehr in sich, was er noch von sich geben konnte.
»Er hat nicht genug von dem Antimonbrechmittel geschluckt«, sagte der Arzt. »Ich gebe ihm noch eine Dosis Zinksulfat.«
Trelawney vernahm den Protest des Wundarztes, der davor warnte, den Patienten zu sehr zu schwächen. Doch der Arzt verabreichte ungerührt das Medikament und bereitete ein neues Klistier vor.
Die Flammen in Sir Orlandos Innern loderten wieder auf. Sein Geist verwirrte sich, versuchte, sich von seinem leidenden Körper zu lösen und davonzueilen, an den Ort, an dem es keine Schmerzen gab. Dort erwartete ihn Elizabeth, seine stille, sanfte Beth ... Bald ... bald würde er wieder mit ihr vereint sein ...
Fünftes Kapitel
Alan hatte sich nur widerwillig vom Krankenlager des Richters losreißen können. Aber er sah ein, dass die Kräfte des Patienten von Stunde zu Stunde dahinschwanden und dass er keine Zeit verlieren durfte. Atemlos erreichte er die »Pfauenschenke« und fragte den Wirt nach Mr. Fauconer. Dieser wies ihm den Weg zu einem Zimmer im Obergeschoss, wo Jeremy beim Eintreten seines Freundes überrascht von einem Buch aufsah.
»Ich bitte Euch, kommt mit mir zu Sir Orlando Trelawney«, rief Alan ohne Begrüßung. »Er ist schwer krank. Dr. Hughes ist ratlos, er probiert jede Rosskur aus, die ihm einfällt, nur um den Anschein zu erwecken, dass er etwas tut. Aber ich bin überzeugt, er wird den Richter damit umbringen. Vielleicht könnt Ihr ihm helfen. Er ist ein gerechter, gottesfürchtiger Mann. Sein Tod wäre ein großer Verlust für die Richterbank.«
»Gut, ich komme«, erwiderte der Jesuit, während er, ohne zu zögern, einige Utensilien einpackte. »Beschreibt mir die Krankheit des Richters unterwegs.«
»Er hat schon an Sankt Laurentius über Kopfschmerzen und Mattigkeit geklagt. Dann überfiel ihn ein Schüttelfrost und starkes Fieber. Manchmal tobt er wie ein Mensch, der dem Wahnsinn verfallen ist.«
»Wie ist seine Gesichtsfarbe?«
»Hochrot! Die Augen glänzen, die Zunge ist belegt.«
»Hat er sich erbrochen?«
»Ja, ein- oder zweimal. Die Dienerschaft ist der Meinung, er wurde vergiftet, so wie Baron Peckham. Aber vor zwei Tagen trat ein seltsamer Ausschlag auf seiner Haut auf, und seitdem ist Dr. Hughes überzeugt, dass es ein ansteckendes Fieber ist.«
»Wie hat er den Kranken behandelt?«
»Zuerst ordnete er einen Aderlass an, den er am dritten Tag an der Halsvene wiederholen ließ. Dazu gab er Brech- und Abführmittel.«
»Ein sicherer Weg, um den Patienten ins Grab zu bringen«, meinte Jeremy zynisch.
Auf dem Weg zur Chancery Lane drängten sie sich rücksichtslos durch die Menge der Händler, Tagelöhner und Müllkutscher. Vor dem roten Backsteinhaus des Richters trafen sie auf Dr. Hughes, der sich gerade auf den Heimweg machte.
»Ah, Meister Ridgeway, gut, dass Ihr kommt«, sagte er, die Müdigkeit in seiner Stimme übertreibend. »Ich war jetzt eine Nacht und einen Tag auf den Beinen und brauche dringend etwas Schlaf. Eine Pflegerin ist bei Seiner Lordschaft. Ihr könnt sie ablösen. Lasst ihn noch einmal zur Ader, wenn sein Zustand sich nicht bessert. Ich komme morgen früh wieder.«
Man sah dem Arzt an, dass er es eilig hatte, wegzukommen.
»Er hat den Richter aufgegeben«, flüsterte Alan seinem Freund zu.
Ein Lakai öffnete ihnen die Haustür und ließ sie schweigend ein. Da der Wundarzt den Weg kannte, entließ er den Burschen mit einer Handbewegung und führte Jeremy eine kunstvoll geschnitzte Eichentreppe in den zweiten Stock hinauf. Beim Betreten des abgedunkelten Schlafgemachs schlug ihnen ein schwerer, übler Geruch entgegen. Die Luft war zum Schneiden dick, denn die Fenster waren fest verschlossen, und im Kamin brannte ein starkes Feuer, wie Dr. Hughes es angeordnet hatte. Frische Luft galt für Kranke als schädlich. Die Hitze sollte den Patienten zum Schwitzen bringen, damit sein Körper von den verdorbenen Säften gereinigt wurde, die die Krankheit hervorriefen.
An der Seite des Bettes, dessen Vorhänge zugezogen waren, damit auch ja kein kühles Lüftchen eindringen konnte, saßen zwei Frauen: die verschlafene Pflegerin und eine Jungfer mit einem verkniffenen Mund, die sich die Zeit ungerührt mit einer Stickarbeit vertrieb. Sie trug ein schmuckloses, graues Kleid mit einem einfachen Leinenkragen und weißen Manschetten.
»Das ist Mistress Esther Langham, die Nichte des Richters«, raunte Alan seinem Begleiter zu. »Eine seltsame Person! Es scheint sie überhaupt nicht zu kümmern, dass ihr Onkel im Sterben liegt.«
Er begrüßte die junge Frau, deren hellblaue Augen ihn ausdruckslos anblickten. »Ich möchte Euch Dr. Fauconer vorstellen. Er hat auf dem Kontinent Medizin studiert und würde sich gerne Euren Onkel ansehen.«
»Noch ein Arzt?«, bemerkte Esther Langham, deren schmales Gesicht unter der strengen Leinenhaube unbewegt blieb. »Untersucht ihn, wenn Ihr es wünscht. Ich werde Euch nicht abhalten.«
Auf Jeremys Wink hin wandte Alan sich an die Pflegerin. »Ihr könnt Euch zurückziehen. Wir werden die Nacht über bei ihm wachen.« Die alte Frau erhob sich dankbar und watschelte aus dem Raum.
Mit einer flinken Bewegung warf Jeremy seinen Umhang über den Stuhl, zog die Bettvorhänge auf und blickte auf den Kranken hinab. Alan hörte, wie er geräuschvoll den Atem durch die Nase stieß, denn trotz seiner Erfahrungen war er schockiert, wie schlimm der Mann zugerichtet worden war. Sein Kopf war kahlgeschoren und mit nässenden Wunden bedeckt. Der Arzt hatte durch Auflegen einer ätzenden Substanz auf die Haut künstlich Geschwüre hervorgerufen, die durch Fremdkörper, in diesem Fall getrocknete Erbsen, so lange offengehalten wurden, bis sie eiterten. Diese Prozedur sollte heilende Körperkräfte wecken und so das Übel austreiben. Als der Priester die schweren Decken, unter denen der Patient fast erstickte, zur Seite schlug, wurden unter den Fußsohlen des Richters schwarze Brandwunden sichtbar, die von einem Glüheisen stammten und demselben Zweck dienten.
»Die Inquisition foltert ihre Opfer nicht grausamer als die gelehrten Herren Ärzte!«, stieß Jeremy zwischen den Zähnen hervor. Er hatte sich auf den Rand des Bettes gesetzt und begann den Kranken zu untersuchen. Trelawney lag völlig apathisch da, mit leerem Gesichtsausdruck, halb geschlossenen, starren Augen und geöffnetem Mund. Seine Haut war heiß und trocken.
Jeremy öffnete mit den Fingern vorsichtig die vom Fieber rissigen Lippen und zog die Zunge heraus, die eine braune Färbung angenommen hatte und mit einem borkigen Belag bedeckt war. Der Rachen war entzündet. Das Nachthemd, in das der Kranke gekleidet war, klebte schmutzig gelb an seinem Körper. Sicher war es in all der Zeit nicht gewechselt worden. Der Jesuit riss es kurzerhand in Stücke, um den Hautausschlag zu begutachten. Unregelmäßige, rosenrote Flecken breiteten sich über Hals, Brust, Bauch und die Arme entlang bis zu den Fingerspitzen und sogar über beide Beine bis zu den Füßen aus. Nur das Gesicht blieb verschont. Sanft ließ Jeremy seine Hand über die Milz gleiten, die deutlich vergrößert war. Trotz der leichten Berührung begann Trelawney vor Schmerz zu wimmern. Sein Puls ging sehr schnell.
»Der Arzt hat Recht, es ist ein ansteckendes Fieber«, verkündete Jeremy. »Kerkerfieber! Ich habe diese Flecken schon oft bei Gefangenen im Newgate gesehen.«
Alan sah betroffen in das verfallene stumpfe Gesicht des Richters, das merklich abgemagert war.
»Er sieht noch schlechter aus als heute Morgen. Ich glaube, er stirbt.«
»Noch ist er nicht tot, mein Freund. Aber wenn wir das Fieber nicht senken, wird er verbrennen.«
Ohne zu zögern sprang der Priester vom Bett und riss die Fenster weit auf, um die kühle Abendluft hereinzulassen. »Löscht das Feuer im Kamin, Alan.«
Die Nichte des Richters sah dem ganz in schwarz gekleideten, hageren Mann verständnislos zu, wie er auch alle Bettvorhänge aufzog und, da sein Freund die Flammen im Kamin nicht schnell genug mit Asche bedeckte, kurzerhand eine Schüssel mit Wasser darüber ausleerte.
»Mistress Langham, ich muss während der Nacht über einen Teil Eurer Dienerschaft verfügen. Ich brauche einen Waschzuber, um Euren Onkel zu baden. Die Bettwäsche muss gewechselt, die Vorhänge entfernt und in einem geschlossenen Raum ausgeräuchert werden. Die Binsenmatten solltet Ihr verbrennen lassen, ebenso das Nachthemd und die anderen Kleider, die der Richter seit Ausbruch der Krankheit getragen hat.«
Die junge Frau starrte ihn mit gerunzelter Stirn an. »Ihr wollt ihn baden?«
Wer hatte schon jemals davon gehört, dass man einen Kranken baden sollte? Das Wasser würde durch die Haut ins Körperinnere eindringen und verdorbene Stoffe hineintragen, die die Organe schädigten.
»Madam, der Patient braucht vor allem Kühlung.«
»Dr. Hughes sagte, das Fieber beschleunige die Kochung der Säfte und habe deshalb eine heilsame Wirkung«, wandte Esther wichtigtuerisch ein.
»Unter gewissen Umständen ist das auch so, Madam, aber wenn das Fieber zu hoch ist, kann es mehr Schaden anrichten als nutzen. Ich habe schon oft Menschen daran sterben sehen. Und mit dieser Erfahrung stehe ich keineswegs allein. Ich hörte von einem Arzt in Westminster namens Thomas Sydenham, der die ansteckenden Fieber studiert und die kühlende Therapie ebenfalls befürwortet.« Da er sah, dass sie noch immer zweifelnd die Stirn in Falten legte, fügte er hinzu: »Madam, ich sehe, Ihr habt einen wachen Verstand. Wenn Ihr die Absicht hättet, ein brennendes Haus vor der Zerstörung zu retten, würdet Ihr dann hingehen und Fackeln hineinwerfen?«
»Natürlich nicht«, antwortete die junge Frau schmunzelnd.
»Seht Ihr? Warum also sollte es sinnvoll sein, einen Kranken, der vom Fieber verzehrt wird, noch zusätzlicher Hitze auszusetzen?«
Mistress Langham betrachtete nachdenklich den Mann vor ihr, dessen graue Augen sie erwartungsvoll ansahen. Es war das erste Mal, dass ein Mann ihr als Frau Verstand zusprach. Die Bitterkeit in ihrem Herzen erschien ihr mit einem Mal erträglicher, und ihre unterdrückte Wut auf den Richter ließ ein wenig nach.
»Tut mit meinem Onkel, was Ihr für richtig haltet. Ich werde Euch bringen lassen, was immer Ihr benötigt.«
»Danke, Madam.« Jeremy kehrte an die Seite des Bettes zurück. »Wie alt ist der Richter, Alan, wisst Ihr das?«, fragte er besorgt.
»So um die zweiundvierzig, glaube ich. Weshalb fragt Ihr?« »Dieses Fieber ist umso gefährlicher, je älter der Kranke ist.« Jeremy legte die Hand auf Trelawneys Brust, um seinen Herzschlag zu fühlen. Dann drückte er sein Fleisch prüfend zwischen den Fingern. Es war ausgetrocknet wie Pergament. »Holt mir Wein«, bat er eindringlich.
Während sich drei Lakaien mit dem Waschzuber abschleppten, der neben dem Bett aufgestellt und mit sauberen Laken ausgelegt wurde, versuchte Jeremy, dem Kranken etwas Wein einzuflößen. Dies erwies sich als mühsam, denn er wollte nicht schlucken. Gaumen und Rachen waren durch die Entzündung schmerzempfindlich geworden. Mit unendlicher Geduld probierte es der Jesuit wieder und wieder, bis Trelawney wenigstens einen Teil des Rotweins getrunken hatte.
Die Vorbereitungen für das Bad gingen ihm dagegen zu langsam voran. Die Stirn des Richters glühte, und die Apathie war einer Phase des Fieberdeliriums gewichen, in der er albtraumhafte Ängste durchlebte, sich unruhig hin und her warf und ab und zu gequälte Schreie ausstieß. Schließlich nahm Jeremy einer mit frischer Wäsche beladenen Magd eines der Laken ab, tauchte es in den erst eine Handbreit gefüllten Waschzuber und legte das nasse Tuch mit Alans Hilfe neben dem Körper des Richters auf das Bett. Gemeinsam hoben sie den Besinnungslosen darauf und wickelten ihn rundum in das tropfende Laken ein, wobei nur das Gesicht und die Füße frei blieben. Durch das Leintuch in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, hörte Trelawney auf zu toben.
Als der Zuber gefüllt war, prüfte Jeremy mit der Hand die Temperatur des Wassers. Es durfte weder zu kühl noch zu warm sein. »Gut, legen wir ihn hinein«, sagte er dann.
Zusammen mit Alan und dem Kammerdiener Malory trug er den nackten Körper zum Bad und tauchte ihn behutsam ins Wasser. Jeremy hielt dem Richter den Kopf, während Alan ihn gründlich wusch. Zwei Dienstmädchen wechselten derweil die Bettwäsche und entfernten Kissen und Vorhänge. Die Lakaien brachten die Binsenmatten hinaus, die den Holzfußboden bedeckten.
Nach einer Weile gab der Priester seinen Helfern einen Wink. Sie hoben den Kranken aus dem Wasser, trockneten ihn mit einem sauberen Leintuch ab und legten ihn in das frisch bezogene Bett. Besorgt fühlte Jeremy Trelawneys Herzschlag und fand ihn zu seiner Beruhigung immer noch kräftig. Gleichwohl gab er ihm zur Stärkung noch etwas Wein zu trinken.
»Habt Ihr Sauermilch im Haus?«, wandte er sich kurz darauf an den Kammerdiener, der nicht mehr vom Lager seines Herrn wich.
»Ich glaube, ja. Ich werde sofort nachsehen«, antwortete Malory eifrig.
Alan beugte sich fasziniert über den Kranken, der ganz ruhig lag. Er atmete jetzt tiefer und entspannter als vorher. »Es geht ihm besser«, stieß er voller Freude hervor.
»Zügelt Euren Enthusiasmus, Alan, das war erst der Anfang. Uns steht eine anstrengende Nacht bevor«, belehrte ihn Jeremy lächelnd.
Den Lakaien, die den Zuber gefüllt hatten, gab er Anweisung, das verschmutzte Wasser auszuleeren und frisches zu holen. Mit unterdrücktem Murren gehorchten sie, was ihnen einen scharfen Tadel der Nichte einbrachte, die ein strenges Regiment in ihrem Haushalt führte.
»Dieses Mädchen ist ein rechter Giftzahn«, flüsterte Alan seinem Freund zu, als Esther das Zimmer verlassen hatte. »Kein Wunder, dass der Richter sie nicht unter die Haube bringen kann.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: