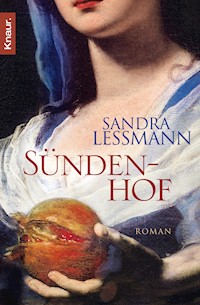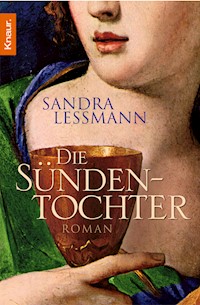6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jeremy Blackshaw
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Krimi von Sandra Lessmann aus dem Irland der Glaubenskriege mit dem sympathischen Ermittler Jeremy Blackshaw von Sandra Lessmann, der Spezialistin für englische Geschichte. 1670 ist Irland tief gespalten: Protestantische Adlige herrschen über die katholische Landbevölkerung, deren Alltag vom Glauben an Feen und Kobolde bestimmt wird. Und längst sind die Wunden nicht verheilt, die Oliver Cromwell geschlagen hat. So wundert es den Jesuitenpater Jeremy Blackshaw nur wenig, dass ihm und seinen Freunden Amoret St. Clair und Breandán, der gerade geadelt wurde, bei ihrer Ankunft auf dessen Besitz offenes Misstrauen entgegenschlägt. Als ein Nachbar nach einem Streit mit Breandán tot aufgefunden wird, wird Jeremys kriminalistischer Spürsinn dringender gebraucht denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sandra Lessmann
Das Lied der Seherin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein historischer Krimi aus dem Irland der Glaubenskriege mit dem sympathischen Ermittler Jeremy Blackshaw
1670 ist Irland tief gespalten: Protestantische Adlige herrschen über die katholische Landbevölkerung, deren Alltag vom Glauben an Feen und Kobolde bestimmt wird. Und längst sind die Wunden nicht verheilt, die Oliver Cromwell geschlagen hat.
So wundert es den Jesuitenpater Jeremy Blackshaw nur wenig, dass ihm und seinen Freunden Amoret St. Clair und Breandán, der gerade geadelt wurde, bei ihrer Ankunft auf dessen Besitz offenes Misstrauen entgegenschlägt.
Als ein Nachbar nach einem Streit mit Breandán tot aufgefunden wird, wird Jeremys kriminalistischer Spürsinn dringender gebraucht denn je.
Inhaltsübersicht
Irische/Englische Namen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Nachwort der Autorin
Glossar
Dank
Literaturauswahl
Die irischen (gälischen) Namen und ihre englische Entsprechung
Gälische Schreibweise
Englische Schreibweise
Ó Riordáin
O’Riordan
Muiredach Ó Donnabháin
Murdoch O’Donovan
Ó Dálaigh
O’Daly
Ó Néill
O’Neill
Lonán Ó Ceallaigh
Lonan O’Kelly
Áengus Ó Seanacháin
Angus O’Shanahan
Laoghaire Ó Seanacháin
Leary O’Shanahan
Clíodhna Uí Mhanacháin
Cleena O’Monaghan
Séamus Ó Leannáin
James O’Lennon
Ruairí Ó Leannáin
Rory O’Lennon
Seán Ó Duibhir
John O’Dwyer
Tadg Ó Duibhir
Taig O’Dwyer
Ó Meadhra
O’Mara
Ó Cathail
O’Cahill
Ó Spealáin
O’Spillane
Uí Cheallacháin
O’Callaghan
Clan Chaomhánach
Kavanagh
Mac Coisdealbhaigh
Costello
Prolog
Der Klageschrei hallte durch das grüne Tal. Er war so durchdringend, dass das Herz des Barden erzitterte.
»Die bean sí … der Ruf des Feenweibs.«
Er wusste, dass sie seinen Tod ankündigte. In Gestalt einer Nebelkrähe segelte sie anmutig über die Burgruine am Wegesrand und entschwand über der dicht bewaldeten Hügelflanke.
Cormac Bán Ó Riordáins Atem ging stoßweise. Die Erkenntnis, dass sein Hochmut ihn das Leben kosten würde, lähmte seine Glieder, fesselte seine Beine an den steinigen Pfad, den er kurz zuvor, noch trunken vom Erfolg seines Wagnisses, entlanggewandert war.
In seinem Rücken vernahm er den Hufschlag eines Pferdes, das einzige Geräusch in dem nun schweigenden irischen Tal, über das sich der Schatten grauer Regenwolken breitete.
Mit dem Gefühl grimmiger Befriedigung war Ó Riordáin am Morgen vom Landsitz der englischen Siedler aufgebrochen. Trotz der Gastfreundschaft, die man ihm erwiesen hatte, nagte die Demütigung seines Abstiegs an ihm. Als file, Poet, Historiker, Chronist der alten Adelsfamilien, als Vertreter der aristokratischen Kaste gälischer Gelehrter, der einst hundert Silbermark als Lohn für ein Gedicht erhalten hatte, war er nun nach dem Zerfall der alten irischen Gesellschaftsordnung dazu verdammt, sein Brot als Barde zu verdienen, als geócach, als niederer Possenreißer, der beim Gelage seiner Gastgeber die Harfe spielte und Volkslieder sang.
Der Schrei der Banshee hatte Cormac Bán Ó Riordáin aus seinen schwermütigen Gedanken gerissen. Als der schnelle Hufschlag in sein Bewusstsein drang, wirbelte er herum, überzeugt, den dämonischen dúlachan hinter sich zu sehen, vor dem ihn seine Mutter als Kind stets gewarnt hatte. Doch es war nicht der Kopflose auf seinem Rappen, der auf ihn zugaloppierte, sondern ein Mann. Für einen Augenblick atmete der Barde erleichtert auf, bevor er den Reiter erkannte. Unschlüssig blickte er ihm entgegen. Als ihm das Wehklagen der Todesfee wieder in den Sinn kam, legte sich eine eisige Faust um Ó Riordáins Herz. Ohne einen weiteren Moment zu zögern, sprang er mit einem Satz, der seine alten Knochen erschütterte, zwischen den Ginster am Wegesrand. Doch wohin sollte er sich wenden, wo Schutz suchen? Sein Blick glitt zu der Ruine des viereckigen Turmhauses. Eine Seite des massiven Gemäuers war vor zwanzig Jahren unter der Gewalt der Cromwellschen Kanonen eingestürzt. Dennoch war es die einzige erreichbare Zuflucht. Zwischen ihm und dem Dorf, durch das er gekommen war, stand sein Verfolger.
Ó Riordáin richtete sich ein wenig auf, um den Weg zu überblicken, der zur Burg führte. Im nächsten Moment erkannte er seinen Fehler. Das scharfe Knallen eines Pistolenschusses zerriss die Stille. Geistesgegenwärtig warf sich der Barde zu Boden. Zu spät! Die Kugel, die ihn in den Rücken treffen sollte, grub sich in seine linke Schulter. Er schrie auf, als der Schmerz wie eine Feuerwalze durch seinen Körper raste und ihn nach Luft ringen ließ. Augenblicklich verlor er jegliches Gefühl in seinem Arm. Der Aufprall des Bleis musste das Schulterblatt zerschmettert haben. In Panik raffte er sich auf, ließ die Harfe, die er auf dem Rücken getragen hatte, zu Boden fallen und rannte in geduckter Haltung auf die düstere Festung zu. Da öffnete der Himmel seine Schleusen, und die schwarzen Wolken ergossen ihre nasse Last über das Tal.
Getrieben von Todesangst, stolperte Ó Riordáin durch Gestrüpp und kniehohes Gras. Jeden Moment erwartete er, einen zweiten Schuss zu hören, glaubte er, einen brutalen Stoß gegen den Körper zu verspüren, der sein Leben auslöschen würde. Doch nichts geschah. Ó Riordáin schöpfte neue Hoffnung. Hatte sein Verfolger aufgegeben?
Mit letzter Kraft erreichte der Barde das Eingangsportal des Turmhauses. Hastig warf er einen Blick zurück auf den Reiter, konnte ihn aber hinter dem dichten Vorhang niederströmenden Regens nicht ausmachen. Der Schmerz pochte in seiner Schulter, und er hatte viel Blut verloren. Erschöpfung überkam ihn. Doch Ó Riordáin war entschlossen, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen.
Die schwere Holztür war geschlossen und hing schief in den Angeln. Mit der rechten Hand zog er an dem Eisenring über dem Schloss und musste zu seinem Entsetzen feststellen, dass sie sich kaum bewegen ließ. Sie war jedoch der einzige Weg hinein. Der Barde wusste, dass sich an der eingestürzten Seite der Burg der Schutt bis in die oberen Stockwerke türmte und kein Durchkommen bot. Entschlossen biss er die Zähne zusammen, stemmte die Füße in den Boden und zerrte mit seinem ganzen Gewicht an der mächtigen Tür. Mit einem lauten Knarren gab sie schließlich ein wenig nach. Doch der Spalt war noch zu schmal, als dass Ó Riordáin hindurchschlüpfen konnte. Mit der Kraft der Verzweiflung zog er erneut an dem Ring. Die untere Kante des Portals schabte ein kleines Stück über den Boden. Nun musste es reichen! Rasch zwängte sich der Barde durch die Lücke. Als seine verletzte Schulter gegen den Rand der Tür rieb, stieß er einen Schrei aus, in dem sich Schmerz und Wut verbanden.
Im Innern des Turms hielt Ó Riordáin kurz inne, um zu lauschen. Zwischen dem Rauschen des Regengusses meinte er, Hufschlag zu vernehmen. Hastig zog er sich vom Eingang zurück, stolperte in den unteren Saal, in dem einst Diener und Soldaten gespeist und geschlafen hatten. Fahles Licht fiel durch die schmalen Schießscharten herein, vermochte das Halbdunkel unter dem gemauerten Gewölbe jedoch kaum zu durchdringen. Aufmerksam blickte sich der Barde um. Zwei lange Tafeln, bestehend aus aufgebockten, massiven Eichenholzplatten, und mehrere Sitzbänke lauerten bedrohlich im Zwielicht des Saales. Die Südseite, wo damals Offiziere und höhergestellte Diener Platz genommen hatten, war nur noch eine Trümmerwand. Zwischen zerbrochenen Steingutbechern und Flaschen erhob sich ein Holzgerüst, das die Decke stützte.
Vorsichtig bewegte sich Ó Riordáin durch das Chaos, stieß jedoch immer wieder mit dem Fuß an Scherben und anderen Schutt. In seinem Rücken hörte er ein Pferd schnauben. Sein Verfolger war ihm weiterhin auf den Fersen. In wenigen Augenblicken würde er den Saal erreichen und seine Tat zu Ende bringen. Angestrengt kniff der Barde die Augen zusammen, um die Schatten um ihn herum besser zu durchdringen. Er brauchte eine Waffe! In seiner Panik stolperte er über einen langen Holzstab, der auf dem Boden ein metallisches Klirren von sich gab. Mit neu erwachter Hoffnung beugte sich Ó Riordáin hinab und umfasste den Schaft. Es war eine rostige alte Hellebarde, die vermutlich zur Ausschmückung des Saals an der Wand befestigt gewesen war.
Er konnte sein Glück kaum fassen. Nun war er zumindest nicht mehr völlig wehrlos. Die Helmbarte war schwer. Ó Riordáin spannte die Muskeln seines rechten Arms an und hob sie hoch. Das Gewicht brachte ihn zum Taumeln. Noch einmal raffte er alle Kraft zusammen und versuchte, sich die Waffe unter die Achsel zu klemmen. Die Bewegung riss an seiner zertrümmerten linken Schulter, ein frischer Blutstrom rann aus der Wunde seinen Rücken hinab, sickerte warm und klebrig in den Stoff des Hemdes, das an seiner Haut klebte. Seine Finger gehorchten ihm nicht mehr, konnten den Schaft nicht halten. Polternd fiel die Hellebarde auf den Holzboden. Der Knall hallte wie ein Glockenschlag unter dem Gewölbe wider. Ein Schluchzen der Hilflosigkeit brach aus ihm heraus. Er war verloren. Die bean sí irrte nicht.
Die Stille, die seinem verzweifelten Wimmern folgte, wurde von festen, entschlossenen Schritten durchbrochen. Der Verfolger des Barden machte sich nicht die Mühe, seine Anwesenheit zu verbergen. Ó Riordáin wich in den Schutz einer Ecke zurück, wo er die Wendeltreppe ins Obergeschoss vermutete. Er wusste, dass er auf diesem Wege nicht entkommen konnte, doch ein wilder Selbsterhaltungstrieb zwang ihn trotzdem vorwärts. Mit der ausgestreckten Rechten suchte er nach der Tür, hinter der die Treppe lag. In seinem Rücken hörte er seinen Mörder mit der Stiefelspitze gegen eine Flasche stoßen, die über den Boden rollte. Fieberhaft griff Ó Riordáin nach dem Riegel, schob ihn hoch und zerrte an der Tür. Doch sie ließ sich nicht öffnen. Irgendetwas blockierte sie. Am ganzen Körper zitternd, beugte sich der Barde vor und tastete nach dem Hindernis. Seine Finger berührten poliertes Holz, eine umgestürzte Sitzbank lag quer vor dem Durchgang. Schluchzend zog Ó Riordáin das Möbelstück zur Seite. Tränen rannen über sein Gesicht, denn er wusste, dass es zu spät für ihn war. Hinter sich spürte er den Tod nahen.
Das angestrengte Atmen seines Verfolgers drang an seine Ohren. Der leichte Luftstrom, als er die Hellebarde schwang, strich sanft über Ó Riordáins Nacken. Dann traf ihn der schwere Stoß, als die Klinge der Waffe in seinen Rücken eindrang, Wirbel und Rippen durchschlug und unter dem Brustbein wieder heraustrat. Die Gewalt des Angriffs warf den Barden nach vorn, und die Spitze der Helmbarte bohrte sich in die Tür zur Wendeltreppe. Ó Riordáin stieß nur ein dumpfes Stöhnen aus. Der Schock war so stark, dass er sofort jegliche Gewalt über seine Glieder verlor. Blut aus seinem durchbohrten Magen stieg ihm in den Mund und erstickte jeden weiteren Laut. Überwältigt von grausamen Schmerzen, nahm er kaum wahr, wie die mörderische Klinge aus seinem Rücken gezogen wurde, wie er einem Sack Mehl gleich zu Boden stürzte und das Leben pulsierend im Rhythmus seines immer kraftloser schlagenden Herzens aus der Wunde strömte. Jemand packte ihn an den Knöcheln, schleifte ihn wie ein geschlachtetes Wild über den Boden. Ein Fußtritt rollte seinen erschlafften Körper in ein dunkles Loch. Das Letzte, was seine erlöschenden Augen sahen, waren die Holzbohlen, die sich über ihm schlossen wie der Deckel eines Sarges. Dann versank alles in undurchdringlicher Finsternis.
Kapitel 1
Über dem Land lag ein magisches Licht. Vor den Reitern erstreckte sich ein weites Tal, das von dicht bewaldeten Hügeln eingefasst war. Ergriffen zügelte Amoret Ceara, um den Anblick in sich aufzunehmen. Ihr Gemahl Breandán Mac Mathúna, Baron Shanrahan, brachte seinen Rappen neben ihr zum Stehen.
Seit ihrer Ankunft in Cork vor gut einer Woche waren sie und ihre Begleiter durch die vielfältigen Landschaften der Smaragdinsel gereist, durch üppig grüne Täler, einsame Hochmoore und dichte Eichenwälder. Unermüdlich waren sie über steinige schmale Wege und von tiefem Schlamm bedeckte Pfade geritten, hatten Bäche und Flüsse durchquert und sich zwischen hohen Bäumen hindurchgeschlängelt. In Irland erlaubten die schlechten Straßen fern der Städte weder den Gebrauch von Kutschen noch von Karren. Waren transportierte man auf Packpferden oder zu Wasser. Die Nächte hatten sie in Herbergen verbracht, die aus einfachen Hütten bestanden und nur über ein oder zwei Betten verfügten. Zum Glück hatte Amoret einige Rollbetten und andere Möbelstücke einpacken lassen.
Schon die Überfahrt nach Cork hatte bei der jungen Frau, die bisher nur einige Male mit dem Paketboot von England nach Frankreich gereist war, faszinierende und ein wenig erschreckende Eindrücke hinterlassen. Zwar begegnete man auch im Ärmelkanal nicht selten stürmischer See, doch an der Südküste Irlands war bereits die wilde Unberechenbarkeit des atlantischen Ozeans spürbar gewesen. Im Westen hatten sich gewaltige dunkle Gewitterwolken aufgetürmt und waren wie eine vernichtende Walze auf das kleine Schiff zugerollt. Die starken Windböen, die sie mit sich brachten, hatten an den Segeln gerissen und den Rumpf auf den tosenden Wellen hin- und hergeworfen. Wie hypnotisiert hatte Amoret die breiten Schleppen grauer Regenschauer beobachtet, die das Wolkenmeer hinter sich herzog und hinter denen der Horizont verschwand, als hätte ein nachlässiger Maler mit feuchten Pinselstrichen den Übergang von Himmel und See verwischt. Die Sonne erlosch hinter dem wüsten Ansturm geballter Nässe, und das Meer wurde tintenschwarz. Doch ebenso schnell, wie sich das Unwetter aufgebaut hatte, verzog es sich wieder. Als das Schiff in den Hafen von Cork einlief, brachen bereits die ersten Sonnenstrahlen durch die zerfasernden Wolken, und ein riesiger leuchtender Regenbogen spannte sich über das Land.
Da selbst die Hafenstädte über wenige Unterbringungsmöglichkeiten für Reisende verfügten, waren der Baron Shanrahan und sein Gefolge auf dem Landsitz eines Adeligen untergekommen, den Amoret vom Hof her kannte. Von dort waren Breandán und sie schließlich zwei Tage später mit ihrem Beichtvater Pater Blackshaw und einigen Dienern aufgebrochen, um den Besitz, den Charles II. dem Iren für seine treuen Dienste übertragen hatte, in Augenschein zu nehmen. Insgeheim war die junge Frau froh, dass das Land nicht in unmittelbarer Nähe zu dem Anwesen der Countess of Castlemaine lag, Charles’ erster Mätresse und Amorets ehemaliger Rivalin bei Hofe, auch wenn diese vermutlich noch nie einen Fuß dorthin gesetzt hatte.
Von Cork aus ging es ins Landesinnere. Als sie am siebten Tag die Knockmealdown-Berge hinter sich gebracht hatten, wand sich der Pfad durch einen dichten Wald mächtiger Traubeneichen. Die Nässe eines kurzen, aber heftigen Regenschauers glitzerte auf den gelappten Blättern der noch in sattem Grün prangenden Baumkronen. Wie Breandán seiner Frau erzählte, war dies einer der letzten größeren Eichenwälder der irischen Insel, die noch nicht der Axt der Einwanderer zum Opfer gefallen waren. Einst hatten sie den Rebellen gegen die Armeen Königin Elizabeth’ Schutz und Unterschlupf geboten. Auch aus diesem Grund hatten die Engländer ihre Zerstörung vorangetrieben. Doch nun, da Irland unterjocht und befriedet war, wurden die letzten Eichen- und Erlenwälder entlang der Flüsse gerodet und die Stämme zu Holzkohle verarbeitet. Mit düsterer Miene war Breandán an den Eisenhütten des Earls of Cork, für die die Holzkohle gebraucht wurde, vorbeigeritten. Für ihn war die Vernichtung der irischen Wälder ein Sinnbild der Unterdrückung seines Volkes.
Seit fast zwei Stunden führte der Weg zwischen den knorrigen Eichen dahin. Ein stetiger Wind brachte die Blätter zum Rauschen. Dann öffnete sich plötzlich der Wald vor der kleinen Reisegruppe und gab den Blick auf das zwischen Hügeln eingebettete Tal frei. Die tiefstehende Sonne übergoss das Land mit einem unwirklichen Licht und tauchte es in ein Farbenspiel aus Gold, leuchtendem Smaragdgrün und sattem Rotbraun. Weder Zäune noch Hecken unterbrachen die unendliche Weite der Wiesen, Felder und Hochmoore. Wie ein Diamant funkelte in der Mitte des Geschmeides die ruhige, glatte Wasserfläche eines kleinen Sees, der von einem von Felsen durchzogenen, schmalen Bach gespeist wurde. Tiefhängende Wolken trieben von Westen heran und umhüllten die Hügelkappen mit grauem Gespinst. Der Wind frischte auf und trug den unerwarteten Geruch des Meeres mit sich, den Salzhauch des offenen Atlantiks, der von Stürmen aufgewirbelten See, die überall in Irland, der Insel im tosenden Ozean, fühlbar blieb.
»Nun ist es nicht mehr weit bis Seanraithean«, sagte Breandán, der seinen Hengst Leipreachán neben Amoret gezügelt hatte. Angesichts der Weite vor ihm wurde der Rappe unruhig. Trotz der strapaziösen Reise der letzten Tage drängte ihn der Anblick zu einem wilden, ungestümen Galopp, und sein Reiter hatte alle Mühe, das Tier zurückzuhalten.
»Da unten nahe des Sees muss es sein«, fügte der Ire hinzu, als er den Hengst wieder in der Gewalt hatte.
Zweifelnd betrachtete Amoret die heranziehenden Wolken, deren Farbe von Perlgrau zu dunklem Anthrazit wechselte.
»Glaubst du, wir werden die Burg vor Einsetzen des Regens erreichen?«
Ein amüsiertes Lächeln huschte über Breandáns wohlgeformte Lippen. »Du bist noch nicht lange in Irland, Liebste.«
»Du meinst, sonst würde ich es besser wissen und gar nicht erst die Hoffnung hegen, unser Ziel trockenen Fußes zu erreichen?«
Ergeben rückte sie ihren Hut zurecht und stieß ein Seufzen aus, als die ersten Regentropfen auf die breite Krempe klatschten. Vorsichtig setzten die Pferde ihre Hufe auf den feuchten Untergrund und schüttelten ihre langen Mähnen, als sie aus dem Schutz des Waldes traten. Von Westen rollten weitere Wolkenberge heran, so dass ein schnelles Ende des Schauers kaum zu erwarten war. Bald peitschte den Reitern der Regen seitlich ins Gesicht, und obgleich sie sich unter ihren Umhängen aus wasserabweisender Wolle zusammenkauerten, fühlten sie, wie die Nässe unter ihre Kleider kroch.
Der schmale Bach, an dem sie entlangritten, toste über sein felsiges Bett. Die Zweige der vereinzelten Bäume, der gelb blühende Ginster und die breiten Fächer der Farne bogen sich unter dem Regen, der auf sie niederprasselte. Auf einem halb abgeernteten Weizenfeld senkten die noch stehenden Ähren wie im Gebet die Köpfe. Keine Menschenseele begegnete ihnen. Offenbar hatten die Bauern vor dem Wolkenbruch Schutz gesucht.
Amoret, die trotz der Unbilden des Wetters von einem Fieber der Erwartung erfasst worden war, blickte sich neugierig um. Doch ihre Vorfreude verflog schlagartig, als sie die düstere Ruine gewahrte, die wie ein unheimliches Mahnmal vor ihnen auftauchte. Die aus grauem Stein gebaute Burg mit ihren vier Ecktürmen musste einst beeindruckend gewesen sein und uneinnehmbar gewirkt haben. Doch irgendwann war ein Teil der Südseite eingestürzt, und die oberen Räume waren nun der Zerstörungswut der Elemente ausgesetzt.
Ungläubig zügelte Breandán sein Pferd vor der verfallenen Festung und wandte sich mit betroffener Miene zu seiner Frau um.
»Ist es das?«, fragte sie. »Bist du sicher?«
Er nickte wortlos. Der Regen rann in Bahnen von der Krempe seines Hutes auf seine Schultern hinab. Die Feder, die ihn zierte, war nur noch ein dünnes Band, das an seinem Rand klebte.
»Ich glaube nicht, dass der König wusste, in welchem Zustand sich das Turmhaus befindet, als er es dir übertrug«, sagte Amoret beschwichtigend, doch insgeheim hegte auch sie Zweifel.
Der Jesuit Jeremy Blackshaw überwand als Erster die allgemeine Enttäuschung und bemerkte philosophisch: »Lasst uns nachsehen, ob wenigstens die unteren Räume bewohnbar sind, damit wir uns trocknen können.«
»Ihr habt recht, Pater«, stimmte Breandán zu.
Er sprang aus dem Sattel und half seiner Frau beim Absteigen. Jeremy und Amorets Diener William schlossen sich ihnen an. Vor dem Portal, das schief in den Angeln hing, hielten sie inne. Gemeinsam zogen Breandán und William an der Tür, die nur einen Spaltbreit offen stand, bis sie sie ganz geöffnet hatten. In der kleinen Vorhalle war es stockdunkel.
»Wir brauchen Licht«, sagte Jeremy. »Wer weiß, was uns drinnen erwartet.«
Wie aufs Stichwort tauchte auf einmal ein tanzender leuchtender Punkt zwischen den Regenschleiern auf und näherte sich ihnen zielstrebig. Kurz darauf blieb ein Mann in einem weiten Umhang vor ihnen stehen, der eine Lampe trug.
»Gott sei mit Euch, Gentlemen, Madam«, grüßte er sie auf Englisch. Ein starker irischer Akzent färbte seine Worte. Seine dunklen Augen, die scharf wie die eines Vogels waren, musterten sie misstrauisch. Amoret meinte, aus seiner Haltung sogar eine gewisse Ablehnung, wenn nicht gar Feindseligkeit zu lesen.
»Seid Ihr der Dorfvorsteher, Sir?«, fragte Breandán.
»Ich bin Eamonn Prendergast, der Verwalter dieses Anwesens. Seid Ihr auf der Durchreise?«
»Ich bin der Baron Shanrahan«, erklärte Breandán. Seine natürliche Bescheidenheit ließ ihn zögern, die Tatsache auszusprechen, dass der Besitz nun ihm gehörte, aber das brauchte er auch nicht.
»Ihr seid also der neue Herr«, stellte Prendergast fest. Obwohl sich der Mann bemühte, seine Gefühle nicht offen erkennen zu lassen, spürte jeder der Anwesenden sein Missfallen. »Dort drinnen werdet Ihr Euch nur die Beine brechen, Mylord«, fuhr der Verwalter fort. »Die englischen Soldaten haben alles geplündert und dabei die Böden aufgerissen. Die Burg muss erst wieder instand gesetzt werden, wenn Ihr dort wohnen wollt. Bitte nehmt meine Gastfreundschaft an, bis sich eine andere Lösung findet. Hier entlang.«
Amoret bemerkte, dass ihr Gatte bei der herrschaftlichen Anrede leicht errötete. Obwohl es seit seiner Erhebung zum Baron nicht das erste Mal war, dass er auf diese Weise angesprochen wurde, war es ihm noch immer unangenehm. Als Sohn eines Bauern und ehemaliger Landsknecht sah er sich weiterhin auf derselben Stufe wie die Menschen, über die er nun gebieten sollte. Die kommenden Monate würden nicht einfach für ihn werden.
Sie durchquerten das Dorf, das zum Teil aus einfachen Lehmhütten bestand. Ihr unwilliger Gastgeber blieb schließlich vor dem größten Gebäude stehen, einem rechteckigen Steinhaus mit weiß getünchten Wänden und einem Dach aus Weizenstroh. Beim Eintreten fiel Amoret ein Gesicht hinter dem Guckloch einer Zwischenwand auf, die den Kamin vor Zugluft schützte. Auch durch die offen stehenden Türen der Hütten hatten sich argwöhnische Blicke auf die Ankömmlinge gerichtet. Ein leichter Schauer überlief Amoret. Es war offensichtlich, dass man sie in Shanrahan nicht willkommen hieß.
Zwei Hühner, die im Haus Schutz vor dem Regenguss gesucht hatten, machten den Menschen gackernd Platz. Im Innern war es recht düster. Der eindringliche Geruch des Torffeuers, das im Kamin glühte, traf Amorets Nase und verdrängte die Farmgerüche, die sie draußen umgeben hatten. Als sich ihre Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten, bemerkte sie die Frau, die hinter dem Guckloch saß. Auf dem Windschutz, in den es eingelassen war, ruhte ein breites Überdach aus getünchtem Flechtwerk, das sich von einer Seite des Hauses zur anderen zog und den Rauchfang des Kamins stützte.
»Meine Gemahlin Moira«, stellte Prendergast die Frau vor, die Amoret auf Mitte vierzig schätzte.
Sie war gut gekleidet, wenn auch entsprechend der Farmarbeit, die sie verrichtete. Eine Schürze aus Leinen schützte ihren langen Wollrock vor Schmutz.
»Das ist der Baron Shanrahan, meine Liebe«, erklärte Prendergast. »Ich habe Seiner Lordschaft und seinem Gefolge unsere Gastfreundschaft angeboten.«
Die Augen der Frau verengten sich, und sie lächelte gezwungen, bevor sie einen kurzen Knicks vollführte.
»Es ist uns eine Ehre, Mylord.«
Um über seine Verlegenheit hinwegzutäuschen, stellte Breandán seine Gemahlin und ihren Beichtvater vor.
Über die Gesichter der Prendergasts huschte ein Ausdruck der Überraschung. Offensichtlich hatten sie nicht damit gerechnet, dass der neue Herr katholisch sein könnte. Die meisten Engländer, die große Teile der Besitzungen in Irland übernommen hatten, waren Protestanten.
»Willkommen, Pater«, sagte Eamonn Prendergast. Sein Ton klang mit einem Mal weniger abweisend. »Ich werde Eure Pferde in den Stall bringen. Áed, der Stallbursche, wird sich um sie kümmern.«
Mit diesen Worten verschwand der Verwalter. Breandán und die Diener William, Gerald und Thomas folgten dem Hausherrn in den Stall, um bei der Versorgung der Pferde zu helfen. Leipreachán ließ sich nicht gern von Fremden anfassen. Den Rest ihres Gefolges hatten sie in Cork zurückgelassen. Amoret war froh, dass sie darauf verzichtet hatte, ihren Sohn Daimhín und dessen Kindermädchen mitzubringen. Sie konnte nur hoffen, dass sich die Burg rasch herrichten ließ, damit sie den armen Leuten nicht länger als nötig zur Last fallen mussten.
Ein junges Mädchen, offenbar eine Magd, die Amoret bisher nicht aufgefallen war, trat aus dem Zwielicht einer Ecke der großen Wohnküche, nahm den Gästen die nassen Umhänge ab und legte sie zum Trocknen auf die Überdachung des Kamins. Amoret entdeckte noch andere Gegenstände, die dort aufbewahrt wurden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen, darunter ein aus Stroh geflochtenes Pferdekummet. In einem Alkoven auf der gegenüberliegenden Seite der Küche schlief eine Greisin. Eine Wolfshündin säugte auf einer Decke ihre vier Welpen. Amoret, ihre Zofe Mary und Jeremy nahmen auf den Bänken zu beiden Seiten des Kamins Platz.
»Sorcha, mach etwas Milch warm und schenke unseren Gästen ein«, sagte Moira auf Gälisch zu der Magd.
Zum Glück waren Amoret und Jeremy des Irischen mächtig. Breandán hatte ihnen die schwierige Sprache über die Jahre beigebracht. Für ihre Dienerschaft, die nur Englisch verstand, würde der Aufenthalt in Shanrahan jedoch mit gewissen Schwierigkeiten verbunden sein. Mary, die an Amorets Seite saß, machte bereits seit Tagen ein unzufriedenes Gesicht und hob immer wieder leidend den Blick zum Himmel, wenn sie sich unbeobachtet fühlte. Zum ersten Mal seit Armandes Hochzeit mit Alan Ridgeway vermisste Amoret ihre langjährige Gefährtin von ganzem Herzen.
Während die Magd frische Milch aus einem Krug in einen kleinen Topf goss, der über dem Torffeuer hing, wandte sich Moira an Breandán, der aus dem Stall zurückgekehrt war:
»Nach Eurer langen Reise müsst Ihr hungrig sein, Mylord. Leider ist vom Mittagsmahl kein Haferkuchen mehr übrig. Mit Eurer Erlaubnis werde ich schnell welchen backen.«
»Ich danke Euch, a bhean uasal«, antwortete Breandán auf Gälisch, um sie wissen zu lassen, dass er die Sprache verstand.
Die Hausherrin nahm die überraschende Tatsache mit hochgezogenen Brauen zur Kenntnis, ging aber nicht darauf ein. Nur Sorcha musterte die Ankömmlinge mit offenem Interesse. Der neue Herr war ausgesprochen gutaussehend, mit ebenmäßigen Zügen, großen blauen Augen und dichtem schwarzbraunem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Er war schlank und geschmeidig wie eine Katze. Die Magd konnte den Blick nicht von ihm abwenden.
»Sorcha! Träum nicht«, mahnte die Hausherrin.
Während die Magd die warme Milch in Holzbecher goss und verteilte, beobachtete Amoret fasziniert Moira Prendergast, die ein Büschel frisch geernteten, noch ungedroschenen Hafer vom Überdach nahm und sich vor die Feuerstelle hockte. Sie hielt das Korn bei den Stengeln über die Flammen, bis es sich entzündete. Dann nahm sie einen Stock, schlug die Körner aus den verbrannten Hülsen und mahlte sie zu Mehl.
Breandán, der die Verwunderung seiner Frau bemerkte, erklärte: »Graddan-Brot wird aus Korn gebacken, das man auf diese Weise getrocknet hat. Es ist eine alte irische Tradition. Das Brot wird für seinen süßen Geschmack geschätzt.« Seine Mundwinkel zogen sich verächtlich nach unten, als er hinzufügte: »Die Engländer haben 1635 sogar ein Gesetz erlassen, das diesen ›barbarischen‹ Brauch verbot. Sie mischen sich in Dinge ein, die sie nichts angehen.«
Inzwischen hatte die Hausherrin einen Holztrog von der Wand genommen und das Mehl zu Teig verarbeitet. In runde Fladen ausgerollt und mit einem Kreuz versehen, wurden die Haferkuchen auf einem flachen, glatten Stein gebacken, der im Torffeuer warm gehalten wurde. Dann musste das dünne Brot noch gegen einen dreibeinigen Brotstock gelehnt aushärten, bevor Moira Prendergast es in vier Stücke brach, dick mit Butter bestrich und ihren Gästen reichte.
Amoret hatte noch nie eine Vorliebe für heiße Milch gehabt, auch wenn sie den Körper angenehm von innen wärmte, doch als sie zum ersten Mal Haferkuchen probierte, hatte sie den Eindruck, nie zuvor etwas Köstlicheres gegessen zu haben, nicht einmal bei Hofe.
»Der Haferkuchen ist wirklich sehr gut, a bhean uasal«, sagte sie auf Gälisch, was der Hausherrin einen noch erstaunteren Blick entlockte, denn Amorets Akzent verriet eindeutig ihre englische Herkunft.
»Danke, Mylady«, antwortete die Frau des Verwalters auf Englisch.
Amoret wurde klar, dass Moira den Neuankömmlingen nicht erlauben würde, sie so leicht für sich einzunehmen.
Zum Abschluss des Mahls verteilte der aus den Ställen zurückgekehrte Hausherr Holzbecher mit einer hochprozentigen Flüssigkeit, an der Amoret nur vorsichtig nippte. William, der den Trunk in einem Schluck hinunterstürzte, quollen die Augen aus den Höhlen, und er musste husten, als ihm der Alkohol die Kehle verbrannte.
»Was ist das für ein Teufelszeug?«, krächzte er, als er die Stimme wiederfand.
»Uisce beatha«, erklärte Eamonn Prendergast. »Wasser des Lebens. Wärmt das Blut und verscheucht jede Krankheit.«
»Whiskey«, übersetzte Breandán.
Unter dem abschätzenden Blick des Verwalters begann der junge Lord sich zunehmend unwohl zu fühlen. Er wusste, was Prendergast in diesem Moment durch den Kopf ging. Sicher fragte er sich, was der neue Baron Shanrahan getan hatte, dass der König von England ihm einen Landsitz in Irland überschrieben hatte, noch dazu, da er offensichtlich Ire und darüber hinaus Katholik war. Das Misstrauen des Mannes war Breandán daher mehr als verständlich. Um sich abzulenken, warf er einen Blick durch die offen stehende Tür.
»Es hat aufgehört zu regnen«, verkündete er. In seiner Stimme schwang eine Erleichterung, die er nicht ganz verbergen konnte.
»Wenn Ihr wollt, führe ich Euch herum, Mylord«, erbot sich Eamonn.
»Danke.«
Amoret schloss sich ihnen an.
Draußen brach die Sonne rotgolden durch die abziehenden Wolken und tauchte die Landschaft in ein warmes, heiteres Licht. Die bewaldeten Hügel, die das Tal einschlossen, verloren sich in der Ferne. An ihrem Fuß erstreckte sich das Hochmoor, das bis an die bestellten Felder heranreichte. Amoret identifizierte Hafer-, Gerste- und Weizenfelder, aber auch einige Pflanzen, die ihr unbekannt waren.
»Was wird dort drüben angebaut?«, fragte sie.
»Kartoffeln«, erklärte Eamonn. »An den Geschmack muss man sich gewöhnen, aber sie sind sehr gehaltvoll, und man erntet sie erst, wenn man sie braucht.«
»Verstehe. Wie ich sehe, baut Ihr auch Kohl, Erbsen und Bohnen an«, bemerkte Amoret mit einem Blick auf den Küchengarten hinter dem Haus.
Sie entdeckte zudem einen Brotofen. Gegenüber der Haustür befand sich der Misthaufen. Offenbar hatten die Iren die Quelle der Fruchtbarkeit ihres Hofes gern im Blick.
»Die Bauern hier sind brave Leute, die hart arbeiten, Mylord«, sagte Eamonn nicht ohne Stolz.
»Daran zweifle ich nicht«, erwiderte Breandán.
Es lag ihm daran, dem Verwalter zu versichern, dass er nicht vorhatte, alteingesessene Pächter um ihr Land zu bringen. Als Kind hatte er miterlebt, wie seine Familie während des Krieges den kleinen Hof verlassen musste, der ihnen ein bescheidenes, aber sicheres Auskommen garantiert hatte. Diese Erfahrung wollte er keinem anderen zumuten.
Kapitel 2
Als der Abend hereinbrach, bot Eamonn Prendergast seinen Gästen das kleine Gemach hinter dem Kamin an, den wärmsten Raum im Haus. Das Ehepaar verbrachte die Nacht in der Kammer auf der anderen Seite des Gebäudes, in der gewöhnlich die beiden Söhne schliefen. Diese waren zurzeit mit dem Vieh auf den entfernt gelegenen Weiden. Die Greisin im Alkoven hatte Eamonn als seine Mutter Nora vorgestellt. Die Alte war bettlägerig, aber geistig wach. Nach kurzer Musterung begrüßte sie den neuen Lord mit größerer Freundlichkeit, als ihr Sohn es getan hatte. Jeremy bemerkte erstaunt, dass sie ihm zuzwinkerte, als sie hörte, dass er Priester war, und nahm sich vor, die alte Nora bei nächster Gelegenheit in ein Gespräch zu verwickeln. Bridget, die Tochter der Prendergasts, schlief in ihrem Bett auf dem Hängeboden, den man auf der östlichen Giebelseite des Hauses eingezogen hatte und der mit einer Leiter erreichbar war.
Amoret fiel es zuerst schwer, in den Schlaf zu finden. Sie hatte sich gerade wieder an das Leben in London gewöhnt, wo auch nachts nie vollkommene Ruhe einkehrte. Immerzu ratterten Wagen durch die Gassen, Betrunkene grölten auf dem Heimweg von der Schenke, der Nachtwächter sang zu jeder vollen Stunde sein Lied. Doch auf das kleine Dorf in Irland sank nach Sonnenuntergang eine mystische Stille herab, die fast hörbar war. Nicht einmal das Plätschern des nicht allzu weit entfernten Baches drang an Amorets Ohren. Die Tiere in den Ställen schliefen ebenso ruhig wie die Menschen. Sie war dankbar für die tiefen Atemzüge ihres Gemahls neben ihr und das leise Schnarchen des Priesters auf dem Rollbett. Die Rückseite des Kamins strahlte eine angenehme Wärme aus, und das Bett war bequem. Die Burgruine bot sicherlich weniger Annehmlichkeiten. Am Morgen würden sie sich das alte Gemäuer näher ansehen und entscheiden, ob es bewohnbar war oder ob sie unverrichteter Dinge nach Cork zurückkehren mussten.
Ein leises Seufzen durchbrach die unheimliche Stille der Nacht. Amoret erriet, dass es von der Wolfshündin stammte, die mit ihren Welpen auf der Decke vor dem Kamin schlief. Dieses Geräusch tiefer Zufriedenheit und Entspannung ließ schließlich auch Amoret einschlafen.
Als sie erwachte, fiel ein rosiger Schimmer durch das kleine Fenster, das mit Schafshaut bespannt war. In Entdeckerlaune verließ Amoret das Bett und schlüpfte in ihr Reisekleid. Ihr Gemahl und der Jesuit schliefen noch. In dem Bemühen, sie nicht zu stören, verließ sie die Kammer und trat um den Kamin und die Querwand herum, die den Wind abhielt, der durch die offen stehende Halbtür hereinblies. Die Hausherrin hockte vor der Feuerstelle und war damit beschäftigt, aus der Glut, die sie am Abend unter der Asche begraben hatte, neue Flammen anzufachen. Amoret grüßte sie freundlich und erhielt eine höfliche, wenn auch wenig herzliche Antwort.
»Kann ich Euch helfen?«, erbot sich Amoret und erntete einen ungläubigen Blick für ihre Worte. Eine englische Lady machte sich im Haushalt gewöhnlich nicht die Finger schmutzig, doch Amorets Erziehung im Kloster hatte sie Demut gelehrt. Wenn es sein musste, konnte sie auch ein annehmbares Mahl zubereiten.
»Nein danke, Madam«, antwortete die Irin. »Setzt Euch doch auf die Bank beim Kamin. Ich bringe Euch warme Milch.«
Inzwischen fanden sich nacheinander die anderen Familienmitglieder und die verbliebenen Gäste ein. Sorcha erschien mit einem Eimer frischer Milch aus dem Kuhstall und begann, Porridge für alle anzurichten.
Nachdem Breandán bei den Pferden nach dem Rechten gesehen hatte, machten er, Amoret, Jeremy und William sich auf den Weg zur Burgruine. Zunächst betrachteten sie sich den Schaden auf der Südseite von außen. Offenbar war diese Wand während des Krieges mit Kanonen beschossen worden. Die oberen zwei Drittel der Ecktürme waren eingestürzt, in den unteren Bereichen standen nur noch die steinernen Wendeltreppen, die ins Leere führten. Die Trümmer der Türme und der beschädigten Seitenwand lagen so dicht beieinander, dass man im Erdgeschoss nicht ins Innere sehen konnte. Im Saal des darübergelegenen Stockwerkes klaffte jedoch ein großes Loch, durch das man die geborstenen Balken der eingebrochenen Holzdecke erkennen konnte. Eamonn hatte ihnen zwei Laternen mitgegeben. Mit vereinten Kräften zogen die Männer die schwere Eingangspforte auf. Die Flammen warfen ein unruhig flackerndes Licht auf die kahlen Steinwände der kleinen Vorhalle. Von dort gelangte man in einen großen Saal, der von einem gemauerten Gewölbe überspannt wurde. Die weiß getünchten Wände waren an den Stellen, wo die Beleuchtung gestanden hatte, rußgeschwärzt. Hier und da lag ein eiserner Kandelaber auf dem Boden inmitten eines wilden Durcheinanders aus Geschirr, zerbrochenen Möbeln und rostigen alten Waffen. Im hinteren Bereich des Saales türmten sich Schutt und Trümmer. Ein Teil der massiven Wand stand jedoch noch. Ein Holzgerüst verhinderte, dass die Decke an dieser Seite einstürzte. Es schien vor langer Zeit, vermutlich kurz nach dem Krieg, errichtet worden zu sein und war das einzige Anzeichen von Reparaturarbeiten. Wie Eamonn gesagt hatte, waren einige der Holzbohlen aus dem Fußboden gerissen worden. Offensichtlich hatten die englischen Soldaten auf der Suche nach Wertsachen nichts dem Zufall überlassen.
Amoret, die an der Seite ihres Gatten geblieben war, blickte sich aufmerksam um.
»Was mag wohl aus den Bewohnern der Burg geworden sein?«, fragte sie.
»Die Soldaten wurden wahrscheinlich erschossen«, spekulierte Breandán. »Der Zustand des Wehrturms lässt vermuten, dass sie Cromwells Truppen Widerstand leisteten. Daher glaube ich nicht, dass man ihnen Pardon gab. Der Inhaber der Burg ging vielleicht ins Exil. Die Dorfbewohner werden Näheres wissen.«
»Es erfordert harte Arbeit, das Chaos zu beseitigen, doch zumindest scheint ein Großteil der Decke unbeschädigt zu sein«, bemerkte Jeremy, der nach Zeichen von eindringender Feuchtigkeit gesucht hatte. »Wenn wir hier, wo das Gerüst steht, eine Zwischenwand einziehen, ist der Saal benutzbar. Der Kamin ist offenbar auch in Ordnung.«
»Da stimme ich Euch zu, Pater«, erwiderte Breandán. »Lasst uns sehen, wie es in den oberen Stockwerken ausschaut.«
Mit der Laterne in der Hand wandte sich William dem nordwestlichen Eckturm zu. Die anderen folgten ihm über verstreute Steingutscherben hinweg.
»Vorsicht. Hier liegt eine Hellebarde«, warnte der Diener seine Begleiter.
»Die Klinge ist noch schwarz von Blut«, bemerkte Amoret erschaudernd.
»Da ist überall Blut auf dem Boden«, ergänzte Jeremy und ließ die Lichtquelle kreisen.
»Welch schreckliche Szenen müssen sich hier abgespielt haben«, murmelte Amoret betroffen. »Kein Wunder, dass die Dorfbewohner uns nicht willkommen heißen. Für sie sind alle Engländer gleich.«
William und Breandán hoben die Holzbank auf, die neben der Tür zur Wendeltreppe auf dem Boden gelegen hatte, und stellten sie an die Wand.
»Sogar an der Tür ist getrocknetes Blut«, sagte der Jesuit, die Stirn gerunzelt. »Jemand ist genau an dieser Stelle verwundet worden. Da, seht ihr das Loch in der Holzbohle? Wie es scheint, hat sich eine scharfe Klinge in die Tür gebohrt.«
Wieder überfiel die junge Frau ein Schaudern. »Glaubt Ihr, er wurde aufgespießt?«
»Durchaus möglich.« Zweifelnd sah Jeremy sie an. »Ich würde es verstehen, wenn Ihr es angesichts der blutigen Ereignisse, die sich hier abgespielt haben, vorziehen würdet, nicht in der Burg zu wohnen, Mylady.«
Fragende Blicke richteten sich auf Amoret. Diese zuckte mit den Schultern.
»In jedem alten Haus gibt es Gespenster der Vergangenheit«, erwiderte sie. »Gehen wir weiter.«
Breandán schenkte ihr ein Lächeln, bevor er sich umwandte und die Tür aufzog. Die in die dicke Mauer des Eckturms eingelassene Wendeltreppe war unbeschädigt. Durch schmale Schießscharten fiel ein wenig Tageslicht herein. An den Innenwänden waren Halterungen für Lampen angebracht. Sie gelangten in einen kleinen Raum, der mit einem schmucklosen Baldachinbett ausgestattet war.
»Da dieser Raum unmittelbar an den Saal anschließt, in dem die Truppen der Burg und die Dienerschaft untergebracht waren, handelt es sich hier wahrscheinlich um die Unterkunft des befehlshabenden Offiziers«, mutmaßte Breandán.
Ein Stockwerk höher befand sich eine kleine Küche, die fast unversehrt schien. Auf gleicher Höhe führte eine Tür in den Großen Festsaal der Burg, der über dem Gewölbesaal lag. Hier musste der einstige Schlossherr Gäste empfangen und Gericht gehalten haben. Die einst prachtvolle Holzdecke war zum Teil eingestürzt, so dass sie den Saal nur von einem Ende aus betrachten konnten.
»Ein Jammer«, meinte Jeremy.
Nachdem sie sich kurz umgesehen hatten, kehrten sie in den Eckturm zurück und stiegen die Wendeltreppe weiter hinauf. Über der Küche befand sich das Schlafgemach des Burgherrn, wie die reiche Ausstattung verriet. Man hatte die Bettvorhänge und die Wandvertäfelung heruntergerissen, sie schienen jedoch noch so weit erhalten, dass man sie mit ein wenig Geschick wieder herrichten konnte. Wie durch ein Wunder waren die Glasfenster unversehrt geblieben. Von der danebenliegenden Wohnstube, in der ein großer Eichentisch und einige Stühle standen, führte eine schmale Tür zur Wendeltreppe im nordöstlichen Eckturm, über die man in die Kapelle und das Schlafgemach des Kaplans gelangte. Allerdings waren die Möbel dort völlig zerstört und die Wandbehänge zerfetzt.
»Allein werden wir es nicht schaffen, einigermaßen Ordnung hereinzubringen«, prophezeite Jeremy.
»Nein«, stimmte Breandán zu, »wir müssen die restlichen Diener aus Cork nachkommen lassen. Das heißt, falls du nichts dagegen hast, dass wir bleiben.« Der Baron wandte sich an seine Gemahlin, die ihm zulächelte.
»Ich sehe das Ganze als Abenteuer. Bleiben wir!«, sagte Amoret.
Sie wusste, wie lange Breandán sich danach gesehnt hatte, in seine Heimat zurückzukehren. Um ihn glücklich zu sehen, war sie auch bereit, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen.
»Dann lasst uns das Gepäck holen«, erwiderte Breandán befriedigt. »Die Kammer des Offiziers scheint weitgehend unbeschädigt. Dort können wir uns einquartieren.«
Auf dem Weg nach unten begutachteten sie das Baldachinbett im Gemach des Hauptmanns. Die Vorhänge waren zerschlissen und mussten ersetzt werden. Die alte Matratze wurde vorsorglich entfernt und durch einen mit frischem Stroh gefüllten Sack ersetzt. Bettzeug und Decken führten sie mit sich.
Breandán kehrte zum Haus der Prendergasts zurück, um ihre Gastgeber von ihrer Entscheidung in Kenntnis zu setzen, dass sie im Turmhaus wohnen würden. Als er in die Küche trat, tapste ihm einer der Wolfshundwelpen zwischen die Beine und brachte ihn beinahe zu Fall. Der Hausherr konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
»Sie ist die Vorwitzigste des Wurfs«, sagte er. »Sicher wird sie einmal eine vorzügliche Wolfsjägerin.«
Lächelnd sank Breandán in die Hocke und streichelte die junge Hündin, die ihm sofort ausgiebig die Hand leckte.
»Als Bub hatte ich auch so einen Hund. Damals in Clare«, murmelte er, als die Erinnerung an glückliche Zeiten zurückkehrte. Die kurze Bemerkung rührte etwas in Eamonns Innerem. Um Gelassenheit bemüht, sagte er: »Sie mag Euch, Mylord. Wenn Ihr wollt, könnt Ihr sie haben. Ein wachsamer Wolfshund kann sehr nützlich sein.«
Obwohl Breandán nie daran gedacht hatte, wieder einen Hund zu halten, empfand er das Angebot als starke Versuchung. Irische Wolfshunde wurden überall für ihre Furchtlosigkeit geschätzt und daher in großer Zahl ins Ausland verkauft.
»Das ist sehr großzügig von Euch«, erwiderte der Baron dankbar.
»Ihr könnt sie gleich mitnehmen. Es ist ohnehin Zeit, sie zu entwöhnen.«
Und so sah Amoret, die mit Jeremy in den unteren Saal hinabgestiegen war, ihren Gemahl mit einem quirligen kleinen Hund auf dem Arm aus dem Dorf zurückkehren.
»Ein fürstliches Geschenk«, kommentierte Breandán die Geste des Verwalters. »Auf dem Kontinent erzielen diese Hunde einen hohen Preis.«
Die Diener hatten inzwischen Besen und andere Putzutensilien aufgetrieben und machten sich ans Aufräumen. Im Keller gab es einen tiefen Brunnen, der genießbares Wasser führte. Draußen hoben die Lakaien eine Grube aus, in die sie die Abfälle warfen. Das Mittagsmahl nahmen Breandán und Amoret erneut als Gäste der Prendergasts ein. Während William und die anderen Diener unter Jeremys Aufsicht den Gewölbesaal ausputzten, führte der Verwalter die neue Herrschaft durch das Dorf. Die Häuser waren mehr oder weniger entlang einer Straße aus festgestampfter Erde angelegt, was dafür sprach, dass das Dorf unter englischem Einfluss geplant worden war. Die Wände waren aus aufeinandergeschichteten Grassoden und Tonerde errichtet und weiß getüncht. Die Dächer bestanden aus Stroh oder Reet und dampften in der morgendlichen Frische der Luft wie riesige Misthaufen. Da die Häuser keine Schornsteine besaßen, entwich der Rauch der Feuerstelle überall durch das Stroh. Breandán erriet, dass die Behausungen allesamt nach den Kriegszügen Cromwells entstanden waren. Ihre Vorgänger hatten die Soldaten mit Sicherheit niedergebrannt. In Irland war es nicht üblich, dass der Gutsherr die Hütten der Pächter erbaute. Dies überließ man den Bauern. Und da die Pachten gewöhnlich nur über zwanzig Jahre liefen, lohnte es sich für die Menschen nicht, dauerhaftere Gebäude zu errichten.
»Gibt es hier eine Kirche?«, fragte Amoret den Verwalter.
»Wenn Ihr dort hinüberseht, Mylady«, antwortete Eamonn und deutete in Richtung Osten, »könnt Ihr die Überreste erkennen. Das Gebäude ist seit über hundert Jahren eine Ruine. Es befindet sich im Besitz der Staatskirche.« Er blickte Amoret unter seinen dichten dunklen Brauen hervor an. »Unser Priester liest sonntags und an Feiertagen die Messe in meinem Haus.«
»Ich wundere mich, dass man sie nicht wieder aufgebaut hat«, sagte Amoret.
»Die protestantische Staatskirche hat kein Interesse an einer Massenbekehrung der katholischen Iren«, konstatierte Eamonn steif.
Breandán bemerkte den überraschten Gesichtsausdruck seiner Frau und erklärte: »Damit würden die Eroberer einen Vorwand verlieren, die Iren von ihrem Land zu vertreiben.«
Amoret errötete leicht. »Natürlich. Wie naiv von mir.« Als sie sich wieder gefasst hatte, fragte sie: »Also duldet die Obrigkeit die Arbeit der katholischen Priester?«
»Solange sie nicht zu sehr auffallen«, entgegnete Eamonn.
Sie waren vor einem Gebäude aus Stein etwas außerhalb des Dorfes stehen geblieben. Der dunkle Kohlenrauch, der dem Schornstein entwich, und das metallische Hämmern, das durch die geöffnete Tür drang, verriet, dass es sich um die Werkstatt des Schmieds handelte.
»Ruairí Ó Leannáin schmiedet alles«, sagte der Verwalter. »Von Pflugscharen, Spaten, Forken, Sensen, Hufeisen, Steigbügeln, Messerklingen bis hin zu Scheren, Riegeln oder Bratspießen, was immer Ihr braucht.«
»Gut zu wissen«, erwiderte Breandán und beobachtete den Schmied eine Weile bei der Arbeit.
»Wir haben auch einen Schreiner, Fintan Ó Meadhra, der sehr geschickt mit Holz umgehen kann. Und dort hinten am Bach ist die Kornmühle, die von Laoghaire Ó Seanacháin betrieben wird.«
»Was ist das da für ein Gebäude? An der Weggabelung?«, erkundigte sich Amoret.
»Das ist eine kleine Herberge, die von Muiredach Ard Ó Donnabháin geführt wird. Dort können Reisende einkehren und übernachten«, erklärte Eamonn. »Es kommen nicht viele Leute hier durch. Händler auf dem Weg nach Cork und Tinker, die Gegenstände des täglichen Bedarfs verkaufen.«
Der »riesige« Muiredach Ó Donnabháin, dachte Amoret amüsiert. Die Iren hatten eine Vorliebe für Spitznamen. Sie war neugierig darauf, den Herbergswirt kennenzulernen.
»Was könnt Ihr mir über die anderen Grundherren in der Umgebung sagen?«, fragte Breandán schließlich.
Eamonn zögerte, bevor er weitersprach. Seine buschigen Augenbrauen rückten näher zusammen, was seinen Blick verdüsterte.
»Euer nächster Nachbar ist ein Engländer namens Ralph Luscombe. Er verdankt sein Land Oliver Cromwell, unter dem er gedient hat.«
»Lebt er auf seinem Gut?«, erkundigte sich Amoret neugierig.
»Überraschenderweise, ja. Offenbar hat er seit der Thronbesteigung von Charles II. in England nichts zu erwarten, obwohl er selbst kein fanatischer Puritaner zu sein scheint. Aber seine Gemahlin ist die Tochter von John Inglewhite, einem treuen Weggenossen Cromwells.«
»Nun, wir werden diesem Luscombe wohl einen Besuch abstatten müssen«, erklärte Breandán. Seine angespannte Miene verriet wenig Begeisterung. Amoret lächelte ihm aufmunternd zu.
»Befindet sich nicht in der Nähe der Besitz eines Verwandten von James Butler, Duke of Ormonde?«, fragte Amoret.
Eamonn nickte. »Kilcash, das Gut seines Bruders. Soviel ich weiß, hat Seine Gnaden sich dafür eingesetzt, dass Lieutenant-General Richard Butler seine unter dem Commonwealth konfiszierten Ländereien zurückerstattet wurden. Die Butlers sind die einflussreichsten Grundherren hier in Tipperary.«
Auf dem Weg zurück zur Burgruine schmiedeten Breandán und Amoret Pläne.
»Sobald wir uns eingerichtet haben, statten wir den Nachbarn Besuche ab«, beschloss der Baron. »Doch zuerst reisen wir nach Cork und holen den Rest unseres Gefolges.«
Amoret nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass er von »unserem« Gefolge sprach, obgleich es sich eigentlich um ihre Dienerschaft von ihrem Landsitz Melverley Court in England handelte. Vielleicht begann ihr Gemahl sich doch allmählich an seine neue gesellschaftliche Stellung zu gewöhnen.
Die zimtfarbene Hündin lief unermüdlich auf ihren viel zu großen Pfoten voraus und beschnupperte begeistert jeden Stein und jedes Gestrüpp.
»Wie wirst du sie nennen?«, fragte Amoret, die den Welpen amüsiert beobachtete.
»Bran, nach der Jagdhündin von Fionn Mac Cumhaill, dem mythischen Helden einer alten Gedichtsammlung.«
»Na, hoffentlich erwartest du keine Heldentaten von der Kleinen«, scherzte Amoret.
Der zottelige Welpe war stehen geblieben und schnüffelte geräuschvoll unter einem Ginsterbusch am Wegesrand. Ein paar Mal nieste die Hündin, um die Nase von ablenkenden Gerüchen freizubekommen, dann begann sie leise zu winseln.
»Siehst du, sie macht ihrem Namen bereits Ehre«, meinte Breandán. »Sie muss etwas Interessantes gefunden haben.«
Neugierig beugte er sich über Bran und zog einen Gegenstand unter dem Strauch hervor. Entgeistert starrte Amoret ihn an.
»Eine Harfe?«
Vorsichtig berührte Breandán die Saiten des Instruments. »Sie sind morsch, und das Holz ist vom Regen völlig durchweicht. Die Harfe muss schon eine ganze Weile hier gelegen haben.«
»Aber sicherlich nicht seit der Belagerung der Burg«, erwiderte Amoret zweifelnd. »Dazu ist sie in einem zu guten Zustand.«
»Mag sein. Aber ein paar Monate liegt sie bestimmt schon hier. Ich werde Prendergast fragen, ob es im Dorf einen Barden gibt, der sie verloren haben könnte.«
Lobend tätschelte er der Hündin den schmalen Kopf.
»Gut gemacht, Bran.« An seine Frau gewandt, erklärte er: »Eigentlich jagen irische Wolfshunde auf Sicht. Ihre Nase reicht an die von Bluthunden nicht heran. Aber die Kleine scheint vielfältige Talente zu haben.«
Im Wohnturm ging die Arbeit gut voran. In der Abfallgrube häuften sich Scherben und anderer Unrat. William war gerade dabei, sie mit Erde zuzuschütten. Der unbeschädigte Teil des Gewölbesaals war nicht wiederzuerkennen. Der Boden war gefegt und frisch gewischt. Nur an manchen Stellen fehlten die Holzbohlen und mussten ersetzt werden.
»Ich werde gleich den Schreiner aufsuchen und ihn beauftragen, die Reparaturen durchzuführen«, entschied Breandán kurzerhand. »Komm, Bran«, rief er der Hündin zu. Diese war schnurstracks in eine Ecke des Saales gelaufen und beschnüffelte die frisch geputzten Dielen.
»Na, komm schon, Kleine«, befahl der junge Lord erneut, obwohl er nicht wirklich damit rechnete, dass Bran so rasch lernen würde, ihm zu gehorchen. Schließlich durchquerte Breandán den Saal und packte die Hündin im Genick, um sie von der Stelle fortzuziehen, an der sie schnüffelte. Zu seiner Überraschung wehrte sie sich und begann herzzerreißend zu winseln.
»Denselben Laut hat sie von sich gegeben, als sie die Harfe aufgespürt hat«, sagte Amoret und trat näher.
Jeremy folgte ihr. Vorsichtig setzte er den Fuß auf eine der Bohlen und wippte auf und ab. Das Holz knarrte unter seinem Gewicht.
»Mir ist eben schon aufgefallen, dass die Dielen an dieser Stelle locker sind.«
»Glaubt Ihr, darunter könnte etwas verborgen sein?«, fragte Breandán.
»Eure Hündin scheint davon überzeugt.«
Kaum hatte der Baron Bran losgelassen, als diese entschlossen mit den Krallen an den Bohlen kratzte und dabei laut winselte.
»Habt Ihr ein Werkzeug?«, fragte Breandán in die Runde.
William eilte mit der Hellebarde herbei, die er beim Saubermachen in eine Ecke gestellt hatte, und setzte die Spitze in einer der Fugen zwischen zwei Holzbohlen an. Zu seiner Überraschung ließ sich die Diele leicht anheben. Sie hatte nur locker aufgelegen. Ein muffiger Verwesungsgeruch schlug ihnen entgegen.
»Heilige Jungfrau!«, entfuhr es Amoret. Entsetzt wich sie zurück.
Der Jesuit schlug vor Schreck die Hand vor den Mund.
Mit zusammengepressten Lippen beugte sich Breandán über den Leichnam, der unter den Holzbohlen zum Vorschein kam. Mit energischer Hand hinderte er Bran daran, sich zu nähern, woraufhin die Hündin ein schauriges Jaulen ausstieß. Die Haut des Toten war mumifiziert und spannte sich wie brüchiges gelbes Pergament über das Skelett. Ein Rest der Weichteile am Unterleib und an den Schenkeln war noch erhalten und mit puderigem weißem Schimmel überzogen. Im Bauch der Leiche klaffte ein riesiges Loch.
»Dieser Mann ist keines natürlichen Todes gestorben«, konstatierte Jeremy.
»Glaubt Ihr, er ist bei der Erstürmung der Burg ums Leben gekommen?«, fragte Amoret, deren Hände sich kalt anfühlten. Unbewusst rieb sie die Finger aneinander, um sie zu wärmen.
»Die englischen Soldaten hätten sich bestimmt nicht die Mühe gemacht, ihn unter dem Fußboden zu verstecken«, gab der Priester zu bedenken.
»Nun, das Wichtigste ist, den armen Mann zu bergen«, beschloss Breandán. »Ich unterrichte Prendergast von unserem Fund und beauftrage den Schreiner, einen Sarg zu zimmern.« An William gewandt, fügte er hinzu: »Hängt eine der Türen aus, bettet den Leichnam darauf und tragt ihn nach draußen. Vielleicht erkennt ihn einer der Dorfbewohner.«
Kapitel 3
Mit ernsten, beunruhigten Mienen zogen die Dorfbewohner in langer Reihe an dem auf die Tür gebetteten Leichnam vorbei. Einige bekreuzigten sich. Breandán hatte die Harfe an seine Seite gelegt, denn es bestand die Möglichkeit, dass sie dem Unbekannten gehört hatte. Während sich der Baron mit dem Schreiner Ó Meadhra besprach, beobachtete Jeremy aufmerksam die Gesichter der Anwesenden. Ihre Züge verrieten Misstrauen. Sie mochten sich fragen, ob die Neuankömmlinge einen Verantwortlichen für den Tod des Mannes suchten. Doch als die Blicke der Leute auf den Leichnam und die Harfe fielen, wandelte sich der Ausdruck auf ihren Gesichtern zu Erstaunen und Betroffenheit.
Sie kannten ihn! Davon war der Jesuit überzeugt. Keiner sprach jedoch ein Wort.
Schließlich trat ein großer, breitschultriger Mann in den Fünfzigern mit an den Schläfen ergrautem dunkelbraunem Haar und kantigen Zügen heran. Er blieb vor dem mumifizierten Toten stehen und schüttelte traurig den Kopf. Eine Weile betrachtete er das von Verwesung und Ameisenfraß verwüstete Gesicht mit den über die Zähne zurückgezogenen lederartigen Lippen. Der Schopf weißer, nur leicht vergilbter Haare bewegte sich im sanften Wind. Der Hüne beugte sich vor und hob die Harfe auf.
»Erkennt Ihr sie?«, fragte Jeremy auf Gälisch.
Leuchtend blaue Augen, die Intelligenz und Schalk ausdrückten, richteten sich auf den Priester.
»Ja«, bestätigte der hochgewachsene Mann mit einem Blick auf die Harfe. »Sie gehörte Cormac Bán Ó Riordáin.«
Bán, der Weißhaarige, dachte Jeremy. Wie passend.
»Könnte es sich bei dem Toten um Ó Riordáin handeln?«
»Obwohl seine Züge nicht mehr zu erkennen sind, denke ich, dass er es ist.«
»Er war Barde?«, fragte der Jesuit.
Der breitschultrige Mann nickte. »Soweit ich weiß, stammte Ó Riordáin aus der Grafschaft Cork. Hin und wieder kam er auf seiner Wanderschaft hier durch und trug in den Herrenhäusern Gedichte vor.«
»Verstehe«, entgegnete Jeremy. »Verzeihung, ich sollte mich wohl vorstellen. Mein Name ist Fauconer.« Der Jesuit hatte sich entschieden, den Decknamen, den er als Priester in England trug, um seine Familie vor Repressalien zu schützen, auch in Irland beizubehalten.
»Muiredach Ard Ó Donnabháin, zu Euren Diensten, Pater.«
»Ihr führt die kleine Herberge am Rande des Dorfes.«
»So ist es. Und ich unterrichte die Kinder.«
Anerkennung blitzte in den grauen Augen des Jesuiten auf. »Ist das nicht Aufgabe des Priesters?«
»Pater Ó Néill ist nicht in dieser Pfarre ansässig. Er reitet von Dorf zu Dorf und hat daher nicht die Zeit, sich um die Bildung der Kleinen zu kümmern.« In der Stimme des Wirts schwang ein leicht abfälliger Ton mit.
Jeremy fragte sich, was sich der Priester wohl hatte zuschulden kommen lassen.
In diesem Augenblick trat Breandán, der sein Gespräch mit dem Schreiner beendet hatte, zu der Leiche.
»Wir wissen nun, um wen es sich bei dem Toten handelt«, erklärte der Jesuit. »Die Harfe gehörte einem gewissen Cormac Bán Ó Riordáin, einem Barden.«
Breandán musterte den Herbergswirt interessiert.
»Ihr kanntet ihn gut?«, fragte er.
»Wir verkehrten seit vielen Jahren miteinander«, berichtigte Muiredach Ard Ó Donnabháin. »Aber ich könnte nicht behaupten, dass ich ihn gut kannte.«
Ein Philosoph, dachte Jeremy. Und jemand, der um Aufrichtigkeit bemüht ist. Der Hüne faszinierte ihn zunehmend. Bei Gelegenheit würde er sich einmal in Ruhe mit ihm unterhalten.
»Habt Ihr eine Ahnung, wann Ó Riordáin hier im Dorf war?«, erkundigte sich Breandán.
»Das ist über ein Jahr her«, antwortete der Wirt.
»Hm, ich glaube nicht, dass er schon so lange tot ist«, widersprach Jeremy und strich sich mit der Hand über das Kinn. »Die Mumifizierung spricht zwar dafür, aber am Oberkörper und an den Schenkeln hat sich noch genug Fleisch erhalten, dass sein Ableben nicht länger als ein paar Monate zurückliegen kann.«
»Wenn er im Laufe des Sommers hier durchkam, so hat er nicht in meiner Herberge haltgemacht«, entgegnete Muiredach Ard.
»Dann habt Ihr wohl auch keinen Verdacht, wer den Barden ermordet haben könnte und weshalb man seinen Leichnam in der Burg versteckte?«
Dass er unter dem Fußboden im Gewölbesaal verborgen wurde, könnte auf einen der Dorfbewohner als Mörder hinweisen, fügte Jeremy in Gedanken hinzu, sprach seine Überlegung aber nicht aus.
»Überhaupt keinen«, erwiderte der Hüne. »Ihr müsst wissen, dass die Barden arme Leute sind, die wie die Fahrenden alles bei sich tragen, was sie besitzen, und das ist gewöhnlich nicht mehr als die Kleider, die sie am Leibe haben, und eine Harfe, mit der sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Jeder Ire weiß, dass es sich nicht lohnt, sie zu berauben.«
»Aber er müsste doch zumindest einen Beutel für das Geld, das er sich mit seinen Liedern verdient hat, bei sich haben. Wir fanden aber keinen.«
»Ihr habt recht. Das ist merkwürdig. Aber wer bringt jemanden für ein paar Münzen um und versteckt dann die Leiche?«
»Eine gute Frage …« Jeremy spürte, wie ihm der Blick des Wirts unter die Haut drang.
»Wie es scheint, interessiert Euch die Antwort tatsächlich.« In Ó Donnabháins Stimme schwang unverhohlene Neugier.
»Ein ungelöstes Rätsel lässt mich nicht ruhen«, antwortete der Priester. »Das war schon immer so.«
»Dann habt Ihr wohl schon einige gelöst.«
»Ja, einige …«
»Hoffen wir, dass Ihr auch in diesem Fall Erfolg habt«, meinte der Herbergswirt. Sein Blick kehrte zu der Leiche zurück. »Wie ist er gestorben?«
»Man hat ihn mit einer breiten Klinge durchbohrt, vermutlich einer Hellebarde«, erläuterte Jeremy, der den Toten einer genauen Untersuchung unterzogen hatte. »Außerdem hatte er eine Bleikugel in der Schulter. Jemand hat von hinten auf ihn geschossen.«
Das Entsetzen, das über die kantigen Züge glitt, schien aufrichtig. »Welch ein schrecklicher Tod«, murmelte Muiredach Ard betroffen.
»Wisst Ihr, ob es hier einen Leichenbeschauer gibt, dem der Mord gemeldet werden muss?«, fragte Breandán.
Der Wirt schüttelte den Kopf. »Der Leichenbeschauer ist kürzlich verstorben. Ich habe keine Ahnung, ob bereits ein neuer gewählt wurde. Am besten wendet Ihr Euch an den Friedensrichter des Bezirks.«
»Und wer bekleidet dieses Amt?«
»Euer Nachbar Captain Luscombe.«
Am Abend saß Amoret fröstelnd vor dem Kamin in der Offizierskammer. Der Schornstein zog nicht gut, und der in den Raum dringende Rauch reizte sie zum Husten. Breandán löschte das Feuer mit einem Schwall Wasser und schmiegte sich an seine Frau, um sie zu wärmen.
»Wir werden uns unter den Decken zusammenkuscheln müssen«, sagte er. Dann fügte er zerknirscht hinzu: »Es tut mir leid. Ich habe mir unser Leben hier anders vorgestellt.«
Amoret antwortete nicht. Ihr war nicht nur die klamme Kälte innerhalb der nackten Steinmauern unter die Haut gekrochen. Sie dachte an den ermordeten Barden, der in der Kapelle im Eckturm nebenan auf einem Tisch lag, bis der Schreiner einen Sarg gezimmert hatte. Erst als sie die Muße fand, über seinen Tod nachzudenken, wurde ihr klar, dass vielleicht in ihrer unmittelbaren Nähe ein Mörder lebte. Was würde geschehen, wenn sie Nachforschungen über Ó Riordáins Tod anstellten? Wie gefährlich der Unbekannte war, bewies die grausame Wunde im Körper des Barden. Machten sie sich nicht zur Zielscheibe, wenn sie den Mord aufzuklären versuchten? Es lag nicht in ihrer Verantwortung, dem Opfer dieses furchtbaren Verbrechens Gerechtigkeit zu verschaffen. Sie mussten nur seinen Tod melden und könnten den Rest den Verwandten des Ermordeten überlassen, sofern es welche gab. Aber konnte man einen Mörder in ihrer Mitte einfach so unbehelligt lassen? War es nicht wahrscheinlich, dass er wieder töten würde, vielleicht aus einem nichtigen Anlass?
Amoret erbebte.
»Du fröstelst«, stellte Breandán fest. »Trink einen Schluck Whiskey, und dann gehen wir zu Bett. Morgen müssen wir unseren Nachbarn aufsuchen.«
Eamonn Prendergast hatte ihnen eine Flasche zukommen lassen. Breandán goss einige Schlucke in einen aus Leder gefertigten Becher und ließ seine Frau trinken, bevor er das Gefäß an den Jesuiten und die Zofe weiterreichte. Der Alkohol wärmte von innen. Dennoch hielten Amorets Gedanken sie noch lange wach, als die anderen längst eingeschlafen waren.
Am nächsten Tag machten sich Breandán und Amoret, begleitet von William und Gerald, zu Pferd auf nach Kilcommon, dem Wohnsitz von Ralph Luscombe. Den Weg hatten sie sich von Eamonn beschreiben lassen.
Es war ein frischer, trockener Septembermorgen. Die Sonne ließ das dunkelgrüne Laub der Bäume auf den Kuppen der umliegenden Berge smaragdfarben aufleuchten, und ihre Strahlen glitzerten auf der unruhigen Wasseroberfläche des kleinen Flüsschens, an dem sie entlangritten. Geblendet betrachtete Amoret die üppige Szenerie. Sie verliebte sich immer mehr in dieses einzigartige, mysteriöse Land. Würde sie es eines Tages als ihre Heimat bezeichnen können? Noch fühlte sie sich fremd, wie eine Außenseiterin, abgelehnt von den Menschen und dem unsichtbaren Volk, den Elfen, die angeblich jeden Baum, jeden Strom, jeden Flecken Erde bewohnten.
In der Ferne kamen bald Häuser in Sicht. Die Reiter durchquerten ein Dorf, an dessen Rand sich eine kleine Herberge befand. Auch hier verfolgten die Bewohner die Fremden mit misstrauischen und zum Teil feindseligen Blicken. Getreidefelder wogten goldgelb im leichten Wind: Weizen, Roggen und Hafer, wie Amoret bemerkte. Die Ernte war in vollem Gange. Man musste sich sputen, bevor der nächste Regen einsetzte.
Kurz darauf tauchte der Landsitz des englischen Captain vor ihnen auf. Er bestand aus einem aus Stein gebauten viereckigen Turm und einem neueren Gebäude nebenan, das kaum älter als zehn Jahre zu sein schien. Offenbar hatte Luscombe das Turmhaus als zu unbequem für seine Familie empfunden. Der Neubau war zweistöckig und der Mode entsprechend mit hohen Fenstern ausgestattet, die viel Licht in die Räume ließen.
Als Breandán, Amoret und ihre Diener vor dem Wohnhaus anhielten, eilten sogleich Stallknechte heran, die sich ihrer Pferde annahmen. Der Baron Shanrahan führte seinen Rappen jedoch selbst in den Stall. Ein Mann in Livree trat aus dem Hauseingang. Der junge Lord stellte sich vor und bat, den Captain zu sprechen. Daraufhin verbeugte sich der Lakai und ging ihnen voraus. Die Diener blieben draußen zurück.
Die Eingangshalle war düster. Einige alte Eichenmöbel und Waffen zierten sie. Zur Rechten führte eine Tür in den Salon. Dieser war mit leichteren Möbeln aus Walnussholz eingerichtet, die unzweifelhaft aus England stammten. An den Wänden hingen Familienporträts und mehrere Stiche. Einer davon stellte Oliver Cromwell dar. Die Morgensonne fiel durch die großen Fenster herein und erhellte den ganzen Raum. Vermutlich verbrachte die Familie hier die Vormittage, um das Licht auszunutzen.
Die Besucher hatten kaum Zeit, sich umzuschauen, als der Hausherr erschien. Er war ein mittelgroßer, kräftiger Mann in den Vierzigern mit schulterlangem hellbraunem Haar. Sein Wams und die Kniehosen entsprachen nicht der neuesten Mode, hinkten dieser jedoch nur etwa fünf Jahre hinterher. Vermutlich hatte Captain Luscombe zu jener Zeit das letzte Mal Dublin oder London aufgesucht, um sich einzukleiden. Alles in allem entsprach er ganz und gar nicht dem Bild eines sittenstrengen Puritaners.