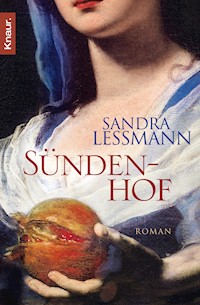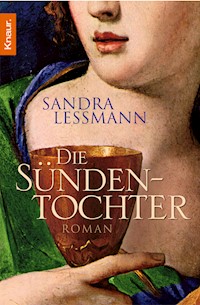3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Fans der Serienhits »Die Tudors« und »Reign«: Eine junge Mutter, die in gefährliche Machtspiele verstrickt wird. England im 16. Jahrhundert. Seit ihrer waghalsigen Flucht vor einem Urteil der englischen Krone verspürt Marianna nur einen einzigen brennenden Wunsch: Ihren kleinen Sohn, den sie zurücklassen musste, endlich wieder in die Arme zu schließen. Doch dafür will man sie zur Spionin von Elizabeth I. machen. Wenn sie ihr Kind jemals wiedersehen will, muss sie den berüchtigten »Greifen« aufspüren, der als Meister der Spionage gilt. Schon bald ist Marianna in einem gefährlichen Spiel gefangen, in dem sie nicht mehr weiß, wer noch Freund oder vielleicht längst schon ihr Feind ist … »Die Romane von Sandra Lessmann sind immer wieder ein Erlebnis, das einen stundenlang gefangen nimmt und einen die Welt um sich herum vergessen lässt.« www.literaturmarkt.info
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
England im 16. Jahrhundert. Seit ihrer waghalsigen Flucht vor einem Urteil der englischen Krone verspürt Marianna nur einen einzigen brennenden Wunsch: Ihren kleinen Sohn, den sie zurücklassen musste, endlich wieder in die Arme zu schließen. Doch dafür will man sie zur Spionin von Elizabeth I. machen. Wenn sie ihr Kind jemals wiedersehen will, muss sie den berüchtigten »Greifen« aufspüren, der als Meister der Spionage gilt. Schon bald ist Marianna in einem gefährlichen Spiel gefangen, in dem sie nicht mehr weiß, wer noch Freund oder vielleicht längst schon ihr Feind ist …
Über die Autorin:
Sandra Lessmann, geboren 1969, lebte nach ihrem Schulabschluss fünf Jahre in London. Zurück in Deutschland studierte sie in Düsseldorf Geschichte, Anglistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Institut für Geschichte der Medizin; ein Thema, dass sie ebenso wie ihre Englandliebe in ihre historischen Romane einfließen ließ.
Sandra Lessmann veröffentlichte bei dotbooks auch ihren historischen Roman »Die Kurtisane des Teufels« sowie ihre historische Krimireihe um »Pater Jeremy«.
Die Website der Autorin: www.sandra-lessmann.de
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Dieses Buch erschien bereits 2007 unter dem Titel »Das Jungfrauenspiel« bei Droemer
Copyright © der Originalausgabe 2007 Droemer Verlag. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/StockNick, Vladimir Mulder, Master 1305
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-203-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandra Lessmann
Die Spionin der Krone
Roman
dotbooks.
Erstes Kapitel
November 1583
Der kleine Segler wiegte sich gemächlich im leichten Wellengang des Hafens von Calais. Ein starker Geruch nach Fisch, Tang und Salz lag in der Luft. Das Geschrei der Möwen, die auf der Suche nach Abfällen tief über das Wasser glitten, verband sich mit den rauhen Stimmen der Seeleute. Es herrschte rege Betriebsamkeit. Fässer wurden über das steinerne Pflaster gerollt, Kisten und Bündel zu wartenden Booten geschleppt.
Roger Ashton nahm die Hände seiner Gemahlin und drückte sie herzlich.
»Seid Ihr sicher, dass Ihr diese gefährliche Reise auf Euch nehmen wollt, meine Liebe? Noch ist Zeit, Eure Meinung zu ändern.« Marianna Ashtons grüne Augen hoben sich zu dem Gesicht ihres Mannes. Entschieden schüttelte sie den Kopf.
»Bitte versteht doch! Von dem Moment an, als sie mir Nathaniel weggenommen haben, suche ich nach einem Weg, ihn zurückzubekommen. Ich will nicht, dass er eines Tages seine Mutter vergisst. Ich bin Euch ins Exil gefolgt, weil ich glaubte, Ihr wüsstet Rat.« Er senkte die Lider. »Es tut mir leid. Wenn ich geahnt hätte, dass man Euch Nat fortnehmen und ihn in die Obhut meines Vetters geben würde, hätte ich euch früher zu mir geholt.«
»Ich gebe Euch keine Schuld. Aber ich muss einen Versuch unternehmen, Nat aus England herauszubringen. Auch wenn er nicht – «
Ashton unterbrach sie. »Schon gut, Ihr braucht nichts weiter zu sagen. Ihr wisst doch, dass ich Euch längst vergeben habe. Trotzdem habe ich Angst um Euch. Walsinghams Spitzel sind überall. Wenn man Euch erkennen sollte ...«
Beschwichtigend legte Marianna die Hand auf den Arm ihres Gatten.
»Ich habe doch einen Pass auf einen anderen Namen. Niemand rechnet damit, dass ich nach England zurückkehre.«
»Es wäre meine Pflicht als Euer Herr und Beschützer, Euch auf dieser Reise zu begleiten.«
»Nein! Ihr wisst sehr gut, dass es unvernünftig wäre. Wenn man Euch in England aufgreift, wird man Euch wegen Hochverrats hinrichten. Mir als Frau werden sie dagegen nichts tun. Wünscht mir Glück, mein Gemahl.«
»Ich werde hier in Calais auf Eure Rückkehr warten. Möge Gott Euch schützen!«
Nur widerwillig ließ Roger Ashton die Hände seiner Gemahlin los und wandte sich an den Diener, der mit einem Bündel über der Schulter hinter ihr stand.
»Christopher, achte gut auf deine Herrin! Ich vertraue dir ihre Sicherheit an. Enttäusche mich nicht!«
Der große, kräftig gebaute, junge Mann neigte leicht den Kopf. »Ja, Sir!«
Christopher war sich der Verantwortung wohl bewusst. Er diente seinem Herrn bereits von Kindheit an und verehrte dessen Gemahlin.
Marianna Ashton wandte sich ohne ein weiteres Wort von ihrem Gatten ab, winkte ihrer Magd Judith und ließ sich von dem Diener an Bord helfen. Der Segler würde sie und einige andere Passagiere zu dem Postschiff bringen, das in tieferem Gewässer vor Anker lag. Roger Ashton blieb noch lange auf der Mole stehen und beobachtete, wie das Schiff die Segel setzte, den Anker lichtete und langsam den Hafen verließ. Erst als es nur noch ein heller Fleck am Horizont war, riss er sich von dem Anblick los und suchte eine der Kirchen der kleinen Stadt auf, um für Mariannas sichere Rückkehr zu beten.
Als Ashton das Gotteshaus verließ, begann es bereits zu dunkeln. Vom Meer her wehte ein kalter Wind, der durch den dicken Wollstoff seines Umhangs drang und ihn trotz der reichlich vorhandenen Fettpolster erzittern ließ. Seine Gedanken wanderten wieder zu seiner Frau und ihrem Vorhaben. Erneut durchlief ihn ein Schauer, für den nicht die Kälte verantwortlich war. Vielleicht hätte er energischer versuchen sollen, sie davon abzuhalten. Aber Marianna hatte von jeher einen Dickkopf besessen, gegen den anzukämpfen ihm oftmals zu mühsam gewesen war. Aus Bequemlichkeit hatte er ihr zu viel durchgehen lassen. Andererseits war sie dank ihrer Entschlossenheit auch ohne ihren Gatten zurechtgekommen, als dieser nach der Rebellion der nordenglischen Grafen ins Exil gegangen war. So jung Marianna damals gewesen war, sie hatte sich in ihrer nicht gerade beneidenswerten Lage als Frau eines Hochverräters behauptet und sich von den Vertretern des Staates, die sie schikaniert hatten, nicht einschüchtern lassen. Ashton hätte es ihr nicht übelgenommen, wenn sie ihren Gatten für die verzweifelte Lage, in die er sie gebracht hatte, von ganzem Herzen gehasst hätte. Zu seinem Erstaunen tat sie es nicht, hatte es nie getan. Es mochte keine Liebe zwischen ihnen gegeben haben – das hatte er bei dem erheblichen Altersunterschied auch nicht erwartet –, doch sie hatten einander mit Achtung und Verständnis behandelt. Die wenige Zeit, die Roger Ashton während seiner vierzehnjährigen Ehe mit seiner Gemahlin verbracht hatte, war das Beste, was ihm je passiert war. So war es ihm nicht schwergefallen, über Mariannas wenige Fehltritte hinwegzusehen. Er gab sich selbst die Schuld. Schließlich hatte er sie im Stich gelassen, um sich einer von vornherein zum Scheitern verurteilten Rebellion gegen die Königin von England und ihre Minister anzuschließen. Nun war es Marianna, die sich in ein gefährliches Vorhaben stürzte, und er brachte es nicht übers Herz, sie zurückzuhalten. Eine heimliche Reise nach England erforderte allerdings eine sorgfältige Planung. Die englischen Hafenstädte wimmelten von Spitzeln, denn die mächtigen Männer am Hof Elizabeths lebten in ständiger Angst vor Verschwörungen gegen ihre Königin. Roger Ashton selbst hätte es nicht wagen können, die Insel zu betreten, ohne Verhaftung, Kerker und eine barbarische Hinrichtung zu riskieren. Seine Gattin dagegen würde kaum Verdacht erregen. Mit einem gefälschten Pass ausgestattet, den sie von einem im Exil lebenden Engländer erstanden hatten, konnte sie sich sicher fühlen. Nun blieb Ashton nichts anderes übrig, als zu warten und zu beten. Tief in Gedanken versunken ging er durch die schlecht beleuchteten Gassen des Küstenstädtchens. Die Geräusche des Hafens hinter ihm wurden vom Wind verweht, der einen Geschmack von Salz auf den Lippen zurückließ. Die Gasse, die zu der Herberge führte, in der er wohnte, stieg ein wenig an, und die leichte Anstrengung nahm ihm bereits den Atem. Ein Gefühl von Enge zog sich um seine Brust und strahlte in seinen linken Arm aus. Er musste stehen bleiben, um Luft zu schöpfen. Das Alter!, dachte er zerknirscht. Dabei hatte er gerade erst sein fünfzigstes Jahr vollendet. Vielleicht war es aber auch seine Schwäche für gutes Essen. Marianna hatte ihn stets wegen seines kräftigen Appetits geneckt. Nun rächte sich die sündige Völlerei. Er musste in Zukunft wohl oder übel kürzertreten!
Ashtons rasselnder Atem übertönte die Schritte der drei Männer, die sich ihm von hinten näherten. Er hörte sie nicht kommen. Plötzlich wurde er an beiden Armen gepackt und gegen eine Hauswand geschleudert. Ashtons Hand tastete nach dem Griff seines Degens. Es gelang ihm noch, die Waffe halb aus der Scheide zu ziehen, als ein Fausthieb in den Magen seine Gegenwehr im Keim erstickte. Röchelnd krümmte er sich zusammen und schnappte nach Luft. Sein Herz raste. Seine Arme wurden auf seinen Rücken gezwungen, ein Seil schnitt in das Fleisch seiner Handgelenke und schnürte sie zusammen. Nun war er völlig wehrlos. Mit schreckgeweiteten Augen nahm er die Gesichter der drei Männer in sich auf, die ihn umstanden. Eines von ihnen gehörte dem Exilanten, der den Pass für Marianna gefälscht hatte.
»Was wollt Ihr von mir?«, stieß Ashton hervor, obwohl er die Antwort bereits kannte. Sie waren einem englischen Spion auf den Leim gegangen!
Wortlos starrten die Männer ihren Gefangenen an.
»Ich bitte Euch, lasst mich gehen!«, flehte Ashton.
Einer der Männer stopfte ihm einen schmutzigen Lappen in den Mund, ein anderer holte einen Leinensack hervor und zog ihn dem vor Angst bebenden Gefangenen über den Kopf, damit er nicht sah, wohin man ihn brachte. Roger Ashton wusste es auch so. Allem Anschein nach war er dazu verdammt, in die Fußstapfen Dr. John Storys zu treten, der im Auftrag William Cecils, Lord Burghley, entführt und in England hingerichtet worden war. Und die ahnungslose Marianna lief in eine Falle!
Zweites Kapitel
Der Regen prasselte gegen die Glasrauten des Fensters. Gedankenverloren zeichnete Marianna die Bleiruten, die die Scheiben zusammenhielten, mit der Fingerspitze nach. Der Schemel, auf dem sie saß, war wie der Rest der spärlichen Einrichtung von langem Gebrauch abgenutzt, der Boden von zweifelhafter Sauberkeit und das Laken des Bettes grau und fleckig. Marianna störte sich nicht daran. Sie hatte die Herberge am Rande von Dover aufgrund ihrer Abgeschiedenheit gewählt, Reinlichkeit und Güte des Essens waren zweitrangig. Hier stiegen weitaus weniger Durchreisende ab als in dem Küstenstädtchen selbst, allerdings erschienen ihr einige der Gäste etwas anrüchig, so dass Marianna oder ihre Magd nur selten die Kammer verließen, in die sie sich eingemietet hatten. Sie lag im zweiten Stock des Fachwerkhauses und war über eine den Innenhof überschauende Galerie erreichbar.
Marianna war in Gedanken bei ihrem Diener. Während sie mit Judith in der Nähe von Dover zurückgeblieben war, hatte sich Christopher allein zum Anwesen Hugh Simpsons, dem Vetter ihres Gatten, begeben. Seine Herrin hatte ihm genug Geld mitgegeben, um einen Knecht oder eine Magd zu bestechen und so in Nathaniels Nähe zu gelangen. Wenn Christopher dem Knaben erklärte, dass seine Mutter ihn geschickt habe, würde dieser ihm sicher folgen, und sie würden beide auf dem schnellsten Weg nach Dover zurückkehren. In ein paar Tagen konnten sie alle bereits wieder auf einem Schiff nach Frankreich sein. Marianna betete für ein gutes Gelingen des gefährlichen Vorhabens.
Der Regen hatte nachgelassen. Auf dem Pflaster des Innenhofs erklang der Hufschlag mehrerer Pferde. Trotz der späten Stunde war offenbar noch eine Reisegruppe eingetroffen. Neugierig erhob sich Marianna, öffnete die Kammertür und trat auf die im Dunkeln liegende Galerie hinaus. Judith tat es ihr nach. Unten im Hof stiegen im Schein der Pechfackeln fünf Männer aus den Sätteln ihrer Pferde. Drei von ihnen waren, ihrer Kleidung nach zu urteilen, Gentlemen, die von zwei Dienern begleitet wurden. Pferdeknechte eilten pflichteifrig herbei, um die Tiere in Empfang zu nehmen, die infolge des Regens in ebenso traurigem Zustand waren wie ihre Reiter. Dennoch war die Laune der Männer ungetrübt, sie lachten und riefen sich grobe Scherze zu. Der Gastwirt bat sie mit einladender Geste in den Schankraum, damit sie sich vor dem Kaminfeuer aufwärmen konnten. Bald kehrte wieder Ruhe auf dem Innenhof der Herberge ein.
Mit einem besorgten Stirnrunzeln zog sich Marianna, gefolgt von Judith, in ihre Kammer zurück. Je mehr Leute sich in der Absteige einfanden, umso größer war die Gefahr, dass sie erkannt wurde. Es war sicherer für sie, wenn sie in dem kleinen Zimmer blieb, so unangenehm dies auch sein mochte.
»Judith, hilf mir aus den Kleidern. Wir gehen früh zu Bett.« Noch während sie sprach, löste Marianna den bestickten Gürtel, an dem eine leinene Tasche hing, von ihrer Taille und reichte sie der Magd. Judith legte den Beutel auf dem Tisch ab, und ihre Herrin streckte ihr die Hände entgegen, damit die Magd die Nadeln aus den Manschetten ziehen konnte, mit denen diese an den wattierten Ärmeln befestigt waren. Die Ärmel wiederum waren durch Schnürbänder mit dem oberen Gewand verbunden, das in der Taille zusammengesteckt war. Darunter kam das Unterkleid aus rostbrauner Wolle zum Vorschein, das aus einem Mieder und einem gefütterten Rock bestand. Beides war von bürgerlicher Einfachheit und sollte verhindern, dass man der Trägerin zu viel Aufmerksamkeit schenkte.
Nach dem Unterkleid fielen die leinenen Unterröcke und das eng geschnürte, mit Fischbein verstärkte Korsett, bis Marianna schließlich nur noch mit Hemd und Wollstrümpfen bekleidet dastand. Sie setzte sich auf den Schemel, damit Judith ihr die Leinenhaube abnehmen und ihr Haar lösen konnte. Vorsichtig entwirrte die Magd die kupferroten Locken mit einem Kamm.
»Ich werde Euch Wasser zum Waschen holen, Madam.« »Gut, aber komm gleich zurück«, mahnte Marianna.
Judith war ein junges Mädchen, das noch wenig von der Welt wusste und Fremden allzu leicht vertraute. Ihre Herrin ließ sie nur ungern aus den Augen, fühlte sie sich doch für sie verantwortlich.
In der Ferne schrie ein Nachtvogel. Ungeduldig erhob sich Marianna vom Bett und strich sich mit der Hand durchs Haar. Es war kalt in der Kammer, und während sie wartete, begann sie zu frösteln. Die Magd musste nur die Treppe zum Innenhof hinabsteigen und den Krug am Brunnen füllen. Weshalb brauchte sie so lange? Hatte sie sich etwa trotz des Verbots ihrer Herrin in ein Gespräch mit einem der Stallburschen verwickeln lassen? Marianna seufzte tief. Sie musste Judith unbedingt noch einmal streng ins Gebet nehmen!
Die Tür wurde aufgestoßen und krachte gegen die Holzwand der Kammer. Kalte Luft wehte herein und ließ Marianna erschaudern. Zwei Männer tauchten im Türrahmen auf und traten mit schweren, drohenden Schritten über die Schwelle. Die junge Frau war vor Schreck wie gelähmt.
»Mistress Ashton!«
Es war eine Feststellung, keine Frage.
Beide Männer boten eine düstere, ungepflegte Erscheinung sowohl in ihrem Äußeren wie in ihrer Kleidung. Doch der Schein trog. Die Tatsache, dass sie ihren Namen kannten, bewies, dass es sich keineswegs um gemeine Straßenräuber handelte, sondern um Handlanger der Regierung. Offenbar hatte man sie aber aus dem Gesindel der Unterwelt rekrutiert. Panik überflutete Marianna.
Wie war das möglich? Wie hatte man sie aufgespürt? Und dann noch so schnell? Natürlich hatte sie die Möglichkeit in Betracht gezogen und sich darauf vorzubereiten versucht. Doch die plötzliche Konfrontation und die Selbstsicherheit der Männer brachten sie völlig aus der Fassung.
»Mein Name ist nicht Ashton ...«, stammelte sie, darum bemüht, ihrer Stimme Festigkeit zu verleihen. Es misslang ihr kläglich.
»Gebt Euch keine Mühe! Wir wissen genau, wer Ihr seid.«
Der vordere Mann trat auf sie zu, während der andere begann, sich in der Kammer umzusehen. Marianna wich vor dem Eindringling zurück und presste sich gegen die Wand hinter ihr. Ihr Blick glitt unauffällig zur Tür, die halb offenstand. Sie dachte nur noch an Flucht.
Der Mann blieb vor ihr stehen und musterte sie von oben bis unten. Seine Augen waren kalt, und sein Atem roch nach Wein. Ein farbloser, kümmerlicher Bart spross auf Wangen und Kinn. Unter seinem durchdringenden Blick wurde sich Marianna bewusst, dass sie nichts weiter als ihr Hemd trug, das ihren Körper kaum verhüllte, und sie fühlte sich nackt und wehrlos. Der Bärtige schien denselben Gedanken zu haben. Ein raubtiergleiches Lächeln teilte seine Lippen und entblößte zwei Reihen schadhafter Zähne.
»Hat man dir nicht gesagt, wie gefährlich es für eine Frau ist, allein zu reisen?«
Der jähe Wechsel zum vertraulichen Du ließ Marianna das Schlimmste befürchten. Von diesem Strolch durfte sie keinen Respekt erwarten. Im nächsten Moment packte er mit der Hand roh ihre Brust und presste sie so fest, dass Marianna vor Schmerz aufstöhnte. Er lachte, raffte mit der anderen Hand ihr Hemd und griff grob an ihre Scham. Doch im nächsten Moment krümmte er sich fluchend zusammen und taumelte durch die Kammer. In einem Reflex hatte Marianna ihm das Knie so kräftig zwischen die Beine gerammt, dass er nur noch Sterne sah.
Ehe sein Begleiter reagieren konnte, huschte ihr Opfer zur Tür hinaus und rannte die Galerie entlang zur Treppe, die in den Hof hinabführte. Ihre nur mit Strümpfen bekleideten Füße klatschten dumpf auf das nasse Pflaster, als sie ihn überquerte. Wohin sollte sie fliehen? Ihr Kopf war leer. Sie vermochte keinen klaren Gedanken zu fassen. Wie eine Motte, die blind dem Licht folgt, hielt sie auf die erleuchteten Fenster des Schankraums zu, aus dem Männerstimmen an ihr Ohr drangen. Die Reisenden, die vor kurzem angekommen waren! Aber würden sie ihr helfen? Sie hatte keine andere Wahl, als es zu versuchen!
Mit zitternden Händen riss Marianna die Tür auf und warf sich, mit wehendem Hemd und schlammbespritzt, zwischen die drei Gentlemen, die erstaunt mitten im Gespräch verstummten. Atemlos, wie sie war, brachte sie keinen Ton heraus. Eine Hand packte sie am Arm und zog sie an einen in Samt gekleideten Körper.
»Was haben wir denn hier?«, grölte eine nicht mehr allzu sichere Männerstimme. »Da fällt mir doch ein hübsches Vögelchen direkt in den Schoß!«
Marianna versuchte, sich aus der Umarmung zu winden, in der sie sich unvermutet wiederfand, als eine ebenfalls vom Wein beeinträchtigte Stimme hinter ihr sagte: »Lass sie los, Tom. Siehst du nicht, dass sich das arme Ding in Not befindet!«
Tatsächlich lockerte sich der Griff des jungen Mannes, der sie hielt, und Marianna machte sich energisch los.
»Wie könnt Ihr es wagen, Sir!«
Sie starrte ihm erbost ins Gesicht, das ihr mit einem Mal bekannt vorkam. Ihrem Gegenüber schien es ebenso zu gehen, denn seine Augenbrauen zogen sich ungläubig zusammen, während er sie eingehend musterte.
»Marianna Percy? Ist das möglich?« Seine Verwunderung machte einem breiten Lächeln Platz. »Erinnerst du dich nicht an mich, liebste Base? Ich bin’s! Dein Vetter Tom ... Thomas Fleetwood.«
Marianna blieb keine Zeit mehr, die Begrüßung zu erwidern. Erneut wurde die Tür zur Schankstube aufgestoßen, und die beiden Strolche stürmten herein.
Die junge Frau sah ihren Vetter flehentlich an. »Hilf mir! Sie haben mich überfallen!«
Tom Fleetwood zögerte nicht, der Bitte nachzukommen.
»Jimmy, pass auf sie auf!«
Er schob seine Base dem Mann in die Arme, der ihn zuvor zur Ordnung gerufen hatte, und stellte sich den Eindringlingen mit gezogenem Degen entgegen. Der dritte junge Mann kam ihm unaufgefordert zu Hilfe.
»Bleibt hinter mir, Madam«, sagte der mit Jimmy Angesprochene, während er kampfbereit die Hand auf den Griff seines Rapiers legte. Es war ein kurzes Gefecht. Die beiden Halunken waren von der Gegenwehr der jungen Herbergsgäste völlig überrascht. Auch sie zogen ihre Degen und mussten unversehens um ihr Leben kämpfen. Unter den entsetzten Blicken des Gastwirts traf Tom Fleetwood einen von ihnen in den Bauch, woraufhin der andere seinen verletzten Kumpanen am Arm packte und mit ihm das Weite suchte.
Marianna überkam eine solche Erleichterung, dass sie spürte, wie ihre Beine unter ihr nachgaben. Sie taumelte und tastete nach einem Halt, als sich zwei warme Hände um ihre Arme legten und sie aufrecht hielten.
»Setzt Euch lieber, Madam«, ließ sich die Stimme des Mannes vernehmen, der sich vor sie gestellt hatte. Sie hob den Blick und sah ihn an. Er war mehr als einen Kopf größer als sie und sehr schlank, man konnte fast sagen, hager. Sein dunkelbraunes Haar war kurz geschnitten und gepflegt, sein Gesicht schmal und bleich. Entgegen der herrschenden Mode war es glattrasiert, was ihn jünger erscheinen ließ als seine Freunde, die beide elegante Schnurr- und Spitzbärte trugen. Sein Lächeln war mitfühlend und übte eine beruhigende Wirkung auf sie aus.
»Ihr zittert ja«, sagte er sanft und schob sie in Richtung des Kamins, da sich ihre Füße nicht vom Fleck bewegen wollten. Marianna ließ sich auf eine Bank dirigieren, die vor dem prasselnden Holzfeuer stand. Ihre Erstarrung begann sich zu lösen, und das leichte Beben, das ihren Körper erfasst hatte, ließ langsam nach.
»Fühlt Ihr Euch ein wenig besser, Madam?« Ihr Beschützer setzte sich neben sie auf die Bank. »Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein Name ist James Danvers, aber meine Freunde nennen mich Jimmy.«
»Ich danke Euch für Euren Beistand, Master Danvers.«
Marianna rang sich ein Lächeln ab, während sie ihm in die Augen sah, deren Farbe zwischen Grün und Braun schwankte. Als er sich bewusst wurde, dass er sie anstarrte, wandte er verlegen den Blick ab.
Nachdem er den Gastwirt mit ein paar Münzen beruhigt hatte, trat Tom zu ihnen.
»Wer waren diese Kerle, Marianna?«
»Ich weiß nicht. Sie stürmten ohne Vorwarnung in meine Kammer und belästigten mich.«
»Ich erinnere mich, dass sie hier im Schankraum saßen, als wir ankamen«, warf Jimmy Danvers ein. »Dann gingen sie vor die Tür. Da hatte ich schon den Eindruck, dass sie etwas im Schilde führten.«
»Bist du allein hier?«, fragte Tom. »Wo ist Roger?«
Marianna wich dem Blick ihres Vetters aus. »Das ist eine lange Geschichte. Roger ist in Frankreich geblieben, da er es für zu gefährlich hielt, nach England zu kommen. Ich reise allein mit einer Magd und einem Diener.«
»Und weshalb hat dich dein Diener nicht verteidigt?«
»Er ist nicht hier. Ich habe ihn mit einem Auftrag fortgeschickt. Wie ich schon sagte, es ist eine lange Geschichte. Ich erzähle dir alles später. Im Augenblick mache ich mir ernsthafte Sorgen um meine Magd Judith. Sie wollte Wasser holen, als die Strolche mich überfielen. Ich muss sie suchen.«
»Überlasst das mir und Harry, Madam«, erbot sich Danvers mit einer Kopfbewegung in Richtung des Mannes, der sich an Fleetwoods Seite mit den Eindringlingen geschlagen hatte.
Mariannas Vetter nickte zustimmend. »Ich geleite dich besser in deine Kammer, damit du dir ein Gewand überziehen kannst. Meine Freunde werden deine Magd suchen.«
Jimmy Danvers und Harry Cleaton traten in den Hof hinaus und sahen sich aufmerksam um. Es war alles ruhig. Aus einer Luke über den Ställen schaute ein junger Bursche heraus, zog sich jedoch gleich wieder zurück, als sich die Blicke der beiden Männer auf ihn richteten.
»Wo mag das Mädchen sein?«, sagte Danvers. »Sie wollte Wasser holen, meinte ihre Herrin. Lass uns also am Brunnen nachsehen.« Doch dort war niemand. Aufmerksam sahen sich die Freunde um und entdeckten schließlich eine Zinnkanne, die nicht weit entfernt auf dem Pflaster lag.
»Sieht aus, als sei der Magd etwas zugestoßen. Trennen wir uns«, schlug Cleaton vor und entfernte sich. Jimmy Danvers wandte sich in Richtung der Ställe. Pferdeschnauben drang an sein Ohr, dann leises Weinen. Als er um eine Ecke bog, sah er ein junges Mädchen in einem mit Wasser gefüllten Pferdetrog knien. Das Haar hing ihr wirr ins Gesicht, und ihr Mieder war zerrissen. Schluchzend wusch sie sich wieder und wieder mit beiden Händen zwischen den Beinen, als versuche sie einen Schmutz loszuwerden, der sich nicht entfernen ließ. Jimmy blieb betroffen stehen. Es fiel dem jungen Mann nicht schwer, die Gesten des Mädchens zu deuten.
Sanft, aber bestimmt rief er: »Judith?«
Sie hob den Kopf und starrte ihn an wie ein Wild, das den Jäger vor sich sieht.
»Deine Herrin macht sich Sorgen um dich, Judith. Komm, ich bringe dich zu ihr.«
Mit vor Angst geweiteten Augen stieg die Magd aus dem Pferdetrog. Ihre mit Wasser vollgesogenen Röcke klatschten schwer um ihre Beine und brachten sie beinahe zu Fall. Danvers trat rasch auf sie zu, um sie zu stützen, doch sie begann zu schreien, noch bevor er sie berührt hatte.
»Schon gut, ich fasse dich nicht an, versprochen«, beeilte sich Jimmy zu versichern.
Die Schreie hatten Harry Cleaton herbeigelockt. »Hast du sie gefunden, Jimmy?«
»Ja, aber das arme Mädchen ist völlig verstört. Hol ihre Herrin. Eine Frau kann damit besser umgehen.«
Cleaton verstand und entfernte sich. Danvers blieb an seinem Platz und versuchte, das schluchzende Mädchen mit Worten zu beruhigen, ohne ihr zu nahe zu kommen. Es dauerte nicht lange, bis Marianna in Begleitung ihres Vetters ein traf. Ihr Blick glitt von Jimmy Danvers zu Judith, die wie ein fluchtbereites Reh vor ihm stand. Mittlerweile zitterte sie in ihren nassen Kleidern vor Kälte am ganzen Körper.
Marianna näherte sich ihr behutsam, aber unbeirrt, und nahm sie schließlich in die Arme.
»Es ist alles gut, arme Kleine. Hab keine Angst mehr.«
Das Schluchzen des Mädchens ging in ein ersticktes Wimmern über, während es seinen Kopf an Mariannas Übergewand schmiegte.
»Ich muss sie zu Bett bringen«, sagte Marianna, während sie sich zu den Männern umwandte.
»Ein Becher heißer Würzwein wird ihr guttun«, schlug Jimmy vor. »Ich werde dafür sorgen, dass Euch der Gastwirt welchen aufs Zimmer bringt.«
Kurz darauf erschien er mit einem Schankmädchen in der Kammer, das für alle Würzwein mitbrachte. Marianna schenkte ihm für seine Fürsorglichkeit ein dankbares Lächeln, das ihn sichtlich erröten ließ.
»Wir sehen uns noch ein wenig in der Umgebung um«, sagte Tom. »Vielleicht sind die Strolche noch in der Nähe. Sie könnten zurückkehren. Verriegele die Tür gut, Base, wir sprechen uns dann morgen früh.«
Er wartete noch, bis er den Riegel einschnappen hörte, und nickte dann seinen Freunden zu. »Einer der Kerle ist verwundet. Ich glaube nicht, dass er weit gekommen ist.«
Harry Cleaton nahm eine brennende Fackel aus der Halterung und ging voraus. Nachdem sie den Innenhof und die Ställe gründlich durchsucht hatten, traten sie auf die Landstraße hinaus, die an der Herberge vorbeiführte, und gingen ein paar Schritte in jede Richtung. Schließlich machten sie noch eine Runde um das Gebäude.
»Ziemlich matschig hier«, bemerkte Jimmy naserümpfend und warf einen unglücklichen Blick auf seine schlammbespritzten Reitstiefel.
»Sag bloß, du bereust es schon, dich für die schöne Base deines Freundes eingesetzt zu haben«, spottete Harry.
Danvers vermied es, ihn anzusehen, und blickte stattdessen hoheitsvoll geradeaus. »Was ist das da vorn? Ein Misthaufen? Es stinkt erbärmlich!«
Cleaton senkte seine Fackel, damit sie besser sehen konnten. »Hast recht, Jimmy, ein Misthaufen oder vielmehr eine Mistgrube. Genau der richtige Ort für einen Mistkerl. Er muss auf der Flucht hineingefallen und stecken geblieben sein.«
Danvers und Fleetwood beugten sich über den Mann, dessen Leiche den Unrathaufen in der Grube zierte.
»Das ist der Kerl, den ich in den Bauch getroffen habe. Dachte mir schon, dass er nicht mehr lange leben würde.« Tom trat dem Toten in den Brustkorb. »Verdammtes Geschmeiß!«
»Glaubst du, er und seine Kumpane haben deine Base nur zufällig als Opfer gewählt?«, fragte Jimmy nachdenklich.
Tom blickte seinen Freund zurückhaltend an. »Was denkst du?« »Nun, sagtest du nicht, sie und ihr Gatte leben im Exil? Weshalb ist sie hier? Und weiß die Regierung, dass sie hier ist?« »Du meinst, die Strolche wurden geschickt, um sie zu verhaften?« »Du nicht?«
Tom schüttelte zweifelnd den Kopf. »Ich weiß nicht.«
»Du solltest sie fragen. Falls es so ist, darf sie nicht hierbleiben!« »Da hast du allerdings recht. Gehen wir!«
Tom kratzte behutsam an der Tür zur Kammer seiner Base. »Wir sind es, Marianna! Bitte mach auf.«
Sie brauchten nicht lange zu warten. Marianna öffnete die Tür einen Spalt, hinderte die Männer jedoch daran, einzutreten. »Judith braucht Ruhe«, erklärte sie.
»Hat sie gesagt, wer ihr das angetan hat?«
»Nein. Ich habe sie gefragt, ob es einer der Stallknechte war, und das hat sie verneint. Mehr war nicht aus ihr herauszubringen. Vielleicht war es einer der Männer, die auch mich belästigten.«
»Ich muss dringend mit dir sprechen«, bat Tom eindringlich. »Das kann nicht bis morgen warten.«
Seine Base sah ihn beunruhigt an. »Gut, ich komme.«
Sie begaben sich in eine geräumige Kammer, die der Gastwirt den drei Männern für die Nacht zugewiesen hatte und in der die Diener geduldig auf ihre Herren gewartet hatten. Tom schickte sie hinaus und bot Marianna einen Sitzplatz an.
»Wir haben einen der Schurken gefunden – tot!«, berichtete Jimmy Danvers. »Der andere ist entkommen. Hier seid Ihr deshalb nicht mehr sicher, Madam.«
Mariannas Blick wanderte fragend von einem zum anderen. Ihre Mienen verrieten deutlich, dass sie etwas ahnten. Sollte sie sich ihnen anvertrauen? Nach den Ereignissen der Nacht, die sie noch immer innerlich erzittern ließen, wurden die Angst vor dem Alleinsein und das Verlangen nach Beistand so übermächtig, dass sie sich entschied, das Wagnis einzugehen. Schließlich hatten diese drei jungen Männer sie ohne Zögern verteidigt. Nun hatten sie auch das Recht auf eine Erklärung.
»Weshalb bist du nach England zurückgekommen?«, fragte Tom. »Dein Gatte gilt noch immer als Hochverräter. Auch wenn du damals erst seit einem halben Jahr mit ihm verheiratet warst und keinen Anteil an seinem Verrat hattest, bist du dennoch seine Gemahlin.«
Marianna nickte schmerzlich. »Ich habe die Folgen nur zu deutlich am eigenen Leib erfahren. Als Roger damals nach der Niederschlagung des Aufstands der Grafen wie durch ein Wunder im Gefolge des Earl of Westmorland mit dem Leben davonkam und sich in den Schutz des Herzogs von Alba begab, wurden all seine Güter konfisziert. Mich verhörte man tagelang, um den Aufenthaltsort meines Gatten aus mir herauszupressen. Zu der Zeit war ich gerade sechzehn Jahre alt! Als sie endlich begriffen, dass ich nichts wusste, setzte man mich auf die Straße. Mittellos, wie ich war, blieb mir nichts anderes übrig, als mich zu meiner Familie zu flüchten. Aber ich wurde nur widerwillig geduldet. Der Platz einer Frau sei an der Seite ihres Gemahls, hieß es. Und so folgte ich Roger schließlich in die spanischen Niederlande.«
»Aber du bist doch einige Jahre später nach England zurückgekehrt«, erinnerte sich Tom. »Das muss so 74 oder 75 gewesen sein.«
Marianna lächelte bitter. »Ja, das stimmt. Roger brauchte Geld und schickte mich, damit ich mit Unterstützung meiner Familie Land verkaufen sollte, das bei der Konfiszierung übersehen worden war. Außerdem erwartete ich damals ein Kind. Mein Gemahl wünschte, dass es in England geboren wurde. Er glaubte, dass es so doch noch einen Teil seines Erbes antreten könnte.« Mariannas Stimme begann zu zittern. »Ich verfluche den Tag, an dem ich seinem Wunsch gefolgt bin!«
Tränen traten in ihre Augen, und sie wandte das Gesicht ab. Betretenes Schweigen trat ein.
»Ihr braucht nicht weiterzuerzählen, wenn es Euch zu schwerfällt, Madam«, sagte Jimmy Danvers sanft.
Sie hob den Kopf und sah ihn an. Wieder fühlte sie sich durch seine einfühlsame Art getröstet.
»Doch, ich bin Euch eine Erklärung schuldig!« Mit der Hand wischte sie sich die Tränen ab.
»Vor einem Jahr nahm mir die Obrigkeit meinen Sohn Nathaniel weg und verbot mir, ihn zu sehen. Man sagte, die Frau eines Verräters würde auch ihr Kind zum Verräter erziehen. Ich habe die Verantwortlichen angefleht, ihn mir zurückzugeben, ich habe mich Hugh Simpson, dem man die Erziehung meines Sohnes anvertraut hat, zu Füßen geworfen, ich habe mich in jeder erdenklichen Weise erniedrigt ... ohne Erfolg ...« Ihre Stimme brach ab.
»Und dann bist du zu Roger zurückgekehrt?«, fragte Tom.
Marianna schluckte schwer. »Ja. Ich hoffte, er wüsste vielleicht einen Ausweg, aber er war ja so hilflos wie ich. Da entschied ich mich, heimlich nach England zu kommen und Nathaniel ...« » ... zu entführen«, vervollständigte Jimmy den angefangenen Satz. »Euer Diener soll ihn herbringen, nicht wahr?« Sie nickte.
»Und wie passen die Strolche, die dich überfallen haben, ins Bild?«, erkundigte sich Tom.
»Sie kannten meinen Namen, obwohl ich mit einem gefälschten Pass reise. Ich glaube, sie hatten die Absicht, mich zu verhaften. Aber wie sie von meiner Anwesenheit in England erfahren haben oder weshalb sie mich festnehmen wollten, weiß ich nicht.« »Du hast recht. Das ist schon seltsam. Vielleicht denkt man, dass du im Auftrag deines Gatten handelst. Wenn sie wissen, dass du unter falschem Namen reist, macht dich das in den Augen Walsinghams oder Burghleys ziemlich verdächtig.«
»Aber wie haben sie herausgefunden, wer ich bin?«
»Keine Ahnung, Base. Auf jeden Fall solltest du dich nicht länger als nötig in diesem Land aufhalten«, sagte Tom beschwörend. »Am besten, du nimmst das erste Paketboot zurück nach Calais!« Marianna fuhr von ihrem Stuhl auf. »Das kann ich nicht! Nicht ohne meinen Sohn!«
»Sei doch vernünftig!«
Sie schüttelte heftig den Kopf. »Nein! Dies ist wahrscheinlich meine einzige Chance, Nat zurückzuholen. Wenn ich jetzt das Land verlasse, sehe ich ihn vielleicht nie wieder. Man wird seinen Geist vergiften und ihn lehren, seine Mutter zu verachten. Das könnte ich nicht ertragen!«
Die drei Männer sahen einander ratlos an. Mariannas Argumente waren durchaus einleuchtend.
»Wo wohnt der Vetter Eures Gatten?«, fragte Danvers schließlich. »Sein Anwesen liegt in der Nähe von Bossingham. Zu Pferd sind es nur ein paar Stunden.«
Jimmy Danvers begegnete den zweifelnden Blicken seiner Freunde.
»Wir könnten sie dorthin begleiten.«
Tom hob protestierend die Hände. »Das ist doch Wahnsinn!«
»Der Ansicht bin ich auch«, ließ sich nun auch Harry Cleaton vernehmen.
»Ich brauche Eure Hilfe nicht!« Mariannas Miene zeigte eine Entschlossenheit, die nichts ins Wanken bringen konnte.
Tom seufzte tief. »Also gut, wir bringen dich hin. Sobald die Sonne aufgeht, reiten wir los.«
Drittes Kapitel
Der Rabe krächzte und schlug mit den seidig glänzenden, schwarzen Flügeln. Seine Krallen gruben sich erbarmungslos in Roger Ashtons Kopfhaut, und sein großer, kräftiger Schnabel hackte seine im Tode geöffneten Augen aus den Höhlen, um sie zu verspeisen ...
Mit einem Schrei fuhr der Gefangene aus dem Schlaf. Vor dem schmalen vergitterten Fenster seiner Zelle im Tower huschte der Schatten eines der schwarzen Vögel vorüber, die von den Wächtern der Festung gehalten wurden. Ashton hörte sie in der Ferne krächzen. Es schien ihm, als lachten sie ihn aus. Mit zitternder Hand wischte er sich den Schweiß ab, der trotz der zwischen den steinernen Mauern herrschenden Kälte auf seiner Stirn stand. Seine Alpträume wurden von Nacht zu Nacht schlimmer. Seit seiner Entführung und Einkerkerung im Tower von London erwachte er jeden Tag in der Erwartung, dass man ihm den Prozess machte. Allerdings würde es sich dabei nur um eine Formalität handeln, denn das Urteil stand zweifellos bereits fest. Man würde ihn wegen Hochverrats hinrichten! Sein Körper würde verstümmelt und sein Kopf auf einem Pfahl aufgespießt auf der London Bridge zur Schau gestellt werden, um andere Missetäter abzuschrecken.
Roger Ashton wagte es nicht, sich der kühnen Hoffnung auf Begnadigung durch die Königin hinzugeben. Man hatte zu viel Mühe darauf verwandt, ihn nach England zurückzubringen, um nun Gnade walten zu lassen. Und obgleich er nicht der Erste war, den man aus einem fremden Land entführt hatte, um ihn der Justiz seines Heimatlandes zuzuführen, verstand Ashton nicht, weshalb es gerade jetzt geschehen war. Sein Verrat lag dreizehn Jahre zurück. Während seines Daseins im Exil hatte er sich bemüht, sich aus den Ränkespielen der Mächtigen herauszuhalten und mehrmals Angebote der Spanier, für sie zu spionieren, ausgeschlagen. In dieser Hinsicht hatte er sich nichts vorzuwerfen – mit einer Ausnahme ... Mit Schrecken erinnerte sich Roger Ashton an das eine Mal, als er wider besseres Wissen wegen eines Bündels Papiere den Boten gespielt hatte. Und das nur, weil kein anderer zur Verfügung stand, der das Vertrauen des Generalstatthalters der Niederlande, Alessandro Farnese, genoss. Hatte man ihn deshalb entfuhrt? Dieser einen Torheit wegen?
Den ganzen Tag ging Roger Ashton in seiner Zelle im Beauchamp-Turm im Westen der Festung auf und ab. An den Wänden waren überall Inschriften zu sehen, die seine unglücklichen Vorgänger in den Stein gekratzt hatten. Zu seinem Schrecken hatte er unter ihnen auch den Namen Dr. John Storys entdeckt. Ashton glaubte nicht, dass man ihn zufällig in dieser Zelle untergebracht hatte. Man wollte ihn an das Schicksal erinnern, das ihn erwartete, und ihn so in Angst und Schrecken versetzen.
Als sein Wächter ihn zum Verhör holte, war Roger Ashton beinahe erleichtert. In dem Gebäude, das der Lieutenant des Towers bewohnte, erwarteten ihn vier Männer. Abgesehen von Sir Owen Hopton, dem Lieutenant, waren sie dem Gefangenen unbekannt. Hopton stellte sie ihm der Reihe nach vor. Es waren der Kronanwalt, Sir John Popham, der Zweite Kronanwalt, Sir Thomas Egerton, und Thomas Phelippes, Sekretär von Sir Francis Walsingham.
»Master Ashton, Ihr habt Euch im Jahr des Herrn 1569 des Hochverrats schuldig gemacht, indem Ihr Euch der Rebellion der Grafen Northumberland und Westmorland gegen Eure rechtmäßige Königin angeschlossen habt«, konstatierte der Lieutenant. »Danach habt Ihr Euch der gerechten Strafe durch Flucht entzogen und seid in die Dienste des Herzogs von Alba getreten, um als Spitzel gegen Eure Landsleute zu arbeiten.«
Ashton protestierte: »Ich schwöre, dass die letztere Anschuldigung nicht zutrifft. Ja, ich habe mich törichterweise der Rebellion der Grafen angeschlossen, und ich bereue es von ganzem Herzen, doch ich habe den Spaniern nie als Spion gedient!«
Für einen Moment trat gewichtiges Schweigen ein, dann ergriff Phelippes das Wort. »Wollt Ihr leugnen, dass Ihr im November vergangenen Jahres im Auftrag des Generalstatthalters Farnese in Antwerpen geheime Papiere in Empfang genommen habt?«
Roger Ashton wurde bleich. Sie wussten es also! Er hätte damit rechnen müssen. Schweigend starrte er zu Boden, auf die Ketten, die um seine Fußgelenke lagen, während Phelippes weitersprach: »Die Papiere, um die es ging, wurden einem meiner Kuriere entwendet, und zwar auf so raffinierte Weise, dass er es nicht einmal merkte, bevor es zu spät war.« Die Stimme des Sekretärs offenbarte deutliche Zerknirschung. »Inzwischen wissen wir, dass es sich bei dem Dieb um einen Spion handelt, der in dem von uns abgefangenen Schriftwechsel der Spanier unter der Bezeichnung ›El Grifon‹ – der Greif – auftaucht. Ihr wisst, wer dieser Verräter ist, Master Ashton. Sagt uns seinen Namen!«
Der Gefangene hob den Kopf und sah in das Gesicht des Sekretärs, der etwa im selben Alter war wie er. Gespannte Erwartung stand in Phelippes’ Zügen geschrieben. In diesem Moment wurde Ashton alles klar. Man hatte ihn nicht entführt, um eine alte Rechnung zu begleichen, sondern weil er der Einzige war, von dem sie annahmen, dass er den Namen des Greif kannte. Beunruhigte dieser kleine Dieb die Mächtigen so sehr?
Roger Ashton spürte, wie eisige Kälte seine Glieder hinaufkroch und in seine Eingeweide wanderte. Er war verloren! Die winzige Hoffnung auf Gnade, die er bis zu diesem Moment gehegt hatte, zerbrach wie Glas. Er hatte ihnen nichts anzubieten. Angst und Verzweiflung wurden so übermächtig, dass er plötzlich lachen musste, wie ein Mensch, den das Entsetzen um den Verstand gebracht hatte.
Die Männer, die ihm gegenübersaßen, starrten ihn ungläubig an. Keiner von ihnen sagte ein Wort. So plötzlich, wie der Lachanfall aufgeflammt war, verschwand er auch wieder. Der Gefangene brach in ein trockenes Schluchzen aus und vergrub das Gesicht in den Händen.
»Sagt uns den Namen des Greif, Master Ashton, oder man wird Euch der Folter unterziehen und Euch zwingen, uns alles zu verraten, was Ihr wisst«, erklärte Phelippes drohend.
»Aber ich weiß nichts«, presste Ashton hervor. »Ich kenne seinen Namen nicht.«
»Ihr habt die Papiere von ihm entgegengenommen«, donnerte Sir Owen Hopton. »Ihr wisst, wer er ist.«
Der Gefangene schüttelte den Kopf. »Nein ... nein ...« »Potztausend, Ihr habt dem Greif gegenübergestanden. Wenn Ihr seinen Namen nicht kennt, beschreibt ihn!«
Roger Ashton sah den Lieutenant hilflos an. »Es war eine Frau! Eine Frau hat mir die Papiere überreicht.«
Wieder herrschte einen Moment lang Schweigen.
»Ihr lügt!«, stieß Hopsten schließlich hervor.
Ashton war nicht überrascht, dass sie ihm nicht glaubten. Sie hielten seine Behauptung für eine List, mit deren Hilfe er sich zu retten versuchte. Doch es war die Wahrheit.
»Es ist keine Lüge! Ich schwöre es Euch«, beteuerte er.
Der Lieutenant des Towers warf Thomas Phelippes einen fragenden Blick zu. Die Züge des Sekretärs verhärteten sich.
»Ich spreche mit Sir Francis. Er wird entscheiden, ob dem Kronrat der Folterbefehl zur Genehmigung vorgelegt werden soll.« Hopton rief nach dem Wächter, der Ashton in seine Zelle zurückbrachte. Dort ließ sich der Gefangene auf die Knie sinken und betete zur Jungfrau Maria um Beistand.
Am folgenden Morgen brachte der Wächter ihn erneut in die Unterkunft des Lieutenants. Roger Ashton fühlte sich schwach und war übermüdet, denn er hatte fast die ganze Nacht im Gebet verbracht. Die vier Männer, die bereits am Vortag an seinem Verhör teilgenommen hatten, erwarteten ihn zusammen mit einem fünften, den Ashton nicht kannte. Man hieß ihn, sich auf einen Schemel zu setzen. Dann ergriff Thomas Phelippes das Wort.
»Wo befindet sich Eure Frau, Master Ashton?«
Der Gefangene hob erstaunt den Blick, ließ ihn aber sofort wieder sinken. Es hätte keinen Sinn, zu leugnen, dass sich Marianna in England aufhielt. Sie hatten es zweifellos von dem Mann erfahren, der den gefälschten Pass ausgestellt hatte. Und so schwieg Ashton.
»Ist Eure Gemahlin auf Euer Geheiß nach England gekommen?«, fragte der Sekretär. »Soll sie etwas für Euch überbringen? Habt Ihr ihr gar aufgetragen, sich mit dem Greif zu treffen?«
Ashton verzog angewidert das Gesicht. »Lasst meine Frau da raus! Sie weiß noch weniger als ich.«
»Weshalb ist sie dann unter falschem Namen ins Land gekommen?«
Der Gefangene zögerte, während er krampfhaft nach einer glaubwürdigen Erklärung suchte, ohne die Wahrheit preisgeben zu müssen. Doch aufgrund seiner Erschöpfung arbeitete sein Verstand nur langsam.
»Sie wollte ihre Familie besuchen«, log er schließlich.
Das abfällige Lächeln, das über Phelippes’ dünne Lippen huschte, verriet, dass er seine Lüge durchschaute.
»Die Güter der Percys liegen im Norden. Weshalb hat Eure Gemahlin dann ein Schiff nach Dover genommen? Nein, Master Ashton, ich glaube, Eure Frau war auf dem Weg nach London, als ...« Der Sekretär wurde sich plötzlich bewusst, dass er bereits mehr gesagt hatte als beabsichtigt, und verstummte. Dann änderte er seine Meinung und fuhr fort: »Sir Francis Walsingham hat drei Männer zur Verhaftung Eurer Frau losgeschickt, doch sie erhielt Hilfe von einigen Durchreisenden und ist entkommen. Wo ist sie?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte der Gefangene. Marianna war ihnen also durch die Finger geschlüpft. Tapferes Mädchen! Hoffentlich hatte sie daraufhin das einzig Vernünftige getan und das nächste Postboot nach Frankreich genommen. Doch er bezweifelte es!
Mehrmals forderten die anwesenden Männer Roger Ashton auf, die Wahrheit zu sagen, und drohten ihm mit Folter, doch ohne Erfolg. Der Gefangene blieb verstockt. Schließlich trat der Mann, dessen Name Ashton nicht kannte, vor und reichte ihm ein Blatt Papier. »Lest das!«
Es war ein Folterbefehl, unterschrieben von den Mitgliedern des Kronrats. Da den englischen Gesetzen nach die Folter nicht rechtmäßig war, bedurfte es stets einer Ausnahmegenehmigung, die vom Monarchen oder vom Rat abgezeichnet werden musste.
»Ich befinde mich in Eurer Gewalt, Gentlemen«, sagte Ashton gepresst. »Ich kann Euch nicht hindern, Euch gegen Gott zu versündigen.«
»Master Norton, er gehört Euch«, erklärte Phelippes ungerührt, während er seine Notizen einpackte. »Bringt mir so bald wie möglich Ergebnisse!«
Roger Ashton spürte, wie sich sein Magen schmerzhaft zusammenzog. Das also war Thomas Norton, der Folterknecht der Königin, von Verrätern und Unschuldigen gleichermaßen gefürchtet und vom Volk verabscheut.
Der Wächter, der den Gefangenen hergebracht hatte, führte ihn nun durch einen unterirdischen Gang von der Unterkunft des Lieutenants zu den Gewölben unter dem Weißen Turm, wo die Folter-Werkzeuge untergebracht waren. Thomas Norton und Sir Owen Hopton folgten ihnen. Nachdem der Wächter einige Fackeln entzündet hatte, um die Finsternis in dem Verlies zu verscheuchen, nahm er Ashton die Ketten ab, die dieser an Hand- und Fußgelenken trug. Norton ergriff ihn am Arm und führte ihn durch das Gewölbe.
»Hier finden sich die verschiedensten Werkzeuge, um den Widerstand eines Mannes zu brechen«, sagte der Foltermeister streng, als spräche er mit einem uneinsichtigen Kind. »Und Ihr werdet mit jedem einzelnen Bekanntschaft machen, wenn Ihr weiterhin so verstockt seid.«
Schaudernd betrachtete Roger Ashton die Daumenschrauben, die Stiefel, die Handschellen, den Storch – eine eiserne Konstruktion, die den Körper zusammenpresste – und die Streckbank, die man auch »Tochter des Herzogs von Exeter« nannte, weil dieser sie einst in England eingeführt hatte.
»Werdet Ihr uns nun sagen, was wir wissen wollen?«, fragte Norton, nachdem der Gefangene ausgiebig Gelegenheit gehabt hatte, sich darüber klar zu werden, was ihn erwartete.
»Ich habe Euch alles gesagt, was ich weiß«, erwiderte Ashton.
Sir Owen Hopton trat zu ihnen und blickte ihn eindringlich an.
»Seid vernünftig, Sir. Was schuldet Ihr einem Verräter? Weshalb wollt Ihr um seinetwillen solche Qualen auf Euch nehmen? Sagt uns, wer sich hinter dem ›Greif‹ verbirgt, und man wird Euch in Eure Zelle zurückbringen.«
Roger Ashton war aschfahl geworden. Schweißperlen traten auf seine Stirn. »Glaubt mir, ich würde Euch den Namen ohne Zögern preisgeben. Aber ich kenne ihn nicht. Der Überbringer der Papiere war eine Frau. Mehr weiß ich nicht!«
Thomas Norton seufzte tief, als sei seine Geduld erschöpft.
»Eure Starrsinnigkeit ist töricht, Sir. Ihr zwingt uns, Euch Schmerzen zuzufügen. Zieht Eure Schuhe und Euer Wams aus und bereitet Euch darauf vor, ›mit der Tochter des Herzogs von Exeter vermählt‹ zu werden!«
Zitternd vor Angst folgte Ashton der Anweisung und ließ sich zu dem berüchtigten Reck führen. Der Wächter hatte sich zwei Männer zu Hilfe geholt, die die Winde der Streckbank bedienen sollten. Als man den Gefangenen aufforderte, sich auf das hölzerne Gerät zu legen, rührte sich dieser jedoch nicht von der Stelle. Das Grauen lähmte ihn. Auf Nortons Wink hin packten die Wächter daraufhin Ashtons Arme und drückten ihn mit Gewalt auf die Streckbank nieder. In jäher Panik begann sich ihr Opfer zu wehren. Die Männer mussten erhebliche Kraft aufwenden, um ihn niederzuhalten. Einer der Wächter fesselte Ashtons nackte Knöchel mit einem Strick an das Fußende der Bank. Der andere zwang dem Gefangenen die Arme über den Kopf und wand zwei feste Seile, die über eine Rolle am anderen Ende des Folterinstruments liefen, um seine Handgelenke. Schließlich stellten sich die beiden Männer an die Winde und sahen Norton fragend an. Dieser beugte sich über den Gefesselten und sagte hart:
»Dies ist Eure letzte Gelegenheit, die Wahrheit zu sagen und so die Tortur zu vermeiden, Master Ashton. Nutzt sie!«
»Ich weiß nichts!«, schrie der Gefangene, den längst der letzte Rest an Mut verlassen hatte. »Ich schwöre es!« Tränen rannen ihm aus den Augenwinkeln.
Hoptons Blick begegnete Nortons.
»Und wenn er die Wahrheit sagt?«
»Dann wird die Folter dies bestätigen«, war die ungerührte Antwort. »Fangt an!«
Die Männer an der Winde spuckten in die Hände und ergriffen die Hebel zu beiden Seiten, die die Rolle in Bewegung setzten. Knirschend begannen sich die Seile zu spannen. Der erste Schmerz, den Roger Ashton verspürte, war das Einschneiden der Stricke in seine Haut, als sie seinen Körper zur vollen Länge auf der Bank ausstreckten. Bis dahin hatte das Umlegen der Hebel den Männern keine Mühe bereitet, doch nun mussten sie gegen den Widerstand von Muskeln und Sehnen ankämpfen. Quietschend drehte sich die Rolle, langsam, aber unaufhaltsam. Ashton presste die Zähne zusammen, als sich seine Muskeln überdehnten und zu brennen begannen. Zuerst waren es nur die Oberarme und die Brust, dann breitete sich der Schmerz in Schultern, Ellbogen, Knie und Knöchel aus. Seine Hände und Füße schwollen an. Stöhnend suchte Ashton den Blick seines Peinigers.
»Bitte ... aufhören ... hört auf ... ich flehe Euch an ...«
Thomas Norton gab den Männern ein Zeichen. Sie setzten die Hebel ab und lockerten die Stricke. Ashton spürte sein Herz angestrengt gegen seine Brust hämmern. Sein ganzer Körper schmerzte, und sein Atem ging keuchend.
»Hab Erbarmen mit mir, oh Herr!«
»Habt Ihr Euch entschlossen, zu reden?«, fragte Sir Owen Hopton.
»Ich weiß nichts ... bitte, glaubt mir ...« Wieder traten dem Gefolterten Tränen in die Augen. Er wusste, sein Flehen war vergeblich. Sie würden nicht aufhören, bis er ihnen gesagt hatte, was sie wissen wollten. Sie würden niemals aufhören!
»Weitermachen!«, befahl Norton, beeindruckt von der Standhaftigkeit seines Opfers.
Erneut packten die Männer die Hebel und begannen, sie umzulegen, um die Rolle zu drehen. Die Stricke spannten sich, schnitten in die frischen Wunden an Roger Ashtons Hand- und Fußgelenken. Ein Schluchzen tiefster Verzweiflung entrang sich ihm. Diesmal war die Wirkung auf seine bereits überdehnten Muskeln noch schmerzhafter als zuvor. Das Stöhnen des Gefolterten ging in Schreien über. Die Seile zerrten mit zunehmender Kraft an den Gliedern, bis mehr und mehr Muskelfasern und schließlich Sehnen rissen. Mit vor Anstrengung verzogenen Gesichtern legten sich die Männer an den Hebeln ins Zeug, in dem Bemühen, den letzten Widerstand des gepeinigten Körpers zu überwinden, und hielten erst ein, als ein knöchernes Knacken, kurz darauf gefolgt von einem zweiten, verriet, dass es ihnen gelungen war, die Oberarmköpfe aus den Schulterpfannen zu reißen. Der Gefolterte stieß einen qualvollen Schrei aus, der in ein hilfloses Wimmern überging.
Wieder gab Norton den Männern Anweisung, die Seile zu lockern. Roger Ashton weinte wie ein Kind, halb betäubt von den Schmerzen seines geschundenen Körpers.
»Redet endlich«, knurrte der Foltermeister, ohne dass in seiner Stimme eine Spur von Mitgefühl zu erkennen war. »Sonst werdet Ihr noch mehr leiden.«
Die drohenden Worte erreichten den Gefangenen nur noch wie durch einen dichten Schleier. Plötzlich durchfuhr Ashton ein neuer, ungekannter Schmerz, als hätten sich die Stricke mit brutaler Gewalt um seine Brust geschlungen und drückten nun sein Herz erbarmungslos zusammen. Kalter Schweiß drang ihm aus allen Poren, das Atmen fiel ihm schwer. Der grausame Schmerz strahlte in seinen Kiefer und seinen linken Arm aus, verband sich mit der Qual seiner zerrissenen Glieder. Der Nachtmahr, der auf seiner Brust saß, wurde schwerer und schwerer, presste ihm die Luft aus den Lungen. Verzweifelt rang Roger Ashton nach Atem. Ein heftiger Schwindel erfasste ihn. Die Todesangst wurde übermächtig.
»Da stimmt etwas nicht! Macht ihn los!«, rief Sir Owen Hopton.
Der Gefolterte nahm kaum mehr wahr, wie die Stricke von seinen Hand- und Fußgelenken entfernt wurden. Jemand rief nach einem Arzt. Eine Hand ohrfeigte ihn mehrmals, dann traf ein Schwall kaltes Wasser sein Gesicht.
»Wo bleibt der Medikus?«
Dunkle Schatten breiteten sich vor Roger Ashtons weit geöffneten Augen aus. Sein rasselnder Atem ging in ein Husten über, und sein Mund füllte sich mit Schaum.
»Er stirbt! Tut etwas, verdammt!«
Doch Ashtons Geist war seinen Peinigern bereits entrückt. Ein letztes Mal noch rang er röchelnd nach Luft, dann lag er still da. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen.
Unbehaglich trat Thomas Norton in der Stube des Hauses auf der Seething Lane von einem Fuß auf den anderen. Eigentlich rechtfertigte die Wichtigkeit seiner Nachricht, dass er unverzüglich zu Sir Francis Walsingham vorgelassen wurde, doch er musste erst warten, bis dessen Leibarzt gegangen war. Der »Mohr«, wie die Königin ihren Minister aufgrund seiner ungewöhnlich dunklen Haut nannte, lag krank im Bett.
Endlich verließ der Medikus das Schlafgemach des Kranken, und Norton wurde vorgelassen.
»Wie fühlt Ihr Euch, Sir?«, fragte der Foltermeister, in dem Bestreben, seine unangenehme Pflicht noch ein wenig hinauszuschieben. Walsingham saß, an Kissen gelehnt, aufrecht im Bett. Seine Augen glänzten fiebrig, und seine Züge offenbarten die Folgen einer von Schmerzen gestörten Nachtruhe. Er litt an der Steinkrankheit. Ein hartes Gebilde in seiner Blase löste immer wieder Fieberanfälle aus und verursachte ein qualvolles Stechen im Unterleib, was ihn mitunter tagelang ans Bett fesselte.
Sir Francis ließ die Frage nach seinem Befinden unbeantwortet. Der unbehagliche Gesichtsausdruck des Besuchers ließ ihn Schlimmes ahnen.
»Was ist passiert?«
Norton wich dem Blick des Ministers aus.
»Es tut mir leid ... ich weiß nicht, wie das geschehen konnte ...« »Kommt zur Sache! Geht es um Roger Ashton?«
»Ja, Sir. Ich muss Euch leider mitteilen, dass er auf der Folter geblieben ist.«
»Er ist tot?« Walsinghams Züge verfinsterten sich. »Hat er Euch den Namen des Greif preisgegeben?«
»Nein, Sir, wir hatten ja gerade erst angefangen«, verteidigte sich Norton. »Plötzlich trat ihm Schaum vor den Mund, und er starb. Wenn er krank war, hätte er uns das sagen müssen. Uns trifft keine Schuld, wir sind in der üblichen Weise vorgegangen.«
Norton sprach im Plural, obwohl die Verantwortung ganz allein bei ihm lag.
»In Frankreich oder Spanien wird man das anders sehen«, belehrte ihn Walsingham. »Man wird sagen, wir haben einen Mann zu Tode gefoltert. Sorgt dafür, dass Euer Versagen nicht an die Öffentlichkeit dringt. Gebt Ashtons Tod als Selbstentleibung aus.«
»Ja, Sir.«
»Hat er auch unter der Folter weiterhin behauptet, dass der Überbringer der Papiere eine Frau gewesen sei?«
»Ja. Erstaunlich, dass er glaubte, wir würden ihm eine so dreiste Lüge abkaufen.«
»Vielleicht war es keine Lüge. Vielleicht hat der Greif eine Komplizin, die Botengänge für ihn erledigt«, spekulierte Walsingham. »Hat Ashton gesagt, wo sich seine Gemahlin befindet?«
»Nein, Sir. Er behauptete, sie sei auf dem Weg zu ihrer Familie.« Sir Francis dachte angestrengt nach. »Hatte Ashton nicht ein Kind? Einen Sohn? Findet heraus, wo sich das Kind aufhält. Vermutlich werdet Ihr dort auch seine Frau finden. Nehmt sie fest und bringt sie zu mir. Aber schickt diesmal jemanden, der über etwas mehr Feingefühl verfügt als dieser Abschaum, der sich bei dem Versuch, sie zu verhaften, hat abstechen lassen – wahrscheinlich zu Recht! Mistress Ashton stammt aus einer einflussreichen Familie und verdient eine höfliche Behandlung. Beauftragt am besten John Kempe, er weiß mit Frauen umzugehen.«
»Aber Master Kempe ist mit der Suche nach Throckmortons Papieren beschäftigt«, widersprach Norton. »Und er untersucht das Verschwinden von Drakes Logbuch.«
»Er soll sich bemühen, beides beizubringen: Mistress Ashton und die Papiere! Was das Logbuch betrifft, wissen wir nicht einmal genau, wann es gestohlen wurde. Es kann schon vor Monaten passiert sein. Da machen ein paar Tage mehr oder weniger auch keinen Unterschied mehr.«
Thomas Norton nickte gehorsam und wandte sich zum Gehen, als Walsingham ihn noch einmal zurückhielt: »Und seht zu, dass Euch mit Francis Throckmorton nicht ein ähnliches Missgeschick passiert, wenn Ihr ihn auf die Folter spannt!«
Der Sarkasmus in der Stimme seines Meisters ließ Norton zusammenzucken. Ohne ein Wort zu entgegnen, verbeugte er sich und verließ das Schlafgemach.
Viertes Kapitel
Dankbar hatte Marianna das Angebot ihres Vetters und seiner Freunde angenommen und sich von ihnen bis zu einer kleinen Herberge in einem Dorf namens Kingston in der Nähe von Bossingham begleiten lassen. Doch nun bestand sie darauf, dass ihre Beschützer ihre Reise nach London fortsetzten. Natürlich protestierten die drei Männer empört und weigerten sich, sie mit ihrer verängstigten Magd allein zurückzulassen. Nur mit Mühe gelang es Marianna, ihnen klarzumachen, dass sie mit einer Eskorte aus drei Gentlemen, zwei Dienern und einer Magd zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und den Vetter ihres Gatten dadurch nur frühzeitig warnen würde. Lediglich von Judith begleitet, konnte sie dagegen unauffällig mit ihrem Diener in der Herberge Zusammentreffen, in der er sich eingemietet hatte. Schließlich sahen Fleetwood, Danvers und Cleaton ein, dass sie recht hatte und dass sie sie mit ihrer Anwesenheit nur in Gefahr brachten. Marianna dankte ihnen noch einmal für ihren Beistand. Zum Abschied nahm Tom galant ihre Hand.
»Ich wünsche dir Glück, liebe Base, und ich hoffe sehr, dass deine Mission erfolgreich sein wird. Wenn du aber wider Erwarten in Schwierigkeiten geraten solltest, schick mir Nachricht in meines Vaters Stadthaus in London.«
»Ihr reist nicht nach Yorkshire weiter?«
»Nein, wir verbringen den Winter in London und kehren erst im Frühling nach Hause zurück. Wenn du also etwas brauchst, suche mich in Fleetwood House auf. Du kennst doch die Straße?« »Ja«, bestätigte Marianna. »Danke für das Angebot.«
Jimmy Danvers schenkte ihr ein letztes, warmes Lächeln, bevor er sein Pferd wendete und seinen Freunden folgte. Marianna verspürte auf einmal Bedauern, als ihr bewusst wurde, dass sie ihn wahrscheinlich nie wiedersehen würde.
Christopher war überrascht, seine Herrin in der Herberge zu sehen, und ahnte gleich, dass etwas Unvorhergesehenes geschehen sein musste, noch bevor Marianna ihn ins Bild setzte.
»Aber das ist schrecklich, Madam! Ihr solltet sofort nach Frankreich zurückreisen, sonst besteht die Gefahr, dass Ihr doch noch in die Hände dieser Leute fallt.«
»Wir brechen auf, sobald du Nathaniel geholt hast! Ich gehe nicht ohne ihn, jetzt, da er mir so nah ist. Hast du mit ihm sprechen können?«
»Ja, ich habe eine Magd überredet, dem Jungen einen Brief zuzustecken, angeblich von Euch. Später überbrachte sie mir seine Antwort. Hinter dem Anwesen gibt es einen großen Garten, umgeben von einer Mauer, in dem man Nathaniel unbeaufsichtigt Lateinvokabeln lernen lässt.«
»Aber wie soll Nat über die Mauer kommen?«
»Er schrieb, dass er versuchen wird, den Schlüssel zu einer kleinen Pforte zu stehlen, die nach draußen führt. Ich werde ihn morgen Nachmittag auf der anderen Seite erwarten und ihn sofort herbringen.« Marianna sah in das von Zuversicht erfüllte Gesicht des jungen Mannes. Es war offensichtlich, dass er fest an einen Erfolg ihres Vorhabens glaubte. War er sich überhaupt bewusst, was er riskierte, indem er sich zu ihrem Komplizen machte? Wenn die Entführung fehlschlug, musste er mit Kerker und einer schweren Leibstrafe rechnen. Doch als Marianna den kühnen Plan gefasst hatte, war Christopher sofort bereit gewesen, sich seiner Herrin anzuschließen. Als Sohn eines einfachen Bauern aus dem Norden war er der Meinung, dass ein Kind zu seiner Mutter gehörte. In ihrer Obhut gedieh es am besten, wie das Lamm bei der Zibbe oder das Füllen bei der Stute. Aber das war nicht der einzige Grund, der Christopher bewogen hatte, sich auf dieses gefährliche Vorhaben einzulassen. Der andere war Dankbarkeit. Die Ashtons hatten den blonden Hünen mit der streitbaren Art davor bewahrt, das Schicksal so manches wilden Burschen zu teilen und auf Abwege zu geraten, wenn nicht gar am Galgen zu enden. In seiner Jugend hatte es kaum eine Prügelei gegeben, an der Christophers Fäuste nicht auch beteiligt gewesen waren. Roger Ashton hatte jedoch das Potenzial zu Treue und Verlässlichkeit in dem ungeschliffenen Raufbold gesehen und ihn zu dem geformt, der er heute war: ein aufrichtiger und mutiger Mann, der seinen Zorn zu meistern wusste, der aber nichtsdestotrotz vernichtend zuschlagen konnte, wenn es nötig war. Marianna war froh, ihn bei sich zu haben. Nat dagegen war aus ganz anderem Holz geschnitzt: eher klein und schmächtig für sein Alter, scheu und verschlossen – Eigenschaften, die sich durch die monatelange Trennung von seiner Mutter und von allem, was ihm während seines jungen Lebens vertraut gewesen war, vermutlich noch verstärkt hatten. Wie mochte die Erziehung des strengen Simpson das Wesen des Kindes geprägt haben? Sicher nicht zum Guten! Und nun hing alles davon ab, ob es dem schüchternen Nat gelang, sich den Schlüssel zur Freiheit zu beschaffen.
»Heilige Mutter Gottes, bitte hilf meinem Sohn!«, entfuhr es Marianna angesichts des Wagnisses, das der Junge eingehen musste. Was würde geschehen, wenn man ihn beim Entwenden des Schlüssels entdeckte? Sie mochte nicht daran denken.
Ohne sich dessen bewusst zu sein, vergrub sie das Gesicht in den Händen. Sie hatte große Angst vor dem, was der morgige Tag bringen würde.
Am folgenden Nachmittag bestieg Christopher sein Pferd und ritt ohne Umwege zum Anwesen Hugh Simpsons. Als er die Mauer des Gartens erreicht hatte, ließ er sein Reittier langsamer gehen und zügelte es schließlich, als er die kleine Pforte entdeckte. Leise stieg der Diener aus dem Sattel und wartete. Der Himmel war bewölkt, aber zum Glück regnete es nicht, denn sonst würde man den Jungen sicherlich im Haus behalten. Der Pfad, der zwischen der Mauer und einem dichten Waldstück verlief, war verlassen. Sollte jemand des Weges kommen, würde Christopher einfach vorgeben, dass sein Pferd lahm sei, und prüfend seine Beine abtasten, bis der andere weiterritt. So würde er hoffentlich keinen Verdacht erregen. Die Zeit verging, ohne dass sich etwas rührte. Angespannt stand Christopher neben seinem Braunen und kraulte ihm die Oberlippe. Ein kühler Wind kam auf, fuhr durch die herbstlich verfärbten Kronen der Bäume, die den Pfad säumten, und ließ einige gelbe und braune Blätter zu Boden segeln. Auf einmal vernahm der Diener fernes Pferdeschnauben. Sofort versteifte sich sein Körper. Unruhig sah er sich um und lauschte angestrengt. Doch es war nichts zu sehen und auch nichts mehr zu hören. Hatte er sich getäuscht? Unbehaglich trat er von einem Fuß auf den anderen.