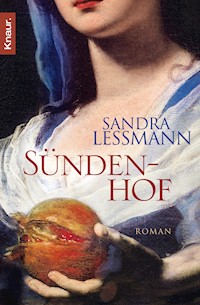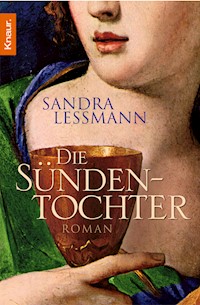9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Briefgeheimnis, das in den falschen Händen zur gefährlichen Waffe werden könnte … London, 1668: König Charles II. ist höchst beunruhigt, als sein Bote von einem wichtigen Auftrag nicht zurückkehrt. Er vertraut ihm seit Jahren die äußerst persönliche Briefkorrespondenz mit seiner Schwester Henriette an, der Schwägerin des französischen Königs. Charles zieht den Jesuitenpater Jeremy zu Rate, der ihm schon mehr als einmal aus einer brisanten Situation herausgeholfen hat. Und die Zeit drängt: Der Brief beinhaltet streng geheime Informationen über die englisch-französischen Beziehungen, die in den falschen Händen einen verheerenden Konflikt auslösen könnten … Der fünfte Roman der mitreißenden historischen Krimireihe um PATER JEREMY, in der jeder Band unabhängig gelesen werden kann, erschien bereits vorab unter dem Titel »Die Winterprinzessin«. Fans von Ellis Peters und C. J. Samson werden begeistert sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, 1668: König Charles II. ist höchst beunruhigt, als sein Bote von einem wichtigen Auftrag nicht zurückkehrt. Er vertraut ihm seit Jahren die äußerst persönliche Briefkorrespondenz mit seiner Schwester Henriette an, der Schwägerin des französischen Königs. Charles zieht den Jesuitenpater Jeremy zu Rate, der ihm schon mehr als einmal aus einer brisanten Situation herausgeholfen hat. Und die Zeit drängt: Der Brief beinhaltet streng geheime Informationen über die englisch-französischen Beziehungen, die in den falschen Händen einen verheerenden Konflikt auslösen könnten …
Über die Autorin:
Sandra Lessmann, geboren 1969, lebte nach ihrem Schulabschluss fünf Jahre in London. Zurück in Deutschland studierte sie in Düsseldorf Geschichte, Anglistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Institut für Geschichte der Medizin; ein Thema, dass sie ebenso wie ihre Englandliebe in ihre historischen Romane einfließen ließ.
Die Website der Autorin: www.sandra-lessmann.de
Bei dotbooks veröffentlichte Sandra Lessmann ihre historischen Romane »Die Spionin der Krone« und »Die Kurtisane des Teufels« sowie ihre historische Krimireihe rund um »Pater Jeremy«.
***
eBook-Neuausgabe November 2024
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »Die Winterprinzessin« bei Knaur Taschenbuch
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Knaur Taschenbuch. Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/A-R-T, Fabio Alina, Tartila, Madele und einer Londonkarte von F. de Witt
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-308-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandra Lessmann
Ein Brief der Krone
Historischer Roman
dotbooks.
Prolog
Juli 1646
Die Bettlerin blieb stehen und ließ den Blick über die sanften Hügel der North Downs gleiten, die sich in der Ferne verloren. Nach all den Tagen angestrengten Marschierens war das Meer noch immer nicht in Sicht. Stattdessen wand sich die Landstraße vor ihr zwischen Feldern und Wiesen hindurch in die Unendlichkeit. Die Frische des Morgens wich allmählich einer drückenden Schwüle, die an den Kräften zehrte. Ihre Füße, die in klobigen Schuhen steckten, schmerzten unerträglich. Doch sie unterdrückte das Seufzen, das sich auf ihre Lippen drängte. Um ihre verspannten Muskeln zu entlasten, schob sie das zweijährige Kind, das sie auf dem Rücken trug, ein wenig zurecht.
Ihre Begleiter, zwei Männer und eine Frau, in Lumpen gekleidet wie sie, hatten ebenfalls innegehalten und warfen ihr besorgte Blicke zu.
»Lasst mich Eure Last eine Weile tragen, Madame«, sagte der Franzose, der an ihrer rechten Seite ging.
»Nenn mich nicht so, Paul«, wies die Bettlerin ihn zurecht. »Man weiß nie, wer zuhört!«
Wie um ihre Worte zu bestätigen, drang das Rumpeln eines näherkommenden Wagens an ihre Ohren. Die Vagabunden wandten sich um. Aus einer gelben Staubwolke tauchten zwei Zugpferde auf, die ein Bauer lenkte. Als der Wagen zu ihnen aufgeschlossen hatte, traten die Bettelleute zur Seite, um ihn passieren zu lassen.
Das Kind, das auf den Schultern der Frau gedöst hatte, wurde munter und winkte dem Fuhrmann fröhlich zu. Da griff dieser in die Zügel und brachte sein Gespann zum Stehen.
»Na, wohin des Weges?«, fragte er ein wenig misstrauisch. »Nach Ashford«, antwortete die Bettlerin.
Da das Kind ihn noch immer anlächelte, sagte der Bauer freundlicher: »Ich fahre frische Milch nach Canterbury. Wenn du magst, gebe ich dir ein Schälchen für deinen Knirps.« »Vielen Dank. Mein Sohn ist sicher durstig«, erwiderte die Frau. Der Bauer schöpfte Milch aus einem der Fässer auf der Ladefläche in einen Zinnbecher und reichte ihn dem Kind. »Bedank dich, Pierre«, mahnte das Bettelweib.
»Ich danke Euch, Sir«, sagte das Kind artig und fügte mit stolzer Würde hinzu: »Ich bin aber nicht Pierre. Ich bin Prinzessin Henrietta, und Ihr müsst Euch vor mir verbeugen.« Erstaunt blickte der Bauer vom Kind zur Bettlerin, die ärgerlich mit den Augen rollte.
»Genug jetzt mit dem Unsinn, Pierre!«, schalt sie das Kind. An den Fuhrmann gewandt, fügte sie entschuldigend hinzu: »Mein Sohn hat eine blühende Phantasie.«
Lachend schüttelte der Bauer den Kopf. »Auch ich habe zwei kleine Mädchen, die sich für Prinzessinnen halten. Na, der Ernst des Lebens holt sie früh genug ein. Da sollte man ihnen ein paar unbeschwerte Jahre gönnen.« Auf das Spiel des kleinen Bettlerknaben eingehend, verbeugte er sich ein wenig unbeholfen. »Bitte vergebt mir, holde Prinzessin. Ich wünsche Euch eine gute Reise, Hoheit.«
Versöhnt strahlte das Kind den Fuhrmann an und winkte ihm nach, als dieser seine Pferde mit einem Zungenschnalzen antrieb. Er wandte sich noch einmal um und erwiderte den Abschiedsgruß. Dabei fiel sein Blick auf einen einzelnen Reiter, der auf dem Hügelkamm hinter ihnen auftauchte. Als der Fremde die kleine Gruppe bemerkte, zügelte er sein Pferd und beobachtete sie aus der Ferne.
Argwöhnisch kniff der Bauer die Augen zusammen und musterte den Reiter. Auch wenn er sich den Grund nicht erklären konnte, hatte er das Gefühl, dass dieser den Bettlern folgte. Für einen Moment verspürte der Fuhrmann den Drang, die Vagabunden auf den Fremden aufmerksam zu machen. Schließlich lebten sie in unsicheren Zeiten. Auch wenn die Schlachten des Bürgerkriegs in anderen Grafschaften ausgetragen wurden und die Kämpfe noch nicht in diese Gegend vorgedrungen waren, lag doch im ganzen Land eine gewisse Spannung in der Luft. Dann aber zuckte der Bauer mit den Schultern und trieb sein Gespann zu größerer Eile an. Sicher war der Mann nur ein Reisender, der Abstand zu dem Bettelvolk halten wollte. Außerdem war er spät dran für den Markt in Canterbury und musste sich sputen, damit er seine Milch verkaufte, bevor sie schlecht wurde.
Die Bettlerin, die den forschenden Blick des Bauern bemerkt hatte, wandte sich um und sah zu dem einzelnen Reiter hinüber, der noch immer regungslos auf seinem Pferd verharrte. Ohne ein Wort mit ihren Begleitern zu wechseln, setzte sie sich wieder in Marsch.
Das durchdringende Geschrei der Möwen kündigte endlich die Nähe des Meeres an. Nach einer unbequemen Nacht im Straßengraben erreichte die kleine Gruppe am späten Nachmittag die Küstenstadt Dover. Am Hafen herrschte reges Treiben. Schiffe wurden be- und entladen. Matrosen kletterten wie die Affen in der Takelage der großen Segler herum und riefen sich Bemerkungen in fremden Sprachen zu. Hafenarbeiter rollten Fässer über das Pflaster oder trugen verschnürte Ballen in die Lagerhäuser. Passagiere drängten sich am Kai, um mit einem Ruderboot zu einem vor Anker liegenden Paketboot überzusetzen. Niemand beachtete die Vagabunden, die sich durch die schmalen Gassen unauffällig dem Hafen näherten.
Plötzlich erklang hinter ihnen eiliges Hufgeklapper. Geistesgegenwärtig wich die Bettlerin mit dem Kind in einen Hauseingang zurück. Der Franzose stellte sich schützend vor sie, während sich der andere Mann und die Frau an die Wand eines kleinen Fachwerkhauses drückten.
Ein Trupp Soldaten trabte durch die Gasse dem Hafen zu. Als die Bettlerin sah, dass sie zur Parlamentsarmee gehörten, erstarrte sie vor Angst. War der Feind ihnen auf die Spur gekommen? Hatte man ihre Flucht entdeckt? Wenn sie erkannt wurde, waren sie alle verloren!
Doch die Soldaten hielten nicht an, sondern machten vor einer Schenke am Hafen halt. Offenbar wollten sie sich eine Erfrischung gönnen. Sie mochten auf der Seite des Parlaments kämpfen, waren offenbar aber keine fanatischen Puritaner, die jegliche Art von Vergnügung verdammten.
Es dauerte eine Weile, bis die Vagabunden den Schrecken überwunden hatten und vorsichtig ihren Weg fortsetzten. Als ein Mann um eine Ecke auf sie zutrat, setzte das Herz der Bettlerin ein weiteres Mal aus, und sie griff sich bestürzt an die Brust.
»Sir William, Ihr taucht auf wie ein Geist«, entfuhr es ihr, als sie ihn erkannte.
»Mylady Dalkeith«, flüsterte er ihr zu. »Würdet Ihr mir bitte folgen?«
Er führte die kleine Gruppe in eine Seitengasse, in der es ruhiger zuging.
»Ich bin erleichtert, Euch und Ihre Hoheit unversehrt zu sehen«, wisperte er. »Verlief die Reise problemlos?«
»Abgesehen von schmerzenden Füßen und einem krummen Rücken, kann ich mich nicht beklagen, Sir William«, erwiderte Lady Dalkeith diplomatisch. »Zum Glück sind wir bis eben auf keine Patrouille gestoßen.«
Sie verschwieg, dass Prinzessin Henrietta jedem Reisenden, dem sie unterwegs begegnet waren, stolz versichert hatte, dass sie nicht Pierre heiße und die Bettlerlumpen nicht ihre gewöhnliche Kleidung seien. Doch niemand hatte das Geplapper des Kindes ernst genommen.
»Ich habe Euch eine Passage auf einem französischen Schiff – der Etoile – besorgt«, unterrichtete Sir William Fenwick die Flüchtlinge. »Es wird heute Abend mit der Flut auslaufen. Ich führe Euch zu einem Haus, in dem Ihr sicher auf die Abfahrt warten könnt.«
»Habt Ihr von Seiner Majestät gehört?«, fragte Lady Dalkeith.
»Ja, Euer Cousin, der Earl of Caversham, war vor zwei Tagen hier und berichtete, dass es dem König gelang, in einer Verkleidung aus dem von der Parlamentsarmee belagerten Oxford zu fliehen. Er hat sich in die Hände der presbyterianischen Armee in Newark begeben, weil er hofft, die Schotten auf seine Seite ziehen zu können. Caversham ist mit einem Brief auf dem Weg nach Frankreich zu Ihrer Majestät der Königin, um sie von der neuen Entwicklung in Kenntnis zu setzen.«
»Möge der Herr ihn beschützen.«
Nachdem Sir William die falschen Bettler bei einer königstreuen Familie am Hafen untergebracht hatte, trat er wieder auf die Straße hinaus und entdeckte den einsamen Reiter, der den Flüchtlingen gefolgt war. Gelassen ging er auf ihn zu. Der Mann zügelte sein Pferd und fragte mit gedämpfter Stimme: »Alles in Ordnung?«
»Alles bestens, Sir John. Das Schiff läuft heute Abend aus. Wenn der Wind günstig ist, wird Ihre Majestät ihre Tochter in wenigen Tagen wieder in die Arme schließen können.«
»Ihr habt Euch sehr um die Krone verdient gemacht, Sir William. Nicht auszudenken, wenn die Prinzessin in die Hände des Parlaments fallen würde wie ihre Schwester Elizabeth und der Duke of Gloucester. Die Rebellen werden nicht davor zurückschrecken, die Königskinder als Geiseln zu benutzen.«
»Ich fürchte, uns stehen noch schwere Zeiten bevor«, sagte Sir William mit einem Seufzen.
»Das denke ich auch. Wer weiß, ob Prinzessin Henrietta ihr Heimatland jemals wiedersehen wird.«
Kapitel 1
Oktober 1668
Grauer Nebel kroch durch die geöffnete Terrassentür ins Innere des prächtig eingerichteten Schreibkabinetts und brachte den faden Grabgeruch der Seine mit sich. Henriette- Anne, Duchesse d’Orléans, überlief ein Frösteln. Sie steckte die Feder in das Tintenfass und erhob sich, um sich einen wärmenden Schal um die Schultern zu legen. Für einen Moment trat sie durch die Tür nach draußen und ließ den Blick über die mit Fontänen bestückten Terrassen gleiten, die sich zum Fluss hinab erstreckten und für die das Schloss von Saint- Cloud berühmt war.
Die Dämmerung war bereits hereingebrochen. Die feuchte Kälte durchdrang das Gewebe des Schals und ließ den zarten Körper der Prinzessin erzittern. Sie trat wieder in das Kabinett zurück, ließ die Terrassentür jedoch offen. Sie musste sich beeilen. Sir William Fenwick würde bald erscheinen, und sie wollte ihn nicht warten lassen. Ohne Zögern setzte sie sich wieder an den Tisch, nahm die Feder zur Hand und beendete den Brief an ihren Bruder, den König von England. Die Korrespondenz zwischen ihr und Charles beschränkte sich nicht allein auf persönliche Sorgen und Erlebnisse. Bruder und Schwester diskutierten darin heikle diplomatische Entscheidungen, deshalb durften die Briefe auf keinen Fall in fremde Hände fallen. Sir William gehörte zu den wenigen Personen, deren Vertrauenswürdigkeit über jeden Zweifel erhaben war. Auch wenn Henriette sich nicht mehr an ihre Flucht aus England während des Bürgerkriegs erinnern konnte, wusste sie doch, welche Rolle er dabei gespielt hatte. Dafür war sie ihm dankbar. Doch als Mensch war ihr der etwas arrogante, von sich selbst überzeugte Höfling nie besonders sympathisch gewesen. Es war bedauerlich, dass ihr Bruder Fenwick dem Capitaine-Lieutenant der Musketiere, Charles Castelmore d’Artagnan, vorzog, obgleich dieser seine Zuverlässigkeit in den Diensten des französischen Königs schon oft bewiesen hatte.
Gerade als Henriette die Tinte gelöscht und den Brief mit ihrem Ring gesiegelt hatte, tauchte eine Schattengestalt lautlos aus dem Nebel auf. Die Prinzessin erschrak, so unheimlich war ihr Erscheinen. Ihr Herzschlag beruhigte sich jedoch sogleich, als sie Sir William Fenwick erkannte.
»Ihr schleicht wie eine Katze, Monsieur«, sagte sie, ärgerlich über ihre Schreckhaftigkeit.
»Ein nicht unpassendes Talent in meinem Metier, meint Ihr nicht auch, Hoheit?«, gab er ironisch zurück, während er ihr seine Reverenz erwies.
Henriette reichte ihm den versiegelten Brief.
»Es gelten dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie immer«, ermahnte sie Fenwick. »Bald wird Seine Majestät mein Bruder mir einen Kode zur Verschlüsselung unserer Briefe schicken. Bis dahin wäre es fatal, wenn eines der Schreiben verlorengehen sollte.«
»Dessen bin ich mir bewusst, Madame«, versicherte Sir William. »Verlasst Euch auf mich.«
Nach einer weiteren Verbeugung verschwand er ebenso lautlos in den Nebelschwaden, wie er gekommen war. Erleichtert schloss Henriette die Terrassentür hinter ihm und ließ sich mit einem Seufzen auf einen Stuhl sinken.
Der Jesuitenpater Thomas Waterhouse alias Harding beobachtete seine fünf Mitreisenden, die die Postkutsche von Dover nach London mit ihm teilten. Da die Fenster mit veralteten Ledervorhängen verhängt waren – nur die Kutschen der Wohlhabenden waren mit dem neuartigen teuren Glas ausgestattet –, herrschte im Innern des Kutschkastens düsteres Halbdunkel. So konnte sich Waterhouse nicht allein auf seine gute Beobachtungsgabe verlassen, sondern musste sich auch seiner anderen Sinne bedienen, um sich ein Bild von seinen Begleitern zu machen.
Es war ein bunt zusammengewürfeltes Grüppchen, mit dem er die zwei Tage dauernde Fahrt nach London verbringen sollte. Zu seiner Linken saß ein Vikar, der sich bemühte, bei dem spärlichen Licht, das durch einen Spalt des Ledervorhangs drang, in einem Buch zu lesen. Dem zufriedenen Ausdruck seines Gesichts und dem unterdrückten Glucksen, das er hin und wieder von sich gab, war zu entnehmen, dass er seine Lektüre sehr genoss. Dem Geistlichen gegenüber hatte die Frau eines Lohgerbers Platz genommen, deren Kleidern der unverkennbare Geruch nach Gerblohe anhaftete. Der Mann zu Waterhouse’ Rechten verströmte dagegen den angenehmen Duft verschiedenster Kräuter. Vermutlich war er Apotheker. Ihm gegenüber saß eine elegant gekleidete Frau, deren Zofe auf dem Außensitz untergebracht war. Da ihre Aufmachung nicht der neuesten Mode entsprach, vermutete Waterhouse, dass es sich eher um die Gattin eines Krautjunkers als eines wohlhabenden Londoner Kaufmanns handelte. Auch ihr Akzent verriet ihre Herkunft aus einer der südwestlichen Grafschaften. Einzig der Mann, der Thomas Waterhouse gegenübersaß, gab ihm Rätsel auf. Er mochte um die fünfzig Jahre alt sein. Seine Kleidung war gepflegt, aber von einfachem Schnitt, ohne modische Verzierungen, abgesehen von kunstvoll gefertigten, silbernen Manschettenknöpfen. Seine abgelaufenen Stiefel und der abgetragene Reisemantel verrieten, dass der Mann viel unterwegs war. Darüber hinaus war er der Einzige, der trotz der schaukelnden Bewegungen des Kutschkastens eingeschlafen war, was auf lange Gewöhnung an diese unbequeme Form der Fortbewegung schließen ließ. Man hätte ihn für einen bescheidenen Kaufmann halten können, wäre da nicht der Degen gewesen, den er an einem ebenso strapazierten Gehänge trug und den er auch während der Fahrt nicht abgelegt hatte. Bevor die Passagiere die Kutsche bestiegen hatten, war Waterhouse aufgefallen, dass der Reisende überdies eine Pistole unter seinem Wams trug. Offenbar wollte er gegen alle Unwägbarkeiten gewappnet sein. Doch die misstrauische Natur des Jesuiten mochte sich nicht mit der Erklärung begnügen, dass sein Gegenüber sich lediglich vor Straßenräubern schützen wollte.
Thomas Waterhouse’ Sorge war berechtigt. Seine Reise war in zweierlei Hinsicht gefahrvoll. Zum einen riskierte er als römischer Priester bereits durch seine Anwesenheit im protestantischen England den Galgen, denn aufgrund eines Gesetzes aus der Zeit Königin Elizabeths galt dies als Hochverrat. Auch wenn dieses Gesetz unter dem jetzigen König Charles II. nicht mehr angewendet wurde, reiste Waterhouse sicherheitshalber unter falschem Namen. Die Stimmung im Land konnte jederzeit umschlagen und die alten Gesetze gegen die Katholiken wiederbelebt werden. So schützte er im Falle einer Verhaftung zumindest seine Familie in Staffordshire. Waterhouse nahm die Gefahr in Kauf, um seiner Berufung zu folgen und seinen Glaubensgenossen in England als Priester und Seelsorger zu dienen. Zum anderen schmuggelte er in seinem Gepäck verbotene katholische Bücher und liturgische Gerätschaften, die für seine Ordensbrüder und andere im Land wirkende Priester bestimmt waren.
Um seine schmerzenden Muskeln zu entlasten, streckte Thomas Waterhouse behutsam seine Beine. Trotz aller Vorsicht stieß er dabei mit der Stiefelspitze an den Fuß seines Gegenübers, der brummend aus dem Schlaf fuhr.
»Verzeiht, Sir«, entschuldigte sich Waterhouse höflich. »Es ist so verteufelt eng in dieser Kutsche und dazu noch düster wie in einem Verlies.«
Sein Gegenüber lächelte verständnisvoll. »Schon gut. Ich hatte mir ohnehin fest vorgenommen, nicht einzuschlafen«, erwiderte er. »Ihr habt mir also einen Dienst erwiesen.« Ein Gähnen unterdrückend, schob der Reisende seinen Hut zurecht, der ihm ins Gesicht gerutscht war, und stellte sich vor: »Mein Name ist Sir William Fenwick. Ich reise so oft, dass mich selbst das Geschaukel einer Postkutsche nicht wach zu halten vermag.«
»Thomas Harding. Sehr erfreut«, erwiderte der Priester die Höflichkeit.
»Ihr sprecht wie ein Gentleman, Sir«, bemerkte Fenwick mit einem amüsierten Lächeln. »Verkehrt Ihr bei Hofe?«
»Nein, Sir, ich begnüge mich mit den Erträgen meines bescheidenen Gutes in Shropshire«, log der Jesuit. »Ein Leben bei Hof könnte ich damit nicht bestreiten.«
»Da habt Ihr allerdings recht. Die meisten Höflinge sind verschuldet, aber was bleibt einem anderes übrig? Wenn man sich bei Hof aufhält, ist man im Grunde verpflichtet, um hohe Einsätze zu spielen. Und gewinnen kann schließlich immer nur einer!«
Die anderen Reisenden lauschten aufmerksam dem Gespräch der beiden Männer. Auch der Vikar sah von seinem Buch auf.
»Was lest Ihr da, Sir?«, wandte sich Fenwick an den Geistlichen. »Lasst uns doch an Eurer Lektüre teilhaben.«
»Wenn Ihr darauf besteht«, entgegnete der Vikar zurückhaltend. »Es handelt sich um ein Essay von Dryden«, fügte er hinzu.
Thomas Waterhouse hatte den Eindruck, dass es dem Anglikaner unangenehm war, dass man ihn bei der Lektüre von Unterhaltungsliteratur erwischt hatte. Doch er bemühte sich, Haltung zu bewahren. Und da keiner der anderen Reisenden Einspruch erhob, begann er mit sonorer Stimme, die das Knarren und Quietschen des Kutschkastens übertönte, zu lesen.
Am Abend machte die Kutsche in einer Herberge außerhalb von Canterbury halt. Nach dem Nachtmahl zogen sich die Passagiere in ihre Kammern zurück, denn am nächsten Morgen sollte die Reise schon bei Tagesanbruch weitergehen.
Thomas Waterhouse, der sich beim Abendbrot mit Sir William Fenwick unterhalten hatte, wurde noch immer nicht recht schlau aus ihm. Seine guten Manieren und seine Kenntnisse über das Hofleben verrieten den Höfling, doch seiner unauffälligen Aufmachung nach war ihm nicht daran gelegen, Aufmerksamkeit zu erregen. Während ihres Gesprächs hatte er keine Erklärung für seine Reise preisgegeben, im Gegensatz zu den anderen Passagieren, die gern über ihre Pläne schwatzten.
Den Vormittag über kamen sie so gut voran, dass der Kutscher den Reisenden mitteilte, dass sie voraussichtlich gegen vier oder fünf Uhr in Southwark eintreffen würden. Sie würden überdies genug Zeit haben, in Ruhe das Mittagsmahl an der nächsten Poststation einzunehmen. Dankbar für die Gelegenheit, sich die Beine vertreten zu können, verließen die Passagiere die Kutsche, als diese im Hof der Herberge in Sittingbourne hielt. Nach dem üppigen Mittagsmahl schlug Sir William Fenwick vor, einen kleinen Verdauungsspaziergang durch den hinter der Herberge gelegenen Obstgarten zu machen. Thomas Waterhouse und Stackwell, der Vikar, stimmten zu, und gemeinsam ergingen sie sich zwischen den Obstbäumen, deren Blätter bereits die Farben des Herbstes annahmen. Es war ein angenehm warmer Oktobertag. Die Sonne lugte immer wieder zwischen den tiefhängenden grauen Wolken hindurch und ließ Gold, Rotbraun und die verschiedensten Grüntöne aufleuchten. Die Luft war erfüllt vom Summen der Insekten, die sich auf den letzten Blüten der Astern niederließen.
»Bei diesem günstigen Wetter kommt man mit der Postkutsche gut voran«, bemerkte Fenwick. »Ich habe die Reise von Dover nach London schon einmal im Winter bei Frost und Schneetreiben gemacht. Die Pferde mussten die ganze Strecke im Schritt gehen, und der Kutscher hielt ständig an, um die Hufe der Tiere vom Pappschnee zu befreien. Wir waren eine Ewigkeit unterwegs.«
»Man sollte es möglichst vermeiden, im Winter zu reisen«, sagte der Vikar weise.
»Leider zwangen mich dringende Geschäfte dazu«, erwiderte Sir William.
»Welcher Art Geschäfte geht Ihr nach, Sir, wenn ich fragen darf«, erkundigte sich der Geistliche.
»Darüber spricht ein Gentleman nicht, mein Lieber«, wies Fenwick den Neugierigen zurecht, was diesen erröten ließ.
Sir William hatte seine Handschuhe ausgezogen und in seine Tasche gesteckt. Thomas Waterhouse bemerkte, dass er kräftige, aber erstaunlich jugendliche Hände hatte, deren Innenflächen Schwielen aufwiesen. Der Jesuit vermutete, dass sie vom Halten der Zügel stammten und dass Fenwick folglich häufig zu Pferd unterwegs war.
Immer wieder umschwirrten Insekten die Köpfe der Männer, die sie mit wedelnden Armbewegungen zu verscheuchen suchten. Auf einmal schlug sich Sir William kräftig auf den Handrücken und gab einen unterdrückten Schmerzensschrei von sich.
»Verdammt! Irgendetwas hat mich gestochen«, rief er.
Waterhouse beugte sich vor und deutete auf ein im Todeskampf sich windendes Insekt zu seinen Füßen.
»Eine Wespe«, bemerkte er. »Ihr hättet nicht nach ihr schlagen sollen.«
»Ich dachte, es wäre eine Mücke«, erwiderte Sir William und betrachtete seine rechte Hand. Die Haut um den Stich begann bereits, sich zu röten und anzuschwellen.
»Ihr scheint gegenüber Insektenstichen empfindlich zu sein, mein Freund. Vielleicht wird es besser, wenn Ihr die Hand in kaltes Wasser haltet.«
Fenwick nickte zustimmend. Gemeinsam kehrten die Männer in den Innenhof der Herberge zurück. Ein Stallbursche fragte sie, ob sie etwas brauchten, und Sir William zeigte ihm den Wespenstich.
»Ihr habt Glück, Sir«, erklärte der Bursche fröhlich. »Annie, das Kräuterweib, hat gerade bei uns haltgemacht. Sie hat für jedes Gebrechen ein Mitteichen.«
»Und wo finde ich diese Kräuterfrau?«, erkundigte sich Fenwick interessiert.
»Seht Ihr das Weiblein da drüben bei dem Maulesel? Das ist Annie.«
Neugierig schloss sich der Jesuit Sir William an, als dieser sich dem bezeichneten Lasttier näherte, während der Vikar in den Schankraum zurückkehrte. Auf den ersten Blick schien es, als sei der Maulesel allein. Doch dann war über der Packtasche, die er auf dem Rücken trug, eine schmuddelige Leinenhaube zu erkennen, die ein von Runzeln geradezu grotesk zerfurchtes Frauengesicht umrahmte.
»Verzeiht die Störung«, sprach Fenwick die Alte höflich an. Das Hutzelweiblein, das damit beschäftigt gewesen war, im Gepäck des Maulesels zu kramen, richtete sich auf und blickte den beiden Männern aus kleinen grauen Augen aufmerksam entgegen.
»Wie kann ich helfen?«, fragte sie mit einer unerwartet jungen, wohlklingenden Stimme, die nicht so recht zu ihr passen mochte.
»Eine Wespe hat mich gestochen«, berichtete Fenwick und zeigte ihr seine Hand. »Der Stallbursche da drüben meinte, Ihr hättet möglicherweise eine lindernde Salbe.«
Prüfend beugte sich das Mütterchen über den Insektenstich, ohne die dargebotene Hand zu berühren. Dann nickte sie wortlos, griff in eine der Packtaschen auf dem Mauleselrücken und zog ein kleines Holzdöschen hervor.
»Reibt die Schwellung damit zweimal am Tag ein«, riet sie. »Dann geht sie schnell zurück, und Ihr werdet keinen Schmerz mehr spüren.«
Fenwick bezahlte dem Kräuterweib einen Shilling, den dieses mit einem zahnlosen Lächeln einsteckte. Während die beiden Männer zum Schankraum zurückschlenderten, öffnete Sir William die Dose und roch vorsichtig an dem Inhalt.
»Puh, das Zeug stinkt entsetzlich«, entfuhr es ihm.
Mit angewiderter Grimasse hielt er seinem Begleiter die Salbe unter die Nase.
»Ihr habt recht. Sie riecht ein wenig streng«, gab Waterhouse zu. »Was nicht heißen muss, dass sie nichts taugt.«
Seufzend überwand sich Fenwick, ein wenig Salbe auf seine geschwollene Hand zu schmieren.
»Es fühlt sich recht angenehm an«, gestand er schließlich. »Zumindest wird es nicht schlimmer.« Er schloss das Döschen und steckte es ein. »Ich denke, wir werden bald weiterfahren. Wenn Ihr mich entschuldigen wollt, Sir, ich habe wohl zu viel Bier getrunken.«
Waterhouse, der sich bereits vor ihrem Spaziergang im Obstgarten erleichtert hatte, nickte ihm zu und schlenderte zur Postkutsche hinüber. Offenbar war diese jedoch noch nicht zur Abfahrt bereit. Die Pferde standen in ihren Ständen und ließen sich ihr Futter schmecken. Mit entschuldigender Miene versuchte der Wirt, den ungeduldig auf und ab gehenden Kutscher zu beschwichtigen.
»Ich weiß auch nicht, was heute mit meinen Stallknechten los ist. Normalerweise dauert es nur eine Stunde, die Tiere zu füttern und zu tränken. Ich werde mir die Burschen einmal ordentlich zur Brust nehmen. In meinem Haus dulde ich keinen Müßiggang.«
Waterhouse entschied sich, wieder in den Schankraum zurückzukehren. Er setzte sich zu dem Vikar, der in seinem Buch las, und beobachtete durch das Fenster den Wirt und den Kutscher, die noch immer erregt diskutierten. Es begann zu nieseln. Der Jesuit hoffte, dass sie London erreichen würden, bevor ein heftiger Regenguss einsetzte und die Straße in einen Schlammpfad verwandelte. Er war gerade im Begriff einzunicken, als Stackwell neben ihm bemerkte: »Wie es scheint, geht es endlich weiter.«
Schlaftrunken schreckte Waterhouse aus seinem Schlummer und blickte zur Kutsche hinüber. Tatsächlich stiegen ihre Mitreisenden bereits ein. Nachdem der Jesuit sich ein wenig gestreckt hatte, um die Müdigkeit aus den Gliedern zu verscheuchen, folgte er dem Vikar in den Hof. Waterhouse warf noch einen prüfenden Blick auf seinen Reisekoffer und bestieg schließlich als Letzter die Kutsche. Die anderen Passagiere hatten bereits Platz genommen. Da die Ledervorhänge wegen des Regens geschlossen waren, herrschte im Innern des Kutschkastens Halbdunkel. Bemüht, niemandem auf die Zehen zu treten, setzte sich Thomas Waterhouse auf den äußeren Platz der Vorderbank. Das Gefährt schaukelte leicht hin und her, als der Kutscher nun ebenfalls aufstieg. Kurz darauf verließen sie den Innenhof der Herberge und bogen auf die Landstraße nach London ein.
Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, nahm der Jesuit die Begutachtung seiner Mitreisenden wieder auf. Dabei fiel sein Blick auf Sir William Fenwick, der ihm schräg gegenüber am Fenster saß. Ein plötzlicher Windstoß ließ den Ledervorhang flattern, so dass ein wenig graues Tageslicht auf Fenwicks Hände fiel. Von dem Wespenstich war nichts mehr zu sehen.
»Anscheinend hat die Salbe Wunder gewirkt, Sir William«, bemerkte Thomas Waterhouse beeindruckt. »Tut die Hand noch weh?«
Der Angesprochene, der den Hut tief in die Stirn gezogen hatte, antwortete mit einem unverständlichen Brummen. Offenbar fiel es ihm schwer, eingestehen zu müssen, dass die Heilsalbe des alten Kräuterweibs doch ganz nützlich war.
Der Apotheker, der neben Waterhouse auf der Vorderbank saß, horchte auf.
»Darf ich fragen, worum es geht, Gentlemen?«, fragte er höflich, jedoch ohne seine Neugier verbergen zu können.
In kurzen Worten fasste der Jesuit die Ereignisse zusammen. »Das ist äußerst interessant«, kommentierte der Apotheker. »Diese Krämerinnen besitzen mitunter ein umfangreiches Wissen über Heilkräuter, von dem sich unsereins eine Scheibe abschneiden kann. Habt Ihr die Salbe noch, Sir? Könnte ich sie einmal sehen?«
Sir William stieß einen hörbaren Seufzer aus, ließ sich dann aber doch dazu herab, in seinen Taschen nach dem Döschen zu kramen. Als er es dem Apotheker reichte, betrachtete Thomas Waterhouse seine Hand aus der Nähe und stellte fest, dass die Schwellung tatsächlich völlig zurückgegangen war. Gespannt zog der Apotheker den Deckel von dem Salbendöschen ab. Sofort verbreitete sich der starke Kräutergeruch im Innern des Kutschkastens. Die Gattin des Junkers rümpfte angewidert die Nase.
»Das riecht nicht gerade angenehm, Sir«, beschwerte sie sich. »Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr die Dose wieder verschließen würdet.«
Errötend beeilte sich der Apotheker, ihrer Bitte nachzukommen, konnte sich aber nicht so recht entscheiden, die geheimnisvolle Salbe an ihren Eigentümer zurückzureichen.
»Da Eure Beschwerden bereits abgeklungen sind, Sir«, wandte er sich schließlich an Fenwick, »würdet Ihr mir das Döschen überlassen? Ich bin sehr erpicht darauf, die Inhaltsstoffe der Salbe zu ergründen. Ich kaufe sie Euch auch gern ab.« Doch Sir William winkte ab, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust, um seinen Mitreisenden deutlich zu machen, dass er seine Ruhe haben wollte.
Kapitel 2
Am späten Nachmittag erreichte die Postkutsche London und fuhr in den Hof einer Herberge in Southwark. Thomas Waterhouse, der ein scharfes Auge auf seine Reisetruhe hatte, fand keine Gelegenheit, sich von seinen Mitreisenden zu verabschieden. Er erhaschte nur noch einen Blick auf Sir William Fenwick, der nicht einmal sein Gepäck mitnahm, sondern mit schnellen Schritten den Hof verließ.
Ein Hackney brachte den Jesuiten zu einer Herberge im Norden Londons außerhalb der Stadtmauern. Zwei Tage später fuhr er in der Postkutsche durch die fruchtbaren Grafschaften Buckinghamshire, Oxfordshire und Gloucestershire. Am dritten Abend war das Ziel der Reise, die kleine Stadt Worcester, schließlich erreicht.
Während Thomas Waterhouse darauf wartete, dass seine Truhe abgeladen wurde, sah er sich aufmerksam im Hof der Herberge um. Der Wirt kam aus der Schankstube, um sie willkommen zu heißen. Reitknechte spannten die Pferde aus, nahmen ihnen das Geschirr ab und führten sie in den Stall. Dann holten sie Futter und Wasser für die Tiere. Ein Mann, der einen Fuchs mit einer Blesse striegelte, fiel dem Jesuiten auf. Beim Eintreffen der Postkutsche hatte er in seiner Arbeit innegehalten und das Treiben der Fahrgäste und Reitknechte beobachtet. Als der Wirt zu Waterhouse trat, um ihm seine Kammer zuzuweisen, band der Mann den Fuchs los und brachte ihn in den Stall.
Vor dem Nachtmahl verließ der Jesuit sein Zimmer und trat auf die Galerie hinaus, über die man vom Hof zu den Kammern gelangte. Die Arme auf das Geländer gestützt, ließ er den Blick umherschweifen. Scheinbar gelangweilt kaute er auf einem Strohhalm, den er vom Boden aufgelesen hatte. Doch in Wahrheit waren alle seine Sinne wachsam.
Er brauchte nicht lange zu warten. Die Daumen in den Gürtel geklemmt, trat der Mann, der zuvor den Fuchs gestriegelt hatte, aus dem im Schatten liegenden Eingang des Stalls und schlenderte über den Hof. Als er die Treppe zur Galerie erreicht hatte, spuckte Waterhouse den Strohhalm aus. Daraufhin nahm der Fremde die Daumen aus seinem Gürtel und stieg ohne Eile die Stufen hinauf.
»Seid Ihr Harding?«, fragte er den Jesuiten.
»Ja«, bestätigte dieser.
»Morgen früh wird Euch ein Wagen abholen«, erklärte der Mann. »Haltet Euch gegen zehn Uhr bereit.«
Waterhouse nickte, und der Fremde ging weiter. Als sich der Jesuit zur Schankstube begab, sah er ihn auf dem Fuchs davonreiten.
Wie verabredet, rumpelte am nächsten Morgen ein vierrädriger Leiterwagen in den Hof der Herberge. Das Zugpferd wurde von dem Burschen gelenkt, der Thomas Waterhouse am Abend zuvor angesprochen hatte. Ein zweiter hochgewachsener, schlanker Mann in bescheidener ländlicher Kleidung saß auf der Ladefläche. Als der Jesuit ihn erkannte, breitete sich trotz aller Beherrschung ein Lächeln der Freude über sein Gesicht. Der Mann mit dem hageren Raubvogelgesicht war sein Ordensbruder Jeremy Blackshaw, den er aus seiner Studienzeit am Englischen College in Rom kannte. Und obgleich sie einander seit fünfzehn Jahren nicht gesehen hatten, hätte Waterhouse dieses unverwechselbare Gesicht mit der hohen glatten Stirn, den eindringlichen grauen Augen, der schmalen Hakennase und dem entschlossen wirkenden Mund überall wiedererkannt.
Als der Fuhrknecht das Pferd zügelte, sprang Jeremy ungeduldig aus dem Wagen und trat seinem Ordensbruder entgegen. Nun, da er unmittelbar vor Waterhouse stand, bemerkte dieser doch die Veränderungen, die seit ihrer letzten Begegnung die Züge seines Freundes gezeichnet hatten. Jeremys hohe Wangenknochen ließen sein Gesicht ausgehöhlt erscheinen, in den Augenwinkeln zerschnitt ein Fächer kleiner Fältchen seine von der Landluft gebräunte Haut, und von den Nasenflügeln zogen sich zwei tiefe Falten bis zu den Mundwinkeln. Sein entgegen der Mode kurzgeschnittenes dunkelbraunes Haar war an den Schläfen ergraut. Zudem wirkte sein ohnehin schlanker Körper noch magerer als früher.
»Ich freue mich, Euch zu sehen, mein lieber Freund«, rief Waterhouse mit einem warmen Lächeln.
»Ihr habt Euch kaum verändert«, erwiderte Jeremy. Sie waren beide zu erfahren in der Kunst der Verschwiegenheit, um sich in der Öffentlichkeit beim Namen zu nennen.
»Ihr auch nicht«, entgegnete Waterhouse, fügte nach kurzem Zögern jedoch hinzu: »Allerdings macht Ihr den Eindruck, als hättet Ihr Euch gerade erst von einer schweren Krankheit erholt. Ich hoffe, es geht Euch besser.«
Dies rief ein Lächeln auf Jeremys Gesicht. »Wie ich sehe, ist Eure Beobachtungsgabe noch ebenso scharf wie früher. Aber lasst uns aufbrechen. Wir können uns später in Ruhe unterhalten.« Inzwischen war auch der Fuhrknecht abgestiegen und machte sich daran, mit Waterhouse’ Hilfe dessen Reisetruhe auf den Wagen zu hieven. Als das Gepäckstück sicher verstaut war, nahmen die beiden Jesuiten auf der Ladefläche Platz.
»Wir können fahren, William«, sagte Jeremy.
Der Diener trieb das Zugpferd mit einem Zungenschnalzen an und lenkte das Gefährt durch das Tor aus dem Hof der Herberge hinaus. Die engen Straßen von Worcester, überragt von den vorkragenden Stockwerken der Fachwerkhäuser, waren gerade breit genug, dass zwei Fuhrwerke einander passieren konnten.
»Ich hätte bereits zwei Tage früher hier sein können«, erklärte Thomas Waterhouse, »doch die Postkutsche aus Dover hatte Verspätung, so dass ich den Anschluss nach Chester verpasste ...«
Waterhouse bemerkte plötzlich, dass sein Ordensbruder ihm nicht zuhörte. Jeremys Blick war starr ins Leere gerichtet. Sein Gesichtsausdruck wirkte abwesend, fast gequält. Beunruhigt legte Waterhouse ihm die Hand auf den Arm.
»Was ist mit Euch?«
Jeremy schrak wie aus einem Traum auf. »Ach nichts ... nur Erinnerungen an eine schreckliche Zeit ...« Er schluckte schwer, und sein Blick klärte sich. »Vor zwanzig Jahren, nach der Schlacht von Worcester, erwachte ich in einer dieser Gassen, nachdem mich ein Soldat der Parlamentsarmee mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen hatte. Ich verdanke mein Leben nur der Tatsache, dass er zuvor seine Muskete abgefeuert hatte, um einen meiner Kameraden zu töten.«
»Ihr dürft Euch nicht schuldig fühlen, weil Ihr überlebt habt, Bruder«, sagte Waterhouse eindringlich. »Euer Schicksal lag allein in Gottes Hand. Es war Seine Entscheidung, Euch zu verschonen. Er muss andere Pläne für Euch gehabt haben.« »Vielleicht ...« Jeremy seufzte und ließ den Blick wieder über die Häuser gleiten. »Ich glaubte, ich würde die Gasse wiedererkennen, in der ich erwachte ... unter den Leibern der Toten, die mich beinahe erstickten ...«
»Denkt nicht mehr daran«, beschwor Waterhouse ihn. »Es ist vorbei.«
»Nein, das ist es nicht«, widersprach Jeremy. »Leider gibt es jemanden, der mich stets an jenen furchtbaren Tag erinnert. Und doch ist sie zugleich die größte Freude in meinem Leben.« Thomas Waterhouse hatte das Gefühl, dass sein Ordensbruder mehr preisgegeben hatte als beabsichtigt, und so überging er die Bemerkung und wechselte das Thema.
»Wie weit ist es bis Melverley Court?«
»Um die Mittagszeit werden wir dort sein«, klärte William ihn auf.
Sie folgten der römischen Straße, die durch das Städtchen Droitwich führte, und bogen schließlich nach Westen in einen schmalen Fuhrweg ein. Zum Glück hatte der Regen der letzten Tage nachgelassen, und der Untergrund war unter dem frischen herbstlichen Wind getrocknet, so dass sie trotz der schlechten Wegverhältnisse gut vorankamen.
Die Sonne hatte ihren höchsten Stand erreicht, als William das Zugpferd in eine Einfahrt lenkte, die auf ein prächtiges, aus Stein gebautes Haus zuführte. Umgeben von sorgfältig angelegten Gärten mit hohen Bäumen, die in Gold- und Rottönen prangten, wirkte es durch seine Abgeschiedenheit wie von der Außenwelt vergessen.
Während sie sich Melverley Court näherten, betrachtete Thomas Waterhouse bewundernd die von Efeu überrankte Fassade. Wie viele Häuser, die zur Zeit Königin Elizabeths gebaut worden waren, war es in Form eines H angelegt. Die Giebel des West- und des Ostflügels verfügten über zweigeschossige Erkerfenster, durch die die Räume zusätzliches Licht erhielten. Ungewöhnlich fand Waterhouse den vierstöckigen Turm im Winkel zwischen dem mittleren Gebäudeteil und dem Ostflügel, der mit einem Zinnenkranz und einer Kuppel verziert war. Das Fuhrwerk hielt vor einer Treppe, die zu einer vorgelagerten Terrasse hinaufführte. Als William vom Wagen sprang, um den beiden Priestern beim Aussteigen zu helfen, eilte ein weiterer Diener in schwarz-blauer Livree herbei, um die Ankömmlinge willkommen zu heißen.
»Wo befindet sich Ihre Ladyschaft?«, fragte Jeremy.
»Im Salon, Doktor«, erwiderte der Lakai.
»Und Mr. Mac Mathúna?«
»In den Ställen, Sir. Offenbar ist es bald so weit. Die Stute hat sich bereits hingelegt, und die Wasser sind gebrochen. Soll ich Mr. Mac Mathúna holen?«
»Nein, Harry«, wehrte Jeremy ab, »er wird kommen, wenn er es für sicher hält, Ceara zu verlassen.«
Mit neugieriger Miene hatte Thomas Waterhouse dem Wortwechsel gelauscht.
»Wer ist dieser Mac Mathúna?«, erkundigte er sich. »Ein Stallknecht?«
Jeremy wandte schmunzelnd den Kopf. »Keineswegs«, belehrte er seinen Ordensbruder. »Auch wenn er sich vorzüglich auf Pferde versteht. Mr. Mac Mathúna ist Lady St. Clairs Gemahl. Ich habe sie selbst getraut. Leider wurde die Ehe ohne die Zustimmung des Königs geschlossen und muss daher geheim bleiben.«
»Dann nehme ich an, dass es sich um eine Liebesheirat gehandelt hat«, vermutete Waterhouse. »Eine Seltenheit in unserer Zeit.« Gespannt, seine Gastgeber kennenzulernen, folgte er Jeremy durch die Eingangspforte am Fuße des Turms, vorbei an einer Wendeltreppe, die in die oberen Stockwerke führte, in den Großen Saal des Mittelbaus. Durch eine Tür zur Linken gelangten sie in den Salon im Westflügel, der von der Einrichtung aus dunklen Eichenmöbeln vergangener Epochen beherrscht wurde.
Bei ihrem Eintreten erhoben sich zwei Frauen von ihren Sitzgelegenheiten, eine schwarzhaarige und eine brünette, eine schöner als die andere.
Beeindruckt verbeugte sich Waterhouse vor den Damen und lächelte ihnen zu. Dabei dachte er bei sich: Wenn ich nicht wüsste, wie wenig sich Jeremy Blackshaw aus den Reizen des weiblichen Geschlechts macht, würde ich mir ernstliche Sorgen um sein Seelenheil machen!
»Mylady, dies ist mein Ordensbruder Thomas Waterhouse«, stellte Jeremy seinen Begleiter vor.
Als die junge Frau mit den schwarzen Haaren vortrat und dem Ankömmling mit einer graziösen Geste die Hand reichte, fiel es diesem nicht schwer, zu glauben, dass sie bei Hof verkehrt und über mehrere Jahre die Mätresse König Charles’ II. gewesen war. Ihre Züge waren wohlgeformt, die großen schwarzen Augen verrieten Intelligenz und einen wachen Geist, ihre Haut war makellos und besaß eine südländische Tönung. Amoret St. Clair trug ein schlichtes Kleid aus blauem Damast. Es bestand aus einem oberen Rock, dem Manteau, der vorn aufgeschnitten und über die Hüften nach hinten gerafft war, und einem unteren Rock aus schimmerndem Satin. Das Mieder endete vorn in einer abgesteiften Spitze, die Amorets schmale Taille betonte. Obgleich das Gewand, abgesehen von einem Besatz aus weißer Spitze am Halsausschnitt, schmucklos war, trug sie es mit so viel Eleganz, dass sie ohne weiteres darin bei Hofe hätte erscheinen können.
»Ich freue mich, Euch kennenzulernen, Pater«, sagte sie und betrachtete ihn interessiert.
Waterhouse war kleiner als Jeremy und besaß einen rundlichen Körperbau. Er trug das lockige dunkelblonde Haar bis auf die Schultern und war in Wams und Kniehosen eines einfachen Landedelmanns gekleidet. Diese Rolle spielte er vorzüglich. Galant verbeugte er sich vor ihr.
»Eine Ehre, Mylady.«
Mit einem herzlichen Lächeln wandte sich Amoret der jungen Frau an ihrer Seite zu. »Meine treue Freundin, Mademoiselle de Roche Montai. Vor ihr könnt Ihr so offen sprechen wie vor mir und Pater Blackshaw«, versicherte sie.
»Sehr erfreut, Mademoiselle«, begrüßte Waterhouse die Französin.
Wie Amoret trug auch Armande de Roche Montai das braune Haar der Mode entsprechend in langen Locken offen bis zur Taille. Nur ein Teil war aus der Stirn gekämmt, am Hinterkopf zu einem Knoten gedreht und mit einer Perlenschnur umwunden. Ihr Kleid aus dunkelbraunem Samt harmonierte wundervoll mit ihrer goldfarben schimmernden Haut und ihren braunen Augen.
In diesem Moment tauchten William und der Lakai in der Tür auf und schleppten keuchend und schnaufend die Reisetruhe des Ankömmlings über die Schwelle.
»Was habt Ihr uns mitgebracht, Pater?«, fragte Amoret amüsiert, während sie die beiden Diener beobachtete, die mit einem erleichterten Seufzen das schwere Gepäckstück zu Füßen ihrer Herrin abstellten und sich zurückzogen.
Der Jesuit lächelte breit und antwortete im Verschwörerton: »Darin befindet sich genug Schmuggelware, um mich für einige Jahre in den Kerker zu bringen, Madam.«
»Weshalb habt Ihr dann das Risiko auf Euch genommen, die ›Ware‹ in Eurem Gepäck zu befördern?«, erkundigte sich Amoret erstaunt. »Wäre es nicht sicherer gewesen, zumindest die Bücher auf dem üblichen Weg über eine der versteckten Buchten an der Küste von Essex ins Land zu schmuggeln?«
»Jetzt, da sich nach dem Sturz von Lord Chancellor Clarendon sogar die Dissenters, die ebenfalls verbotene Literatur ins Land schaffen, einer gewissen Toleranz erfreuen, wird man bei der Einreise nicht mehr durchsucht«, belehrte Thomas Waterhouse sie. »So bot sich mir die Gelegenheit, einige Kleinigkeiten aus Rom mitzubringen. Es ist aber auch ein Stoß Douai-Bibeln dabei.«
Während sich Jeremy erwartungsvoll die Hände rieb, zog Waterhouse einen Schlüssel unter seinem Wams hervor, den er an einem Band um den Hals getragen hatte, und steckte ihn in das Schloss der Reisetruhe. Der Inhalt wirkte unverdächtig: ein zweites Wams aus dunklem Tuch, Kniehosen, Strümpfe, mehrere Hemden, gestärkte Kragen und ein warmer Umhang. Nachdem er die Kleider herausgehoben und auf einem Stuhl gestapelt hatte, nahm Waterhouse sein Speisemesser aus dem Gürtel und steckte die Spitze in eine unsichtbare Ritze am Boden der Truhe. Dieser ließ sich nun leicht anheben. Darunter kamen mehrere Bündel zum Vorschein. Neugierig griff Amoret in die Truhe, nahm eines der Päckchen heraus und schlug das Tuch zur Seite. Es enthielt eine Monstranz aus Silber.
»Eine schöne Arbeit«, bemerkte Jeremy, der das Schaugefäß von Amoret entgegennahm.
In den anderen Bündeln befanden sich die erwähnten Bibeln in englischer Sprache, die für die Mission in Douai gedruckt wurden, Rosenkränze aus Stechpalmenholz, Altarsteine, die sich bequem in die Tasche stecken ließen, Messkelche und Patenen aus Zinn, Kerzenständer, eine Pyxis und ein kleines Weihrauchfass.
Während sie den mitgebrachten Schatz begutachteten, erkundigte sich Thomas Waterhouse: »Verfügt Melverley Court eigentlich über Priesterkammern, Madam?«
»Ich bin dessen sicher«, erwiderte Amoret überzeugt. »Natürlich durfte ich als Kind nicht einmal von ihrer Existenz wissen. Und mein Vater hat das Geheimnis um ihre Lage mit ins Grab genommen, als er bei der Schlacht von Worcester fiel. Aber die meisten Häuser katholischer Familien hier in der Gegend verfügen über Verstecke sowohl für Priester als auch für das Messgerät. Vielleicht gelingt es Pater Blackshaw eines Tages, sie aufzuspüren.«
Der Angesprochene sah nicht auf und ging auch nicht auf Amorets Bemerkung ein. Diese bereute es, die Schlacht von Worcester erwähnt zu haben, denn sie wusste, dass der Jesuit nicht gern daran erinnert wurde. Um das bedrückende Schweigen zu durchbrechen, wechselte Amoret rasch das Thema.
»Ihr müsst von der langen Reise hungrig und durstig sein, Pater. Was darf ich Euch anbieten? Trinkt Ihr Wein oder Ale? Oder zieht Ihr wie Euer Ordensbruder Tee vor?«
»Danke, Mylady. Ein Humpen Ale wäre mir jetzt sehr willkommen«, antwortete Waterhouse schmunzelnd. »Da ich nicht wie Pater Blackshaw das Glück hatte, das ferne Indien zu bereisen und dort dieses chinesische Getränk kennenzulernen, das Ihre Majestät die Königin so sehr schätzt, bleibe ich lieber beim Altbewährten.«
Nachdem Armande de Roche Montai einen Diener in die Küche geschickt hatte, um Erfrischungen zu holen, nahm der Besucher auf einem hochlehnigen Stuhl Platz.
»Während meiner Reise habe ich eine faszinierende Beobachtung gemacht, die auch Euch interessieren dürfte, Bruder«, berichtete Thomas Waterhouse. »In der Postkutsche von Dover nach London kam ich mit einem seltsamen Mann namens Sir William Fenwick ins Gespräch. Er behauptete, bei Hof zu verkehren. Sagt Euch der Name etwas, Mylady?«
Amoret legte die Stirn in Falten. »Ich bin nicht sicher. Gehört er der älteren Generation an?«
Waterhouse nickte. »Ich würde ihn auf etwa fünfzig Jahre schätzen.«
»Vielleicht ein Veteran des Bürgerkriegs«, mutmaßte Amoret. »Ich wurde nicht recht schlau aus ihm«, fuhr der Jesuit nachdenklich fort. »Er sprach wie ein Höfling und trug den Degen, doch ansonsten war seine Kleidung bescheiden wie die eines einfachen Landedelmanns. Zudem reiste er offensichtlich viel.«
»Und wie seid Ihr zu dieser Überzeugung gekommen, Bruder?«, fragte Jeremy.
»Indem ich Eure Methode der genauen Beobachtung anwandte, mein Freund«, antwortete Waterhouse neckend und zählte seinem Ordensbruder die Einzelheiten auf, die ihm an Sir Williams Aufmachung und Verhalten aufgefallen waren.
»Sehr gut«, meinte Jeremy zufrieden und lehnte sich in seinem Armlehnstuhl zurück.
»Aber das ist es eigentlich nicht, was ich Euch erzählen wollte«, besann sich der Besucher. »In einer Herberge in Sittingbourne, in der wir haltmachten, um das Mittagsmahl einzunehmen, vertraten wir uns ein wenig die Beine, als Sir William von einer Wespe in die Hand gestochen wurde. Sein Handrücken schwoll innerhalb kurzer Zeit an.«
»Hm, manche Menschen reagieren empfindlich auf Insektenstiche«, bestätigte Jeremy.
»Ein Stallbursche empfahl uns daraufhin die Dienste einer fahrenden Kräuterhändlerin, die sich zufällig in der Herberge aufhielt«, fuhr Waterhouse fort. »Sie verkaufte Sir William eine Salbe, die einen entsetzlichen Geruch verströmte, aber erstaunlich wirkungsvoll war. Etwa eine halbe Stunde später war von der Schwellung nichts mehr zu sehen.«
Jeremys Augen leuchteten auf, und auf seine hageren Züge trat ein Ausdruck höchsten Interesses. Er wirkte wie ein Jagdhund, der die Spur des Wildes aufgenommen hatte.
»Habt Ihr diese ungewöhnliche Wirkung mit eigenen Augen beobachtet?«, fragte er.
»Aber ja«, bestätigte Waterhouse. »Zwar war es ein wenig düster in der Kutsche, aber ich könnte schwören, dass Sir Williams Hand so unversehrt war wie vor dem Wespenstich.« »Habt Ihr eine Ahnung, was die Salbe enthielt?«
»Leider nein. Das Kräuterweib erwähnte nichts dergleichen, und am Geruch allein konnte ich nicht erkennen, welche Heilpflanzen sie darin verarbeitet hatte.«
»Wie bedauerlich, dass Ihr Euch keine Probe von dieser Wundersalbe habt geben lassen.«
»Nun, der Gedanke kam mir«, gestand Waterhouse zerknirscht. »Aber einer der anderen Passagiere, ein Apotheker, überredete Sir William, ihm die Dose zu überlassen. Auch er war fasziniert von der Wirkung der Salbe.«
»Das ist sehr schade. Ihr habt also nichts, um diese schöne Geschichte zu untermauern, die, mit Verlaub, völlig unglaubwürdig ist«, fasste Jeremy tadelnd zusammen.
»Ihr bezweifelt meine Worte?«, fragte Waterhouse erstaunt. Auch Amoret blickte ihren Beichtvater verwundert an, den sie nur als ausgeglichenen und freundlichen Menschen kannte. Diese plötzliche Schroffheit passte nicht zu ihm und erfüllte sie mit Sorge.
»Mir ist noch nie ein Heilmittel untergekommen, das eine so rasche Wirkung auf eine Schwellung ausübt«, bekräftigte Jeremy. »Ihr müsst Euch getäuscht haben.«
»Aber, mein lieber Freund, ich versichere Euch, dass ich weiß, was ich gesehen habe«, beharrte Waterhouse. Doch auf einmal überkamen auch ihn Zweifel. War es tatsächlich die rechte Hand gewesen, mit der Fenwick dem Apotheker das Salbentöpfchen gereicht hatte? Angestrengt rief er sich die Szene in der Postkutsche ins Gedächtnis zurück. Er sah Fenwick vor seinem inneren Auge in seinen Taschen kramen und die Dose hervorziehen. Ja, er war sicher, dass Sir William seine rechte Hand benutzt hatte!
»Würde es Euch Freude machen, meinen Sohn zu sehen, Pater?«, unterbrach Amoret den Gedankengang ihres Gastes. Sie war von ihrem Stuhl aufgestanden, um den hitzigen Wortwechsel der beiden Priester zu beenden. Erleichtert lächelnd nickte Waterhouse.
»Sehr gern, Mylady.«
Amoret trat zur Tür des Salons und trug dem draußen bereitstehenden Diener auf, die Amme zu bitten, ihren Sohn herzubringen. Kurz darauf erschien ein feistes Bauernmädchen mit blondem Haar und braungebranntem Gesicht mit einem kleinen Bündel auf dem Arm. Thomas Waterhouse erhob sich und betrachtete das winzige Gesicht des Säuglings, der fest schlief. »Das ist mein Sohn Daimhín«, erklärte Amoret stolz. »Er ist gerade dreieinhalb Wochen alt.«
»Ich gratuliere Euch, Mylady«, sagte Waterhouse. »Er ist allerliebst. Man sieht es Euch nicht an, dass die Niederkunft weniger als einen Monat her ist, wenn ich das sagen darf, Madam.«
»Leicht war sie nicht, muss ich gestehen«, erwiderte Amoret lächelnd. »Ich konnte mich glücklich schätzen, dass mir die beiden besten Ärzte beistanden, die ich kenne.«
»Pater Blackshaw?«, fragte Waterhouse interessiert, da er über Jeremys Vergangenheit als Feldscher und Medikus im Bilde war.
Die junge Mutter nickte bestätigend. »Er und sein Freund Meister Ridgeway, der dafür aus London angereist war. Inzwischen ist er wieder zurückgefahren, da er seine Chirurgenstube nicht so lange im Stich lassen kann.«
»Und wann werde ich den Vater Eures Sohnes kennenlernen, Mylady?«
»Bald, hoffe ich«, entgegnete Amoret, die den Blick nicht von dem Säugling abwenden konnte. »Wenn Ihr nicht zu ermüdet von der Reise seid, Pater, könnten wir in den Stall hinübergehen und nachsehen, wie es um Ceara steht«, schlug sie schließlich vor. »Sie bekommt ihr erstes Fohlen. Deshalb will mein Gatte sie nicht den Stallburschen überlassen.«
In diesem Moment waren Schritte zu hören, die sich dem Salon näherten. Ein junger Mann erschien in der Tür, den Waterhouse zuerst für einen Stallknecht hielt, denn der Bursche trug ein Hemd, dessen Ärmel mit Blut beschmiert waren, fleckige Kniehosen und Reitstiefel. Doch ein Blick in Lady St. Clairs Richtung belehrte ihn rasch eines Besseren. Ihre Augen leuchteten auf, und ihre Lippen öffneten sich zu einem glücklichen Lächeln. Es war das Gesicht einer Liebenden.
»Mein Gemahl, Breandán Mac Mathúna«, stellte sie ihn vor. »Liebster, unser Gast Pater Waterhouse.«
Der seltsam gekleidete Bursche begrüßte den Jesuiten mit einer eleganten Verbeugung, an der kein Höfling etwas auszusetzen gehabt hätte. Als der Priester den jungen Mann genauer betrachtete, verstand er, weshalb Lady St. Clair ihm so zugetan war. Er war ausgesprochen gutaussehend, mit ebenmäßigen feinen Zügen, undurchdringlichen blauen Augen und einem wohlgeformten Mund. Vom Körperbau her war der Ire eher schlank, fast grazil, aber seine muskulösen Arme verrieten Kraft und Geschmeidigkeit. Doch es war nicht allein die Vollkommenheit seines Aussehens, die faszinierte. Darüber hinaus besaß Breandán Mac Mathúna eine besondere Ausstrahlung, die sicherlich viele Frauen für ihn einnahmen.
»Verzeiht meine Aufmachung, Pater«, entschuldigte sich der Ire. »Ich ziehe mich rasch um.« An die anderen Anwesenden gewandt, verkündete er: »Ceara und das Fohlen sind gesund. Es ist ein kleiner Hengst.«
»Wie schön!«, entfuhr es Armande.
»Dem Herrn sei Dank.« Jeremy seufzte.
Während des Mittagsmahls berichtete Thomas Waterhouse seinen Gastgebern von seinen weiteren Plänen.
»Pater Jones, ein hochbetagter Seminarpriester, der den Haushalt von Lady Thurborne betreut, ist schon seit einiger Zeit gesundheitlich nicht mehr in der Lage, seine Aufgaben zu versehen«, erklärte der Jesuit. »Mylady Thurborne hat darum ersucht, ihr Ersatz zu schicken. Ihr Sohn reiste dazu eigens nach Rom und sprach bei General Oliva vor.«
»Aber Ihr werdet doch noch ein paar Tage unser Gast sein?«, bat Amoret. Sie hatte das Gefühl, dass das Landleben Pater Blackshaw zu langweilen begann. Zwischen der Ernte und den langen dunklen Tagen des Winters, die vor ihnen lagen, gab es keine Rätsel zu lösen, und sie bemerkte, wie ihr Beichtvater zunehmend rastlos und ein wenig launisch wurde. Geistige Untätigkeit war ihm zuwider. Amoret hatte gehofft, dass der Besuch seines Ordensbruders ihn aufheitern würde. Sicherlich gab es genug interessanten Gesprächsstoff, mit dem sich die beiden die Zeit vertreiben konnten.
»Ich bleibe gern noch eine Weile, Mylady«, stimmte Waterhouse zu.
Jeremy schenkte Amoret ein Lächeln, das ihr verriet, dass er sie durchschaute und ihr für die Einladung seines Ordensbruders dankbar war.
Nach dem Essen zeigte Amoret ihrem Gast den Rest des Hauses, bevor sie alle gemeinsam in den Stall gingen und das neugeborene Fohlen betrachteten. Es war ein kleiner schwarzer Hengst mit einer weißen Stirnblesse, der seinem Vater, Breandáns Rappen Leipreachán sehr ähnlich sah. Schließlich fragte der Ire den Jesuiten, ob er ein guter Reiter sei, und als dieser bejahte, schlug Breandán ihm vor, einen Ausritt über die Ländereien von Melverley Court zu unternehmen. Amoret begleitete sie.
Am Abend beobachtete die Hausherrin mit Erleichterung, wie sich Pater Blackshaw mit seinem Ordensbruder zum Schachspiel niederließ. Hin und wieder warf sie einen Blick zu den beiden Priestern hinüber, während sie ihrem Gatten lauschte, der einige irische Lieder sang und dazu Gitarre spielte. Sie liebte das Gälische mit seinen weichen dunklen Lauten, das jede flüchtige Bemerkung wie eine Liebeserklärung klingen ließ. Nach Jahren der Unterweisung durch ihren Mann sprach sie es selbst nun recht fließend, doch zu ihrem Unwillen war ihr englischer Akzent noch immer deutlich zu hören. Wahrscheinlich würde es ihr nie gelingen, Gälisch so einwandfrei zu sprechen wie Französisch, das sie als Kind gelernt hatte.
Im Laufe des Abends fiel Amoret auf, dass Pater Blackshaw zweimal beim Schachspiel verlor, obgleich er außergewöhnlich gut spielte. Wieder überkam sie die Sorge um ihren Beichtvater. Er hätte sich längst von dem letzten Abenteuer, das nun bereits ein halbes Jahr zurücklag, erholen müssen. Doch seine Genesung schien kaum Fortschritte zu machen. Noch immer wirkte er mager und ausgemergelt und war oftmals geistig abwesend. Vielleicht sollte sie Meister Ridgeway schreiben und ihn noch einmal herbitten, damit er seinen Freund gründlich untersuchte.
Jeremy war sich Amorets besorgter Blicke bewusst, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ. Und so war er auch nicht überrascht, als er ihr auf dem Weg zu seinem Gemach begegnete, nachdem er seinen Ordensbruder vor dessen Kammer eine gute Nacht gewünscht hatte.
»Seid Ihr nicht müde, Mylady? Wir haben alle einen anstrengenden Tag hinter uns«, neckte er sie.
»Geht es Euch gut, Pater?«, fragte sie mit ernster Miene. »Ihr wart heute nicht recht bei der Sache.«
»Ich hing nur meinen Erinnerungen nach, Mylady«, erwiderte er ausweichend. »Gewährt einem alten Mann ab und an dieses Privileg.«
Amorets Augenbrauen zogen sich zusammen. »Offenbar waren es keine guten Erinnerungen. Was immer es ist, vergesst es, Pater. Diese Grübeleien tun Euch nicht gut.«
»Ihr habt recht«, gab er zu. »Aber es ist nicht leicht, gewisse Erlebnisse aus dem Gedächtnis zu streichen.«
Auf einmal ahnte Amoret, wovon er sprach. »Euer Besuch in Worcester hat die Erinnerung an die Schlacht von Einundfünfzig geweckt, nicht wahr? Ich hätte es wissen müssen und Euch nicht fahren lassen dürfen«, sagte sie zerknirscht. »Es muss furchtbar für Euch gewesen sein. Aber es ist nun siebzehn Jahre her. Ihr müsst darüber hinwegkommen.« Eindringlich sah sie ihn an. »Ihr hättet meinen Vater nicht retten können! Macht Euch deswegen keine Vorwürfe.«
Wie stets überrascht über ihre Fähigkeit, seine Gedanken zu lesen, sah Jeremy ihr nach, während sie den dunklen Gang zu ihrem Gemach entlangschritt und schließlich um eine Ecke verschwand.
Kapitel 3
September 1651
Zum wiederholten Mal prüfte Jeremy den Inhalt seiner Feldkiste. Salben, Wundtränke, Charpie, Schermesser, Lanzetten, Zangen, Kugelbohrer, Nadeln ... alles lag bereit. Seufzend schloss er den Deckel der Holzkiste und sah zu dem Kameraden hinüber, der beharrlich Laken in Streifen riss, die als Verbände dienen würden.
»Glaubt Ihr, wir haben eine Chance?«, fragte Alan Ridgeway, als er den besorgten Blick seines Freundes bemerkte.
»Gegen Cromwells ›Eisenseiten‹? Nachdem fast die Hälfte unserer schottischen Verbündeten desertiert ist?«, fasste Jeremy sarkastisch zusammen. »Diese Schlacht kann unser König nicht gewinnen.«
Alan antwortete nicht, sondern senkte bedrückt den Kopf und fuhr fort, Leinenlaken zu zerreißen.
Als vor neun Jahren der Bürgerkrieg zwischen den Anhängern des Königs und des Parlaments ausgebrochen war, hatten die beiden Männer nicht lange darüber nachdenken müssen, welche Seite sie in diesem Konflikt wählen sollten. Auch wenn sie die Bestrebungen König Charles’ I. nach Alleinherrschaft, die den Streit ausgelöst hatten, nicht gutheißen konnten, erkannten sie die Parlamentarier doch als das, was sie waren: durch Handel und Landbesitz reich gewordene Männer, denen es nur um die Durchsetzung der eigenen Interessen ging, nicht aber um das Wohl der einfachen Bevölkerung, um deren Unterstützung sie sich bemühten. Als Katholiken hatten Jeremy und Alan von einem puritanischen Parlament zudem eine nur noch schärfere Unterdrückung und Benachteiligung zu erwarten als unter Erzbischof Laud.
Nachdem Jeremy eine Zeitlang als Feldscher im Heer des Königs im Westen Englands unter dem nominellen Befehl des sechzehnjährigen Prince of Wales gedient hatte, war er ihm nach der Niederlage von Truro nach Frankreich gefolgt, wohin auch die Königin geflüchtet war.
Aber der im Exil lebende Hof war bettelarm, abhängig von einer nur allzu knapp bemessenen Pension Kardinal Mazarins, der für den minderjährigen französischen König Louis XIV. regierte. Jeremy wollte nicht zu den abgerissenen Bittstellern gehören, die von ihrem Souverän auch unter den widrigsten Umständen Unterstützung erwarteten. Stattdessen suchte er sich Arbeit als Privatlehrer, und da seine Bedürfnisse nach Bequemlichkeit und Zerstreuung äußerst bescheiden waren, gelang es ihm mit ein wenig Glück, einige Jahre an der Universität von Paris zu studieren.
Dort erreichte ihn 1649 schließlich die Nachricht vom Tod des Königs. Charles I. war auf Betreiben Oliver Cromwells nach einem Schauprozess hingerichtet worden, den auch die puritanischsten Rechtsgelehrten als gesetzwidrig bezeichnet hatten. Damit machte er den König unweigerlich zum Märtyrer.
Als der Thronfolger sich zwei Jahre später nach Schottland begab, um dort mit den Covenanters zu verhandeln und wenn möglich mit ihrer Hilfe sein Königreich zurückzuerobern, schloss sich Jeremy ohne Zögern der Expedition an. Auch wenn er den Krieg hasste, bot ein Schlachtfeld doch die beste Praxis für einen jungen Wundarzt, der den Ehrgeiz besaß, das Beste aus den herkömmlichen Behandlungsmethoden zu machen.
Obwohl Prinz Charles in Scone zum König gekrönt worden war, stand das Unternehmen von Anfang an unter einem schlechten Stern. Die Schotten waren untereinander zerstritten, ihre Armee von mehreren Niederlagen gegen Cromwell erheblich geschwächt. Außerdem hatte das Commonwealth, wie sich fortan die Regierungsform in England nach Abschaffung der Monarchie nannte, die Bevölkerung fest in der Hand. Niemand durfte sich ohne besondere Erlaubnis des Parlaments auf Reisen begeben oder das Land verlassen. Die Zeitung Mercurius Britanniens brachte dem Volk die Schrecken aller schottischen Invasionen der letzten sechshundert Jahre ins Gedächtnis zurück und drohte mit unmenschlichen Strafen für diejenigen, die sich dem König der Schotten anschließen sollten.
Und so blieb der erhoffte Zustrom kampfbereiter Royalisten aus. Je weiter die Armee des Königs nach Süden vordrang, desto verzweifelter wurde die Lage. Am zweiundzwanzigsten August erreichte Charles II. mit nur sechzehntausend Mann die königstreue Stadt Worcester. Es war ein erschöpfter, zerlumpter Haufen, der sich zwölf Tage später den gut ausgebildeten Truppen Cromwells gegenübersah, in einer Schlacht, die sie nicht gewinnen konnten.
In der Ferne erklangen Musketenschüsse. Jeremys und Alans Blicke trafen sich.
»Geht es los?«, fragte Alan mit düsterer Miene.
»Sehen wir nach!«
Als die beiden Freunde ihr Quartier verließen, begegnete ihnen der König, der mit einem Fernglas in der Hand der Kathedrale zustrebte. Das markante Gesicht des jungen Monarchen war angespannt, verriet jedoch auch eine gewisse Erleichterung. Das untätige Warten der vergangenen Tage begann ihn zu zermürben. Kurze Zeit später eilte Charles wieder vom Turm der Kathedrale herab und rief seine Offiziere zu sich.
»Cromwell hat den Severn überschritten«, hörte Jeremy ihn sagen. »Dadurch ist die Verteidigung seiner Geschütze geschwächt. Unsere Chance, sie ihm abzujagen. Aber wir müssen sofort angreifen!«
In kürzester Zeit waren die königlichen Truppen versammelt und stürmten durch das Sidbury-Tor hinaus. Charles setzte sich furchtlos an ihre Spitze und spornte sie leidenschaftlich an.
Jeremy, der ihnen beim Verlassen der Stadt nachblickte, spürte, wie sich ihm angesichts solcher Tollkühnheit vor Grauen die Nackenhaare sträubten. Charles war jetzt einundzwanzig Jahre alt, verbittert durch den Mord an seinem Vater, die Zeit des Exils, die erniedrigende Behandlung, die er durch die Schotten erfahren hatte, und die Enttäuschung dieses Feldzugs, der an der mangelnden Beteiligung der englischen Royalisten zu scheitern drohte.
Schon oft genug hatte der junge König seinen Mut unter Beweis gestellt, doch dieses Mal zog er mit einer solch beängstigenden Todesverachtung ins Gefecht, dass Jeremy insgeheim befürchtete, Charles habe sich entschlossen, entweder zu siegen oder zu sterben. Er hatte zwei Brüder, die seine Nachfolge antreten konnten. Mit diesem Wissen mochte es ihm leichtfallen, die eigene Sicherheit außer Acht zu lassen.
Jeremy biss ärgerlich die Zähne aufeinander. Wenn der König fiel, waren sie alle verloren, und die Menschen würden vielleicht für immer die Hoffnung verlieren, Cromwells tyrannische Herrschaft abschütteln zu können. In Alans Begleitung stieg er auf die Stadtmauer, um das Gefecht zu beobachten. Sicher würden sie bald Arbeit bekommen.
Drei Stunden lang tobte der Kampf um die Geschütze. Zuerst schien es, als würde der kühne Angriff der Royalisten gelingen, doch dann wendete sich das Blatt. Cromwell, der von weitem erkannte, was vorging, führte seine Truppen zurück über den Severn, während der Kommandant der schottischen Infanterie, David Leslie, die Nerven verlor und sich weigerte, an der Seite des Königs zu kämpfen. Sein einziges Interesse lag darin, seine Armee wohlbehalten nach Schottland zurückzuführen.
Gegen fünf Uhr nachmittags war die Schlacht verloren. Die überlebenden Royalisten zogen sich in die Stadt zurück, erschöpft und entmutigt, viele von ihnen verwundet.
Jeremy, der hinter dem Sidbury-Tor von einem Verletzten zum anderen eilte, sah zu seinem Schrecken, dass in der Einfahrt ein Munitionswagen umgestürzt war. Eine verirrte Kugel musste einen der Ochsen getroffen haben, die ihn zogen. Das Hindernis machte den Durchgang für die zurückweichenden Royalisten unpassierbar.
Mit ein paar schnellen Schritten war Jeremy an der Seite des zweiten Zugtiers und versuchte, es zum Aufstehen zu bewegen, bemerkte dann jedoch das Blut auf seinem Fell. Es war sinnlos!