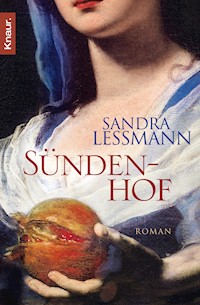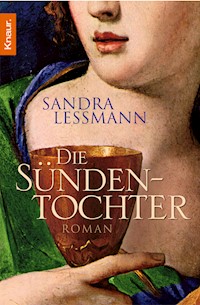6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jeremy Blackshaw
- Sprache: Deutsch
Der Arzt Alan Ridgeway und sein Freund Jeremy, der im Verborgenen wirkende Jesuitenpater, kommen durch die unglaubliche Geschichte eines Patienten Alans einer ungeheuren Intrige auf die Spur. Ihre Suche führt sie in die grauenerregende Welt des berüchtigten Londoner Irrenhauses …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sandra Lessmann
Narren Kind
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Juli 1667
Die einsetzende Dämmerung ließ das Tageslicht allmählich verblassen. Auf Geheiß des Wirtes entzündete eine der Mägde einen Holzspan am Herdfeuer und begann, die Unschlittkerzen im vollbesetzten Schankraum zu entzünden. Bald tanzte das warme Licht der Flammen auf den mit fleckigen Tüchern bedeckten Tischen, und der ranzige Geruch des Kerzentalgs vermischte sich mit dem Bratendunst aus der Küche und dem blauen Tabakrauch, der wie Nebelschwaden in der Luft hing.
Peter Standish zog die blakende Kerze näher zu sich heran und entfaltete zum wiederholten Mal das Blatt Papier, das man ihm heimlich in die Reisetasche gesteckt hatte. Er hatte sie nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Schankraum stehenlassen, als er den Abort aufgesucht hatte. Welcher von den Gästen, die rings um ihn herum zu Abend aßen, mochte die Gelegenheit genutzt haben, ihm die Nachricht zuzustecken? Oder war es vielleicht einer der Stallburschen oder gar eines der Schankmädchen gewesen?
Das Kerzenlicht fiel auf die eilig hingekritzelten Worte. Unmöglich auszumachen, ob sie von der Hand eines Mannes oder einer Frau stammten.
»Wenn Ihr George Holcrofts Geheimnis erfahren wollt, kommt nach Sonnenuntergang zum Waldrand hinter der Herberge. Sagt niemandem, wohin Ihr geht.«
Die Botschaft trug keine Unterschrift.
Nachdenklich faltete Peter Standish das Papier zusammen und ließ es wieder in seine Hosentasche gleiten. Woher wusste der Unbekannte, dass er nach Walthamstow gekommen war, um Nachforschungen über George Holcroft anzustellen? Hatte er zufällig gehört, wie er den Wirt nach dem Weg zu Holcrofts Landsitz gefragt hatte? Dies schien ihm die einzige logische Erklärung zu sein. Soweit er sich entsinnen konnte, hatten sich mehrere Leute in der Nähe befunden, als er den Wirt angesprochen hatte: verschiedene Bedienstete der Herberge, ein Händler aus London, der mit zwei Dienern unterwegs war, ein Fuhrknecht, der seine Pferde im Hof tränken ließ, ein junges Paar, das offenbar auf dem Weg zum Herrensitz seiner Familie war, eine maskierte Frau, die mit ihrer Zofe reiste, und eine Gruppe junger Männer, deren Gesichter sich Peter nicht näher angesehen hatte.
Aufmerksam ließ er den Blick durch den Schankraum gleiten. Je weiter der Abend fortschritt, desto dichter wurden die Tabakschwaden, die aus unzähligen Pfeifen quollen. Die Gäste, die noch mit ihrer Mahlzeit beschäftigt waren, mussten den Rauch ertragen. Zinnlöffel klapperten auf Zinnteller, es wurde gerülpst, gelacht, gegrölt. Weindunst überlagerte die Gerüche der Braten und Eintöpfe, bevor diese in den Mägen verschwanden, und wetteiferte mit den übelriechenden Talgkerzen und Binsenlichtern. Ihre Flammen und die Körperausdünstungen der Menschen erhitzten den Schankraum trotz seiner hohen Decke aus geschwärzten Balken. Peter Standish fühlte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat und sein Hemd feucht an seiner Haut klebte. Er sehnte sich nach frischer Luft, entschied sich jedoch, noch eine Weile zu warten, bis es draußen völlig dunkel geworden war. Andernfalls würde der lichtscheue Briefschreiber vielleicht nicht zur angegebenen Stelle kommen.
Wer könnte es sein? Angespannt studierte er die Gesichter der anderen Gäste. Keines von ihnen war ihm bekannt. Die Nasen und Wangen einiger Zecher begannen, sich zu röten, je mehr sie dem Wein zusprachen. Zwei Gäste hatten einen dritten Mann, der wie ein Landei aussah, zum Würfelspiel überredet. Vermutlich würden sie dem Unbedarften das Fell über die Ohren ziehen, sofern der Wirt ihrem Treiben kein Ende bereitete. Das Klappern des Würfelbechers mischte sich unter die Laute der Trunkenheit. Ein Mann in der Nähe des Kamins, in dem aufgrund der sommerlichen Hitze kein Feuer brannte, hatte eine Schnupftabakdose aus Horn hervorgeholt und steuerte bald darauf sein wiederholtes Niesen zum allgemeinen Trubel bei. Das junge Paar und die Frau mit der Zofe waren nicht anwesend. Vermutlich speisten sie in separaten Räumen.
Ein Schankmädchen näherte sich Peter Standishs Tisch, um ihm aus einem Zinnkrug Wein nachzuschenken, doch er schüttelte den Kopf, schob die Reste seines Hammeleintopfs von sich und stand auf. Er war froh, aus dem verräucherten Raum in den Hof der Herberge hinaustreten und frische Luft atmen zu können. Der Geruch nach Pferden und heißem Pech, den die in eisernen Halterungen steckenden Fackeln verströmten, war im Vergleich zu den Ausdünstungen im Schankraum geradezu angenehm. Aus den Stallungen war Pferdeschnauben und Hufscharren zu hören.
Zielstrebig durchquerte Peter den Innenhof und verließ ihn durch die Toreinfahrt. Hinter der Herberge erstreckte sich ein kleiner Buchenhain, in dem der Wirt offensichtlich Holz schlagen ließ. Das erste Mal, seit Peter sich entschlossen hatte, Nachforschungen über George Holcroft anzustellen, hatte er nicht mehr das Gefühl, einem Irrlicht nachzujagen. Alle hatten ihn verspottet, als er Bedenken über Holcrofts Absichten geäußert hatte: Vater, sein Bruder Joseph, ja selbst Elena, seine süße Schwester, um deren Wohl es ihm schließlich bei dieser Untersuchung ging. Selbst sie hatte seine Sorge um ihre Sicherheit belächelt. Peter bewunderte den Gleichmut und das Gottvertrauen dieses so zerbrechlich anmutenden Mädchens mit dem Engelshaar und dem rosigen Gesicht. Aufgrund des erheblichen Altersunterschieds hatten Elena und er sich nie sehr nahegestanden, aber er hatte schon immer eine Schwäche für seine kleine Schwester gehabt. War es da so unverständlich, dass er sie in guten Händen wissen wollte?
Der Lichtschein, der durch die bleigefassten Fenster der Herberge zu ihm herüberfiel, ließ gerade noch den Weg erkennen, der an dem Buchenhain entlangführte. Peter Standish folgte dem Pfad, bis er das Gebäude ein ganzes Stück hinter sich gelassen hatte, und blieb dann mit einem wachsenden Gefühl der Enttäuschung stehen. Der Briefschreiber war nirgendwo zu sehen. War er Opfer eines Scherzes geworden? Aber wer sollte ihm einen so dummen Streich spielen?
Aufmerksam sah er sich um, versuchte, die nächtliche Finsternis mit den Augen zu durchdringen. Um ihn herum war alles ruhig. Ernüchtert ging er den Weg zurück, blieb aber immer wieder stehen und ließ den Blick schweifen. Mit einem Mal fiel ihm zwischen den Baumstämmen ein Licht auf. Vielleicht wartete der Unbekannte im Schutz der Buchen, um sich vor der Neugier Uneingeweihter zu verbergen. Einen Versuch war es jedenfalls wert.
Langsam ging Peter auf den Lichtpunkt zu. Die Bäume standen nicht sehr dicht, und so reichte der blasse Schimmer, der von der Herberge zu ihm drang, gerade noch aus, um sich zurechtzufinden. Unter Peters Schuhsohlen knisterten vertrocknete Farne und die Reste des Herbstlaubs vom vergangenen Jahr. Ein Nachtvogel schrie in einem der Baumwipfel. Auf einmal begann sich der junge Mann unwohl zu fühlen. Dieses Versteckspiel war ausgesprochen merkwürdig.
Zögernd blieb er stehen und überlegte unschlüssig, was er tun sollte. Das Licht war nun klar zu erkennen. Es ging von einer Lampe aus, die an der Tür eines hölzernen Verschlages hing. In der Hütte musste vor einiger Zeit noch jemand gehaust haben, doch inzwischen schien sie verlassen und baufällig. Die Fensterläden waren geschlossen. Abgesehen von der Lampe deutete nichts darauf hin, dass sich jemand in der Nähe befand.
Peter Standish entschloss sich dennoch, weiterzugehen. Zweifellos war das Licht für ihn bestimmt. Wenn er jetzt umkehrte, würde er nie erfahren, was der Unbekannte ihm über den zwielichtigen George Holcroft mitzuteilen hatte. Beherzt trat er zur Tür des Verschlags, nahm die Lampe vom Nagel und drückte den Riegel herunter.
»Ist da jemand?«, fragte der junge Mann vernehmlich, während er langsam die Tür aufschob.
Im Innern des Verschlags war es stockdunkel. Erst als er über die Schwelle trat, leuchtete im Schein der Kerzenflamme etwas auf. Verwundert hielt Peter inne. Zwei glühende Augen starrten ihn aus der Finsternis an. Dann ertönte ein Grollen, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ.
Weg hier!, durchzuckte es ihn, doch seine Beine wollten ihm nicht gehorchen. Wie angewurzelt stand er da, als sich ihm das Tier entgegenwarf. Im letzten Moment gelang es ihm, die Lähmung abzuschütteln und zur Seite zu springen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte auf den Waldboden. Die Lampe fiel ihm scheppernd aus der Hand und erlosch. Mit wild schlagendem Herzen rappelte sich Peter auf und wirbelte herum.
Wie eine Kanonenkugel war das Tier aus der Hütte gestürmt und stand ihm nun mit gesträubtem Fell gegenüber. Es war ein großer, schwarzer Hund, der ihn knurrend und zähnefletschend anstarrte. Von seinen langen, weiß leuchtenden Fängen tropfte der Geifer.
Eine Falle!, dachte er. Man hatte ihm eine Falle gestellt.
Als Peter eine leichte Bewegung machte, begann der Hund, wie rasend zu bellen. Der Körper des Tieres zitterte in höchster Erregung, und an seinen Lefzen bildete sich weißer Schaum. Kopflos wandte sich Peter zur Flucht. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen eine Wurzel und stürzte … Es gelang ihm gerade noch, sich herumzuwerfen, da war der Hund bereits über ihm. Schreiend riss der junge Mann die Arme hoch, um Gesicht und Hals zu schützen. Ein furchtbarer Schmerz durchfuhr seinen rechten Unterarm, als die Fänge des Tieres in sein Fleisch drangen. Die Kiefer schlossen sich, und die Zähne bohrten sich bis auf die Knochen. Peter schrie … rief verzweifelt um Hilfe. Mit der Linken schlug er auf den wütenden Hund ein, versuchte, ihn von sich abzuschütteln, doch die unbarmherzigen Fänge wollten nicht loslassen.
Ein Gedankenblitz durchzuckte sein gepeinigtes Hirn … seine Pistole … er hatte doch eine geladene Waffe dabei … Wie von selbst tastete seine linke Hand zu seinem Gürtel, zog die Pistole, spannte mit einiger Mühe den Hahn und schoss …
Der Hund heulte auf und sackte leblos über dem jungen Mann zusammen. Die Kugel war ihm in die Brust gedrungen. Zitternd schob Peter den Körper des toten Tieres von sich und löste seinen Arm aus den gefährlichen Fängen. Vor seinen Augen stieg eine schwarze Wand auf, sein Magen rebellierte, und er erbrach sich. Schwach wie ein Greis hockte er auf dem Waldboden, unfähig, auf die Beine zu kommen. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Brechreiz nachließ und es ihm gelang, sich schwankend aufzuraffen. Sein Arm brannte wie Feuer. Als er mit der anderen Hand über die Wunde tastete, wurde er vor Schmerz beinahe ohnmächtig.
Taumelnd machte er sich schließlich auf den Rückweg, musste aber immer wieder anhalten, um seine Kräfte zu sammeln. Eine Ewigkeit – so schien es ihm – verging, bevor er den Weg wiederfand, der zur Herberge führte. Mit letzter Kraft wankte er durch die Toreinfahrt in den Hof, wo ein Stallknecht gerade einen Eimer ausschüttete. Betroffen sah der Bursche dem Mann entgegen, der mit kalkweißem Gesicht auf ihn zuschwankte.
»Sir, was ist passiert?« Er packte Peters unverletzten Arm und stützte ihn. »Ihr seid ja verwundet, Sir.«
»Ein Hund …«, stammelte der junge Mann. »Ein wilder Hund … hat mich angefallen …«
Im Schankraum kam ihnen der Wirt entgegen.
»Das sieht bös aus. Ich hole meine Frau. Sie soll Euch verbinden.«
Als der Wirt mit seiner Gattin zurückkehrte, hatte der Stallknecht den Verletzten auf einer Bank abgesetzt. Die anwesenden Zecher wandten neugierig die Köpfe und beobachteten das Schauspiel.
»Wart Ihr etwa bei dem Holzschuppen im Wald?«, fragte der Wirt erstaunt. »Einer meiner Wachhunde hat sich seit einigen Tagen so seltsam benommen, da haben wir ihn dort eingesperrt. Morgen sollte der Konstabler ihn erschießen.«
»Ich fürchte, diese Pflicht musste ich ihm abnehmen«, erwiderte Peter stöhnend.
»Es tut mir leid, Sir. Ich habe wohl versäumt, Euch darauf hinzuweisen, dass sich in dem Verschlag ein bissiger Hund befindet, aber ich konnte nicht ahnen, dass jemand zu so später Stunde noch in den Wald gehen würde.«
»Schon gut. Ihr habt keine Schuld«, meinte Peter und knirschte mit den Zähnen, während die Wirtin die Bissverletzung an seinem Arm auswusch.
»Ihr solltet möglichst bald einen Wundarzt aufsuchen, Sir.«
Der junge Mann nickte nur. Ihm war noch immer übel, und als er sich erhob, zitterten seine Beine, nicht allein wegen der Schmerzen in seinem Arm, sondern auch vor Angst. Jemand hatte versucht, ihn umzubringen. Nur so war die Nachricht, die ihn zur Hütte im Wald gelockt hatte, zu erklären.
Kapitel 2
Ein unheimliches Heulen ließ Peter Standishs Pferd scheuen. Nur mit Mühe unterdrückte er einen Aufschrei, als ein scharfer Schmerz durch seinen verletzten Arm fuhr und ihm schwarz vor Augen wurde. Seine Linke packte die Zügel des Wallachs fester, und seine Fersen trieben ihn vorwärts. Die Gerüche der Stadt hatten den schweren Duft blühender Wiesen und abgeernteter Felder abgelöst. Vor ihm lag das Bishopsgate, eines der sieben Tore, durch die man den von einer Mauer umgebenen Stadtkern Londons betreten konnte.
Nach einer durchwachten Nacht hatte Peter eingesehen, dass er keine Wahl hatte, als seine Nachforschungen abzubrechen und nach Hause zurückzukehren. Die Bisswunde schmerzte höllisch, und so nahm er sich vor, auf dem Heimweg bei einem Wundarzt haltzumachen. Als er Shoreditch im Norden Londons erreichte, war er bereits am Ende seiner Kräfte. Der Wallach spürte, dass mit seinem Reiter etwas nicht stimmte, und wurde von Meile zu Meile nervöser und schreckhafter. Und als das unmenschliche Heulen wie aus dem Nichts erklang, brach das Tier verstört zur Seite aus und hätte seinen Reiter beinahe abgeworfen.
»Ruhig, Junge, beruhige dich!«, sprach Peter auf ihn ein.
Sein Blick glitt nach rechts zu einer Reihe von Gebäuden, von denen nur die Dächer hinter den Häusern, welche die Straße säumten, sichtbar waren. Von dort kam das unheimliche Geräusch, das Wehklagen unzähliger gepeinigter Seelen … Es war das Bethlehem Hospital, das Londoner Tollhaus, in dem die Unglücklichen untergebracht waren, die Gott mit Wahnsinn geschlagen hatte.
Ein Schauer durchlief Peter, als das Geschrei erneut anhob. Rasch trieb er sein Pferd vorwärts. Als er das Bishopsgate durchquerte, hallten die eisenbeschlagenen Hufe des Tieres unter dem steinernen Torbogen wider und übertönten die Stimmen der armen Seelen.
Auf der Gracechurch Street, die durch den Stadtkern nach Süden zur Themse führte, herrschte viel Verkehr. Mit Waren oder Baumaterial beladene Fuhrwerke verstopften die Straßen und behinderten Reiter, Fußgänger und die Kutschen wohlhabender Leute. Fast zwölf Monate nach dem Brand, der London zerstört hatte, waren erst wenige Häuserzeilen wieder aufgebaut worden. Zuweilen stand ein einzelnes Gebäude inmitten der Trümmer, mit einer Verzahnung aus Ziegelsteinen an den Seitenwänden, wo es mit den zukünftigen Nachbarhäusern verbunden werden sollte. Aufgewirbelter Staub und der Ruß, den das Feuer zurückgelassen hatte, lagen in der Luft und reizten Peter Standish zum Husten. Er sehnte sich nach der Ruhe seiner Wohnung und einem erfrischenden Schluck Bier.
Die New Fish Street führte zur London Bridge, eines der prachtvollsten Bauwerke der Stadt. Auf neunzehn Pfeilern überspannte sie die Themse zum Südufer. Zu beiden Seiten der schmalen Brückenstraße erhoben sich mit kunstvollen Schnitzereien verzierte Fachwerkhäuser aus dem vergangenen Jahrhundert, in denen Händler die verschiedensten Waren anpriesen. Drei Viertel der Gebäude waren vom Feuer verschont geblieben, nur der nördliche Häuserblock war von den Flammen zerstört und bis zum Wiederaufbau durch einen Bretterzaun ersetzt worden, der Fußgänger und Vieh vor einem Absturz in die Themse bewahren sollte.
Als Peter Standish die ehemalige Kapelle von St. Thomas à Becket passiert hatte, fiel ihm auf der gegenüberliegenden Seite eine über die Straße ragende, rot-weiß gestreifte Stange auf, an deren Ende eine Aderlassschale hing: das Zunftzeichen der Barbiere und Wundärzte. Daneben knarrte ein Schild, auf dem ein leicht verblasster Zuckerhut dargestellt war.
Kurzentschlossen zügelte Peter sein Pferd, stieg ab und band es an einem in die Hauswand eingelassenen Ring fest. Die Bewegungen verstärkten die Schmerzen in seinem Arm. Als er über die Schwelle der Chirurgenstube trat, verspürte er erneut Übelkeit. Seine Fingerspitzen begannen, unangenehm zu kribbeln, und vor seinen Augen fiel ein schwarzer Schleier herab, auf dem bunte Sterne glühten. Durch den wallenden dunklen Nebel nahm er die Gestalten zweier Männer wahr, die sich ihm zuwandten.
»Verzeihung … könntet Ihr …«, hauchte er noch, dann brach er ohnmächtig zusammen.
Alan Ridgeway, Meister der Chirurgengilde, und sein Geselle Nicholas sprangen dem Ankömmling entgegen, um ihn aufzufangen, bevor sein Körper auf den Holzboden schlug.
»Heben wir ihn auf den Operationstisch«, sagte Alan.
Dies erwies sich als mühsam, denn der Ohnmächtige war schwerer als ein Sack Korn. Der Wundarzt packte den Mann unter den Achseln, und der Geselle nahm seine Beine, doch es gelang ihnen nur mit erheblicher Mühe und angestrengtem Keuchen, ihn auf den massiven Holztisch zu hieven, der sich im hinteren Teil der Chirurgenstube befand. An den Wänden standen Regale mit eng aneinandergereihten Salbentiegeln und ein Schrank mit vielen kleinen Schubladen, in denen Arzneien und Heilkräuter untergebracht waren. Ein Wandschirm konnte gegebenenfalls vor den Operationstisch gezogen werden.
In der Tür zum Hinterzimmer erschien ein Mann. Er trug ein schwarzes Wams mit einem schneeweißen Leinenkragen, schwarze Kniehosen sowie Strümpfe und Schuhe in derselben Farbe. Schulterlanges dunkelbraunes Haar umrahmte ein hageres Raubvogelgesicht mit einer intelligenten hohen Stirn, einer knochigen Habichtsnase und einem starken, spitz zulaufenden Kinn. Als der Mann sah, was vor sich ging, eilte er ohne Zögern näher, um den anderen zu helfen. Doch seine grauen Augen drückten neben Betroffenheit angesichts des ohnmächtigen Fremden auch Neugier und erregtes Interesse aus.
»Was ist geschehen?«, wandte er sich an Meister Ridgeway, der den Unbekannten zu untersuchen begann.
»Keine Ahnung, Jeremy. Er kam herein und fiel einfach um. Sehen wir mal, was der Grund sein könnte.«
Die fahle Gesichtsfarbe und der kalte Schweiß auf der Stirn des Ankömmlings verhießen nichts Gutes. Jeremy Blackshaw, selbst ehemaliger Feldscher und studierter Arzt, und der Geselle Nick hoben den Oberkörper des Bewusstlosen an, so dass Alan ihm das Wams ausziehen konnte. Mit einem kurzen Brummen registrierte der Wundarzt den blutigen Verband am rechten Unterarm.
Ohne auf Anweisung zu warten, holte Nick eine Messingschüssel und eine Flasche Branntwein herbei. Sein Meister und dessen Freund wuschen sich die Hände und entfernten den Leinenstreifen, der die Wunde bedeckte.
»Ein Hundebiss«, sagte Alan. »Ungewöhnlich tief … Das sieht nicht gut aus.«
Der Geselle brachte ein scharfes Messer. Nachdem Alan die Bisswunde mit Branntwein gesäubert hatte, begann er, das von den Hundezähnen gequetschte Fleisch herauszuschneiden, bis helles, frisches Blut hervorquoll. Als er sicher war, dass alles tote Gewebe entfernt war, wusch er die Wunde erneut aus und nähte geschickt die glatten Ränder zusammen. Schließlich legte er einen lockeren Verband an, der eine Verunreinigung verhindern sollte.
»Versuchen wir, ihn wieder zu sich zu bringen«, meinte Alan, während er den Leinenstreifen mit einem Knoten befestigte.
Jeremy trat an eines der Regale, nahm eine Flasche Essig herunter und träufelte einige Tropfen auf ein Tuch, das er dem Besinnungslosen unter die Nase hielt. Die scharfen Dünste reizten die Schleimhäute des Mannes und ließen ihn husten. Endlich schlug er die Augen auf und blickte verständnislos in die Runde.
»Was ist passiert?«, fragte er.
»Ihr wurdet ohnmächtig, Sir«, klärte Alan ihn auf.
»Ach ja … die Schmerzen … ich wollte Euch bitten, die Wunde an meinem Arm zu behandeln.«
»Schon geschehen«, antwortete Jeremy lächelnd.
»Verzeiht, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Peter Standish«, sagte der junge Mann entschuldigend.
Alan erwiderte die Höflichkeiten und fragte dann: »Könnt Ihr aufstehen, Sir?«
Peter nickte, doch seine Mimik verriet, dass er sich seiner Kräfte nicht allzu sicher war. Als er sich mit der Hilfe des Wundarztes aufgesetzt hatte, brach ihm erneut der Schweiß aus, und sein Gesicht wurde noch bleicher, als es ohnehin war. Seine Finger klammerten sich krampfhaft an den Rand des Operationstisches, bis die Knöchel weiß unter der Haut hervortraten.
»Ich denke, es ist besser, wenn Ihr Euch noch eine Weile ausruht, bevor Ihr weiterreitet«, meinte Jeremy. »Nick wird Euer Pferd in einer der Herbergen in Southwark einstellen, damit es Futter und Wasser bekommt.«
»Woher wisst Ihr, dass ich zu Pferd unterwegs bin?«, fragte Peter erstaunt.
»Niemand geht hier in London mit Reitstiefeln spazieren, es sei denn, er ist Pferdeknecht«, erwiderte Jeremy lächelnd.
»Natürlich, wie dumm von mir. Ihr habt ein waches Auge für Einzelheiten, Doktor. Mein Pferd steht draußen. So unangenehm es mir ist, fürchte ich doch, dass ich Euer Angebot annehmen muss. Aber zuerst lasst mich Euch für Eure Mühe bezahlen, Meister Ridgeway.«
Der Wundarzt winkte ab. »Das könnt Ihr später noch, bevor Ihr geht.«
Da der Verletzte zu schwach schien, um Treppen zu steigen, schob der Geselle ein Rollbett hinter den Wandschirm und holte eine Decke. Jeremy und Alan halfen Peter Standish durch den Raum und legten ihn auf das Bett.
»Nur für einen Moment«, sagte der junge Mann. »Dann geht es mir sicher besser.«
Wenige Augenblicke später war er fest eingeschlafen.
»Eine merkwürdige Sache«, murmelte Jeremy. »Ich frage mich, wie er an die Wunde gekommen ist.«
»Fragt ihn doch, wenn er aufwacht«, schlug Alan vor. Doch das Interesse seines Freundes an Peter Standishs Verletzung behagte ihm gar nicht. Zu oft schon hatte Jeremys unbändige Neugier sie beide in Gefahr gebracht.
Peter Standish rührte sich den ganzen Nachmittag über nicht. Als die Dämmerung hereinbrach, beugte sich Jeremy über den Verletzten und drückte seine Schulter, um ihn zu wecken. Verschlafen blinzelnd hob Peter den Blick zu dem hageren Gesicht, aus dem ihn zwei eisgraue Augen freundlich, aber zugleich prüfend musterten.
»Fühlt Ihr Euch besser, Sir?«
Der junge Mann setzte sich auf und fuhr sich mit der Hand durch das blonde Haar, dem das Kerzenlicht einen rotgoldenen Schimmer entlockte. Seine blauen Augen waren noch ein wenig vom Schlaf getrübt, als er verwirrt den Blick schweifen ließ.
»Wo bin ich? Wie spät ist es?«, fragte er.
»Ihr befindet Euch in Meister Ridgeways Chirurgenstube auf der Brücke«, klärte Jeremy ihn auf. »Die Glocke von St. Mary Overie hat gerade die neunte Stunde geschlagen.«
»Ich erinnere mich. Ihr habt meine Armwunde behandelt.«
»Es würde mich interessieren, wie Ihr sie Euch zugezogen habt.«
Peter Standish wich dem Blick des Arztes aus und schüttelte abwehrend den Kopf.
»Das ist eine lange Geschichte, Doktor.«
»Ich frage nicht aus reiner Neugier, Sir. Vor allem möchte ich sichergehen, dass Ihr Euch der Gefahr bewusst seid, in der Ihr schwebt.«
Erstaunt sah Peter sein Gegenüber an. »Was meint Ihr damit?«
»Ich finde es merkwürdig, dass ein bewaffneter Mann« – Jeremy deutete auf die Pistole in Peters Gürtel – »einen bissigen Hund so nah an sich heranlässt, dass er ihm den Arm zerfleischen kann. Der Angriff des Tieres muss Euch also in einer Situation überrascht haben, in der Ihr nicht damit rechnen konntet.«
»Potztausend, Ihr habt recht, Doktor«, entfuhr es dem Verwundeten. »Ja, ich gebe es zu. Man hat mir eine gemeine Falle gestellt.«
»Wisst Ihr, wer der Verantwortliche ist?«
»Nein, aber ich kenne zumindest den Grund. Jemand will mich daran hindern, mich einzumischen. Aber ich werde mich nicht so leicht ins Bockshorn jagen lassen. Zumal ich jetzt den Beweis habe, dass mein Verdacht begründet ist.« Das glatte, jugendliche Gesicht des Verletzten nahm einen entschlossenen Zug an. »Verzeiht, dass ich nicht weiter ins Detail gehe, Doktor, es handelt sich um eine Familienangelegenheit. Ich muss mich selbst der Sache annehmen.«
»Dann kann ich Euch nur raten, äußerst vorsichtig zu sein, Sir«, meinte Jeremy warnend, während er Peter auf die Beine half. »Ihr seid noch nicht wieder ganz bei Kräften«, fügte er hinzu. »Es ist wohl besser, wenn ich Euch nach Hause geleite.«
»Das ist wirklich nicht nötig. Ich wohne nur wenige Schritte von hier, im Nonsuch House.«
»Ich möchte Euch dennoch begleiten. Mit Eurem Arm könnt Ihr nicht einmal eine Laterne halten.«
Peter Standish sah ein, dass der Medikus recht hatte, und fügte sich schließlich. Nachdem Alan seinen verletzten Arm in eine Schlinge gelegt und sein Patient ihn bezahlt hatte, zündete Jeremy eine Laterne an und verließ mit dem jungen Mann das Haus.
Auf der Brückenstraße hatte der Verkehr nach Einbruch der Dämmerung nachgelassen. Da die Hausbewohner nur im Winter verpflichtet waren, während der Nacht eine Lampe über ihrer Tür anzubringen, blieb die Straße in dieser mondlosen Julinacht ein düsterer Ort. Die Händler hatten ihre Läden hochgeklappt und sich in ihre Stuben zurückgezogen. Nur hinter den Fenstern der oberen Stockwerke war noch Licht zu sehen. Jeremy und Peter Standish wandten sich nach Süden und tauchten in den Tunnel der Häuser ein, die sich über der Brückenstraße trafen. Vom Wind bewegt, quietschten Schilder an eisernen Armen, die Symbole, die auf ihnen dargestellt waren, unsichtbar in der abendlichen Finsternis. Pferde- und Viehdung bedeckten das Pflaster und vermischten sich mit Asche aus den Feuerstellen, Essensresten und anderem Unrat. Zumindest hatten die Brückenbewohner nicht die Gepflogenheit, den Inhalt ihrer Nachttöpfe aus dem Fenster zu schütten, denn die meisten besaßen einen Abort über dem Fluss. Und so trug der vom Wasser aufsteigende Windhauch unerfreuliche Gerüche mit sich, an die ein Londoner allerdings von Kindheit an gewöhnt war.
Der Weg zu Peter Standishs Wohnung war nicht weit. Eng an seine nördlichen Nachbarn geschmiegt, bildete das Nonsuch House das Ende des Häuserblocks. Es trug seinen Namen zu recht, denn es war ein »Haus ohnegleichen«, ein einzigartiges Wunderwerk der Architektur und Handwerkskunst. An seiner Stelle hatte einst das Drawbridge Gate gestanden, das die Stadt London nach Süden hin verteidigt hatte. Bei Angriffen hatte man ein Fallgitter heruntergelassen und eine hölzerne Zugbrücke hochgezogen. Allerdings war das Bauwerk den dabei entstehenden Erschütterungen nicht gewachsen gewesen und war nicht lange nach seiner Erbauung wieder abgerissen worden, nachdem man die auf Pfähle gespießten Köpfe hingerichteter Hochverräter zum Great Stone Gate am Südende der Brücke überführt hatte. Vor knapp hundert Jahren war schließlich das Nonsuch House errichtet worden, dessen Einzelteile man in Holland vorgefertigt und dann nach England verschifft hatte. Es wurde nicht von Nägeln, sondern allein von Holzdübeln zusammengehalten.
Jeremy hob die Laterne an, während sein Begleiter einen Schlüssel hervorzog und die Haustür aufschloss. Diese öffnete sich auf eine prächtige Holztreppe, die in die oberen Geschosse führte. Sie wurde durch einen Wandleuchter erhellt, so dass Peter ohne fremde Hilfe zu seiner Wohnung finden würde. Jeremy verabschiedete sich daher auf der Türschwelle von dem jungen Mann. Bevor er ging, ermahnte er ihn noch einmal, seinen verletzten Arm zu schonen.
»Meister Ridgeway wird Euch in den nächsten Tagen aufsuchen, um sich die Wunde anzusehen und den Verband zu wechseln«, erklärte Jeremy. »Und bitte seid auf der Hut, Sir. Ihr habt einen Feind, der offenbar vor nichts zurückschreckt.«
»Ich werde mir Eure Warnung zu Herzen nehmen, Doktor«, versicherte Peter Standish.
Hoffentlich ist es nicht bereits zu spät, dachte Jeremy. »Halte Deine schützende Hand über diesen Mann, o Herr, ich bitte Dich!«
Kapitel 3
Das Neugeborene stieß einen kräftigen Schrei aus. Erleichtert übergab Alan es der Hebamme Madame Farge, die die Nabelschnur abband und sie mit einem scharfen Messer durchtrennte.
»Ihr habt einen Sohn, Mistress Delton«, verkündete der Wundarzt.
Es war keine leichte Niederkunft gewesen. Da die Gebärende ein verengtes Becken besaß, hatte die Hebamme nach Meister Ridgeway geschickt, sobald die Wehen einsetzten, damit er eingreifen konnte, falls das Kind nicht von selbst kam. Jeremy hatte ihn begleitet. Nach zehn erschöpfenden Stunden hatte das Kleine schließlich das Licht der Welt erblickt und erprobte nun herzhaft seine Lungen. Erst als Madame Farge es an die Brust der Mutter legte, beruhigte es sich.
Trotz der Armut der Flussschifferfamilie, der ein weiteres hungriges Maul nicht willkommen sein durfte, hob die Mutter glücklich den Blick zu Jeremy.
»Würdet Ihr ihn gleich taufen, Pater?«, bat sie.
»Euer Sohn ist kräftig, Mistress Delton. Es besteht kein Grund zur Eile.«
»Man weiß nie, wann der Herr entscheidet, die Kleinen zu sich zu nehmen, Pater. Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, dass mein Sohn nicht in den Limbus infantium eingehen muss, falls er plötzlich sterben sollte, sondern die Chance hat, Gott in all Seiner Herrlichkeit zu schauen.«
»Wenn Ihr es wünscht«, lenkte Jeremy ein.
Dies war einer der Momente, in denen er sein Doppelleben besonders genoss. Als er vor vierzehn Jahren während seines Studiums in Padua erkennen musste, wie hilflos die Medizin gegenüber den meisten Krankheiten war, hatte er sich zum Priesteramt berufen gefühlt, um auch denen noch beistehen zu können, die selbst die größte ärztliche Kunstfertigkeit nicht mehr retten konnte. Jeremy war nach Rom gegangen und dort der Gesellschaft Jesu beigetreten, die ihn nach dem Empfang der Weihen als Missionar in seine Heimat zurückgeschickt hatte. Seit England unter Elizabeth I. protestantisch geworden war, wurde die unterdrückte katholische Minderheit von Missionaren betreut, die heimlich ins Land geschmuggelt wurden und im Untergrund leben mussten, denn allein durch ihre Anwesenheit in England riskierten die Priester die Todesstrafe. Aus diesem Grund lebte Jeremy Blackshaw unter dem Decknamen Fauconer, damit seine in Shropshire lebende Familie im Falle seiner Verhaftung keine Repressalien zu fürchten hatte.
»Welchen Namen soll Euer Sohn erhalten, Mistress Delton?«, fragte der Jesuit, während er der Hebamme ein Zeichen gab, ihm frisches Wasser zu holen.
»Wenn Ihr erlaubt, Meister Ridgeway, soll das Kind Alan heißen«, sagte die Wöchnerin, an den Wundarzt gewandt. »Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr zustimmen würdet, sein Pate zu sein.«
Alan nickte lächelnd. »Natürlich, gerne. Ist Euer Gatte denn einverstanden?«
»Er hat es selbst vorgeschlagen. Wir haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen.«
Als Madame Farge mit dem Wasser zurückkehrte, folgte ihr der Vater des Kindes zur Tür der Wochenstube. Die Luft war noch schwer von Blut- und Schweißgeruch, doch die Gehilfin der Hebamme hatte die Wöchnerin gewaschen und die blutigen Leinentücher von dem Gebärstuhl entfernt, so dass sich der Vater nach kurzem Zögern über die Schwelle traute.
Nachdem Jeremy den Knaben im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft und ihn in die Arme seiner Mutter zurückgelegt hatte, trat der Flussschiffer an Alan heran.
»Ich würde Euch gerne noch wegen einer Angelegenheit sprechen, die meiner Frau und mir am Herzen liegt.«
»Worum geht es, Mr. Delton?«
»Ihr kennt doch unseren Sohn Edmund? Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder John ist Edmund bedauerlicherweise nicht zum Fährmann geschaffen, aber er ist recht aufgeweckt. Und da Ihr zurzeit keinen Lehrling habt, dachten wir, Ihr würdet ihn vielleicht nehmen.«
Alans Gesicht verdüsterte sich, denn die Erinnerung an seinen letzten Lehrknaben war schmerzlich. Der Junge war vor knapp drei Monaten ermordet worden. Seitdem hatte es der Wundarzt noch nicht über sich gebracht, überhaupt an einen neuen Lehrling zu denken.
»Wie alt ist Euer Sohn?«, fragte er.
»Sechzehn. Natürlich werde ich Euch das Lehrgeld zahlen, das Ihr verlangt«, versicherte der Vater.
Alan ließ sich die Sache durch den Kopf gehen. Zweifellos brauchte er einen neuen Lehrjungen, denn die anfallende Arbeit war von ihm und Nick kaum zu bewältigen. Auch konnte der Geselle mit seinem Holzbein keine Besorgungen erledigen. Darüber hinaus war es von Vorteil, einen katholischen Lehrling zu haben, der Jeremy zur Hand gehen konnte, wenn dieser in Alans Haus die Messe für die ihm anvertrauten Gläubigen las.
»Ich würde gerne mit Eurem Sohn reden«, entschied der Wundarzt. »Wenn er geeignet ist, nehme ich ihn.«
Alan und Jeremy folgten dem Flussschiffer in die Stube, in der ein hoch aufgeschossener Junge und zwei jüngere Mädchen auf die Nachricht warteten, ob es ihrer Mutter und dem neuen Geschwister gutging. Delton klärte sie auf, und die Mädchen baten, den Kleinen sehen zu dürfen. Ihr Vater schickte sie in die Wochenstube, ermahnte sie jedoch, die Mutter nicht zu ermüden.
Dann wandte sich Delton an seinen Sohn. »Edmund, Meister Ridgeway wird dir ein paar Fragen stellen. Wenn er zufrieden ist, nimmt er dich vielleicht als Lehrjungen.«
»Ja, Vater.«
Alan ließ sich auf einen Schemel nieder und betrachtete den Knaben eingehend. Er war schlank, aber kräftig. Sein Gesicht wirkte ernst und aufrichtig, sein Blick verriet Tatendrang und Lerneifer, allerdings auch eine gewisse Ungeduld, die auf ein feuriges Temperament hindeutete. Es würde nicht einfach sein, diesen Burschen im Zaum zu halten, doch Alan zog einen lebhaften Lehrling einem trägen vor.
»Du willst also das Handwerk des Wundarztes erlernen, Sohn?«, begann Alan freundlich. »Bist du dir im Klaren darüber, dass die Arbeit hart und schmutzig ist und dass ich weder Faulheit noch Unehrlichkeit dulden werde?«
»Ja, Sir«, bestätigte der Junge geradeheraus.
»Du wirst lernen, wie man Salben anfertigt und Heilkräuter anwendet, aber auch wie man Wunden und Abszesse behandelt. Du wirst viel Blut zu sehen bekommen. Glaubst du, dass du das aushältst?«
»Ich denke schon, Sir«, antwortete Edmund, wenn auch weniger eifrig als bei der ersten Frage.
»Hin und wieder ist es in unserem Handwerk auch nötig, Operationen durchzuführen«, fuhr Alan mit einem Seitenblick auf Jeremy fort. »Wie den Steinschnitt oder eine Amputation.«
Der Knabe erblasste ein wenig, zuckte aber nicht mit der Wimper. »Das weiß ich, Sir. Ich habe noch nie einer Operation beigewohnt, aber ich glaube, ich bin dem gewachsen. Ich möchte es gerne versuchen.«
Alan wechselte erneut einen Blick mit seinem Freund, und als dieser zustimmend nickte, sagte er: »Also gut, ich nehme dich für die übliche Probezeit. Danach werde ich entscheiden, ob du das Zeug zum Chirurgen hast. Komm morgen in mein Haus auf der Brücke.«
Delton dankte ihm und versprach, seinen Sohn am nächsten Morgen persönlich vorbeizubringen. Schließlich galt es noch, sich über die Höhe des Lehrgelds einig zu werden. Wie jeder andere Wundarzt nahm Alan gewöhnlich fünfundzwanzig Pfund, doch für eine arme Familie gab er sich auch schon einmal mit weniger zufrieden, besonders wenn der Junge Talent hatte.
Als sich die beiden Freunde auf den Heimweg machten, war die Dämmerung noch nicht hereingebrochen.
»Sollen wir einen kleinen Umweg nach Covent Garden machen?«, schlug Alan vor. »Wir waren so lange nicht mehr aus. Wir könnten einen Kaffee zusammen trinken, bevor wir nach Hause gehen.«
Obwohl sie beide einen anstrengenden Tag hinter sich hatten, stimmte Jeremy zu.
Die Kaffeehäuser in Covent Garden waren stets gut besucht. Da nur männliche Kundschaft Zutritt hatte, boten sie so manchem geplagten Ehegatten eine willkommene Zuflucht, in der er gemütliche Stunden verbringen konnte. Auch im Sommer brannte in dem großen Kamin stets ein Feuer, das den davor in gusseisernen Kannen aufgereihten Kaffee warm hielt. Blauer Tabaksqualm lag in der Luft und schwebte träge um die Köpfe der Gäste, die fast alle an den bereitgestellten weißen Tonpfeifen saugten. Da alle Tische besetzt waren, setzten sich Alan und Jeremy zu einem Mann, der gespannt aus dem Fenster spähte und sich nicht um sie kümmerte. Alan musterte ihn neugierig, denn sein Gesicht kam ihm bekannt vor. Und dann fiel ihm auch der Name des Gastes ein. Es war der Stückeschreiber Tom Porter, Sohn des Dichters Endymion Porter. Der Wundarzt hatte ihn einige Male bei seinen häufigen Theaterbesuchen gesehen. Worauf mochte der junge Mann so ungeduldig warten?
Ein Junge in braunem Wams und bis zu den Knien reichender Schürze kam an ihren Tisch und bot ihnen Pfeifen an. Tom Porter schenkte ihm keine Beachtung, und die beiden Freunde lehnten ab.
»Danke, nur Kaffee bitte«, sagte Alan.
Der Junge holte zwei Schälchen aus Steingut und füllte sie aus einer der kegelförmigen Kannen vom Kamin mit einer herrlich duftenden schwarzen Brühe, jenem bitteren türkischen Getränk, das sich seit seiner Einführung in England vor fünfzehn Jahren wachsender Beliebtheit erfreute. Die Zubereitung war einfach. Man kochte zuerst eine Gallone Wasser, bis die Hälfte verdampft war, dann fügte man für jeden Schoppen einen Löffel gemahlenen Kaffee hinzu und kochte das Gemisch unter mehrmaligem Umrühren eine Viertelstunde lang. Einige Rezeptbücher empfahlen, nach dem Genuss von Kaffee ein oder zwei Stunden zu fasten.
Während die Freunde an dem heißen bitteren Kaffee nippten, machte Alan Jeremy auf das Gehabe ihres Tischnachbarn aufmerksam. Tom Porter lauerte noch immer wie eine Katze am Fenster und beobachtete die vorübergehenden Passanten. Der Jesuit nickte und schnitt eine Grimasse.
Vielleicht wartet er auf eine Dame, die er verehrt, dachte der Wundarzt amüsiert.
»Glaubt Ihr, Edmund Delton wird einen guten Lehrknaben abgeben?«, fragte Jeremy nach einer Weile.
»Wir werden sehen, wie er sich anstellt«, meinte Alan. »Meist kann man schon nach ein paar Tagen erkennen, ob jemand zum Wundarzt geschaffen ist oder nicht.«
»Jedenfalls war es richtig, dass Ihr Euch entschlossen habt, es mit ihm zu versuchen. Ihr braucht dringend einen Lehrknaben.«
»Ich weiß …«, räumte der Chirurg ein, »aber es fällt mir immer noch schwer, einen anderen Kits Platz einnehmen zu sehen, auch wenn es der natürliche Lauf der Dinge ist. Ich hatte den Jungen liebgewonnen.«
»Dass Ihr einen neuen Lehrling nehmt, bedeutet nicht, dass Ihr Kit vergesst«, widersprach Jeremy. »Er wird stets in unserer Erinnerung weiterleben. Denkt daran, dass er jetzt bei Gott ist.«
Sie hatten ihre Schälchen geleert und bezahlten bei dem Jungen mit der Schürze die Zeche, als ein Diener das Kaffeehaus betrat und sich ihrem Tisch näherte. Vor Tom Porter blieb er stehen. Sein Gesicht war gerötet, und sein Atem ging keuchend. Er musste gerannt sein.
»Mylord Belasyse’ Kutsche wird gleich hier sein, Sir. Ihr könnt sie mit Leichtigkeit abfangen.«
Wie von einer Hornisse gestochen, sprang Tom Porter von der Bank auf und stürmte ohne ein Wort zur Tür hinaus. Jeremy und Alan sahen ihm verwundert nach.
»Sieht aus, als würde es gleich Ärger geben«, bemerkte der Wundarzt.
In stillem Einverständnis folgten die Freunde dem Stückeschreiber auf die Straße hinaus. Dieser war der Kutsche in den Weg getreten und hatte sie so zum Anhalten gebracht.
»Sir Henry!«, rief Porter. »Habt die Güte, auszusteigen.«
Belasyse öffnete den Schlag, verließ das Innere der Kutsche aber nur zögernd.
Porter zog seinen Degen. Sein Gegenüber tat es ihm nach und warf die Scheide von sich.
Bestürzt drückte Alan Jeremys Arm. »Sie wollen sich duellieren!«
Inzwischen waren auch die anderen Gäste des Kaffeehauses und die vorbeigehenden Passanten auf das Geschehen aufmerksam geworden und blieben neugierig stehen. Belasyse’ Diener waren vom hinteren Trittbrett der Kutsche herabgestiegen und verfolgten den Wortwechsel mit steigender Besorgnis.
»Seid Ihr bereit?«, fragte Tom Porter.
»Ja«, war die Antwort.
Im nächsten Moment gingen die Männer mit gezückten Degen aufeinander los. Stahl klirrte auf Stahl. In dem Verlangen, nichts zu verpassen, schloss sich ein Kreis von Gaffern um die Streithähne. Bald wurden Jeremy und Alan so weit zurückgedrängt, dass sie das Geschehen nicht mehr verfolgen konnten. Sie hörten nur noch das Klirren der Degen, die anfeuernden Rufe der Umstehenden, das erschrockene Schnauben und Stampfen der Kutschpferde, das Keuchen der Kämpfenden … und dann einen Schmerzensschrei, gefolgt von einem zweiten.
»Sie haben sich gegenseitig umgebracht«, schrie einer der Zuschauer, die auf einmal still geworden waren und wie angewurzelt dastanden.
»Macht Platz!«, forderte Alan und zwängte sich, gefolgt von dem Jesuiten, zwischen den Leuten hindurch. »Ich bin Wundarzt.«
Widerwillig ließen die Gaffer sie vorbei. Die Streithähne standen noch auf den Beinen, doch Sir Henry Belasyse, der sich an eines der Wagenräder lehnte, schwankte bedenklich. Sein Gesicht war weiß wie ein Laken, und auf seinem Bauch breitete sich ein dunkler Blutfleck aus. Tom Porter hielt sich die linke Schulter, die ebenfalls blutig war.
Zum Erstaunen aller Anwesenden rief Sir Henry seinen Gegner zu sich. »Tom, komm her, mein Freund!«
Fast ebenso bleich wie er, trat Porter näher. Sir Henry nahm ihn in die Arme und küsste ihn auf die Wange. »Geh, Tom«, sagte er mit letzter Kraft. »Du hast mich verwundet, aber ich werde versuchen, auf den Beinen zu bleiben, bis du dich zurückgezogen hast. Ich werde dafür sorgen, dass du wegen dem, was du getan hast, nicht belästigt wirst.«
Mit Tränen in den Augen wandte Tom Porter sich ab und stolperte davon. Niemand machte einen Versuch, ihn aufzuhalten. Belasyse’ Diener waren an die Seite ihres Herrn getreten und hielten ihn aufrecht.
»Bringt ihn ins Kaffeehaus«, wies Alan sie an. »Ich werde mir seine Wunde ansehen.«
Sie taten wie geheißen und setzten den Verletzten auf einer der Bänke ab, die zu beiden Seiten der Tische standen. Alan rief nach sauberen Tüchern und Wein.
Nachdem er die Bauchwunde freigelegt hatte, bat er einen der Schankjungen um eine Kerze. Im Schein der Flamme, die Jeremy für ihn hielt, wusch er das Blut mit Wein ab, den man aus einer Schenke in der Nähe hatte holen lassen. Die Wunde war nicht sehr breit. Die Degenklinge war jedoch so tief eingedrungen, dass sowohl das Bauchfell als auch der Dünndarm verletzt war. Ein Teil des Darms war durch die Wunde vorgefallen.
»Bei Christi Blut«, jammerte einer der Diener. »Er ist verloren. Verletzungen des Darms sind tödlich, nicht wahr?«
»Sie müssen es nicht sein«, murmelte Alan, während er ein mit Fischhaut bespanntes Bindfutter hervorholte, in dem sich seine chirurgischen Instrumente befanden.
»Dabei sind sie die besten Freunde, mein Herr und Mr. Porter«, klagte der Diener. »Es war ein dummer Streit … ein unglückliches Missverständnis …«
Sir Henry ließ die Untersuchung des Wundarztes tapfer über sich ergehen.
»Er hat recht …«, sagte er mit schwacher Stimme. »Ein dummer Streit … ich gab Tom eine Ohrfeige, ich weiß selbst nicht mehr, warum … und er konnte den Schlag nicht auf sich sitzenlassen …«
»Spart Euren Atem, Sir«, mahnte Jeremy. »Die Wunde muss genäht werden, dann habt Ihr eine gute Chance, zu überleben.«
»Tut Euer Bestes«, erwiderte Sir Henry. »Wenn Ihr keinen Erfolg haben solltet, wird Euch niemand Vorwürfe machen.«
Die Schaulustigen, die dem Duell beigewohnt hatten, standen nun neugierig um den Verletzten und die beiden Freunde herum und ließen ihnen kaum Platz zum Atmen. Alan hätte sie gerne weggeschickt, doch er wusste, dass es keinen Sinn hätte, es zu versuchen. Auf ihn würde man nicht hören.
»Hat jemand nach dem Konstabler geschickt?«, fragte er in die Runde.
»Nein, tut das nicht«, bat Sir Henry. »Gebt meinem Freund Zeit, das Weite zu suchen.«
»Ihr seid sehr großherzig, Sir«, meinte Jeremy.
»Nicht großherzig genug, sonst wäre das hier nicht passiert.«
»Wir müssen Euch auf den Tisch legen«, erklärte Alan.
Der Wundarzt hatte sich die Hände in Wein gewaschen und erweiterte nun die Bauchwunde mit einem Fistelmesser, um den verletzten Dünndarm besser erreichen zu können. Die Diener hielten ihren Herrn auf dem Tisch nieder, und zwei der Zuschauer stützten sich auf die Beine des Verwundeten. Jeremy hatte die Kerze an den Schankjungen weitergereicht und gab ihm Anweisungen, wie er sie halten sollte. Dann nahm er die kleinste Nadel aus Alans Bindfutter, fädelte einen Pergamentfaden ein und wusch sie kurz im Wein. Nachdem er sie Alan übergeben hatte, hielt er die Wundränder mit zwei Haken auseinander. Um sie herum herrschte gespannte Stille, als die Schaulustigen mit angehaltenem Atem die Operation beobachteten. Nur das schmerzvolle Stöhnen des Verletzten und das Knistern des Feuers im Kamin waren zu hören.
Sorgfältig nähte Alan das Loch im Darm mit einer Kürschnernaht zu und rief dann nach Öl. Die Besitzerin des Kaffeehauses eilte herbei und brachte ihm ein Fläschchen Rosenöl, womit der Chirurg den Darm anfeuchtete, bevor er ihn in die Bauchhöhle zurückschob. Inzwischen hatte Jeremy eine größere Nadel mit einem stabilen dicken Faden versehen und reichte sie seinem Freund. Alan durchstach Bauchhaut, Muskeln und Peritoneum, die er mit den Fingern zusammenhielt, zog den Faden durch und knüpfte eine Schlinge. Da die Naht starken Belastungen standhalten musste, setzte er die Stiche eng nebeneinander. Jeremy half ihm, die Ränder so weit wie möglich zusammenzubringen.
»Könnt Ihr mir Verbandszeug beschaffen, Madam?«, fragte Alan die Kaffeehausbesitzerin, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen.
Mit leichtem Bedauern opferte diese eines ihrer Tischtücher für besondere Gelegenheiten und beobachtete mit zusammengepressten Lippen, wie Jeremy es in lange Streifen riss. Nachdem Alan die Wunde noch einmal mit Wein gewaschen hatte, wickelte er die Leinenbandage um den Bauch des Verletzten, der sich wacker gehalten hatte.
»Ihr könnt Euren Herrn jetzt nach Hause bringen«, sagte Alan zu den Dienern. »Aber weist den Kutscher an, langsam zu fahren.« An Sir Henry Belasyse gewandt, fügte er hinzu: »Ich suche Euch morgen im Laufe des Tages auf, um mir die Wunde anzusehen, wenn es Euch recht ist.«
Der Verletzte nickte nur, war aber zu schwach und elend, um zu antworten. Betroffen sahen der Wundarzt und der Priester ihm nach, während die Diener ihn auf dem Weg zur Tür mehr trugen als stützten.
»Wohin soll das nur führen«, murmelte Jeremy betrübt, »wenn sich die besten Freunde nun schon wegen einer Lappalie duellieren und einander umzubringen versuchen? Was ist das für eine Welt, in der wir leben?«
Kapitel 4
Am nächsten Morgen erschien in aller Frühe der Flussschiffer Delton mit seinem Sohn. Er zahlte Alan das verabredete Lehrgeld und klopfte Edmund ein letztes Mal aufmunternd auf die Schulter.
»Sei brav, Sohn«, ermahnte er ihn. »Gehorche deinem Meister und mach deiner Mutter und mir keine Schande.«
Als Delton gegangen war, stellte Alan dem Jungen seinen Gesellen Nick und die Magd Nan vor.
»Führ Edmund herum und zeig ihm das Haus«, wies Alan den Gesellen an. Während die beiden jungen Männer durch die Tür zur Stiege verschwanden, prüfte der Wundarzt sorgfältig sein Bindfutter, denn er hatte sich vorgenommen, an diesem Morgen zuerst die Krankenbesuche zu erledigen. Sir Henry Belasyse’ Bauchverletzung bereitete ihm Sorge, und Peter Standishs Bisswunde musste ebenfalls kontrolliert werden.
Als Nick mit dem Lehrknaben zurückkehrte, war Alan aufbruchsbereit.
»Du wirst hier in der Offizin auf dem Rollbett schlafen«, erklärte er Edmund. »Deine Kleider kannst du in der Truhe in der Ecke aufbewahren.«
Der Junge nickte und schnürte das Bündel auf, das er bei seiner Ankunft auf dem Boden abgelegt hatte. Es enthielt zwei vollständige Anzüge. Offenbar hatten Familie und Verwandte Geld zusammengelegt, um die Garderobe zu bezahlen, damit Edmund seinen Meister nicht in Verlegenheit brachte.
»Beeil dich, ich muss einige Krankenbesuche machen«, drängte der Wundarzt.
Doch in diesem Moment wurde die Tür geöffnet, und ein Mann betrat die Offizin. Alan seufzte ergeben. Der Ankömmling war James Pearse, Leibchirurg des Herzogs von York. Einen so bedeutenden Besucher konnte er zu seinem Bedauern nicht dem Gesellen überlassen.
»Mr. Pearse, welch eine unerwartete Ehre«, begrüßte Alan den Zunftgenossen. »Was führt Euch zu mir?«
»Ich komme gerade von Sir Henry Belasyse«, erklärte Pearse. »Ihr habt bei der Behandlung seiner Wunde gute Arbeit geleistet, Meister Ridgeway, das muss ich Euch lassen. Trotzdem hoffe ich, Ihr werdet es mir nicht übelnehmen, wenn ich mich nun um Sir Henry kümmere. Immerhin ist er Parlamentsabgeordneter und verkehrt bei Hofe.«
»Wenn Sir Henry dies wünscht«, erwiderte Alan, ohne jedoch seinen Ärger über das anmaßende Auftreten des Leibchirurgen völlig verbergen zu können.
»Ich versichere Euch, dass Sir Henry Euch dankbar ist und das Euch zustehende Honorar bezahlen wird.«
»Daran zweifle ich nicht«, gab Alan zurück. Er hätte es wissen müssen. Ein wohlhabender Patient war stets heiß begehrt, denn er zahlte meist auch überhöhte Honorare ohne Murren.
»Wenn das alles ist«, meinte Alan. »Ich habe noch andere Patienten zu besuchen.«
Er winkte Edmund und verabschiedete sich mit kühler Höflichkeit von James Pearse, der ihm mit überheblichem Blick nachsah.
In der Passage, die unter dem Nonsuch House hindurchführte, hielt Alan inne und klopfte an die Eingangspforte. Ein Page, der für die Bewohner Besorgungen machte, öffnete ihnen.
»Zu Mr. Standish. Ich bin Meister Ridgeway«, sagte der Wundarzt.
Der Bursche führte den Besuch die breite Holztreppe hinauf in den ersten Stock bis vor die Tür zu Standishs Wohnung und meldete sie an. Peter begrüßte den Chirurgen und seinen Lehrknaben herzlich und reichte Alan seine unversehrte Hand.
»Kommt herein, Meister Ridgeway. Ich muss mich bei Euch bedanken. Dank Eurer hervorragenden Behandlung beginnt die Wunde bereits zu heilen.«
»Das freut mich«, erwiderte Alan. »Lasst sie mich trotzdem sehen, um ganz sicher zu sein.«
Die Stube, die sie betraten, war ein großer, in dunkler Eiche getäfelter Raum. Am Fenster stand ein breiter Tisch, den ein türkischer Teppich zierte. Ein Schwall Papiere bedeckte ihn. Mehrere hochlehnige, mit dem neuartigen Rohrgeflecht versehene Stühle standen an den Wänden und zeugten von der Wohlhabenheit des jungen Mannes.
»Seid Ihr Kaufmann?«, fragte Alan.
»Ja, ich habe mein Glück als Handelsvertreter in der Levante gemacht und handle jetzt hauptsächlich mit englischem Tuch und Rohseide aus der Türkei und Syrien. Der Verlust meiner Lagerhäuser an der Themse durch das Feuer war bitter, aber jetzt, da wir Frieden mit den Niederlanden und Frankreich haben, wird es mir hoffentlich bald gelingen, erneut ein Schiff in die Levante zu schicken.«
Peter führte seine Besucher ins Schlafgemach, in dem ein massives Baldachinbett stand. Die Vorhänge aus Kamelott waren bei Tag um die Pfosten geschlungen. Die vergoldeten Ledertapeten an den Wänden ließen den Raum düster erscheinen, besonders an einem regnerischen Tag wie diesem. Einzig die weiße Stuckdecke hellte ihn ein wenig auf.
»Ihr lebt allein?«, erkundigte sich Alan, da ihm das Fehlen einer weiblichen Hand auffiel. Dies war das Gemach eines Junggesellen.
»Ich habe meine besten Jahre in der Ferne verbracht und hatte daher bislang keine Gelegenheit, mich zu verheiraten«, erklärte Peter Standish. »Leider verstand ich mich mit meinem Vater nicht besonders und war froh, mein Elternhaus zu verlassen.«
»Das tut mir leid, Sir.«
Der Wundarzt machte seinem Patienten ein Zeichen, sich neben den Waschstand zu setzen. Peter beobachtete ihn, während er den Verband löste und die Wunde freilegte. Die sicheren Bewegungen von Alans feingliedrigen Händen flößten Vertrauen ein. Es war offensichtlich, dass der Chirurg sein Handwerk verstand. Peter schätzte ihn auf Ende dreißig. Er war groß und schlank und überragte sogar den hochgewachsenen Kaufmann. Sein schulterlanges glattes Haar war schwarz wie Rabenfedern und nur an den Schläfen mit einzelnen Silberfäden durchwoben. Alan Ridgeways hohe Stirn verriet Intelligenz, und seine graublauen Augen blickten freundlich und mitfühlend. Eine Stupsnase und ein breiter Mund mit schmalen Lippen, der sich nur allzu bereitwillig zu einem charmanten Lächeln öffnete, vervollständigten das Bild. Meister Ridgeway war Peter ebenso sympathisch wie Dr. Fauconer.
»Ihr erwähntet meinem Freund gegenüber, dass Euch eine Familienangelegenheit in jene Situation gebracht hat, in der Ihr von dem bissigen Hund angefallen wurdet«, bemerkte der Wundarzt.
»Macht sich Dr. Fauconer immer noch Gedanken um meine Sicherheit?«, fragte Peter amüsiert.
Alan sah ihn entschuldigend an, während er die Bisswunde, die gut heilte, mit herbem Wein betupfte.
»Mein Freund ist fasziniert von kniffligen Rätseln, und wenn er eines wittert, dann lässt ihm das keine Ruhe.«
»Dr. Fauconer scheint mir ein kluger Kopf zu sein«, meinte der Kaufmann anerkennend. »Vielleicht ziehe ich ihn tatsächlich zu Rate, wenn ich allein nicht weiterkomme. Allerdings handelt es sich um eine heikle Angelegenheit, über die zu sprechen mir schwerfällt.«
Alan beließ es dabei. Nachdem er eine Wundsalbe aufgetragen und einen neuen Verband angelegt hatte, riet er seinem Patienten, den Arm noch eine Woche in der Schlinge zu tragen. »Wenn Ihr Euch kräftig genug fühlt, könnt Ihr wieder Eurer Arbeit nachgehen.«
»Ich danke Euch, Meister Ridgeway«, sagte Peter und bezahlte den Wundarzt großzügig.
»Kommt in den nächsten Tagen noch einmal in meine Offizin, Sir«, fügte Alan hinzu. »Wenn die Wunde weiter so gut heilt, könnt Ihr bald auf den Verband verzichten.«
Als Peter Standish den Wundarzt und seinen Gesellen verabschiedete, kehrte gerade sein Kammerdiener John von einer Besorgung zurück.
»Hilf mir beim Umziehen«, sagte Peter kurzentschlossen. »Ich werde meiner Familie einen Besuch abstatten.«
Kapitel 5
Nach einem halbstündigen Fußmarsch die New Fish Street und die Gracechurch Street entlang bog Peter Standish schließlich in die St. Mary Axe ein und stand kurz darauf vor dem Haus, in dem er aufgewachsen war. Der Anblick des verwitterten Fachwerks mit den silbergrau verfärbten Eichenbalken, die das Gerüst des Gebäudes bildeten, den weiß verputzten Gefachen aus dem mit Lehm beworfenen Flechtwerk und dem spitzen Giebel, der über die Straße ragte, weckte wie stets widersprüchliche Gefühle in ihm. Seine Kindheit, die von Freude ebenso geprägt gewesen war wie von Leid, hatte er nur allzu abrupt hinter sich gelassen, als er mit sechzehn Jahren als Kaufmannslehrling in die Levante aufgebrochen war. Das Leben in der Ferne war nicht leicht gewesen, aber er hatte einen klugen und freundlichen Meister gehabt, ein angesehenes Mitglied der Levant Company, der ihn mit viel Geduld alles Wissenswerte über den Handel in jenem Teil der Welt gelehrt hatte. Und da dessen einziger Sohn an einem Fieber gestorben war, hatte er Peter schließlich zu seinem Erben gemacht. So hatte dieser sich, unabhängig von seiner Familie, sein eigenes Handelsgeschäft aufgebaut, und dies mit einem Erfolg, den nur das Feuer von London und der Krieg mit Holland hatten bremsen können. Ersteres hatte ihn zwei Lagerhäuser voller Rohseide und Letzteres ein Schiff gekostet, an dem er einen Anteil besessen hatte und das vor der Küste Englands von den Holländern gekapert worden war.
Seine Familie sah er nach seiner Rückkehr aus der Levante nur selten. Sein Vater hatte stets seinen jüngeren Sohn Joseph vorgezogen, denn dieser gehörte zu den Menschen, die bei anderen durch Schmeichelei alles erreichten und niemals offen ihre eigenen Ansichten verteidigten. Peter hatte sich dagegen nie gescheut, andere zwar mit dem nötigen Respekt, aber geradeheraus zu kritisieren. Sein autoritärer Vater hatte ihn dafür oftmals hart bestraft, ihn jedoch nicht zu brechen vermocht. Auch das Verhältnis zu Joseph war von jeher angespannt gewesen, denn Peter hatte seinen jüngeren Bruder schon als Kind durchschaut und ihn als einen Menschen ohne Rückgrat insgeheim stets ein wenig verachtet. Einzig seine kränkliche Mutter und seine jüngere Schwester Elena lagen ihm am Herzen.
Ein Lakai öffnete Peter die Tür.
»Ist mein Vater zu Hause, Dickon?«
»Nein, Sir, der Herr ist ausgegangen.«
»Und meine Schwester?«
»Mistress Standish ist in der Stube, Sir.«
»Danke, Dickon. Ich werde sie gleich aufsuchen. Aber zuerst sehe ich nach meiner Mutter.«
Eine schmale Treppe führte in die oberen Stockwerke zu den Schlafgemächern. In einem trotz des trüben Wetters abgedunkelten Raum lag Elizabeth Standish im Bett. Die Vorhänge waren bis auf eine Lücke am Kopfende zugezogen, und im Kamin brannte ein Feuer. Als Peter eintrat, öffnete sie die Augen und bemühte sich, im Halbdunkel das Gesicht des Ankömmlings zu erkennen.
»Seid Ihr das, Elena?«, fragte sie mit schwacher Stimme.
»Nein, ich bin es, Euer Sohn Peter.«
Ein schwaches Lächeln huschte über ihre blassen Lippen. »Peter, welch eine Freude. Ihr wart lange nicht hier.«
»Nur eine Woche, Mutter. Soll ich die Läden öffnen? Es ist regnerisch draußen, das Licht wird Euch nicht stören.«
»Ja, tut das. Ich möchte ein wenig hinaussehen.«
Peter faltete die Läden zurück und zog die Bettvorhänge auf. Obgleich nur blasses Tageslicht ins Zimmer fiel, blinzelte Elizabeth und wandte den Kopf ab.
»Wie geht es Euch, Mutter?«
Aufmerksam studierte er ihr knochiges, blutleeres Gesicht. Dunkle Schatten lagen unter müden, glanzlosen Augen. Ihr einst blondes Haar war vorzeitig ergraut.
»Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis der Herr mich zu sich ruft«, antwortete sie. Ihre Stimme klang heiser, und das Atmen fiel ihr sichtlich schwer.
»Bitte sagt das nicht«, entgegnete Peter betroffen. Sie litt schon eine geraume Weile an Schwindsucht, doch in den letzten zwei Wochen hatte sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert.
»Es hat keinen Sinn, sich vor der Wahrheit zu verschließen«, wehrte sie ab. »Aber reden wir nicht von mir. Weshalb tragt Ihr Euren Arm in der Schlinge?«
»Ein Hund hat mich gebissen«, erklärte Peter. »Macht Euch keine Sorgen, Mutter, es ist nichts Ernstes.«
»Du solltest wirklich besser auf dich achtgeben«, erwiderte Elizabeth vorwurfsvoll. »Spiel nicht mit wilden Hunden, das ist gefährlich.«
Das Lächeln gefror auf Peters Lippen. Auch die geistigen Kräfte seiner Mutter ließen erheblich nach. Offenbar glaubte sie, den Bub von einst vor sich zu haben, der sich in Entdeckerlaune so manches Mal in Schwierigkeiten gebracht hatte.
»Ich passe in Zukunft besser auf, versprochen«, sagte er.
Der Ausdruck von Unruhe wich von Elizabeths Zügen.
»Ich kann mich nicht länger mit dir unterhalten, mein Junge.«
Ein röchelnder Husten begann sie zu schütteln. Gelbgrüner Schleim, vermischt mit Blut, trat über ihre Lippen und rann über ihr Kinn. Peter erhob sich, nahm eines der Leintücher von der Truhe neben dem Bett und wischte ihr den Mund ab.
»Lass mich jetzt schlafen«, keuchte sie.
»Braucht Ihr noch etwas, Mutter?«
»Nein, geh nur …«
Ihr Kopf sank zur Seite, und ihre Augen schlossen sich. Es kostete Peter erhebliche Anstrengung, sich von ihrem Lager abzuwenden und das Krankenzimmer zu verlassen. Er hatte das Gefühl, jeder Atemzug könnte ihr letzter sein. Im Erdgeschoss blieb Peter einen Moment zögernd vor der Tür zur Stube stehen, bevor er eintrat. Seine Schwester Elena saß am Fenster und säumte mit geschickter Hand ein Damasttischtuch. Das blasse Tageslicht, das durch die Scheiben fiel, hob ihr ebenmäßiges Profil mit der hohen Stirn, der kleinen Nase und dem spitzen Kinn hervor. Sie trug ein Gewand, das aus einem eng geschnürten Mieder aus blauem Satin, einem oberen Rock aus demselben Stoff und einem mit silbernen Spitzen besetzten, unteren Rock bestand. Das unter dem mit Fischbeinstäben verstärkten Mieder getragene Leinenhemd quoll in üppigen Falten unter den lediglich bis zu den Ellbogen reichenden Ärmeln hervor, der tiefe Brustausschnitt war unter dem dünnen Schleiertuch, das ihn züchtig bedeckte, nur zu erahnen. Elenas goldblondes Haar war straff aus dem Gesicht gezogen und im Nacken zu einem mit Perlen durchflochtenen Knoten gebunden. Zu beiden Seiten der Schläfen wippten ein paar eng gedrehte Locken, und ein zarter Saum aus flaumigen Löckchen um die Stirn nahm der Frisur ein wenig von ihrer Strenge.
Als Peter auf der Schwelle erschien, wandte seine Schwester den Kopf. Sogleich fiel ihr Blick auf die Schlinge, in der er den rechten Arm trug, und ein erschrockener Ausdruck trat auf ihr Gesicht. Sie ließ ihre Näharbeit fallen und stürzte ihm entgegen.
»Peter, was ist passiert?«, rief sie aufgeregt. »Bist du verletzt?«
Der junge Kaufmann legte beschwichtigend die linke Hand auf den Arm seiner Schwester.
»Es ist nicht so schlimm.«
»Aber was …«
»Ich werde euch alles der Reihe nach erzählen.«
Sein Blick wanderte zu seinem Bruder Joseph, der an das Kaminsims gelehnt dastand und den Ankömmling ebenso überrascht ansah wie Elena. Als Einziger in der Familie hatte Joseph nicht das blonde Haar der Standishs geerbt, sondern besaß dunkelbraune Locken, die ihm auf Brust und Schultern fielen. Seine Haut war stets kränklich bleich, und nicht einmal die Strahlen der Sommersonne vermochten ihr einen gesünderen Ton zu verleihen. Aus diesem Grund vermied er dunkle Kleidung, die seine Blässe nur noch unvorteilhafter hervorhob. So sagte ihm die neue Mode, die aus Überrock und Weste aus schwarzen und weißen Stoffen bestand und die der König vor einigen Monaten bei Hof eingeführt hatte, nicht zu, obwohl ihr inzwischen auch viele der wohlhabenderen Londoner Bürger folgten. Stattdessen trug er ein etwas altmodisch wirkendes Wams aus gerippter goldbrauner Seide, das kaum bis zur Taille reichte und den feinen Leinenstoff des Hemdes sehen ließ. Die Ärmel bestanden aus einzelnen, nur am Armloch des Wamses und der Manschette befestigten Brokatstreifen, zwischen denen der weiße Taft des Futters sichtbar war. Dazu trug Joseph eine sogenannte Rhingrave, auch als »Unterrockhose« bezeichnet, eine stoffreiche, in viele Falten gelegte Hose, deren Beine unter den Knien mit Spitzenmanschetten zusammengehalten wurden. Die Manschetten des Wamses, der Bund und die Seiten der Rhingrave waren mit lachsfarbenen, gelben, grünen, lila- und elfenbeinfarbenen Bändern besetzt. Helle Seidenstrümpfe, mit Rosetten verzierte Schuhe und ein Filzhut mit weißen Straußenfedern vervollständigten Josephs Aufmachung.
Was war sein Bruder doch für ein Geck, dachte Peter naserümpfend.
Er setzte sich neben Elena, die ihren Platz am Fenster wieder eingenommen hatte, auf einen Stuhl. Die neugierigen Blicke seiner Geschwister auf sich gerichtet, begann Peter, von seiner Reise nach Walthamstow zu berichten.
»Du wolltest Stapleford Manor aufsuchen?«, unterbrach Elena ihren Bruder. »Aber weshalb nur?«
»Weil der Familiensitz eines Mannes der Ort ist, an dem er seine Geheimnisse am leichtesten vor der Außenwelt verbergen kann.«
»Glaubst du denn tatsächlich, dass George Holcroft etwas Anrüchiges zu verbergen hat?«, schaltete sich Joseph in leicht gelangweiltem Ton ein. »Das sind doch Hirngespinste.«
»Als älterer Bruder sehe ich es als meine Pflicht, Elena vor einem Schritt zu bewahren, der sie ins Unglück stürzen würde«, widersprach Peter. »George Holcroft hat Dreck am Stecken, da bin ich sicher. Der Tod seiner ersten Gemahlin ist sehr rätselhaft. Niemand scheint zu wissen, wie sie gestorben ist.«
»Das ist doch nichts Ungewöhnliches«, meinte Joseph mit einem Achselzucken. »Wie oft versagen die Ärzte bei der Behandlung eines Kranken, weil sie nicht wissen, was ihm fehlt. Egal, woran man leidet, sie verordnen stets das Gleiche: Aderlass, Brechmittel oder Einlauf …«
Da musste Peter seinem Bruder allerdings zustimmen. So viel Erkenntnis hatte er ihm gar nicht zugetraut.
»Dennoch … mir ist nicht wohl dabei, Elena einem zwielichtigen Mann wie diesem Holcroft anzuvertrauen. Eigentlich wäre es die Pflicht unseres Vaters, Erkundigungen über ihren zukünftigen Gatten einzuholen, aber ihn interessiert nur die einträgliche Verbindung mit einem wohlhabenden Geschäftspartner.«
»Was ist dagegen einzuwenden?«, fragte Joseph. »Schließlich ist es gang und gäbe, dass ein Vater seine Tochter vorteilhaft verheiratet. Und Elena hat gegen diese Verbindung nichts einzuwenden.«
Peter streifte das engelhafte Gesicht seiner Schwester mit zweifelndem Blick.
»Elena, ich kann nicht verstehen, dass es dir nichts ausmacht, einen dreißig Jahre älteren Mann zu ehelichen.«
Sie blickte ihn aus ihren kornblumenblauen Augen offenherzig an.
»Mr. Holcroft hat mich stets mit der größten Höflichkeit und Zuvorkommenheit behandelt. Ich zweifle nicht daran, dass er mir ein rücksichtsvoller Gemahl sein wird.«