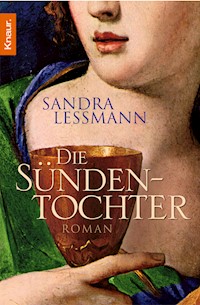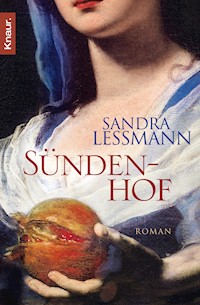
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jeremy Blackshaw
- Sprache: Deutsch
London 1667: Richter Orlando Trelawney wird nachts an den königlichen Hof gerufen. Dort hat man eine enthauptete Leiche gefunden. Der König persönlich beauftragt Orlando mit der Aufklärung des Falles – und untersagt ihm ausdrücklich, seinen Freund, den katholischen Priester Jeremy Blackshaw, zu Rate zu ziehen. Dies ist leichter gesagt als getan, denn Jeremy bekommt bald Wind von der Sache und errät, dass es sich bei dem Toten um einen Amtsbruder handelt. Unabhängig von Orlando und ohne sein Wissen stellt er eigene Nachforschungen an, unterstützt von der schönen Amoret, der Mätresse des Königs. Als diese herausfindet, wo genau die Leiche gefunden wurde, ahnt sie nicht, dass sie sich in höchste Gefahr begibt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Sandra Lessmann
Sündenhof
Roman
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Erstes Kapitel
Februar 1667
Er war allein. Die nächtliche Stille, die ihn umgab, wurde nur vom Knistern des Feuers im Kamin durchbrochen. Seit Stunden schon stand er am Fenster und sah auf die Themse hinaus, die sich träge durch die schlafende Stadt wand. Die Dunkelheit hüllte alles so vollkommen ein, dass man den Fluss hinter den Glasscheiben, auf denen sich die tanzenden Flammen spiegelten, kaum mehr erahnen konnte. Doch er war ohnehin blind für seine Umgebung. Vor seinem inneren Auge stand das Objekt seiner Sehnsucht, der Stachel im Fleisch des Liebenden: La Belle Stewart. Er sah ihr Gesicht mit den edlen Zügen, ihr vollkommenes Profil, das bald als Britannia die Rückseite der neuen Münzen schmücken würde. Nur sie war dessen würdig, die keusche, betörend schöne Jungfrau, mit einer Haut wie Milch und Honig, einem Körper voller Grazie … und einem Herzen aus Eis!
Er seufzte tief, und seine Züge verhärteten sich. Es war ein markantes dunkles Gesicht mit schwarzen Augen unter schweren Lidern, einer kräftigen Nase und einem starken Kinn. Dunkle Brauen beschatteten die Augen, und ein schmaler Oberlippenbart verlieh den groben Zügen eine gewisse Eleganz. Die schwarzen Locken einer Perücke umrahmten das Gesicht, in das Schmerz und Enttäuschung tiefere Linien gegraben hatten. So mancher Betrachter hätte es als hässlich bezeichnet.
Im Geiste liebkosten seine Hände den schlanken Frauenkörper, der für ihn unerreichbar blieb. Er hatte sie mit Geschenken und Aufmerksamkeiten überhäuft, ihr alles angeboten, alles – nur nicht die Ehe. Nun ahnte er, dass er sie verlieren würde. Es brach ihm das Herz. Zuweilen hasste er sie sogar.
Das leichte Kratzen von Fingernägeln an der Tür riss ihn aus seinen Gedanken. »Jetzt nicht!«, rief er gereizt.
Die Tür öffnete sich, und der Kammerdiener William Chiffinch trat, den Befehl seines Herrn missachtend, ein.
»Verzeiht, Euer Majestät, aber es ist etwas Schreckliches geschehen!«
»Was ist so wichtig, dass du mich zu dieser Stunde noch stören musst?«
»Ein Mord, Euer Majestät! Man hat im Palast eine Leiche gefunden.«
Der Tote war mit einem eilig herbeigeholten Bettlaken zugedeckt worden. König Charles II. gab Chiffinch ein Zeichen, das Laken anzuheben. Wortlos betrachtete er den übel zugerichteten Leichnam, dann nickte er und wandte sich ab.
»Wer hat ihn gefunden?«
Sein Bruder James, Herzog von York, antwortete mit gepresster Stimme: »Eine der Wachen. Er kam sofort zu mir.«
»Hat sonst noch jemand den Toten gesehen?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Er kann hier nicht liegenbleiben. Bringt ihn in einen unbenutzten Raum und bewacht die Tür«, befahl Charles dem Gardisten, der die Leiche gefunden hatte. »Niemand darf erfahren, dass es im Palast einen Mord gegeben hat. Die Königin und die Hofdamen würden sich nur ängstigen.«
»Gleichwohl muss der Mörder überführt werden«, mahnte James.
Sein Bruder nickte zustimmend. »Ich werde die Ermittlungen jemandem überlassen, der absolut vertrauenswürdig ist.«
»Wem?«
»Sir Orlando Trelawney.«
James hatte keine Einwände.
Der König blickte ihn eindringlich an. »Geh zu Bett! Ich kümmere mich um alles.«
Charles wartete, bis sich sein Bruder entfernt hatte. Dann wandte er sich an seinen Kammerdiener, der zusammen mit dem Gardisten den Leichnam in das Laken wickelte.
»Chiffinch, für dich habe ich eine besondere Aufgabe.«
Der Geruch der eben gelöschten Kerze hing noch in der Luft. Sir Orlando Trelawney, Richter des Königlichen Gerichtshofs, schmiegte seine Wange an die duftende Haut seiner Frau Jane und lauschte ihren gleichmäßigen Atemzügen. Nach dem Nachtmahl hatte sie sich nicht recht wohl gefühlt, doch nun schlief sie so ruhig, als gäbe es keine Sorgen auf der Welt. Darum beneidete er sie. Je weiter die Zeit fortschritt, desto schwieriger wurde es für ihn, einzuschlafen. Zuweilen lag er noch lange wach, so wie an diesem Abend, und betrachtete ihr schmales Gesicht, das so zerbrechlich wirkte und so gar nicht zu den schwellenden Brüsten und dem prallen Leib passen mochte. Seit dem Moment, da sie ihm gestanden hatte, dass sie schwanger war, lebte er in der ständigen Furcht, dass ihr oder dem Kind etwas zustoßen könnte. Seine erste Gemahlin war nach einer Fehlgeburt gestorben, und er gab sich die alleinige Schuld daran. Sein sehnlicher Wunsch, Kinder zu haben, hatte seine arme Beth frühzeitig ins Grab gebracht. Er wollte auf keinen Fall erleben, dass es Jane ebenso erging. Ängstlich beobachtete er sie, ob sie wohlauf war, fragte sie immerzu nach ihrem Befinden und umsorgte sie wie eine Glucke ihr Küken. Einmal die Woche schickte er nach seinem Freund Dr. Fauconer, damit er Jane untersuchte und Sir Orlando bestätigte, dass alles in Ordnung war. Dann erst gelang es dem Richter, ein wenig gelöster zu schlafen, denn er hatte uneingeschränktes Vertrauen in die Fähigkeiten des Arztes. Immerhin hatte dieser ihn einst von einer schweren Krankheit geheilt, als er von anderen Ärzten bereits verloren gegeben worden war. Wenn jemand sein Kind gesund auf die Welt bringen konnte, dann Dr. Fauconer! Sir Orlando verband eine außergewöhnliche Freundschaft mit diesem Mann, der nicht nur Arzt und Gelehrter, sondern auch katholischer Priester und Jesuit war. Da im protestantischen England die Ausübung des römischen Glaubens verboten war, arbeiteten die Priester, denen dem Gesetz nach die Todesstrafe drohte, unter falschem Namen im Verborgenen und hielten die heilige Messe für ihre Gläubigen in Privathäusern ab. So war auch Fauconer nicht der richtige Name seines Freundes. Manchmal erschien es dem Richter seltsam, dass er nicht wusste, wie der Mensch, dem er am meisten vertraute, in Wirklichkeit hieß, doch es war ihm nie wichtig gewesen.
Der langersehnte Schlaf begann Sir Orlando Trelawney endlich einzuhüllen, als ein Geräusch ihn hochfahren ließ. Jemand hämmerte unten an das Hauptportal. Sofort war der Richter hellwach. Wenn jemand zu dieser späten Stunde Einlass begehrte, musste es sich um etwas Wichtiges handeln. Vorsichtig erhob er sich aus dem Bett, bemüht, seine Gemahlin nicht zu wecken, doch da öffnete Jane auch schon die Augen.
»Wohin geht Ihr?«, fragte sie verschlafen.
»Da ist jemand an der Tür. Ich muss nachsehen, was er will.«
Er verzichtete darauf, die Kerze anzuzünden, und tastete im Dunkeln nach seinem Schlafrock. In diesem Moment wurde an der Tür zum Gemach gekratzt, und der Kammerdiener des Richters sah herein.
»Was gibt es, Malory?«
»Ein Bote des Königs ist gekommen, Mylord. Seine Majestät wünscht Euch zu sprechen.«
»Gut, sag ihm, ich bin gleich da. Und dann hilf mir beim Ankleiden.«
Der Diener nickte und verschwand.
»Was mag der König um diese Zeit von Euch wollen?«, fragte Jane verwundert.
»Ich hoffe, es handelt sich nicht um eine Staatskrise.«
»Ob die Holländer gelandet sind?«
Sir Orlando setzte sich auf die Bettkante und nahm die Hand seiner Frau, um sie zu beruhigen. »Selbst wenn es so wäre, bräuchtet Ihr keine Angst zu haben, meine Liebste.«
»Wann wird der König diesen unseligen Krieg endlich beenden? Wie sollen wir uns auf Dauer zweier so mächtiger Gegner wie Frankreich und Holland erwehren?«
»Macht Euch darüber keine Gedanken. Ihr dürft Euch in Eurem Zustand nicht aufregen. Überlasst die Sorge über den Krieg den Staatsdienern.«
Sir Orlando streichelte zärtlich ihre Wange. »Ich weiß nicht, wie lange ich wegbleiben muss. Ich werde nach Dr. Fauconer schicken, damit Ihr nicht allein bleibt.«
Sie lächelte, was er in der Dunkelheit nur erahnen konnte. »Glaubt mir, es geht mir gut. Ein paar Wochen wird es noch dauern, bis meine Zeit kommt.«
Er erhob sich vom Bett. »Ich bestehe darauf, meine Liebe. Vor ein paar Stunden habt Ihr noch über Unwohlsein geklagt. Und ich habe keine Ahnung, welchen Auftrag Seine Majestät für mich hat. Vielleicht zieht sich die Angelegenheit bis in den morgigen Tag hinein. Versteht doch, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich Euch in guten Händen weiß.«
Sie hütete sich davor, ihm zu widersprechen, denn sie kannte seine Ängste. Als Malory erschien, zog sich der Richter mit dem Kammerdiener in den Ankleideraum nebenan zurück.
Wenig später rumpelte Sir Orlando Trelawneys Kutsche den Strand entlang, die Verbindungsstraße zwischen London und Westminster, vorbei an den Palästen des Adels aus dem vergangenen Jahrhundert, deren Gärten sich bis ans Ufer der Themse zogen. Nicht alle Hausbesitzer kamen ihrer Bürgerpflicht nach und hängten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang eine Lampe über ihre Tür, und so war es nach Einbruch der Dunkelheit in den Straßen von London recht düster. Die Kutsche des Richters war mit zwei Laternen ausgestattet, und in mondlosen Nächten wie dieser ging gewöhnlich ein Lakai mit einer Fackel voraus, um dem Gefährt den Weg zu leuchten. Diese Aufgabe hatte an diesem Abend jedoch der voranreitende Gardist übernommen. Bei Charing Cross bogen sie in Richtung des Whitehall-Palastes ab. Kurz darauf lenkte der Soldat sein Pferd durch das Palast-Tor in den Großen Hof und zügelte es vor dem Küchentrakt. Sir Orlando stieg aus seiner Kutsche und folgte ihm durch eine kleine Pforte ins Innere eines Gewirrs von Korridoren, Treppen und Zimmerfluchten, aus dem der alte Palast bestand. Über die Jahrhunderte hatte man immer neue Trakte an die bestehenden Gebäude angebaut, so dass Whitehall mehr und mehr einem verschachtelten Irrgarten glich. Trelawney wusste bald nicht mehr, wo sie sich befanden, und atmete auf, als der Gardist endlich vor einer Tür stehenblieb und mit der Hand darauf wies. Sir Orlando kratzte am Rahmen und trat ein, als eine Stimme ihn dazu aufforderte. Zu seiner Überraschung fand er sich in einem kleinen Kabinett wieder, in dem einige mit Tüchern bedeckte Möbel an den Wänden aufgereiht waren. Es wurde von zwei Laternen erleuchtet. In der Mitte stand der König. Auf dem Boden neben ihm lag eine menschliche Gestalt, die in ein Laken gehüllt war.
»Ah, da seid Ihr ja, Sir Orlando«, begrüßte Charles den Ankömmling.
Der Richter verbeugte sich und trat näher. »Zu Euren Diensten, Euer Majestät.«
»Ich habe Euch kommen lassen, weil ich weiß, dass auf Eure Diskretion Verlass ist, Mylord, und weil Ihr Erfahrung mit der Aufklärung von Verbrechen habt.« Der König deutete auf die verhüllte Gestalt. »Man fand diesen Leichnam auf dem Gelände von Whitehall. Ihr wisst, was das bedeutet: eine Herausforderung an den König! Jemand hat den Frieden meines Palastes gestört und stellt damit meine Autorität als Herrscher in Frage. Ich wünsche, dass Ihr herausfindet, wer dahintersteckt.«
»Ich werde mein Bestes tun, Sire«, versicherte Trelawney. »Weiß man, wer der Tote ist?«
Charles schüttelte den Kopf. Sein Blick richtete sich nachdenklich auf die Leiche.
»Nein, Mylord. Ihr werdet feststellen, dass es nicht einfach sein wird, das herauszufinden.«
Verständnislos krauste der Richter die Stirn. Bevor er etwas entgegnen konnte, ergriff der König erneut das Wort: »Es ist unerlässlich, dass die Angelegenheit geheim bleibt, Sir Orlando. Niemand würde sich am Hof seines Monarchen mehr sicher fühlen, vor allem die Damen nicht. Ich möchte unbedingt eine Panik vermeiden.«
»Natürlich, Euer Majestät.«
Charles trat ganz nah an Trelawney heran, und seine schwarzen Augen bohrten sich in die blauen Augen des Richters.
»Ihr dürft mit niemandem über diesen Vorfall sprechen, weder mit Euren Brüdern, dem Leichenbeschauer, Euren Dienern oder Eurer Frau – und ganz besonders nicht mit Eurem Freund Dr. Fauconer!«
Über Sir Orlandos Gesicht breitete sich ein Ausdruck der Verwirrung.
»Aber, Euer Majestät, ich versichere Euch, dass Dr. Fauconer vertrauenswürdig ist.«
»Ich weiß. Dennoch wünsche ich von Euch hier und jetzt das Versprechen, dass Ihr ihm gegenüber nicht die geringste Einzelheit über diesen Mord verlauten lasst.«
Die Stimme des Königs klang scharf, unnachgiebig. Es war ein Befehl, der Gehorsam forderte. Trelawney hatte keine andere Wahl, als nachzugeben.
»Ich verspreche es, Sire.«
Doch sein Gesicht gab nur allzu deutlich die Enttäuschung preis, die er empfand. In den vergangenen Jahren hatte er sich daran gewöhnt, seinen Freund, den Arzt und Priester, zu Rate zu ziehen, wann immer er ein Problem hatte. Und er war nie enttäuscht worden. Fauconers Wissen, das dieser sich durch lange Studien und als Missionar auf Reisen in ferne Länder angeeignet hatte, schien unerschöpflich. Er liebte es, knifflige Rätsel zu lösen, und bedachte Einzelheiten, die Trelawney gar nicht in den Sinn gekommen wären. Wie sollte er diesen Mord ohne Dr. Fauconers Hilfe aufklären?
Charles riss den Richter aus seinen Gedanken. »Ich überlasse Euch nun Euren Nachforschungen, Mylord. Warren wird Euch zur Hand gehen. Er hat den Toten gefunden.« Der König deutete auf den Gardisten, der Sir Orlando hergeführt hatte. »Wenn Ihr Neuigkeiten habt, wendet Euch an Chiffinch. Er ist außer mir und Warren der Einzige, der in die Sache eingeweiht ist. Viel Glück!«
Der Richter blickte Charles nach, bis sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte. Seufzend wandte er sich dem am Boden liegenden Leichnam zu.
»Wo hat man den Toten gefunden?«
»Im Großen Hof«, antwortete John Warren kurz angebunden.
»Ich möchte die Stelle sehen.«
»Da ist nichts, Mylord. Nur eine Blutlache, und die habe ich beseitigt.«
Trelawney presste ärgerlich die Lippen zusammen. Die Untersuchung des Mordes würde nicht einfach werden, wenn es keine Spuren zu deuten gab.
»Nehmt das Laken ab.«
Der Gardist beugte sich zu dem Toten hinab und lüftete das Betttuch. Sir Orlando trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Bei Christi Blut! Der Kopf … wo ist der Kopf?«
Er spürte, dass er bleich geworden war. Entsetzt starrte er auf die enthauptete Leiche, die in ein dunkles bürgerliches Gewand gekleidet war. Nun verstand er auch, weshalb Charles gesagt hatte, es würde schwierig werden, den Namen des Toten zu ermitteln. Ohne Kopf … ohne Gesicht war es tatsächlich so gut wie unmöglich, herauszufinden, wer er war und weshalb man ihn getötet hatte.
Trelawney schmeckte bitteren Gallensaft auf der Zunge und bemühte sich, den Brechreiz zu überwinden. Ein paar Mal atmete er tief durch, dann sank er in die Hocke, um die Leiche näher zu begutachten. Die rechte Hand des Toten wies Verbrennungen an den Fingern auf. Sir Orlando hob sie an und betrachtete sie. Die Haut war verkohlt und glänzte im Schein der auf dem Boden stehenden Funzel. An den Handgelenken waren Striemen zu sehen. Das Wams des Leichnams zeigte an mehreren Stellen dunkle Flecken und Risse.
»Zieht ihm die Kleider aus«, befahl der Richter.
»Mylord?«
»Da ich weder den Leichenbeschauer noch einen Wundarzt zu Rate ziehen kann, muss ich mich selbst an die Untersuchung des Opfers machen.«
Wie gerne hätte Trelawney diese Aufgabe seinem Freund überlassen, der als ehemaliger Feldscher weitaus mehr Erfahrung mit Wunden hatte als er. Doch Sir Orlando hatte Fauconer mehrere Male bei der Untersuchung einer Leiche zugesehen und hoffte, dass es ihm gelingen würde, dessen Methoden anzuwenden.
Murrend machte sich der Soldat daran, die Kleider zu entfernen. Dabei fiel Sir Orlando auf, dass die Totenstarre noch nicht eingesetzt hatte. Das Opfer konnte also noch nicht allzu lange tot sein, ein paar Stunden vielleicht.
Nacheinander durchsuchte der Richter das Wams, die Kniehosen, das Hemd des Toten, fand jedoch nichts.
»Merkwürdig! Er hat nichts bei sich, nicht das Geringste. Niemand geht ohne ein paar Münzen aus dem Haus. Man muss ihn beraubt haben.«
Sir Orlando zog ein Taschentuch hervor und wischte sich die Hände ab, die von der Berührung mit den Kleidern blutbeschmiert waren. Als der Körper nackt vor ihm lag, waren die Wunden mühelos zu erkennen. Es waren drei: eine in der linken Schulter, eine in der rechten Flanke und eine im Unterbauch. Vermutlich war Letztere tödlich gewesen. Trelawney überlegte, was sie verursacht haben könnte: ein Dolch, ein Stilett?
»Ich brauche Euren Degen«, sagte er.
Widerspruchslos zog der Gardist die Waffe aus der Scheide und reichte sie Sir Orlando mit dem Griff zuerst. Der Richter ließ die Spitze der Klinge in die Bauchwunde gleiten. Sie passte!
»Also ein Degen«, murmelte er, überrascht von seinem eigenen Einfallsreichtum. Fauconer wäre sicher stolz auf ihn.
Trelawney wiederholte das Experiment an der Schulterwunde und stellte fest, dass die Klinge kaum einen Zoll durch die Muskeln glitt, bevor sie auf ein Hindernis stieß. Auch klafften die Wundränder weiter auseinander, als sei die Degenklinge im Fleisch gedreht worden. Betroffen reichte er dem Gardisten die Waffe zurück.
»Die Verletzung an der Schulter wurde dem Mann nicht zugefügt, um ihn zu töten, sondern um ihm Schmerz zuzufügen. Man hat seine Hand ins Feuer gehalten und ihn mit Degenstichen durchbohrt.« Trelawneys Gesicht verzerrte sich vor Abscheu. »Jemand hat den Unglücklichen erbarmungslos gefoltert!«
Zorn stieg in Sir Orlando auf und versengte ihm die Kehle. Grausamkeit hatte ihn von jeher krank gemacht. Als Richter ging er rücksichtslos gegen Verbrecher vor, die anderen Menschen ohne Mitleid Schaden zufügten. In diesem Fall ahnte er jedoch, dass es schwierig werden würde, den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Energisch zwang sich Trelawney zur Ruhe und beugte sich erneut über den Leichnam. Er wollte sicher sein, dass ihm nichts Wichtiges entging. An den Fußgelenken fanden sich ebenfalls Striemen. Man hatte das Opfer also gefesselt, bevor man es gequält hatte. Vielleicht war es über längere Zeit festgehalten worden.
An den Armen waren Blutergüsse zu erkennen. Trelawney legte seine Hand um den rechten Oberarm des Toten und bemerkte, dass seine Finger und die dunklen Male deckungsgleich waren. Man hatte den Unbekannten also roh an den Armen gepackt. Vermutlich hatte man ihn überfallen, entführt und anschließend gefesselt irgendwo gefangen gehalten. Hatte man ihn zwingen wollen, etwas preiszugeben, was nur er wusste? Und hatte er das Geheimnis verraten, oder war er standhaft geblieben? Angesichts der Wunden konnte Sir Orlando sich die zweite Möglichkeit kaum vorstellen. Der Unglückliche musste Höllenqualen gelitten haben. Auch war zu bezweifeln, dass der Stich in den Bauch sofort tödlich gewesen war. Wunden wie diese verursachten furchtbare Schmerzen. Der Verletzte siechte mitunter über Stunden dahin, bevor er starb. Was hatte dieser Mann getan, dass man ihm solche Grausamkeiten zugefügt hatte?
Trelawney stutzte, als er an der Innenseite des rechten Unterarms eine gelbliche Verfärbung entdeckte, die ihm bisher nicht aufgefallen war. Dies war kein Bluterguss und auch keine Brandwunde. Sir Orlando strich behutsam mit der Fingerspitze darüber. Die Haut fühlte sich vernarbt an. Eine alte Wunde? Vielleicht fand sich hier der einzige Hinweis, der ihm helfen könnte, den Namen des Toten herauszufinden.
»Wenn Ihr mit Eurer Untersuchung fertig seid, Mylord, bringe ich die Leiche weg«, bemerkte der Gardist, dem das Warten zu lang wurde.
»Wohin?«, fragte Trelawney.
»Seine Majestät sagte, ich soll sie verschwinden lassen. Also werfe ich sie in die Themse.«
Der Richter sah den Soldaten missbilligend an. »Diese arme Kreatur hat ein ordentliches Grab verdient. Schlagt ihn wieder in das Laken und bringt ihn zu meiner Kutsche. Der Pfarrer meines Kirchspiels wird ihn auf meine Bitte hin heimlich begraben.«
»Wie Ihr wünscht, Mylord.«
Zweites Kapitel
Die Ruder tauchten in regelmäßigen Abständen in das ruhig fließende Wasser der Themse. Sir Orlandos Kammerdiener Malory zog den Umhang enger um seinen Körper, doch es half nichts. Die Kälte stieg von den Fluten auf und kroch unbarmherzig in seine Glieder.
»Wollt Ihr unter der Brücke hindurchschießen?«, fragte der Fährmann, der das Boot ruderte.
»Nein, lasst mich am ›Alten Schwan‹ aussteigen.«
»Aber die Stufen sind noch nicht wieder repariert, seit das große Feuer sie zerstört hat. Es gibt nur einen vorläufigen Landungssteg.«
»Das wird schon gehen«, antwortete Malory mit klappernden Zähnen.
Als das Boot angelegt hatte, bezahlte der Kammerdiener den Flussschiffer, bat ihn aber, auf seine Rückkehr zu warten. »Ich fahre gleich wieder zur Anlegestelle des Temple zurück.«
»Meinetwegen«, brummte der Fährmann. »Aber beeilt Euch.«
Malory nahm seine Laterne und hastete an der ausgebrannten Schenke vorbei. Zu seiner Linken breiteten sich die Trümmer der Stadt London aus, die ein verheerender Brand vor nun sechs Monaten dem Erdboden gleichgemacht hatte. Zwar waren die Straßen inzwischen vom Schutt befreit worden und auch wieder mit der Kutsche befahrbar, doch der Wiederaufbau kam nur schleppend in Gang. Malory beeilte sich, das verwüstete Gelände hinter sich zu lassen, denn dort wimmelte es von Diebesgesindel und Raubmördern. Jede Nacht kam es zu Übergriffen auf unvorsichtige Passanten oder auf die mittellosen Leute, die sich in den Trümmern der Häuser eingerichtet hatten. Der Kammerdiener war erleichtert, als er die ausgebrannte Hülle von St. Magnus the Martyr hinter sich gelassen hatte und die Brücke betrat. Auch hier hatte das Feuer den nördlichen Häuserblock vernichtet. Stattdessen war zu beiden Seiten ein Lattenzaun errichtet worden, der Fußgänger davor schützen sollte, bei Sturm in die Themse gerissen zu werden. Der Rest der Brücke bis zum Südufer trug noch immer die jahrhundertealten Holzbauten, die sich an manchen Stellen über der Straße trafen, eine Bauweise, die den Bewohnern einen zusätzlichen Raum bescherte.
Malory atmete auf, als er das nördlichste Gebäude, das Kapellenhaus, erreichte. Vor dem Haus schräg gegenüber auf der Westseite blieb er stehen. Über der Tür knarrte an einem schmiedeeisernen Arm ein Holzschild, auf dem ein Zuckerhut dargestellt war. Daneben war eine rot-weiß gestreifte Stange angebracht, an deren Ende eine Aderlassschale hing, das Zunftzeichen der Wundärzte.
Malory klopfte vernehmlich an die Tür. Die Fensterläden waren geschlossen und die Bewohner bereits im Bett, doch es dauerte nicht lange, bis dem Besucher geöffnet wurde. Ein Junge von fünfzehn Jahren steckte seinen blonden Schopf durch den Türspalt und musterte den Ankömmling neugierig. Da er Malory kannte, ließ er ihn ohne Zögern eintreten.
»Ich möchte mit Dr. Fauconer sprechen«, bat der Kammerdiener.
»Ich hole ihn.«
Malory sah dem Knaben nach, der im Nachthemd und mit nackten Füßen die Stiege hinaufeilte. Kurz darauf kehrte er mit Dr. Fauconer zurück.
»Malory, ist etwas passiert?«, fragte dieser besorgt.
»Seine Lordschaft ist soeben vom König nach Whitehall gerufen worden. Und er weiß nicht, wie lange er dort festgehalten wird.«
»Ich verstehe. Er möchte seine Gemahlin in ihrem Zustand nicht so lange allein lassen. Warte hier, ich ziehe mich nur rasch an.«
Der Arzt stieg wieder in den zweiten Stock hinauf, wo sich die Schlafkammern befanden.
»Was ist los, Jeremy?«, fragte der Wundarzt Alan Ridgeway, der an der Tür zu seinem Gemach stand.
Sein Freund machte eine beschwichtigende Handbewegung. »Nichts, was Euch Sorge bereiten sollte. Seine Lordschaft wurde an den Hof beordert und möchte, dass ich so lange über seine Gemahlin wache.«
Alan lächelte ironisch. »Der alte Knabe macht einen ganz schönen Aufstand um seinen zukünftigen Stammhalter.«
»Ich habe Verständnis für seine Ängste. Er hat mehrere Kinder noch im Säuglingsalter verloren, und er gibt sich die Schuld am Tod seiner ersten Frau. Sollte seinem Kind oder – Gott bewahre – seiner Gemahlin etwas zustoßen, brächte ihn das wahrscheinlich um den Verstand. Deshalb muss ich alles tun, was in meiner Macht steht, damit es diesmal gutgeht.«
»Soll ich mitkommen?«, erbot sich der Wundarzt.
»Nein, das wird nicht nötig sein. Mylady Trelawneys Zeit ist noch nicht gekommen. Ich möchte nur sehen, wie es ihr geht.«
Jeremy Blackshaw, der unter dem Namen Fauconer auftrat, um seine Familie vor den möglichen Folgen seiner verbotenen Tätigkeit zu schützen, warf sich rasch seine Kleider über und verließ mit Malory das Haus. Der Fährmann hatte geduldig gewartet und ruderte sie nun stromaufwärts, entlang des vom Brand zerstörten Uferstreifens, vorbei an den Ruinen von Coldharbour, des Stahlhofs und von Baynard’s Castle. Die völlige Vernichtung des alten Stadtkerns hatte einige enthusiastische Architekten dazu angeregt, Vorschläge für eine grundlegend neue Straßenplanung vorzulegen. Kluge Köpfe wie Christopher Wren, John Evelyn und Robert Hooke hatten die Vision von einer Stadt mit großen, geräumigen Plätzen, von denen strahlenförmig breite Straßen ausgingen, die die verwinkelten Gassen der vergangenen Jahrhunderte ablösen sollten. Doch die kühnen Pläne scheiterten an den unentwirrbaren Grundbesitzverhältnissen. Und so blieb letztlich alles beim Alten. Die Gassen sollten in ihrem ursprünglichen Verlauf übernommen, wenn auch verbreitert und gepflastert werden. Noch beriet das Parlament über das »Gesetz zum Wiederaufbau der Stadt London«, doch man ging davon aus, dass es vor Ende des Monats verabschiedet würde. Dann konnten die Arbeiten endlich beginnen.
Das Boot legte an den Temple-Stufen an. Malory bezahlte den Fährmann und reichte seinem Begleiter die Hand, um ihm beim Aussteigen zu helfen. Es war nicht weit bis zum Haus des Richters auf der Chancery Lane. Als sie ihr Ziel erreicht hatten, schloss Malory die Dienstbotentür auf und schlüpfte, gefolgt von Jeremy, hinein.
»Soll ich Euch heißen Würzwein oder Warmbier bringen, Doktor?«, erbot sich der Kammerdiener. »Es ist ganz hübsch kalt draußen.«
Jeremy hätte Tee vorgezogen, doch das exotische Getränk, das er als Missionar in Indien kennengelernt hatte, war in England noch nicht sehr verbreitet. Eigentlich hatte nur die Königin, die aus Portugal stammte, eine Schwäche dafür.
»Heißer Würzwein würde mir jetzt guttun, danke«, entschied sich Jeremy.
Während der Kammerdiener in der Küche zurückblieb, machte sich der Arzt mit einer Kerze allein auf den Weg zu seiner Patientin. Lady Trelawney lag im Bett, schlief aber nicht. Als Jeremy in der Tür erschien, bat sie ihn lächelnd herein. Er setzte sich auf einen gepolsterten Stuhl und betrachtete die zierliche junge Frau, die in dem großen massiven Baldachinbett fast verloren wirkte. Wie viele Möbelstücke war auch dieses Bett mit seinen aufwendigen Schnitzereien und Marketeriearbeiten eine Kostbarkeit, die von Generation zu Generation weitervererbt wurde. Es war fast hundert Jahre alt und hatte einst der Familie von Richter Trelawneys Mutter gehört. Er hatte es von seinem Großvater John Langham geerbt, weshalb es als Langham-Bett bezeichnet wurde. Phantastische Gestalten der griechischen Mythologie sahen von dem Kopfbrett und den Pfosten auf den Betrachter herab. Die ursprünglich roten Bettvorhänge waren durch grüne ersetzt worden, die auf den Ton von Lady Trelawneys Augen abgestimmt waren. Die Eheleute hatten ihre Hochzeitsnacht in diesem Bett verbracht, als es noch in Sir Orlandos Landsitz Oakleigh Hall gestanden hatte. Auf Bitten seiner Gattin hatte er es in sein Haus auf der Chancery Lane bringen lassen, da sie aufgrund von Trelawneys vielen Verpflichtungen das Landhaus nur selten aufsuchen konnten.
Janes schmales Gesicht verschwand beinahe in den dicken Federkissen, auf denen ihr Kopf ruhte. Mit Jeremys Hilfe richtete sie sich nun vorsichtig auf.
»Es ist sehr freundlich von Euch, mir Gesellschaft zu leisten, Pater«, sagte sie dankbar. Da sie allein waren, konnte sie es wagen, ihn als Priester anzusprechen. Lange kannte sie sein Geheimnis noch nicht. Vor einem halben Jahr, während des verheerenden Brandes, hatte sie durch Zufall erfahren, dass der beste Freund ihres Gemahls Jesuit war und dass Orlando trotz der Gesetze, die alle katholischen Priester in England zu Freiwild machten, seine schützende Hand über ihn hielt. Dadurch war ihr Gatte nur noch mehr in ihrer Achtung gestiegen.
»Es tut mir leid, dass Ihr meinetwegen um den Schlaf gebracht werdet«, entschuldigte sich Jane. »Aber es hätte keinen Sinn gehabt, Orlando zu widersprechen, als er nach Euch schicken wollte.«
Jeremy machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ich bin gerne gekommen, und sei es nur, damit er beruhigt ist. Es kann auch für Euch nicht einfach sein.«
Sie nickte ernst. »Ich fühle mich gesund, und ich fürchte mich auch nicht sehr vor der Niederkunft, aber wenn er mich so ängstlich umsorgt, dann wird mir auch ein wenig bang. Wenn er nun recht behalten sollte!«
Jeremy nahm beruhigend ihre schmale weiße Hand. »Ich weiß, er macht es Euch nicht leicht. Aber lasst Euch von seiner Sorge nicht anstecken. Ihr müsst doppelt stark sein, für Euch und für ihn. Dabei werde ich Euch, so gut ich kann, beistehen.«
»Ich wünschte, es wäre schon vorbei«, murmelte Jane, während sie eine Strähne ihres weißblonden Haares zurückstrich, die der Nachthaube entschlüpft war.
Malory erschien in der Tür und reichte dem Besucher einen Becher heißen Würzwein, an dem dieser seine noch immer klammen Finger wärmte. Jane lächelte verständnisvoll. Im Gegensatz zu ihrem sanguinischen Gatten wirkte Dr. Fauconer mit seinem hageren Gesicht, der knochigen Habichtsnase, den dünnen Lippen, dem energischen spitzen Kinn und der großen mageren Gestalt wie ein Asket, den man sich gut in Mönchskutte in einer kahlen Klosterzelle vorstellen konnte. Er war Ende dreißig. Der Blick seiner grauen Augen war scharf und durchdringend, konnte aber so sanft und gütig sein, dass man ihm ohne Zögern Vertrauen schenkte. So erging es auch Jane. Als sich die bleichen Wangen des Jesuiten unter Einwirkung des Weins zu röten begannen, fasste sie sich ein Herz und fragte scheu: »Glaubt Ihr, die heilige Mutter Gottes würde mich erhören, wenn ich sie um Beistand bäte?«
Jeremys Überraschung war nicht geheuchelt. Neugierig sah er sie an. »Natürlich würde sie das, Madam.«
Jane senkte den Blick auf ihre ineinander verflochtenen Finger.
»Orlando würde es vermutlich töricht finden, aber es fällt mir leichter, mich mit meinen Sorgen an die Mutter Maria zu wenden, auch wenn unsere Priester sagen, dass man seine Gebete an Gott den Herrn richten soll. Die Hebamme, die Ihr mir schicktet, Madame Farge, sagte, dass Eurem Glauben nach Frauen im Kindbett die Märtyrerinnen Barbara und Agathe und den heiligen Leonhard als Fürsprecher anrufen, damit das Kind gesund zur Welt kommt. Meine Urgroßmutter hat sich noch ihres Beistands versichert. Sie muss sich weniger allein gefühlt haben als ich.« Jane sah ihr Gegenüber unsicher an. »Ich weiß nicht, warum ich so empfinde, aber ich habe das Bedürfnis, meine Ängste und Sorgen den alten Heiligen anzuvertrauen. Gott ist so vollkommen und so fern.«
»Aber er ist auch barmherzig, Madam«, erinnerte Jeremy sie.
»Würdet Ihr mir von der Mutter Gottes und den Heiligen erzählen, Pater?«, bat Jane.
»Natürlich, wenn Ihr das wünscht.«
Sie lächelte ihm zu, dankbar und beruhigt.
»Seit ich weiß, dass Ihr Priester seid, frage ich mich, warum Ihr dieses gefährliche Leben führt«, gestand sie. »Die alten Gesetze sind doch nie abgeschafft worden. Man könnte Euch wegen Hochverrats hinrichten, nur weil Ihr katholischer Priester seid. Ihr setzt mit Eurer Anwesenheit in diesem Land Euer Leben aufs Spiel, Pater.«
»Da habt Ihr zweifellos recht, Madam. Aber ich bin nun einmal Engländer. Nach langen Jahren des Exils hatte ich den Wunsch, in meine Heimat zurückzukehren, auch wenn ich den meisten meiner Landsleute nicht willkommen bin. Einzig die Autorität des Königs, der nicht an der Treue seiner katholischen Untertanen zweifelt, schützt mich.«
»Ich habe nie verstanden, weshalb Seine Majestät die Strafgesetze nicht abschafft.«
»Weil er sich gegen die antikatholischen Einflüsse im Parlament nicht durchsetzen kann. Vor kurzem erst hat ein parlamentarisches Komitee eine Petition an den König gerichtet, in der die Verbannung aller ›papistischen Priester und Jesuiten‹ verlangt wird. Seine Majestät hat zugestimmt, um das Komitee zu beruhigen, auch wenn er eine solche Maßnahme nicht billigt. Er braucht Geld, um regieren und Krieg führen zu können, Geld, das nur das Parlament ihm bewilligen kann.« Er lächelte bitter. »Es heißt, dass die Musiker des Königs hungers sterben, weil Seine Majestät ihnen seit der Thronbesteigung vor sieben Jahren den Lohn schuldig geblieben ist. Und kürzlich habe der Bewahrer der Ratsprotokolle erklärt, er sei nicht mehr in der Lage, dem König Papier für die Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen, da sein Privatvermögen aufgebraucht sei und er nie einen Penny als Ausgleich für seine Ausgaben bekommen habe.«
Janes Augen wurden groß. »Aber das ist doch nicht möglich. Steht es tatsächlich so schlimm?«
»Ich fürchte ja.«
»Mein Gatte erzählt mir nie solche Dinge«, murmelte sie bedauernd. »Er denkt wohl, eine Frau sollte sich nicht mit Staatsproblemen beschäftigen.«
»Er möchte nicht, dass Ihr Euch Sorgen macht«, sagte Jeremy in dem Versuch, seinen Freund zu entschuldigen.
Jane nickte schwach. »Ich weiß.« Sie schluckte ihre Enttäuschung hinunter und hob den Blick zu dem hageren Gesicht ihres Gegenübers. »Wisst Ihr diese Einzelheiten von Mylady St. Clair?«
»Ja«, gestand der Priester lächelnd. »Sie hält mich über den Hofklatsch auf dem Laufenden, ob ich ihn hören möchte oder nicht.«
»Sie ist Euer Beichtkind, nicht wahr?«, fragte Jane.
»Ja.«
»Es ist sicher nicht leicht, der Beichtvater einer Mätresse des Königs zu sein.«
Der Jesuit verdrehte vielsagend die Augen. »Das ist es tatsächlich nicht. Aber es war ihr Wunsch, und ich konnte es ihr nicht abschlagen. Wir kennen uns, seit sie ein Kind war. Ich war für eine Weile ein Vaterersatz für sie, nachdem ihr leiblicher Vater in der Schlacht von Worcester umgekommen war. Ihre Mutter hatte sie schon einige Jahre zuvor verloren.«
»Man hört so viel Anrüchiges über die Damen des Hofes. Aber Mylady St. Clair scheint mir ein offener und herzlicher Mensch zu sein.«
»Ihr würdet sie mögen, Madam«, bestätigte Jeremy.
Jane verzog mit einem Mal das Gesicht und stemmte die Hände in die Matratze, auf der Suche nach einer bequemeren Stellung. Fürsorglich erhob sich der Priester und schüttelte ihr die Kissen zurecht.
»Habt Ihr Rückenschmerzen, Madam?«
»Ein wenig. Das Kind ist manchmal recht unruhig. Die Hebamme sagt, es wird vermutlich ein Junge, weil meine rechte Brust stärker geschwollen ist als die linke.«
Sie sah ihn lächeln. »Ihr glaubt nicht an solche Voraussagen, Pater?«
»Nun, Männer sind im Allgemeinen warm und trocken, Frauen aber kalt und feucht. Daher macht die Vermutung, dass ein Knabe auf der rechten Seite des Uterus, nahe der blutkochenden und Wärme spendenden Leber heranreift, und ein Mädchen auf der linken Seite, die der kühleren Milz zugewandt ist, schon Sinn. Dennoch glaube ich nicht, dass sich der Plan Gottes so leicht durchschauen lässt. Lasst Euch überraschen, Madam. Auch wenn Sir Orlando sich sehnlichst einen Erben wünscht, würde er eine Tochter doch ebenso lieben.«
Ein leises Geräusch verriet, dass das Hauptportal geöffnet wurde. Die Schwangere und der Priester verstummten und lauschten den Schritten, die sich die Treppe herauf näherten. Kurz darauf stand Sir Orlando Trelawney in der Tür des Schlafgemachs. Jeremy, der sich von seinem Stuhl erhoben hatte, bemerkte trotz des kümmerlichen Lichts, dass das Gesicht des Richters blass und besorgt wirkte.
»Mylord, ist alles in Ordnung?«
Sir Orlandos Blick begegnete dem seines Freundes. Wie gern hätte er das bedrückende Erlebnis der letzten Stunden mit ihm geteilt und seinen Rat eingeholt. Ärgerlich presste er die Lippen aufeinander, als er an die Worte des Königs dachte, die ihm diese Erleichterung versagten. Der Grund für das Verbot blieb ihm ein Rätsel. Seine Majestät kannte Dr. Fauconer und wusste, dass dieser alles andere als eine Klatschbase war. Das Geheimnis wäre bei ihm sicher aufgehoben. Für einen Moment verspürte Trelawney den Drang, sich über den Befehl des Königs hinwegzusetzen und Fauconer ins Vertrauen zu ziehen, doch sein Pflichtbewusstsein hinderte ihn schließlich daran.
Als der Richter seinen Freund begrüßte, spürte Jeremy dessen Unbehagen. Aufmerksam studierte der Priester Sir Orlandos Gesicht mit den wohlgeformten fleischigen Zügen, die seine vierundvierzig Jahre kaum verrieten. Seine blauen Augen blickten ernst, die Lippen waren voll und sinnlich, das hellblonde Haar verschwand ganz unter der gelockten Perücke, deren Farbe auf die dichten blonden Augenbrauen abgestimmt war. Er war ein gutaussehender Mann von hohem, schlankem Wuchs, der keine Verantwortung scheute, dem aber nur selten ein Lachen über die Lippen kam. Nie hatte es einen Zweifel an seiner Redlichkeit gegeben, ein Umstand, der sicherlich Anteil an seinem raschen Aufstieg zum Richter des Königlichen Gerichtshofs gehabt hatte.
»Weshalb hat Seine Majestät Euch rufen lassen, Mylord?«, fragte Jeremy, der seine Neugier nicht länger bezähmen konnte.
»Es gibt ein Problem bei Hof. Der König wünscht allerdings, dass über die Sache Stillschweigen bewahrt wird«, antwortete Sir Orlando ausweichend.
Jeremy gab sich zufrieden. »Ich verstehe.«
Der Richter bemühte sich, das Thema rasch zu beenden. »Wie geht es meiner Frau?«
»Es geht ihr gut. Aber nun solltet Ihr Eurer Gemahlin noch etwas Ruhe gönnen.«
»Das werde ich. Vielen Dank, dass Ihr über sie gewacht habt«, sagte Trelawney, und seine Stimme wurde wieder herzlich.
Drittes Kapitel
Wie so oft bestand Sir Orlando darauf, dass sein Freund für die Nacht seine Gastfreundschaft annahm. In dem großen Haus des Richters war immer ein Gemach für ihn hergerichtet. Da Jeremy tiefe Müdigkeit verspürte, war ihm das Angebot willkommen, und kaum hatte sein Kopf das nach Kräutern duftende Kissen des Gästebettes berührt, schlief er auch schon wie ein Murmeltier.
Das Krähen eines Hahns, der irgendwo im Hof eines benachbarten Hauses auf dem Misthaufen thronte, weckte ihn. Die Stadt erwachte früh. Noch vor Sonnenaufgang regten sich die Dienstboten, Läden wurden geöffnet, das Feuer in der Küche wurde geschürt, Wasser für die Herrschaft erhitzt, Bettzeug gelüftet und Nachtgeschirr zum Fenster hinausgeleert – sehr zum Missfallen der Frühaufsteher, die zu Fuß unterwegs waren.
Jeremy hatte bereits sein Morgengebet beendet, als der Kammerdiener des Richters ihm heißes Wasser zum Waschen brachte. Auf dem dreibeinigen Gestell, auf dem eine Schüssel und ein Krug aus Zinn standen, fand sich alles Nötige zur morgendlichen Reinigung: Seife aus Kastilien, Salz zum Abreiben der Zähne, ein frisches Leintuch zum Abtrocknen.
»Wünscht Ihr, dass ich Euch rasiere, Sir?«, fragte Malory, Rasiermesser und Seifenschüssel in der Hand.
»Nein danke, Malory, das erledige ich selbst.«
»Dann bringe ich Euch einen Spiegel.«
Nach der Rasur schlüpfte Jeremy in Leinenhemd, Wams und Kniehosen, Wollstrümpfe und Stiefel. Zuletzt legte er sich den schmucklosen weißen Leinenkragen um den Hals.
Im Speiseraum wurde bereits das Morgenmahl aufgetragen, als Jeremy in der Tür erschien. Sir Orlando half seiner Gemahlin auf einen der hochlehnigen Stühle aus Walnussholz mit einem Sitz aus Rohrgeflecht, einer kürzlich eingeführten Neuerung. Der Tisch, an den sie sich setzten, war ebenfalls aus Nussbaum und ließ sich auseinanderklappen.
»Ich hoffe, Ihr habt gut geschlafen«, sagte Jane, nachdem sie den Priester begrüßt hatte.
»Ja danke.« Jeremy warf einen prüfenden Blick in Sir Orlandos Gesicht, das Spuren einer durchwachten Nacht zeigte. »Ihr seht nicht so aus, als hättet Ihr Ruhe gefunden, Mylord.«
»Nein, nicht wirklich«, erwiderte der Richter.
Auf weißen Delfter Fayencen wurden Austern, gesalzene Heringe, kaltes Rindfleisch, Banbury-Käse, feine Weißbrötchen und Butter serviert. Dazu gab es Ale. Jane zog Warmbier mit Eiern, Brot, Zucker und Gewürzen vor, gefolgt von ein paar Scheiben Röstbrot.
»Ich sehe deutlich, dass Euch etwas bedrückt, Sir«, bemerkte Jeremy, als er gesättigt war. »Wollt Ihr mir nicht erzählen, was gestern geschehen ist?«
Sir Orlando nahm einen Schluck Ale. »Glaubt mir, mein Freund, ich würde nichts lieber tun, aber ich kann nicht.«
»Weil der König es Euch untersagt hat?«
»Ja. Er möchte die Angelegenheit geheim halten, und nach dem, was ich gestern sah, gebe ich ihm recht.«
»Ihr denkt doch nicht, dass ich darüber reden würde?«, fragte der Jesuit erstaunt.
»Aber nein, natürlich nicht«, versuchte der Richter zu beschwichtigen. »Ihr wisst, dass ich Euch vertraue. Aber Seine Majestät bestand darauf, dass ich Euch gegenüber nichts über die Sache verlauten lasse.«
Jeremys Stirn legte sich in Falten. »Nannte er ausdrücklich meinen Namen?«
»Ja. Es tut mir leid. Ich musste ihm schwören, nichts zu sagen.«
Die Verwirrung des Priesters wuchs, je länger er über Sir Orlandos Worte nachdachte. Weshalb wollte der König ihn aus dieser Angelegenheit heraushalten? Traute er ihm nicht mehr? Hatte er einen Streit mit Lady St. Clair gehabt und fürchtete nun, dass sie durch ihren Beichtvater etwas erfuhr, was sie nicht wissen sollte?
»Dann kann ich Euch für Eure Nachforschungen nur Glück wünschen«, sagte Jeremy.
»Es ist eine verzwickte Sache. Und ich bedauere sehr, dass ich auf Eure Hilfe verzichten muss«, gestand der Richter. »Vielleicht könnt Ihr mir eine Frage beantworten, ohne dass ich Euch Einzelheiten nenne.«
»Fragt nur.«
»Könnt Ihr eine Vermutung darüber anstellen, wie eine gelbliche Verfärbung der Haut entstanden sein könnte, eine Verkrustung wie bei einer Verbrennung?«
Jeremy, der sich gerade Ale nachgeschüttet hatte, stutzte. Langsam stellte er den Krug auf den Tisch zurück und nahm sich Zeit, aus seinem Glas zu trinken, als müsste er nachdenken.
»Wo befindet sich die Verkrustung?«, fragte er, ohne Sir Orlando anzusehen.
»Am Unterarm. Ist das wichtig?«
»Vielleicht …« Wieder nahm Jeremy einen langen Schluck, um sein Gesicht vor dem Freund zu verbergen. »Eine Verletzung, wie Ihr sie beschreibt, ist wahrscheinlich durch eine Verätzung der Haut mit Säure entstanden. Die Farbe gibt Auskunft über die Art der Säure: schwarz bei Schwefelsäure, weiß bei Salzsäure und gelb bei Salpetersäure. Euer Mann hat vermutlich mit Salpetersäure, dem sogenannten Scheidewasser, zu tun. Vielleicht beschäftigt er sich mit der Chemie oder arbeitet mit Schießpulver.«
»Woher wollt Ihr wissen, dass es sich um einen Mann handelt?«, fragte Sir Orlando erstaunt.
»Nun, eine Frau hätte kaum Umgang mit Säuren«, erwiderte Jeremy mit einem Lächeln.
Der Richter presste die Lippen aufeinander. Es würde nicht leicht werden, den Mord vor seinem aufgeweckten Freund geheim zu halten.
Jeremy erhob sich vom Stuhl und verbeugte sich vor Jane. »Wenn Ihr mich nun entschuldigen wollt, Madam. Die Pflicht ruft.«
»Natürlich, Doktor.«
Sir Orlando warf einen prüfenden Blick durchs Fenster. »Es regnet. Ich lasse meine Kutsche anspannen, damit Ihr trockenen Fußes nach Hause kommt.«
»Das ist wirklich nicht nötig, Sir«, widersprach Jeremy, doch der Richter blieb wie immer hartnäckig. Schließlich gab der Jesuit nach. Im Grunde war er froh, nicht auf einem Boot vom Regen durchweicht zu werden.
Während Sir Orlando seiner Gemahlin vom Stuhl half, ging Jeremy in die mit schwarz-weißem Marmor ausgelegte Eingangshalle, um seinen Umhang zu holen, den er auf dem Weg in den Speiseraum auf einer Bank abgelegt hatte. Jemand klopfte an das Portal. Ein Diener eilte herbei und öffnete. Neugierig musterte Jeremy den vom Regenschauer durchnässten Besucher, der rasch in die Halle trat und dem Diener seinen tropfenden Umhang reichte. Darunter kam ein geistliches Gewand zum Vorschein, das den Ankömmling als anglikanischen Priester auswies.
»Melde mich Seiner Lordschaft. Ich muss ihn dringend sprechen!«
Der Diener verschwand im Speisesaal und teilte Sir Orlando mit, dass der Pfarrer eingetroffen sei.
»Gut, führ ihn zu mir«, sagte Sir Orlando. »Würdet Ihr mich allein mit dem Pfarrer reden lassen, meine Liebe?«
Jane zog sich zurück und traf in der Halle auf Jeremy. »Ich gebe Anweisung, dass die Kutsche angespannt wird, Doktor. Wo ist Euer Umhang? Ich werde ihn holen lassen.«
»Ich fürchte, ich habe ihn im Schlafgemach vergessen«, log Jeremy, um Zeit zu gewinnen.
Jane ließ ihn allein. Der Jesuit wartete, bis der Diener den Pfarrer in den Speisesaal geführt und sich wieder entfernt hatte. Dann näherte er sich mit leisen Schritten der Tür, die nicht geschlossen worden war, und lauschte aufmerksam.
»Mylord, es ist etwas äußerst Merkwürdiges geschehen«, berichtete der Geistliche. »Ich kam sofort her, um Euch davon Kenntnis zu geben. Ich hoffe, das ist in Eurem Sinne.«
»Natürlich, Herr Pfarrer. Worum geht es denn?«
»Um den Leichnam, den Ihr mir gestern Nacht brachtet. Ich wollte ihn heute Morgen in aller Frühe beisetzen, nachdem der Totengräber die Grube ausgehoben hatte.«
»Und?«
»Er war fort! Einfach weg! Jemand muss in der Nacht die Tür zur Sakristei aufgebrochen und den Leichnam gestohlen haben.«
Jeremy hörte, wie der Richter scharf die Luft durch die Nase ausstieß.
»Ich danke Euch für Eure Mühe, Herr Pfarrer«, sagte er mit deutlicher Betroffenheit in der Stimme. »Und es tut mir leid, Euch so viele Unannehmlichkeiten bereitet zu haben. Bitte bewahrt Stillschweigen über diese Angelegenheit.«
»Es sieht ganz so aus, als habe der Teufel hier die Hand im Spiel, Mylord«, erwiderte der Kirchenmann beunruhigt.
»Es hat den Anschein, aber ich glaube, ich weiß, wer den Leichnam gestohlen hat. Macht Euch keine weiteren Gedanken, Herr Pfarrer, ich kümmere mich darum.«
Jeremy trat von der Tür zurück, als er die Schritte des Kammerdieners vernahm. Malory kam mit entschuldigender Miene auf ihn zu.
»Es tut mir leid, Sir, ich kann Euren Umhang nicht finden.«
Mit gespielter Verwunderung sah sich der Jesuit in der Halle um. »Dann muss ich ihn wohl woanders hingelegt haben. Ach, da ist er ja. Wie dumm von mir.«
Jeremy ließ sich von Malory den Umhang um die Schultern legen und folgte dem Kammerdiener in den Hof des Hauses, in dem die Kutsche wartete.
»Vergiss nicht, deiner Herrin Bescheid zu sagen, dass ich meinen Umhang gefunden habe. Und richte ihr aus, dass ich mich für die Umstände entschuldige.«
Der Regen ließ bereits nach, so dass der Jesuit nun auf das Angebot verzichten und stattdessen ein Boot hätte nehmen können, doch Jeremy wusste die Großzügigkeit seines Freundes zu schätzen und wollte ihn nicht unnötig vor den Kopf stoßen.
Die Kutsche wurde von vier flämischen Stuten gezogen und von einem Kutscher in Livree gelenkt, der recht unbequem auf einem zwischen zwei Stangen befestigten Lederriemen saß, während seine Füße auf der Wagendeichsel ruhten. Dieser Sitz führte oft zu Unfällen und galt als so unsicher, dass sich während der letzten Jahre sogar die Mitglieder der Königlichen Gesellschaft um die Entwicklung einer besseren Lösung bemühten und stets neue Entwürfe erprobten, wie Sir Orlando, der zuweilen an ihren Treffen teilnahm, seinem Freund berichtet hatte. Der Kutschkasten hing an breiten Lederriemen zwischen vier Pfosten, die mit den Radachsen verbunden waren, was die Stöße auf unebenen Straßen ein wenig abfangen sollte. Er war mit schwarzem Leder bezogen und mit funkelnden Messingnägeln beschlagen. Nachdem Jeremy eingestiegen war, schloss ein Stallbursche die Tür, und das Gefährt setzte sich in Bewegung. Es ging die Chancery Lane hinunter in Richtung Themse, dann links in die Fleet Street. Als die Kutsche den Temple-Bezirk zur Rechten und Clifford’s Inn, eine der vorbereitenden Rechtsschulen für Studenten des Inner Temple, hinter sich gelassen hatte, tat sich übergangslos eine geschwärzte staubige Einöde auf. Hier begann das zerstörte London, die endlos sich hinziehenden Überreste der vom Feuer vernichteten Straßenzüge, die Ruinen ausgebrannter Kirchen und Gildenhäuser, die einst den Stolz der Kaufmannschaft und den Reichtum der Stadt symbolisiert hatten. Von den meisten Holzhäusern waren nur verkohlte Balken übrig. Inzwischen sah man wieder Kutschen durch die Wüstenei rumpeln, vorbei an den wenigen Zelten, in denen die ehemaligen Bewohner bis zum Wiederaufbau ihrer Häuser Unterschlupf suchten. Viele von ihnen hatten den harten Winter nicht überlebt oder waren schließlich doch in andere Städte gezogen. So mancher glaubte, dass London nie wieder aufgebaut würde.
Die Kutsche des Richters überquerte den völlig verschmutzten Fleet-Fluss, der sich nur noch als Rinnsal seinen Weg durch den Schutt bahnte, der ihn verstopfte. Allerdings gab es Pläne, den Fleet gründlich zu säubern und zu kanalisieren, um ihn für kleinere Schiffe wieder zugänglich zu machen.
Wenig später rollte das Gefährt durch den ausgebrannten Ludgate-Bogen, eines der alten Tore des Stadtkerns, und passierte die Ruine der St.-Pauls-Kathedrale. Das einst so erhabene Bauwerk bot einen traurigen Anblick. Noch war ein Wiederaufbau nicht vorgesehen. Man hatte die noch stehenden Reste des Gotteshauses so weit befestigt, dass für Besucher keine Gefahr mehr bestand, und hielt in einem geschützten Teil der Kathedrale weiterhin Gottesdienste ab.
Die Kutsche fuhr weiter über die Cheapside, dann in die Poultry. Ein paarmal flog eine der mit Glasfenstern versehenen Türen auf, wenn ein Rad ein Schlagloch traf, und Jeremy musste mit ausgestreckter Hand nach dem Griff angeln, um sie wieder zuzuziehen. Schließlich schob er das Fenster herunter und hielt die Tür zu, während er hinaussah. Auch wenn die Glasfenster einen Fortschritt gegenüber den zuvor üblichen Ledervorhängen darstellten, war ihre Befestigung in den Türen noch nicht recht ausgereift. Dabei war das Glas selbst von einer bewunderungswürdigen Klarheit. Es stammte aus den Glaswerken des Herzogs von Buckingham, der kurz nach der Thronbesteigung von König Charles II. ein Patent zu seiner Herstellung erhalten hatte.
Als die Kutsche die Kreuzung New Fish Street und Thames Street oberhalb der London Bridge erreichte, steckte Jeremy vorsichtig den Kopf durch das geöffnete Fenster und rief dem Kutscher zu: »Ihr könnt mich hier aussteigen lassen. So erspart Ihr Euch das Gedränge auf der Brückenstraße.«
Der Kutscher brummte dankbar und zügelte sein Gespann vor der Ruine der Kirche St. Magnus the Martyr. Jeremy betrat das von Lattenzäunen gesäumte Nordende der Brückenstraße und wand sich durch den nie abreißenden Strom von Menschen, Pferden, Fuhrwerken und Vieh, der sich von Southwark am Südufer über die Brücke zum Stadtkern am Nordufer wälzte. Unter den neunzehn Brückenpfeilern rauschte die Themse.
Schräg gegenüber der ehemaligen Kapelle von St. Thomas à Becket, die nach ihrer Entweihung unter Henry VIII. ein trauriges Dasein als Lagerhaus eines Lebensmittelhändlers führte, befand sich das neue Domizil des Chirurgen Alan Ridgeway. Nachdem Alans Haus in der Paternoster Row bei dem Brand vernichtet worden war, hatte er dank Lady St. Clairs Vermittlung einen Mietvertrag mit der Stadt abgeschlossen und war vor einigen Monaten in das Haus auf der Brücke gezogen. Jeremy war der Einladung seines Freundes gefolgt und bewohnte nun eine Kammer im zweiten Stock, in der er für die Katholiken der Umgebung die Messe las.
Das Schild mit dem Zuckerhut quietschte über der Tür. Anders als in anderen Städten stellten die Schilder in London nicht das Gewerbe des Handwerkers oder Händlers dar, sondern gehörten zum Haus, ganz gleich, wer dort wohnte.
Jeremy betrat die Chirurgenstube, die den vorderen Raum des Erdgeschosses einnahm. Ein Geruch nach Kräutern und Blut traf seine Nase. Meister Ridgeway war gerade dabei, einen rotgesichtigen Mann zur Ader zu lassen, während sein Lehrknabe Christopher eine Messingschüssel unter das aus der Armwunde rinnende Blut hielt. An einem Tisch, auf dem getrocknete Heilpflanzen aufgehäuft waren, rührte der Geselle Nicholas eine Wundsalbe an.
Die Offizin war mit dunklem Holz getäfelt. An den Wänden befanden sich Regale mit Salbentöpfen und ein Arzneischrank mit unzähligen kleinen Schubladen. Blinkende Aderlassbecken hingen unter der Decke. Das auffälligste Möbelstück war jedoch ein breiter Operationstisch. Meister Ridgeway war für seine Fingerfertigkeit mit der Lanzette und dem Messer berühmt und konnte sich über einen Mangel an Zulauf nicht beklagen.
Jeremy grüßte und stieg in seine Kammer hinauf, um sein Hemd zu wechseln. Als er wieder nach unten kam, hatte Alan seinen Kunden bereits verabschiedet.
»Wie geht es Mylady Trelawney?«, fragte der Wundarzt.
»Oh, sehr gut. Es gibt keinen Grund zur Sorge.«
»Das sieht Seine Lordschaft vermutlich anders.«
Jeremy zuckte mit den Schultern. »Er wird sich erst beruhigen, wenn das Kind gesund zur Welt gekommen ist.« Nachdenklich nagte er an seiner Unterlippe. »Eine merkwürdige Sache ist da heute Morgen passiert …«
Alan sah seinen Freund neugierig an. »Was denn?«
»Seine Lordschaft wollte mir nicht sagen, weshalb der König ihn hatte rufen lassen. Doch er wirkte betroffen. Irgendetwas Schreckliches muss bei Hof vorgefallen sein, etwas, das Seine Majestät mit allen Mitteln geheim halten will.«
»Hat der Richter denn nichts preisgegeben?«
Jeremys Blick richtete sich auf einen Punkt an der Wand. »Nicht viel. Er fragte mich, wie eine gelbliche Verätzung auf der Haut entstanden sein könnte.«
»Eine Verätzung?«, wiederholte Alan verwundert. »Durch Säure?«
»Ja, durch Scheidewasser.«
»Aber was hat das zu bedeuten?«
»Das weiß ich noch nicht. Aber da war noch etwas. Als ich mich verabschiedete, erhielt Seine Lordschaft Besuch vom Gemeindepfarrer. Ich hörte einen Teil des Gesprächs mit. Offenbar hatte der Richter den Pfarrer gebeten, heimlich eine Leiche zu begraben. Doch bevor dies geschehen konnte, wurde der Leichnam gestohlen.«
Alan machte große Augen. »Das ist ja die reinste Räuberpistole. Glaubt Ihr, da gibt es einen Zusammenhang? Zwischen Richter Trelawneys Unterredung mit dem König und dem Leichenraub?«
Jeremy nickte. »Da bin ich sicher. Gehen wir einmal davon aus, man habe im Palast eine Leiche gefunden. Vermutlich hat der Tote eine Säureverätzung am Arm. Seine Majestät lässt den Richter rufen und gibt ihm den Auftrag, den Tod des Mannes zu untersuchen.«
»Aber warum hat Seine Lordschaft Euch nicht in die Sache eingeweiht?«
»Nun, an dieser Stelle wird die Angelegenheit erst richtig mysteriös«, erwiderte der Jesuit, die Stirn gefurcht. »Der König hat Trelawney ausdrücklich untersagt, mir etwas über den Fall zu erzählen.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht«, seufzte Jeremy.
Alan überlegte kurz. »Ich hatte vor, heute Nachmittag mit Armande ins Theater zu gehen. Ich werde sie im Palast abholen. Warum begleitet Ihr mich nicht und fragt Amoret, ob sie etwas über den Vorfall weiß.«
»Das ist eine gute Idee.«
Es war nicht allein die Neugier, die ihn antrieb, sondern auch ein unbestimmtes Gefühl von Sorge. Sosehr er seinen Freund, den Richter, schätzte, traute er ihm doch nicht zu, dass er mit dem seltsamen Todesfall allein fertig wurde. Es war besser, wenn Jeremy auf eigene Faust Nachforschungen anstellte.
Viertes Kapitel
Jeremy und Alan saßen mit dem Gesellen und der Magd Betty beim Mittagsmahl, als der Lehrknabe Christopher atemlos zur Tür hereinstürmte. »Du bist spät, Kit!«, tadelte ihn sein Meister. »Du solltest doch nur Mistress Jennings die Salbe bringen und dann gleich zurückkommen.«
Der blonde Knabe errötete. »Tut mir leid, Meister. Ich habe mich nur kurz aufgehalten, um mir den kopflosen Toten anzusehen, den die Leichenfledderer aus der Themse gefischt haben.« Verlegen blickte er zu Boden.
Jeremy sah interessiert von seinem Teller auf. »Eine kopflose Leiche? Wo?«
»Na da, wo sie alle landen: an den Brückenpfeilern. Die Leichenfledderer haben sie auf einen der Eisbrecher gezogen und zeigen sie jedem, der sie sehen will.«
Jeremy wischte sich mit einem Leintuch den Mund ab und erhob sich. »Auf welchem Eisbrecher?«
»An der Uferschleuse, Sir.«
Alan Ridgeway warf seinem Freund einen verständnislosen Blick zu. »Ihr wollt Euch die Leiche ansehen?«
»Ja. Ich habe so eine Ahnung, dass es etwas mit dem verschwundenen Toten zu tun hat. Kommt Ihr mit?«
Alan brummte etwas Unverständliches, ließ dann aber doch mit leisem Bedauern den Rest seiner Taubenpastete stehen. Wenn der Jesuit eine Fährte aufgenommen hatte, konnte ihn nichts mehr bremsen.
Die beiden Männer warfen sich ihre Umhänge über und traten auf die Brückenstraße hinaus. Als sie etwa auf der Höhe der Uferschleuse waren, suchte Jeremy eine Lücke im Lattenzaun und sah auf das Pfeilerhaupt hinab, auf dem der Brückenpfeiler stand. Auf der Spitze der bootförmigen Insel, die mit losem Steinschutt gefüllt war und von tief in das Flussbett getriebenen Ulmenpfählen zusammengehalten wurde, lag der Tote, den die Leichenfledderer aus dem Fluss gezogen hatten und nun Schaulustigen gegen Bezahlung aus der Nähe zeigten.
Seufzend richtete Jeremy sich auf.
»Habt Ihr ihn gesehen?«, fragte Alan.
»Ja, da unten liegt tatsächlich ein kopfloser Leichnam. Gehen wir zu der Anlegestelle am ›Alten Schwan‹. Die Bootsleute rudern die Gaffer zum Brückenpfeiler. Habt Ihr ein paar Münzen in der Tasche? Ich möchte mir den armen Teufel aus der Nähe ansehen.«
Für sechs Pence pro Person ruderten die Flussschiffer Alan und Jeremy zum Pfeilerkopf, dessen Spitze das Wasser teilte und durch die Bögen der Brücke leitete. Der Jesuit kniete sich neben die bereits verfärbte Leiche und musterte sie einen Moment nachdenklich. Dann umfasste er das rechte Handgelenk und drehte die Innenseite des Unterarms nach oben. Auf der Haut war deutlich eine gelbliche Verfärbung zu sehen.
»Bei allen Heiligen!«, entfuhr es Alan, der seinen Freund neugierig beobachtet hatte. »Wie kamt Ihr darauf, dass es der Tote mit der Säureverätzung ist?«
»Ich ahnte es«, erwiderte Jeremy bedrückt. »Die Leiche wurde gestohlen. Sie in die Themse zu werfen war der einfachste Weg, sie zu beseitigen.«
Der Priester erhob sich und wandte sich an den Fährmann, der ungerührt dastand: »Wie viel verlangt Ihr für den Leichnam?«
Der Mann krauste verwundert die Stirn, und Alan tat es ihm gleich. »Was wollt Ihr denn damit, Sir?«
»Ihn begraben.«
»Na, das ist aber eine noble Geste von Euch, Sir«, grinste der Mann. »Wenn Ihr eine halbe Krone springen lasst, bring ich ihn Euch ans Ufer.«
Jeremy warf dem verdutzten Alan einen auffordernden Blick zu, und dieser griff mit einem ergebenen Seufzen in seine Geldkatze. Zwei Shillinge und sechs Pence rollten in die Hand des Leichenfledderers. Der kopflose Tote wurde in das Boot geschafft und am »Alten Schwan« ausgeladen. Alan eilte nach Hause, um ein Laken zu holen, das als Leichentuch dienen sollte. Mit dem Toten unter dem Arm kehrten die beiden Freunde schließlich unter den verblüfften Blicken der Leute in die Chirurgenstube zurück und betteten ihn auf den Operationstisch.
»Wollt Ihr mir nicht erklären, was Ihr vorhabt?«, fragte Alan. »Ihr könnt Euch doch nicht jeder Leiche annehmen, die an der Brücke angespült wird.«
»Das habe ich auch nicht vor«, versicherte ihm Jeremy. »Übrigens solltet Ihr nach dem Leichenbeschauer schicken, bevor es einer der Nachbarn tut.«
Alan nickte, rief nach Kit und beschrieb ihm den Weg. Ohne einen weiteren Kommentar machte sich der Jesuit an die Untersuchung des Toten. Er begutachtete die Verbrennungen an der rechten Hand, die Stichwunden in Schulter und Leib, die Striemen an Hand- und Fußgelenken und die Blutergüsse an den Armen. Seine Miene wurde immer finsterer. Schließlich hielt Jeremy inne und bekreuzigte sich mehrmals.
»Er wurde gefoltert«, sagte er mit gepresster Stimme. Sein Gesicht war totenbleich geworden. Schwankend ließ er sich auf einen Schemel sinken.
Beunruhigt trat der Wundarzt an seine Seite und legte ihm die Hand auf die Schulter.
»Ist Euch nicht wohl? Warum nimmt Euch der Tod dieses Unbekannten so mit?«
Jeremy hob den Blick zu ihm. In seinen grauen Augen standen Trauer und Schmerz.
»Er ist kein Unbekannter. Letzte Woche war er noch unser Gast. Dieser Tote ist Pater Williams.«
»Wie konntet Ihr es wagen, meinen Befehl zu missachten, Sergeant!«, schimpfte Sir Orlando mit verhaltener Stimme, damit kein Außenstehender das Gespräch mithören konnte. »Ich habe Euch gesagt, dass ich mich um die Bestattung kümmern würde. Nun höre ich vom Pfarrer, dass die Leiche gestohlen wurde. Ihr wart der Einzige, der davon wusste.«
John Warren hielt dem zornigen Blick des Richters trotzig stand.
»Ich bin Sergeant der königlichen Garde und einzig und allein Seiner Majestät Rechenschaft schuldig, Mylord. Der König befahl mir, den Leichnam zu beseitigen, und das habe ich getan.«
»Was habt Ihr mit ihm gemacht?«
»Ihn in die Themse geworfen, Mylord.«
»Und Ihr glaubt, so werdet Ihr ihn los«, entgegnete Trelawney ironisch. »Wisst Ihr nicht, dass alle Leichen an der Brücke angespült werden? Wenn wir Pech haben, zerreißt sich inzwischen schon die ganze Stadt das Maul über den kopflosen Toten.«
Der Gardist senkte schweigend den Kopf.
Verärgert wandte sich Sir Orlando ab und begab sich von der Kammer der königlichen Garde in den Großen Hof, wo seine Kutsche wartete. Was blieb ihm nun anderes übrig, als sich persönlich zur Brücke zu begeben und dort auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen? In seine Gedanken vertieft bemerkte er die beiden Männer, die ihm entgegenkamen, erst, als sie mit ihm auf gleicher Höhe waren.
»Dr. Fauconer, Meister Ridgeway! Welche Überraschung, Euch hier bei Hof zu sehen«, rief der Richter. »Seid Ihr auf dem Weg zu Lady St. Clair?«
»So ist es«, antwortete Alan.
»Und Ihr, Mylord?«, erkundigte sich Jeremy neugierig.
Sir Orlandos Miene drückte Verlegenheit aus. »Ihr wisst, dass ich nicht darüber sprechen darf, Doktor.«
»Dann wollen wir Euch nicht aufhalten, Mylord«, erwiderte der Jesuit und ging weiter. Nach kurzem Zögern folgte ihm Alan.
»Warum habt Ihr ihm nicht gesagt, wer der Tote ist?«, fragte der Wundarzt verdutzt.
»Der König hat ihm verboten, mit mir über die Sache zu sprechen. Wenn ich Sir Orlando nun offenbare, dass ich über alles Bescheid weiß, wird er sich Vorwürfe machen, dass er mir entgegen der Wünsche Seiner Majestät einen Hinweis gegeben hat. Im Augenblick halte ich es für besser, ihm nichts zu sagen, bis ich herausgefunden habe, was hier vor sich geht.«
Die Freunde verließen den Hof durch das Palast-Tor, gingen am Banqueting House vorbei und betraten einen älteren Teil des Schlosses durch das Holbein-Tor. Durch einen Korridor gelangten sie zu den Gemächern von Amoret St. Clair, Mätresse des Königs. Vor zwei Jahren hatte sie Charles II. einen Sohn geschenkt, den der König anerkannt hatte, doch seit Seine Majestät leidenschaftlich in Frances Stewart verliebt war, suchte er Amoret nur noch selten auf, um mit ihr das Lager zu teilen, und zog es vor, mit ihr wie mit einer guten Freundin zu plaudern.
Durch die Tür zu Lady St. Clairs Gemächern waren deutlich Gitarrenklänge und ein dunkler kehliger Gesang in einer fremdartigen Sprache zu hören. Jeremy und Alan wechselten wissende Blicke.
»Breandán ist bei ihr«, bemerkte der Wundarzt. »Versteht Ihr, was er singt?«
»Nun, ich habe erst ein paar Lektionen Gälisch bei ihm gelernt, aber ich glaube, das Lied handelt von Liebe und Eifersucht.«
Alan, der bereits die Hand gehoben hatte, um an der Tür zu kratzen, zögerte. »Breandán weiß, dass ich Armande abholen komme. Glaubt Ihr, er trägt mir noch nach, dass Amoret und ich uns während seiner Abwesenheit damals nähergekommen sind?«
Jeremy schüttelte den Kopf. »Ich denke nicht. Er hat Euch doch mit gezogenem Degen beschützt, als Ihr auf der Straße bedroht wurdet. Es mag ihm nicht leichtfallen, zu vergeben, aber er und Amoret sind glücklich miteinander. Er hat keinen Grund, Euch etwas nachzutragen.«
Eine junge Frau mit kastanienbraunem Haar und dunklen Augen öffnete auf Alans Kratzen hin die Tür.
»Einen gesegneten Tag wünsche ich Euch, Mademoiselle«, grüßte Jeremy die Zofe. Armande knickste, bevor sie die beiden Männer eintreten ließ.