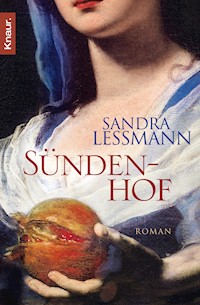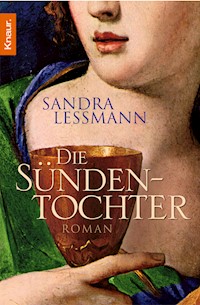9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tod lauert in den dunklen Gassen Londons … 1666: Sir Orlando ist auf dem Heimweg durch das bitterkalte London, als ein Schrei die Stille der Nacht zerreißt. Hilflos muss er mit ansehen, wie eine Hebamme von einer verhüllten Gestalt ermordet wird – nur ihre Tochter kann Orlando in letzter Sekunde retten. Fest entschlossen, dass diese Tat gesühnt werden muss, betraut Orlando seinen Freund Pater Jeremy mit der Aufklärung des Falls. Jeremy ist bald überzeugt, dass das Mädchen etwas über den Tod ihrer Mutter weiß – doch sie schweigt eisern. Als kurz darauf in der Stadt ein verheerender Brand ausbricht, scheint die Aufklärung des Verbrechens nahezu unmöglich zu werden … Der zweite Roman in der Spannungsreihe um PATER JEREMY, in der jeder Band unabhängig gelesen werden kann, ist bereits unter dem Titel »Die Sündentochter« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
1666: Sir Orlando ist auf dem Heimweg durch das bitterkalte London, als ein Schrei die Stille der Nacht zerreißt. Hilflos muss er mit ansehen, wie eine Hebamme von einer verhüllten Gestalt ermordet wird – nur ihre Tochter kann Orlando in letzter Sekunde retten. Fest entschlossen, dass diese Tat gesühnt werden muss, betraut Orlando seinen Freund Pater Jeremy mit der Aufklärung des Falls. Jeremy ist bald überzeugt, dass das Mädchen etwas über den Tod ihrer Mutter weiß – doch sie schweigt eisern. Als kurz darauf in der Stadt ein verheerender Brand ausbricht, scheint die Aufklärung des Verbrechens nahezu unmöglich zu werden …
Über die Autorin:
Sandra Lessmann, geboren 1969, lebte nach ihrem Schulabschluss fünf Jahre in London. Zurück in Deutschland studierte sie in Düsseldorf Geschichte, Anglistik, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaften. Anschließend arbeitete sie am Institut für Geschichte der Medizin; ein Thema, dass sie ebenso wie ihre Englandliebe in ihre historischen Romane einfließen ließ.
Die Website der Autorin: www.sandra-lessmann.de
Bei dotbooks veröffentlichte Sandra Lessmann ihre historischen Romane »Die Spionin der Krone« und »Die Kurtisane des Teufels« sowie ihre historische Krimireihe rund um »Pater Jeremy«.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »Die Sündentochter« bei Knaur
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/A-R-T, Martina Bergsma, vandycan und einer Londonkarte von F. de Witt
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-351-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandra Lessmann
Die Tochter der Hebamme
Historischer Roman
dotbooks.
Erstes Kapitel
Dezember 1665
Alle Farbe war aus ihrem Gesicht gewichen. Nun, da es vorbei war, verließen sie schlagartig die Kräfte. Ihre Knie gaben nach, und sie glitt an der Wand des Schuppens zu Boden. Die eisige Kälte, die in die nackte Haut ihrer Schenkel biss, erreichte ebenso wenig ihr Bewusstsein wie der Schmerz, der ihren Körper durchbohrte. Wie gelähmt saß sie da, ohne sich zu rühren, ohne etwas zu fühlen…
Ein fernes Geräusch ließ sie zusammenfahren. Er kommt zurück! Ihr Herz begann wild zu schlagen. Mit fahrigen Händen raffte sie ihr Hemd über der Brust zusammen, um ihre Blöße zu bedecken, und zog hastig ihr Mieder zurecht. Sie wollte aufspringen und weglaufen, doch ihre Beine bewegten sich nicht. Wie ein in die Enge getriebenes Tier presste sie sich in eine Ecke des Schuppens, den Blick wie gebannt auf die Tür gerichtet. Doch nichts geschah. Er kam nicht zurück. Er hatte bekommen, was er wollte. Aber morgen oder übermorgen würde er ihr wieder auflauern… und er würde es wieder und wieder tun!
Allmählich begann sie die Kälte zu spüren, die aus der Erde in ihre Haut drang. Sie versuchte, die verrutschten Wollstrümpfe über ihre Knie zu ziehen und die Strumpfbänder zu befestigen, doch ihre klammen Finger waren wie Fremdkörper an ihren Händen und wollten ihr nicht gehorchen.
»Anne! Anne!« Es war die Stimme ihrer Mutter. »Anne, wo bist du?«
Die Tür des Schuppens öffnete sich knarrend. »Anne, warum antwortest du nicht?«, fragte ihre Mutter und trat mit besorgter Miene zu ihr. Das Gesicht ihrer Tochter sagte mehr als alle Worte. »Was ist passiert? Hat er dich wieder angefasst? Hat er…?«
Da brach sich der Schrecken des Mädchens endlich in einem tiefen Schluchzen und einer Flut von Tränen Bahn. Ihre Mutter nahm sie in die Arme, presste sie an sich und versuchte, sie zu beruhigen. Immer wieder strich ihre Hand zärtlich über den Kopf ihrer Tochter.
»Ich werde ihn zur Rede stellen!«, versprach sie. »Ich werde dafür sorgen, dass er dich in Ruhe lässt. Er wird es nie wieder wagen, dich anzurühren!«
Der Schleier des Todes, der so lange über der Stadt London gelegen hatte, begann sich endlich zu lüften. Den ganzen Sommer über hatte die Pest verheerend gewütet, hatte Tausende und Abertausende unerbittlich hinweggerafft, bis sie nun mit Eintritt des Winters allmählich ihren Würgegriff lockerte. Innerhalb weniger Wochen erwachte die Geisterstadt zu neuem Leben. Viele der Bürger, die bei Ausbruch der Seuche in Panik aufs Land geflohen waren, kehrten zurück, begierig, ihre Geschäfte wieder aufzunehmen und nach ihrem Besitz zu sehen, den sie zurückgelassen hatten. Die Läden der Handwerker und Kaufleute öffneten ihre Türen, die ausgestorbenen Straßen, auf denen das Gras zwischen den Pflastersteinen gesprossen war, belebten sich neu. Die Menschen wichen einander nicht mehr aus Angst vor Ansteckung aus, sondern grüßten sich, wenn sie sich begegneten, blieben stehen und plauderten fröhlich miteinander.
Der starke Schneefall, der im Februar einsetzte, bedeckte schließlich auch die Gräber der Toten auf den Kirchhöfen und entzog sie so den Blicken der Lebenden, die die schreckliche Heimsuchung vergessen und ihr Leben neu ordnen wollten. Man wagte wieder, in die Zukunft zu sehen und auf die Gnade Gottes zu hoffen.
Zwei Gestalten in wollenen Umhängen eilten durch die weißen Schleier herabfallender Schneeflocken. Ein kleiner Junge, der eine Fackel trug, ging ihnen voraus, um ihnen zu leuchten, denn es war bereits später Abend. Wohl dem, der bei diesem ungemütlichen Wetter in seinen schützenden vier Wänden vor der wärmenden Feuerstelle saß und keinen Fuß vor die Tür zu setzen brauchte. Doch Margaret Laxton konnte sich als Hebamme einen derartigen Luxus nicht leisten. Wenn man sie rief, musste sie zur Stelle sein, egal, zu welcher Tageszeit, ob bei Regen oder Schnee. Kinder richteten sich nun einmal nach keiner Uhr, sie bestimmten selbst den Zeitpunkt, zu dem sie zur Welt kommen wollten. Margaret Laxton verlangsamte ihre Schritte und blickte sich besorgt nach ihrer Tochter Anne um, die immer wieder zurückfiel. Anne war zugleich ihr Lehrmädchen und erlernte bei ihr das Handwerk der Hebamme.
»Komm, mein Kind«, rief Margaret Laxton ihr zu. »Wir dürfen den Burschen nicht aus den Augen verlieren. Dieser Lümmel hat offenbar die Absicht, uns durch halb Smithfield zu hetzen.«
Unter der Kapuze des Wollumhangs richteten sich Annes gerötete Augen mit einem gequälten Ausdruck auf sie.
»Es wird alles gut«, sagte ihre Mutter tröstend. »Vertrau mir. Eins meiner Rezepte bringt alles wieder ins Lot. Nur ein bisschen Geduld, dann ist es vorbei. Und Vater wird nichts merken.«
Sie nahm die Hand ihrer Tochter und setzte sich wieder in Bewegung. Am Pie Corner wartete der Fackelträger und mahnte sie ungeduldig zur Eile.
»Wie weit ist es denn noch, Junge?«, fragte Margaret Laxton.
»Nur noch rechts in die Cock Lane, dann sind wir da«, erklärte er und lief ihnen wieder voraus. Die Schneeflocken fielen so dicht, dass sie seine kleine schlanke Gestalt augenblicklich verschluckten. Nur das Licht seiner Pechfackel, das wie ein Leuchtkäfer in der Luft tanzte, war noch sichtbar. Die Hebamme versuchte zu ihm aufzuschließen und zog ihre Tochter energisch hinter sich her. Doch der Junge bewegte sich bedeutend leichtfüßiger über den gefrorenen Boden als die beiden Frauen, deren Rocksäume den Schnee aufwirbelten. Durch die schwere Tasche mit den Utensilien ihrer Zunft, die Margaret Laxton über der Schulter trug, wurde es für sie noch beschwerlicher, mit dem Knaben mitzuhalten, der flink wie ein Wiesel in die Cock Lane einbog. Der Leuchtkäfer verschwand aus dem Blickfeld der Frauen. Wieder trieb die Hebamme ihre Tochter zur Eile an.
Als sie die Ecke erreichten, verlangsamte Margaret Laxton verdutzt ihre Schritte und versuchte, das Schneegestöber mit den Augen zu durchdringen. Wo war der Bengel geblieben?
»He, Bursche, wo bist du?«, rief sie, und als keine Antwort kam, begann sie, Anne an der Hand, zu laufen, um ihren Führer einzuholen. In ihrer Hast übersah sie einen Misthaufen, den einer der Hühner haltenden Anwohner in der schmalen Gasse aufgeschüttet hatte. Sie geriet ins Stolpern und wäre beinahe gefallen. Es gelang ihr gerade noch, sich zu fangen. Keuchend blieb sie stehen und sah sich erneut verwirrt um. Dabei fiel ihr Blick auf das Ende eines Stocks, der aus dem Unrathaufen herausragte. Sie zog ihn heraus und berührte mit der Hand vorsichtig das andere Ende. Es war warm und klebrig und roch stark nach verbranntem Pech.
»Was hat das zu bedeuten?«, murmelte sie verständnislos. Warum hatte der Junge seine Fackel gelöscht? Und wohin war er verschwunden?
»Mum, was ist denn?«, fragte Anne beunruhigt.
»Ich weiß es nicht, mein Liebes. Ich weiß es nicht…«
Irgendwo schnaubte ein Pferd. Margaret Laxton wandte den Kopf und spitzte die Ohren, um festzustellen, aus welcher Richtung der Laut kam.
»Ich glaube, da ist jemand hinter uns«, sagte sie leise und zog ihre Tochter mit sich fort. »Gehen wir weiter. Das Ganze ist mir nicht geheuer.«
Anne folgte ihr stumm, während die Hebamme sich immer wieder umdrehte und zurückblickte. Und mit einem Mal sah sie etwas: Eine dunkle Gestalt trat aus der Finsternis der Häuserreihe in die Gasse hinein, ein Mann in einem Umhang mit einem tief ins Gesicht gezogenen Hut. Sein Anblick war so unheimlich, dass Margaret Laxton innehielt und wie gebannt zu ihm hinüberstarrte.
»Der Teufel…«, hauchte sie.
Die Gestalt bewegte sich, ein Arm verschwand unter dem Umhang und wurde kurz darauf wieder sichtbar, streckte sich ihnen entgegen… ein Funke blitzte auf, ein lauter Knall ertönte… Margaret Laxton brach zusammen, zu überrascht, um einen Laut von sich zu geben. Sie war tot, bevor ihr Körper auf dem Boden aufschlug…
Als sie fiel, löste sich ihre Hand aus der ihrer Tochter. Anne starrte ungläubig auf ihre Mutter hinab, die sich nicht mehr rührte. Sie wirbelte entsetzt herum, ihr Blick richtete sich auf die erschreckende Gestalt, registrierte noch einmal dieselbe Bewegung des Arms, der unter dem Umhang verschwand und nach etwas tastete… nach einer zweiten Waffe, wie sie instinktiv begriff…
Schreiend warf sich Anne herum und begann zu laufen, rannte, was ihre Beine hergaben, blind und ziellos. Immer wieder glitt sie auf der gefrorenen Erde aus, raffte sich verzweifelt auf und rannte weiter. Sie konnte nicht aufhören zu schreien, erst als ihr vor Erschöpfung und Angst die Luft wegblieb, versagte ihr die Stimme.
Sir Orlando Trelawney bewegte sich auf Freiersfüßen. Anderthalb Jahre war es nun her, dass des Richters erste Frau Elizabeth bei einer Fehlgeburt gestorben war. Fünfzehn Jahre lang hatte sie Freud und Leid mit ihm geteilt und mit derselben Inbrunst wie er darum gebetet, dass wenigstens eines ihrer schwächlichen Kinder das Säuglingsalter überleben möge. Aber Gott hatte anders entschieden. Eines nach dem anderen hatte er die winzigen, zerbrechlichen Wesen zu sich geholt, die Elizabeth alle zwei Jahre zur Welt brachte. Die ständigen Schwangerschaften und die anstrengenden Geburten hatten die zierliche Frau allmählich ausgezehrt. Doch sie hatte sich niemals beklagt. Das letzte Kind, das in ihr herangewachsen war, hatte sie schließlich das Leben gekostet. Und Sir Orlando verlor nicht nur eine liebende und geduldige Gefährtin, mit ihr starb auch die Hoffnung auf ein Kind von seinem Fleisch und Blut, die Erfüllung seines sehnlichsten Wunsches.
Die Zeit der Witwerschaft war Trelawney unerträglich geworden. Allein in seinem großen Haus in der Chancery Lane, nur von Dienstboten umgeben, empfand er die Einsamkeit wie eine göttliche Strafe. Der Wunsch, ihr zu entkommen, hatte ihn das Erlöschen der Pest und die Rückkehr der bürgerlichen Familien in die Stadt mit steigender Ungeduld erwarten lassen. Es dauerte nicht lange, bis sich herumsprach, dass einer der Richter des Königlichen Gerichtshofs auf Brautschau war. Und da er überdies für einen Mann in seiner Position relativ jung war – er hatte vor wenigen Monaten sein dreiundvierzigstes Jahr vollendet –, durfte er hoffen, eine Gemahlin zu finden, die ihren ehelichen Pflichten nicht mit Widerwillen nachkommen würde. Bald konnte sich Sir Orlando vor Einladungen zum Mittagsmahl bei den besten Familien Londons kaum mehr retten. Einige nahm er an, andere lehnte er taktvoll ab. Schließlich ließ er einem reichen Landbesitzer namens George Draper gegenüber ein vorsichtiges Interesse an dessen Tochter Sarah durchblicken. Der Vater war ein flammender Royalist und hatte wie Trelawney im Bürgerkrieg auf der Seite des Königs gegen die Parlamentarier unter Oliver Cromwell gekämpft. Nach der Hinrichtung des Königs Charles I. hatte Draper während des Commonwealth einige seiner Ländereien durch Requirierung an Cromwells Anhänger verloren und sie auch nach der Thronbesteigung des neuen Königs Charles II. vor fünf Jahren nicht zurückerhalten. Doch er war noch immer reich genug, um seine einzige Tochter mit einer ansehnlichen Mitgift auszustatten.
Auch wenn noch keine konkreten Verhandlungen aufgenommen worden waren, bestand inzwischen ein unausgesprochenes Einverständnis beider Parteien. Sir Orlando erhielt eine Einladung, zu Lichtmess das Wochenende auf dem Landsitz der Drapers in Essex nicht weit von London zu verbringen. Man vertrieb sich die düsteren Wintertage mit Schach, Billard und Cribbage, einem beliebten Kartenspiel. Abends wurde musiziert. Sarah Draper spielte Spinett und sang dazu, begleitet von ihrer jüngeren Base Jane Ryder, die eine herrliche Singstimme besaß. Trelawney genoss den Aufenthalt sehr, fühlte sich aber bedrängt durch die wachsende Ungeduld des Familienvaters, der zweifellos damit gerechnet hatte, dass sein Gast das Wochenende nutzen würde, um die Eheverhandlungen zu eröffnen. Doch Sir Orlando zögerte. Er wollte sicher sein, dass Sarah Draper die richtige Frau für ihn war, und noch war er davon nicht völlig überzeugt.
Während er nun an diesem Montagabend in seiner Kutsche vom Landsitz der Drapers nach London zurückfuhr, beschäftigten sich seine Gedanken unablässig mit seiner zukünftigen Braut. Die Unsicherheit, die ihn vor dem letzten Schritt zurückschrecken ließ, wollte nicht vergehen. Er verspürte das starke Bedürfnis, mit einem anderen über seine Zweifel zu reden und sich Rat zu holen, am besten bei jemandem, der sich mit Menschen auskannte, hinter ihre Fassade blickte und sie nüchtern und unvoreingenommen einschätzen konnte. Für diese Aufgabe kam nur sein Freund Dr. Fauconer in Frage. Ja, er würde ihn sobald wie möglich aufsuchen und mit ihm über die Angelegenheit sprechen.
Sir Orlandos Gedankengang wurde jäh unterbrochen, als sein Kutscher ohne Vorwarnung in die Zügel griff und die Pferde zum Stehen brachte. Der Richter wurde auf seiner Sitzbank durchgerüttelt und holte schon Luft, um dem Bediensteten gehörig den Kopf zu waschen, als die gellenden Schreie einer Frau an sein Ohr drangen. Sofort begriff er, weshalb der Kutscher angehalten hatte. Jemand war in Not.
Trelawney öffnete den Schlag und stieg aus. Dicke weiche Schneeflocken wehten unter seine Hutkrempe in sein Gesicht und blieben in seinen Wimpern hängen. Sein Kammerdiener Malory war von dem hinteren Fußbrett gesprungen, auf dem er mit einem Lakaien während der Fahrt gestanden hatte, und trat neben den Richter. Ein zweiter Lakai, der der Kutsche mit einer Fackel vorangegangen war, eilte herbei, um ihnen zu leuchten.
»Wer hat geschrien?«, fragte Sir Orlando. »Hast du etwas gesehen, Malory?«
Der Kammerdiener ließ suchend den Blick schweifen. Dann hob er plötzlich den Arm und deutete in eine Seitenstraße.
»Dort, Sir!«
Trelawney folgte seinem ausgestreckten Finger und blinzelte, um seine Wimpern vom Schnee zu befreien. Da sah er sie auch: eine junge Frau, die durch den weißen Vorhang stürzte und schreiend in ihre Richtung stolperte, als werde sie von Dämonen verfolgt.
Ohne zu zögern lief Malory ihr entgegen. In diesem Moment tauchte hinter ihr eine zweite Gestalt auf, ein Mann in einem schwarzen Umhang, dessen Gesicht ein breitkrempiger Hut verbarg.
Trelawneys Hand schnellte an seine Seite und schloss sich um den Griff seines Degens. »Malory!«, schrie er warnend. »Komm zurück!«
Doch der Diener gehorchte nicht, sondern beschleunigte seine Schritte, soweit ihm dies auf dem hart gefrorenen Untergrund möglich war. Als er sie fast erreicht hatte, stolperte die junge Frau und fiel auf die Knie. Ihr Verfolger hob seine Pistole und legte auf sie an.
»Nein! Nein!«, schrie Malory, ohne anzuhalten.
Der Fremde zögerte, die Mündung seiner Waffe zielte noch immer auf das Mädchen, doch als er sah, dass der Diener direkt auf ihn zukam, richtete er die Pistole auf ihn und drückte kaltblütig ab. Der Schuss dröhnte in Malorys Ohren. Im nächsten Moment spürte er, wie ihm die Beine weggerissen wurden. Mit einem Aufschrei ging er zu Boden. Der Fremde wandte sich um und verschwand wie ein Geist in der Nacht.
Den Lakaien mit der Fackel an seiner Seite, näherte sich Sir Orlando mit gezücktem Degen seinem Diener, der sich, vor Schmerzen schreiend, am Boden wand. Als Trelawney sah, dass der Schütze fort war, steckte er den Degen weg und beugte sich über Malory, während sein Lakai das schluchzende Mädchen zu beruhigen versuchte.
Malorys Hände hatten sich um seinen linken Schenkel gekrampft, oberhalb des Knies, von dem das Blut über seine weißen Strümpfe rann und den frischen Schnee unter ihm rot färbte. Es war unmöglich, zu sagen, wie schwer er verletzt war, doch wie es schien, hatte die Kugel ihm das Knie zerschmettert. Malorys Schmerzensschreie gingen in ein gequältes Wimmern über. Sein Magen drehte sich um, er wandte den Kopf zur Seite und erbrach sich.
Trelawneys Hand drückte besänftigend seine Schulter. »Schon gut, mein Junge. Ich bringe dich so schnell wie möglich zu einem Wundarzt.«
Da Sir Orlando nichts anderes zur Hand hatte, nahm er seinen Spitzenkragen ab und wickelte ihn um das verletzte Knie seines Dieners, um die Blutung zu stillen. Malory stöhnte vor Schmerzen und biss knirschend die Zähne zusammen.
»Mädchen, was wollte dieser Kerl von dir?«, fragte der Richter schließlich die junge Frau, die ihn verschreckt ansah.
»Er hat meine Mutter getötet«, presste sie mühsam hervor, und diese wenigen Worte schienen bereits eine ungeheuerliche Kraftanstrengung für sie zu bedeuten.
»Wo ist das passiert?«
Anne Laxton hob nur stumm die Hand und zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»Jack, gib mir die Fackel und bleib bei Malory und dem Mädchen«, befahl Trelawney, zog seinen Degen und ging mit angespannten Sinnen die schmale dunkle Gasse entlang. Nach etwa fünfzig Yards entdeckte er vor sich einen kleinen Hügel von der Größe eines menschlichen Körpers. Der dichte Pulverschnee hatte die Frau bereits mit einem weißen Leichentuch zugedeckt. Als Sir Orlando sich über sie beugte und nach einem Herzschlag tastete, versanken seine Finger in einem warmen klebrigen Loch. Die Kugel musste direkt ins Herz gedrungen sein. Hier war nichts mehr zu machen.
Eilig kehrte der Richter zu seinen Dienern und dem Mädchen zurück. »Bring sie zur Kutsche«, befahl er Jack. Dem zweiten Lakaien, Tom, gab er die Anweisung, ihm mit Malory zu helfen. Gemeinsam knieten sie sich neben den Verletzten. Malory war seit vielen Jahren in Trelawneys Diensten und ihm stets treu ergeben gewesen. Es war tragisch, dass er durch eine freilich tollkühne und selbstlose, aber leichtsinnige Tat zum Krüppel wurde. Der junge Mann schien sich seines traurigen Schicksals bewusst zu sein, denn seine tränenerfüllten Augen richteten sich mit einem verzweifelten Ausdruck auf Sir Orlando.
»Mein Bein…«, stammelte er. »Ich will mein Bein nicht verlieren… bitte, lasst nicht zu, dass sie mir das Bein abschneiden…«
Trelawney verspürte aufrichtiges Mitleid für ihn, wusste aber nicht, wie er ihn trösten sollte. »Egal, was passiert, du wirst immer einen Platz in meinem Haus haben«, erklärte er unbeholfen. Er meinte, was er sagte. Malory hatte sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Er hatte seinen Herrn hingebungsvoll gepflegt, als dieser krank gewesen war, und er hatte mit einer Waffe neben seinem Bett geschlafen, um ihn zu beschützen, als Trelawney bedroht wurde. Ein treuer Diener war eine Seltenheit und verdiente Pflege und Obdach, auch wenn er nicht mehr in der Lage war, seine Arbeit zu tun.
Behutsam hoben Sir Orlando und Tom den Verwundeten hoch und trugen ihn zur Kutsche. Als sie seine Beine beugen mussten, um ihn durch die schmale Tür ins Innere zu befördern, hörten sie ein knöchernes Knacken. Malory schrie gequält auf. Und als er endlich auf der hinteren Bank saß, war sein Gesicht kalkweiß und seine Hände zitterten wie Espenlaub.
Sir Orlando wandte sich an seinen Kutscher: »Wo sind wir hier?«
»Am Holborn-Brunnen, Mylord.«
»Gut, fahr zum Newgate und von dort weiter in die Paternoster Row zur Chirurgenstube von Meister Ridgeway.«
Zweites Kapitel
Die Fahrt über die unebenen Fahrrinnen der gefrorenen Straßen wurde für den Verletzten zu einer grausamen Tortur. Tränen liefen ihm über die Wangen, und er schluchzte unaufhörlich. Trelawney sprach beruhigend auf ihn ein, obwohl er wusste, dass nichts von dem, was er sagte, Malorys Schmerzen zu lindern vermochte. Das Mädchen, das sich auf der vorderen Sitzbank zusammengekauert hatte, gab keinen Ton von sich.
Das Newgate war zugleich ein Gefängnis und eines der sieben Stadttore, durch die man in den alten Londoner Stadtkern gelangte. Zu dieser späten Stunde waren die Pforten des gewaltigen Torhauses jedoch bereits verschlossen. Der Lakai, der mit der Fackel vorausging, brauchte eine Weile, bis er einen der Wächter dazu bewegen konnte, die gemütliche Wachstube zu verlassen und sich in das unwirtliche Wetter hinauszuwagen. Doch als dieser die Kutsche des Richters erkannte, änderte sich seine Haltung.
»Ich habe ein Verbrechen zu melden«, berichtete Trelawney. »Geht zum Konstabler von Farringdon Without, der für Smithfield zuständig ist, und sagt ihm, dass es in der Cock Lane einen Mord gegeben hat. Eine Frau wurde erschossen. Er soll sich sofort dorthin begeben und auf mich warten. Ich komme so bald wie möglich zu ihm.«
»Jawohl, Mylord«, antwortete der Torwächter gehorsam, obgleich es ihm ganz und gar nicht behagte, in diesem Schneetreiben einen Botengang zu erledigen, ebenso wenig wie der Konstabler des Bezirks sehr erbaut sein würde, in dieser Höllennacht aus dem Haus beordert zu werden und neben einer Leiche Wache halten zu müssen.
Des Richters Kutsche setzte sich wieder in Bewegung und passierte den Torbogen. Malorys Martyrium nahm seinen Fortgang, während das schlecht gefederte Gefährt die Warwick Lane entlangrumpelte, in die Paternoster Row einbog und endlich vor der Chirurgenstube zum Stehen kam. Jack hämmerte sogleich mit aller Kraft an die Tür. Obwohl die Fensterläden bereits geschlossen waren und es still im Haus war, dauerte es nicht lange, bis die Tür geöffnet wurde und ein junger Bursche die Ankömmlinge begrüßte.
»Wir haben einen Verletzten, der sofort behandelt werden muss«, erklärte der Lakai atemlos.
Der Bursche nickte und rief lautstark ins Innere des Ladens: »Meister, kommt schnell!«
Kurz darauf hastete Alan Ridgeway, Meister der Barbier- und Chirurgengilde, die Stiege aus dem ersten Stock herunter und folgte dem Lakaien ohne Zögern in die Winternacht hinaus zur Kutsche des Richters.
»Mylord, Ihr seid es«, rief Alan aus, als der Schlag geöffnet wurde und er Trelawney erkannte. Als sein Blick auf den Kammerdiener fiel, der noch immer vor Schmerzen wimmerte, sog er betroffen die Luft ein.
Mit Hilfe seines Gesellen Nicholas hob er den Verwundeten behutsam aus der Kutsche und trug ihn ins Haus. In der chirurgischen Offizin, die den vorderen Bereich des Erdgeschosses einnahm, legten sie ihn auf einen mächtigen hölzernen Operationstisch, der in der Mitte des dunkel getäfelten Raumes stand. An der Rückwand befand sich ein Eichenschrank mit vielen kleinen Schubladen, in denen Kräuter und andere Arzneimittel aufbewahrt wurden. In einem Regal auf der anderen Seite waren bauchige Salbentiegel und Flaschen aufgestellt.
Während der Geselle geschäftig mehrere Öllampen entzündete, deren Licht sich in den unter der Decke hängenden Aderlassbecken spiegelte, entfernte Alan Ridgeway den blutgetränkten Spitzenkragen von Malorys verletztem Knie und begann dann, vorsichtig die Kniehose mit einer Schere aufzuschneiden.
Sir Orlando, der ihnen ins Haus gefolgt war, klopfte seine Kleider vom Schnee frei, warf seinen Hut auf einen Schemel und rückte seine blonde Perücke zurecht. Aufmerksam beobachtete er Meister Ridgeway bei der Arbeit. Der Richter kannte ihn seit Jahren und schätzte ihn als geschickten und fingerfertigen Wundarzt. Alan war ein hoch gewachsener, schlanker Mann von Ende dreißig, mit langen Armen und Beinen, die ihm etwas Schlaksiges gaben. Sein Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel, war pechschwarz und begann nur an den Schläfen leicht zu ergrauen. Seine graublauen Augen verloren nur selten ihren typischen schelmischen Ausdruck, und das Lächeln seines beweglichen Mundes war so breit, dass es wahrlich von Ohr zu Ohr reichte und sogar auf den griesgrämigsten Menschen ansteckend wirkte. Seine schmale gerade Nase schließlich bog sich an der Spitze ganz leicht nach oben, als habe sie sich im letzten Moment entschlossen, die Richtung zu ändern. Sir Orlando mochte den Wundarzt nicht allein deshalb, weil er seine Kunst so vorzüglich beherrschte, sondern auch, weil er anständig, hilfsbereit und mitfühlend war. Man konnte sich in der Not stets auf ihn verlassen. Dass er einer anderen Religion, dem römisch-katholischen Glauben, angehörte, machte für den protestantischen Richter keinen Unterschied. Er hatte gelernt, einen Menschen nach seinen Tugenden zu beurteilen, nicht nach der Religion, zu der er sich bekannte.
Meister Ridgeway hatte inzwischen den zerschossenen Stoff der Kniehose entfernt und Malorys verletztes Bein bis zum Schenkel entblößt. Da noch immer Blut aus der Wunde floss, band er es oberhalb des Knies ab. Dann wandte er sich zu seinem Gesellen, der ihm eine mit Branntwein gefüllte Schüssel entgegenhielt, und wusch sich die Hände darin. Nachdem Nicholas die Schüssel weggestellt hatte, machte er sich mit Hilfe des Lehrjungen daran, das chirurgische Besteck zurechtzulegen, das sein Meister bei der Operation benötigen würde.
Als Malorys Blick auf die verschiedenen Messer, Zangen, Bohrer, Lanzetten, Sonden, Brenneisen und vor allem die Knochensäge fiel, stöhnte er laut auf. Seine Hand tastete zitternd nach Alans Wams, und seine Finger vergruben sich krampfhaft in seinem Schoßzipfel.
»Bitte nicht…«, flehte er. »Nehmt mir nicht das Bein ab… bitte… ich will mein Bein nicht verlieren… ich will nicht zum Krüppel werden… lieber würde ich sterben.«
Alan lächelte ihm beruhigend zu. »Ganz ruhig, mein Freund. Lass mich erst einmal sehen, wie schlimm es ist.«
Er wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen, dem Verletzten aber auch keine unberechtigten Hoffnungen machen. Während des Bürgerkriegs hatte Alan als Feldscher gearbeitet und damals auf dem Schlachtfeld leider nur zu oft gesehen, welche Zerstörungen die leicht verformbaren Bleikugeln anrichteten, wenn sie in den menschlichen Körper eindrangen. Wenn zu viel an Muskeln und Sehnen zerrissen oder gequetscht war oder Knochen zerschmettert worden waren, blieb meist nichts anderes übrig, als das betroffene Glied zu amputieren, um den Patienten vor einem qualvollen Tod durch Wundbrand zu bewahren.
Auch Sir Orlando hatte nach mancher Schlacht mit ansehen müssen, wie tapfere Soldaten unter dem Messer des Feldschers Arme und Beine verloren. Und obwohl er Meister Ridgeways Kunstfertigkeit nicht bezweifelte, wäre ihm wohler gewesen, Malory in den Händen des besten Arztes zu wissen, den er kannte.
»Wo ist Dr. Fauconer?«, fragte er. »Ist er nicht da?«
»Ich bin hier, Mylord«, antwortete ihm eine ruhige Stimme von der Treppe her.
Trelawney wandte sich um und begrüßte den hageren Mann, der sich ihnen näherte, mit einem erleichterten Lächeln. Er war in ein schwarzes Wams, schwarze Kniehosen und Wollstrümpfe in derselben Farbe gekleidet. Um seinen Hals lag ein einfacher weißer Leinenkragen ohne jegliche Verzierung. Seine Füße steckten in schwarzen, mit schmucklosen Metallspangen versehenen Lederschuhen. Auch er trug sein dichtes dunkelbraunes Haar bis auf die Schultern. Sein Gesicht war lang und schmal, mit einer hohen Stirn, einer knochigen, spitz vorspringenden Nase und eingefallenen Wangen. Er war im selben Alter wie Alan Ridgeway, wirkte aber älter, da sich bereits einige kleine Fältchen um seine Augen zogen und in seine Stirn kerbten. Das Auffälligste an ihm waren zweifellos seine hellen grauen Augen: Ihr Blick war scharf und ging unter die Haut wie der eines Falken.
Dr. Fauconers Auftauchen übte sogleich eine entspannende Wirkung auf Sir Orlando aus. Der Richter konnte es sich selbst manchmal nicht erklären. Sicher, er verdankte diesem eher ernsten, schweigsamen Mann viel. Er hatte Trelawney in seiner schwersten Stunde den Lebensmut zurückgegeben, als dieser sich bereits dem Tode ausgeliefert sah. Ohne ihn wäre er heute nicht mehr am Leben. Sir Orlando würde ihn, ohne zu zögern, als seinen besten Freund bezeichnen, dem er uneingeschränkt vertraute – obwohl er nicht einmal seinen richtigen Namen kannte. Trelawney hatte zuweilen gehört, wie Alan Ridgeway seinen Freund mit »Jeremy« ansprach, und er vermutete, dass er tatsächlich auf diesen Namen getauft worden war, aber sein Familienname war ihm unbekannt. Er hatte auch nie danach gefragt, aus Respekt vor seinem Freund, der den Decknamen Fauconer führte, um seine Familie vor Repressalien zu schützen, denn er hielt sich entgegen der herrschenden Gesetze in England auf und lebte streng genommen ständig im Schatten des Schafotts. Er war römischer Priester und Jesuit, und wirkte im Geheimen als Missionar unter den englischen Katholiken, die in dem protestantischen Königreich eine unterdrückte Minderheit darstellten. Die Ausübung ihres Glaubens stand unter Strafe, und die Priester, die aus den katholischen Ländern des Kontinents nach England geschmuggelt wurden, waren dem Gesetz nach allein durch ihre Anwesenheit des Hochverrats schuldig. Seit der Thronbesteigung Charles’ II. wurden die Strafgesetze gegen die Katholiken zwar nicht mehr angewendet, blieben jedoch weiterhin in Kraft. Der Einfluss des Königs, der Glaubensfreiheit anstrebte, schützte sie, wenn auch sehr zum Unwillen des protestantischen Parlaments. Auch wenn Sir Orlando Trelawney die Vorurteile der Anglikaner gegenüber dem römischen Glauben teilte und wie die meisten Engländer die Jesuiten für machthungrige Verschwörer hielt, betrachtete er doch seinen Freund als rühmliche Ausnahme. Es war Dr. Fauconer gelungen, sich die Tugenden eines ehrlichen, bescheidenen Mannes zu bewahren, der den Menschen Liebe und Mitgefühl entgegenbrachte. Damals, als sie sich kennen lernten, hatte Fauconer ihm freimütig gestanden, dass er Priester war, nur weil Trelawney sich ihm anvertraut hatte und er ihn nicht hatte belügen wollen, obwohl der Richter ihn aufgrund dieses Geständnisses aufs Schafott hätte bringen können. Darüber hinaus hatte er nie versucht, Sir Orlando zu bekehren. Auf diese Weise waren die beiden so verschiedenen Männer Freunde geworden: Der protestantische Richter und der Jesuit, die aufgrund der äußeren Umstände, die ihrer beider Dasein bestimmten, Feinde hätten sein müssen.
Der Priester trat an den Operationstisch und sah auf den stöhnenden Malory hinab.
»Was ist passiert?«
»Ein Straßenräuber hat ihm das Knie zerschossen«, berichtete Sir Orlando. »Der Kerl hatte bereits eine Frau ermordet und wollte gerade auch noch dieses arme Mädchen töten, als Malory dazwischenging.«
Trelawney machte eine Kopfbewegung in Richtung des Mädchens, das Jack inzwischen ins Haus gebracht und auf eine Holzbank gesetzt hatte. Alan Ridgeway legte erstaunt die Stirn in Falten. »Ich kenne sie. Ihr Name ist Anne Laxton. Ihr Vater ist Meister der Chirurgengilde. Ihre Mutter ist Hebamme.«
»Sie sagte, die Frau, die erschossen wurde, sei ihre Mutter gewesen. Eine Kugel traf sie genau ins Herz«, fügte der Richter hinzu.
»Bei Christi Blut, das ist schrecklich«, murmelte Alan voller Mitleid und machte seinem Lehrknaben Christopher ein Zeichen. »Kit, hol Molly und sag ihr, sie soll einen Teller Suppe warm machen und dem Mädchen bringen.«
Dann wandte sich Alan mit ernster Miene an seinen Freund. »Jeremy, ich glaube, Seine Lordschaft wünscht, dass Ihr mir bei Malorys Behandlung zur Hand geht.«
Der Angesprochene nickte verständnisvoll und trat an die Seite des Wundarztes. Dieser fühlte sich durch das Anliegen des Richters nicht beleidigt. Auch Alan erkannte ohne Neid an, dass Jeremy ein begnadeter Arzt war. Dieser hatte wie sein Freund als Feldscher begonnen. Während des Bürgerkriegs hatten sie sich kennen gelernt und einige Zeit zusammen auf den Schlachtfeldern die Verwundeten versorgt. Später war Jeremy, dem das Dasein als Handwerkschirurg nicht genügte, nach Italien gegangen und hatte Medizin studiert. Aber auch die Arbeit als gelehrter Medikus hatte ihn nicht befriedigt, und so war er stattdessen Priester geworden, um auch denen beistehen zu können, die sein beschränktes medizinisches Wissen nicht vor dem Tod bewahren konnte. Sein Interesse an der Heilkunst war jedoch nie erloschen, und sein Bedürfnis zu helfen machte es ihm schwer, einen Kranken abzuweisen.
Jeremys geübter Blick erfasste sofort den Grund für den Ausdruck der Panik, der in Malorys Gesicht stand. Beruhigend legte er dem Verletzten die Hand auf die Stirn und ließ sie dann sanft über seine Augen gleiten. Malorys Zittern legte sich ein wenig.
»Alan, habt Ihr einen Schwamm vorbereitet?«, fragte Jeremy.
»Ja, aber er ist noch nicht lang genug eingeweicht.«
»Das lässt sich jetzt nicht ändern. Der arme Bursche hat genug gelitten.«
Alan reichte dem Priester ein mit Wasser gefülltes Becken und dieser nahm den Schwamm heraus, der darin lag. Ein seltsamer Geruch ging von ihm aus. Jeremy ließ das Wasser abtropfen und hielt den Schwamm unter Malorys Nase.
»Atme tief ein, mein Junge«, sagte er auffordernd, und als der Diener ihn ängstlich ansah, fügte er hinzu: »Vertrau mir. Bald wirst du keinen Schmerz mehr spüren.«
Jeremy ließ ihn ein paarmal die Dämpfe einatmen, die aus dem feuchten Schwamm aufstiegen, und beobachtete Malory dann aufmerksam. Nach einer Weile begann sich sein verkrampfter Körper zu entspannen, und sein schmerzverzerrtes Gesicht glättete sich. Seine Augen wurden glasig, seine Lider sanken herab, und sein angestrengtes Stöhnen verstummte.
»Wie habt Ihr das gemacht?«, fragte Sir Orlando entgeistert.
»Ich habe ihn die Dämpfe eines Spongia somnifera einatmen lassen, der zuvor mit einem Gemisch von Pflanzensäften der Mandragora, des Mohns und des Bilsenkrauts getränkt wurde«, erklärte Jeremy bereitwillig. »Man lässt ihn trocknen, bis man ihn braucht, und befeuchtet ihn dann wieder. Eigentlich soll der Schlafschwamm etwa eine Stunde einweichen, aber ich möchte mit der Operation lieber nicht länger warten.«
»Ich habe noch nie von diesen Schlafschwämmen gehört«, warf Trelawney erstaunt ein.
»Dennoch sind sie bereits seit Hunderten von Jahren im Gebrauch«, belehrte ihn Jeremy. »Schon in den Büchern Theoderichs von Bologna findet Ihr sie beschrieben.«
»Aber wenn es so einfach ist, einen Menschen zu betäuben und ihm so den Schmerz zu nehmen, warum operieren die meisten Wundärzte ihre Patienten dann, während sie wach sind, so dass sie vor Schmerzen halb wahnsinnig werden?«
»So einfach, wie es aussieht, ist es nicht. Die verwendeten Pflanzensäfte sind giftig und können in der falschen Dosierung tödlich wirken. Die meisten Chirurgen schrecken vor dem Risiko zurück. Sie nehmen lieber in Kauf, dass ein Patient an einem Übermaß an Schmerzen stirbt als an einer falsch angewendeten Droge. Dann ist es nicht ihre Schuld, wenn der Patient zu schwach ist, um die Qualen zu ertragen, die das Zerschneiden von Muskeln und Zersägen von Knochen verursachen. Ich bestreite nicht, dass tatsächlich die Gefahr besteht, den Patienten durch einen dieser Schwämme in einen Schlaf zu versetzen, aus dem er nicht mehr erwacht. Daher verwende ich einen solchen nur, wenn es absolut nötig ist, dass der Patient sich bei der Operation nicht bewegt. Und ich achte darauf, nicht zu viel von den Substanzen zu verwenden und eher zuzulassen, dass er nicht völlig betäubt ist. Ein Patient im Halbschlaf ist immer noch besser als einer, der vor Angst zittert. Außerdem muss man natürlich wissen, wie man einen Bewusstlosen wieder aufweckt, falls er zu lange schläft. Man hält ihm ein Tuch unter die Nase, das mit starkem Essig getränkt ist. Dann kann man ihm noch Wein oder Kaffee einflößen, wenn er sehr unter den Nachwirkungen der Droge leidet.«
Sir Orlando lächelte, wie so oft beeindruckt durch das Wissen seines gelehrten Freundes. »Ich bin froh, dass ich das Wohl meines geschätzten Dieners in Eure Hände legen kann.«
Alan Ridgeway hatte sich von seinem Gesellen eine Flasche Branntwein geben lassen und spülte die Wunde an Malorys Knie gründlich aus. Der Kammerdiener war inzwischen so benommen, dass er die Schmerzen der Prozedur zwar noch spürte, aber nur noch leicht zusammenzuckte.
Jeremy wählte ein schmales Messer aus dem vor ihm liegenden Besteck aus und säuberte die Wunde von zerschossenem Fleisch und Stofffasern, die von der eindringenden Kugel aus der Kniehose gerissen und nach innen gedrückt worden waren. Schließlich tastete er über Malorys Kniekehle, bis er eine zweite Wunde im Fleisch fühlte.
»Werdet Ihr ihm das Bein abnehmen müssen?«, fragte Trelawney.
»Nein, Euer Diener hatte Glück im Unglück. Die Kugel ist auf der Rückseite wieder ausgetreten«, erklärte der Priester befriedigt. »Sie hat keinen größeren Schaden angerichtet. Die Kniescheibe ist unversehrt und der Unterschenkelknochen scheint nicht gebrochen zu sein. Die Kugel hat lediglich an der Seite einige Splitter vom Knochen abgesprengt. Das Scheuern dieser spitzen Teile gegen das wunde Fleisch dürfte die Schmerzen verursacht haben.«
Jeremy überließ nun seinem Freund die weitere Behandlung der Wunde. »Die Entfernung der Splitter ist eine knifflige Feinarbeit. Und Meister Ridgeway hat entschieden geschicktere Finger als ich«, fügte er bescheiden hinzu.
Sir Orlando hatte sichtlich aufgeatmet. »Er wird also wieder laufen können?«
»Ich denke schon.«
»Welch ein Glück, dass der Schurke ein so schlechter Schütze war!«
»Oh, ich glaube, da irrt Ihr Euch, Mylord. Wenn ich mich recht erinnere, sagtet Ihr doch, der Unbekannte habe die Frau direkt ins Herz geschossen. Und da sollte es ihm nicht gelungen sein, Malory in die Brust oder den Bauch zu treffen, was ihn zweifellos getötet hätte? Nein, ich denke, er ist ein sehr guter Schütze. Er wollte Malory nicht umbringen, sondern nur aufhalten, um ungehindert fliehen zu können. Was uns zu der Frage bringt, weshalb er die Frau getötet hat.«
»Und das Mädchen töten wollte«, ergänzte Trelawney. »Er hatte auf sie angelegt, als Malory sich einmischte. Erst als er sah, dass Malory unmittelbar auf ihn zulief, hat er sein Ziel geändert.«
Jeremy warf einen nachdenklichen Blick auf die junge Frau, die schweigend die Suppe löffelte, die ihr die Magd gebracht hatte.
»Ich glaube, es wird Zeit, dass wir der Kleinen ein paar Fragen stellen.«
Als sich die beiden Männer näherten, hob das Mädchen den Kopf und sah sie mit großen blauen Augen an, in denen noch immer Furcht stand. Jeremy lächelte ihr freundlich zu.
»Mistress Laxton, ich bin Dr. Fauconer und dies ist Sir Orlando Trelawney, Richter des Königlichen Gerichtshofs. Wie fühlt Ihr Euch? Ich hoffe, Ihr seid nicht verletzt.«
Sie schüttelte stumm den Kopf.
»Die Frau, die getötet wurde, war Eure Mutter?«
Das Mädchen nickte.
»Könnt Ihr uns sagen, was passiert ist? Wer war der Mann, der auf Eure Mutter geschossen hat?«
Anne Laxton öffnete den Mund, um etwas zu sagen, brachte jedoch kein Wort heraus. Der Jesuit und der Richter warteten geduldig, bis sie sich einigermaßen gefangen hatte. »Ich weiß es nicht…«, stammelte sie. »Er tauchte plötzlich auf…«
»Hat er etwas gesagt?«
»Nein, er hat gleich geschossen, einfach so…«
»Hattet Ihr den Eindruck, dass Eure Mutter ihn erkannte?«, bohrte Jeremy weiter.
»Nein… sie sagte nur: der Teufel…«
»Der Teufel? Habt Ihr eine Ahnung, warum sie ihn so nannte?«
Wieder schüttelte das Mädchen den Kopf.
Jeremy setzte sich zu ihr auf die Bank. »Was habt Ihr bei diesem Wetter allein außer Haus getan? Hatte man nach Eurer Mutter geschickt?«
Doch mehr brachte er nicht aus ihr heraus. Annes Augen füllten sich mit Tränen, und sie begann zu schluchzen. Der Schrecken saß noch zu tief.
»Es hat keinen Zweck. Lassen wir sie«, entschied Jeremy seufzend.
Trelawney stimmte ihm zu. »Ich habe einen der Konstabler von Farringdon Without angewiesen, bei der Leiche zu wachen, bis ich zurückkehre.«
»Dann solltet Ihr den armen Mann nicht länger warten lassen.«
Sir Orlando zog verlegen die Augenbrauen zusammen. »Ich hatte eigentlich gehofft, dass Ihr mich begleiten würdet.«
»Um nach Spuren zu suchen, die das Schneetreiben inzwischen zweifellos vernichtet hat?«, spöttelte Jeremy. »Ihr beliebt zu scherzen, Mylord.«
»Nun, ich nahm an, dass dieser seltsame Überfall Euch interessieren würde«, verteidigte sich der Richter mit einem deutlichen Unterton der Enttäuschung.
»Freilich interessiert er mich«, erwiderte Jeremy lächelnd, der seinen Freund nur hatte necken wollen. »Sehen wir uns also den Ort des Verbrechens an. Vielleicht wird die Angelegenheit dann klarer.«
Jeremy stieg in seine Kammer hinauf, schlüpfte in kniehohe Stiefel und warf sich einen dicken, wollenen Umhang über. Schließlich zog er sich noch lederne Handschuhe an und stülpte sich einen hohen steifen Hut auf den Kopf.
»In der Aufmachung könnte man Euch für einen Quäker halten«, witzelte Trelawney, während er sich seinen eigenen federbesetzten Hut aufsetzte.
»Ihr schätzt die ›Gesellschaft der Freunde‹ wohl nicht sehr, Mylord.«
»Nein, die ›Freunde, wie sich diese Sektierer nennen, sind eine Plage und machen vor Gericht nur Ärger. Sie verstehen es vorzüglich, einem das Wort im Munde zu verdrehen, und halten sich nicht an die einfachsten Regeln des Anstands. Sie haben keinen Respekt vor der Obrigkeit. Sie weigern sich sogar, vor Gericht ihre Hüte abzunehmen, und erdreisten sich, jeden mit du anzureden.«
»Weil sie glauben, dass vor Gott alle Menschen gleich sind.«
»Das mag schon sein, doch was das irdische Leben betrifft, so sind sie es nicht. Anstandsregeln müssen gewahrt werden. Wo kämen wir sonst hin?«
Der Richter wandte sich zur Tür, und Jeremy folgte ihm mit einem nachsichtigen Lächeln auf den Lippen. Er wusste nur zu gut, dass Trelawney sich des Öfteren vor Gericht mit so genannten Dissenters, Anhängern protestantischer Sekten, die die Riten der anglikanischen Staatskirche kritisierten, herumschlagen musste. Diese unterstanden ähnlichen Strafgesetzen wie die Katholiken, wurden in den letzten Jahren jedoch schärfer verfolgt, da sie als Aufwiegler galten und deshalb eine Gefahr für den Frieden des Königreichs darstellten. Die Anhänger Cromwells, die Charles I. hingerichtet hatten, waren Dissenters gewesen. Doch auch unter den Sekten bestanden bedeutende Unterschiede in der Lehre. Die Quäker beispielsweise waren friedliche Leute, die jegliche Art von Gewalt ablehnten.
Der Schneefall ließ allmählich nach. Trelawneys Kutscher hatte sich mit den Lakaien beim Halten der Pferde abgewechselt, war aber trotzdem bis auf die Knochen durchgefroren und deshalb ganz und gar nicht erbaut, als der Richter ihn anwies, zur Cock Lane zurückzufahren.
»Merkwürdige Sache«, murmelte Sir Orlando. »Weshalb hat dieser Unbekannte eine wehrlose Frau erschossen?«
»Und dann noch so ganz ohne Vorwarnung, wenn man dem Mädchen glauben darf«, fügte Jeremy hinzu, der dem Richter in der Kutsche gegenübersaß.
»Ob er sie berauben wollte?«
»In dem Fall hätte es genügt, die Frauen mit der Waffe zu bedrohen. Außerdem begibt sich kein gescheiter Straßenräuber bei diesem Wetter auf Beutezug. Er müsste damit rechnen, sich stundenlang die Beine in den Bauch zu stehen, bevor ihm ein geeignetes Opfer über den Weg läuft. Ich fürchte, hinter diesem Überfall steckt mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Mädchen uns tatsächlich alles gesagt hat, was es weiß.«
Die Kutsche durchquerte das Newgate und hielt einige Zeit später in der Cock Lane an der Stelle, an der Margaret Laxton zu Tode gekommen war.
In einen Hauseingang gezwängt warteten zwei Männer mit zutiefst griesgrämigen Mienen, die den Richter und seinen Begleiter mit gezwungener Höflichkeit begrüßten. Der Konstabler trug eine Perücke und einen breitkrempigen Hut. Sein wollener Umhang ließ nur einen flüchtigen Blick auf seinen Spitzenkragen und das Wams aus feinem Tuch zu, das mit Silberknöpfen besetzt war. In der Hand trug er seinen langen Amtsstab. Der Büttel, der ihn begleitete und die Fackel hielt, war dagegen weit weniger fein gekleidet. Auf seinem natürlichen Haar, das ihm auf die Schultern herabfiel, saß ein verbeulter Hut, sein Wams war aus robustem Leder, und der Mantel, den er darüber trug, wirkte schmutzig und von langem Gebrauch mitgenommen.
»Mylord, war es wirklich notwendig, uns zu so später Stunde herzubeordern und im Schnee stehen zu lassen?«, beschwerte sich der Konstabler. »Das Weib ist schließlich tot und dürfte sich kaum davonstehlen.«
»Immerhin geht es um einen Mord«, erwiderte Sir Orlando eisig. »Der Schurke muss zur Strecke gebracht werden, bevor er wieder zuschlägt.«
»Was hat das Weibsbild auch zu so unchristlicher Zeit auf der Straße zu suchen? Kein Wunder, dass sie irgendeinem Strolch in die Arme gelaufen ist.«
»Die Tote war Hebamme. Sie konnte es sich leider nicht aussuchen, wann sie das Haus verließ. Es ist Eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Straßen Eures Bezirks auch des Nachts sicher sind und nicht von Diebesgesindel wimmeln.«
Während Trelawney seinem Ärger über die Pflichtvergessenheit des Konstablers Luft machte, beugte sich Jeremy mit einer Fackel in der Hand über die Leiche und befreite sie vom Schnee. Sir Orlandos Beobachtung war zutreffend gewesen, die Kugel war in Margaret Laxtons Brust eingedrungen und hatte sich in ihr Herz gebohrt. Ein hervorragender Schuss!, dachte der Priester anerkennend. Und ein gefährlicher Schütze!
Ohne sich um das Streitgespräch zwischen dem Richter und dem Konstabler zu kümmern, das seinen Lauf nahm, sah sich Jeremy in der unmittelbaren Umgebung um. Er entdeckte den Misthaufen, umrundete ihn interessiert und hob schließlich die erloschene Fackel auf, die daneben auf dem Boden lag. Prüfend roch er an dem nun kalten Pech. Neugier begann sich in ihm zu regen, und so ging er noch ein paar Schritte die Gasse entlang bis zu einer Hofeinfahrt. Hier blieb er nachdenklich stehen, betrachtete die Häuser um sich herum und suchte in gebeugter Haltung den Boden der Einfahrt ab.
»Dr. Fauconer, wo seid Ihr?«, rief Sir Orlando, der das Verschwinden seines Freundes bemerkt hatte. Und da der Vermisste nicht antwortete, sahen sich der Richter und die beiden Ordnungshüter genötigt, ihm die Gasse entlang zu folgen.
»Doktor, was macht Ihr denn da?«, fragte Trelawney entgeistert, als er den Jesuiten auf allen vieren in der Hofeinfahrt herumkriechen sah.
Jeremy erhob sich und klopfte sich den Schnee von den Handschuhen. »Schade, der Boden ist zu hart. Es sind keine Spuren zurückgeblieben.«
»Glaubt Ihr, dass der Mörder hier gelauert hat?«
»Zweifellos. Mylord, erinnert Ihr Euch, Hufschlag gehört zu haben, als der Unbekannte floh?«
Sir Orlando krauste grübelnd die Stirn. »Jetzt, wo Ihr mich fragt, kann ich mich tatsächlich erinnern, ein Pferd gehört zu haben. Es war mir völlig entfallen. Ich hatte nicht so genau darauf geachtet, denn ich lief zu Malory, der vor Schmerz schrie.«
»Nun, es spricht für Euch, dass das Wohl Eures Dieners Euch so sehr am Herzen lag, aber es wäre hilfreicher gewesen, wenn Ihr Augen und Ohren offengehalten hättet. Der Mörder war also beritten und wartete hier auf sein Opfer. Deshalb schoss er auch auf Malory. Er brauchte Zeit, um zu seinem Pferd zurückzukommen.«
»Aber das hieße ja, dass wir es hier nicht mit einem gemeinen Straßenräuber zu tun haben«, schloss Trelawney.
»Oh, das habe ich von Anfang an bezweifelt, Sir«, betonte Jeremy. »Der Mörder war für einen einfachen Straßenräuber viel zu gut bewaffnet. Er hatte immerhin mindestens zwei Pistolen bei sich. Nicht gerade die Ausstattung eines kleinen Strauchdiebs, meint Ihr nicht?«
»Ihr habt Recht! Die Sache wird immer mysteriöser.«
»Allerdings. Zumal ich der Ansicht bin, dass der Unbekannte die beiden Frauen absichtlich hierherlockte, um sie zu töten.«
»Ihr glaubt nicht, dass es ein zufälliges Zusammentreffen war?«
»Nein, er kam zu Pferd und wartete in dieser Hofeinfahrt darauf, dass jemand, vermutlich ein Komplize, die Frauen hierherführte.«
»Wie wollt Ihr das wissen?«, fragte der Richter erstaunt. »Das Mädchen hat nichts dergleichen erwähnt.«
»Margaret Laxton war Wehmutter. Es war ein Leichtes, sie unter dem Vorwand, dass ihr Beistand gebraucht würde, aus dem Haus zu locken. Jemand geht ihr und ihrer Tochter mit der Fackel voraus, führt sie bis hierher, löscht die Fackel und verschwindet in der Nacht. Dieser Misthaufen scheint der verabredete Punkt gewesen zu sein. Seht hier, Mylord, eine Fackel, die vor kurzem noch brannte und an der noch genug Pech klebt, dass sie vermutlich nicht von allein ausgegangen ist. Nein, der Mörder lauerte Margaret und Anne Laxton auf, um beide kaltblütig zu töten. Seine Bewaffnung beweist es. Er hatte zwei Pistolen dabei. Eine für die Mutter, eine für die Tochter. Malory hat den Plan jedoch vereitelt, als er dazwischenging. Der Mörder sah sich gezwungen, die zweite Kugel für ihn zu verwenden, um seine Flucht zu decken.«
»Nun, das leuchtet mir ein, Doktor«, stimmte Trelawney zu. »Das heißt, wir müssen unbedingt noch einmal mit dem Mädchen sprechen.«
Alan wusch sich das Blut von den Händen und nahm das Leintuch entgegen, das Kit ihm reichte. Malory hatte sich während der Behandlung nicht gerührt und lag noch immer in erlösender Betäubung da. Nach Entfernung der Splitter hatte Alan den betroffenen Knochen mit einer Feile geglättet, die Wunde verbunden und dann das Bein auf eine Weise geschient, die eine Beugung des Knies verhinderte. Die Heilung musste er nun der Natur überlassen.
»Sag Molly, sie soll das Bett in der Kammer im zweiten Stock herrichten«, wies Alan den Lehrknaben an. »Wenn sie fertig ist, tragen wir ihn nach oben.«
Sein Blick fiel auf das Mädchen, das noch immer verloren auf der Bank hockte, und er schämte sich, dass er sie während der Operation völlig vergessen hatte. Ihr Gesicht unter der verrutschten Leinenhaube war sehr blass, sie wirkte wie entrückt in eine andere, weniger grausame Welt, in der sie vor der Wirklichkeit Schutz suchte.
Mit leiser Stimme, um sie nicht zu erschrecken, sprach Alan sie an: »Ich weiß, das ist alles sehr schwer für Euch. Ihr müsst erschöpft sein. Bei diesem Wetter könnt Ihr unmöglich nach Hause gehen. Ich biete Euch gerne meine Schlafkammer für die Nacht an, wenn Ihr wollt.«
Der erschrockene Blick, den Anne ihm zuwarf, machte ihn zutiefst verlegen. »Ich meine natürlich… ich wollte sagen, ich schlafe derweil bei meinem Freund. Ihr werdet ganz ungestört sein«, fügte er eilig hinzu.
Verdammt!, dachte er. Ich trete doch immer ins Fettnäpfchen!
Anne senkte den Blick und nickte, ohne ein Wort zu sagen.
Alan räusperte sich und rief nach der Magd: »Molly, bring Mistress Laxton in meine Schlafkammer und sieh zu, dass sie es bequem hat.«
Hoffentlich findet sie in dieser Nacht wenigstens ein bisschen Schlaf, überlegte er, während er dem Mädchen nachblickte.
Wenig später kehrten der Richter und der Priester zurück.
»Wie geht es Malory?«, fragte Trelawney, während er seinen schlafenden Diener begutachtete.
»Es wird eine Weile dauern, bis er wieder zu sich kommt«, erklärte Alan. »Ich möchte ihn gerne einige Tage hierbehalten, Mylord, er sollte so ruhig wie möglich liegen. Wenn die Wunde gut heilt, könnt Ihr ihn abholen, am besten in einer Sänfte.«
»Das werde ich tun, Meister Ridgeway. Und danke für Eure Mühe. Was schulde ich Euch für die Behandlung?«
Alan nannte ihm seinen Lohn, und Sir Orlando bezahlte ihn.
»Wo ist das Mädchen?«, fragte der Richter dann.
»Ich habe sie in meiner Kammer untergebracht.«
»Das ist gut«, bemerkte Jeremy. »Heute hätten wir ohnehin nichts mehr aus ihr herausbekommen. Wir werden morgen noch einmal mit ihr reden.«
Richter Trelawney stimmte ihm zu. Bevor er sich verabschiedete, nahm er seinen Freund zur Seite und sagte verlegen: »Ich weiß, dies ist eigentlich nicht der passende Augenblick, aber ich wollte Euch noch um einen Gefallen bitten, Pater.«
»Jederzeit, Mylord«, erbot sich Jeremy bereitwillig. »Worum geht es?« .
»Nun, ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten.«
»Sehr lobenswert. Es wird Euch guttun. Wer ist denn die Glückliche?«
»Ihr Name ist Sarah Draper. Ihr Vater ist ein Gutsbesitzer aus Essex, der im Bürgerkrieg für den König gekämpft hat. Die Familie siedelt in einigen Tagen von ihrem Landsitz nach London über. Ich bin zu Sankt Valentin in ihrem Stadthaus zum Mittagsmahl eingeladen und wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mich begleiten würdet.«
Jeremy zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Ihr wollt mich zu einem Essen mit der Familie Eurer Verlobten mitnehmen?«
»Nun, noch sind wir nicht verlobt. Bevor ich mich zu Eheverhandlungen bereit erkläre, hätte ich gerne Eure Meinung über das Mädchen gehört.«
»Mylord, das ist nicht Euer Ernst!«
»Durchaus. Ihr seid der beste Menschenkenner, der mir je begegnet ist. Deshalb möchte ich Euch die Familie vorstellen.«
»Sir, wenn Ihr Euch nicht sicher seid, ob Ihr dieses Mädchen ehelichen wollt, so kann ich Euch auch nicht weiterhelfen. Ihr müsst selbst zu einer Entscheidung kommen.«
»Ich bitte Euch lediglich, mir zu sagen, was Ihr von ihr haltet«, beharrte Trelawney. »Also abgemacht, Pater. Noch eine gute Nacht wünsche ich!« Und er war zur Tür hinaus, bevor Jeremy auch nur den Mund öffnen konnte, um Einspruch zu erheben.
Alan, der das Gespräch mit angehört hatte, grinste breit. »Da seid Ihr aber schwer in der Bredouille, mein Freund. Wie kommt unser guter Richter nur darauf, Ihr könntet ihm bei seinem Problem weiterhelfen? Schließlich versteht Ihr doch überhaupt nichts von Frauen.«
»Ich weiß das, aber er anscheinend nicht«, spöttelte Jeremy. Trelawneys Anliegen war ihm denkbar peinlich, doch zugleich fiel es ihm schwer, seinem Freund eine Abfuhr zu erteilen. Er würde noch einmal mit Engelszungen auf Sir Orlando einreden müssen, um ihn zu überzeugen, dass er etwas Unmögliches verlangte.
Drittes Kapitel
Nachdem sich Alan in der Zinnschüssel gewaschen hatte, die auf einer Truhe stand, öffnete er das Fenster der Kammer und schüttete das Schmutzwasser auf die Straße. Unten brach jemand in Verwünschungen aus. Schuldbewusst streckte Alan den Kopf aus dem Fenster und entschuldigte sich höflich.
»Ihr hättet vorher rufen sollen«, sagte Jeremy lachend. »Wo seid Ihr nur mit Euren Gedanken?«
Alan zog sich sein langes Leinennachthemd über und schlüpfte zu seinem Freund ins Bett. »Ich dachte an das arme Ding da unten in meiner Kammer«, sagte er, während er die Kerze ausblies und die Vorhänge des Baldachinbetts zuzog. Das Feuer im Kamin war erloschen, und es war empfindlich kalt. »Sie hat Furchtbares durchgemacht. Mit ansehen zu müssen, wie die Mutter erschossen wird! Schrecklich!«
»Ich glaube, sie ahnt, wer der Täter ist«, bemerkte Jeremy nachdenklich. »Hoffentlich ringt sie sich dazu durch, uns zu sagen, was sie weiß. Schließlich könnte sie immer noch in Gefahr sein.«
»Dann sollten wir vielleicht ihre Familie befragen«, schlug Alan eifrig vor.
»Wir?«
»Ja, warum nicht? Ich werde das Mädchen morgen doch nicht allein nach Hause gehen lassen. Und wenn ich schon einmal dort bin, kann ich doch gut Erkundigungen einziehen.«
»Wie Ihr wollt«, lenkte Jeremy mit einem verschlafenen Seufzer ein. »Gehen wir morgen also alle gemeinsam zu den Laxtons.«
Befriedigt rollte sich Alan unter der warmen Decke zusammen und schloss die Augen. Das Baldachinbett war gerade lang genug für Jeremy, der um wenige Zoll kleiner war als sein Freund, doch Alans Zehen reichten über den Rand der Matratze hinaus, wenn er sich ausstreckte. So war er gezwungen, mit angezogenen Beinen zu schlafen, wollte er sich keine kalten Füße holen.
In den frühen Morgenstunden wurden sie von einem gellenden Schrei aus dem Schlaf gerissen.
»Was… was ist passiert?«, stammelte Alan und rieb sich die Augen.
»Das kommt aus Eurer Kammer«, klärte Jeremy ihn auf. »Die Kleine hat Albträume.«
Pflichtbewusst schälte sich Alan aus der Decke und schlüpfte in seine Kniehose. »Ich sehe mal nach.«
Noch mit dem Verschluss seiner Hose beschäftigt, glitt er mit den Füßen in seine Pantoffeln und hastete die Stiege in den ersten Stock hinunter. Als er die Tür zu seiner Schlafkammer öffnete, setzte sein Herz für einen Moment aus. Nur mit einem dünnen Leinenhemd bekleidet, stand Anne vor dem geöffneten Fensterflügel, das rechte Bein angewinkelt, den Fuß schon auf dem schmalen Sims.
»Nein, tut das nicht!«, schrie Alan und stürzte auf sie zu. Seine Hände ergriffen ihre Taille, gerade als sie sich mit dem anderen Bein abstieß und aus dem Fenster springen wollte. Alan riss sie zurück und wollte sie zum Bett zerren, doch sie entwand sich ihm und versuchte, wieder zum Fenster zu kommen. Da schlang er die Arme um sie und zog sie mit Gewalt auf die andere Seite der Kammer. Anne begann zu schreien und um sich zu schlagen, doch er ließ sie nicht los.
»Lasst mich! Lasst mich!«, kreischte sie wie von Sinnen. Sie holte aus und schlug nach ihm. Alan spürte einen scharfen Schmerz an der linken Wange, als sich ihre Fingernägel hineingruben. Erst als es ihm gelang, ihre Arme an ihren Körper zu pressen und festzuhalten, verließen sie allmählich die Kräfte, und sie hörte auf zu toben.
Jeremy, Nick und Molly waren inzwischen in der Tür zur Kammer aufgetaucht und blieben angesichts des seltsamen Schauspiels entgeistert stehen. Jeremy fing sich als Erster.
»Molly, kümmere du dich um das Mädchen«, gebot er.
Als Alan sie losließ, brach Anne in Schluchzen aus und sackte auf dem Bett zu einem bemitleidenswerten Häufchen Elend zusammen. Die Magd tätschelte ihr tröstend die Schultern und zog das Mädchen dann an ihre Brust. Jegliche Gegenwehr war erstorben.
Jeremy schlug das Fenster zu und nahm Alan energisch beim Arm. »Offenbar lässt sie sich nicht gern von Männern anfassen. Lassen wir sie in Ruhe. Molly, es wird besser sein, wenn du den Rest der Nacht bei ihr bleibst. Nick, geh zu Malory, und falls er wach ist, sag ihm, dass alles wieder in Ordnung ist. Er soll versuchen weiterzuschlafen.«
Jeremy nötigte Alan, ihn nach unten in die Offizin zu begleiten, damit er die Wunde an seiner Wange versorgen konnte.
»Das ›arme Ding‹ ist eine ziemliche Kratzbürste«, kommentierte der Jesuit, während er die Abschürfungen mit Salbe bestrich. »Ihr könnt froh sein, wenn keine Narbe zurückbleibt.«
»Sie wollte sich umbringen. Sie wollte einfach aus dem Fenster springen!«, murmelte Alan fassungslos.
»In den frühen Morgenstunden ist der Mensch den Versuchungen des Teufels gegenüber am wehrlosesten. Wenn es erst Tag ist, wird sie schon wieder zur Vernunft kommen, glaubt mir.«
»Ich weiß, sie hat Schreckliches mit ansehen müssen. Aber reicht das aus, um seinem Leben ein Ende machen zu wollen? Sie hat doch noch ihren Vater und einen Bruder, soweit mir bekannt ist.«
»Vielleicht gibt es noch etwas anderes, das ihr auf der Seele liegt«, mutmaßte Jeremy.
»Ich würde ihr gerne helfen.«
»Na, dann viel Glück. Sie sieht mir nicht aus wie jemand, der gerne über seine Gefühle spricht. Und nun kommt, gehen wir wieder ins Bett und versuchen, ein wenig zu schlafen.«
Es war noch dunkel, als Jeremy am Morgen das Bett verließ und im Nachthemd vor dem Kruzifix niederkniete, das an der Wand hing, um in der Stille des noch schlafenden Hauses zu beten. Die Kälte der Winternacht biss in das Fleisch seiner nackten Beine, ohne dass er es wahrnahm. Erst als er sich wieder erhob, spürte er den Schmerz seiner steif gewordenen Muskeln, die gegen die plötzliche Bewegung rebellierten.
Ohne Alan zu wecken, warf sich Jeremy einen dicken Schlafrock über und steckte seine taub gewordenen Füße in warme Schafsfellpantoffeln. Da sie keine Haushälterin hatten und Molly mit Anne Laxtons Aufsicht betraut war, übernahm der Jesuit an diesem Morgen die Pflichten des Haushalts. Bevor er in die Küche ging, öffnete er leise die Tür zu Alans Schlafkammer und sah hinein. Das Mädchen schlief noch. Die Magd hatte sich zu ihr ins Bett gelegt, um sich vor der Kälte zu schützen, und wandte den Kopf, als sie Jeremy bemerkte.
»Bemüh dich nicht, Molly«, sagte er abwehrend, als sie sich anschickte, das Bett zu verlassen. »Ich kümmere mich unten um das Feuer.«
Er schloss leise die Tür und stieg ins Erdgeschoss hinab. Nachdem er das Feuer in der Feuerstelle geschürt und Kohlen aufgelegt hatte, füllte er den Zinnkrug aus seiner Kammer an der Wasserpumpe, die von einer unterirdischen Zisterne gespeist wurde, und stellte ihn auf einen Rost über der Glut. Mit dem erhitzten Wasser kehrte er nach oben zurück, wusch sich in der Zinnschüssel, säuberte seine Zähne mit Salz und rasierte sich schließlich vor einem kleinen Spiegel, den er auf dem Tisch gegen einen Kerzenständer lehnte. Als er sich fertig angekleidet hatte, schlief Alan noch immer den Schlaf des Gerechten. Jeremy rüttelte ihn unsanft an der Schulter, doch der Wundarzt murmelte lediglich etwas Unverständliches und rollte sich auf die andere Seite.
»Alan, wacht auf!«, forderte der Priester ungeduldig. »Ich habe Euch heißes Wasser gebracht. Steht auf, bevor es kalt wird.«
»Ist es denn schon Zeit?«, brummte Alan verschlafen. »Wir sind doch gerade erst ins Bett gegangen.«
»Jeden Morgen dasselbe mit Euch!«, schalt Jeremy ihn in freundschaftlichem Ton. »Nun macht schon. Wir müssen das Mädchen nach Hause bringen.«