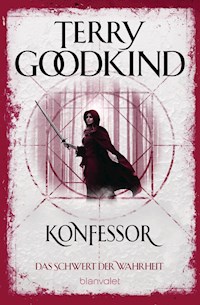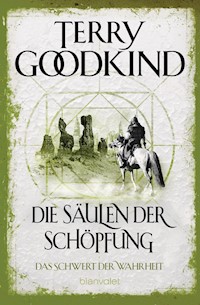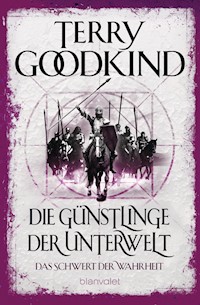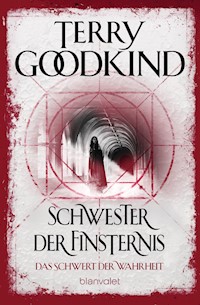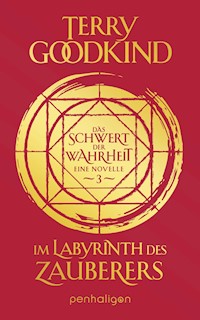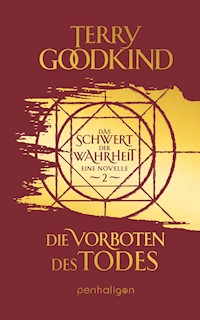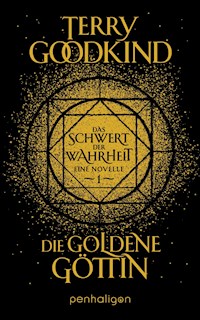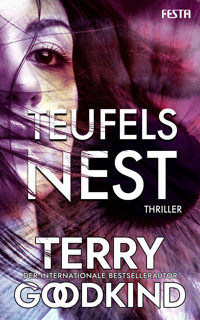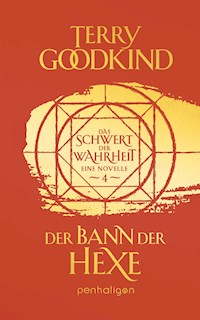9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legende von Richard und Kahlan
- Sprache: Deutsch
Er kämpft gegen einen unsichtbaren Feind, um seine Welt zu retten!
Eine neue Bedrohung zieht in den Dunklen Landen auf. Mit der Essenz des Todes infiziert und seiner Macht als Zauberer beraubt, muss Richard schnellstmöglich die teuflische Verschwörung aufdecken, die hinter der Mauer hoch im Norden brodelt. Seine Freunde und Verbündeten sind bereits Gefangene eines fürchterlichen Feindes, und Kahlan, die ebenfalls vom Tod höchstpersönlich berührt wurde, wird sterben, wenn Richard versagt. Ohne seine Magie bleiben Richard nur noch sein Schwert, sein Verstand und seine innere Stimme – und eine außergewöhnliche Begleiterin, die junge Heilerin Samantha …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Schwert der Wahrheit bei Blanvalet in der ungeteilten,
dem Original entsprechenden Taschenbuchausgabe:
Erstes Buch: Das erste Gesetz der Magie (36967)
Zweites Buch: Die Schwestern des Lichts (36968)
Drittes Buch: Die Günstlinge der Unterwelt (36969)
Viertes Buch: Der Tempel der vier Winde (37104)
Fünftes Buch: Die Seele des Feuers (37105)
Sechstes Buch: Schwester der Finsternis (37106)
Siebtes Buch: Die Säulen der Schöpfung (37288)
Achtes Buch: Das Reich des dunklen Herrschers (37289)
Neuntes Buch: Die Magie der Erinnerung (37290)
Zehntes Buch: Am Ende der Welten (37389)
Elftes Buch: Konfessor (37390)
Die Legende von Richard und Kahlan bei Blanvalet:
Erstes Buch: Dunkles Omen (26838)
Zweites Buch: Im Reich der Jäger (6033)
Terry Goodkind
Im Reich der Jäger
Die Legende von Richard und Kahlan
Zweites Buch
Roman
Deutsch
von Caspar Holz
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
The Third Kingdom bei Tor Books, New York.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung April 2016 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Terry Goodkind
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
published in agreement with the author, c/o Baror International, Inc.,
Armonk, New York, USA
Umschlaggestaltung: © Isabelle Hirtz, Inkcraft
unter Verwendung einer Illustration von Melanie Miklitza
Redaktion: Werner Bauer
BS · Herstellung: sam
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-17111-7V001
www.blanvalet.de
1
»Wir sollten sie uns jetzt gleich einverleiben, ehe sie noch krepieren und vergammeln«, ließ sich eine unwirsche Stimme vernehmen.
Richard war sich des leisen Getuschels nur vage bewusst. Immer noch halb bewusstlos, vermochte er sich nicht zusammenzureimen, wer da sprach, viel weniger noch zu begreifen, was diese Leute da redeten, aber immerhin war er bei ausreichend klarem Verstand, um durch ihren mitleidlosen Ton beunruhigt zu sein.
»Ich finde, wir sollten sie eintauschen«, erwiderte ein zweiter Mann, während er den Knoten in dem Strick festzurrte, den er um Richards Knöchel geschlungen hatte.
»Sie eintauschen?«, fragte der erste gereizt. »Sieh dir doch die blutigen Decken an, in die sie gehüllt waren, und das Blut überall auf dem Wagenboden. Vermutlich würden sie krepieren, ehe wir sie jemals eintauschen könnten, und dann würden sie verderben. Und überhaupt, wie könnten wir sie beide transportieren? Die Pferde ihrer Soldaten, der Wagen, das alles ist dahin, zusammen mit allem anderen von Wert.«
Der zweite Mann stieß einen unglücklichen Seufzer aus. »Dann sollten wir den Großen vertilgen, ehe noch jemand anders aufkreuzt. Die Kleinere wäre leichter zu transportieren, und wir könnten sie später eintauschen.«
»Oder wir behalten sie selbst und fressen sie später.«
»Wir würden uns besser stehen, sie einzutauschen. Wann wird sich uns je wieder eine solche Gelegenheit bieten, so viel zu bekommen, wie sie uns bringen würde?«
Während die beiden Männer miteinander debattierten, versuchte Richard, seine Hand zur Seite auszustrecken und die unmittelbar neben ihm liegende Kahlan zu berühren, doch er schaffte es nicht. Seine Hände, merkte er, waren fest mit einem groben Strick zusammengebunden. Also stieß er sie stattdessen mit dem Ellbogen an. Sie reagierte nicht.
Irgendetwas musste er tun, aber er wusste auch, dass er erst einmal wieder vollends zu Bewusstsein und zu Kräften kommen musste, da er sonst keine Chance hätte. Aufgrund einer eigentümlichen Übelkeit, die ihn nicht nur seiner Kraft beraubt, sondern auch seinen Verstand in einem Nebel aus Dumpfheit zurückgelassen hatte, fühlte er sich mehr als schwach, geradezu fiebrig.
Er hob den Kopf ein kleines Stück und versuchte blinzelnd, im trüben Licht etwas zu erkennen, sich zu orientieren, vermochte aber eigentlich kaum etwas wahrzunehmen. Als er mit dem Kopf irgendwo anstieß, dämmerte ihm, dass er und Kahlan mit einer steifen Plane zugedeckt waren. Unter deren Rand hervor konnte er am Ende des Wagens, hinter seinen Füßen, vage ein paar dunkle Schemen ausmachen. Einer der Männer trat näher und hob das untere Ende der Plane an, während der andere einen Strick um Kahlans Knöchel schlang und diesen, wie schon zuvor bei Richard, festzurrte.
Durch die Öffnung konnte Richard sehen, dass es Nacht war. Ein voller Mond stand am Himmel, dessen Licht jedoch war von gedämpfter Helligkeit, was ihm verriet, dass der Himmel bedeckt war. Ein träger Nieselregen wehte durch die stille Luft. Jenseits der beiden Gestalten erhob sich eine undurchdringliche Wand aus Fichten, die sich über den Rand des Gesichtsfeldes hinaus erstreckte.
Kahlan rührte sich nicht, als er ihr den Ellbogen ein wenig fester gegen die Rippen stieß. Wie seine, lagen auch ihre gefalteten Hände auf ihrer Gürtellinie. Die Sorge, was mit ihr nicht stimmen könnte, trieb ihn an, mit aller Macht wieder zur Besinnung zu kommen. Wenigstens konnte er sehen, dass sie atmete, wenn auch nur flach.
Während er nach und nach sein Bewusstsein wiedererlangte, erkannte er, dass nicht nur irgendeine Art Fieber ihn schwächte, sondern dass sein ganzer Körper mit Hunderten winziger schmerzender Wunden bedeckt war; aus manchen sickerte noch immer Blut. Er konnte sehen, dass auch Kahlan mit den gleichen Schnitt- und Stichwunden übersät war. Ihre Kleider waren blutdurchtränkt.
Doch es war nicht nur das Blut auf ihnen beiden, das ihn beunruhigte. Die feuchte, unter der Plane hereinwallende Luft trug einen noch schwereren Blutgeruch heran. Sie waren in Begleitung gewesen, von Leuten, die ihnen zu Hilfe gekommen waren. Das Ausmaß seiner Beunruhigung stieg und lähmte sein Bemühen, wieder zu Kräften zu kommen.
Richard konnte die abklingenden Auswirkungen einer Heilung spüren, erkannte schemenhaft die Berührung jener Frau, die ihn geheilt hatte, da aber seine Stich- und Schnittwunden noch immer schmerzten, wusste er, dass die Heilung zwar begonnen worden, über diesen Anfang aber nicht hinausgekommen und schon gar nicht abgeschlossen worden war.
Er fragte sich, warum.
Auf seiner anderen, der Kahlan abgewandten Seite, hörte er, wie etwas über den Wagenboden geschleift wurde.
»Sieh dir das an«, sagte der Mann mit der barschen Stimme, während er es hervorzog. Als der Mann hineinlangte und den Gegenstand, den er zu sich herangezogen hatte, hochhob, konnte Richard zum ersten Mal sehen, wie kräftig die Arme des Fremden waren.
Der andere stieß einen leisen Pfiff aus. »Wie konnten die das bloß übersehen? Und überhaupt, wie haben sie diese zwei hier übersehen können?«
Der Größere der beiden sah sich um. »So chaotisch, wie hier alles aussieht, müssen das diese Shun-tuk gewesen sein.«
Eine plötzliche Befürchtung ließ den anderen die Stimme senken. »Shun-tuk? Glaubst du das wirklich?«
»Nach allem, was ich über ihre Gewohnheiten weiß, würde ich sagen, sie waren es.«
»Was sollten die Shun-Tuk hier draußen wollen?«
Der große Mann beugte sich zu seinem Begleiter hinüber. »Dasselbe wie wir. Jagd auf Seelenbesitzer machen.«
»So weit abseits ihres Stammesgebietes? Unwahrscheinlich.«
»Jetzt, da die Barriere durchbrochen ist, wo könnte man da besser Jagd auf Menschen machen, die eine Seele besitzen? Um solche Menschen zu finden, würden die Shun-tuk überall hinziehen, alles tun. Genau wie wir auch.« Er hob den Arm und wies mit einer schnellen Geste um sich. »Wir sind hierhergekommen, um in diesen neuen Landen zu jagen, oder etwa nicht? Nichts anderes würden auch die Shun-tuk tun.«
»Aber sie nennen ein riesiges Territorium ihr Eigen. Bist du sicher, das würden sie verlassen?«
»Ihr Reich mag riesig und sie selbst mächtig sein, trotzdem fehlt ihnen, wonach es sie am meisten verlangt. Da die Grenzbarriere durchbrochen ist, können sie jetzt danach jagen, genau wie wir und alle anderen.«
Der Blick des anderen wanderte unruhig umher. »Trotzdem, ihr Reich ist weit weg. Und du meinst, sie könnten es gewesen sein? So weit abseits ihres Stammesgebiets?«
»Ich bin den Shun-tuk selbst noch nicht begegnet, und ich hoffe, dabei bleibt es auch.« Der große Mann fuhr sich mit seinen dicken Fingern durch das feuchte, strähnige Haar, während er seinen Blick suchend über die dunkle Baumreihe wandern ließ. »Aber ich hab gehört, dass sie, bis sie auf Seelenbesitzer stoßen, andere Halbmenschen jagen, einfach so zur Übung. Dies hier sieht ganz nach ihrer Vorgehensweise aus. Hält sich ihre Beute, so wie hier, im offenen Gelände auf, schlagen sie schnell, hart und mit einer gewaltigen Übermacht zu. Das Ganze ist vorbei, ehe jemand auch nur eine Chance hat, sie kommen zu sehen oder zu reagieren. Gewöhnlich vertilgen sie ein paar von denen, über die sie hergefallen sind, die meisten aber sparen sie sich für später auf.«
»Und was ist dann mit den beiden hier? Warum hätten sie die zurücklassen sollen?«
»Hätten sie niemals getan. In ihrer Hast, ein paar ihrer Gefangenen zu verspeisen und die übrigen zu verschleppen, müssen sie die beiden unter der Plane übersehen haben.«
»Ich hab erzählen hören, die Shun-tuk kommen oft noch mal zurück, um sich nach versprengten Rückkehrern umzusehen«, meldete der Kleine sich wieder zu Wort.
»Da hast du richtig gehört.«
»Dann sollten wir von hier verschwunden sein, ehe sie noch einmal wiederkommen. Hat sie die Blutgier einmal übermannt, werden sie uns ohne Zögern verschlingen.«
Richard spürte den Griff kräftiger Finger an seinem Knöchel. »Ich dachte, du wolltest den hier verspeisen, ehe er womöglich stirbt und seine Seele ihn verlassen kann.«
Der andere Mann packte Richards anderen Knöchel. »Vielleicht sollten wir ihn erst einmal an einen sicheren Ort schaffen, wo es nicht so wahrscheinlich ist, dass die Shun-tuk auf uns stoßen und sich einmischen. Haben wir erst einmal angefangen, lasse ich mich nur ungern überraschen. Schließlich gibt es Leute, die für einen Seelenbesitzer jeden Preis bezahlen würden. Um so einen würden selbst die Shun-tuk feilschen.«
»Ein gefährlicher Gedanke.« Er dachte kurz darüber nach. »Aber du hast recht, die Shun-tuk würden ein Vermögen bezahlen.« Die wölfische Gier war in der Stimme des anderen zurück. »Aber der hier, der gehört mir.«
»Es ist für uns beide reichlich da.«
Der andere grunzte; er schien bereits ganz in seine eigenen Gelüste versunken. »Aber nur eine Seele.«
»Die gehört dem, der sie verschlingt.«
»Genug geredet«, knurrte der Größere. »Ich will mich über ihn hermachen.«
Als Richard aus dem Wagen geschleift wurde, bemühte er sich noch immer, zumindest wieder so weit zur Besinnung zu kommen, dass er die seltsamen Dinge einigermaßen begriff, die er da hörte. Die Warnungen vor den Gefahren der Dunklen Lande waren ihm noch bestens in Erinnerung. Auch war er klar genug, um zu begreifen, dass sein Leben im Augenblick davon abhing, den beiden Kerlen nicht zu zeigen, dass er im Begriff war, wieder zu sich zu kommen.
Als er kurzerhand an den Knöcheln von der Ladefläche gezerrt wurde, schlug sein Oberkörper auf den Boden. Er versuchte noch, den Kopf einzuziehen, doch mit gefesselten Händen konnte er seine Arme nicht wirksam einsetzen, um zu verhindern, dass sein Kopf hart auf den steinigen Boden schlug. Der Schmerz war von schockierender Schärfe, gefolgt von einer einlullenden, verführerischen Schwärze, die ihm ganz sicher zum Verhängnis werden würde, wenn es ihm nicht gelang, dagegen anzukämpfen.
Er konzentrierte sich auf die Umgebung und suchte, bemüht, seinen Verstand zu beschäftigen, nach einem Fluchtweg. Soweit er dies im fahlen Mondschein erkennen konnte, stand der Wagen mutterseelenallein in der Wildnis. Die Pferde waren fort.
Zwar sah er niemanden sonst in der unmittelbaren Umgebung, entdeckte aber ganz in der Nähe Knochen. Die Knochen waren nicht von der Witterung ausgebleicht, sondern dunkel und fleckig von Fleischfetzen und getrocknetem Blut. Er konnte Spuren sehen, dort, wo Zähne jeden Gewebeschnipsel von den Knochen abzunagen versucht hatten.
Es waren Menschenknochen.
Auch Uniformfetzen erkannte er; es waren die Uniformen der Ersten Rotte, seiner persönlichen Leibgarde. Offenbar hatten zumindest einige von ihnen bei der Verteidigung von ihm und Kahlan ihr Leben gelassen.
Der kleinere Kerl, offenbar nicht gewillt, von seiner Beute abzulassen, hielt noch immer Richards Knöchel gepackt. Der andere Mann stand etwas seitlich und betrachtete den Gegenstand, den er über die Ladefläche geschleift und schließlich aus dem Wagen gezogen hatte.
Es war sein Schwert, wie Richard jetzt erkannte.
Der Mann mit dem Schwert in der Hand zog Kahlan halb unter der Plane hervor. Ihre Unterschenkel knickten ab und hingen leblos über der Ladeflächenkante.
Als der Mann sie musterte und dadurch abgelenkt war, ergriff Richard die Gelegenheit beim Schopf. Er richtete sich auf, stürzte vor und versuchte sein Schwert zu packen, doch der Mann zog es zurück, außer Reichweite, ehe Richard seine Finger um das Heft schließen konnte. An Händen und Füßen gefesselt, war er nicht beweglich genug, um es schnell genug zu greifen.
Die beiden Männer wichen einen Schritt zurück. Sie hatten nicht damit gerechnet, dass er bei Bewusstsein war. Richard hatte den Vorteil der Überraschung verloren und nichts dafür gewonnen!
Als Reaktion darauf, ihn wach zu sehen, beschlossen die beiden Männer, keine weitere Zeit zu vergeuden. Knurrend wie hungrige Wölfe stürzten sie sich auf ihn und fielen wie Tiere im Fressrausch über ihn her. Die Situation war so bizarr, dass sie sich jedem Begreifen entzog.
Der Kleinere der beiden riss Richards Hemd auf. In seinen Augen konnte Richard einen Glanz ungehemmter Grausamkeit schimmern sehen. Der Größere, die Zähne in animalischer Raserei gebleckt, stürzte sich sogleich von der Seite her auf Richards Hals. Reflexartig zog Richard die Schulter hoch und wehrte den Vorstoß im allerletzten Augenblick noch ab. Eine Bewegung, die seinen freiliegenden Hals schützte, dafür jetzt aber seine Schulter der Attacke aussetzte.
Richard schrie vor Schmerz, als sich die Zähne in seinen Oberarm gruben. Er wusste, er musste handeln, und zwar schnell.
Ihm fiel nur eine Möglichkeit ein: seine Gabe. Gedanklich drang er bis in sein Innerstes vor, rief verzweifelt todbringende Kräfte auf den Plan, wandte sich nachdrücklich an jene Kraft, die sein Geburtsrecht war.
Nichts geschah.
Mit dem Ausmaß seines Zorns, seiner Verzweiflung, dazu der Angst um Kahlan, waren die notwendigen Voraussetzungen für die Reaktion seiner Gabe gegeben. In der Vergangenheit hatte sie stets auf ein solch drängendes Verlangen reagiert. Sie hätte jetzt mit der ihr eigenen Macht brüllend hervorbrechen sollen.
Es war, als wäre da gar keine Gabe, die auf den Plan gerufen werden konnte.
Unfähig, sie zu wecken, an Handgelenken und Knöcheln gefesselt, hatte er keine Möglichkeit, sich der beiden Männer wirksam zu erwehren.
2
Richard – entmutigt und wütend, weil er es nicht schaffte, seine Gabe zu einer Reaktion zu bewegen, um sich selbst und Kahlan zu helfen – wusste, ihm blieb keine Zeit für einen Versuch, dies zu verstehen. Stattdessen griff er auf das zurück, worauf er sich stets verlassen konnte: seine Instinkte und seine Erfahrung.
Als sich die Männer auf ihn stürzten, schlug er blindlings um sich, um zu verhindern, dass sie ihn festhalten, ihn mit purer Muskelkraft in ihre Gewalt bringen konnten. Dass er am Boden lag, das Gewicht seiner Angreifer über sich, benachteiligte ihn ganz entschieden, was ihn jedoch unter keinen Umständen davon abhalten durfte, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sich ihrer zu erwehren.
Richard hatte Geschichten gehört, von Leuten, die von Bären angefallen und gefressen worden waren. Diese beiden sich auf ihn werfenden Männer erinnerten ihn an die Hilflosigkeit, die in diesen Geschichten zum Ausdruck kam, allerdings noch unterlegt von der beängstigenden neuen Dimension menschlicher Bosheit.
Mehrfach waren ihre Zähne kurz davor, sich in sein Fleisch zu graben, doch jedes Mal gelang es Richard, sich ihnen mit einem Ruck zu entwinden, sie mit den Ellbogen fortzustoßen, bevor sie es schafften, ihn mit den Zähnen fest genug zu packen, um Stücke aus ihm herauszureißen. Ihm war unbegreiflich, wieso sie ihn nicht einfach erstachen. Beide führten sie Messer mit, außerdem hatten sie sein Schwert.
Fast schien es, als wüssten sie, wie sie vorgehen wollten, griffen aber aufgrund ihrer Unerfahrenheit weniger hart durch, als sie es sonst vielleicht getan hätten. Trotzdem, auch die nur teilweise erfolgreichen Bemühungen hinterließen klaffende, entsetzlich schmerzhafte Wunden, aus denen das Blut hervorsprudelte. Richard, der vom Kampf unter dem Gewicht der beiden Männer, ganz zu schweigen von seinem Blutverlust, rasch ermüdete, wusste, dass sie mit ihrem Vorhaben unvermeidlich Erfolg haben würden.
Unverständlicherweise hielten die beiden Männer zwischen den Versuchen, Stücke aus ihm herauszureißen, immer wieder kurz inne, um das Blut aufzuschlecken – ganz so, als verdursteten sie und wollten sich nicht einen Tropfen entgehen und im Boden versickern lassen. Wenigstens verschafften diese Unterbrechungen in den Beißattacken Richard eine Verschnaufpause.
Verärgert über sein Unvermögen, ihn in seine Gewalt zu bringen, presste der Größere der beiden Richard einen muskelbepackten Unterarm auf die Kehle und stützte sich mit seinem ganzen Gewicht darauf. Nach Atem ringend, versuchte Richard, sich unter dem gegen seine Kehle drückenden Arm hervorzuwinden. Es war ein grauenhaftes Gefühl, diese beiden Kerle, die ihn mit ihren Zähnen in Stücke zu reißen versuchten, über sich zu haben, bewegungsunfähig zu sein, unfähig, sie abzuschütteln.
Plötzlich rutschte der Arm, der ihn niederdrückte, in all dem Blut ab. Um sich abzustützen, musste der Mann im Vorwärtsfallen eine Hand vorstrecken. Blitzschnell, mit von Angst und Verzweiflung befeuerter Energie, zog Richard seinen vom Blut glitschigen Arm unter dem quer über ihm liegenden Mann hervor und nahm seinen Kopf in den Schwitzkasten.
Dessen Stützarm stieß er mit dem Ellbogen zur Seite. Ohne die abstützende Hand am Boden verlor er sein Gleichgewicht und kippte nach vorn. Richard drückte den Rücken durch, blockte gleichzeitig mit den Knien ab und drehte den Mann gewaltsam auf den Rücken. Endlich in der Stellung, einen Hebel anzubringen, zog Richard den Strick, mit dem seine Handgelenke gefesselt waren, fest um die Kehle des Mannes.
Jede Unze seiner Kraft aufbietend, riss Richard den groben Strick nach hinten und benutzte ihn wie eine Garrotte, um den großen Kerl zu erdrosseln.
Der kam in seiner Überraschung gar nicht mehr dazu, Luft zu holen, ehe Richard ihn in seiner Gewalt hatte. Keuchend rang er nach Luft, während er verzweifelt nach Richards Unterarmen griff. Seine Fingernägel rissen Scharten quer über Richards Haut, doch all das Blut machte Richards Arme so seifig, dass der Mann sich nicht befreien konnte. Unfähig, der Umklammerung zu entrinnen, versuchte er Richard die Augen auszudrücken oder ihm das Gesicht zu zerkratzen, doch das war außer Reichweite, sodass die Finger des Mannes ins Leere griffen.
Nun kam der zweite Seelenfresser seinem Kumpan zu Hilfe. Auch er versuchte, Richards Arme von seinem Gefährten wegzudrehen, vermochte seine Finger jedoch nirgendwo für einen festen Griff unter diese zu schieben. Richard kämpfte um sein Leben und hielt den ersten Mann weiterhin in tödlicher Umklammerung gefangen.
Außerstande, Richards Griff zu brechen, drosch der zweite Kerl mit seinen Fäusten auf Richards Arme ein, um diesen irgendwie dazu zu bringen, dass er seinen Gefährten losließ. In seinen Zorn versunken, nahm Richard die Schläge kaum wahr.
Als der Mann sah, dass seine Bemühungen fruchtlos blieben, wurde ihm rasch klar, dass er etwas anderes versuchen musste. Er schrie seinen Gefährten an, bloß nicht aufzugeben, und schlug mit der Faust nach Richards Gesicht, um ihn zum Loslassen zu bewegen. Doch so, wie Richard den großen Mann fest gegen sich zog, waren die Hiebe nicht direkt genug. Mehrfach glitt seine Faust an Richards Kiefer ab, während er diesen anschrie loszulassen.
Richard hatte nicht die Absicht, dies zu tun. Loszulassen würde seinen sicheren Tod bedeuten.
Der große Mann wand sich wie von Sinnen in Richards Würgegriff, schlug wild mit den Armen um sich, während er verzweifelt etwas zu greifen versuchte, irgendetwas, das ihm helfen würde, sich herauszuwinden oder wenigstens Luft zu holen. Er trat mit den Füßen aus, zielte auf Richards Schienbeine. Der zog die Knie an, um seine Unterschenkel außer Reichweite zu bringen. Die meisten ungezielten Tritte landeten auf dem Boden, und diejenigen, die trafen, waren nicht direkt genug. Die Zähne vor Anstrengung zusammengebissen, riss Richard den Mann noch weiter nach hinten, um sicherzugehen, dass er mit seinen Fersen keinen Schaden anrichten konnte.
Richard erblickte eine ausholende Messerklinge in der blutverschmierten Hand des zweiten Mannes. Er zog den großen Mann über sich, um sich so gut es ging gegen den Messerangriff zu schützen. Wie sinnvoll das war, wusste er nicht, aber es war seine einzige Chance.
Plötzlich gab es einen lauten, knochenzermalmenden dumpfen Schlag. Der Mann zögerte, versuchte sich herumzudrehen. Ein weiterer, schärferer Schlag folgte kurz darauf. Beim dritten regnete es Blut.
Der Mann ließ das Messer fallen und brach kraftlos über dem Mann in Richards Würgegriff zusammen.
Mannomannomann! Was genau passiert war, wusste Richard nicht, er hatte aber auch nicht die Absicht, es herauszufinden. Jetzt, da der zweite Mann von ihm abgelassen hatte, konnte er seine ganze Kraft auf die anstehende Aufgabe konzentrieren. Längst waren die Bewegungen des großen Mannes träge und kraftlos geworden, da ihm nicht nur die Luftzufuhr abgeschnitten wurde, sondern auch die Blutzufuhr zum Gehirn.
Mit einem wütenden Aufschrei verlieh Richard seinen schmerzenden Muskeln neue Kraft. Als das Mühen des Mannes erschlaffte, wechselte Richard rasch den Griff, schlang ihm einen Arm um den Hals und bekam ihn in den Schwitzkasten. So fest er konnte, verdrehte er ihm den Kopf. Als er im stillen Nieselregen den Punkt des Widerstands erreichte, ließ er ein wenig nach, um zusätzliche Kräfte zu sammeln, riss dann den Kopf des Mannes noch fester hintüber. Dann endlich spürte er das Genick brechen. Sofort erschlaffte der gesamte Körper.
Befeuert von seinem Zorn, würgte Richard den Mann weiter, obwohl dieser längst jegliche Gegenwehr eingestellt hatte.
Wie aus dem Nichts langte eine Hand herab und legte sich beruhigend auf seinen Bizeps.
»Schon gut. Er ist tot. Sie sind beide tot.« Es war eine ihm unbekannte Frauenstimme. »Ihr seid in Sicherheit«, sagte sie. »Ihr könnt jetzt loslassen.«
Immer noch vor Anstrengung und Wut keuchend, sah Richard blinzelnd hoch in mehrere schemenhafte, sich über ihn beugende Gesichter.
Soldaten waren es nicht. Nach ihrer schlichten Kleidung zu schließen, schien es sich um Landbewohner zu handeln. Zwei Männer und zwei Frauen beugten sich vor und blickten auf ihn herunter. Ein Stück weit hinter diesen vier drängte eine Handvoll anderer Männer nach vorn. Auch sie schienen Landbewohner zu sein.
3
Nach und nach lockerte Richard den Druck auf den Hals des Toten. Zischend entwich die Restluft aus seiner leblosen Lunge, und sein Kopf fiel schlaff und schief zur Seite.
Einer der über ihm stehenden Männer hob den erschlafften Arm des anderen Toten und zerrte ihn seitlich herunter. Selbst noch im Tod war sein Gesicht zu einer blutgierigen Fratze erstarrt.
Eine Maske aus heruntergelaufenem Blut bedeckte seine eine Gesichtshälfte, aus seinem verfilzten Haar ragten Knochensplitter. Richard sah, dass sein Hinterkopf zertrümmert worden war, von einem großen Stein, den einer der anderen ihn umdrängenden Männer noch immer fest umklammert hielt.
Als der Mann mit dem gebrochenen Genick langsam seitlich herunterzurutschen begann, stieß eine der Frauen, diejenige, die Richard am Arm berührt hatte, den größeren der beiden Toten mit dem Fuß zur Seite. Es war eine Erleichterung, endlich von dem erdrückenden Gewicht befreit zu sein.
Die Frau hob das blutverschmierte Messer auf, das der zweite Angreifer fallen gelassen hatte, als ihm der Schädel eingeschlagen wurde, beugte sich vor und säbelte damit an dem Strick herum, der Richards Hände band. Es war eine Erleichterung, als er sich endlich löste. Während Richard sich die restlichen Strickschlaufen herunterriss und seine blutenden Handgelenke rieb, rutschte sie nach unten und durchschnitt den Strick, der seine Knöchel zusammenband.
»Danke.« Richard war mehr als froh, endlich wieder frei zu sein. »Du hast mir das Leben gerettet.«
»Fürs Erste«, bemerkte einer der Männer in den Schatten.
»Wir hoffen, Ihr werdet uns dieselbe Gunst erweisen«, setzte ein anderer hinzu.
Richard war es schleierhaft, was er meinte, allerdings hatte er im Moment größere Sorgen.
Mit einer verärgerten Geste bedeutete die Frau mit dem Messer den Männern still zu sein, dann richtete sie ihre Aufmerksamkeit erneut auf Richard.
Im schwachen Schein des Vollmonds, der die Wolkendecke erhellte, fiel ihm auf, dass sie mittleren Alters war. Ihr Gesicht war auf ansprechende Weise von feinen Fältchen durchzogen. Es war zu dunkel, um die Farbe ihrer Augen zu erkennen, nicht aber die Unerschrockenheit in ihnen. Auch aus ihrer Miene sprach grimmige Entschlossenheit.
Die Frau beugte sich vor und presste eine Hand auf die Bisswunde seitlich an seinem Oberarm, um die Blutung zu stillen. Dann sah sie auf, und ihre Blicke begegneten sich, während sie weiter Druck auf seine Wunde ausübte.
»Seid Ihr der, der Jit getötet hat, die Heckenmagd?«, fragte sie.
Richard, überrascht von der Frage, nickte und blickte um sich, in die steinernen, ihn anstarrenden Gesichter. »Woher weißt du das?«
Mit ihrer freien Hand strich sich die Frau ein paar Strähnen ihres glatten, schulterlangen Haars aus dem Gesicht. »Vor einer Weile ist ein Junge zu uns gekommen, Henrik. Er erzählte uns, dass er ihr Gefangener gewesen sei und dass sie ihn hatte töten wollen, so wie all die anderen, die sie umgebracht hatte. Er meinte, zwei Leute hätten ihn gerettet und die Heckenmagd getötet, aber die wären jetzt in Schwierigkeiten und bräuchten Hilfe.«
Richard beugte sich vor. »War sonst noch jemand bei ihm?«
»Ich fürchte nein. Da war nur dieser Junge.«
Richard hatte zwar die Heckenmagd getötet, allerdings waren er und Kahlan dabei schwer verwundet worden. Ihre Freunde hatten eine kleine Armee mitgebracht, um die beiden aus dem Bau der Heckenmagd herauszuschaffen und sie nach Hause zu transportieren. Jetzt waren diese Freunde samt und sonders verschollen. Freiwillig, da war er sich sicher, hätte keiner von ihnen Kahlan und ihn auf diese Weise im Stich gelassen.
»Henrik war der Junge, der meinen Freunden berichtet hatte, was geschehen war und wo sie uns finden konnten«, erklärte Richard. »Eigentlich hätten sie bei ihm sein sollen.«
Die Frau schüttelte den Kopf. »Bedaure, aber er war allein. Verängstigt und allein.«
»Hat er euch erzählt, was hier vorgefallen ist?«, fragte Richard. »Euch erzählt, wo unsere Begleiter jetzt sind?«
»Er war außer Atem und auf der panischen Suche nach Hilfe. Er meinte, für Erklärungen wäre keine Zeit. Meinte, wir müssten uns sputen und Euch helfen. Wir sind sofort hergekommen.«
Jetzt, da Richard befreit und die Hektik des Kampfes vorbei war, begann der Schock der Schmerzen ihm ernstlich zu Leibe zu rücken. Mit zitternden Fingern fasste er sich an die Stirn.
»Aber hat er sonst noch was gesagt, irgendwas?«, fragte er. »Es ist wichtig.«
Die Frau blickte in der Dunkelheit um sich, schüttelte dabei den Kopf. »Er meinte, Ihr wärt angegriffen worden und bräuchtet Hilfe. Wir wussten, dass wir uns beeilen mussten. Henrik ist jetzt wieder in unserem Dorf. Sobald wir zurück sind, könnt Ihr ihn selbst befragen. Jetzt müssen wir uns erst einmal vor der Nacht in Sicherheit bringen.« Sie gestikulierte eindringlich zu der Frau hinter ihr. »Gib mir dein Tuch.«
Diese zog es sich sofort vom Kopf und reichte es ihr. Die neben Richard kniende Frau benutzte das Kopftuch wie eine Bandage und wickelte es mehrmals fest um seinen Oberarm. Sie verknotete es rasch, schob dann den Messergriff unter den Knoten und drehte ihn, um den Druckverband festzuziehen. Richard biss vor Schmerzen die Zähne zusammen.
Er schien außerstande, seinen rasenden Puls zu beruhigen, denn er sorgte sich um all seine Begleiter, sorgte sich, was ihnen zugestoßen sein mochte. Er musste zu Henrik und herausfinden, was hier vorging, vor allem aber beschäftigte ihn der Gedanke, Hilfe für Kahlan zu holen.
»Wir sollten uns nicht länger hier draußen aufhalten«, versuchte einer der Männer im Hintergrund die Frau mit ruhiger Stimme zur Eile zu drängen.
»Fast fertig«, antwortete diese, während sie rasch einige seiner offensichtlicheren Verletzungen begutachtete. »Ihr müsst diese Wunden nähen und mit einem Wickel behandeln lassen, sonst werden sie sich morgen entzündet haben«, erklärte sie Richard. »Bisswunden wie diese darf man nicht unbehandelt lassen.«
»Bitte«, sagte Richard und wies mit seinem anderen Arm zum Wagen. »Könnt ihr meiner Frau helfen? Ich fürchte, sie ist schwerer verletzt.«
Auf eine rasche Handbewegung der Frau hin eilten zwei der Männer zum Wagen.
»Ist sie die Mutter Konfessor?«, rief einer der Männer nach hinten, während er nach ihr sah.
Richards Anspannung nahm zu. »Ja.«
»Ich glaube nicht, dass wir hier etwas für sie tun können«, gab er zurück.
Der andere Mann bemerkte das Schwert und hob es vom Boden auf. Sein Blick wanderte über die kunstvoll gefertigte Gold- und Silberscheide und er sah, dass in den Silberfaden, mit dem das Heft umwickelt war, mit einem goldenen Faden das Wort WAHRHEIT eingewoben war.
»Demnach seid Ihr Lord Rahl?«
»Das ist richtig«, antwortete Richard.
»Dann besteht kein Zweifel. Ihr seid die, nach denen wir gesucht haben«, entschied der Mann. »Dieser Junge, Henrik, hat uns erklärt, wer Ihr seid. Wir sind gekommen, um Euch zu holen.«
Richards Sorge ließ nach, als er hörte, dass es Henrik war, der ihnen genau erklärt hatte, wer er und Kahlan waren.
»Es reicht«, sagte die Frau und wandte sich rasch wieder Richard zu. »Ich bin froh, dass wir rechtzeitig hier waren, Lord Rahl. Ich bin Ester. Jetzt müssen wir Euch beide erst einmal in Sicherheit bringen.«
»Richard genügt.«
»Jawohl, Lord Rahl«, sagte sie in Gedanken, so als würde sie nicht länger zuhören, während sie seine Wunden abtastete, um festzustellen, wie tief sie waren.
Sie gab einem der anderen Männer hinter ihr einen Wink. »Du wirst ihm helfen müssen. Er ist schwer verletzt. Wir müssen von hier fort sein, bevor die zurückkommen, die dies getan haben.«
Erleichtert, dass sie endlich bereit war aufzubrechen, eilten mehrere Männer herbei, um Richard aufzuhelfen. Kaum wieder auf den Beinen, bestand dieser darauf, zu Kahlan hinüberzugehen. Von den Männern gestützt, wankte er zum Wagen. Dort sah er, dass Kahlan immer noch bewusstlos war, aber atmete. Die Angst um ihren Zustand zerriss ihn, als er sie mit einer Hand berührte. Ihre Kleider waren von dem schweren Kampf mit der Heckenmagd blutdurchtränkt, und der Gedanke an dieses abscheuliche Geschöpf und was es Kahlan angetan hatte, weckte erneut Richards Wut.
Die Heckenmagd hatte Kahlans Blut getrunken.
Er schob seine Hand durch den langen Schlitz in ihrem Hemd und ertastete die Stelle, wo die Vertrauten von Jit Kahlans Unterleib aufgeschlitzt hatten, um sie zur Ader zu lassen und ihr Blut aufzufangen, damit die Heckenmagd es trinken konnte. Was ihn beschäftigte, war nicht allein die Schwere der entsetzlichen Wunde, sondern auch ihr Blutverlust. Zu seiner Verblüffung entdeckte er an der Stelle nur ein paar geschwollene Falten in ihrer Haut; die lange Narbe war nahezu verheilt.
Da erinnerte sich Richard an die Berührung, die er gespürt hatte – die Berührung einer begonnenen, aber nicht abgeschlossenen Heilung. Zedd oder Nicci mussten Kahlans tiefe Wunde geheilt haben, den übrigen auf ihr noch sichtbaren Wunden konnte er jedoch entnehmen, dass sie, wie bei ihm auch, das Begonnene nicht zu Ende gebracht hatten. Er erinnerte sich, dass es in seinem Fall Niccis heilende Berührung gewesen war, demnach war es vermutlich Zedd gewesen, der mit Kahlans Heilung angefangen hatte. Doch Richard war sich sicher, dass sie weitere schwere Verletzungen haben musste, sonst wäre sie nicht bewusstlos.
»Gib es bei euch jemanden, der ihr helfen kann?«, wollte Richard wissen. »Einen mit der Gabe Gesegneten?«
Ester zögerte. »Wir haben jemanden, der mit der Gabe gesegnet ist und vielleicht helfen kann«, meinte sie schließlich.
Einer der Männer hinter ihr beugte sich näher, fasste sie an der Schulter ihres Kleides, zog sie leicht zurück und sprach leise in ihr Ohr. »Hältst du das für klug?«
Die Frau sah ihn verärgert an. »Was bleibt uns anderes übrig? Sollen wir sie stattdessen sterben lassen?«
Er richtete sich auf, seine einzige Antwort ein Seufzen.
»Aber wir müssen uns beeilen«, sagte Ester. »Sind sie erst tot, kann sie sie nicht mehr heilen.«
»Abgesehen davon«, erinnerte sie ein anderer, »müssen wir uns alle vor der Nacht in Sicherheit bringen.«
Auf seine Bemerkung hin blickten die anderen in der Dunkelheit um sich. Sie alle, fiel Richard auf, schienen horrende Angst zu haben, sich nach Einbruch der Dunkelheit im Freien aufzuhalten. Früher, als er noch Waldführer gewesen war, hatte er des Öfteren Landbewohner aufgesucht. Das Bedürfnis, sich nach Sonnenuntergang einzuschließen, war unter ihnen recht verbreitet. In entlegenen Gebieten neigten die Menschen eher zu Aberglauben, und ihnen allen gemein war die Angst vor Dunkelheit.
Auch wenn er zugeben musste, dass die Ängste dieser Menschen zweifellos real und berechtigt waren.
Richard sah zu, wie mehrere Männer Kahlan behutsam hochhoben und sie dann dem größten von ihnen über die Schulter legten. Richard hätte sie gern selbst getragen, wusste aber, dass er nicht einmal alleine laufen konnte. Widerstrebend ließ er zu, dass zwei der Männer ihn unter den Armen stützten und ihm halfen, sich auf den Beinen zu halten.
Im schwachen Mondlicht und dem goldenen Schein der Laternen, die mehrere der Dorfbewohner dabeihatten, schaute Richard nach hinten, hinter den Wagen, und gewahrte zum ersten Mal die zahllosen Leichen. Das waren keine Soldaten der Ersten Rotte. Seltsam blasse, halb nackte Gestalten lagen überall dahingestreckt am Boden. Angesichts ihrer klaffenden Wunden schien sich die Erste Rotte einen erbitterten Kampf geliefert zu haben. In Anbetracht der großen Zahl der Toten war es kein Wunder, dass die feuchte Luft nach Blut und Grind roch.
Ganz in der Nähe, gleich hinter der Wagenecke, lag ein Toter mit weit offenem Mund ausgestreckt auf dem Rücken. Seine toten Augen starrten in den dunklen Nachthimmel.
Seine Zähne waren zu Spitzen abgefeilt.
Richards Großvater Zedd und die Hexenmeisterin Nicci hatten Elitesoldaten mitgebracht, um Richard und Kahlan sicher zum Palast des Volkes zurückzubringen. Keiner von ihnen hätte die beiden je im Stich gelassen. Richard ließ den Blick suchend über die zwischen den überall am Boden umherliegenden Uniformteilen, Rangabzeichen und Waffen der Ersten Rotte verstreuten Knochen schweifen. Es war ein grauenhafter Anblick, aber er sah nichts, das Zedd, Nicci oder Cara zu gehören schien.
Cara, seine und Kahlans persönliche Leibwächterin, war eine Mord-Sith. Sie hätte ihn niemals im Stich gelassen, aus keinem Grund außer ihrem eigenen Tod, und selbst dann wäre sie vermutlich aus dem Totenreich zurückgekommen, um ihn zu beschützen.
Er befürchtete, irgendwo da draußen in der Dunkelheit, wo er sie nicht sehen konnte, inmitten all der Toten, lagen die Gebeine all derer, die ihm so viel bedeuteten. Die Panik angesichts der Vorstellung, alle verloren zu haben, die ihm nahestanden, schnürte ihm die Brust zusammen.
»So beeilt euch doch«, drängte Ester die Männer, die Richard stützten. »Er blutet stark. Wir müssen zurück.«
Die anderen waren mehr als froh, den Anblick von so viel Tod endlich hinter sich lassen und sich wieder in Sicherheit bringen zu können.
Richard ließ sich von den Männern halb zu einem schmalen Pfad tragen, der durch die Wand aus Bäumen hindurch und in die Nacht führte.
4
Auf ihrem forschen Marsch durch einen Wald, so dicht, dass der Boden des Pfades vom Mondlicht nahezu unberührt blieb, hielten alle um ihn herum das sie umgebende Dunkel aufmerksam im Blick. Auch Richards Blicke suchten den Wald ab, konnten aber jenseits des schwachen Laternenscheins kaum etwas erkennen. Unmöglich zu sagen, was sich in den schwarzen Tiefen der Wälder verbergen mochte, unmöglich zu sagen, ob diese rätselhaften, halb nackten Gestalten, die seine Freunde abgeschlachtet hatten, ihn womöglich verfolgten.
Jedes Geräusch erregte seine Aufmerksamkeit und zog seinen Blick auf sich, jeder Zweig, der ihn streifte oder sich an seinem Hosenbein verfing, beschleunigte seinen Herzschlag.
Soweit er erkennen konnte, führten seine Begleiter nichts weiter mit sich als ganz gewöhnliche Messer. Um seinen Angreifer auszuschalten, hatten sie sich eines Steins bedient. Hier, auf diesem dunklen Pfad, würde er nur äußerst ungern einer Horde dieser Schlächter begegnen und sich ihrer mit wenig mehr als ein paar Steinen erwehren müssen.
Er war froh, den verzierten Waffengurt aus Leder wieder über seiner rechten Schulter zu spüren, das Schwert an seiner linken Hüfte. Zur Beruhigung berührte er das vertraute Heft von Zeit zu Zeit gedankenverloren, auch wenn ihm klar war, dass er kaum in der Verfassung war für einen Kampf.
Trotzdem, allein die Berührung dieser uralten Waffe rüttelte die ihr innewohnende Kraft wach, den stillen Sturm des in ihr eingeschlossenen Zorns, und gleichzeitig dessen Gegenpart in seinem, Richards Innerem, und verleitete ihn, sie auf den Plan zu rufen. Es war ein beruhigendes Gefühl, jederzeit über diese verlässliche Waffe und die dazugehörige Kraft verfügen zu können.
Da einige Dorfbewohner Laternen mitführten, suchte Richard die Schwärze nach dem Widerschein von Augen ab, der jenseits des begrenzten Radius des Lichtkegels die Anwesenheit und Position von Tieren verraten würde. Und obwohl er tatsächlich ein paar kleinere Tiere ausmachen konnte, Frösche etwa, einen Waschbären sowie einige Nachtvögel, sah er keine Augen von größeren, sie womöglich beobachtenden Tieren. Natürlich war es immer möglich, dass sich in den dichten Farnbüscheln oder Sträuchern, oder hinten, zwischen den Baumstämmen, irgendetwas Größeres verbarg und Richard dies einfach übersah.
Und natürlich wäre in dem Fall, dass ihre Beobachter Menschen waren, kein solcher Widerschein zu sehen gewesen.
Da in den schwarzen Tiefen des Waldes praktisch unmöglich irgendetwas zu erkennen war, verließ er sich als Warnung vor möglichen Gefahren stattdessen auf Geräusche und Gerüche. Doch außer dem Duft von Balsam, Farn und ebenjenem dichten Bodenbelag aus Kiefernnadeln, trockenem Laub und Streu roch er nichts. Die einzigen Geräusche, die er hörte, waren das Summen der Insekten und ab und zu der schrille Ruf eines Nachtvogels. Gelegentlich hallten ferne, schwache Rufe von Kojoten durch die Berge.
Während des Fußmarschs unterließen es die Leute, die Richard und Kahlan in die Sicherheit ihres Dorfes brachten, miteinander zu sprechen. Die wachsame Gruppe marschierte zügig, dabei nahezu lautlos, so wie es nur jemand konnte, der sein ganzes Leben in den Wäldern zugebracht hatte. Selbst der Mann vorneweg, der Kahlan trug, war kaum zu hören, während er sich den Pfad entlangbewegte. Richard, der nicht gut zu Fuß war und trotz der beiden ihn stützenden Männer das Tempo verschleppte, machte mehr Lärm als jeder andere, konnte aber wenig dagegen tun.
Angesichts der seltsamen menschlichen Leichname, die er in der Nähe des Wagens gesehen hatte, ganz zu schweigen von den beiden Männern, die ihn angegriffen hatten, den Dingen, die er zufällig aufgeschnappt hatte, wie auch den Warnungen, die er vorab über das Vordringen in die Dunklen Lande erhalten hatte, waren die Nervosität und übergroße Vorsicht dieser Leute nur zu verständlich. Seine beiden Angreifer wiesen keinerlei Ähnlichkeit mit den Toten auf, die er gesehen hatte. Wenn diese beiden Männer recht hatten, dann gehörten die Toten jenem rätselhaften Volk an, von dem sie gesprochen hatten, den Shun-tuk.
Anders als bei den Landbewohnern, die Richard aus seiner Heimat kannte, schienen die Befürchtungen seiner Begleiter nicht allein auf primitivem Aberglauben zu beruhen.
Er wusste es zu schätzen, wenn Menschen reale Gefahren ernst nahmen. Meist waren es die mutwillig Unwissenden – Menschen, die die Existenz von Schwierigkeiten nicht wahrhaben wollten –, die durch ihr grundsätzliches Leugnen Ärger erst heraufbeschworen. Es war unmöglich, auf Dinge vorbereitet zu sein, die man niemals in Betracht gezogen hatte, mit denen zu befassen man sich weigerte. Angst war mitunter ein wertvolles Mittel im Überlebenskampf, weshalb Richard es für töricht hielt, sie zu ignorieren. Gleichwohl war ihm ihre leichte Bewaffnung Anzeichen dafür, dass sie die Gefahren wohl doch nicht ernst genug nahmen.
Entweder das, oder die Gefahren, denen sie sich gegenübersahen, waren neu für sie.
Nicht lange, und sie verließen unvermittelt die beengende, bedrückende Dunkelheit des Waldes und gelangten in offenes Gelände. Ein zarter Nebel, hervorgerufen durch kühlere Luft, legte sich feucht auf Richards Gesicht.
In der Ferne, jenseits der leicht geschwungenen Hügellandschaft vor ihnen, erblickte Richard eine vom gedämpften Mondschein beschienene Wand aus nacktem Fels. Auf halber Höhe der Klippenwand, in Höhlengängen, die offenbar bis tief in den Fels reichten, konnte er ein schwaches, flackerndes Licht erkennen, vermutlich von Kerzen oder Laternen.
Auf seinem Weg geradewegs auf diese Felswand zu führte der Pfad zwischen ausgedehnten Feldern hindurch, einige bepflanzt mit Getreide, andere mit Gemüse. Kaum befanden sie sich inmitten der sich vor dem Sockel der hoch aufragenden Felswand erstreckenden Felder, fühlten sich seine Begleiter sicher genug, um untereinander zu tuscheln anzufangen.
Als sie sich der Felswand näherten, stießen sie auf Pferche, errichtet aus gespaltenen Geländerbalken, die teils Schafe, teils ziemlich magere Schweine enthielten. In der Ecke eines Geheges drängten sich ein paar Milchkühe zusammen. Längliche Verschläge, zwischen den von der über ihnen aufragenden Felswand herabgefallenen Felsbrocken gelegen, schienen für Hühner bestimmt, die sich zweifellos für die Nacht auf ihre Stangen zurückgezogen hatten. Richard sah ein paar Männer, die die Tiere versorgten.
Einer von ihnen kümmerte sich gerade um die Schafe, gab ihnen einen Klaps auf den Rücken, damit sie zur Seite gingen, während er sich einen Weg durch die kleine, aber dichte Herde bahnte, die sich in dem großen Pferch zusammendrängte.
»Was gibt’s denn, Henry?« erkundigte sich Ester beim Näherkommen. »Was tut ihr Männer hier unten zu dieser nächtlichen Stunde?«
Der Mann konnte nicht umhin, die Fremden, die man herbrachte, für einen kurzen Moment anzustarren: einen Mann, den man beim Gehen stützte, und eine Frau mit langem Haar, die über den Schultern eines Mannes lag. Er wies mit einer Handbewegung auf das ordentliche Gitternetz aus Pferchen.
»Die Tiere sind unruhig.«
Richard sah über seine Schulter. Seine Linke ruhte auf dem vertrauten Heft seines Schwertes, als sein Blick über die Felder zwischen ihnen und der dunklen Masse der Wälder schweifte. Er bemerkte nichts Ungewöhnliches.
»Ich denke, ihr lasst besser von den Tieren ab und begebt euch nach drinnen«, sagte er, während sein Blick suchend über die dunkle Baumreihe glitt.
Die Stirn gerunzelt, nahm der Mann seine Strickkappe ab und kratzte sich in seinem schütteren weißen Haar. »Und wer, bitte, seid Ihr, dass Ihr mir sagt, was ich mit unseren Tieren tun soll?«
Achselzuckend blickte Richard sich zu dem Mann um, legte dann aber, als er seine Beine nachgeben spürte, seinen Arm wieder um die Schulter eines der Männer neben ihm. »Nur jemand, der es nicht mag, wenn Tiere unruhig sind, außerdem habe ich diese Nacht schon eine Menge furchteinflößender Dinge gesehen – und das gar nicht so weit hinter uns.«
»Er hat recht«, sagte Ester und machte sich wieder auf den Weg in Richtung Felswand. »Am besten, du gehst mit uns zusammen hoch nach drinnen.«
Henry setzte seine Kappe wieder auf und warf einen besorgten Blick hinüber zu der stillen Wand aus Bäumen, direkt hinter dem fernen Rand der Felder. Die hohen Föhren sahen aus wie Wächter, die dem Mondlicht das Eindringen verwehrten.
Mit einem Nicken gab er sich geschlagen. »Ich werde die anderen gleich hinter euch nach oben bringen.«
5
Gestützt von den beiden Männern rechts und links, folgte Richard hinter Ester, die wiederum gleich hinter dem Mann ging, der Kahlan trug. Ein Mann mit einer Laterne, vorne an der Spitze der kleinen auf die Felswand zusteuernden Gruppe, sah sich hin und wieder um und achtete darauf, dass keiner zurückblieb.
Kahlan, das Haar blutverkrustet, hing mit baumelnden Armen schlaff und bewusstlos über der Schulter des Mannes, der sie trug. Im Mondschein konnte Richard die Wunden erkennen, hervorgerufen durch die Dornenranken, mit deren Hilfe die Heckenmagd sie gefesselt und gefangen gesetzt hatte. Blut aus diesen und anderen Wunden tropfte ab und an von ihren Fingerspitzen.
Diese Dornenranken mussten mit einer Substanz bedeckt gewesen sein, die verhinderte, dass sich die Wunden richtig schlossen, denn auch aus seinen sickerte noch immer Blut. Immerhin hatte er die Heckenmagd töten können, ehe sie Kahlan vollends hatte ausbluten lassen. Seine Frau war schwer verletzt, lebte aber wenigstens noch.
Er hatte während des ganzen Weges durch den Wald zum Dorf das dringende Bedürfnis verspürt, anzuhalten und sie eigenhändig zu heilen – auch wenn er wusste, dass er für die Bewältigung einer solchen Aufgabe gar nicht in der Verfassung war. Es hätte dafür aufseiten der die Heilung durchführenden Person einer Vielzahl von Kräften bedurft, Kräfte, die er derzeit nicht besaß. Vernünftiger war es, jemanden zu finden, der ihr half.
Sobald er Kahlan in Sicherheit wusste, würde er in Erfahrung bringen müssen, was den Soldaten der Ersten Rotte und den Freunden in ihrer Begleitung zugestoßen war.
Als sie sich dem Fuß der Felswand näherten, bahnte sich die kleine Gruppe einen Weg durch ein ausgedehntes Geröllfeld – im Laufe der Zeit entstanden durch aus der Felswand abgespaltenes Gestein, das sich unten angesammelt hatte. An manchen Stellen mussten Richards im Gänsemarsch gehenden Begleiter sich unter massiven Felsplatten hinwegducken, die von der Bergflanke herabgefallen waren und nun auf dem Chaos aus Gesteinstrümmern ruhten.
Richard war überrascht, die Leute vor ihm einen schmalen Pfad in Angriff nehmen zu sehen, der direkt die Stirnseite der Felswand hinaufführte. Verborgen hinter einem Gestrüppgewirr, wäre er leicht zu übersehen gewesen, hätte er nicht beobachtet, wie die vor ihm Gehenden ihn emporzusteigen begannen.
Er war davon ausgegangen, dass sie vielleicht Leitern hätten, die zu den bewohnten Höhlen hinaufführten, oder sogar einen Höhlengang im Innern des Bergmassivs, doch offenbar gab es nur einen Weg nach oben: über den aus natürlichen Klippen und Vorsprüngen in der Felswand bestehenden Pfad. Wo es keine natürlichen Tritte gab, hatte man das Gestein offenbar mit großem Aufwand abgetragen. Im spärlichen gelblichen Schein der Laternen, die einige der vorne Gehenden trugen, konnte er erkennen, dass das Gestein glattgetreten war – von Menschen, die, vermutlich schon seit Jahrtausenden, beim Erklimmen der Felswand diesen Pfad emporgestiegen waren.
»Was ist das für ein Ort?«, erkundigte sich Richard mit leiser Stimme.
Ester sah über ihre Schulter. »Unser Dorf, Stroyza.«
Richard stockte kurz. Er fragte sich, ob sie wusste, was der Name bedeutete. Es gab nur noch wenige Zeitgenossen, die Hoch-D’Haran verstanden. Einer von ihnen war er selbst.
»Und wieso lebt ihr hier oben? Warum baut ihr nicht unten zwischen den Feldern, dann müsstet ihr nicht ständig diese tückische Felswand rauf- und runterklettern?«
»Es ist der Ort, wo unser Volk schon immer gelebt hat.« Als ihm das als Begründung nicht zu genügen schien, zeigte sie ihm ein nachsichtiges Lächeln. »Meint Ihr nicht, sie wäre ebenso tückisch für jeden, der uns des Nachts überfallen wollte?«
Richard blickte zu den tanzenden Punkten aus Laternenschein weiter vorn hinüber, wo die Leute sich behutsam einen Weg nach oben bahnten. Der Pfad war nicht annähernd breit genug, um ihn auf beiden Seiten zu stützen, weshalb einer der Männer unmittelbar hinter ihm ging, bereit, ihn abzusichern, falls er stolpern sollte. Zum Glück hatte man an besonders engen Stellen eiserne Handgriffe in die Felswand getrieben.
Leider befanden sich diese auf der linken Seite, und seinen bandagierten linken Arm hatte es am schlimmsten erwischt. Er hatte solche Schmerzen, dass seine Finger kaum die Eisengriffe packen konnten, sodass er manchmal mit der Rechten hinüberlangen musste, was das Kraxeln zusätzlich erschwerte. Der hinter ihm gehende Mann hielt sich mit einer Hand an den Eisengriffen fest und stützte Richard mit der anderen, um zu verhindern, dass er stürzte. Der Blick in die Tiefe offenbarte im blassen Mondschein einen schwindelerregenden Abgrund.
Als sie endlich oben ankamen, wartete dort eine kleine Abordnung der Dorfbewohner, um sie zu begrüßen. Als Richard auf die freie Fläche trat, wich die Gruppe zurück, um den Eintreffenden Platz zu machen. Er konnte sehen, dass der geräumige, natürlich entstandene Hohlraum sich stellenweise zu mehreren höhlenähnlichen Gängen verjüngte, die tiefer in das Bergmassiv hineinführten. Besorgnis lag auf den Gesichtern der Leute, als sie sahen, wie die verletzten Fremden hereingebracht wurden.
Mehrere Katzen kamen aus dem Dunkeln hervor, um die Rückkehrer aus dem Dorf zu begrüßen. Hinten in den Höhlengängen erblickte Richard weitere dieser scheuen Geschöpfe. Die meisten von ihnen waren schwarz.
»Wir sind froh, euch alle wieder wohlbehalten hier zu sehen«, begrüßte sie einer der Wartenden. »Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, weil ihr so lange nach Einbruch der Dunkelheit noch draußen wart.«
Ester nickte. »Ich weiß. Es war nicht zu ändern. Zum Glück haben wir sie gefunden.«
Ehe Ester ihn vorstellen konnte, erspähte Henrik sie und kam aus dem Schutz der Schatten angelaufen, um sie zu begrüßen.
»Lord Rahl! Lord Rahl! Ihr lebt!«
Ein erstauntes Raunen ging durch die kleine Abordnung der Dörfler. Offenbar waren nicht alle im Dorf darüber unterrichtet worden, wen die Gruppe zu bergen aufgebrochen war.
»Lord Rahl … der Herrscher des D’Haranischen Reiches?«, fragte ein Mann, während sich das Getuschel weiter unter den Versammelten ausbreitete.
Trotz seiner Schmerzen nickte Richard. »Ganz recht.«
Als sie Anstalten machten, auf ein Knie runterzugehen, unterband Richard die Ergebenheitsbezeugung kurzerhand mit einer Geste. »Nichts dergleichen, bitte.«
Während sich alle zögernd wieder erhoben, rang sich Richard ein Lächeln für den Jungen ab. »Ich bin erleichtert zu sehen, dass du wohlauf bist, Henrik.«
Der Mann, der Kahlan trug, ließ ihren schlaffen Körper von der Schulter gleiten. Sofort eilten mehrere Leute herbei, um zu helfen.
Ester stellte rasch ein paar der Dorfbewohner vor, die sich um sie geschart hatten, brach dann aber vorzeitig ab. »Wir müssen sie nach drinnen schaffen. Sie sind beide schwer verletzt. Wir müssen ihre Verletzungen versorgen.«
Unter den Blicken mehrerer Katzen folgte ihr die kleine Menschenansammlung, als Ester sie kurzerhand nach hinten in einen der breiteren Höhlengänge führte. In die natürlichen Spalten und Risse entlang des Weges in den hinteren Teil der Höhle war eine ganze Reihe von Räumen gebaut worden. Viele dieser Räume, wie auch das Labyrinth aus Höhlengängen, waren aus dem weichen Gestein gegraben worden. Allerdings hatte man, um die Lücken auszufüllen, einige davon mit Frontseiten aus vermörtelten Steinmauern versehen. Einige Unterkünfte hatten Holztüren, andere waren mit Tierfellen verhängt, sodass eine aus kleinen Behausungen bestehende Gemeinde entstand.
Die wabenähnlichen Wohnstätten in diesem engen, unübersichtlichen Bau schienen auf ein karges Dasein hinzudeuten, Richard nahm jedoch an, dass die Sicherheit dieses so hoch droben im Innern des Berges gelegenen Dorfes dies mehr als wettmachte. Die Kleider, die die Leute um ihn herum trugen, kündeten ebenfalls von einer asketischen Lebensweise in ihrem kleinen Dorf. Sie alle trugen die gleiche Art von grob gewebtem Stoff, der bestens mit der Farbe des Gesteins harmonierte.
Ester zupfte eine vor ihr gehende Frau am Ärmel und beugte sich zu ihr. »Hol Sammie her.«
Die Frau blickte fragend über ihre Schulter. »Sammie?«
Ester bejahte dies mit einem entschlossenen Nicken. »Die beiden müssen dringend geheilt werden.«
»Sammie?«, fragte die Frau noch einmal.
»Ja, und beeil dich. Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
»Aber …«
»Geh schon«, kommandierte Ester mit einer Handbewegung. »Beeil dich. Ich werde sie zu mir bringen.«
Während die Frau davoneilte, um die von Ester verlangte Hilfe zu holen, drängte die Gruppe in einen engeren Höhlengang hinein und gelangte schließlich zu einer mit einem schweren Behang aus Schaffell verhängten Türöffnung. Ester und mehrere andere traten gebückt ein. Einer der Männer zündete, kaum hatte er den kleinen Raum betreten, sogleich Dutzende von Kerzen an. Derbe, aber farbenfrohe Teppiche bedeckten den Boden und bildeten einen deutlichen Kontrast zu dem schlichten Holztisch, den drei Stühlen und einer seitlich stehenden Kiste. Die einzigen anderen Sitzgelegenheiten boten Kissen, gefertigt aus einem ähnlich schmucklosen Material, aus dem auch ihre Kleidung bestand.
Ester dirigierte die Männer, die Kahlan trugen, zur einen Seite des Raums hinüber, wo diese sie behutsam auf einem mit einer Anzahl schlichter, abgenutzter Kissen gepolsterten Lammfell ablegten. Die Männer bei Richard halfen ihm, sich, an mehrere Kissen gelehnt, auf den Boden zu setzen.
»Wir müssen sofort mit der Versorgung Eurer Verletzungen beginnen«, erklärte Ester Richard und wandte sich dann um zu einigen der Frauen, die ihnen nach drinnen gefolgt waren. »Holt warmes Wasser und ein paar Tücher. Wir werden einen Wickel zurechtmachen müssen. Bringt auch Verbände und Nadel und Faden mit.«
Als die kleine Gruppe von Frauen wieder aus dem bescheidenen Quartier nach draußen eilte, um ihren Anordnungen Folge zu leisten, kniete Ester neben Richard nieder. Mit sanfter Hand hob sie seinen Arm behutsam an und lockerte den Druckverband, um einen Blick unter die blutdurchtränkte Bandage werfen zu können.
»Die Farbe Eures Arms gefällt mir gar nicht«, meinte sie. »Diese Bisswunden müssen ausgewaschen werden. Einige müssen genäht werden.« Sie blickte hoch in seine Augen. »Außerdem braucht Ihr fähigere Hilfe.«
Richard wusste, was sie meinte: Um ihn zu heilen, bedurfte es einer mit der Gabe gesegneten Person. Er nickte, lehnte sich zur Seite und strich Kahlan behutsam einige Haarsträhnen aus dem Gesicht, sodass er die Innenseite seines Handgelenks an ihre Stirn legen konnte. Sie fühlte sich fiebrig an.
»Ich kann warten«, meinte er. »Ich möchte, dass du dich zuerst um die Mutter Konfessor kümmerst.«
Als er sich wieder Ester zuwandte, hatten ihre Züge einen angespannten Ausdruck angenommen. Offensichtlich befürchtete sie, dass er es war, der sofort Hilfe brauchte.
Richard milderte seinen Ton. »Ich bin für alles dankbar, was du und deine Leute getan haben, aber bitte, ich möchte, dass du zuerst meiner Gemahlin hilfst. Du hast ja recht, meine Bisswunden müssen dringend versorgt werden, aber sie ist bewusstlos und offensichtlich in großer Gefahr. Vielleicht können meine Wunden ja genäht und verbunden werden, während eure mit der Gabe gesegnete Person erst einmal dafür sorgt, dass der Mutter Konfessor geholfen wird. Bitte, ihr Zustand macht mir große Sorgen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass sie wieder gesund wird.«
Für einen kurzen Moment sah Ester ihm wieder in die Augen, dann lächelte sie schüchtern. »Verstehe.« Sie wandte sich herum und machte eine schnelle Handbewegung. »Peter, bitte geh und sorg dafür, dass Sammie so schnell wie möglich herkommt.«
6
Richard ließ von Kahlan ab, als er draußen in den Gängen Leute kommen hörte. Die erste Frau, die unter dem Schaffell des Türdurchgangs hindurchtauchte, hatte einen Eimer Wasser dabei. Die anderen Frauen brachten einen zweiten Wassereimer mit, dazu Verbände sowie weitere Utensilien.
Zu seiner Überraschung sah er als Nächstes einige ältere Frauen eintreten, die ein hauchzartes Geschöpf hereinführten, das gerade erst am Beginn der Blüte zur vollen Weiblichkeit stand. Eine Mähne langen schwarzen Haars rahmte ihr schmales Gesicht. Die dunklen Augen staunend geweitet, stand sie etwas schüchtern inmitten der Gruppe der sie behütenden Frauen. Die glatte Haut ihres schmalen Gesichts hinter der Masse ihrer dunklen Locken wirkte im Schein der Kerzen blass, sehr blass.
Ester erhob sich und wies hinter sich auf Richard. »Sammie, das hier ist Lord Rahl. Die Frau, die dort liegt, ist seine Gemahlin, die Mutter Konfessor. Die beiden sind schwer verletzt und brauchen deine Hilfe.«
Die dunklen Augen des Mädchens sahen kurz nach unten, um Kahlan in Augenschein zu nehmen, ehe sie den Blick wieder auf Ester richtete. Auf deren Drängen trat sie zögernd einen Schritt vor, lupfte den Saum ihres Kleides rechts und links und vollführte einen ungelenken Knicks vor Richard.
Richard konnte unschwer erkennen, dass sie nicht bloß schüchtern war, sie hatte Angst vor ihm. Geboren und aufgewachsen in einem derart kleinen, abgelegenen Ort, bekam sie wahrscheinlich nur selten Fremde zu Gesicht, erst recht nicht solche wie ihn. Um sie zu beruhigen, zwang er sich trotz seiner Schmerzen und seiner Sorge um Kahlan zu einem freundlichen Lächeln.
»Danke, dass du gekommen bist, Sammie.«
Sie nickte, die dünnen Arme um ihren Körper geschlungen, zog sich dann ohne ein Wort der Erwiderung wieder in die Obhut der älteren Frauen zurück.
»Sammie, würdest du uns bitte einen Augenblick entschuldigen?« Er sah hoch zu Ester. »Könnte ich dich unter vier Augen sprechen?«
Ester ahnte offenbar, warum er sie alleine sprechen wollte. Als Antwort rang sie sich ein dünnes Lächeln ab, ehe sie das kleine Grüppchen wieder Richtung Tür drängte. Die Frauen schienen verwirrt und zögerten, als Ester sie hinausscheuchte, gehorchten aber dann. Sie hatten den Raum kaum verlassen, als Ester den Durchgang wieder mit dem Schaffell verhängte.
»Lord Rahl, mir ist klar, dass …«
»Sie ist ein Kind.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: