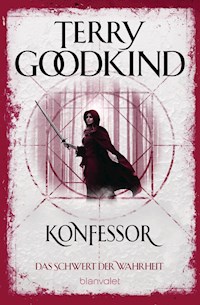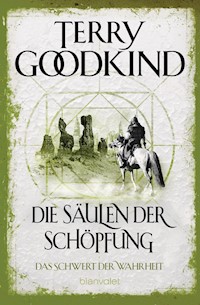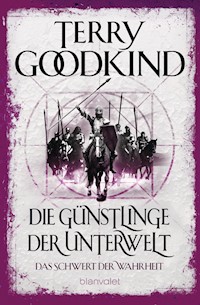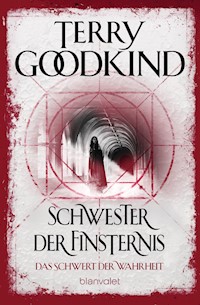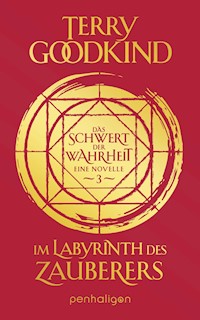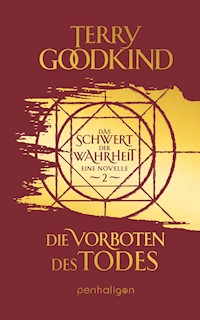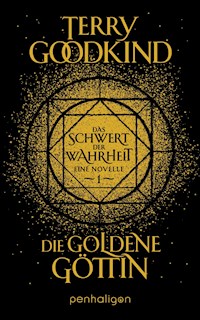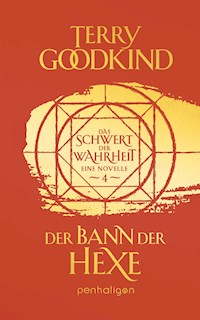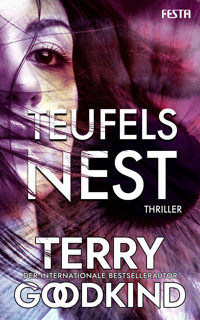
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erkenne das Böse … Der Mord an ihrem Bruder reißt Kate Bishop aus ihrem konventionellen Leben. Überdies gesteht die leitende Ermittlerin, dass sie Kates Bruder gut kannte. Er verfügte über eine besondere Gabe: Er half ihr, Mörder zu identifizieren … Kurz darauf wird Kate von Jack kontaktiert, einem Schriftsteller. Er behauptet, die Antworten auf ihre Fragen zu kennen. Was Kate nicht weiß: Jack operiert mit internationalen Geheimdiensten und ist einer globalen Bedrohung auf der Spur – eine Bedrohung, die auch Kates Tod sein könnte. Schonungslos dringt Bestsellerautor Terry Goodkind in einen Bereich der Evolution vor, der absolut mörderisch ist. Writersafterdark.com: »Düster, erschreckend. Kann man nicht aus der Hand legen.« Publishers Weekly: »Ein packender Ritt.« Nelson DeMille: »Raubt den Lesern den letzten Atem!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe The Nest
erschien 2016 im Verlag Skyhorse Publishing.
Copyright © 2016 by Terry Goodkind
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Lektorat: Tammo Hobein
Titelbild unter Verwendung eines Motivs von Adobe Stock/tinofotografie
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-971-8
www.Festa-Verlag.de
Für Jeri, die Liebe meines Lebens.
Für ihre standhafte Unterstützung und dafür, dass sie so geduldig gewartet hat, bis dieses ganz besondere Buch endlich das Licht der Welt erblickte.
1
Vor drei Wochen hatte John Allen Bishop den Teufel in seinem Keller angekettet. Was genau diesen nach Chicago geführt hatte, wusste John nicht, und der Teufel verriet es ihm nicht. Aber dafür wusste er, dass die Situation im Laufe der letzten Tage immer besorgniserregender geworden war.
Zuerst hatte der Gefangene die schlimmsten Drohungen, die man sich vorstellen konnte, zu ihm hinaufgerufen – Dinge, die John vom Leibhaftigen erwartet hätte. Aber in den letzten paar Tagen hatte sich etwas verändert. In diesen langen, leisen Momenten, wenn die Sonne unterging und die Welt still wurde, hatte John sich näher zur Kellertür geschoben, sich vorsichtig herangebeugt und den Hals gereckt, um sein Ohr an den schmalen Türspalt zu legen, hinter dem die Dunkelheit lag.
Da hatte er das Flüstern zum ersten Mal gehört.
Weil die Bodendielen knarrten, wusste der Teufel immer, wann er in der Küche war und sich in der Nähe der Treppe befand. Wenn John sein Ohr an den Türspalt legte, begrüßte ihn der Teufel und nannte ihn beim Namen. Manchmal lachte er leise vor sich hin. Seine geflüsterten Versprechen sorgten dafür, dass John einen trockenen Mund bekam.
Aber jetzt war die bedrohliche Präsenz im Keller unerklärlicherweise verstummt. Das Schweigen bereitete ihm mehr Sorgen, als es das Flüstern getan hatte.
Er ging zwischen Kühlschrank und Spüle hin und her und überlegte, was er tun sollte. Der Gedanke, wieder dort hinunterzusteigen, behagte ihm ganz und gar nicht. Die Kette war stark genug, da war er ganz sicher, und er wusste auch, wie lang sie war. Auf den Zentimeter genau. Trotzdem wollte er erst hinuntergehen, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ.
Während er auf und ab ging, summte die Neonröhre über dem Spülbecken voller schief aufeinandergestapelter, schmutziger Teller. Ein Bündel verkrusteter Gabeln, die auf eine Wäsche warteten, ragte aus einem rissigen grünen Plastikbecher hervor. Normalerweise legte John großen Wert auf Sauberkeit, aber nach den schlimmen Ereignissen der letzten Zeit hatte er nicht das Gefühl, sich wegen des liegen gelassenen Geschirrs schämen zu müssen.
Die Teller würden warten müssen; der Teufel war wichtiger.
Er wandte sich von dem Durcheinander in der Spüle ab, ging wieder auf den Kühlschrank zu und legte denselben Weg zurück, den er seit einer Stunde ging. Das Gefühl der Reue wuchs und mit ihm das vertraute Gewicht der Unentschlossenheit. Er wusste nicht, wie er überhaupt jemals auf diese verrückte Idee gekommen war.
Er hatte die Sache nicht sorgfältig genug durchdacht. Das wurde ihm jetzt klar. Er hätte gründlicher nachdenken sollen. Die Leute sagten immer zu ihm, dass er das tun sollte.
Aber was hätte er sonst tun können? Es war so unerwartet gekommen. Er war zum Handeln gezwungen gewesen. Der Teufel wusste Dinge – zu viele.
Zuerst kam es ihm einfach vor. Wenn er den Dämon in Ketten legte, würde die Welt in Sicherheit sein.
Kate würde sicher sein.
Aber dann hatte sich herausgestellt, dass es doch nicht so einfach war.
John sagte sich, dass er nach unten gehen und dem Teufel den Schädel einschlagen sollte. Er wusste, dass er das tun sollte. Im Keller befanden sich Werkzeuge – natürlich jenseits der Reichweite, die die Kette bot. Dort war ein Vorschlaghammer, der für diesen grässlichen Zweck gut geeignet war.
Aber dazu fehlte ihm der Mut. Er hätte es schon am Anfang tun sollen, als der Teufel bewusstlos gewesen war, aber auch dann hatte er sich nicht getraut. Noch während er sich innerlich darauf vorbereitete, zu tun, was nötig war, begriff er, dass er seine Chance bereits verpasst hatte.
Er fragte sich, ob er Detective Janek anrufen sollte. Von Zeit zu Zeit kam sie zu ihm, um ihm die Bilder zu zeigen. Sie war nett. Er half ihr gern.
Er warf einen Blick zum Telefon, das im Flur an der Wand hing. Die Visitenkarte von Detective Janek stand an die Wand gelehnt auf dem Telefon. Sie hatte sie eines Tages dort gelassen und ihm mitgeteilt, dass er sie jederzeit anrufen könne, Tag und Nacht.
Er fragte sich, ob er dies möglicherweise jetzt tun sollte.
Aber John benutzte das Telefon nicht gern. Er rief nicht gern Leute an. Am Telefon war er oft verwirrt.
Er befürchtete, dass es anders sein würde als bei ihren Besuchen. Er befürchtete, dass sie ihm nicht glauben würde.
Vielleicht würde er sogar in Schwierigkeiten kommen.
Angst und Zweifel stiegen in ihm auf. Was, wenn er seinen Job verlor?
Seine Schwester hatte ihm geholfen, seine Arbeitsstelle zu bekommen. Sie hatte ihm versichert, dass er es schaffen konnte, ihn aufgefordert, sein Bestes zu geben. Es war überhaupt der erste Job, den er bekommen hatte. Er mochte es, die bunten Plastikteile zusammenzufügen, aber am meisten gefiel ihm die Unabhängigkeit, die er dadurch gewann. Durch diese Stelle konnte er die Rechnungen bezahlen und auf eigenen Beinen stehen.
Kate half ihm, wenn er verwirrt war, aber um die meisten Angelegenheiten konnte er sich selbst kümmern. Sie sagte, sie sei stolz auf ihn, weil er so gut zurechtkam.
Er mochte es, unabhängig zu sein. Er wollte seine Arbeitsstelle nicht verlieren. Und er wollte Kate nicht enttäuschen.
John erzählte seiner Schwester nie von Detective Janek. Er wollte ihr keine Angst machen. Das war seine einzige Möglichkeit, sie zu schützen.
Natürlich wusste er, dass es falsch war, Leute im Keller anzuketten, aber hier handelte es sich nicht um eine gewöhnliche Person. Hier ging es um den Teufel.
Trotzdem fürchtete er, dass nicht einmal Detective Janek ihm glauben würde.
Plötzlich fragte er sich, ob man ihn vielleicht sogar ins Gefängnis stecken würde.
John wischte sich die verschwitzten Hände an den Hosenbeinen ab. Er schluckte vor panischer Angst vor dem, was ihm widerfahren würde, falls man ihn einsperrte. Allein die Vorstellung, ins Gefängnis zu kommen und all den Männern dort in die Augen sehen zu müssen, führte dazu, dass er weiche Knie bekam.
Seine Aufmerksamkeit richtete sich auf seinen Schatten, der auf den Kühlschrank fiel. Er rückte seinen Hemdkragen zurecht und sagte sich, dass er alles unter Kontrolle hatte. Er musste nur dafür sorgen, dass es so blieb, das war alles.
Es wurde spät und er wusste, dass er nach unten gehen musste. Er mochte es nicht, Nahrungsmittel in den Keller zu bringen, aber John hatte einfach nicht das Zeug dazu, jemanden zu töten, sei es durch einen schnellen Schlag oder durch langsames Verhungernlassen. Er ertrug es nicht, wenn Menschen litten, nicht einmal wenn es sich bei diesem Leid nur um Hunger handelte.
Wie aus weiter Ferne kam ihm zwischen durcheinanderwirbelnden Gedankenfetzen, die seinen Verstand hierhin und dorthin trieben, die Erkenntnis, dass etwas mit dem Kühlschrank nicht stimmte. Etwas war anders.
Im dämmrigen Licht betrachtete er die Zeitungsberichte, die er vorsichtig ausgeschnitten und an die Tür geklebt hatte. Sie waren alle noch da. John hasste den kalten Anblick des weißen Kühlschranks, weshalb er regelmäßig Gegenstände, die ihn interessierten, an der kahlen Tür befestigte, nachdem er die spitzen Ecken sorgfältig umgeknickt hatte. Er mochte keine Spitzen.
Er tauschte die Zeitungsausschnitte oft aus, immer wenn ihm etwas Neues ins Auge fiel. Es musste nichts besonders Bedeutungsvolles sein. Bilder von Tieren, Schlagzeilen über Feiertage, manchmal auch nur ein einzelnes Wort, das ihm gefiel – alles, was die Nacktheit des Kühlschranks verhüllen konnte.
Dort fanden sich auch Fotos, deren Ecken ebenfalls sorgfältig umgeknickt waren. Sie waren mit Wortmagneten an der Kühlschranktür befestigt. Er erwiderte das Lächeln seiner Schwester, die ihn von einem sonnigen Strand aus anstrahlte, hinter dem Lenkrad ihres ersten Autos, auf der Couch in seinem Wohnzimmer.
Er überflog die Schlagzeilen der Zeitungen über Paraden, Feiertage und sonnige Wetteraussichten auf der Suche nach etwas Neuem, etwas, das sich geändert hatte. Irgendein Wort. Ein Zeichen.
Dann entdeckte er, was nicht stimmte.
An der Tür hafteten Dutzende kleiner Magnete. Sie waren ein Geburtstagsgeschenk von seiner Schwester gewesen. Jeder Magnet bestand aus einem weißen Wort auf schwarzem Hintergrund. Er arrangierte die Wörter gern so, dass sie sich reimten oder etwas Fröhliches ausdrückten. Die Sprüche an der weißen Metalltür wirkten immer einladend und begrüßten ihn freundlich, wenn er nach Hause kam und sich etwas zu essen holen wollte – oder wenn er, wie jetzt, dem Teufel etwas zu essen holte.
Die letzte Botschaft, die er mit den Magneten zusammengefügt hatte, war noch da: IN EINER BURG BIST DU SICHER.
Er hatte diesen Satz vor einer Weile zusammengesetzt, nachdem er das Sprichwort gehört hatte: »Mein Haus ist meine Burg«. Abgesehen von seinen Wegen zum Arbeitsplatz und zum Supermarkt ging John nicht gern nach draußen. Er blieb gern drinnen. In Sicherheit. Zu Hause war man sicher. Sein Haus war seine Burg.
Das Anketten des Teufels war das Waghalsigste, das John in seinem ganzen Leben getan hatte.
Aber jetzt waren die kleinen Magnete, aus denen er so sorgfältig den Satz IN EINER BURG BIST DU SICHER geformt hatte, nicht mehr allein dort aufgereiht.
Alle unbenutzten Wörter, die er nach rechts geschoben hatte, waren nun zu einem Kreis angeordnet, in dessen Mitte ein leerer, runder weißer Fleck frei blieb, nahe dem Türgriff. IN EINER BURG BIST DU SICHER stand in der Mitte dieses Kreises.
Neue Worte waren darunter in einer sauberen Linie zusammengefügt wie eine Antwort.
Sie lauteten: JETZT NICHT MEHR.
2
John beugte sich näher heran und starrte auf die neu hinzugekommene Botschaft.
JETZT NICHT MEHR.
Er selbst hatte diesen Text nicht angefertigt.
Er sah zur Kellertür. Es war eine dicke Holztür mit sechs Blättern. Hier und dort kam ein verblichenes Blau hinter dem abblätternden, cremefarbenen Anstrich zum Vorschein. John erinnerte sich an die glücklichen Zeiten, als diese Tür noch ganz blau gewesen war und er auf dem Küchenboden gespielt hatte.
Sie war an der Oberseite ein kleines Stück weit geöffnet, weil sie sich verformt hatte und nicht mehr ganz schließen ließ.
Es gab ein Schloss, aber er besaß keinen Schlüssel dafür. Das Schlüsselloch war eines dieser altmodischen, die er in Cartoons und Filmen gesehen hatte. Als er noch klein gewesen war, hatte John immer hindurchgespäht und sich vorgestellt, er sei ein Spion, der nach Gefahren Ausschau hielt. Aber jetzt wusste er, welche Gefahr auf der anderen Seite lauerte.
Durch den Spalt der teilweise offenen Tür sah er tintenschwarze Dunkelheit. Der Teufel, der dort unten in der Finsternis saß, blieb stumm. Nicht einmal ein Flüstern drang aus dem Keller hervor. John fragte sich, ob das ein gutes Zeichen war. Er blieb reglos wie ein Stein stehen, beugte sich vor und lauschte.
Wieder dachte er daran, die Polizei anzurufen. Er warf noch einen Blick auf die Karte, die Detective Janek auf sein Wandtelefon gestellt hatte. Vorher hatte sie die Ecken sorgfältig umgeknickt, damit die Spitzen John keine Angst machten.
Sie war immer nett zu ihm gewesen, hatte ihm immer geglaubt, aber er fragte sich, ob sie das auch diesmal tun würde. Wenn Detective Janek in den Keller ging und ihn sah, ihm in die Augen blickte, würde sie es dann nicht begreifen?
John hatte dem Teufel in die Augen gesehen. Er begriff es.
Während er bewegungslos dastand und durch den dunklen Spalt nach unten schaute, wurde ihm klar, dass sein Zuhause, seine Burg, nicht so sicher war, wie er geglaubt hatte.
Das bedeuteten die Worte am Kühlschrank. Dieser Ort war nicht mehr sicher. Der Teufel hatte ihn betreten.
Verstohlen sah John noch einmal zu dem wasserblauen Telefon, das seitlich der nach oben führenden Treppe an der Wand mit der Blumentapete hing, gleich um die Ecke. Vielleicht sollte er Detective Janek anrufen. Es würde die Polizei doch sicher interessieren, dass der Teufel in Chicago war.
Oder vielleicht sollte er seine Schwester anrufen.
Der Teufel kannte ihren Namen. Das sollte sie wissen – dass der Leibhaftige ihren Namen kannte.
Er sollte mit Kate telefonieren und es ihr sagen. Damit sie in Sicherheit war.
Wenn er mit ihr sprach, würde sie ihm vielleicht sagen können, was zu tun war. Die Polizei würde ihm möglicherweise nicht zuhören, ihm nicht glauben, aber Kate würde seinen Worten diesmal Glauben schenken. Das musste sie einfach.
Ganz plötzlich stand ihm die Lösung klar vor Augen. Er würde seine Schwester anrufen und ihr alles erzählen, alles, was passiert war, dass der Teufel ihren Namen kannte, so wie er auch Johns Namen gewusst hatte. Sie wüsste bestimmt, was zu tun war.
Er trat in Aktion und nahm hastig alle Fotos, die seine Schwester zeigten, von der Kühlschranktür. Die Magnete, die sie an Ort und Stelle gehalten hatten, fielen klappernd zu Boden. Anstatt innezuhalten, um sie aufzuheben, begann er, die Fotos in die Vordertasche seiner Arbeitshose zu stopfen. Die Vorstellung, dass der Teufel die Bilder von Kate zu Gesicht bekommen könnte, bereitete ihm Sorgen. Er hielt es für keine gute Idee, ihn seine Schwester sehen zu lassen.
John wollte nicht, dass das Böse sie sah.
Sobald er alle Fotos sicher in seiner Tasche verstaut hatte, lief er eilig in den Flur, um sie anzurufen.
Gerade als er die Hand nach dem Telefon ausstreckte, klingelte dieses.
Sein Herz klopfte wie wild. Er schnappte sich den Hörer, drückte ihn an sein Ohr und wartete. Dabei fürchtete er sich davor, dass es vielleicht der Teufel war, der ihn aus dem Keller anrief.
»Hi, Johnny. Ich bin’s.«
Eine Welle schwindelerregender Erleichterung durchlief seinen Körper, als er die vertraute, fröhliche Stimme seiner Schwester hörte. Er packte das verknotete Telefonkabel mit der anderen Hand und ließ sich an der Wand hinabsinken.
»Hi, Kate«, sagte er mit einem erwartungsvollen Keuchen.
Dann warf er einen Blick zu dem dunklen Spalt unter der Kellertür.
»Ich komme einen Tag früher von meinem Ausflug zurück und der Fahrer setzt mich gleich zu Hause ab.«
»Mhm.«
»Was ist los? Du hörst dich an, als wärst du außer Atem. Bist du gerade die Treppe raufgerannt?«
John musste ihr vom Teufel erzählen. Kate würde wissen, was zu tun war. Sie war klug. Seine Schwester wusste immer, was nötig war. Sie half ihm immer. Er vermisste sie. Genau in diesem Moment vermisste er sie mehr als alles andere auf der Welt. Er schirmte das Telefon mit beiden Händen ab, damit der Teufel nicht mithören konnte.
»Äh … nein.«
»Hey, hör mal«, sagte sie ohne Ungeduld. Sie war die Einzige, die nie ungeduldig wurde und ihn unter Druck setzte. »Ich habe einen Anruf von einem Anwalt gekriegt.«
John blinzelte. »Einem Anwalt?«
»Ja. Erinnerst du dich an Moms Halbbruder, der im Westen lebt – Everett, weißt du noch?«
John war nicht sicher. Während er zur Kellertür starrte, schossen ihm so viele Dinge durch den Kopf und das Nachdenken fiel ihm schwer.
»Ähm …«
Sie hauchte ein unbekümmertes, leises Lachen hervor. »Ich eigentlich auch nicht. Wir sind dort einmal hingefahren – zu diesem Wohnwagen in dieser kleinen Stadt in der Wüste. Er war nicht gerade sehr freundlich. Damals warst du noch klein. Ich habe auch nicht erwartet, dass du es noch weißt. Ich erinnere mich selbst kaum noch an ihn. Jedenfalls, er ist leider gestorben.«
John wandte den Blick von dem dunklen Spalt ab. »Gestorben?«
»Ja. Der Anwalt sagte, es ist vor etwa drei Wochen passiert …«
»Drei Wochen?«
»Ja, drei, na ja, fast vier Wochen.«
John wischte sich eine Träne von der Wange. Er hörte sie einen Augenblick atmen, bevor sie weitersprach.
»Ich weiß, wie sehr es dir zu schaffen macht, wenn jemand stirbt, John, aber er war schon sehr alt. Sei nicht zu traurig darüber. Er ist nie von dort weggezogen, und ich wette, der Grund dafür ist, dass er diesen Ort so geliebt hat, wie du dein Haus liebst. Ich wette, er hatte dort ein gutes Leben, ein gutes, langes Leben.«
»Woran ist er gestorben?«
Nach einem langen Moment des Schweigens erwiderte sie: »Er war alt, John.«
Sie wollte es ihm nicht sagen. Er wusste, dass Kate ihm manchmal die Wahrheit verschwieg und ihm stattdessen etwas Einfacheres mitteilte.
»Jedenfalls, der Anwalt hat gesagt, dass wir seine einzigen Angehörigen sind, und Everett hat uns sein Grundstück vererbt. Er glaubt nicht, dass es besonders viel wert ist, aber es gehört jetzt dir und mir. Ich werde da hinfahren und mich darum kümmern müssen. Schätze, ich werde es wohl verkaufen oder so.«
John sah wieder zur Kellertür. Vor allem anderen musste er es ihr sagen. Er schluckte und nahm all seinen Mut zusammen, um ihr die ganze Geschichte zu erzählen, von Anfang an.
»Ich bin auf den Friedhof gegangen«, stieß er hervor.
»Ach, ja?« Sie hielt inne, wirkte überrascht. »Allein?«
John nickte und begann plötzlich schneller zu sprechen, im Versuch, ihr alles auf einmal zu berichten. »Ich bin zum Laden gegangen, habe Blumen gekauft und sie ans Grab von Mom und Pop gestellt, an die Grabsteine, wie du’s mir gezeigt hast, in der Vase, wie die Leute vom Friedhof das möchten. Ich hab auch deinen Namen mit auf die Karte geschrieben.«
»Das ist so lieb von dir.« Ihre Stimme war sanft geworden. »Danke. Ich wette, die Blumen haben Mom und Dad gefallen.« Sie räusperte sich. »Wann warst du denn auf dem Friedhof?«
Er war noch nie zuvor allein dort gewesen. John wischte sich mit dem Handrücken über die Nase und versuchte, nicht zu weinen. »Vor drei Wochen.« Er spürte, wie ihm noch eine Träne über die Wange lief. Er musste es ihr sagen. Sie würde wissen, was zu tun war. »I-i-ich war da, und jemand hat mich beobachtet … Und dann, als ich nach Hause kam …«
Im Keller ging plötzlich das Licht an.
John erstarrte.
Er blieb reglos stehen und starrte mit großen Augen auf den schmalen Lichtstreifen, der unter der Tür hervordrang.
»John, das war wahrscheinlich bloß irgendjemand, der Blumen auf ein Grab gestellt hat«, sagte seine Schwester im Hörer an seinem Ohr.
Er konnte sich nicht zum Sprechen überwinden. In seinem Kopf schrie eine Stimme: Sag’s ihr, schnell, sag’s ihr, aber er brachte die Worte nicht heraus. Seine Stimme verweigerte den Dienst. Er fürchtete sich davor, Geräusche zu machen.
Dann drang noch etwas anderes durch die Tür – eine leise Stimme, die seinen Namen sagte. Seinen vollständigen Namen, wie es die Erwachsenen in seiner Kindheit getan hatten, wenn er etwas angestellt hatte.
»John Allen Bishop.«
Er sah, wie die Lichtstrahlen, die von unten kamen, heller, dunkler, dann wieder heller wurden.
»John? Ist da noch jemand bei dir im Haus?«, fragte Kate.
Er sehnte sich verzweifelt danach, dass sie ihm half. Aber was, wenn der Teufel sie durch das Telefon erreichen konnte? Er wollte seine Schwester nicht in Gefahr bringen.
Die zischende Stimme dort unten nannte wieder seinen Namen, aber nur den ersten Teil, dann noch einmal. Sie kam näher, bewegte sich die Treppe herauf. Die Tür knarrte und begann sich zu öffnen.
»John? Was ist das für ein Geräusch? Hast du Gesellschaft? John?«
»Lauf weg, Kate!«, schrie er in den Hörer. »Lauf!«
Er knallte den Hörer auf die Gabel, damit der Teufel nicht durch die Telefonleitung zu seiner Schwester konnte. Dann rannte er so schnell zur Haustür, wie seine krummen Beine ihn trugen.
Beinahe hätte er es geschafft.
Etwas sehr Schweres rammte ihn von hinten und stieß ihn mit dem Gesicht voran gegen die Tür. Er prallte zurück, aber eine kräftige Hand packte ihn am Hemd und riss ihn herum. Der Aufprall hatte ihn benommen gemacht. Seine Nase fühlte sich an, als wäre sie von einem Baseballschläger getroffen worden. Er spürte, wie warmes Blut durch sein Gesicht lief und von seinem Kinn tropfte. Die Vorstellung, dass so viel Blut aus seiner Nase strömte, erschreckte ihn.
John blickte nach oben und erstarrte vor Entsetzen. Der Teufel hatte seine Heugabel.
Seine Augen schienen aus purer Bosheit von innen her zu leuchten. Es waren Augen, die nichts als Leid sehen wollten.
Der Teufel brüllte mit wutverzerrtem Gesicht und stieß die Heugabel in den Boden. Die Zinken durchbohrten Johns Schuhe, seine Fußknochen, die dicken Sohlen. Sie blieben fest in den Dielenbrettern stecken.
Während John vor Grauen wie gelähmt war, schob der Teufel eine Hand in seine Hosentasche. Er zog die Fotos von Kate heraus. John zitterte, konnte nicht mehr denken und der Schmerz sorgte dafür, dass er nicht einmal versuchte, sich zu bewegen. Währenddessen betrachtete der Teufel langsam die Bilder, eins nach dem anderen, und sein tückisches Grinsen wurde breiter und breiter.
John wollte nicht, dass der Teufel Kate ansah. Er griff nach den Fotos. Aber der Leibhaftige packte seine Hand und bog seine Finger nach hinten, bis sie mit einem Übelkeit erregenden Knacken brachen wie Zweige.
John schrie vor Schreck und Schmerz und hielt sich mit der unverletzten Hand die verbogenen, gebrochenen Finger. Der Teufel schob sich die Fotos von Kate in die eigene Tasche.
»Du hast mir ganz schön Schwierigkeiten gemacht, Johnnyboy.«
»Lass uns in Ruhe«, wimmerte John. »Bitte …«
Der Teufel ragte hoch vor ihm auf und sah ihm tief in die Augen. »Erinnerst du dich an mein Versprechen, John?«
Die furchtbaren Schmerzen in seinen Füßen, die von den Zinken durchbohrt waren, begannen nun langsam, durch die lähmende Panik und die entsetzliche Qual seiner ruinierten Finger zu dringen.
Er erinnerte sich an das Versprechen. Nur allzu gut. Sein hilfloses Schluchzen wurde lauter.
»Was siehst du mit diesen Augen, die du da hast?«, fragte der Teufel und kam noch näher heran, als versuchte er, irgendein Geheimnis zu erspähen, das in Johns Augen verborgen war. »Was siehst du, Johnnyboy?«, flüsterte er aus nicht mehr als zwei bis drei Zentimetern Entfernung.
John zitterte unkontrollierbar. »Nichts!«
»Ich glaube, du siehst viel zu viel.« Eine große Hand packte Johns Haar am Hinterkopf. »Das werde ich beheben.«
Dann beugte der Teufel sich ganz nahe heran, bis sein Mund an Johns Ohr war, und flüsterte ihm erneut sein Versprechen zu.
»Ich werde dir immerwährende Dunkelheit bringen.«
John kreischte vor Furcht und Schmerz, als etwas schrecklich Langes und scheußlich Spitzes zweimal in seine Körpermitte gestoßen wurde. Er konnte den tiefen Atemzug, den er so verzweifelt brauchte, nicht nehmen.
Die Zähne des Leibhaftigen wirkten riesig in seinem weit aufgerissenen Maul, als er kam, um sich zu holen, was er wollte. Die Zähne kratzten durch Johns Gesicht und schälten seine Augenlider ab.
»Im Großen und Ganzen«, sprach der Teufel, während er einen Daumen seitlich in eine von Johns Augenhöhlen drückte, »spielt das keine Rolle. Schließlich ist auch das Universum blind.«
Die Worte kamen wie aus weiter Ferne und ergaben für John keinen Sinn. Er zappelte und schrie in Qualen, die gerade erst begonnen hatten.
Ein sich drehender Schmerz und Dunkelheit drangen in seine Augen ein.
Er hoffte, dass Kate schnell und weit davonlaufen, dass sie entkommen würde …
3
Als Detective Sanders ihren Namen rief, hob Kate den Blick. Sie war wie benebelt. Das alles fühlte sich nicht real an.
Er lehnte sich mit einem Arm auf das Autodach, direkt über der offenen Hintertür. Sie saß seitlich auf dem Rücksitz und war verzweifelt, weil es nichts gab, das sie tun konnte. Er war derjenige gewesen, der sie beiseitegenommen hatte, als sie bei Johns Haus eingetroffen war.
Sanders war ein älterer, leicht übergewichtiger Mann und ein besserer Tröster, als sein strenges, pockennarbiges Gesicht vermuten ließ.
»Miss Bishop«, sagte er zu ihr in einem mitfühlenden, aber förmlichen Ton, »fühlen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten?«
Kate nickte. »Aber ich fürchte, ich weiß nichts, das Ihnen dabei helfen könnte, herauszufinden, wer das getan hat.«
Eine Ermittlerin in einem dunklen Anzug stand in Hörweite und betrachtete die im Scheinwerferlicht der Polizeiwagen vor ihnen liegende Szenerie. Sie war gerade erst angekommen und hatte nach dem Verlassen des Hauses noch kein Wort gesagt. Dem Anschein nach war sie ein paar Jahre älter als Kate, vielleicht Mitte 30. Ihre Haltung, ihre Schultern, der offene Kragen ihres strahlend weißen Hemds und der Zuschnitt ihrer Kleidung ließen darauf schließen, dass sie sehr auf sich achtete. Ihr braunes Haar reichte nur bis knapp unterhalb ihrer kräftigen Kiefer. Mit ihren dunklen Augen musterte sie Kate so aufmerksam, so bedächtig, dass diese langsam begann, sich unbehaglich zu fühlen.
Detective Gibson, der ähnlich wie Detective Sanders ein weißes Hemd, eine Krawatte und ein graues Jackett trug, kam aus dem Haus und flüsterte der Ermittlerin etwas zu. Ebenso wie bei Sanders waren seine Haare so kurz, dass jedes weitere Kürzen zu einer Glatze geführt hätte. In seinem Stiernacken bildeten sich dicke Hautfalten.
Detective Sanders saugte etwas zwischen seinen Schneidezähnen hervor und gab Kate mit einem Fingerzeig zu verstehen, dass er sich für einen Moment entschuldigen musste. Er ging und sprach mit den anderen.
Alle drei trugen Dienstmarken der Polizei an ihren Gürteln. Kate sah, dass sie alle unter ihren Jacketts Pistolen trugen. Kate empfand das professionelle Auftreten der Ermittler als beruhigend, soweit das in dieser Situation überhaupt möglich war.
Zwei Polizisten in dunklen Uniformen standen an beiden Seiten der Haustür auf der Veranda und achteten darauf, dass sich kein Unbefugter Zutritt verschaffte. Die Aktivitäten hatten ein wenig nachgelassen, seit man die Leiche ihres Bruders aus dem Haus geholt und in den Van des Gerichtsmediziners geladen hatte. Sie fragte sich, was sie zu tun hätte, um ihren Bruder für die Beerdigung zurückzubekommen. Vermutlich sollte sie das Bestattungsinstitut anrufen, das sich bereits um ihre Eltern gekümmert hatte. Dort würde man bestimmt wissen, welche Schritte dazu notwendig waren.
Leute mit Kisten voller Ausrüstung kamen und gingen. All diese Tätigkeiten und Prozeduren waren für Kate verwirrend und rätselhaft, obwohl ihr klar war, dass sie natürlich nach Spuren suchten, die sie auf die Fährte des Mörders bringen konnten. Von Zeit zu Zeit zuckten Blitze. Es schien, als würden sie einfach alles fotografieren, was sich im Haus befand.
Aber obwohl sie nicht viel über die jeweiligen Aufgaben dieser Leute wusste, erkannte sie doch, dass sie gut organisiert waren. Niemand irrte orientierungslos herum. Alle außer Kate wussten, was von ihnen erwartet wurde.
Und niemand beeilte sich. Sie nahm an, dass Hektik auch sinnlos gewesen wäre. Es gab niemanden, der gerettet werden musste, keine fliehenden Verdächtigen, die gejagt und festgenommen werden mussten. Außerdem machten diese Leute hier nur ihren Job. Für sie war es ein Arbeitstag wie jeder andere. Aber für Kate würde dieser Tag immer einer der schlimmsten ihres Lebens bleiben.
Als sie angekommen war, hatte sie ins Haus gehen und ihren Bruder sehen wollen. Aber die Detectives hatten sie daran gehindert. Sie hatten ihr gesagt, dass sie zuerst ihre Arbeit erledigen müssten. In vertraulichem Tonfall hatte Sanders ihr erklärt, dass es besser sei, wenn sie ihren Bruder nicht so zu Gesicht bekam, im Haus, in dem es passiert war. Sie würde ihren Bruder nicht so in Erinnerung behalten wollen. Sosehr sie geglaubt hatte, dass sie ihn sehen wollte, hatte die Aufrichtigkeit in Sanders’ Blick sie innehalten und begreifen lassen, dass er wahrscheinlich recht hatte.
Während all diese Leute kamen und gingen, die Detectives dicht gedrängt beieinanderstanden und sich leise unterhielten und die Techniker ihre Gerätschaften vorbeitrugen, war es schwer, sich die schreckliche Szene im Haus vorzustellen. Auf eine gewisse Weise machte das, was sich ihrer Kenntnis entzog, die ganze Sache noch schlimmer.
Bis jetzt war das Einzige, das sie mit Sicherheit wusste, dass ihr Bruder tot war. Gleich am Anfang hatte man ihr mitgeteilt, dass es Mord gewesen sei. Sie sagten es so, als ob daran nicht der geringste Zweifel möglich war. Kates Fantasie ging mit ihr durch. Aber vor allem konnte sie sich einfach nicht vorstellen, warum irgendjemand ihrem Bruder etwas angetan haben sollte.
Die Zahl der Schaulustigen auf dem Bürgersteig vor dem Absperrband hatte im Laufe des Abends abgenommen. Bei ihrer Ankunft hatten noch viele Leute vor dem Haus herumgestanden und sich unterhalten, hatten zugesehen, Gerüchte ausgetauscht und besorgt darüber gesprochen, welcher Wahnsinnige sich wohl in ihrem Viertel herumtrieb.
Einmal hatte ein seltsames Gefühl der Beklemmung dafür gesorgt, dass sie den Blick hob. Ein großer Mann mit zerzaustem Haar, der die Hände in den Taschen einer leichten Jacke vergraben hatte, wandte sich im selben Augenblick ab. Obwohl sie sein Gesicht nicht sah, erkannte sie an der Art, wie er sich durch die Menge zurückzog, dass er sie von dort beobachtet hatte. Bei dem Gedanken, dass Fremde sie so anstarrten, lief ihr ein Schauer über den Rücken. Es führte dazu, dass sie sich nackt und verletzlich fühlte.
Noch einige andere Menschen wandten den Blick ab, als sie in ihre Richtung sah. Auch diese hatten sie angestarrt.
Die ganze Zeit über waren Detectives oder Polizisten in Uniform in Kates Nähe geblieben. Sie hatten wenig gesprochen, ihr aber manches über ihre Vorgehensweise erläutert, wenn sie Fragen über mögliche Verdächtige stellte, über die Leiche ihres Bruders, darüber, was sie mit dieser vorhatten und was sie selbst würde tun müssen.
Die Reporter, Kameraleute und Scheinwerfer tragenden Nachrichtenteams hatten mit einem hochrangigen Polizisten gesprochen, der ihnen im Grunde gar nichts gesagt hatte, abgesehen davon, dass das Opfer John Allen Bishop hieß und offenbar von einem unbekannten Angreifer in seinem Haus ermordet worden war. Als sie fragten, wie es geschehen war, erwiderte er, dass die Einzelheiten nicht öffentlich gemacht werden sollten, und gab ihnen eine Nummer, unter der Hinweise gegeben werden konnten.
Tadellos gekleidete Live-Reporterinnen blickten für die Elf-Uhr-Nachrichten in die Kameras und sprachen von einem grausigen Fund. Dankenswerterweise hatte die Polizei Kate von den Nachrichtenleuten abgeschirmt und diese nicht darüber informiert, dass sie die Schwester des Opfers war. Eine Reporterin mit frischem Lippenstift, die ihr ein Mikrofon ins Gesicht schob und sie fragte, wie sie sich gefühlt habe, als sie erfahren habe, dass ihr Bruder ermordet worden war, war das Letzte, das Kate jetzt gebrauchen konnte.
»Er hat doch nicht gelitten, oder?«, fragte Kate Detective Sanders, als dieser endlich zurückkehrte. Sie überlegte, ob sie diese Frage bereits gestellt hatte, aber falls ja, konnte sie sich nicht an seine Antwort erinnern. »Hat John gelitten? Können Sie mir wenigstens das verraten?«
Detective Sanders hörte auf, in seinen Notizen zu blättern und blickte von der offenen Wagentür zu ihr hinab. »Das weiß ich nicht mit Sicherheit, Miss Bishop, aber ich glaube, nicht. Unserer Einschätzung nach war es schnell vorbei.«
Kate zog ein zerknülltes Taschentuch aus ihrer Jeanstasche und ließ es zwischen ihren Fingern hindurchwandern. Er begann wieder, seine Aufzeichnungen systematisch durchzugehen. »Miss Bishop, Sie sagten, als Sie mit ihm telefoniert haben, habe Ihr Bruder Sie plötzlich angeschrien, dass Sie weglaufen sollten, und dann habe er aufgelegt.«
Kate nickte. »Das stimmt. Dann habe ich sofort die 911 angerufen.«
»Haben Sie irgendeine Ahnung, warum er das gesagt hat? Warum wollte er, dass Sie weglaufen? Sie waren nicht in der Nähe seines Hauses.«
Sie wischte sich die Nase mit dem Taschentuch ab, bevor sie antwortete. »Wegen seiner geistigen Behinderung konnte John Dinge nicht so verstehen, wie ein normaler Erwachsener das kann. Wenn er Angst hatte, war es für ihn bedeutungslos, ob jemand eine halbe Stadt oder ein halbes Land von ihm entfernt war. Er hat die Welt in einer vereinfachten Weise betrachtet, so als ob alles direkt in seiner Nähe wäre. Mit Konzepten wie Entfernung hatte er seine Schwierigkeiten.«
Detective Sanders machte eine Geste mit seinem Stift. »Das heißt, als er Ihnen gesagt hat, dass Sie wegrennen sollen, hat er vielleicht einfach damit gemeint, dass jemand dort im Haus war, und durch seine Art zu denken hat er diese Person nicht nur als eine Gefahr für sich, sondern auch für Sie gesehen.«
»Wahrscheinlich.« Kate wischte ihren schwarzen Pony zur Seite und sah zu ihm auf. »Er hat sich immer Sorgen um mich gemacht.«
»Konnte er denn trotz seiner geistigen Behinderung einer normalen Arbeit nachgehen?«, fragte Detective Gibson, der neben Sanders trat.
»Ja.« Kate blickte in die ausdruckslose Miene des Mannes. »Er hat im Clarkson-Zentrum für Entwicklungsstörungen gearbeitet.« Sie wies über ihre Schulter. »In der Hamilton Street. Die bieten Jobs an, mit denen Leute wie John zurechtkommen. Das hilft ihnen dabei, unabhängig zu sein. Die Ärzte hatten empfohlen, ihn so weit wie möglich ein normales Leben führen zu lassen.«
»Meinen Sie denn, dass er der Aufgabe gewachsen war, für sich selbst zu sorgen?«, hakte Gibson nach. Trotz seines wuchtigen Äußeren klang seine Stimme angenehm. Ihr entging nicht, dass er absichtlich versuchte, seine Frage nicht wie den Vorwurf klingen zu lassen, sie habe ihren Bruder vernachlässigt.
»Ja. Er war zum Glück nicht so schwer behindert wie manch anderer. Er kam allein ziemlich gut zurecht. Die Ärzte haben gesagt, es wäre besser für ihn, wenn er das könnte, wenn er das Gefühl hätte, sein Leben selbst in der Hand zu haben. Und das Gefühl, ein Ziel und die Kontrolle über sich zu haben, hat wirklich dazu geführt, dass er glücklicher war.
Er ist mit dem Bus zur Arbeit und zurück gefahren. Zum Laden konnte er zu Fuß gehen. Die Leute dort kannten ihn alle. Größtenteils konnte er alles selbst erledigen, und das mochte er. An den wenigen Orten, die er kannte, hat er sich wohlgefühlt.
Er ist nicht so sehr sich selbst überlassen worden, wie es vielleicht den Anschein hat. Wenn ich nicht beruflich unterwegs war, bin ich oft zu ihm gefahren, um nach ihm zu sehen. Ich bin mit ihm zum Doktor gefahren, zum Zahnarzt, bin mit ihm essen gegangen. Manchmal habe ich ihn mitgenommen, wenn ich Kleidung kaufen gegangen bin. Das mochte er. Solange ich dabei war, hat er sich auch in fremden Umgebungen sicher gefühlt.
Ich habe ihm geholfen, die Rechnungen zu bezahlen, habe darauf geachtet, dass er ordentlich isst, dass er sich um den Haushalt kümmert – solche Sachen eben. Er war zwar langsam, aber er konnte einfache Dinge selbst machen. Es hat mich emotional ziemlich mitgenommen, dass ich nicht immer für ihn da sein konnte, aber ich glaube, es war gut für ihn, sein eigenes Leben führen zu können.«
»Wann waren Sie zum letzten Mal hier?«, fragte Detective Sanders, ohne von dem Notizblock aufzublicken, in den er etwas schrieb. »Ich meine, wann war das letzte Mal, dass Sie ihn wirklich gesehen haben?«
Kate rieb sich mit den Fingerspitzen die Stirn. »Vor etwas mehr als drei Wochen. So lange bin ich vorher noch nie weg gewesen, aber ich musste beruflich nach Dallas. Ich bin Auditorin bei KDEX Systems. In unserem Büro in Dallas gab es ein paar Unregelmäßigkeiten, und ich musste dorthin, um einen Blick darauf zu werfen. Ich habe John aber so gut wie jeden Abend angerufen.«
»Dann haben Sie ihn heute Abend also angerufen, um ihm mitzuteilen, dass Sie wieder in der Stadt sind?«
»Ja.« Kate sah dem Mann ins Gesicht, der sie wartend anblickte. »Abgesehen davon, dass ich nach ihm sehen wollte, musste ich ihm auch mitteilen, dass ein Verwandter von uns – der Halbbruder meiner Mutter – gestorben ist. Das habe ich selbst heute erst erfahren.«
»Tut mir leid, das zu hören, Ma’am«, erwiderte Gibson. »Wann ist er gestorben?«
»Vor etwas mehr als drei Wochen – am Zwölften, letzten Monat. In Nevada. Er wurde ermordet.« Detective Sanders betrachtete sie über den Rand seines Notizblocks hinweg. »Ermordet?«
4
Mit leicht gerunzelter Stirn stellte Detective Gibson dieselbe Frage. »Ihr Onkel ist ermordet worden?«
»Ja.«
»Wie wurde er getötet?«, erkundigte sich Sanders.
Kate hob matt die Hand. »Bei den Umständen bin ich mir nicht ganz sicher. Ein Sheriff aus Esmeralda County in Nevada hat mich angerufen und mir mitgeteilt, dass Everett bei einem Raubüberfall ums Leben gekommen ist. Viel Sinn hat das Ganze nicht ergeben. Everett hatte nicht viel, das sich zu stehlen lohnte, jedenfalls nicht soweit ich weiß.«
»Haben die Ihnen verraten, wie er ermordet wurde? Irgendwelche Details?«
Kate schüttelte den Kopf. »Nein. Nur dass er bei einem Raubüberfall getötet wurde. Ich hatte angenommen, dass ihn jemand erschossen hat. Aber jetzt, wo Sie fragen – ich schätze, genau weiß ich das nicht.
Ich bin Everett nur einmal begegnet, als ich noch ein kleines Mädchen war, und ich weiß eigentlich nicht viel über ihn. Der Sheriff hat mir die Nummer von Everetts Anwalt gegeben und vorgeschlagen, dass ich ihn anrufe. Als ich das getan habe, sagte mir der Anwalt, dass John und ich in Everetts Testament genannt werden, weil wir die letzten lebenden Angehörigen sind. Ich hatte gedacht, er würde seine Sachen irgendeinem Freund hinterlassen, oder sonst jemandem, den er dort kannte, aber das hat er nicht getan. Was immer er besessen hat, er hat es uns vererbt.« Erst nach dem Anruf war ihr eingefallen, dass sie dem Anwalt vielleicht sagen konnte, dass er einfach alles an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden sollte. Sie kannte Everett eigentlich kaum.
»Der Anwalt hat auch erwähnt, dass Everett schon vor langer Zeit Vorkehrungen für seine Beerdigung getroffen hat – einer dieser Zahlungspläne –, sodass er bereits seinen Wünschen nach bestattet worden war. John und mir gehören demnach jetzt der Wohnwagen, in dem er gelebt hat, sein Pick-up und seine persönlichen Sachen. Ich soll da hinfahren und mich um das alles kümmern, sobald es mir passt. Aber jetzt …« Sie machte eine hilflose Geste in Richtung des Hauses.
Sie kam sich dumm vor, weil sie nicht einmal eine so grundlegende Frage gestellt hatte wie die, wie ihr Verwandter ermordet worden war. Es sah ihr nicht ähnlich, keine Fragen zu stellen. Tatsächlich war es ihr Job, nachzuforschen, nachzuhaken, Dingen auf den Grund zu gehen.
Aber der Anruf war, ebenso wie die Nachricht selbst, so unerwartet erfolgt, dass ihr diese Frage gar nicht in den Sinn gekommen war. Noch dazu hatte der Sheriff recht angespannt gewirkt, auf eine Weise, die nicht gerade zu Neugier ermutigte. Sie hatte angenommen, dass er sehr beschäftigt war, weil er schließlich einen Mordfall aufzuklären hatte.
Kate glättete mit dem Daumen ein paar Falten an ihrem Hosenbein, während sie beobachtete, wie ein Mann mit Latexhandschuhen einen schwarzen Plastiksack aus dem Haus trug, die Tür eines weißen Polizeivans öffnete und ihn hineinlegte.
Detective Gibson ging zu seinem Wagen zurück. »Ich werd mir das mal ansehen«, wandte er sich über die Schulter an Sanders.
Während sie ihm nachblickte, bemerkte Kate, dass die weibliche Ermittlerin immer noch in der Nähe stand, zuhörte und sie beobachtete.
»Hatte Ihr Bruder irgendwelche … Meinungsverschiedenheiten mit jemandem an seinem Arbeitsplatz?«, fragte Detective Sanders.
Kate sah in sein pockennarbiges Stirnrunzeln hinauf. »Das glaube ich nicht. John hat mir immer erzählt, was in seinem Leben vorging. So etwas hat er nie erwähnt. Vor einer Weile war er einmal aufgebracht, weil irgendwelche Kinder ihn auf dem Rückweg von der Bushaltestelle aufgezogen hatten. Sobald er mir davon erzählt hatte, schien er sich schon besser zu fühlen. Ich glaube, am nächsten Tag hatte er das schon wieder vergessen.
Er mochte seinen Job. Er hat immer gesagt, dass die Leute dort nett seien. John hat sich darauf verlassen, dass ich ihn beschützen würde, wenn er Angst hatte. Ich glaube, er hätte es mir gesagt, wenn er bei der Arbeit irgendwelche Schwierigkeiten gehabt hätte.«
Mit dem Notizblock in der einen und seinem Stift in der anderen Hand zog sich Detective Sanders die Hose zurecht, wobei er eine Gruppe von Männern betrachtete, die mit Kisten und Metallkoffern aus dem Haus kamen. Jede Person zog auf der Veranda ihre blauen Überziehschuhe aus Papier aus und steckte sie in einen Beutel.
»Miss Bishop, wären Sie bereit, mit uns reinzugehen? Die haben noch nicht alles beseitigt, abgesehen davon, dass sie Ihren Bruder herausgeholt haben, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn Sie uns vielleicht ein paar Dinge erklären könnten. Aber wenn Ihnen nicht danach zumute ist …«
»Ist da noch … Blut? Ist das Blut weggewischt worden?«
Die Ermittlerin, die in die Dunkelheit gespäht und die Schaulustigen beobachtet hatte, wandte sich von dort ab und trat näher zu Kate, um zu antworten.
»Ich fürchte, wir müssen dort alles so lassen, wie es ist, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Wir möchten nur, dass Sie sich dort kurz umsehen, falls Sie sich das zutrauen.«
Die Frau streckte eine Hand aus, um Kate zu stützen, als diese aufstand, aber Kate brauchte keine Hilfe.
»Ich bin übrigens Detective Janek«, sagte die Frau und schüttelte ihr die Hand. »Ich würde mit Ihnen gehen, wenn Sie bereit wären, reinzugehen und uns ein paar Fragen zu beantworten.«
Wenn sie bereit wäre? Kate hatte diese Leute seit Stunden gebeten, sie ins Haus zu lassen. Aber anstatt sie an diese Tatsache zu erinnern, zwang sie sich zu einem knappen Lächeln.
»Mir geht’s gut. Wirklich. Es ist bloß so ein Schock. Ich kann nicht fassen, dass jemand John etwas antun wollte. Er war wie ein Kind – Sie wissen schon, unschuldig und fröhlich, jedenfalls meistens. Ich kann einfach nicht glauben, dass jemand ihn verletzen wollte.« Sie dachte wieder an Everett, den Halbbruder ihrer Mutter. »Wurde John bei einem Raub umgebracht? Hat jemand das Haus ausgeräumt und dabei John getötet?«
Die Detectives wechselten einen Blick.
Detective Janek beugte sich ein Stück näher heran. »Hören Sie, Miss Bishop …«
»Bitte, nennen Sie mich Kate.«
›Miss Bishop‹ wurde sie von den Mitarbeitern von KDEX Systems genannt, wenn sie überraschend ihr Homeoffice verließ und dort aufkreuzte.
Detective Janek lächelte. Kate hielt ihr Lächeln für echt. »Kate, wir müssen Ihnen ein paar Dinge mitteilen, bevor Sie sie aus der Presse erfahren. Und nachdem wir drinnen waren, wäre es gut, wenn Sie Ihren Bruder identifizieren, solange der Leichenwagen noch hier ist. Dann bleibt Ihnen die Fahrt zum Leichenschauhaus erspart. Aber wir möchten Sie zuerst vorbereiten.«
Vorbereiten? Kate schluckte. »In Ordnung.«
Janek blickte sich um, um sich zu vergewissern, dass niemand in der Nähe war. Dann suchte sie wieder Kates Blick. »Derjenige, der es getan hat, war ziemlich krankhaft veranlagt.«
»Wie meinen Sie das?«
»Er … hat Ihrem Bruder die Augen entfernt.«
»Die Augen entfernt?« Kate blinzelte. »Warum?«
»Das wissen wir noch nicht. Eins von ihnen fehlte. Das andere lag neben der Leiche. Es scheint teilweise gegessen worden zu sein.«
Kates Kopf fühlte sich plötzlich völlig leer an.
Für gewöhnlich schreckte sie nicht vor dem Ergründen schwieriger Sachverhalte zurück. Sie wusste immer genau, welche Fragen zu stellen waren, um einer Sache auf den Grund zu gehen.
Aber jetzt wollte ihr Verstand sich einfach nicht in Bewegung setzen. Beim Gedanken daran, dass jemand John verletzt und ihm so etwas angetan hatte, war sie wie betäubt vor Wut. Sie kannte Johns Ängste gut. Sie versuchte, sich seine Entsetzens- und Schmerzensschreie nicht vorzustellen. Eine heiße Welle aus Schuldgefühlen überflutete sie, weil sie nicht da gewesen war, um ihn zu beschützen.
»Wer kann so etwas tun?«
»Genau das wollen wir herausfinden«, erwiderte Detective Sanders.
»Bringen Sie mich da rein«, sagte Kate mit zunehmender Wut. »Zeigen Sie mir, was ich Ihnen erklären soll.«
Sanders und Janek tauschten einen Blick aus, als sie ihren entschlossenen Tonfall hörten, der von siedender Wut zeugte.
Als sie zum Haus aufbrachen, blieb Kate dicht hinter Detective Sanders. Janek blieb schützend an ihrer Seite. Beim Erreichen der Stufen zogen sie blaue Papier-Überziehschuhe an und baten sie, dasselbe zu tun.
Draußen auf der Veranda stand eine mit einer Zahl versehene Markierung neben etwas, das wie ein blutiger Fußabdruck aussah. Als sie das Wohnzimmer betrat, in dem es mehr Licht gab, erblickte sie einen Blutfleck, etwa auf Augenhöhe an der Innenseite der Eichentür.
Das Blut im Wohnzimmer sah nicht so aus, wie Kate es sich vorgestellt hatte. Sie hatte geglaubt, es würde schon zum Großteil im Holzboden versickert oder getrocknet sein. Aber nicht weit hinter der Tür war eine schreckliche, breite Pfütze davon, die sie umgehen mussten.
Kate stellte schockiert fest, dass das ganze Wohnzimmer mit Blut bespritzt war. Abgesehen von den Spuren am Boden hatte die Wucht der Attacke Blutfäden und -tropfen an den Wänden, dem Sofa, den Lampenschirmen, sogar den Vorhängen hinterlassen.
Ein trüber, analytischer Teil ihres Hirns sagte: So sieht also der Tatort eines Mordes aus.
Kate sah verschmierte, blutige Fußabdrücke, die einem gewundenen Pfad folgten. Am gegenüberliegenden Rand der Pfütze befand sich ein gekrümmter Schmierfleck, der aussah, als hätte der ausgestreckte Arm ihres Bruders dort gelegen. Es schien ziemlich eindeutig, dass John verzweifelt versucht hatte zu entkommen. Er hatte sich nicht einfach in sein Schicksal ergeben. Er hatte um sein Leben gekämpft.
»Was macht denn die hier oben?«, fragte Kate und zeigte auf etwas.
Eine rostige Heugabel mit vier Zinken lag neben der Blutlache auf dem Boden. Neben ihr stand eine gelbe Plastikmarkierung mit der schwarzen Zahl ›6‹. Langsam verstand sie, warum die Ermittler so viele Fragen hatten.
»Mein Vater hat damit immer im kleinen Garten auf der Rückseite gearbeitet. Im Herbst hat er damit Kartoffeln ausgegraben.«
Mit gerunzelter Stirn bückte sie sich ein wenig, um genauer hinzusehen. »Die Zinken sind angespitzt worden. Mein Vater hat damit nur Erde umgegraben. Sie war immer rostig und nicht spitz. Die Zinken sehen aus, als wären sie nachgefeilt worden.«
Bevor sie etwas erwidern konnten, deutete Kate auf vier splitterige Löcher im Kiefernholzboden, mitten in einem großen Blutfleck. »Sieht aus, als hätte sie jemand da vorne in den Boden gerammt.«
Detective Sanders nickte. »Ich fürchte, der Mörder hat sie benutzt, um den Fuß Ihres verstorbenen Bruders an den Boden zu nageln, wahrscheinlich damit er nicht fliehen konnte.«
Kate stand vor Verblüffung der Mund offen. »Warum hat er ihm nicht einfach eins auf den Kopf gegeben?«
»Die Antwort darauf kennen wir noch nicht«, erwiderte Detective Janek. »Manchmal ist es einfach blinde Wut, manchmal haben sie einen Grund. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn fragen.«
An ihrem eiskalten, beherrschten Gesichtsausdruck erkannte Kate, dass Detective Janek vorhatte, dieses Versprechen tatsächlich zu halten.
Sie musste den Blick schließlich von der Frau abwenden, um sich umzusehen.
Nach der Art und Weise zu urteilen, wie das Blut überall hingespritzt war, hielt sie es für einen Akt der blinden Wut.
»Wissen Sie, wo die Heugabel aufbewahrt wurde?«, erkundigte sich Sanders.
Kate nickte. »Im Keller.«
Er wandte sich einem der Kriminaltechniker zu, machte mit seinem Stift eine wackelnde Geste in Richtung Boden und sagte mit leiser Stimme: »Sie können sie jetzt mitnehmen.«
Der kahl werdende Mann, der blaue Latexhandschuhe trug, ging in die Hocke und schob die Heugabel vorsichtig in einen langen Pappkarton.
Detective Janek nahm Kate sanft am Ellbogen und führte sie weg. »Was wir Ihnen wirklich gerne zeigen wollen, ist im Keller.«
»Im Keller?« Kate konnte sich nicht vorstellen, was sie dort erwartete, aber sie folgte Detective Sanders, der in diese Richtung aufbrach, nachdem Janek ihm zugenickt hatte.
Im Unterschied zum Wohnzimmer befand sich im kurzen Flur kein Blut an den Wänden. Kate blieb in der Küche stehen. In einem grünen Plastikbecher in der Spüle steckten schmutzige Gabeln und Löffel.
»John hat das Geschirr immer sofort gespült. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je gesehen hätte, wie er dreckiges Geschirr so stehen lässt. Das Spülen war eine seiner Zwangshandlungen.«
»Fällt Ihnen noch irgendwas Ungewöhnliches auf?«, erkundigte sich Detective Janek.
»Meine Bilder.« Sie deutete an eine Stelle. »John hatte Fotos von mir am Kühlschrank. Die Ecken waren alle umgeknickt. Manchmal hat er sie abgenommen und sie zur Sicherheit in seine Tasche gesteckt. Ansonsten waren sie immer hier, am Kühlschrank.«
Andere Fotos hingen noch dort – eins von den voll erblühten Büschen im Garten, ein altes von ihren Eltern. Aber der Rest bestand vorwiegend aus Zeitungsausschnitten.
Sie warf den Ermittlern einen Blick zu. »Hatte John meine Fotos bei sich?«
Detective Sanders schüttelte den Kopf und notierte sich etwas auf seinem Block. »In seinen Taschen waren keine Bilder.«
Kate fragte sich, wo sie geblieben waren.
»Und diese Magnete auf dem Boden, damit hat er die Fotos von Ihnen am Kühlschrank befestigt?«, fragte Detective Janek.
Es klang eher wie eine Feststellung, nicht wie eine Frage. Kate bestätigte es mit einem Nicken.
Es fühlte sich so merkwürdig an, in diesem Haus zu sein. Sie war hier aufgewachsen, hatte sich hier immer sicher gefühlt, aber jetzt wirkte es fremdartig. Der Frieden war gestört worden. Es fühlte sich … gefährlich an.
Sie folgte dem stämmigen Sanders durch die Küche und die Holztreppe in den modrigen Keller hinab. Janek ging hinter Kate. Die beiden nackten Glühbirnen leuchteten und warfen scharfkantige Schatten.
Was Kate unten zu sehen bekam, machte sie sprachlos.
»Wir vermuten«, sagte Detective Sanders und wählte seine Worte mit Bedacht, »dass Ihr Bruder hier unten jemanden angekettet hatte.«
Eine schwere Kette war mit einem Vorhängeschloss an einem großen Ring im Betonboden befestigt. Der Eisenring war einmal als Ankerpunkt benutzt worden, als man eine der Grundmauern begradigt hatte. Damals war sie noch klein gewesen, aber sie erinnerte sich vage an Männer, die im Keller gearbeitet hatten, und auch an eine Kette, die durch diesen schweren Ring geführt worden war.
Stücke gebrochenen Metalls lagen am Ende der schlangenartig am Boden liegenden Kette. Seitlich davon, vor der aus Mörtel und Ziegeln bestehenden Grundmauer, stand ein Papierkorb, der vor benutzten Papptellern überquoll. Weitere Teller lagen wahllos verstreut, als hätte jemand sie einfach beiseitegeworfen. An den meisten klebten angetrocknete Essensreste.
»Die Kette reicht gerade bis zur Toilette und dem Waschbecken da in der Ecke.« Detective Sanders deutete mit dem Stift dorthin. »Aber nicht bis hierher, zur anderen Seite des Raums.«
An der jenseits der Reichweite der Kette liegenden Seite türmte sich viele Jahre altes, verstaubtes Gerümpel. Dort fand sich alles Mögliche, von einem alten Wasserheizgerät, das ihr Vater hatte wegwerfen wollen, über Kartons mit Weihnachtsdekoration für den Außenbereich bis hin zu Fensterblenden und defekten Stühlen. In der Ecke standen eine Harke, eine Hacke und verschiedene Schaufeln. Bei allen war das Metall verrostet.
»Die Heugabel hat immer da drüben gestanden.« Kate zeigte auf die Werkzeugsammlung. »Die war genauso rostig wie die anderen Sachen.«
Sanders warf einen Blick auf die Geräte und nickte. »Anscheinend war jemand ein paar Wochen lang hier unten angekettet.«
Kate wies auf einen Schraubenzieher, eine Zange und eine Feile am Boden. »Er muss seine Kleidung benutzt haben, vielleicht seinen Gürtel, um eins der Werkzeuge vom anderen Ende schnappen und zu sich heranziehen zu können. Sieht aus, als hätte er damit die Kette zerstört.«
»Das nehmen wir ebenfalls an«, bestätigte Sanders.
Kate sah einen Haufen abgefeilter Eisenreste. »Scheinbar hat er eine Feile benutzt, um die Heugabel anzuspitzen.«
Der Detective neigte den Kopf und betrachtete die ringsum liegenden verschmutzten Pappteller. »Hat Ihr Bruder jemals vorher so etwas getan?«
»Nein, nie«, antwortete sie ohne Zögern, während sie sich umblickte. »Ich kann mir das alles nicht erklären.«
»Ist Ihr Bruder je gewalttätig geworden?«
Kate schüttelte den Kopf, noch während er die Frage aussprach. »Nein«, erwiderte sie mit Nachdruck. »Nein. Das lag nicht in seiner Natur. Ich meine, ich weiß, wie das hier aussieht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass John so etwas getan hat. Er war schüchtern. Wenn ihn jemand beschimpft hat, ist er weggelaufen. Er hat sich nie in Kämpfe verwickeln lassen. Soweit ich weiß, hat er sich nie gewehrt, selbst wenn ihn jemand herumgeschubst hat. Danach hat er sich höchstens in sein Zimmer gesetzt und vor sich hin gegrübelt.«
Detective Sanders ließ den Blick noch einmal durch den Raum schweifen. »Sieht aus, als wäre er über die Grübelphase hinausgekommen.«
Sie hob entnervt die Arme. »Und was wollen Sie damit sagen?« Sie ließ ihre Hände seitlich hinabfallen. »Dass ein geistig behinderter Mann mit dem Verstand eines Kindes einen wahnsinnigen, Augäpfel fressenden Killer überwältigt und hier unten in Ketten gelegt hat?«
Sanders zog eine Augenbraue hoch.
»Danach sieht es jedenfalls aus.«
5
Detective Janek lenkte den stahlgrauen, nicht gekennzeichneten Polizeiwagen an den Bürgersteig, brachte den Schalthebel in Parkstellung und stellte den Motor ab. In Johns Haus waren immer noch Polizisten, und diese würden auch den Rest der Nacht dortbleiben. Sie hatte Kate mitgeteilt, dass die Mordermittler gleich am Morgen wiederkommen würden, um weiter Beweise zu sammeln, alle Nachbarn zu befragen und möglichen Spuren nachzugehen. Sie hatte gesagt, dass sie nach Hause fahren wollte, um ein paar Stunden zu schlafen, und Kate angeboten, sie ebenfalls heimzubringen.
Aber Kate wusste, worum es ihr wirklich ging. Sie wusste, dass es nicht nur ein freundliches Angebot war. Die Mordermittlerin wollte die Gelegenheit nutzen, allein mit ihr zu sprechen, um sie unverbindlich aushorchen zu können, ohne dass es wie ein Verhör wirkte.
In ihrem eigenen Job machte Kate die Leute oft nervös. Wenn sie aufkreuzte, bedeutete das immer, dass es Probleme gab, und sie war dort, um der Sache auf den Grund zu gehen. Die unschuldigen, fleißigen Mitarbeiter machte sie mit ihren Nachforschungen oft nervöser als diejenigen, die die Probleme eigentlich verursachten. Deshalb versuchte sie in diesen Fällen, ihre Erkundigungen auf sanfte, nicht bedrohliche Weise anzustellen.
Sie tat ihr Bestes, um bei der sanften Befragung durch die Ermittlerin offen und ehrlich zu bleiben, hatte jedoch keine echten Antworten für sie parat. Aber sie wollte, dass der Mörder ihres Bruders gefunden und einer gerechten Strafe zugeführt wurde.
Trotz der Fragen zu vielen verschiedenen Themen, die die Frau in ihren Small Talk einfließen ließ, spürte Kate, dass sie noch etwas anderes im Sinn hatte.
Ihr selbst ging es genauso. Was sie im Keller gesehen hatte, hatte sie verwirrt und erschüttert, aber diese Gedanken wurden von Trauer überschattet. Durch ihre Arbeit und die Tatsache, dass sie den Großteil ihrer Freizeit mit John verbracht hatte, hatte sie nie die Chance gehabt, enge Freundschaften einzugehen. Daher war ihr Bruder auf eine gewisse Weise nicht nur derjenige gewesen, für den sie verantwortlich war, sondern auch ihr engster Freund. Nun hatte sie das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein.
John hatte sich immer auf sie verlassen. Sie hätte wissen müssen, dass etwas nicht stimmte. Sie hätte für ihn da sein sollen. Als sie noch klein gewesen war, hatte ihre Mutter ihr oft mit ernstem Ton gesagt, dass sie beide auf John aufpassen müssten, weil dieser es nicht selbst tun könne. So sei es nun einmal. Sie hatte immer geahnt, dass die Worte ihrer Mutter die nicht ausgesprochene Botschaft enthielten: Manchmal ist das Leben nicht fair, aber das lässt sich nicht ändern. Nach dem Tod ihrer Eltern war die Aufgabe, auf ihren Bruder aufzupassen, ganz allein Kate zugefallen.
John war immer ein guter Zuhörer gewesen, hatte sie nie unterbrochen, wenn sie ausgedehnte Vorträge über ihre eigenen Probleme bei der Arbeit hielt. Seine Probleme hingegen konnte sie meist leicht beheben. Doch sie kam nicht umhin, sich zu fragen, ob sie die falschen Entscheidungen getroffen hatte, was das Leben ihres Bruders betraf, und ob diese dazu beigetragen hatten, dass er allein und voller Angst gestorben war.
Vor allem jedoch war ihr bewusst: Sie hätte für ihn da sein müssen.
»Das ist alles meine Schuld«, sagte sie und starrte auf die bedeutungslosen Zahlen, Adressen und Namen auf dem Computerbildschirm der Polizei, der zwischen den Vordersitzen angebracht war.
»Es ist normal, dass man sich schuldig fühlt, dass man glaubt, man hätte irgendwas tun können. Aber so ist es nicht, Kate.«
Kate blickte auf den Bildschirm, ohne ihn wirklich zu sehen. »Doch, ist es. Ich hätte das verhindern können.«
Die Ermittlerin hielt einen Moment inne, bevor sie fragte: »Wie meinen Sie das?«
Schließlich warf Kate der Frau einen Blick zu. »Mein Rückflug war heute Nachmittag. Ich hatte eigentlich einen Flug für morgen Abend gebucht, aber ich war mit meiner Untersuchung dort fertig und habe durch Glück heute noch einen Flieger bekommen. Ich hätte John bei seinem Arbeitsplatz abholen oder bei ihm zu Hause auf ihn warten können. Wenn ich zuerst zu seinem Haus gefahren wäre …«
Detective Janek runzelte die Stirn. »Warum haben Sie’s nicht getan?«
Kate schluckte. »Eine Frau, die ich von der Arbeit kenne, liegt im Krankenhaus. Ich habe davon gehört, als ich unterwegs war. Als ich zurückkam, hat mir der Fahrer aus dem Büro, der mich am Flughafen abholte, gesagt, dass sie die Nacht wahrscheinlich nicht überlebt. John hat erst morgen Abend mit mir gerechnet, also habe ich mich von dem Fahrer zu Hause absetzen lassen, damit ich meine Taschen loswerden und mich umziehen konnte. Dann habe ich mich zum Krankenhaus bringen lassen. Ich wollte sie besuchen. Ich wollte für ihre Familie da sein. Sie hat eine nette Familie.«
»Oh. Tut mir schrecklich leid, das zu hören. Was ist mit ihr?«
Kate sah wieder zum Bildschirm. »Eine Seite ihres Gesichts ist eingeschlagen. Die Augenhöhle ist zerquetscht. Selbst wenn sie überlebt, wird sie auf diesem Auge blind sein, haben die gesagt. Sie hat einen Hirnschaden durch Knochensplitter. Ihr Mann hat mir erzählt, dass sie sie schon zweimal operiert haben, um ihr Leben zu retten, aber auch die Ärzte können nicht zaubern. Er sagte, selbst wenn sie überlebt, wird sie nie mehr die alte Wilma sein.«
»Wilma …« Janeks Augen zuckten zum Computer. »Wie ist das passiert?«
»Vor ein paar Tagen wollte sie irgendwo zum Mittagessen gehen und ein Kerl ist an ihr vorbeigegangen, direkt vor unserem Gebäude. Er hat sie plötzlich ins Gesicht geschlagen, so fest er konnte. Er war groß und stark. Sie war klein und zerbrechlich. Sie ist umgefallen und seitdem nicht wieder aufgewacht. Ihre Kinder waren im Krankenhaus. Die Ärzte haben ihnen allen gesagt, dass sie die Nacht wahrscheinlich nicht übersteht.
Die Leute bei der Arbeit sagten, dass ein verschwommenes Video davon online gestellt wurde. Die Typen im Video lachen darüber, wie sie fällt, und geben dem Kerl, der es getan hat, einen High five.«
Die Polizistin nickte. »Jetzt weiß ich, von wem Sie sprechen. Ich habe den Bericht gelesen. Da hat wieder jemand das Knock-out-Spiel gespielt.«
Kate schüttelte den Kopf, ohne den Blick zu heben. »Tolles Spiel. Sie wird vielleicht sterben.«
»Da wäre sie weder die Erste noch die Letzte. Diese Videos verbreiten sich wie eine Seuche. Wir hatten hier eine ganze Reihe solcher Angriffe, und ein paar andere Städte auch.
Meiner Auffassung nach ist das Mord oder zumindest versuchter Mord, aber sie werden selten geschnappt. Weil es so willkürlich ist, haben sie keinerlei Verbindung zu ihren Opfern. Und da es meistens nicht möglich ist, die Angreifer anhand der Videos zu identifizieren, gibt es nur wenige Beweismittel. Selbst wenn sie gefasst werden, passt ihre Strafe selten zu dem Schaden, den sie anrichten.«
»Kaum zu glauben, was aus der Welt geworden ist.«
»Da bin ich ganz Ihrer Meinung«, seufzte Janek. Sie schaute zu Kate hinüber. »Sie sind also hingefahren, um sie zu besuchen, anstatt zuerst zu John zu fahren?«
»Ja.« Kate blickte ihr in die dunklen Augen. »Der Fahrer hat mich nach Hause gebracht, nachdem ich für einige Zeit im Krankenhaus war. Ich hatte einen langen Tag hinter mir und war müde. John hat erst morgen mit mir gerechnet, also hatte ich geplant, früh ins Bett zu gehen und genug Schlaf zu bekommen, um dann morgen zu ihm zu gehen.
Ich habe ihn aus dem Auto angerufen, als ich fast zu Hause war. Als er mich angeschrien hat, dass ich weglaufen soll, habe ich sofort die 911 angerufen, während der Fahrer mich schnell zu John gebracht hat. Aber Sie waren alle schon vor mir da.
Hätte ich es so gemacht, wie ich es ursprünglich geplant hatte, und John überrascht, indem ich ihn bei der Arbeit abhole, statt zum Krankenhaus zu fahren, dann wäre er jetzt nicht tot. Aber ich wollte ihn nicht dorthin mitnehmen. Er mag es nicht, andere Menschen leiden zu sehen.«
»Sie haben einfach das getan, was am sinnvollsten war.«
Kate spürte einen Kloß im Hals und schluckte ihn hinunter. »Nein, ich hätte mich zuerst um meinen Bruder kümmern sollen. Wenn ich zu ihm gefahren wäre, hätte ich gemerkt, dass etwas los ist, dass jemand im Keller angekettet ist. Ich hätte es herausgefunden und die Polizei gerufen.«
Sie wandte sich ab und starrte aus dem Fenster in die Dunkelheit. »Wilma war bewusstlos und hat nicht einmal bemerkt, dass ich dort war. Ich hatte John seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Ich hätte erst nach ihm schauen sollen, dann wäre das nie passiert. John hätte es mir erzählt. Es ist meine Schuld, dass er tot ist.«
»Das stimmt nicht, Kate.« Detective Janek beugte sich etwas näher heran. »Hören Sie zu. Jemand hat ihn ermordet. Das ist der Schuldige, nicht Sie. Wenn Sie zuerst dorthin gefahren wären, wäre der einzige Unterschied gewesen, dass Sie dort auf eine sehr bizarre Szene gestoßen wären – eine unerwartete Szene. Sie wären darauf nicht vorbereitet gewesen und wären genauso wie Ihr Bruder ermordet worden. Was immer sich abgespielt hat, sein Tod ist nicht Ihre Schuld. Das muss Ihnen klar sein.«
Kate reagierte mit einem knappen Lächeln. »Ich wünschte, ich könnte das glauben.«
»Eines Tages werden Sie das. Bis dahin werde ich sehr hart arbeiten, um den Kerl zu finden, der das getan hat. Es gibt eine Menge Leute, die wir befragen müssen. Wir werden eine Spur finden, die uns zum Killer führt.«
»Haben Sie die Namen all der Leute, die in der Nähe standen und zugeschaut haben?«
»Worauf Sie sich verlassen können.«