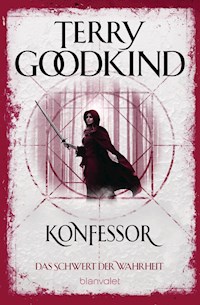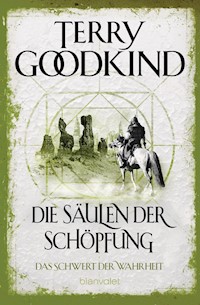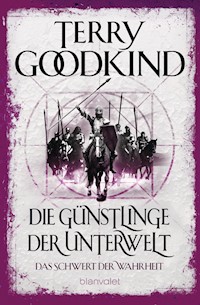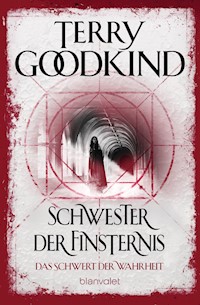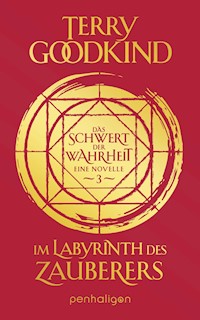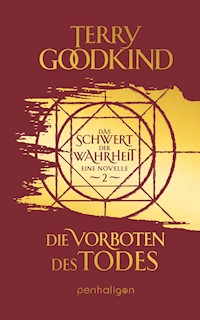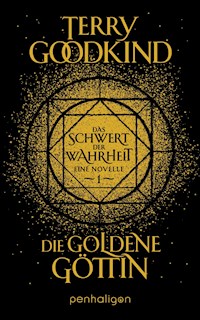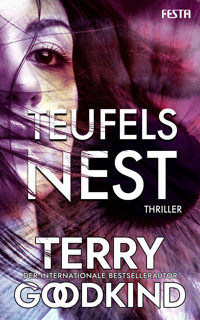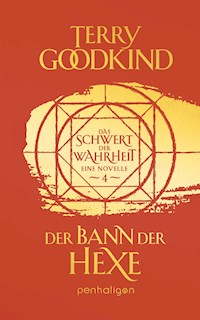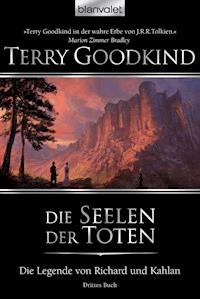
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Legende von Richard und Kahlan
- Sprache: Deutsch
Die Armee der Toten schreitet voran — nur Richard und Kahlan können sie aufhalten
Zwei unerbittliche Generäle führen eine riesige Totenarmee aus den hintersten Winkeln des D‘Haranischen Reiches bis in dessen Zentrum. Doch ihr Ziel ist nicht die Zerstörung des Reiches, sie wollen die Welt der Lebenden vernichten.
Richard und Kahlan sind mit der Essenz des Todes infiziert, was ihnen ihre Kräfte raubt und sie schließlich das Leben kosten wird. Sie müssen um jeden Preis den Palast des Volkes erreichen, um sich und das Reich zu retten. Doch die tödliche Bedrohung lauert überall ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Zwei unerbittliche Generäle führen eine riesige Totenarmee aus den hintersten Winkeln des D’Haranischen Reiches bis in dessen Zentrum. Doch ihr Ziel ist nicht die Zerstörung des Reiches, sie wollen die Welt der Lebenden vernichten. Richard und Kahlan sind mit der Essenz des Todes infiziert, was ihnen ihre Kräfte raubt und sie schließlich das Leben kosten wird. Sie müssen um jeden Preis den Palast des Volkes erreichen, um sich und das Reich zu retten. Doch die tödliche Bedrohung lauert überall …
Das Schwert der Wahrheit bei Blanvalet in der ungeteilten, dem Original entsprechenden Taschenbuchausgabe:
Erstes Buch: Das erste Gesetz der Magie
Zweites Buch: Die Schwestern des Lichts
Drittes Buch: Die Günstlinge der Unterwelt
Viertes Buch: Der Tempel der vier Winde
Fünftes Buch: Die Seele des Feuers
Sechstes Buch: Schwester der Finsternis
Siebtes Buch: Die Säulen der Schöpfung
Achtes Buch: Das Reich des dunklen Herrschers
Neuntes Buch: Die Magie der Erinnerung
Zehntes Buch: Am Ende der Welten
Elftes Buch: Konfessor
Die Legende von Richard und Kahlan bei Blanvalet:
Erstes Buch: Dunkles Omen
Zweites Buch: Im Reich der Jäger
Drittes Buch: Die Seelen der Toten
Terry Goodkind
Die Seelen der Toten
Die Legende von Richard und Kahlan
Drittes Buch
Roman
Deutsch
von Caspar Holz
1
»Bringt uns unsere Toten.«
Im selben Moment, als er hinter sich die Stimme hörte, spürte Richard den Griff einer eiskalten Hand auf seiner Schulter.
Er zog sein Schwert und wirbelte herum.
Das unverwechselbare stählerne Klirren zerriss die gedämpfte frühmorgendliche Stille. Die seiner Klinge innewohnende Kraft folgte dem Ruf und erfüllte Richard in Vorbereitung auf den Kampf mit Zorn.
Im Dunkel, unmittelbar hinter der Stelle, wo er auf Wache gewesen war, standen drei Männer und zwei Frauen. Das verglimmende Lagerfeuer, das ein Stück weit hinter ihm brannte, warf ein schwaches, rötlich flackerndes Licht auf die fünf versteinerten Mienen. Untätig standen die ausgezehrten Gestalten da, mit hängenden Schultern, die Arme kraftlos an den Seiten.
Neben einer ersten Andeutung auf den bevorstehenden Regen trug die Luft den Geruch von Holzrauch von dem Feuer hinten beim Lager heran, den Duft von Balsamtannen und des ganz in der Nähe wachsenden Zimtfarns, ihrer Pferde sowie den muffigen Geruch des feuchten, den Boden bedeckenden Laubs. Richard meinte plötzlich auch einen Hauch von Schwefel wahrzunehmen.
Obwohl keiner der fünf bedrohlich wirkte oder so auftrat, ließ die knisternde Energie der uralten Waffe, die er in Händen hielt, sein Herz wild pochen. Ihre passive Haltung war nicht dazu angetan, sein Gefühl von Gefahr zu zerstreuen, seine Kampfbereitschaft zu vermindern, sollten sie plötzlich zum Angriff übergehen.
Mehr als alles andere beunruhigte ihn allerdings der Umstand, dass er in der frühmorgendlichen Stille zwar auf jedes Geräusch gelauscht, auf jede Bewegung geachtet hatte – schließlich bestand darin der Sinn des Wachestehens –, aber er hatte die fünf Fremden von hinten weder kommen gehört noch sie gesehen.
Für Richard war der Aufenthalt im Wald eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es war praktisch undenkbar, dass sich auch nur ein Eichhörnchen unbemerkt an ihn heranschlich, von fünf Personen ganz zu schweigen.
Und doch hatten es diese fünf getan.
Richard war nur ein falsches Wort, eine plötzliche Bewegung davon entfernt, seine Zurückhaltung aufzugeben, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Gedanklich hatte er diesen Schritt bereits vollzogen, jede Bewegung vorausberechnet und entschieden. Sollte auch nur einer der fünf irgendetwas Falsches tun, würde er nicht zögern, sich selbst und seine Begleiter im Lager hinter ihm zu verteidigen.
»Wer seid ihr?«, fragte er. »Was wollt ihr hier?«
»Wir sind gekommen, um bei unseren Toten zu sein«, antwortete eine der beiden Frauen in demselben teilnahmslosen Ton wie schon zuvor der erste Sprecher. Alle fünf schienen starren Blicks geradewegs durch ihn hindurchzusehen.
»Bringt sie zu uns«, setzte die zweite Frau im selben unheimlichen Tonfall hinzu. Wie die anderen schien sie aus wenig mehr als Haut und Knochen zu bestehen.
»Wovon redet ihr da?«, wollte Richard wissen.
»Bringt uns unsere Toten«, wiederholte einer der anderen Männer.
»Welche Toten denn?«, fragte Richard.
»Unsere«, meldete sich ein anderer mit teilnahmsloser Stimme.
Die Antworten drehten sich im Kreis und brachten ihn nicht weiter.
Drüben, im Lager hinter ihm, nahm Richard eine leise, planvolle Unruhe wahr, als die Soldaten der Ersten Rotte, vom Geräusch des Ziehens seines Schwertes geweckt, ihre Decken abwarfen und aufsprangen. Er wusste, in diesem Moment griffen sie zu den unmittelbar neben ihren Schlafplätzen bereitliegenden Schwertern, Lanzen und Streitäxten. Es waren Männer, die jederzeit auf Ärger vorbereitet waren.
Ohne die fünf länger als nötig aus den Augen zu lassen, hielt Richard kurz zu beiden Seiten hin nach weiteren Gefahren Ausschau und wusste, die Soldaten in seinem Rücken würden sich per Handzeichen über ihre Verteidigungspositionen verständigen. Trotz der Entfernung und ihres umsichtigen Vorgehens konnte Richard hier einen Schritt wahrnehmen, dort ein Rascheln im Laub, und, etwas seitlich, das Schmatzen von Morast, als einige von ihnen sich mit schnellen Schritten durch den Wald bewegten, um die Fremden einzukreisen.
Diese Männer waren die Besten der Besten – erfahrene Soldaten, die hart gearbeitet hatten für den Eintritt ins Elitekorps der Ersten Rotte. Sie alle hatten jahrelange Kampfeinsätze hinter sich, und schon jetzt hatten seit dem Vordringen in die Dunklen Lande nicht wenige aus ihren Reihen ihr Leben gelassen, um Richard und Kahlan sicher zum Palast zurückzubringen.
Allerdings war es bis nach Hause nach wie vor ein weiter Weg.
»Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet«, erklärte Richard, während er die entrückten Blicke der fünf Leute vor ihm beobachtete.
»Unsere Toten«, wiederholte die erste Frau mit lebloser Stimme.
Richard runzelte die Stirn. »Und wieso sagt ihr das mir?«
»Weil Ihr der Eine seid«, erklärte der Mann, der ihn berührt hatte.
Einen nach dem anderen streckte Richard in einer wellenförmigen Bewegung seine Finger und korrigierte seinen Griff am Schwert. Sein Blick wanderte von einer leeren Miene zur nächsten.
»Der Eine? Wovon redet ihr?«
»Ihr seid fuer grissa ost drauka«, warf ein anderer ein. »Ihr seid der Eine.«
Eine kribbelnde Gänsehaut kroch Richards Nacken hoch. Fuer grissa ost drauka bedeutete in der alten Sprache Hoch-D’Haran »Überbringer des Todes«, ein Name, der ihm in den Weissagungen gegeben worden war. Außer ihm selbst waren nur sehr wenige Menschen mit der toten Sprache Hoch-D’Haran vertraut.
Vielleicht noch verstörender aber war, wieso diese fünf wussten, dass sich der Name auf ihn bezog.
Er hielt seine Schwertspitze auf die fünf gerichtet, um sicherzustellen, dass sich keiner von ihnen nähern konnte – auch wenn niemand dies versuchte. Er wollte halt sichergehen, dass er im Notfall Platz zum Kämpfen hatte.
»Und wo habt ihr das aufgeschnappt?«, fragte er.
»Ihr seid der Eine – Ihr seid der fuer grissa ost drauka: der Überbringer des Todes«, erklärte eine der Frauen. »Das ist es, was Ihr tut: Ihr bringt den Tod.«
»Und wie kommt ihr darauf, ich könnte euch eure Toten bringen?«
»Wir haben lange nach unseren Toten gesucht«, erklärte sie. »Ihr müsst sie zu uns bringen.«
»Bringt uns unsere Toten«, wiederholte einer der anderen – zum ersten Mal mit einem Anflug von rätselhafter Beharrlichkeit, der Richard nicht gefiel.
Für diese fünf schien dies irgendeinen Sinn zu ergeben, nicht jedoch für Richard, außer auf entschieden verquere Weise. Er war mit den drei uralten Bedeutungen des Begriffs fuer grissa ost drauka vertraut und wusste, wie diese sich auf ihn bezogen.
Diese fünf jedoch bedienten sich ihrer auf völlig andere Art.
Hinter sich konnte er Kahlan hören, die zu ihm zurückgelaufen kam. Er erkannte das unverwechselbare Geräusch ihrer Schritte. Sie war vor dem Morgengrauen eine ganze Weile mit ihm zusammen gewesen und erst Augenblicke zuvor zum Lager zurückgegangen. Als sie jetzt herbeigestürzt kam, streckte er seinen linken Arm vor, damit sie nicht im Weg war, sollte er sein Schwert benutzen müssen.
»Was geht hier vor?« Sie keuchte, als sie nicht weit entfernt abrupt stehen blieb.
Richard sah kurz über seine Schulter. Die angespannte Besorgnis auf ihrem Gesicht vermochte der makellosen Schönheit ihrer vertrauten Züge nichts anzuhaben.
Richard wandte sich wieder zu den fünfen herum, um sie im Auge zu behalten.
Sie waren verschwunden!
Überrascht kniff er die Augen zusammen und sah sich um. Er hatte gerade mal den Bruchteil einer Sekunde fortgesehen. Es war unmöglich, und doch waren alle fünf verschwunden.
»Sie haben doch gleich hier gestanden«, meinte er, halb zu sich selbst.
In dem kurzen Augenblick, als er sich zu Kahlan umgedreht hatte, hätten sie sich unmöglich irgendwo verstecken können …
»Wer denn?«, wollte Kahlan wissen und beugte sich zur Seite, um an ihm vorbeizuspähen.
Richard streckte den Arm und zeigte beharrlich mit dem Schwert. »Noch vor wenigen Sekunden standen hier fünf Leute.«
Die dünnen Himmelsstreifen, die man durch die Lücken im Laubdach sehen konnte, begannen sich in der aufkommenden Morgendämmerung zu einem bleiernen, gedämpften, rot getönten Grau zu verfärben. Kahlan war klug genug, Richards Beobachtung nicht einfach abzutun. Sie suchte das nahe Dunkel zu beiden Seiten mit den Augen ab.
»Waren das Halbmenschen?«, fragte sie mit spürbarer Besorgnis in der Stimme.
Richard spürte noch immer die Eiseskälte, dort, wo einer der Männer ihn an der rechten Schulter berührt hatte.
»Nein, das glaube ich nicht. Einer von ihnen hat mich mit der Hand berührt – wie um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie haben nicht die Zähne gebleckt. Ich glaube nicht, dass sie gekommen waren, um meine Seele zu rauben.«
»Bist du sicher?«
»Ziemlich.«
»Haben sie irgendwas gesagt?«
»Sie meinten, ich solle ihnen ihre Toten bringen.«
Kahlans Mund öffnete sich in stummer Verblüffung. Richard betrachtete die Stelle, wo sie eben noch gestanden hatten, sah sich noch einmal nach irgendeinem Hinweis auf die fünf um. In diesem trüben Dunkel waren keine Fußspuren zu erkennen.
Die Arme um den Körper geschlungen, trat Kahlan schließlich näher. »Da ist niemand, Richard.« Sie wies zu den Bäumen hinüber. »Und nichts, wo man sich verstecken könnte, es sei denn, man geht zurück bis in den Wald. Wie hätten sie verschwinden können?«
Aus der Dunkelheit kamen Dutzende Soldaten der Ersten Rotte, seine Leibgarde, herbeigeeilt, um einen Schutzring um ihn zu bilden. Jeder der groß gewachsenen Männer hatte eine Waffe zur Hand, bereit, sich gegebenenfalls einen erbitterten Kampf zu liefern.
»Lord Rahl«, erkundigte sich einer der Offiziere. »Was gibt es? Was ist passiert?«
»Hier waren fünf Leute – gerade eben noch.« Richard gestikulierte mit seinem Schwert. »Sie hatten sich von hinten angeschlichen und standen gleich dort drüben.«
Der Soldat versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen, dann stürzte mindestens ein Dutzend Männer wortlos davon, hinein in den Wald, um nach den Eindringlingen zu suchen. Obwohl die Morgendämmerung bereits begonnen hatte, den stillen Wald in ein trübes graues Licht zu tauchen, war es noch immer so dunkel, dass es, dessen war sich Richard bewusst, ein Leichtes gewesen wäre, jemanden zu übersehen, der sich in einem derart dichten Wald verbarg.
Doch er glaubte nicht, dass die fünf irgendwo kauerten und sich versteckten.
Er wusste es besser.
Er wusste, sie waren verschwunden.
2
»Was gibt es?«, rief Nicci, während sie sich einen Weg durch den dichten Schutzring aus hochgewachsenen Soldaten bahnte. Ihr Blick glitt kurz zu seinem Schwert, wahrscheinlich um zu sehen, ob es blutverschmiert war. Trotz der Größe der Männer und ihrer furchterregenden Waffen machte Niccis Gabe sie vermutlich tödlicher als sämtliche Soldaten zusammen. Würde seine Gabe funktionieren, hätte er die Aura ihrer Kraft erkennen können, die sie schimmernd umgab.
»Während ich Wache stand, sind von hinten fünf Leute gekommen«, erklärte ihr Richard, als auch Zedd durch die von Nicci geschaffene Lücke herbeieilte. »Ich habe sie erst bemerkt, als mich einer von ihnen an der Schulter berührte.«
Nicci musste zweimal hinsehen. »Sie sind einfach auf dich zugegangen, und einer hat dich an der Schulter berührt?«
»Leute?« Zedd spähte rechts und links an Richard und Kahlan vorbei. »Was denn für Leute?«
Jetzt kamen hinter Zedd auch Samantha und ihre Mutter Irena angelaufen. Trotz ihrer jungen Jahre hatte Samantha, früher auch gerne mal Sammie genannt, ihre außerordentlichen Fähigkeiten als Hexenmeisterin bereits unter Beweis gestellt. Über die Gabe ihrer Mutter wusste Richard noch nicht viel, aber wenn Samantha ein Indiz war, dann war ihre Mutter womöglich ziemlich beeindruckend.
Den Kenntnissen, Fähigkeiten und Kräften der um ihn Versammelten zum Trotz befanden sie sich in einem gefährlichen Land, das sie alle in Gefahr brachte. Der Umstand, dass sich ihnen fünf Personen hatten nähern und anschließend wieder verschwinden können, unterstrich nur noch die Gefährlichkeit der Dunklen Lande.
»Ist mit Euch alles in Ordnung, Lord Rahl?«, erkundigte sich Irena mit besorgter Miene und streckte eine Hand vor, um Richard am Arm zu berühren.
Als er dies nickend bejahte, schob sich Nicci geschickt, aber behütend neben ihn, nah genug, um Irena sanft zur Seite zu drängen.
»Sie haben sich heimlich von hinten angeschlichen?« Den Kopf schräg, musterte sie Richard.
Richard wies resigniert hinter sich. »Gleich hier haben sie gestanden, und dann waren sie plötzlich fort.«
Zedd legte den Kopf schräg, senkte seine buschigen Brauen und starrte angespannt mit einem Auge. »Verschwunden?«
»Ja, verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin sind. Ich habe sie weder kommen noch gehen sehen. Als ich mich wieder herumdrehte, um sie im Auge zu behalten, waren sie einfach nicht mehr da.«
Das Kinn emporgereckt, sog Samantha witternd die Luft ein. Ihrem Gesicht stand der Wandel zu den ausgeprägteren Zügen einer Erwachsenen noch bevor. Sie rümpfte ihr feines Näschen.
»Was ist das für ein Geruch?«, fragte sie ziemlich nachdrücklich, ehe Zedd oder sonst jemand etwas sagen konnte. »Er klingt bereits ab, aber ich meine ihn von irgendwoher wiederzuerkennen.«
Verwirrt über ihre seltsame Frage und ihren alarmierten Ton, blickten sich alle um.
Kahlan runzelte die Stirn. »Jetzt, wo du es sagst, kommt er mir auch bekannt vor.«
Richard, nach wie vor auf der Suche nach irgendeinem Hinweis auf die fünf Fremden, ließ den Blick systematisch über die Schatten wandern. »Das ist Schwefel.«
Samantha strich sich einige ihrer verfilzten schwarzen Haare aus dem Gesicht und sah zu ihm hoch. »Schwefel?«
»Ja – der Geruch des Todes«, erwiderte Richard.
»Nein.« Kahlan klopfte mit dem Daumen auf den Griff ihres in der Scheide steckenden Messers und versuchte sich zu erinnern. »Die Seelen wissen, ich war diesem Geruch oft genug ausgesetzt. Das hier ist ohne Zweifel widerlich, aber es ist nicht der Geruch des Todes. Es ist etwas anderes.«
»Das hat er nicht gemeint«, bemerkte Nicci in einem dunklen und beunruhigenden Ton, während sie einen wissenden Blick mit Richard wechselte, als dieser sich wieder zu ihnen herumdrehte.
»Es ist der Geruch des Totenreichs«, erklärte Richard, »so, als hätte sich für einen kurzen Moment einen Spalt breit die Tür zur Unterwelt geöffnet.«
Alle starrten ihn an.
»Die Unterwelt!« Samantha schnippte mit den Fingern. »Daher kenne ich diesen Geruch. Es war, als ich Euch und die Mutter Konfessor zu heilen versuchte. Als ich in die Nähe dieses giftigen Todeshauchs in Euerm Innern geriet, da ist mir dieser eigentümliche Geruch in die Nase gestiegen.«
Mittlerweile hatte Irena sich hinter ihre Tochter gestellt. Eine Hand auf ihrer Schulter, beugte sie sich vor. »Giftiger Todeshauch? Was denn für ein giftiger Todeshauch?« Ihr Gesicht hatte einen argwöhnischen Zug angenommen – ein Ausdruck, der mit den Falten in der Mitte ihrer Stirn und ihrem schwarzen Haarschopf ganz natürlich einherzugehen schien. »Was hatte meine Tochter in der Nähe von irgendwas zu suchen, das mit der Unterwelt zu tun hat?«
»Jit, die Heckenmagd, hatte Kahlan und mich gefangen genommen«, erklärte Richard. »Bevor sie uns jedoch umbringen konnte, ist es mir gelungen, unsere Ohren mit Pfropfen aus Stoff zu verstopfen und anschließend das in ihrem Innern gefangene Böse zu befreien, das Leuten ihres Schlags innewohnt. Dabei hat sie unwillkürlich einen Schrei ausgestoßen, der den Tod zu ihr rief. Auf diese Weise habe ich sie töten können, und wir konnten entkommen. Leider konnte dieser Laut teilweise trotzdem entweichen. Dieser Durchlass zur Unterwelt ist jetzt in unserem Innern eingeschlossen. Als Samantha später unsere anderen Verletzungen heilte, ist sie in die Nähe dieser tief in unserem Innern verankerten Grenze geraten. Daran hat sie sich gerade erinnert.«
»Samantha versteht von diesen Dingen nichts«, beharrte Irena, während ihr Blick von ihrer Tochter wieder zurück zu Richard ging. »Dafür ist sie viel zu jung. Es steht ihr noch gar nicht zu, sich an solchen Dingen zu versuchen. Sie hat noch viel zu viel zu lernen, ehe sie sich auch nur in die Nähe dieser dunklen Kräfte begibt.«
Samantha legte den Kopf in den Nacken und schaute hoch zu ihrer Mutter; angesichts dieser schrecklichen Erinnerung hatte sie einen tränenfeuchten Glanz in den Augen. »Es war die einzige Möglichkeit, ihre Verletzungen zu heilen. Ich musste es tun, sonst wären sie gestorben. Lord Rahl ist der Eine, dem es bestimmt ist, uns zu retten. Er hat bei der Rettung vieler Bewohner Stroyzas geholfen. Er hat mich bei dem, was ich tun musste, angeleitet. Und dabei, als ich die Heilung vornahm, ist es dann passiert. Plötzlich habe ich diese entsetzliche Finsternis des Todes tief in ihrem Innern gespürt. Und in dem Moment hab ich diesen entsetzlichen Geruch bemerkt. Ich korrigiere das und sage: Gestank.«
»Sie hat recht«, brummte Zedd unglücklich. »Ich erinnere mich an einen Hauch ebendieses Gestanks, seinerzeit, als ich, kurz bevor wir überfallen und gefangen genommen wurden, bei den beiden mit der Heilung begann. Damals war mir gleich klar, das ist der muffige Gestank aus den dunkelsten Tiefen des Totenreichs.« Er wandte den Blick ab. »Diesem außergewöhnlichen Gestank bin ich auch früher schon begegnet.«
»Wenn man sich nahe der Grenze zur Unterwelt befindet und der Tod nicht weit ist«, erklärte jetzt Nicci mit ruhiger Stimme, »kann man es manchmal riechen, das Totenreich jenseits des Schleiers.«
Irena betrachtete die düsteren Gesichter ringsum. »Wenn der Tod nicht weit ist …? Das Totenreich? Hier, jetzt? Was redet Ihr denn da? Wahrscheinlich ist es nichts weiter als irgendeine in der Nähe liegende Schwefelquelle. In den Dunklen Landen gibt es jede Menge solcher Orte. Höchstwahrscheinlich hat der Wind einen Hauch von einer Schwefelquelle herangetragen, die in dieser Richtung liegt, das ist alles.« Sie bedachte Nicci mit einem vielsagenden Blick. »Ich finde, wir lassen uns zu Befürchtungen hinreißen, die völlig unbegründet sind.«
Niccis makelloses Gesicht bekam einen gereizten Zug, als sie ihren Blick auf die Frau heftete. »Ich war früher eine Schwester der Finsternis. Ich habe diesen Gestank oft ertragen, wenn der Hüter der Unterwelt uns im Schlaf heimsuchte, wenn er zu uns kam, um uns zu befehlen, ihm zu Willen zu sein. Deswegen hat die Mutter Konfessor es für eine Erinnerung an einen Traum gehalten. Im Schlaf treten die Bilder und Geräusche der bewussten Welt in den Hintergrund. In diesem Zustand ist sie der Grenze zur Unterwelt näher, die jetzt in ihrem Innern verankert ist.«
Samantha fiel die Kinnlade herunter. »Ihr wart eine Schwester der …«
»Sei still«, zischte ihre Mutter von hinten mit gesenkter Stimme und legte der jungen Frau die Hände auf die Schultern, um ihrer Warnung Nachdruck zu verleihen.
Niccis Bekenntnis schien Samanthas Mutter zu erschüttern. Wie viele Menschen, die abgeschieden lebten, waren Irena und ihre Tochter abergläubisch und vermieden es, über Dinge zu sprechen, die sie ängstigten, um diese rätselhaften Gefahren nicht noch zu beschwören. Und etwas Erschreckenderes als den Hüter der Unterwelt gab es nicht. Richard kannte Schwestern des Lichts, die den Hüter, aus Angst, ihn herbeizurufen, nur als den »Namenlosen« bezeichneten.
Aber er sah auch den Anflug von Argwohn in Irenas dunklen Augen. Frauen, die sich solch dunklen Kräften verschrieben hatten, fanden nie den Weg zurück ins Licht. Nicci jedoch hatte genau dies geschafft.
»Schwefel riecht ganz ähnlich, trotzdem ist es nicht dasselbe wie dieser Gestank aus der Unterwelt. Angesichts meiner früheren Loyalitäten würde es mir schwerfallen, Schwefel mit dem unvergesslichen Gestank der Unterwelt zu verwechseln. Als ich Richard und Kahlan vorhin berührte, um sie zu heilen, konnte ich in aller Deutlichkeit sehen, dass der Tod selbst in den beiden um sich greift.«
In Anbetracht des unverkennbaren Untertons von Kompetenz und Erfahrung in Niccis Stimme verzichtete Irena darauf zu widersprechen.
Das faltige Gesicht angespannt, sah Zedd sich alarmiert um. »Wo steckt eigentlich Cara?«
Richards Großvater wusste: Wenn Richard und Kahlan irgendeine Gefahr drohte, war die Mord-Sith niemals weit.
Seine Worte trafen Richard wie ein Stich ins Herz.
»Sie ist fortgegangen«, erwiderte er ruhig, drehte sich um und sah in die haselnussbraunen Augen seines Großvaters.
Zedds Stirn furchte sich tiefer. »Fortgegangen? Was soll das heißen, fortgegangen? Als wir das Lager aufschlugen, war sie doch noch hier.«
»Sie ist vor einigen Stunden aufgebrochen, noch in der Nacht.«
Als Zedd Richards Gesichtsausdruck sah, schloss er den Mund und hob sich seine Fragen für später auf. Er war bei der brutalen Ermordung von Caras Ehemann durch die Halbmenschen dabei gewesen – wie Cara auch. Richard sah seinen Augen an, dass er schlagartig die Verbindung zu dem Grund von Caras Fortgang hergestellt hatte.
Irena richtete ihren Blick auf die dunklen Umrisse der Bäume, die sich mit heraufziehender Morgendämmerung aus dem Dunkel schälten. Mit dem gleichen drahtigen Körperbau, dem gleichen Schopf dunklen Haars, der ihr feingliedriges Gesicht einrahmte, wirkte sie wie eine ältere, wenn auch etwas angespanntere Version Samanthas. Im Gegensatz zu ihr hatte sich Samantha tapfer und entschlossen entsetzlichen Gefahren gestellt, was allerdings zum Teil wohl auf ihr jugendliches Alter zurückzuführen war.
Möglicherweise, kam es Richard in den Sinn, hatte Irena, die ihr ganzes Leben als erfahrene Hexenmeisterin in den Dunklen Landen zugebracht hatte, weit mehr erlebt als ihre Tochter und somit allen Grund für ihre Angespanntheit. Vermutlich hatte sie Dinge gesehen, die Samantha bislang erspart geblieben waren, Dinge verstanden, die Samantha erst noch begreifen musste. Sicherlich hatte die ältere Frau mehr als doppelt so viele Jahre den Gefahren eines so wilden und entlegenen Ortes getrotzt.
Auch Irena wusste, dass die Barriere zum Dritten Königreich gefallen war. Als Hexenmeisterin des Dorfes Stroyza war sie für dafür verantwortlich gewesen, diese Barriere zu überwachen und andere zu warnen, sollte sie jemals durchbrochen werden. Vermutlich waren ihr zumindest einige der Schrecken von jenseits des Walls im Norden bekannt, über den ihr Volk jahrtausendelang gewacht hatte.
Richard fragte sich, wie viel genau sie über die Barriere und das Dritte Königreich wusste, das so lange dahinter weggesperrt gewesen war, ein Reich, in dem die Welt des Lebens und das Totenreich am selben Ort gleichzeitig existierten. Um das herauszufinden, würde er sich einmal gründlich mit ihr unterhalten müssen.
»Wir sollten nicht an diesem Ort bleiben«, murmelte sie, während sie die Schatten beobachtete.
Die Erwähnung der Halbmenschen hatte sie nervös gemacht, und das aus gutem Grund. Ihr Ehemann war von diesen Halbmenschen getötet worden – war vor ihren Augen von ihnen in dem Versuch verschlungen worden, seine Seele zu rauben.
Jetzt, da die Barriere zum Dritten Königreich gefallen war, waren diese barbarischen Halbtoten – seelenlose Wesen – auf die Welt der Lebenden losgelassen. Sie fielen über jeden her, dessen sie habhaft werden konnten, und verschlangen dessen Fleisch in dem wirren Versuch, für sich selbst eine Seele zu erbeuten. Nach dem Fall der Barriere, die jahrtausendelang das Böse zurückgehalten hatte, hatte Irena ihr Dorf verlassen, um die Menschen vor diesen Geschehnissen zu warnen. Weit war sie nicht gekommen. Gleich nach der Ermordung ihres Ehemanns hatten die Halbmenschen sie gefangen genommen und hätten sie – nach einem Versuch, sie für ihre okkulten Zwecke zu missbrauchen – schließlich wie so viele andere verschlungen. Glücklicherweise war es Richard gelungen, sie vorher zu befreien – mitsamt seinen Soldaten sowie Zedd, Nicci und Cara.
Leider war Ben, Caras Ehemann, der befehlshabende Offizier dieser Soldaten, nicht mit dem Leben davongekommen.
Alle drehten sich suchend um, als sie einen fernen Schrei vernahmen.
Richard zeigte mit seinem Schwert. »Dort drüben!«
3
Er wollte sich gerade zu der Stelle aufmachen, von wo der Schrei gekommen war, als Irena seinen Arm festhielt.
»Nicht, Lord Rahl – das dürft Ihr nicht. Sie könnten viel zu zahlreich sein. Wir müssen Euch von hier fortschaffen.«
Als er einen weiteren Schrei hörte, riss Richard seinen Arm los. »Das ist einer unserer Männer.«
Nachdrücklich wies sie in die Richtung, aus der die Schreie kamen. »Aber es ist zu spät, ihn noch zu retten. Das Risiko wäre vergeblich.«
»Das wissen wir nicht.« Im Vorbeigehen schob er die Frau aus dem Weg. »Wir lassen niemanden zurück, solange noch Hoffnung besteht, ihn zu retten.«
Kahlan schob sich dicht hinter ihn, um zu verhindern, dass die Frau ihn weiter belästigte. Dies war nicht der Moment für Diskussionen. Das wusste sie ebenso gut wie Richard. In Situationen wie dieser konnten Sekunden den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.
Außerdem konnte sie den Zorn der Waffe in seinen Augen sehen. Er war fest entschlossen, der Bedrohung Einhalt zu gebieten, und würde sich dabei von niemandem in die Quere kommen lassen.
Für Irena war es vermutlich nur logisch, sich um Richards Sicherheit zu sorgen, schließlich war er der Lord Rahl und Oberhaupt des D’Haranischen Reiches. Das Überleben aller hing in vielerlei Hinsicht von ihm ab. Allerdings fragte sich Kahlan, was die aus einem so entlegenen Ort stammende Irena überhaupt von der Welt dort draußen wusste – oder, was noch bedenklicher war, über die einzigartigen Gefahren ihres Geburtsorts. Doch diese Frage galt es erst mal hintanzustellen. Sie beeilte sich, um in Richards Nähe zu bleiben.
Als der gesamte Trupp von Soldaten herumschwenkte, um Richard hinterherzueilen, schob Nicci sich vor Kahlan, um unmittelbar hinter ihm zu bleiben.
Jetzt, in Abwesenheit Caras, und da die todbringende Schwäche das Funktionieren von Richards und Kahlans Kraft verhinderte, war Nicci offenbar fest entschlossen, zum Schutz der beiden ganz in der Nähe zu bleiben. Vielleicht mehr als jeder andere war sie sich bewusst, dass von Richard das Überleben aller abhing. Wie Cara war sie fest entschlossen, alles für seine Sicherheit zu tun.
Kahlan war froh, dass wenigstens noch die Kraft seines Schwertes funktionierte. Auch wenn seine Gabe nicht besser funktionierte als ihre Kraft, verfügte das Schwert über eine ihm eigene Magie, auf die er sich nach wie vor verlassen konnte.
Anstatt sich über Niccis Verhalten zu beschweren, blieb sie einfach dicht hinter der Hexenmeisterin.
Gleich dahinter folgte Zedd, während Samantha und Irena von der Flut der von hinten herbeieilenden Soldaten mitgerissen wurden. Ein paar von ihnen schwärmten zu den Seiten aus, bildeten einen Flankenschutz und stellten sicher, dass sie nicht von den Seiten her überraschend angegriffen wurden.
Im Griff des Zorns des Schwertes war Richard nicht bereit, sich von irgendetwas aufhalten zu lassen, und so hatte er bereits nach kurzer Zeit alle anderen weit hinter sich gelassen. Er hastete durch den Wald, schlängelte sich zwischen den Stämmen der hoch aufragenden Föhren hindurch, brach durch Gestrüpp, setzte über Felsen, umgestürzte Bäume und Bachläufe hinweg, und das alles mit einer erprobten Selbstvergessenheit, der die anderen nichts entgegenzusetzen hatten. Es war, als sähe man einen Schatten unaufhaltsam durch das Gehölz schlüpfen, der schließlich von dem Dunkel weiter vorn verschluckt wurde.
Mehr als das aber beeinträchtigte die Krankheit in ihrem Innern Kahlans Fähigkeit, Schritt zu halten. Es war beunruhigend, wie sie an ihren Kräften zehrte, sie ihr den Atem raubte, viel früher als sonst üblich. Der gleiche Todeshauch griff auch in Richards Körper um sich, bei Kahlan aber war er bereits weiter fortgeschritten.
Zedd und Nicci hatten sie über den Ernst der Lage aufgeklärt, hatten sie gewarnt, dass dieser giftige Todeshauch von Jit zunehmend an Kraft gewinnen würde. Wurde er nicht entfernt, würden sie wohl beide nicht mehr allzu lange leben.
Als sie gegenüber Richard und Nicci an Boden zu verlieren begann, sie Mühe hatte, Luft zu bekommen, legte Zedd ihr eine Hand auf den Rücken, zwischen ihre Schulterblätter. Es war nicht bloß als Hilfe zur Wahrung ihres Gleichgewichts gedacht – auch wenn er nicht entfernen konnte, was sie innerlich vergiftete, so ließ er seine Gabe auf sie übergehen, um ihrem Lebenswillen zusätzliche Kraft zu verleihen. Dieses Kraftrinnsal hielt sie gerade eben noch auf den Beinen. Lange jedoch würde es nicht vorhalten, dessen war sie sich bewusst.
Ab und zu vernahm Kahlan die Schreie des Soldaten weiter vorn. Das Geschrei kam immer näher – es mussten die Halbmenschen sein, die über den Mann herfielen, doch da sie keinerlei Geräusch verursachten, hatte sie keine Ahnung, wie viele es sein mochten. Auch wenn es ihr widerstrebte, sich Hals über Kopf in eine derart unklare Situation zu stürzen, sie hatten keine andere Wahl, es sei denn, sie überließen den Mann seinen Meuchlern, und das kam nicht in Frage.
Im Licht der frühen Morgendämmerung sah sie Zweige im letzten Moment aus dem Dunkel in ihre Richtung wischen, ehe diese sie knapp verfehlten. Immer wieder mussten sie behände seitlich abtauchen, um nicht im Gesicht getroffen zu werden. Gelegentlich reagierte sie zu spät und konnte nur noch die Augen schließen. Dann wieder federten die Zweige zurück, nachdem Richard sie zur Seite geschlagen hatte, und streiften ihre Schulter.
Mitunter, wenn ein Ast zu dick war, um ihn zur Seite zu drücken oder zu umgehen, schwang Richard auf seinem Sturmlauf durch den dichten Wald einfach sein Schwert, sodass der Ast davonflog, aus dem Weg, nur um mitten unter den Nachfolgenden herabzufallen, die sich mit erhobenem Arm gegen die mitten unter ihnen herniedergehenden Äste schützten. Manchmal hatte Kahlan Mühe, ihn wiederzufinden, wenn er kurz im dichten Unterholz aus jungen Föhren und Gestrüpp verschwand, nur um über einen umgestürzten Baumstamm oder eine Felszunge hinwegspringend wieder zum Vorschein zu kommen.
Dann brachen sie in vollem Lauf durch ein weiteres Gestrüpp und gelangten auf eine mitten im Wald gelegene, offene Lichtung, wo es zwischen den jungen Ahornbäumen und Birken kaum Unterholz gab – und sahen sich unvermittelt einer kleinen Gruppe halb nackter, mit weißer Asche beschmierter Halbmenschen gegenüber, die alle über etwas kauerten, das am Boden lag.
Shun-tuk.
Im trüben Licht des frühen Morgens sahen sie wie Gespenster aus. Alle hatten sie sich die Augenhöhlen mit einer schwarzen, öligen Substanz beschmiert. Ein breites Grinsen aus aufgemalten Zähnen vervollständigte das Bild und verlieh ihnen das Aussehen von Totenschädeln. Die meisten hatten sich den Schädel kahl rasiert, einige hatten jedoch mittig ein Büschel Haare stehen lassen, zusammengebunden mit Perlen- und Knochenschnüren, damit es aufrecht stand und einer Haarfontäne glich.
Einige der Männer ließen von ihrer Beute ab und blickten überrascht auf, als Richard über einen Findling hinwegsetzte und, plötzlich einen wütenden Schrei ausstoßend, das Schwert mit beiden Händen erhoben, mitten unter ihnen landete.
In diesem erstarrten Augenblick erkannte Kahlan, dass die aufgeschreckten Gesichter blutbeschmiert waren.
Die Shun-tuk hatten Messer, die jedoch steckten noch in ihren Scheiden.
Stattdessen benutzten sie nur ihre Zähne.
4
Richard, sein Zorn endlich vollends entfesselt, landete mit Getöse mitten zwischen den kreideweißen Gestalten. Seine Klinge schwang im Bogen herum und hackte einen kahl rasierten Schädel ab. Dessen dunkel umrandete Augen stutzten noch, als die Waffe – mit einer so gewaltigen Schnelligkeit, dass ihre Spitze ein Surren in der Luft erzeugte – bereits weiterflog, der Schulter des Shun-tuk neben dem jetzt Kopflosen eine klaffende Wunde beibrachte und seinen Arm fast vollständig abtrennte. Sofort versetzte Richard dem von der anderen Seite auf ihn zustürzenden Mann einen wuchtigen Tritt in die Seite.
Als einige der Halbmenschen um Richard zur Seite stolperten, erblickte Kahlan den am Boden liegenden Soldaten unter den weißen Gestalten, die sich wie ein Rudel Wölfe im Fressrausch um ihn drängten. Obwohl Richard bei seinem Vorstoß mehrere von ihnen tötete, verdrehten andere nur kurz den Kopf, um zu ihm hochzublicken, nicht bereit, das Fleisch preiszugeben, in das sie ihre Zähne schlagen wollten. Andere, in ihre Blutgier versunken, schienen sich der Gefahr gar nicht bewusst.
Trotz der Halbmenschen, die sich auf ihn geworfen hatten, hatte der Soldat sein Schwert noch immer in der rechten Hand, hielt er sein Messer fest mit seiner Linken umklammert. Er trat um sich, schlug mit seinem Schwert nach den Leibern, die ihn am Boden festzuhalten versuchten, und benutzte gleichzeitig sein Messer, um auf diejenigen einzustechen, die noch versuchten, bei dem Festschmaus mitzumischen.
Es war offensichtlich, dass der Soldat sich heftig zur Wehr gesetzt hatte, so wie dies jeder aus der Ersten Rotte getan hätte. Eine Reihe weißer Gestalten lag über den Waldboden verteilt, eine Spur blutiger Leiber markierte einen Pfad, entlang dessen sie bis zu seinem Sturz mit ihm gerungen hatten.
Der Großteil der besiegten Shun-tuk war eindeutig tot. Der Soldat hatte sich nicht ohne Weiteres niederringen lassen, und der Feind hatte einen hohen Preis dafür bezahlt, ihn zu Fall zu bringen.
Das Problem war, es waren einfach zu viele dieser Halbmenschen gewesen, als dass er sich aller hätte erwehren können. Die Gefahr für sie selbst schien diesen seelenlosen Wesen weniger wichtig, als an ihr Opfer heranzukommen und die Gelegenheit zu erhalten, ihm seine Seele zu entreißen.
Richards Schwert schwang im Bogen herum und säbelte einer kreidig weißen Gestalt säuberlich den Kopf ab, als diese sich aufrichtete, um ihn zu packen und zu dem Soldaten hinunterzuziehen. Ein paar andere kamen ebenfalls hoch, ganz versessen darauf, sich in der Absicht, eine fremde Seele zu erbeuten, auf die sich ihnen entgegenwerfenden Neuankömmlinge zu stürzen.
Zu Kahlans Entsetzen griffen die meisten jedoch Richard an, ganz so, als hätten sie ihn erkannt und es in erster Linie auf ihn persönlich abgesehen.
Ehe sie ihn überwältigen und unter dem Gewicht ihrer Übermacht zu Boden reißen konnten, fuhren die Soldaten mitten zwischen das Rudel aus weiß gekälkten Gestalten und trieben die meisten zurück, fort von Richard. Die Halbmenschen, blind für die Gefahr, griffen die sich auf sie stürzenden Soldaten augenblicklich an.
Doch Zähne waren dem rasiermesserscharfen Stahl nicht gewachsen.
Der grauenerregende Anblick erinnerte Kahlan an ein von Sicheln niedergemähtes Weizenfeld. Es war ein brutales Gemetzel unter Wilden, die nur ein einziges Ziel kannten: Mord.
Nichts, was die Soldaten taten, vermochte sich mit der brutalen Gewalt zu messen, mit der Richards Schwert unter ihnen wütete. Sobald die Halbmenschen nach ihm griffen, trennte sein Schwert Finger, Hände, Arme und Köpfe ab und schlug hie und da ihre Leiber mitten entzwei. Es schien, als hielte seine Klinge niemals inne, als fände sie jedes Mal ihr Ziel, wenn sie Schädel zertrümmerte, Körperteile und Knochen abtrennte.
Nicci, sich dessen bewusst, dass die Gabe nur wenig gegen diese Halbmenschen auszurichten vermochte, gelang es mithilfe ihrer Talente zumindest, Luft zu einer mächtigen Faust zu ballen, um eine Reihe von ihnen zurückzustoßen, die Kahlan von der Seite her bedrängten. Als sie zurücktaumelten und wieder einen festen Stand zu finden versuchten, hackten die Soldaten sie in Stücke. Mit ihrem Messer schlitzte Kahlan mehrere der weiß gekälkten Gestalten auf, die ihr zu nahe kamen. Aus der Nähe wirkten ihre geschwärzten Augen einschüchternd, erst recht, wenn sie die Mäuler aufrissen und ihre Zähne bleckten.
Auch Zedd kämpfte erbittert, um Kahlan zu behüten, genau wie Irena und Samantha. Doch dann befreite sich Irena aus Samanthas Griff und der Obhut Zedds und lief mit ausgestreckten Händen auf Richard zu, offensichtlich in der Absicht, ihn mit ihrer Gabe zu beschützen – nur vermochte Kahlan nicht zu erkennen, dass dies irgendeine Wirkung zeigte. Vielmehr sahen die Halbmenschen in ihr eine Gelegenheit, sich die Seele einer mit der Gabe Gesegneten einzuverleiben. Kreideweiße Arme und krallende Finger griffen nach ihr.
Ehe sie sie packen konnten, trennte Richard ihnen die Arme ab und mähte alle nieder, die herbeigerannt kamen, um sich auf sie zu werfen. Noch während sie zu Boden gingen, schlang er einen Arm um Irenas Hüfte, schleuderte sie zurück und damit aus dem Bereich der unmittelbaren Gefahr. Sichtlich erleichtert, fasste Samantha den Arm ihrer Mutter und zog sie zurück, fort von der bedrohlichen Situation.
Gerade als es schien, als würden sie die Lage in den Griff bekommen und die Halbmenschen niederringen, die den Soldaten angegriffen hatten, gerieten Sträucher und Stämme in Bewegung. Urplötzlich begann es im Wald von Shun-tuk zu wimmeln, die überall rings um sie her aus dem Dunkel hervorgelaufen kamen.
Kahlan hatte bereits geahnt, dass dies eine Falle war und der Soldat nur als Köder diente. Dies waren räuberische Wesen, die ihr Vorgehen untereinander abstimmten, um ihre Beute anzulocken und anschließend zu Fall zu bringen.
Hinten, ein Stück entfernt vom Schlachtgetümmel, sah sie mehrere der kreidig weißen Gestalten sich über ihre eigenen Toten beugen. Sie beteiligten sich nicht an dem Überfall, zudem waren die Gestalten am Boden eindeutig tot und nicht bloß verwundet, weshalb sie sich nicht vorzustellen vermochte, was sie da taten. Ihre Haarknoten schwankten, derweil sie die Köpfe hin- und herwarfen, die Arme in ritueller Manier über den leblosen Körpern schwenkten und dabei Worte sprachen, die Kahlan nicht verstand.
Als einer von ihnen sein Tun beendete und rasch zu einem weiteren, auf der Seite liegenden Leichnam weiterging, setzte sich der erste Tote auf, erhob sich schließlich und richtete sich zu seiner vollen Größe auf, so als wäre er ins Leben zurückgeholt worden. Seine Augen, einen Moment zuvor noch glasig, wiesen nun ein inneres rotes Glimmen auf. In dem trüben Dunkel war es schwer, irgendetwas deutlich zu erkennen, diese Augen jedoch drangen wie glühende Kohlen durch das Dämmerlicht.
Schockiert verfolgte Kahlan mit starrem Blick, wie der Tote sich auf sie zuzubewegen begann. Halb stolpernd trat er auf seine eigenen Eingeweide, die aus einer entsetzlichen, klaffenden, diagonal über seinen Unterleib verlaufenden Wunde hingen und am Boden hinter ihm herschleiften. Bei jedem Schritt hielt er kurz inne, um nachzusehen, was ihn da bremste. Als er dann seine blutigen Innereien bemerkte – sie reichten von der offenen Wunde in seinem Unterleib bis zu seinem auf ihnen stehenden Fuß – langte er kurzerhand nach unten und riss sich seine eigenen Gedärme aus dem Leib, damit sie ihn nicht länger behinderten.
Noch während er auf die Lebenden eindrosch, sah Richard den Toten kommen. Sein Schwert schwang herum und zertrümmerte den Schädel des toten Mannes. In der Rückwärtsbewegung trennte ein nicht minder mächtiger Hieb dem Mann die Beine ab. Noch im Vorwärtsfallen griffen die Arme des kopflosen Leichnams nach Richard, verfehlten ihn jedoch. Er landete hart auf seiner Brust; seine Finger krallten sich in die Erde und umklammerten ein spärliches Gestrüpp, um die kopf- und beinlosen Überreste vorwärtszuziehen.
Kahlan konnte beobachten, wie sich die kalkweißen Gestalten in einiger Entfernung über weitere ihrer Toten beugten und diese zum Leben erweckten. Kurz überkam sie ein Anflug von Hoffnungslosigkeit, dass selbst sie umzubringen ihnen nicht weiterhelfen würde. Selbst im Tod würden sie noch weiter attackieren.
Auch Richard erkannte, was hier geschah. Er zeigte mit seinem Schwert.
»Dort drüben!«, rief er, laut genug, dass alle Soldaten ihn hören konnten. »Haltet auf das höher gelegene Gelände zu, am Fuß der Felswand dort. Wir müssen eine Stelle finden, wo es unmöglich ist, uns einzukreisen, damit wir uns besser verteidigen können!«
Im Nu und ohne weiterer Befehle zu bedürfen, formten einige Männer der Ersten Rotte eine von Klingen strotzende Keilformation – eine Formation, dafür gedacht, feindliche Linien zu durchbrechen. Auch wenn dies in der Schlacht nicht immer die effektivste Taktik war, ihre Erfahrung und Ausbildung sagte ihnen, in diesem Fall war es genau das Richtige.
Gemeinsam erzeugten Nicci und Zedd eine glühend heiße Flammenwand, um den Weg vor den Soldaten freizuräumen, woraufhin einige der weißen Gestalten – vermutlich dieselben, die imstande waren, die Toten auferstehen zu lassen – eine Hand hoben, als wollten sie die Bedrohung von sich weisen. Die Flammen teilten sich und entfernten sich in elegantem Bogen von den Halbmenschen, ehe sie diese einhüllen konnten. Anderen, zu den Seiten hin, war dieses Glück nicht beschieden. Sie wurden von den Flammen erfasst, ehe sie diese abwehren konnten. Von dem Flammen umhüllte Gestalten strauchelten blindlings umher, während sie von den Soldaten niedergestreckt wurden. Dann stürmte der Keil aus Soldaten auf sie zu, und die Halbmenschen in seiner Bahn, eben noch den herbeigezauberten Flammen entkommen, vermochten nicht mehr auszuweichen.
Mit einem Rückhandschwung schlug Richard eine schmächtige, fauchende Gestalt fast in zwei Hälften, langte mit seiner anderen Hand nach unten, packte den Unterarm des gestürzten, blutenden Soldaten und zerrte ihn unter mehreren, immer noch nach ihm schnappenden Shun-tuk hervor. Dann endlich hatte er ihn auf den Beinen, hackte mit seinem Schwert die Arme der Halbmenschen von dem Verwundeten weg, drehte ihn dann in die Richtung ihrer Fluchtroute und schrie ihn an, sich zu beeilen. Obwohl überall am Körper voller Bissverletzungen und Blut, schien der Soldat jetzt, befreit vom Gewicht der Angreifer, allein zurechtzukommen – zumindest fürs Erste.
Richard packte Kahlan an der Hüfte und zog sie mit sich, nahm sie unter seine Fittiche. »Die haben ihn absichtlich nicht getötet«, sagte er, dicht über sie gebeugt. »Sie wollten, dass er schreit. Das war eine Falle, um uns anzulocken.«
Er wies mit einem Nicken auf das höher liegende Gelände. »Wir müssen es unbedingt bis zu dieser Verteidigungsstellung schaffen, ehe die Übrigen auch noch über uns herfallen.«
»Du denkst, uns steht noch mehr bevor?«
»Ganz ohne Zweifel.«
Da der Soldat nun gerettet war und die Männer sie beschützend umringten, folgten sie der Stahlkeilformation zu dem ansteigenden Gelände, das an der Rückseite von einer sich zwischen den Harthölzern erhebenden Felswand begrenzt wurde. Ab und zu gelang es Zedd, eine Flammenflut vor ihnen auszubreiten. Das gleißend gelbe Licht setzte die Bäume in Brand und ließ die Unterseite der Wolken hell aufleuchten. Zu den Seiten hin loderten Föhrennadeln auf, sobald das Feuer sie erfasste, sie in Flammen aufgingen und eine Feuerkaskade die Stämme hinaufschoss, ehe diese in Asche verwandelt wurden.
Wer von den Shun-tuk das Pech hatte, von der blendenden Glut erfasst zu werden, war einen Augenblick lang als Skelett zu sehen, ehe selbst diese Überreste verdampften.
Kahlan war, als würde die Hitze ihr Haar und Augenbrauen versengen. Sie wusste nicht, über welche Art von Kraft die Halbmenschen verfügten, allerdings richteten die Flammen unter den Bäumen größeren Schaden an, als bei den meisten von ihnen. Zum Glück hatte es ausgiebig geregnet, alles war so durchnässt, dass sich die Flammen auf die unmittelbare Umgegend beschränkten und nicht den gesamten Wald in Flammen aufgehen ließen.
Auch wenn das Inferno nicht so viele Halbmenschen erfasste wie erhofft, so trug es doch dazu bei, sie auseinanderzusprengen und zu vertreiben. Waren die Shun-tuk erst einmal mithilfe von okkulten Kräften abseits der Huldigung erschaffen worden, schien ihnen Magie nicht mehr so zuzusetzen, wie dies bei normalen Menschen der Fall gewesen wäre.
Dann sah Kahlan immer mehr Halbmenschen aus den Wäldern hinter ihnen hervorkommen.
Richard, an ihrer rechten Seite, fasste sie fester um die Hüfte, um sie zu stützen, während links Nicci ihre Hand weiter fest zwischen ihre Schulterblätter presste, nicht nur, damit sie sich so schnell wie möglich bewegte, sondern auch, um ihr Kraft zu geben. Kahlan konnte es nicht ausstehen, auf Hilfe angewiesen zu sein.
Unmittelbar hinter ihnen schob Irena Samantha vor sich her.
»Lord Rahl«, rief Samantha, »was kann ich tun, um zu helfen?«
»Schneller rennen«, rief er nach hinten über seine Schulter.
Samantha und ihre Mutter gehorchten, unterdessen wehrten die Truppen den Feind an den Seiten ab. Zum bestmöglichen Schutz ihrer Flanken legte Zedd hinter ihnen einen weiteren Feuerteppich. Kahlan wusste, der Einsatz dieser Kraft war schwierig und zehrte an seinen Kräften, wusste, dass er eine solch heftige Kraftanstrengung nicht lange würde durchhalten können.
Jetzt, da der Weg vor ihnen von der Keilformation aus Soldaten der Ersten Rotte freigemacht wurde, wuchs Kahlans Zuversicht, dass sie es bis zu der Verteidigungsstellung auf dem höher liegenden Gelände vor der Felswand schaffen würden. Waren sie erst einmal dort, würden sie sich der Halbmenschen nur noch auf einer Seite erwehren müssen. Es würde sie in die Lage versetzen, den Feind nach und nach zu dezimieren und ihn hoffentlich irgendwann gänzlich zu vernichten.
Doch als Kahlan voller Entsetzen spürte, dass sich plötzlich fremde Zähne seitlich in ihren Hals gruben, merkte sie, dass eine dieser gespenstischen Gestalten sich aus einem Baum auf ihren Rücken hatte fallen lassen. Sie schlug mit dem Gesicht voran der Länge nach hart auf den Waldboden.
5
Gerald runzelte die Stirn. Er richtete sich von seiner Arbeit, die Kante seiner Schaufel zu schärfen, auf und horchte. Und meinte ein seltsames, leises Rumpeln zu vernehmen. Allerdings konnte er das Rumpeln im lockeren Erdboden unter seinen Füßen eher fühlen als hören. Es erinnerte ihn an fernes Donnergrollen, war jedoch zu gleichförmig, zu gleichbleibend und regelmäßig, als dass es hätte Donner sein können. Trotzdem erinnerte es ihn daran, mehr als an alles andere.
Behutsam legte er die Feile auf die hölzerne Werkbank und trat an das kleine seitliche Fenster, das einen Blick über den gesamten Friedhof ermöglichte. Jenseits des fernen Rains der regendurchweichten Heufelder erstreckte sich der sanft geschwungene Wald, der den größten Teil der Dunklen Lande bedeckte, über stetig ansteigendes Gelände bis hin zu den schneebedeckten Bergen in der Ferne.
Gerald mochte den Wald nicht besonders. Die Dunklen Lande waren auch so schon gefährlich genug, ohne dass man sich allzu weit in den Wald hineinwagte. Er war immer schon der Meinung gewesen, dass Menschen bereits genug Ärger bedeuteten, wozu also das Schicksal herausfordern mit diesen Wesen, die in dem Wald hausten.
Anstatt ohne guten Grund den rätselhaften Gefahren der weglosen Wälder der Dunklen Lande zu trotzen, zog er es vor, seiner Arbeit nachzugehen, den Friedhof zu beaufsichtigen und Leute unter die Erde zu bringen, die niemandem mehr ein Leid zufügen konnten. Die Bewohner der Ortschaft Insley kamen nicht gern heraus zu diesem Ort, wo tote Körper in der Erde verwesten, deshalb ließ man ihn in Ruhe und ging ihm, da er, wie er es nannte, den Garten der Toten bestellte, aus dem Weg.
Und auch die Toten ließen ihn in Frieden.
Die Toten ließen jedermann in Frieden; die Menschen fürchteten sie lediglich aus törichtem Aberglauben. Dabei gab es doch jede Menge ganz realer Dinge, vor denen man sich ängstigen konnte, die Gefahren etwa, die in der waldreichen Wildnis der Dunklen Lande lebten. Die Toten behelligten nie jemanden.
Die Arbeit als Totengräber wurde nicht gut bezahlt, er hatte jedoch keine Familie mehr, und seine Bedürfnisse waren bescheiden. Glücklicherweise waren die meisten Menschen immerhin mehr als bereit, ihn für das Verscharren ihrer Angehörigen zu entlohnen, wenn auch nicht eben üppig. Es reichte jedoch, um sich ein kleines Zimmer im Ort leisten zu können, wo er des Nachts unter den Ortsbewohnern sicher war, auch wenn sie den Blick abwandten, wann immer er vorüberging. Er würde stets ein Dach über dem Kopf haben, ein Bett und genug zu essen.
Auch wenn sie nicht viel abwarf und ihn in der Welt weitgehend allein dastehen ließ, ein Vorteil seiner Arbeit war: Solange es die Lebenden gab, würde stets ein Bedarf an Totengräbern bestehen, um sich der frisch Verstorbenen zu entledigen.
Was gar nicht so sehr daran lag, dass die Menschen etwas dagegen hatten, selbst herumzubuddeln – vielmehr grauste ihnen vor den Toten, weshalb sie es ablehnten, draußen auf dem Friedhof ein Loch zu graben und die Toten eigenhändig anzufassen. Gerald war ihnen gegenüber längst abgestumpft. Für ihn bedeuteten sie einen festen Arbeitsplatz, und Scherereien machten sie ihm nie.
Den größten Teil seines Erwachsenenlebens war es Gerald eine traurige Pflicht gewesen, jene zu begraben, auf die er große Stücke hielt, und ein Privileg, Menschen unter die Erde zu bringen, von denen er zu Lebzeiten nicht viel gehalten hatte. Über das Dahinscheiden der ersten Sorte hatte er so manche Träne vergossen; das Dahinscheiden der zweiten Sorte dagegen bescherte ihm, sobald er daranging, Erde über sie zu schaufeln, ein grimmiges Lächeln.
Niemals jedoch war sein Lächeln überzogen, wusste er doch, dass er sich eines Tages zu ihnen allen in der Unterwelt gesellen würde. Auf keinen Fall wollte er einer der Seelen dort einen Grund geben, einen Groll gegen ihn zu hegen. Er versuchte seiner Arbeit nachzugehen, damit auch die Lebenden keinen Grund hatten, einen Groll gegen ihn zu hegen.
Er wischte sich einige Strähnen seines schlaffen, grauen Haars aus den Augen, beugte sich ein wenig näher zu dem kleinen Fenster hin und spähte lauschend in die Ferne. Sämtliche Kühe auf den Weiden, fiel ihm auf, hatten das Grasen eingestellt. Sogar das Wiederkäuen ihres Futters hatten sie aufgegeben und starrten alle in die gleiche Richtung, zu derselben Stelle im Nordosten.
Das fand er beunruhigend. Er strich sich über die Stoppeln auf seiner Wange und dachte nach. Dort drüben im Nordosten gab es nicht eben viel. Voller Gefahren, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen durfte, waren die Dunklen Lande auch so schon trostlos genug, im Nordosten jedoch waren sie noch unwirtlicher – weitgehend wegloses Ödland ohne irgendwelche ihm bekannte Dörfer, mit einer Ausnahme: Stroyza.
Es hieß, seit Menschengedenken seien die Dunklen Lande stets eine Ödnis gewesen und würden das auch immer bleiben, denn dort, in dieser Richtung, hause ein fürchterliches Übel, von dem sich jeder fernhielt, der auch nur über einen Funken Verstand verfügte. Es galt als allgemeiner, wenn auch nebelhafter, von Generation zu Generation weitergegebener Allgemeinplatz, dass es weit entfernt in dieser Richtung üble Dinge gab, ja, sogar von Hexen war die Rede. Und mit Hexen war, wie jeder wusste, nicht zu spaßen.
Die meisten Leute stellten weder Fragen noch irgendwelche Nachforschungen an. Wer wollte schon ein schlafendes Übel wecken? Oder Hexen? Was hätte das für einen Sinn?
Gerald war reisenden Händlern begegnet, die das ferne Dorf Stroyza aufgesucht hatten – weitab in jener Richtung, jenseits des sich auftürmenden Gebirgszugs, den er im Nordwesten sehen konnte. Nie war er jemandem aus Stroyza selbst begegnet, allerdings hatte er mit den wenigen Händlern gesprochen, die – wenn auch nur selten – ihr Glück in dieser Richtung versuchten. Es gab dort kaum etwas, womit man Handel treiben konnte, und da die Kaufleute für ihre Mühen mit kaum etwas von Wert von dort zurückkehrten, zog es sonst niemanden dorthin. Stroyza war eine kleine Ansiedlung von Menschen, die, so hatte er erzählen hören, ihr entlegenes, in eine Felswand gebautes Dorf bewohnten und unter sich blieben. Die abweisende Art der dortigen Bewohner war nur verständlich, bedeuteten Fremde doch für gewöhnlich nichts als Ärger.
Es hieß, manch einer, der nach Nordosten gezogen war, um dort sein Glück zu finden, sei schlicht nicht mehr zurückgekehrt. Und wer zurückgekommen war, erzählte Geschichten über Begegnungen mit brutalen Kerlen im Dunkel der Nacht, mit durchtriebenem, übelwollendem Volk und sogar Hexen. Es war nicht schwer, sich vorzustellen, warum so mancher nie zurückgekommen war. Und wer es doch geschafft hatte, kehrte nie wieder dorthin zurück und suchte zur Bestreitung seines Lebensunterhalts stattdessen andere, bekanntere Orte auf.
Während er Ausschau hielt, erspähte Gerald eine verdächtige Bewegung am Rand der fernen Wälder. Genau war es nur schwer zu sagen, es sah jedoch ganz so aus, als könnte es sich um einen dieser Nebel handeln, die ab und an aus den Bergen herabkamen und über das Tiefland hinwegzogen. Er fragte sich, ob er sich möglicherweise getäuscht hatte und es eine Art seltsamer Gebirgsdonner war, den er hörte, und es sich bei dem Blick, der sich ihm bot, um einen Dunst handelte, der als Vorbote eines Unwetters aus den Bergen herabzog.
Er schüttelte den Kopf. Was er da hörte, war kein Donner. Er machte sich nur selber etwas vor, wenn er das dachte. Was immer dieses dumpfe Rumpeln erzeugte, noch nie zuvor hatte er etwas Vergleichbares gehört, so viel stand fest.
Während er den unerbittlich näher rückenden Dunst beobachtete, kam ihm der Gedanke, es könnte sich vielleicht um Reiter handeln, eine Menge Reiter, Kavalleriesoldaten vielleicht. Wie jeder in Insley hatte er Geschichten über den jüngsten Krieg gehört, von manchen dieser jungen Männer, die ausgezogen waren, um für D’Hara zu kämpfen, die zurückgekehrt waren und davon berichtet hatten. Sie hatten Geschichten von gewaltigen Armeen erzählt, von Abertausenden von Reitertruppen, die sich in blutige Schlachten stürzten. Er fragte sich, ob es sich bei dem Dunst möglicherweise um Staub handeln könnte, aufgewirbelt von einer großen Anzahl Pferde. Oder vielleicht um gewaltige Massen marschierender Soldaten.
Was solche Truppen oder Kavalleristen hier, so weit draußen in den Dunklen Landen, zu suchen hatten, vermochte er nicht einmal ansatzweise zu erahnen. Allerdings würden über das Tiefland galoppierende Pferdehufe das rumpelnde Geräusch erklären.
In der Vergangenheit hatte er einige von Bischof Hannis Arcs Gardisten durch Insley passieren sehen. Die allerdings verfügten gar nicht über eine derart große Zahl von Soldaten, um eine Staubwolke aufzuwirbeln, wie er sie jetzt vor Augen hatte, oder um den Boden erbeben zu lassen.
Dann wurde ihm klar, dass es sich in Anbetracht der Feuchtigkeit des Bodens unmöglich um Staub handeln konnte.
Was immer es sein mochte, nach und nach begann er, auf breiter Front einzelne Punkte in dieser schmutzigen, nebelhaften Wolke auszumachen. Punkte, als könnte es sich womöglich um Menschen handeln.
Gerald langte nach unten und ließ seine Hand über den Griff einer Spitzhacke gleiten, die an der Wand lehnte. Er fasste sie oben, in der Nähe des Kopfes, um das schwere Ende leichter heben zu können. Richtige Waffen besaß er keine – er hatte im Grunde gar keine Verwendung für sie. Zumal herkömmliche Waffen gegen solche Wesen, wie man sie in den Dunklen Landen befürchten musste, tatsächlich gar nichts nützten, Wesen wie besagtes Volk der Durchtriebenen oder Hexen. Und was alles andere betraf, nun, selbst in betrunkenem Zustand scheuten die meisten Menschen eine Auseinandersetzung mit einer Spitzhacke.
So wenig ihm die Vorstellung behagte, er steuerte auf die Tür des Schuppens zu, um hinauszutreten und zu sehen, ob sich nicht feststellen ließe, was da auf ihn zukam.
6
Gerald schützte seine Augen mit der freien Hand gegen den düsteren, schiefergrauen Himmel und starrte in die Ferne. Mit der anderen packte er den Schaft der Spitzhacke dicht unterhalb des Kopfes, deren Gewicht seinen anderen Arm senkrecht nach unten zog.
Er hatte sich nicht getäuscht. Dort in der Ferne, das waren eindeutig Menschen, viele Menschen. Er konnte gerade so eben ihre Gehbewegung erkennen. Natürlich wusste er aus den Geschichten der Kaufleute und Händler, dass es Orte mit einer Unmenge von Bewohnern gab. Er hatte von einer Reihe riesiger Städte weit drüben im Westen und Süden gehört, obwohl er sie nie mit eigenen Augen gesehen hatte. Auch in den Dunklen Landen gab es Ortschaften, meist im Südwesten, die beträchtlich größer waren als Insley.
Die größte ihm bekannte Stadt war Saavedra – am äußersten Rand der entlegensten und gefürchtetsten Gebiete der Dunklen Lande gelegen –, von deren Zitadelle aus Bischof Hannis Arc über die Provinz Fajin herrschte. Die meisten Menschen nannten die Provinz Fajin bei ihrem Namen aus alter Zeit: die Dunklen Lande. Es war ein Name, der haften geblieben war, ganz so wie die aus den Toten heraussickernde Jauche, die man nie wieder unter den Fingernägeln wegbekam, ganz gleich, wie oft man sich wusch und sie abzuschrubben versuchte.
Ein einziges Mal, als er noch jünger gewesen war, hatte Gerald sich bis nach Saavedra gewagt, allerdings auf den Rat derer hin, die die Stadt kannten, einen weiten Bogen um die Zitadelle gemacht. Dieselben Personen hatten mit gesenkter Stimme beängstigende Schilderungen Hannis Arcs geliefert. Da es nichts brachte, Ärger heraufzubeschwören, hatte er ihren Rat beherzigt.
Arbeit hatte er in Saavedra keine gefunden, wohl aber eine Frau. Sie stammte aus einer ärmlichen Familie, mit Eltern, die nicht imstande waren, ihre Kinder anständig zu ernähren, weshalb sie sich mehr dafür interessiert hatte, genug zu essen zu haben, als für seinen Beruf. Und da er ihr ein Auskommen bot, hatte sie ihn geheiratet. Anschließend waren sie nach Insley zurückgekehrt, und er hatte sich wieder um den Friedhof gekümmert, damit etwas zu essen auf den Tisch kam.
Sie war vor langer Zeit gestorben, damals, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger ging. Eine Ewigkeit schien das jetzt her zu sein. Eine andere Frau hatte er nie gehabt.
Als Gerald jetzt in die Ferne schaute und all diese Menschen beobachtete, die auf ihn zuhielten, beschlich ihn das entschieden mulmige Gefühl, dass dies nur Scherereien bedeuten konnte. Er dachte daran wegzulaufen, war jedoch zu alt, um es noch weit zu schaffen.
Zudem war dies eine aberwitzige Befürchtung. Was konnten sie schon von ihm wollen? Ein betagter Totengräber würde schwerlich ein Lösegeld einbringen. Im Grunde besaß er überhaupt nichts Wertvolles. Sein einziger halbwegs wertvoller Besitz waren seine Werkzeuge sowie ein klappriger, nach den Toten stinkender Handkarren. Sofern sie also nicht die Absicht hatten, Tote herumzukarren und Gräber für sie auszuheben, waren seine Besitztümer für jeden außer ihm selbst nahezu wertlos.
Während er die Unmenge von Gestalten jetzt in der Ferne ausschwärmen sah, ließ ihn seine Neugier wie angewurzelt an seinem Platz verharren. Wo hätte er sich auch verstecken sollen? Im Wald? Dort gab es furchterregende Wesen, die vermutlich schlimmer waren als eine große Masse durch Insley marschierender Menschen.
Das Seltsamste – abgesehen von ihrer offenbar gewaltigen, in die Tausende gehenden Zahl – war, dass die Gestalten alle in Weiß gekleidet schienen. Weiße Gewänder? Als er einen Moment später die Augen fest genug zusammenkniff, sah er, dass er sich getäuscht hatte. Sie trugen überhaupt keine Gewänder, sie waren schlichtweg nackt. Mehr oder weniger …
Ihre Leiber, Arme und Beine – ja sogar ihre Köpfe – waren von kreidig weißer Farbe, so als hätten sie sich von Kopf bis Fuß mit Asche eingerieben. Solche Menschen hatte er sein ganzes Leben lang noch nicht zu Gesicht bekommen. Er konnte sich nicht vorstellen, was für einen Zweck es haben sollte, sich mit weißer Asche einzureiben.
In der Mitte jedoch, an der Spitze, gab es mehrere dunklere Figuren. Der Kontrast zu der Flut aus bleichen Gestalten hinter ihnen war augenfällig und hob sie nur noch mehr heraus.
Der schmutzige Dunst, den Gerald zunächst beobachtet hatte, schien eine Art den Pulk umgebende Hülle zu sein, so als würde er von ihnen mitgeschleppt oder gar erzeugt. Dieser Dunst wurde immer mehr zu einer nichts Gutes erahnen lassenden Düsternis, einer Atmosphäre der Bedrohlichkeit, merkwürdigerweise so, als befänden sie sich in einer Blase aus ihrer eigenen, von ihnen selbst mitgeführten Zeit.
Im Innern dieser bedrückenden Düsternis flackerte ab und zu knisternd eine seltsame grünliche Lumineszenz auf.
Gerald überdachte seinen Entschluss, nicht die Flucht zu ergreifen. Er wäre gerne weggelaufen, oder zumindest für ein Weilchen abgetaucht, im Wald, bis all diese Leute ihres Weges gezogen wären. Doch da die dunkleren Gestalten in der Mitte genau auf ihn zuhielten, war ihm instinktiv klar, dass Weglaufen wohl nicht viel bringen würde.
Und in diesem Moment wurde ihm klar, dass dies Räuber und Beutejäger waren.
Er entschied, dass es wohl das Beste wäre, nicht den Kopf zu verlieren, sich freundlich zu geben und den nahenden Fremden jede Auskunft zu geben, die sie verlangten. Er war für sie ganz offensichtlich keine Bedrohung, daher standen seine Chancen wohl am besten, wenn er hilfsbereit war und sie ihres Weges ziehen ließ.
Die Menschen duldeten einen, solange man ihnen nützlich war, das wusste er durchaus. Obwohl er keine echten Freunde hatte und ihm in Insley niemand sonderlich freundlich gesinnt war, nahm man ihn, eben wegen seiner Hilfsbereitschaft, mit einem knappen Lächeln und einem flüchtigen Nicken hin. Er hatte sich nur deswegen so lange gehalten, weil er bei lästigen Arbeiten behilflich war.
Seine Beunruhigung nahm allerdings zu, als er erkannte, dass die dunkleren Gestalten an der Spitze mit ihrem gesamten Gefolge genau mitten durch seinen sorgsam gepflegten Totengarten marschieren würden.
Eine der dunkleren Gestalten war von einer Art schwach leuchtendem, bläulich grünem Licht umgeben, wie er jetzt sah – als wäre sie halb Mensch, halb Geist. Daneben ging eine Gestalt, die noch weit dunkler war. Diese trug einen schweren schwarzen Umhang, und ihr Fleisch schien, soweit Gerald dies anhand der Hände und des Gesichts erkennen konnte, dunkel von irgendwelchen Tätowierungen. Dahinter folgte eine weitere, ganz in Rot gekleidete Gestalt. Er wusste nur zu gut, welche Bewandtnis es damit haben musste.
Gerald schluckte, als er sah, dass die Augen des Mannes in dem dunklen Gewand auf ihn gerichtet – und rot waren!
Der Geistmann schritt mit lockerem und gleichmäßigem Schritt dahin, die Arme gesenkt, die Handteller nach vorn gedreht. Es schien, als sei er die Quelle dieses düsteren Dunsts, als werde dieser von den Händen des Mannes mitgeschleppt – ganz so, wie ein Boot seine Heckwelle hinter sich herzog.
Gerald vermochte sich nicht vorzustellen, was er anderes sein konnte als eines dieser Legendenwesen aus den finstersten Tiefen des Waldes.