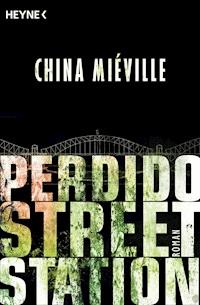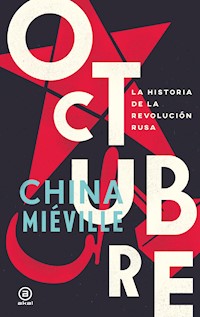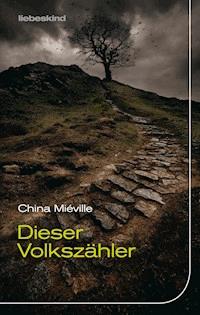Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
1941, inmitten des vom Zweiten Weltkrieg bedrohten Marseilles, stolpert der amerikanische Ingenieur und Okkultist Jack Parsons in eine Widerstandsgruppe, zu der auch der surrealistische Dichter André Breton zählt. In dieser Résistance aus regimekritischen Diplomaten, exilierten Revolutionären und Avantgarde-Künstlern sieht Parsons einen Hoffnungsschimmer. Aber was er aus Versehen freisetzt, ist die Macht der Träume – und der Albträume –, die den Krieg für immer verändert. 1950 erkundet der einsame Kämpfer des Surrealismus Thibaut die halluzinogene Stadt Neu-Paris, wo sich Nazis und Résistance einen ewigen Guerilla-Krieg liefern und in den Straßen lebendig gewordene surrealistische Kunstwerke und Texte ihr Unwesen treiben. Gemeinsam mit der amerikanischen Fotografin Sam versucht er, unversehrt aus der Stadt zu entkommen. Doch dafür müssen sie sich mit der gefährlichsten Manifestation zusammenschließen: dem Cadavre Exquis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Die letzten Tage von Neu-Paris ist ein Roman.
Alle Personen, Organisationen und Ereignisse sind frei erfunden
oder erscheinen in fiktiven Zusammenhängen.
Die englische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel
The Last Days of New Paris bei Del Rey, einem Imprint von
Random House, der Verlagsgruppe Penguin Random House LLC,
New York, USA.
© 2016 by China Miéville
Copyright der deutschen Erstausgabe
© 2019 by Golkonda Verlags GmbH & Co. KG,
München • Berlin
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorenthalten.
Lektorat: Elisabeth Bösl
Korrektorat: Clemens Voigt
Gestaltung: benSwerk [benswerk.wordpress.com]
Illustrationen (Innenteil): China Miéville
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
www.golkonda-verlag.de
ISBN: 978-3-946503-86-6 (Buchausgabe)
ISBN: 978-3-946503-87-3 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Rupa
»Man erlebt ja viele Reaktionen auf surrealistische Kunst, aber die jämmerlichste von allen ist die derjenigen, die fragen: ›Was soll ich da sehen und was soll ich dabei empfinden?‹ Mit anderen Worten: ›Was sagt Papa, was ich da sehen und empfinden darf?‹«
Grace Pailthorpe, »On the Importance of Fantasy Life«
André Breton, Jacqueline Lamba, Yves Tanguy:
Köstlicher Leichnam (Cadavre Exquis), 1938.
Erstes Kapitel
1950
Eine Straße im Laternenlicht. Jenseits einer Mauer aus zerfetzter Stadt schossen die Nazis.
Hinter der Barrikade und einer Reihe Schneiderpuppen, die sich zu einem unbeholfenen, erstarrten Can-Can zusammengefunden hatten, konnte Thibaut das Khaki von Wehrmachtssoldaten erkennen, die in alle Richtungen auseinanderstoben, graue Ausgehuniformen, SS-Schwarz, das Blau der Kriegsmarine, erhellt vom Schein des Mündungsfeuers. Irgendetwas raste die Rue de Paradis entlang, wich mit Gummigeheul Leichen und Ruinen aus und kam direkt auf die Deutschen zu.
Zwei Frauen auf einem Tandem? Sie kamen schnell auf riesigen Rädern näher.
Die Soldaten feuerten, luden nach und ergriffen die Flucht, da das heranbrausende Gefährt unter ihren Salven weder umdrehte noch fiel. Man hörte Ketten schwirren.
Jetzt konnte Thibaut ausmachen, dass nur eine der beiden Frauen fuhr. Die andere war ein Torso, der aus dem Rahmen des Fahrrads hervorwuchs, ein lebendiger Vorbau, eine Gallionsfigur, die den Platz der Lenkstange eingenommen hatte. Sie wuchs direkt aus dem Metall heraus. Sie warf die Arme zurück, die sich dort, wo Hände hätten sein sollen, wie Korallen kräuselten. Sie reckte den Hals und riss die Augen auf.
Thibaut schluckte und versuchte Worte herauszubringen, setzte nochmals an und rief: »Es ist das Vélo!« [1]
Sofort waren seine Genossen neben ihm. Sie drückten sich gegen das große Fenster und starrten hinab in die Düsternis der Stadt.
The Amateur of Velocipedes – die Liebhaberin der Velozipeden. Sie jagte auf Rädern mit massiven Speichen durch Paris und sang ein Lied ohne Worte. Mein Gott, dachte Thibaut, denn eine Frau fuhr auf ihr, und das durfte nicht sein. Aber dort war sie, hielt mit einer Hand das Handgelenk des Vélos umfasst, während sie mit der anderen an einem Lederriemen zog, der straff um den Hals der Fahrrad-Zentaurin geschlungen war.
Das Vélo war schneller als jedes Auto, jedes Pferd oder jeder Teufel, die Thibaut bisher gesehen hatte, schlug Haken zwischen den Fassaden, wich Kugeln aus. Es brach durch die noch verbleibenden Männer und die Reihe der Schneiderpuppen, die sie aufgestellt hatten. Es riss sein Vorderrad hoch und krachte auf die Barrikade, erklomm den meterhohen Wall aus Putz, Stein, Knochen, Holz und Mörtel, der die Straße versperrte.
Es hob vom Boden ab, katapultierte sich durch die Luft über den Soldaten, schien einen Moment still zu stehen und durchstieß schließlich die unsichtbare Grenze zwischen dem neunten und dem zehnten Arrondissement. Es schlug heftig auf der surrealistischen Seite der Straße auf.
Das Vélo machte einen Satz, schlingerte auf seinen Reifen, rutschte zur Seite. Die Fahrrad-Zentaurin kam zum Stehen und blickte auf, zum Fenster des Verstecks der Partisanen von La Main à plume, direkt in Thibauts Augen.
Er stürzte als erster aus dem Zimmer und die geborstene Treppe hinunter, fiel beinahe aus dem Hauseingang auf die Straße, wo schon die Dämmerung hereinbrach. Sein Herzschlag ließ seinen ganzen Körper erbeben.
Die Fahrerin des Vélos lag dort, wo ihr Reittier sie abgeworfen hatte, auf den Pflastersteinen ausgestreckt. Das Vélo bäumte sich über ihr auf seinem Hinterrad auf wie ein kampfbereites Pferd. Es schwankte.
Die Fahrrad-Zentaurin sah Thibaut an, mit pupillenlosen Augen von derselben Farbe wie ihre Haut. Die Manifestation spannte ihre mächtigen Arme und langte nach oben. Sie zerriss den Riemen, der um ihren Hals geschlungen war, und ließ ihn zu Boden fallen. Sie schaukelte im Wind.
Thibaut hielt sein Gewehr unschlüssig in den Händen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Élise eine Granate über die Barrikade warf, für den Fall, dass die Deutschen sich neu formiert hatten. Die Explosion ließ das Straßenpflaster und die Verteidigungsanlage erzittern, aber Thibaut rührte sich nicht.
Das Vélo kippte nach vorn und stand jetzt wieder auf beiden Rädern. Es setzte sich in Bewegung und kam auf ihn zu, doch er zwang sich, bewegungslos stehenzubleiben. Es beschleunigte mit surrenden Rädern. Adrenalin durchflutete ihn im Angesicht des sicheren Aufpralls, bis das Vélo im letzten, nicht mehr wahrnehmbaren Augenblick zur Seite schwenkte und so nah an ihm vorbeistrich, dass der Fahrtwind an seinen Kleidern zerrte.
Mit singenden Reifen raste die Fahrrad-Erscheinung im Zickzack zwischen den zerstörten Häusern der Cité de Trévise in die Ruinen und Schatten davon, außer Sichtweite.
Thibaut wagte wieder zu atmen. Als er sein Zittern unter Kontrolle gebracht hatte, wandte er sich der Frau zu, die auf dem Vélo gefahren war. Er ging zu der hingestreckten Gestalt hinüber.
Die Frau lag im Sterben. Die deutschen Kugeln, die dem Vélo nichts hatten anhaben können, hatten sie durchsiebt. Irgendetwas, was an dieser Straßenkreuzung, diesem Schnittpunkt mächtiger Kräfte flüchtig wirksam geworden war, hatte die Löcher in ihrem Fleisch trocken und runzlig werden lassen. Doch aus ihrem Mund quoll Blut, als müsse es sich einen Ausgang suchen. Sie hustete und versuchte zu sprechen.
»Hast du das gesehen?«, rief Élise. Thibaut kniete nieder und legte der Frau am Boden seine Hand auf die Stirn. Die Partisanen sammelten sich. »Sie ist auf dem Vélo gefahren!«, sagte Élise. »Was hat das zu bedeuten? Wie zur Hölle hat sie es gelenkt?«
»Nicht sonderlich gut«, bemerkte Virginie.
Das dunkle Kleid der Fahrerin war schmutzig und zerrissen. Ihr Schal lag auf der Straße ausgebreitet und umrahmte ihr Gesicht. Sie runzelte die Stirn wie in Gedanken. Als ob sie über eine komplizierte Frage nachgrübeln würde. Sie war nicht viel älter als er selbst, dachte Thibaut. Sie sah ihn eindringlich an.
»It’s … It’s …«, stieß sie hervor.
»Ich glaube, das ist Englisch«, stellte er leise fest.
Cédric trat hinzu und versuchte, ein Gebet zu flüstern, aber Virginie schob ihn mit einer heftigen Bewegung weg.
Die sterbende Frau ergriff Thibauts Hand. »Hierher«, flüsterte sie. »Er kam. Wolf. Gang.« Ihr Atem ging stoßweise. Thibaut legte sein Ohr dicht an ihren Mund. »Gerhard«, sagte sie. »Der Doktor. Der Priester.«
Thibaut bemerkte, dass sie ihn nicht mehr ansah, sondern an ihm vorbeischaute, auf etwas hinter ihm. Er spürte ein Kribbeln auf der Haut. Paris verlangte seine Aufmerksamkeit. Er wandte sich um.
Hinter den Fenstern des Hauses, das ihnen am nächsten war, über ihren Köpfen, ballte sich ein waberndes, schrundiges Universum embryonaler Klümpchen zusammen. Ein Morast dunkler Farben, der sich plastisch gegen eine noch schwärzere Dunkelheit abhob. Die Umrisse wirbelten durcheinander. Sie schlugen gegen das Glas. Eine Sturm-Manifestation war im Inneren des Hauses aufgekommen, um dem Tod jener Frau beizuwohnen.
Während alle Blicke auf die schwarze Kraft hinter den Fenstern gerichtet waren [2], spürte Thibaut, wie die Finger der Frau die seinen umfassten. Er erwiderte ihren Druck. Doch sie wollte keine letzte Geste der Zuwendung. Sie öffnete seine Hand und legte etwas hinein. Thibaut spürte sofort, dass es eine Spielkarte war.
Als er sich zu ihr umdrehte, war die Frau tot.
Thibauts ganze Loyalität galt La Main à plume. Er hätte nicht zu sagen vermocht, warum er die Karte in seine Tasche gleiten ließ, ohne sie seinen Genossen zu zeigen.
Mit der anderen Hand hatte die Frau Buchstaben auf das Straßenpflaster geschrieben, wobei sie ihren Zeigefinger als Schreibfeder benutzt hatte. Ihr Fingernagel troff von schwarzer Tinte, mit der die Stadt sie in jenem letzten Moment der Not versehen hatte. Sie hatte zwei letzte Worte geschrieben.
FALL ROT.
Monate sind vergangen und Thibaut kauert in einem Pariser Hauseingang. Er tastet in seiner Hosentasche nach der Spielkarte. Über seinen Kleidern trägt er ein blau und golden gestreiftes Damennachthemd.
Der Himmel schreit. Zwei Messerschmitts tauchen aus den Wolken auf, verfolgt von Hurricanes. Dachziegel bersten im britischen Feuer und die Flugzeuge reißen sich aus ihrem Sturzflug hoch. Eine der Messerschmitts fliegt ein gewagtes Wendemanöver, ihre Bordgeschütze speien Feuer und in einem flammenden Windstoß entfaltet sich eines der RAF-Flugzeuge in der Luft zu einer Blüte, öffnet sich wie ein Paar Hände, wie ein zugeworfener Kuss, und Feuer regnet herab und lässt dort unten ein ungesehenes Haus zu Staub werden.
Die zweite Messerschmitt schwenkt ab Richtung Seine. Wieder erbeben die Dächer, diesmal von unten.
Etwas erhebt sich aus dem Inneren von Paris.
Eine baumhohe Ranke mit zottigem hellglänzendem Blattwerk. Sie richtet sich in der Luft auf. Zuckende Knospen- oder Früchtetrauben, jede einzelne so groß wie ein menschlicher Kopf, erblühen riesenhaft über den Dächern.
Der deutsche Pilot fliegt direkt auf die lebendigen Blumen zu, wie ein Verliebter, wie im Rausch. Er senkt die Nase seines Flugzeugs in die Pflanze. Sie breitet zitternd ihre Blätter aus. Die riesige Rebe rankt noch einmal haushoch auf und umschlingt das Flugzeug. Reißt es hinab, hinter die Dächer, in die Straßen, außer Sicht.
Es gibt keine Explosion. Das gefangene Flugzeug verschwindet einfach in den Tiefen der Stadt.
Die übrigen Maschinen stieben wild auseinander. Thibaut wartet, bis sie fort sind, bis sein Herz wieder langsamer schlägt. Als er sich gefasst hat und wieder auf die Straße hinaustritt, ist der Himmel über ihm sauber.
Thibaut ist vierundzwanzig, abgehärtet, dünn und muskulös. Seine Augen sind ununterbrochen in Bewegung. Die Gefahr kann von überallher kommen: Er hat die gereizte Aggressivität und die zusammengebissenen Zähne des Neu-Parisers. Er achtet darauf, dass seine Haare und Nägel kurz geschnitten sind. Doch seine zusammengekniffenen Augen sind nicht nur Ausdruck von Misstrauen: Ihm fehlt die Brille, die er vermutlich braucht. Unter seinem grellen Damennachthemd trägt er ein schmutziges, ausgebessertes weißes Oberhemd, dunkle Hosen mit Hosenträgern und abgetragene schwarze Stiefel. Es ist einige Tage her, seit Thibaut sich zum letzten Mal rasiert hat. Er ist dreckverkrustet und stinkt.
Diese Piloten waren lebensmüde. Der Himmel über Paris ist voller Gründe, am Boden zu bleiben.
Es gibt Schlimmeres als jene flugzeugfressenden Pflanzen [3], von denen sich eine die Messerschmitt geschnappt hat. Ekstatische Vogelwolken umbrausen die Schornsteine von Paris. Knochen, aufgebläht wie Luftschiffe. Schwärme von Geschäftsleuten und Damen in altmodischen Kostümen mit Fledermausflügeln [4] rufen in endlosen Monologen Sonderangebote aus und verstopfen Flugzeugpropeller mit ihrem fragwürdigen Fleisch. Thibaut hat fliegende Kugeln und riesige abscheuliche Spindeln mit einer, zwei oder drei Tragflächen [5] gesehen und ein Sprossenfenster mit schwarzen Vorhängen, die wie lebende Tote über Hausgiebel geflogen sind, hinter einem verirrten Heinkel-Greif-Bomber her, um ihn mit einer bleiernen Berührung auszulöschen.
Thibaut kennt die Titel der meisten Manifestationen, denen er begegnet. Wenn sie Titel haben.
Schon vor dem Krieg hatte er sich jener Bewegung verschrieben, die sie hervorgebracht hat; einer Bewegung, die ihre Gegner als überholt und ausgelaugt verspottet hatten. »Mir ist egal, was gerade Mode ist!«, hatte er seiner amüsierten Mutter erklärt und mit den Schriften herumgewedelt, die er unbesehen bei einem wohlwollenden Buchhändler in der Rue Ruelle gekauft hatte, der alles aus dieser Richtung für ihn zurücklegte. »Hier geht es um Befreiung!« Der Buchhändler, das wurde Thibaut erst klar, als diese Tage schon weit in der Vergangenheit lagen, hatte seinem ebenso enthusiastischen wie unwissenden jungen Kunden gelegentlich wahre Raritäten für einen lächerlichen Preis überlassen. Zwei Tage bevor Thibaut für immer sein Zuhause verließ, war das letzte Paket bei ihm eingetroffen.
Als er später die Deutschen in die Stadt hatte einmarschieren sehen, war der Anblick ihrer Kolonnen am Arc de Triomphe ihm wie eine makabre Collage vorgekommen, eine Agitprop-Warnung.
Jetzt durchstreift er mit erhobenem Gewehr die breiten, öden Straßen des sechzehnten Arrondissements, weit weg von den Orten seiner eigenen Kämpfe, während der goldene Saum seines Nachthemds im Wind flattert. Die Sonne bleicht die Ruinen. Eine auf wundersame Weise dem Kochtopf entgangene Katze schießt unter einem ausgebrannten deutschen Panzer hervor, um sich woanders zu verkriechen.
Unkraut sprießt durch alte Autos und die Dielen von Zeitungskiosken. Es liebkost die Skelette der Gefallenen. Überall wurzeln riesige Sonnenblumen [6], und das Gras unter den Füßen ist mit Pflanzen gesprenkelt, die es vor der Explosion der S-Bombe nicht gab: Pflanzen, die Geräusche von sich geben, Pflanzen, die sich bewegen. Blumen der Liebenden, mit mandelförmigen Augen und pulsierenden Cartoon-Herzen als Blütenblättern. Ihre schwankenden Stängel sprießen aus den Mäulern sich aufrichtender Schlangen hervor [7], und sie starren Thibaut an, während er vorsichtig vorübergeht.
Schutt und Vegetation werden spärlicher und der Horizont weiter, als er den Fluss erreicht. Thibaut hält nach Monstern Ausschau.
Im Schlamm des seichten Ufers der Île aux Cygnes kriechen menschliche Hände, die aus Seeschneckenhäusern ragen. [8] Ein Schwarm Seine-Haie wirbelt unter dem Pont de Grenelle schmutzigen Schaum auf. Auf den Wellen schaukelnd beobachten sie, wie Thibaut näherkommt, während sie an einem auf und nieder tanzenden Pferdekadaver nagen. Jeder Hai hat vor der Rückenflosse eine Vertiefung mit einem Kanu-Sitz darin. [9]
Thibaut ist jetzt über ihnen auf der Brücke. Auf halbem Wege zwischen Festland und Ufer hält er an. Er ist eine Zielscheibe. Sein Soldateninstinkt drängt ihn, Deckung zu suchen, aber er zwingt sich, stehenzubleiben und sich umzusehen. Er lässt seinen Blick über die verwandelte Stadt schweifen.
Zacken der Zerstörung, eine in sich zusammengestürzte Silhouette. Vor dem flachen hellen Himmel im Nordosten ragt der Eiffelturm auf. Seine obere Hälfte befindet sich dort, wo sie hingehört, wo der Pont d’Iéna auf den Quai Branly stößt, über akkurat gepflegten Parkanlagen, doch auf halbem Weg zur Erde endet die Metallkonstruktion unvermittelt. Die Verbindung zum Boden fehlt. Der Turm hängt abgeschnitten in der Luft. Ein verbliebener Schwarm tapferer Pariser Vögel schießt unter den Stümpfen der Verstrebungen hindurch, vierzig Stockwerke über dem Erdboden. [10] Der Turm-Torso weist mit seinem langen Schatten den Weg.
Wo sind die Zellen von La Main à plume jetzt? Wie viele sind noch übrig?
Vor Monaten, nach der Episode mit dem Vélo, war Thibaut, so könnte man vielleicht sagen, aufgefordert worden, aktiv zu werden, sofern irgendjemand noch zu irgendetwas aufgefordert werden konnte. Über die Nachrichtenkanäle der Stadt hatte ihn eine Einladung erreicht. Eine Botschaft von alten Genossen.
»Man hat mir gesagt, dass Sie den Laden hier leiten«, hatte die junge Kundschafterin gesagt. Thibaut gefiel das nicht. »Werden Sie kommen?«
Thibaut erinnert sich, wie schwer die Spielkarte in seiner Tasche gelegen hatte. Wusste jemand, dass er sie besaß? War das der Grund, warum sie ihn zu sich riefen?
Auf der Karte ist ein blasses stilisiertes Frauengesicht abgebildet. Es sieht den Betrachter zweimal an, rotationssymmetrisch. Aus dem gelbblonden Schopf der Frau wachsen zwei große Katzen hervor, die sie in ihr Haar einwickeln. Unter jedem ihrer beiden Gesichter ist das blaue Profil einer anderen Frau mit geschlossenen Augen zu sehen, wenn sie es nicht selbst ist. In der oberen rechten Ecke der Spielkarte und links unten befindet sich jeweils ein schwarzes Schlüsselloch.
»Was soll das«, hatte Thibaut die Botin gefragt. »Warum soll ich kommen? Ich sichere das Neunte.«
Einige Zeit nach seiner Weigerung hatte er von einem dramatischen Ausfall gehört, der auf schreckliche Weise gescheitert war. Wer dabei den Gerüchten zufolge ums Leben gekommen war: die Namensliste seiner Lehrer.
Auf Wiedersehen, denkt er endlich, nach so vielen Wochen. Sein Nachthemd peitscht im Wind.
Thibaut war fünfzehn, als die S-Bombe explodierte.
Ein Geräusch wie eine weit entfernte Sirene unten am Fluss und eine Welle aus Schatten und Schweigen, die von dort heranbrauste und den jungen Thibaut nach Atem ringen und die für einen Moment erblindeten Augen zusammenkneifen ließ, und dahinter die Stadt, bereit und gerüstet, während etwas Gestalt annahm, was gleichzeitig in ihr Unbewusstes ein- und aus ihm herausbrach. Ein Traum, in den die höllischen Heerscharen einfallen. Was einst die schönste Stadt der Welt gewesen war, war nun von den eigenen unschönen Phantasmen bevölkert – und von der Hässlichkeit des Höllenschlundes.
Thibaut war nicht zum Guerilla geboren. Aber er hasste die Invasoren und wollte überleben, also hatte er kämpfen gelernt. Als Pariser war er ein Teil jener Apokalypse, in die er hineingezogen worden war, wie er, von Entsetzen hin- und hergerissen, rasch begriff.
In jenen ersten Tagen hatte der Wahnsinn unumschränkt geherrscht, Attacken unmöglicher Gestalten und falsch erinnerter Skelette. Auf den Straßen hatten sich Nazis und Résistance-Angehörige in Panik massakriert, während sie versuchten, unverständliche Traumbilder in Schach zu halten. In der zweiten Nacht nach der Explosion hatten verängstigte Wehrmachtssoldaten beim Versuch, eine Zone zu sichern, Thibaut und seine Familie und alle Nachbarn in einem Stacheldrahtpferch auf der Straße zusammengetrieben. Dort drängten sie sich aneinander und umklammerten Taschen mit wahllos zusammengerafften Habseligkeiten, während die Soldaten schimpften und miteinander stritten.
Dann war ein gewaltiges Geheul erklungen, das rasch näher kam. Schon damals erkannte Thibaut, dass es die Stimme einer Manifestation war.
Alle begannen zu schreien. Ein Offizier fuchtelte panisch mit seiner Waffe herum, um sie schließlich, in einem plötzlichen Entschluss auf die zusammengetriebenen Zivilisten zu richten. Er drückte ab.
Einige Soldaten versuchten vergeblich, ihn davon abzuhalten, weiter zu feuern, andere schossen mit ihm. Über dem Widerhall des Gemetzels erklang ununterbrochen der Schrei der Manifestation. Thibaut erinnert sich, wie zuerst sein Vater fiel und dann seine Mutter bei dem Versuch, ihn mit ihrem Körper zu schützen, und wie er schließlich selbst zusammensackte, ohne zu wissen, ob seine Beine nachgegeben hatten oder ob er sich totstellte, um zu überleben. Er hatte immer wieder Schreie gehört und ganz nah die Stimme der Manifestation und die Geräusche neuer Gewalt.
Und dann endlich, als alle Schreie und Schüsse verklungen waren, streckte Thibaut seinen Kopf langsam zwischen den Toten hervor, wie ein Seehund, der aus dem Wasser auftaucht.
Er blickte in ein Metallgitter. Das Visier eines federgeschmückten Ritterhelms. Es war viel zu groß und nur Zentimeter von seinem Gesicht entfernt.
Die behelmte Erscheinung starrte ihn an. Er blinzelte und das Metall erzitterte. Außer ihm und der Erscheinung rührte sich nichts. Die Deutschen waren tot oder geflohen. Die Manifestation schwankte, aber Thibaut verharrte reglos. Er wartete darauf, dass sie ihn töten würde, und sie erwiderte seinen Blick und ließ ihn am Leben. Es war die erste von vielen Manifestationen, die so auf ihn reagierten.
Das Ding richtete sich schlingernd auf, weg von dem Fleisch und den Trümmern, die die Stätte des Massakers bedeckten. Es ragte sieben, acht Meter hoch auf, ein unmöglicher Zwitter aus Turm und Mensch und einem riesigen Schild, zu einem sich drohend auftürmenden, unproportionierten Leib verbunden, handlose Arme, die schlauchartig am Körper herabhingen, der linke von Pferdebremsen umschwirrt. Die Scharniere seiner Rüstung kreischten klagend. Als das Geräusch verebbt war, stakte das gigantische Ding schließlich auf drei Beinen davon: ein riesiges, sporenbewehrtes Männerbein und ein Paar Frauenfüße in hochhackigen Schuhen. [11]
Dann war Stille. Und Thibaut, vom Krieg an Sohnes statt angenommen, war zitternd über die Opferstätte und durch die Trümmer gekrochen, bis er die Leichen seiner Eltern fand und weinte.
Oft hat er sich ausgemalt, wie er rachedurstig jenen Offizier verfolgt, der als erster geschossen hat, aber Thibaut kann sich nicht mehr erinnern, wie er aussah. Oder den Mann oder die Männer, deren Kugeln seine Eltern getötet haben, aber er weiß nicht, wer sie waren. Vielleicht wurden sie im Durcheinander von ihren eigenen Kameraden erschossen, oder sie gehörten zu denen, die von Backsteinen erschlagen wurden, als die Manifestation die Hausfassade niederriss.
In der Rue Giroux sackt das Mauerwerk zu einer chaotischen Dünenlandschaft zusammen. Ziegel krachen einen trümmerübersäten Hang hinab und eine junge Frau kommt zum Vorschein. Ihr Gesicht ist blutig und verkrustet und ihr Haar starr vor Schmutz. Sie bemerkt Thibaut nicht. Er beobachtet, wie sie an ihren Nägeln kaut und weiterhuscht.
Eine von Tausenden, die in der Falle sitzen. Die Nazis werden niemals zulassen, dass Paris das übrige Frankreich ansteckt. Alle Straßen in die Stadt hinein und hinaus sind gesperrt.
Als klar wurde, dass die Manifestationen, diese neuen Dinge mit ihren neuen Kräften, nicht wieder verschwinden würden und das Reich sich noch nicht für die Abriegelung entschieden hatte, hatte man zunächst versucht, sie zu zerstören, und dann, sie sich dienstbar zu machen. Oder eigene Manifestationen zu schaffen, die weniger launisch waren als die höllischen Verbündeten des Reichs. Es war den Nazis mit ihrer Manifestologie sogar gelungen, ein paar Dinge heraufzubeschwören: unfähige Statuen, einen Céline’schen Weltgeist, matte Pilzgeflechte, halb bewussten Dreck und eine Nervenschwäche, die Haus um Haus infiziert hatte. [12] Aber ihre Erfolge waren selten, hielten nicht lang und gehorchten nicht.
Jetzt, Jahre später, scheint es Thibaut, dass die Zahl der Manifestationen abnimmt. Dass die Stadt in eine zweite Phase nach der S-Bombe eingetreten ist.
Natürlich wimmelt es in Paris immer noch. Wenn du daran zweifelst, mach einfach einen Spaziergang, denkt er, und lass dich überraschen, was dir entgegenkommt. Enigmarelle, der eitle Roboter, einem Ausstellungskatalog entsprungen [13] und die Arme zu einer tödlicher Umarmung ausgestreckt. Die träumende Katze [14], groß wie ein Kind, die ungelenk auf zwei Beinen geht und dich aufmerksam und mitfühlend beobachtet. Du wirst solchen Gestalten begegnen, denkt Thibaut. Noch eine ganze Weile.
Und wenn du so weitergehst und auf der Hut bist und ungesehen bleibst, dann wirst du irgendwann wieder allein sein, und du wirst auf ein Stück Straße stoßen mit Fenstern und Mauern, die unberührt vom Krieg sind, und du könntest für einen Augenblick meinen, dass du wieder im alten Paris bist.
Ich vermisse nichts, sagt Thibaut einmal mehr trotzig zu sich selbst. Weder die Zeit vor dem Krieg, noch die relative Sicherheit, die bis vor Kurzem im neunten Arrondissement geherrscht hat. Die im Zehnten festsitzenden Nazis waren nicht in der Lage, jene Straßen einzunehmen, ebenso wenig wie die verwandelten Landschaften, die sie durchirrten, Sagenländer, glattgeschliffene Gebirgszüge, die an verdrehte Gardinen denken ließen [15], Häuser mit gefrorenen Zimmern voller Uhren, Orte, deren Geographie ihr eigenes Echo zurückwarf. Die Fülle aufsässiger Kunst im Neunten machte es uneinnehmbar. Es bot niemandem Schutz außer denen, die für diese Kunst kämpften – der surrealistischen Nachhut, den Soldaten des Unbewussten, La Main à plume.
Ich vermisse absolut gar nichts. Thibaut ballt die Faust um seine Waffe.
Jeder Baum am Flussufer ist hier in einer anderen Jahreszeit. Welke und lebendige Blätter. Thibaut wünscht sich Eisenbahnlinien. Wege nach draußen. Unter einer Laterne ist es Nacht. [16] Er lehnt sich gegen den Laternenpfahl, lässt sich zu Boden sinken und betrachtet minutenlang die Sterne.
Bin ich dieser Orte überhaupt noch würdig? Sie erschienen zur falschen Zeit, auf die falsche Art. Die Befreiung war für’n Arsch. Und wenn er keinen Funken Freude mehr in ihnen findet, denkt Thibaut, dann ist er möglicherweise auch nicht besser als irgendein Stalinist. Oder einer von de Gaulles Speichelleckern, ein Feind wahrer Freiheit.
Das bin ich nicht, denkt er. Nein.
Er steht auf und tritt zurück ins Sonnenlicht, jenseits der winzigen Insel aus Nacht, und im selben Moment erfüllt Gebrüll die Straße.
Sofort lässt sich Thibaut zu Boden fallen und geht hinter dem Stumpf einer Säule in Deckung, die Waffe im Anschlag. Der Krieg hat ihn gelehrt, sich unsichtbar zu machen. Das ist kein menschliches Geräusch, und – das weiß er mit Sicherheit – auch nicht das einer Manifestation.
Er wartet. Er atmet flach und horcht, wie etwas Schweres sich nähert. Langsam kommt es in Sicht. Thibaut visiert es über den Lauf seines Gewehrs an und packt die Waffe fester.
Ein schwankender Leib, wie der eines riesigen Stiers. Die Flanken sind blutverschmiert und schillern in allen Regenbogenfarben, als ob sie mit auf Wasser schwimmendem Benzin getränkt wären. Auf der Stirn des Dings sitzt ein Durcheinander langer grauer Hörner, manche davon abgebrochen. Es brüllt abermals auf und zeigt die Fangzähne eines Fleischfressers.
Es bewegt sich nicht mit der traumhaften Genauigkeit einer Manifestation, sondern mit stampfenden, unsicheren Schritten, die den Boden so stark erzittern lassen, dass er es spüren kann. Es nähert sich, ohne jenen winzigen Funken des Wiedererkennens auszulösen – selbst angesichts von etwas Unvorstellbarem, noch nie Gesehenem –, den eine Manifestation bei ihm entzündet. Es trieft und tropft und verursacht Thibaut Übelkeit. Dort, wo sein Blut knisternd und rauchend den Boden trifft, lodern Flammen auf. Das Tier schüttelt den Kopf, und von seinen Hörnern stieben Fetzen, die feucht auf der Erde landen. Thibauts Gedärme ziehen sich zusammen, und dieser Krampf sagt ihm, dass es sich um die Überreste einer Manifestation handelt.
Wenn die Teufel und die lebenden Kunstwerke sich nicht aus dem Weg gehen können, kommt es zu schrecklichen Kämpfen. Was da vom Gesicht des Dämons tropft, ist das frische Fleisch einer Manifestation.
In den Tagen nach der Explosion der S-Bombe hatten sich entsetzliche Wesen wie jener irregegangene Eindringling zu den deutschen Truppen und den Manifestationen gesellt, Bataillone aus der Tiefe.
Einige von Thibauts Genossen hatten versucht, diese einst gefallenen und jetzt aus der Hölle zurückgekehrten Ungeheuerlichkeiten zu begreifen. Es war eine Maßnahme im Überlebenskampf gewesen. Sie verschafften sich die notwendigen Fachkenntnisse aus schlechtbeleumundeten Büchern, die sie aufstöberten. Sie schwatzten gefangenen deutschen Kurieren und fachkundigen Priestern aus Aleschs im Aufbau begriffenem Bistum Informationen ab. Die Kühnsten belauschten die gebellten Unterhaltungen der Dämonen, setzten Informationsfetzen zusammen, analysierten Gerüchte über widerstrebend geschlossene Bündnisse zwischen Hölle und Reich. Élise hätte ihm vielleicht sagen können, was für eine Art von Teufel er da vor sich hat, während er betet, wenn auch zu keinem Gott, dass er ihn nicht entdeckt: Alles, was Thibaut weiß, ist, dass es ein Teufel ist, und ein großer dazu.
Wie die meisten von seiner Sorte hat das Ding offensichtlich Schmerzen. Doch was für Wunden oder Krankheiten es auch haben mag, bei dieser Größe werden sie Thibaut nicht helfen. Das bisschen Flitterkram, das er dabei hat, um es gegen die höllischen Scharen einzusetzen, ist nicht genug. Das Ding wird ihn töten, wenn es ihn entdeckt.
Doch das Ungeheuer watschelt schmerzgepeinigt davon, ohne in seine Richtung zu blicken, auf Beinen, deren Zahl veränderlich scheint. Es lässt eine Spur aus brennendem Blut und aufgerissenem Straßenpflaster zurück.
Thibaut wartet, bis es von der Straße abbiegt, außer Sicht, und lauscht, wie es sich wegschleppt, und wartet noch länger, bis nichts mehr zu hören ist. Erst dann entspannt er sich und betastet sein Nachthemd. Selbst das hier, denkt er und fährt mit dem Finger den Saum entlang, hätte ihn nicht gerettet. Ich sollte von den Straßen runter, denkt er. Dann spöttisch: Vielleicht sollte ich die Métro nehmen.
Thibaut denkt an seine Toten im Wald. Er denkt an den gescheiterten Plan, den Anschlag, von dem er sich selbst ausgeschlossen hat.
Er zieht einen Bleistift und ein vielfach gefaltetes fleckiges altes Schulheft aus der Tasche. Er öffnet sein Kriegsnotizbuch.
Ich bin kein verdammter Deserteur. Die Mission ist sinnlos. Ich bin kein Deserteur.
Thibaut war fast siebzehn, als er, den Erzählungen Überlebender und dem Lärm von Schüssen und verbrannten und gespenstisch verrenkten Überresten deutscher Patrouillen und den Ahnungen, die ihn manchmal heimsuchten, folgend, La Main à plume in den Ruinen aufspürte.
Er wedelte mit zerlesenen Zeitschriften, als er sich ihrem Quartier näherte, und zitterte dabei vor Nervosität so stark, dass die Mitglieder des Auswahlkomitees, die ihn in Empfang nahmen und ihn in ihr Lager führten, lachen mussten – ein nicht unfreundliches Lachen.
»Ihr seid das, nicht wahr?«, wiederholte er immer wieder und zeigte dabei auf die Seiten, die Namen. Sie lachten weiter, als er sagte: »Ich will mitmachen.«
Sie stellten ihn auf die Probe. Als er sagte, dass er nicht schießen könne – er hatte damals noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt –, scherzten sie, dass er es dann mit automatischem Schießen versuchen müsse. Wie automatisches Schreiben. »Weißt du, wer gesagt hat, dass die einfachste surrealistische Handlung darin besteht, wahllos in die Menge zu schießen?« Er wusste es, und das gefiel ihnen.
Weitere Prüfungen. Sie zeigten auf bestimmte Gegenstände aus dem Gerümpel, das ihren Keller füllte, und fragten ihn, ob es surrealistische Objekte wären oder einfach Müll. Thibaut sah sich die Dinge an und murmelte seine Antworten so schnell, dass er offensichtlich nicht hatte nachdenken müssen – ein Stuhlbein mit Klauenfuß war nichts, eine leere Zigarrenkiste und eine Haarbürste waren surreal, und so weiter. Nur einmal musste er sich korrigieren, bei was erinnerte er sich später nicht mehr. Als er fertig war, sahen sie ihn nachdenklicher an.
Als einer der Befrager seinen Schuh auszog, um sich am Fuß zu kratzen, nahm Thibaut mit einer Kühnheit, die damals noch nicht ganz zu ihm passte, dem überraschten Mann den Schuh aus der Hand, griff sich einen Kerzenleuchter, den er zuvor als bloßen Alltagsgegenstand verworfen hatte, und stellte ihn in den alten Ledergaloschen.
»Jetzt ist er surreal«, sagte er. Die Blicke, die sich das Auswahlkomitee zuwarf, das aus zu Guerillas gewordenen Künstlern, Büroangestellten und Museumskuratoren bestand, entgingen ihm nicht.
»Du willst kämpfen, sagst du?«, fragte der halb beschuhte Mann und sah ihn von der Seite an. »Im Augenblick allerdings … mit all diesen … warum auf diese Art? Warum mit uns? So, wie es um die Stadt steht, gibt es da nicht Wichtigeres als Poesie?«