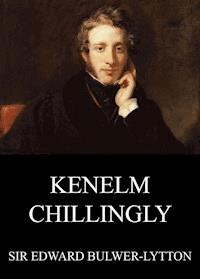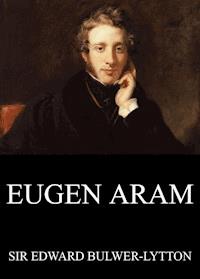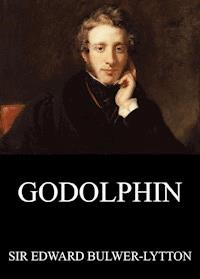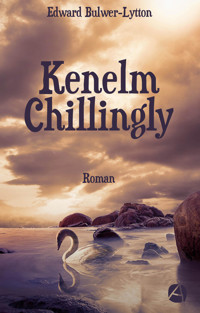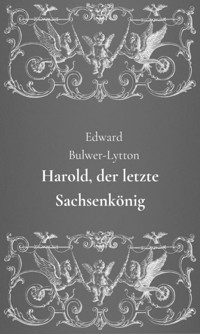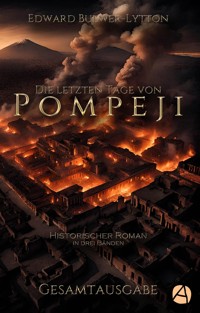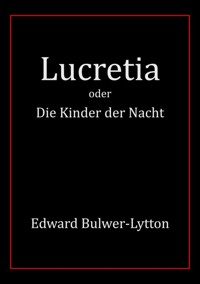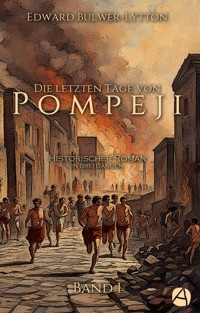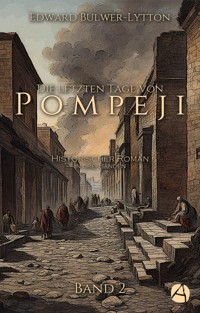
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ausbruch des Vesuv
- Sprache: Deutsch
Pompeji, 79. n. Chr.: Der junge und reiche Grieche Glaukus führt ein dekadentes Leben in Ausschweifungen und Laster. Er verbringt seine Zeit in der müßigen Gesellschaft von neureichen und nichtsnutzigen Tagedieben, wie dem Patrizier Clodius und dem Freigelassenen Diomed. Doch als er der schönen Ione begegnet und sich in diese verliebt, wird ihm die Sinnlosigkeit seines bisherigen Lebenswandels schlagartig bewusst. Seine Gedanken kreisen nur noch um die junge Frau, die seine Gefühle erwidert. Aber Ione ist ein Mündel des ägyptischen Isispriesters Arbaces, der sie seinerseits begehrt. Und während die Einwohner Pompejis ihren menschlichen Verwicklungen und Interessen folgen, deuten erste Beben eine unvorhergesehene Katastrophe an. Das 1834 erschienene große Werk von Edward Bulwer-Lytton war bei seinem Erscheinen eine literarische Sensation. Die imposanten Naturschilderungen, die authentisch gezeichneten Figuren und die Darstellung des römischen Lebens in Pompeji kurz vor Ausbruch des Vesuvs wurden mehrfach verfilmt. Dies ist der zweite Band von insgesamt drei Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
EDUARD BULWER-LYTTON
DIE LETZTEN TAGE VON POMPEJI
HISTORISCHER ROMAN
IN DREI BÄNDEN
BAND 2
DIE LETZTEN TAGE VON POMPEJI wurde in der zugrundeliegenden Übersetzung von Wilhelm Schöttlen zuerst von Scheibe, Riegler & Sattler veröffentlicht, Stuttgart 1845.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
2024
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
BAND 2
ISBN 978-3-96130-620-6
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
ROMANE von JANE AUSTEN
im apebook Verlag
Verstand und Gefühl
Stolz und Vorurteil
Mansfield Park
Northanger Abbey
Emma
*
* *
HISTORISCHE ROMANREIHEN
im apebook Verlag
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
Die Geheimnisse von Paris. Band 1
Mit Feuer und Schwert. Band 1: Der Aufstand
Quo Vadis? Band 1
Bleak House. Band 1
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
Inhaltsverzeichnis
Die letzten Tage von Pompeji. Band 2
Impressum
Drittes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Viertes Buch.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
ApePoints sammeln
Zu guter Letzt
Drittes Buch.
Hellen Scheines leuchte du Selene,Dich beschwört mein leises Zaubersingen,Hekate, auch Dich, die Höllgengöttin:Führe Du uns, Dein blutig Mahl zu suchenUnter Gräbern, zittern selbst die Hunde.Hekate, Dich grüß ich: Hilf vollenden,Mache mir den Zauber stark wie Kirkes,Die Medeas stark und Perimedes.
Theocr. Idyll. II. 10.
Erstes Kapitel.
Das Forum der Pompejaner – Der erste rohe Mechanismus, vermittelst dessen die neue Weltepoche bewerkstelligt wird.
Es war noch früh am Mittag und das Forum mit Geschäftigen sowohl, als mit Müßiggängern angefüllt. Wie heutzutage in Paris, so lebten damals in den Städten Italiens die Menschen fast ganz außerhalb ihrer Häuser; die öffentlichen Gebäude, das Forum, die Säulengänge, die Böden, und selbst die Tempel konnten als ihre eigentliche Heimat betrachtet werden. Es war daher nicht zu verwundern, daß sie diese beliebten Versammlungsplätze so prachtvoll ausschmückten; bildeten sie doch für sie gewissermaßen einen Gegenstand häuslicher Zuneigung, sowie nationalen Stolzes. Und belebt war in der Tat zu jener Zeit der Anblick, den das Forum zu Pompeji darbot! Auf seinem breiten, aus großen Marmorplatten gebildeten Pflaster waren verschiedene Gruppen versammelt, in jener energischen Unterhaltungsweise begriffen, die jedem Wort eine Geberde beifügt, und die noch heute das unterscheidende Merkmal der Völker des Südens ist. Hier saßen in sieben Buden auf einer Seite der Kolonnade die Geldwechsler, glänzende Münzhaufen vor sich aufgetürmt, und Seemänner und Kaufleute in bunten Trachten, drängten sich um ihre Buden. Auf der andern Seite sah man mehr Männer in langen TogenF34 einem stattlichen Gebäude zueilen, wo der Magistrat die Gerechtigkeit verwaltete; diese Herren waren Advokaten, tätig, plaudernd, scherzend und witzelnd, wie man sie noch heute in Westminster finden kann. In der Mitte des Platzes standen mehre Statuen, unter welchen die majestätische Gestalt des Cicero die beachtungswerteste war, auf Piedestalen. Um den Hof herum lief ein regelmäßiger und symmetrischer Säulengang nach dorischer Ordnung, und da nahmen Manche, die durch ihr Geschäft frühe hierher geführt wurden, die leichte Mahlzeit ein, welche damals ein italienisches Frühstück ausmachte, und sprachen sehr lebhaft von dem Erdbeben der vorigen Nacht, während sie Stücke Brod in ihre Becher mit verdünntem Weine tauchten. Auch in dem offenen Raume gewahrte man mehre Krämer, die hier ihr Gewerbe ausübten. Da zeigte Einer einer Dame seine schönen Bänder, ein Anderer rühmte einem stattlichen Pächter die Trefflichkeit seiner Schuhe; ein Dritter, eine Art von Buden-Restaurateur, wie wir sie noch jetzt in den italienischen Städten so häufig finden, versorgte manchen hungrigen Magen mit warmen Speisen aus seinem kleinen ambulanten Ofen; während – scharf charakterisierender Gegensatz, und sprechendes Bild der Vereinigung materiellen und intellektuellen Lebens jener Zeit – dicht dabei ein Schulmeister seinen verwirrten Zöglingen die Anfangsgründe der lateinischen Grammatik erklärte.F35 Eine Galerie über dem Seitengang, zu der man auf kleinen hölzernen Treppen emporstieg, hatte auch ihre Gäste, obgleich, da hier hauptsächlich die eigentlichen Geschäfte des Ortes abgemacht wurden, ihre Gruppen einen ruhigeren und ernsteren Anblick darboten.
Dann und wann trat die Menge unten ehrfurchtsvoll auf die Seite, wenn ein Senator auf dem Wege zum Jupitertempel (der eine Seite des Forums einnahm und den Versammlungsort der Senatoren bildete) vorbeiging, denjenigen seiner Freunde und Klienten, die er aus der Menge erkannte, mit prahlerischer Herablassung zuwinkend. Unter den heitern Kleidungen der bessern Stände sah man auch die kräftigen Gestalten der benachbarten Pächter, wie sie nach den öffentlichen Getreidemagazinen sich begaben. Hart bei dem Tempel gewahrte man den Triumphbogen und die lange, mit Menschen angefüllte Straße jenseits desselben; in einer Nische des Bogens spielte ein Springbrunnen munter in den Sonnenstrahlen, und über dem Karnieß dunkelte, im lebhaften Gegensatz zu dem freundlichen Sommerhimmel, die eherne Reiterstatue Caligula's. Hinter den Buden der Wechsler stand jenes Gebäude, das jetzt das Pantheon genannt wird, und eine Schaar ärmerer Pompejaner trat mit Körben unter dem Arm durch die enge, in das Innere führende Vorhalle und drängte sich nach einer Plattform zwischen zwei Säulen, wo diejenigen Nahrungsmittel, welche die Priester vom Opfer erübrigt hatten, zum Verkaufe ausgeboten wurden.
An einem der für die öffentlichen Angelegenheiten der Stadt bestimmten Gebäude, waren Werkleute mit den Säulen beschäftigt, und von Zeit zu Zeit hörte man den Lärm ihrer Arbeit aus dem Gesumse der Menge hervortönen; – die Säulen sind bis auf den heutigen Tag unvollendet!
Alles dies zusammengenommen, ging nichts über die Mannigfaltigkeit in der Tracht, dem Stand, dem Benehmen und den Beschäftigungen der Menge; nichts über die Regsamkeit, die Munterkeit, die Tätigkeit, die beständig ringsherum herrschende Lebensbewegung. Man sah da all die tausend Zeichen einer erhitzten und krankhaften Civilisation, wo das Vergnügen und der Handel, der Müßiggang und die Arbeit, die Geldgierde und die Ehrsucht ihre bunten und rauschenden, aber gleichwohl harmonischen Ströme in ein großes Meer ergossen.
Den Stufen des Jupitertempels gegenüber stand mit gefalteten Armen und gerunzelter und verachtender Stirn ein Mann von etwa fünfzig Jahren. Sein Anzug war besonders einfach, nicht sowohl dem Stoffe nach, als vielmehr durch den Mangel all der Verzierungen, die von den Pompejanern jeden Standes getragen wurden, teils aus Liebe zum Schaugepränge, teils auch, weil diese Verzierungen meist in diejenigen Formen gebracht waren, die als die wirksamsten gegen die Angriffe der Zauberei, wie gegen den Einfluß des bösen AugesF36 galten. Seine Stirn war hoch und kahl, die wenigen Locken am Hinterkopfe durch eine Art Kapuze versteckt, die einen Teil seines Mantels bildete und nach Belieben aufgezogen und herabgelassen werden konnte, jetzt aber zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen über den Kopf hereingezogen worden war. Sein Gewand war braun – eine, bei den Pompejanern, die alle die gewöhnlichen Mischungen von Scharlach und Purpur sorgfältig vermieden, nicht sehr beliebte Farbe. Sein Gürtel enthielt ein kleines Dintengefäß, das eingehängt war, einen Stylus (Griffel) und Schreibtäfelchen von nicht gewöhnlicher Größe. Noch auffallender war, daß der Gürtel keine Börse enthielt, die doch eine beinahe unerläßliche Zugabe desselben bildete, – selbst wenn diese Börse das Unglück hatte, leer zu sein.
Es geschah nicht häufig, daß die lebenslustigen und egoistischen Pompejaner sich damit abgaben, die Gesichter und Handlungen Anderer zu beobachten; aber in Lippe und Auge dieses Mannes lag, als er die religiöse Prozession die Stufen des Tempels hinaufsteigen sah, etwas so auffallend Bitteres und Verachtendes, daß es nicht verfehlen konnte, vielseitige Aufmerksamkeit zu erregen.
»Wer ist jener Cyniker?« fragte ein Kaufmann seinen Gefährten, einen Juwelier.
»Es ist Olinth,« antwortete der Befragte, »der im Geruche eines Nazareners steht.«
Der Kaufmann schauderte. »Eine schreckliche Sekte,« sprach er mit leiser, furchtsamer Stimme. »Man sagt, bei ihren nächtlichen Versammlungen beginnen sie ihre Ceremonien jedesmal mit der Ermordung eines neugeborenen Kindes, auch stellen sie die Lehre von der Gemeinschaft der Güter auf. Was würde aus den Kaufleuten oder Juwelieren werden, wenn solche Begriffe in die Mode kämen!«
»Das ist sehr wahr,« entgegnete der Juwelier, »überdies tragen sie keine Juwelen und murmeln Verwünschungen, wenn sie eine Schlange sehen, während doch alle unsere Verzierungen in Pompeji schlangenförmig sind.«
»Sehet nur,« sagte ein Dritter, ein Fabrikant von Bronzewaaren, »wie jener Nazarener die Feierlichkeit des Opferzuges verspottet. Er murmelt gewiß Flüche auf den Tempel. Weißt Du wohl, Celsinus, daß dieser Bursche, als er neulich an meiner Bude vorbeiging und mich an einer Statue der Minverva beschäftigt sah, mir mit Stirnrunzeln erklärte, wenn sie von Marmor wäre, so würde er sie zerbrochen haben, aber das Erz sei zu stark für ihn. ›Eine Göttin zerbrechen!‹ sagte ich – ›eine Göttin,‹ antwortete der Atheist, ›es ist ein Dämon, ein böser Geist.‹ Dann setzte er fluchend seinen Weg fort. Ist so etwas zu dulden? Was Wunder, daß die Erde in der letzten Nacht so fürchterlich erbebte, wie um den Atheisten aus ihrem Schooß zu werfen. Ein Atheist, sag' ich? Noch etwas Schlimmeres, ein Verächter der schönen Künste! – Wehe uns Bronzefabrikanten, wenn solche Burschen der Gesellschaft Gesetze geben dürften!«
»Dies sind die Mordbrenner, die unter Nero Rom anzündeten,« seufzte der Juwelier.
Während solche freundliche Bemerkungen über das Aussehen und den Glauben des Nazareners gewechselt wurden, gewahrte auch Olinth selbst den Eindruck, den er hervorbrachte; er schaute sich um und beobachtete die aufmerksamen Gesichter des Haufens, der immer größer wurde, ihn angaffte und sich allerlei zuflüsterte. Er betrachtete die Menge einen Augenblick mit einem Ausdrucke des Trotzes, darauf des Mitleidens, und entfernte sich sodann, nachdem er seinen Mantel um sich geschlagen, indem er hörbar murmelte: »Verblendete Götzendiener! – Hat euch das Erdbeben der vorigen Nacht nicht gewarnt? Ach, wie werdet ihr am letzten Tage bestehen!«
Die Menge, welche diese weissagenden Worte hörte, legte sich dieselben verschieden aus, je nach den verschiedenen Schattirungen der Unwissenheit oder Furcht; alle jedoch stimmten in der Ansicht überein, daß eine schreckliche Verwünschung in ihnen liege. Sie betrachteten den Christen als den Feind der Menschen; die Beiworte, mit denen sie ihn überhäuften, unter denen Atheist das beliebteste und häufigste war, dürften vielleicht uns, die Bekenner desselben nunmehr triumphierenden Glaubens, als Warnung dienen, solchen Meinungsverfolgungen, wie sie Olinth erlitt, uns nicht hinzugeben, und diejenigen, deren Ansichten von den unsrigen verschieden sind, nicht mit solchen Ausdrücken zu beschimpfen, wie sie den Vätern unseres Glaubens damals so reichlich zu Teil wurden.
Während Olinth durch die Menge hinschritt und einen der weniger besuchten Ausgänge des Forums erreichte, gewahrte er ein blasses und ernstes Antlitz, das ihn scharf ansah, und das er auch sofort erkannte.
In ein Pallium gehüllt, das seine heiligen Gewänder teilweise verbarg, betrachtete der junge Apäcides den Jünger dieses neuen und geheimnisvollen Glaubens, zu dem er selbst einmal halb bekehrt worden war.
»Ist auch er ein Betrüger? Macht auch dieser Mann, der so schlicht und einfach in seinem Leben, in seinem Anzuge und in seiner Miene ist – macht auch er, wie Arbaces, äußerliche Strenge zum Deckmantel der Sinnlichkeit? Verbirgt der Schleier der Vesta die Laster der Verworfenheit?«
Olinth, der an den Umgang mit Leuten aus allen Klassen gewöhnt war, und mit der Begeisterung seines Glaubens eine tiefe Menschenkenntnis verband, erriet vielleicht aus den Gesichtszügen des Isispriesters etwas von dem, was in der Brust des Letzteren vorging. Mit festem Auge und heiterer und aufrichtiger Stirne hielt er den prüfenden Blick des Apäcides aus.
»Friede sei mit Dir!« sagte er, den Apäcides grüßend.
»Friede,« wiederholte der Priester in einem so hohlen Tone, daß er dem Nazarener zum Herzen drang.
»In diesem Wunsche,« fuhr Olinth fort, »sind alle guten Gaben vereinigt – ohne Tugend kannst Du keinen Frieden haben. Wie der Regenbogen ruht der Friede auf der Erde, aber seine Wölbung verliert sich in den Himmel. Der Himmel badet ihn in den Tinten des Lichts – er entsteht inmitten von Tränen und Wolken, ist ein Abglanz der ewigen Sonne, ein Bürge der Ruhe, das Zeichen eines großen Bundes zwischen Gott und dem Menschen. Ein solcher Friede, junger Mann, ist das Lächeln der Seele, ein Ausfluß von dem fernen Kreis des unsterblichen Lichts. Friede sei mit Dir!«
»Ach!« begann Apäcides, gewahrte jedoch sofort die neugierigen Blicke der Umherschlenderer, die gerne erforscht hätten, was denn der Gegenstand eines Gesprächs zwischen einem Nazarener und einem Isispriester sein könne; er hielt deshalb inne und setzte mit leiser Stimme hinzu: »Hier können wir uns nicht unterhalten, aber ich will Dir an die Ufer des Flusses folgen; dort gibt es einen Spaziergang, der um diese Stunde gewöhnlich einsam und verlassen ist.«
Olinth nickte bejahend. Mit schnellem Schritt, aber mit lebhaftem und beobachtenden Auge ging er durch die Straßen. Da und dort wechselte er einen ausdrucksvollen Blick oder ein leichtes Zeichen mit einem der Vorbeigehenden, der seiner Kleidung nach den unteren Klassen angehörte; denn das Christentum war hierin ein Vorbild aller andern minder wichtigen Revolutionen – das Senfkorn wucherte in den Herzen der Armen. Unter den Hütten der Armut und des Fleißes hatte der gewaltige Strom, der später die Städte und Paläste der Erde mit seinem breiten Gewässer bespülte, seine unbeachtete Quelle.
Die Rechtsgelehrten und die Klienten nämlich, wenn sie ihren Patronen aufwarteten, behielten die Toga selbst dann noch bei, nachdem diese bei der übrigen Bevölkerung außer Gebrauch gekommen war.
Im Museum zu Neapel befindet sich ein wenig bekanntes Gemälde, das eine Seite des damaligen Forums zu Pompeji darstellt und mir bei gegenwärtiger Beschreibung die wesentlichsten Dienste leistete.
Dieser Aberglaube, dessen ich im vorliegenden Werke mehr als einmal gedacht habe, dauert in Großgriechenland mit kaum verminderter Kraft noch immer fort. Ich erinnere mich, daß eine Dame aus Neapel vom höchsten Rang und von einem Geist und einer Bildung, wie man sie unter den vornehmen Italienern beiderlei Geschlechtes selten trifft, in einem Gespräche mit mir plötzlich die Farbe wechselte und eine reiche und sonderbare Bewegung mit ihren Fingern machte. »Mein Gott, jener Mann,« flüsterte sie zitternd.
Zweites Kapitel.
Die Mittagsfahrt auf dem kampanischen Meer.
»Aber erzähle mir Glaukus,« sagte Ione, als sie in ihrem Lustboote den kräuselnden Corpus hinabfuhren, »wie kamst Du mit Apäcides zu meiner Befreiung von jenem schändlichen Manne herbei?«
»Frage die Nydia dort,« antwortete der Athener, auf das blinde Mädchen deutend, das in einiger Entfernung von ihnen, nachdenkend auf seine Lyra gelehnt, saß. »Ihr mußt Du danken, nicht uns. Sie scheint in mein Haus gekommen zu sein, und da sie mich dort nicht traf, Deinen Bruder in seinem Tempel aufgesucht zu haben; er begleitete sie zu Arbaces; unterwegs trafen sei mich in einer Gesellschaft von Freunden, denen ich mich in der heitern Stimmung über Deinen freundlichen Brief angeschlossen hatte. Nydia's scharfes Ohr erkannte meine Stimme – wenige Worte genügten, mich zum Begleiter des Apäcides zu machen; meinen Gefährten übrigens sage ich nicht, warum ich sie verließ – konnte ich ihren leichten Zunge und ihrer Indiscretion Deinen Namen anvertrauen? Nydia führte uns an die Gartentür, durch welche wir Dich nachher trugen; wir traten ein und wollten uns eben in die Geheimnisse jenes argen Hauses stürzen, als wir Dein Geschrei in einer andern Richtung vernahmen. Das Übrige weißt Du.«
Ione errötete tief; dann erhob sie ihre Augen zu Glaukus und in ihnen las er all den Dank, den sie nicht auszusprechen vermochte.
»Komm hierher, meine Nydia,« sprach Ione zärtlich zu der Thessalierin. »Sagte ich Dir nicht, Du sollest meine Schwester und Freundin sein? Bist Du nicht schon mehr gewesen – meine Beschützerin, meine Erretterin?«
»Das ist unbedeutend,« antwortete Nydia kalt, ohne aufzusehen.
»Ah, ich vergaß,« fuhr Ione fort, »daß ich zu Dir kommen muß.« Damit schritt sie längs der Schiffsbank hin, bis sie zu der Stelle kam, wo Nydia saß, schlang ihre Arme zärtlich um sie und bedeckte ihre Wangen mit Küssen.
Nydia war an diesem Morgen blässer als gewöhnlich und ihr Gesicht wurde sogar noch bleicher und farbloser, während die schöne Neapolitanerin sie umarmte. »Aber wie kam es denn, Nydia,« flüsterte Ione, »daß Du die Gefahr, der ich ausgesetzt war, so genau errietest? Kanntest Du den Ägypter schon?«
»Ja, ich kannte seine Laster.«
»Und woher?«
»Edle Ione, ich war eine Sklavin der Lasterhaften – die, denen ich diente, waren seine Gehülfen.«
»Du hast wohl sein Haus schon betreten, da Du jenen geheimen Eingang so genau kanntest?«
»Ich habe dem Arbaces auf meiner Leier gespielt,« erwiderte Nydia verlegen.
»Und Du bist der Gefahr entgangen, aus der Du Ione gerettet hast?« entgegnete die Neapolitanerin in einer Stimme, die für das Ohr des Glaukus zu leis war.
»Edle Ione, wir stehen weder Schönheit noch Rang zur Seite; ich bin ein Kind, eine Sklavin und blind; die Verachteten sind immer sicher.«
Nydia gab diese demütige Antwort in einem schmerzlichen, stolzen und entrüsteten Tone, und Ione fühlte, daß sie durch längeres Besprechen dieses Gegenstandes das arme Kind nur verwunden würde. Sie blieb deshalb still und die Barke schwamm jetzt in die See hinaus.
»Gestehe, daß ich Recht hatte,« sprach Glaukus, »als ich Dich bestimmte, diesen schönen Mittag nicht in Deinem Zimmer zuzubringen – gestehe, daß ich Recht hatte.«
»Du hattest Recht, Glaukus,« fiel Nydia schnell ein.
»Das liebe Kind spricht für Dich,« erwiderte der Athener. »Gestatte mir jedoch, mich Dir gegenüber zu setzen, sonst könnte unser leichtes Boot das Gleichgewicht verlieren.«
Mit diesen Worten nahm er seinen Sitz gerade Ione gegenüber und bildete sich, vorwärts lehnend, ein, es sei ihr Atem und nicht der Sommerwind, der die Wohlgerüche über das Meer hinströme.
»Du wolltest mir sagen,« sprach Glaukus, »weshalb mir Deine Tür so viele Tage verschlossen war.«
»Oh, denke nicht mehr daran!« antwortete Ione schnell; »ich schenkte dem Gehör, was ich jetzt als boshafte Verleumdung erkenne.«
»Und mein Verleumder war der Ägypter?«
Ione's Stillschweigen bejahte die Frage.
»Seine Beweggründe liegen klar genug am Tage.«
»Rede nicht mehr von ihm,« bat Ione, ihr Gesicht mit den Händen bedeckend, als ob sie selbst den Gedanken an ihn verbannen wollte.
»Vielleicht ist er jetzt schon an den Ufern des langsamen Styx.« hub Glaukus von Neuem an, »doch hätten wir in diesem Falle wahrscheinlich von seinem Tode gehört. Dein Bruder hat, wie es mir scheint, unter dem schlimmen Einfluß seines finstern Gemütes gelitten. Als wir gestern Nacht in Deinem Hause ankamen, verließ er mich plötzlich. Wird er sich je herablassen, mein Freund zu sein?«
»Irgend ein geheimer Kummer nagt an ihm,« antwortete Ione unter Tränen. »Könnten wir ihn doch von sich selber abziehen! Laß uns gemeinschaftlich dieses Liebeswerk unternehmen.«
»Er soll mein Bruder sein,« erwiderte der Grieche.
»Wie ruhig,« sagte Ione, indem sie sich aus der düstern Stimmung zu erheben suchte, in welche sie der Gedanke an Apäcides gestürzt, »wie ruhig scheinen die Wolken am Himmel zu schweben und doch sagtest Du mir – denn ich selbst wußte es nicht – die Erde habe gestern Nacht unter unsern Füßen gebebt.«
»Allerdings, und zwar, wie man sagt, heftiger als je seit der großen Erschütterung vor 16 Jahren; das Land, worin wir leben, hegt manchen geheimnisvollen Schrecken, und das Reich Pluto's, das sich unter unseren brennenden Feldern ausbreitet, scheint von unsichtbarem Kampfe gerissen. Fühltest Du gestern Nacht auf der Stelle, wo Du saßest, das Erdbeben nicht, und war es nicht die Furcht, Nydia, die Dich weinen machte?«
»Ich fühlte wie der Boden unter mir schwankte und sich hob, wie eine ungeheure Schlange,« antwortete Nydia, »aber da ich nicht sah, so hatte ich auch keine Furcht und glaubte, die Erschütterung sei ein Zauber des Ägypters. Man behauptet, er habe Gewalt über die Elemente.«
»Du bist eine Thessalierin, meine Nydia,« erwiderte Glaukus, »und hast daher ein Nationalrecht, an Magie zu glauben.«
»Magie – wer zweifelt daran?« entgegnete Nydia einfach, »etwa Du?«
»Bis vorige Nacht, in welcher ein nekromantisches Wunder mich allerdings erschreckte, glaubte ich, so viel mir bewußt, an keine andere Magie, als an die der Liebe!« sprach Glaukus mit zitternder Stimme, seine Blicke auf Ione geheftet.
»Ach!« sagte Nydia mit einer Art Schauder und griff mechanisch einige freundliche Töne auf ihrer Leier, deren Ton zu der Ruhe des Wassers und zu der sonnigen Stille des Mittags trefflich paßte.
»Spiele uns, liebe Nydia,« hub Glaukus an, »spiele und gib uns eines Deiner alten thessalischen Lieder, mag es nun von Magie handeln oder nicht, wie Du willst, wenn es nur von Liebe spricht.«
»Von Liebe!« wiederholte Nydia, ihre großen, unstäten Augen aufschlagend, die Alle, welche darein schauten, mit einem gemischten Gefühle des Mitleidens und der Furcht erfüllten. Nie konnte man sich an ihren Anblick gewöhnen; so sonderbar erschien es, daß diese dunklen, wilden Kreise den Tag nicht kennen sollten, und ihr tiefer, geheimnisvoller Blick war entweder so starr, oder ihr Glanz so unruhig und wirr, daß man, wenn man ihnen begegnete, denselben unbestimmten und unheimlichen, halb übernatürlichen Eindruck empfand, den die Gegenwart von Wahnsinnigen in uns hervorruft – von Menschen, die, obwohl ihr äußeres Leben dem unsern gleicht, doch im Innern ein unähnliches, unergründliches und unenträtselbares Leben führen!
»Willst Du, daß ich von Liebe singe?« sagte sie, diese Augen auf Glaukus richtend.
»Ja!« antwortete er und blickte zu Boden.
Sie entfernte sich ein wenig aus dem sie noch immer umfassenden Arme Ione's, als ob diese sanfte Umarmung ihr hinderlich wäre, setzte ihr leichtes und anmutiges Instrument auf ihr Knie und sang nach einem kurzen Vorspiel folgendes Lied:
Der Wind und der Lichtstrahl liebten die Rose,Die Rose, sie liebte das Licht;Wen fesselt der Wind, der haltungslose?Wer liebt die Sonne nicht?
Wer weiß es, wohin der Wind sich stehle,Der Wolken willenlos Spiel?Wer träumt sich in sein Geächz' eine Seele,Sein Murren ein zartes Gefühl?
O glückliches Licht, wie leicht kannst du malenDas Feuer, von welchem du glühst,Das Bild deiner Liebe, es liegt in den Strahlen,Womit du den Liebling begrüß'st!
Doch wie kann der Wind seine Liebe bezeugen,Vor dessen Gestöhn man erschrickt?Laß zu der Geliebten ihn nieder sich beugen:Sieh, seine Umarmung erstickt.
»Das ist ein trauriges Lied, süßes Mädchen,« sagte Glaukus, »Deine Jugend fühlt bis jetzt bloß den dunkeln Schatten der Liebe; eine ganz andere Begeisterung aber erweckt sie, wenn sie selbst hervorbricht und auf uns leuchtet.«
»Ich singe, wie ich gelehrt wurde,« antwortete Nydia seufzend.
»Dein Lehrer war also unglücklich in der Liebe – versuch' doch ein heitereres Lied. Doch nein, Mädchen, gib mir das Instrument.« Während Nydia gehorchte, streifte ihre Hand die seinige und bei dieser leichten Berührung hob sich ihre Brust, rötete sich ihre Wange. Ione und Glaukus bemerkten, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, diese Zeichen sonderbarer und frühreifer Regungen nicht, die ein Herz verzehrten, das, durch die Einbildungskraft genährt, der Hoffnung entsagte.
Und jetzt dehnte sich breit, blau und hell vor ihnen, das halcyonische Meer aus, schön wie ich es in diesem Augenblicke, siebzehn Jahrhunderte später, dieselben göttlichen Küsten bespülen sehe. Himmel, der noch jetzt durch einen sanften Zauber wie zur Zeit der Circe, verweichlicht – der uns unbewußt und geheimnisvoll zur Harmonie mit sich selbst umgestaltet, jeden Gedanken an härtere Arbeit, die Stimme des wilden Ehrgeizes, den Kampf und Lärm des Lebens verbannt – der uns mit anmutigen und überwältigenden Träumen erfüllt und unserer Natur das zum Bedürfnisse macht, was am wenigsten irdisch an ihr ist, so daß die Luft selbst uns die Sehnsucht und den Durst nach Liebe einhaucht. Jeder, der dich besucht, scheint die Erde und ihre bittern Sorgen hinter sich zu lassen – durch das elfenbeinerne Tor in das Land der Träume zu treten! Die jungen und lockenden Horen der Gegenwart – die Horen, jene Kinder des Saturn, welche dieser immer zu verschlingen trachtet, scheinen hier vor ihm gesichert zu sein. Die Vergangenheit wie die Zukunft sind vergessen, wir genießen bloß den Augenblick. Blumen im Garten der Welt, Quelle des Entzückens, Italien von Italien, schönes, mildes Kampanien! – übermütig fürwahr waren die Titanen, wenn sie an dieser Stelle noch um einen andern Himmel kämpften! Wer sehnte sich nicht, wenn Gott dieses Werktagsleben zu einem beständigen Festtag bestimmt hätte, wer sehnte sich alsdann nicht, hier für immer zu leben – nichts wünschend, nichts hoffend, nichts fürchtend, so lange dein Himmel über ihm schwebt, so lange deine Meere zu seinen Füßen funkeln, so lange dein Luft ihm süße Botschaften von Veilchen und Orangen bringt, und so lange das Herz, mit einer einzigen Empfindung sich begnügend, die Lippen und Augen finden kann, die ihm (Eitelkeit der Eitelkeiten!) mit der Versicherung schmeicheln, die Liebe könne der Abnützung trotzen und ewig sein?
Unter diesem Himmel also und auf diesen Meeren, schaute der Athener in ein Antlitz, das der Nymphe, des Schutzgeistes des Ortes, würdig gewesen wäre. An den wechselnden Rosen dieser zarten Wangen seine Augen weidend, fühlte er sich glücklich über das Maaß des gewöhnlichen Lebensglückes, denn er liebte und wußte, daß er geliebt wurde.
Die Beschreibung menschlicher Leidenschaften aus früheren Zeiten gewinnt gerade durch die Entfernung der Zeiten ein besonderes Interesse. Wir freuen uns, das Band, das die entferntesten Zeiten verknüpft, in uns zu fühlen. Menschen, Völker, Gebräuche vergehen. Die Neigungen sind unsterblich! – Sie sind der sympathische Reif, der alle Generationen umschlingt. Die Vergangenheit lebt wieder auf, wenn wir ihre Gefühle betrachten – sie lebt ins uns selbst! Was war, ist immer. Der Talisman, der die Toten belebt, den Staub vergessener Gräber neu beseelt, liegt nicht in der Geschicklichkeit des Schriftstellers, sondern im Herzen des Lesers.
Noch immer vergebens die Blicke Ione's suchend, welche halb niedergeschlagen, halb abgewendet die seinigen mieden, drückte der Athener die Gefühle, welche durch beseligendere Gedanken hervorgerufen werden, als diejenigen waren, welche dem Gesange der Nydia die Färbung gegeben, mit sanfter und leiser Stimme folgendermaßen aus:
Die Barke schwebt auf dem glühenden Meer,Mein Herz auf den Wogen der Liebe daher;Im Raume verloren, erschrickt es doch nicht,Denn klar wie dein Aug ist der Fluten Gesicht.Bald schwellend, bald hohl ist's über den Tiefen,Dein Lächeln, dein Seufzen bestimmt sein Geschick;Das Zwillingsgestirn, das die Schiffer sonst riefen,Der Leitstern, der Gott für das Herz – ist dein Blick.
Die Barke mag sinken, wenn Wolken erstehn,Was soll sie auch, kann sie den Leitstern nicht sehn?Dein Lächeln, dein Licht ist ihr Leben und Lust,Dein Zürnen, dein Dunkeln des Daseins Verlust.O sänk' sie, so lang sie kann Liebe noch lesen,Im Auge, das frei vom Gewölke noch ist!Ich möcht' nicht beweinen, was du mir gewesen,Möcht streben, so lang ich noch weiß, was du bist.
Als die letzten Worte dieses Liedes über die See hinzitterten, erhob Ione die Augen und begegnete denen ihres Geliebten. Glückliche Nydia! – glücklich in deinem Leben, daß du diesen bezaubernden und entzückenden Blick nicht sehen konntest, der so viel sagte, der das Auge zur Stimme der Seele machte, der die Unmöglichkeit eines Wechsels gelobte.
Obgleich übrigens die Thessalierin diesen Blick nicht bemerken konnte, so erriet sie doch dessen Bedeutung an dem Schweigen der beiden Liebenden, an ihren Seufzern. Sie drückte ihre Hände fast kreuzweise gegen die Brust, als ob sie die bittern und eifersüchtigen Regungen derselben niederdrücken wollte, und beeilte sich sodann, zu sprechen – denn dieses Stillschweigen war ihr unerträglich.
»Im Grunde genommen, o Glaukus,« sprach sie, »liegt nichts besonders Heiteres in Deinem Liede.«
»Und doch wollte ich etwas Heiteres geben, als ich Deine Leier nahm. Hübsches Kind, vielleicht gestattet uns das Glück nicht, fröhlich zu sein.«
»Wie sonderbar,« begann Ione, ein Gespräch ändernd, das sie zugleich beengte und entzückte, »daß seit mehren Tagen jene Wolke bewegungslos über dem Vesuv hängt, oder eigentlich nicht ganz bewegungslos, denn bisweilen wechselt sie ihre Form, und gerade jetzt erscheint sie mir wie ein gewaltiger Riese, der einen Arm über die Stadt ausstreckt; kommt sie Dir auch so vor, oder ist dieses Bild nur das Kind meiner Einbildungskraft?«
»Schöne Ione! Auch ich finde diese Ähnlichkeit, und sie ist wirklich erstaunlich scharf ausgeprägt. Der Riese scheint auf der Spitze des Berges zu sitzen, die verschiedenen Schatten der Wolke stellen ein weißes und flatterndes Kleid um seine gewaltige Brust und seine Glieder vor; mit festem Blicke scheint er auf die Stadt hinabzuschauen, mit einer Hand, wie Du sagtest, auf ihre schimmernden Straßen hinzudeuten, die andere aber – bemerkst Du es nicht? – gegen den Himmel zu erheben. Man möchte sagen, es sei der Geist eines riesenhaften Titanen, der über die schöne Welt brütet, die er verloren; trauernd um die Vergangenheit, zugleich aber auch eine gewisse Drohung für die Zukunft aussprechend.«
»Sollte dieser Berg in einigem Zusammenhang zu dem Erdbeben der vorigen Nacht stehen? Man sagt, vor vielen Jahrhunderten, fast in der frühesten Epoche, deren Andenken uns überliefert wurde, habe er Feuer ausgeworfen, wie noch jetzt der Ätna. Vielleicht lauern und glühen die Flammen immer noch in seiner Tiefe.«
»Das ist möglich!« entgegnete Glaukus nachdenklich.
»Du sagtest, Du glaubest nicht sehr an Magie?« fiel Nydia plötzlich ein. »Ich habe gehört, eine mächtige Hexe wohne inmitten der ausgebrannten Höhlen des Berges, und jene Wolke ist vielleicht der dunkle Schatten des bösen Geistes, mit dem sie verkehrt.«
»Du hast den Kopf voll von phantastischen Ideen Deines Heimatlandes Thessalien,« antwortete Glaukus, »und zeigst eine sonderbare Mischung von Verstand und all dem widerstrebenden Aberglauben.«
»Im Dunkeln sind wir immer abergläubisch,« entgegnete Nydia. »Sage mir,« fügte sie nach einer kleinen Pause hinzu, »sage mir, Glaukus, gleichen Alle, die schön sind, einander? Man sagt, Du seiest schön und Ione ebenfalls. Sind Eure Gesichter also dieselben? Ich glaube nicht, obgleich ich es vielleicht sollte.«
»Füge Ionen kein so schweres Unrecht zu,« antwortete Glaukus lachend, »denn ach, wir gleichen einander nicht einmal in der Weise, in welcher sich der Häßliche und der Schöne bisweilen gleichen. Ione's Haar ist dunkel, das meinige hell; Ione's Augen sind – von welcher Farbe, Ione? Ich kann sie so nicht sehen, wende sie mir zu. Oh, sind sie schwarz? Nein, sie sind zu sanft. Sind sie blau? Nein, sie sind zu tief; sie wechseln mit jedem Strahl der Sonne – ich weiß ihre Farbe nicht – aber die meinigen, süße Nydia, sind grau und glänzen nur, wenn Ione auf sie scheint! Ione's Wange ist ...«
»Ich verstehe auch nicht ein Wort von Deiner Beschreibung,« fiel Nydia verdrießlich ein, »ich begreife bloß, daß Ihr einander nicht gleicht, und bin erfreut darüber.«
»Wie so, Nydia?« sagte Ione.
Nydia errötete leicht; »weil ich,« antwortete sie kalt, »mir Euch immer unter verschiedenen Formen gedacht habe, und man sich freut, zu erfahren, daß man Recht habe.«
»Und welchem Gegenstand dachtest Du, daß Glaukus gleiche?« fragte Ione sanft.
»Der Musik,« antwortete Nydia, die Augen niedersenkend.
»Du hast Recht,« dachte Ione.
»Und welche Ähnlichkeit hast Du Ione zugeschrieben?«
»Ich kann es noch nicht sagen,« antwortete das blinde Mädchen; »ich kenne sie noch nicht lange genug, um Gestalt und Zeichen für meine Mutmaßungen aufzufinden.«
»Dann will ich es Dir sagen,« sprach Glaukus leidenschaftlich; »sie ist die Sonne, die erwärmt, wir die Woge, die erfrischt.«
»Die Sonne verbrennt und die Woge ertränkt bisweilen,« antwortete Nydia.
»So nimm die Rose,« sprach Glaukus, »möge ihr Duft Dir ein Bild von Ione geben.«
»Ach, die Rosen verwelken,« rief die Neapolitanerin boshaft.
Unter solchem Gespräche verbrachten sie die Stunden – die Liebenden nur des Glanzes und des Lächelns der Liebe bewußt, das blinde Mädchen aber nur ihre Dunkelheit und ihre Qualen, die Wut der Leidenschaft und ihre Wehen fühlend.
Während sie so von den Wellen hingetrieben wurden, ergriff Glaukus von Neuem die Laute und ließ ihre Saiten mit leichter Hand von einem so ungekünstelten und heiter schönen Liede ertönen, daß selbst Nydia aus ihren Träumen aufgeweckt wurde und einen Schrei der Bewunderung ausstieß.
»Du siehst, mein Kind,« rief Glaukus, »daß ich den Charakter der Liebesmusik noch retten kann, und daß ich Unrecht hatte, als ich sagte, das Glück könne nicht heiter sein. Höre Nydia! höre, teure Ione! höret
Die Geburt der Liebe.F37
1.
Ein Stern aus des Gewölkes Siebe,Ein Traumbild aus der Nächte Lauf,So stieg die fleischgewordene LiebeAus der entzückten Tiefe auf.Und neudurchglühte Strahlen badenSich an den cyprischen Gestaden;Und durch die grünen Wipfel zittertEin neues Leben luftumwittert,Ein Leben, das mit GlutverlangenSogleich die ganze Welt umfangen.Heil dir, Heil!Ihr huldigten des Meeres Tiefen,Die Reife ihr am Sternenzelt,In ihrem hohen Schweigen riefenSie: Heil der Königin der Welt!Heil dir, Heil!Der Zephyr schwamm auf SilberlockenAn sie heran mit Liebeslust,F38Und koste mit den goldnen LockenUnd koste mit der Schwanenbrust.Und auf des Ufer's weichem SandDrehn sich die Horen Hand in Hand,Sie zu empfangen auf der Erden,Die ihr soll unterwürfig werden.
2.
Sieh, wie sie in der Muschel ruht,Die Königsperle in der Flut!Und dieser Muschel RosenschimmerSich auf dem Schnee des Nackens gießt,Und mit verschämten GlutgeflimmerDie zarten Glieder überfließt.Indem sie leise durch die TänzeDer Silberwogen ringt,Der Tochter seine FreudenkränzeDas Licht entgegenschlingt.Heil, Heil!Dein sind wir Alle für und für,Kein Ländchen auf dem Land ist hier,Kein Tropfen in den Meeren,Kein Seufzer in des Himmels Plan,Und keine Perle in dem Tau,Die dein nicht ewig wären.
3.
Und du, Geliebte, die ich meine,Mir ist, als müßt ich aus dem Scheine,Dem tiefen, deiner blauen Augen,Die Göttin in das Herz mir saugen.Die Lieder sind die Muschelschaale,Worin die junge Liebe glüht;Sieh, wie sie mir mit EinemmaleAus dem Gehäus entgegensprüht!Heil, Heil, Heil!Sie steigt, wie sie der See entstiegen,Ins Herz hinab aus deinen Zügen,Ins Herz hinab, ins Herz hinab.Sie steigt wie sie der See entstiegenIns Herz hinab aus deinen Zügen,Ins Herz hinab, ins Herz hinab.
Eingegeben durch ein von Pompeji hinweggenommenes und nunmehr im Museum zu Neapel sich befindendes Gemälde der Venus, wie sie aus dem Meere aufsteigt.
Nach der Mythologie der Alten entstieg Venus dem Meere in der Nähe von Cypern, wohin sie sodann von den Zephyren geweht wurde. Hier warteten die Jahreszeiten ihrer, um sie zu bewillkommnen.
Drittes Kapitel.
Die Christenversammlung.
Gefolgt von Apäcides, erreichte der Nazarener das Ufer des Sarnus. Dieser Fluß, der heutzutage zu einem Bächlein eingeschrumpft ist, stürzte sich damals munter in das Meer, bedeckt mit zahllosen Fahrzeugen und aus seinen Wogen die Gärten, die Weinberge, die Paläste und die Tempel von Pompeji zurückwerfend. Von seinen geräuschvolleren und besuchteren Gestaden wandte Olinth seine Schritte einem Pfade zu, der in geringerer Entfernung vom Flusse unter dem Schatten von Bäumen sich hinabschlängelte. Dieser Weg war des Abends ein Lieblingsplätzchen der Pompejaner, während der Hitze und Lasten des Tages aber selten besucht, außer etwa von einigen Gruppen spielender Kinder, einem nachdenkenden Poeten oder einigen streitsüchtigen Philosophen. Auf der vom Ufer entferntesten Seite tauchten unter dem zarteren und schwindenden Laubwerk mehre Buchsbäume auf, und diese waren in tausend wunderliche Gestalten geschnitten, indem sie bald Faunen und Satyre, bald die Nachahmung ägyptischer Pyramiden, bisweilen auch die Buchstaben darstellten, welche den Namen eines beim Volke beliebten oder hochgestellten Bürgers bildeten. So ist der falsche Geschmack ebenso alt als der reine, und die Kaufleute, welche sich vor hundert Jahren nach Hackney und Paddington zurückzogen, ahnten vielleicht nicht, daß sie zu ihren verstümmelten Eibenbäumen und ihrem ausgeschnittenen Buchs in der versteinerten Periode des römischen Altertums, in den Gärten Pompeji's und den Villen des so schwer zu befriedigenden Plinius ihre Vorbilder finden konnten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: