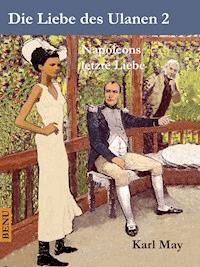
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Die Liebe des Ulanen«, ein packender Fortsetzungsroman über den deutsch-französischen Krieg 1870/71, erschien in 107 Lieferungen von September 1883 bis Oktober 1885 in der Zeitschrift »Deutscher Wanderer«. Der Jahrgang umfasste insgesamt 108 Lieferungen; in der Nummer 87 gab es keinen May-Text. Die vorliegende Textfassung folgt in 5 Bänden unverändert und ungekürzt der Erstausgabe des Münchmeyer-Verlags und entspricht damit vollständig der Originalfassung von Karl May. Der besseren Übersichtlichkeit wegen wurden zusätzliche Kapiteleinteilungen eingefügt. Der Ulanenrittmeister Richard von Königsau reist im Jahre 1870 inkognito und als buckliger Erzieher verkleidet nach Ortry in Lothringen, um im Schlosse des Gardekapitäns Albin Richemonte tragische Familiengeheimnisse aufzuklären und französischen Kriegsvorbereitungen gegen Deutschland auf die Spur zu kommen. Auf dem Weg nach Ortry rettet er Marion, Richemontes schöner Enkelin, das Leben und entdeckt seine Liebe zu ihr. In dem geheimnisvollen Schloss Ortry, einem Gebäude mit Tapetentüren, geheimen Gängen und unterirdischen Verliesen bekämpft Köngsau die Machenschaften des finsteren Richemonte und gelangt schließlich auf die Spur eines Jahrzehnte zurückliegenden Verbrechens, durch das seinen Vorfahren ein furchtbares Schicksal zugefügt worden ist. Mutig und entschlossen nimmt Königsau den Kampf mit den Mächten des Bösen auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. Kapitel13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. KapitelImpressum1. Kapitel
Zu Anfang des Ereignisreichen Monats Juni des Jahres 1815 befand sich das große Hauptquartier der Franzosen zu Laon, während das Hauptquartier der Moselarmee zu Thionville lag.
In dem Ersteren war bereits Baron Daure, der Generalintendant der Armee, vor einigen Tagen angekommen, und nun erwartete man täglich, dort auch den Kaiser zu sehen. Zugleich wurde von Napoleon gesagt, dass er nach Straßburg gehen werde, um sich dort zu zeigen und die gesunkene Begeisterung für sich wieder zu entflammen. Auch in Thionville wurde er erwartet.
Man kannte den großen Mann genau. Er liebte es, möglichst allgegenwärtig zu scheinen und sich grad da sehen zu lassen, wo er am wenigsten erwartet wurde. Überhaupt zeigte die damals von ihm eingeschlagene Route, auf welcher er sich nach dem voraussichtlichen Schauplatze der zu erwartenden Kämpfe begab, noch heutigen Tages einige unausgefüllte Lücken. Er hat nach seiner ihm gewohnten Weise mehrere blitzschnelle Abstecher gemacht, deren Absicht selbst den Personen seiner nächsten Begleitung ein Rätsel blieb.
Die Eigenheiten eines Herrschers pflegen Nachahmung zu finden. Einige Marschälle des Kaisers hatten sich ein ähnliches Verfahren, ihre Untergebenen zu überraschen, angewöhnt. Besonders wusste man von Marschall Grouchy, dass er es liebte, überall selbst zu sehen und zu hören, und es war allgemein bekannt, dass er viele seiner zahlreichen Siege und Erfolge meist dieser Angewohnheit zu verdanken habe. –
Es war um Mittag des Tages, mit welchem das letzte Capitel geschlossen hat, als jener Verkleidete, welcher Niemand Anders war, als Leutnant von Königsau, in Sedan anlangte. Er hätte die Stadt lieber umgangen, aber damals war die Sedaner Brücke die einzige, welche in jener Gegend über die Maas führte. Der Fluss war sonst ohne Gefahr nicht zu passieren, da er in Folge mehrtägigen Regens eine ungewöhnliche und aufgeregte Wassermenge mit sich führte.
Sedan, der Geburtsort des berühmten Turenne, ist zu jeder Zeit ein in kriegerischer Beziehung wichtiger Platz gewesen. Darum war es nicht zu verwundern, dass es auch jetzt nebst seiner ganzen Umgegend voller Truppen lag.
Diese Letzteren gehörten zu dem Heeresteile des Marschalls Ney, welcher, in Saarlouis als Sohn eines Böttchers geboren, es durch seine Talente zum Marschall von Frankreich, Herzog von Eßlingen und Fürst von der Moskwa gebracht hatte.
Unter ihm kommandierte General Drouet, welcher zum Alde-Major-General von Bonapartes Garden ernannt worden war. Dieser General, welchen der geneigte Leser bereits kennen gelernt hat, verzichtete darauf, in Sedan selbst zu wohnen, und hatte sein Standquartier hinaus nach Roncourt verlegt, jenem Orte, bei welchem der Meierhof Jeanette lag. Diesen Meierhof hatte Drouet für sich selbst in Beschlag genommen, während sein Stab in Roncourt lag.
Bei seinem Eintritte in Sedan wurde Königsau nach seiner Legitimation gefragt. Er zeigte dieselbe vor, welche er gestern Abend dem Wirte übergeben und heut Morgen vor seinem Scheiden natürlich wieder zurückerhalten hatte.
Diese Legitimation stammte zwar aus Blüchers Hauptquartier, war aber dennoch vollständig hinreichend. In Kriegszeiten jedoch pflegt man mit mehr Sorgfalt als gewöhnlich zu verfahren, und so hatte der Leutnant auf der Commandantur ein Verhör zu bestehen, welches ihn einigermaßen in Schweiß brachte. Er hatte gegen die Franzosen gekämpft und war längere Zeit in Paris gewesen. Wie leicht war es möglich, dass Jemand ihn hier erkannte. Dann wäre es allerdings um ihn geschehen gewesen.
Darum wurde ihm das Herz außerordentlich leicht, als er seine Legitimation zurückerhielt und mit ihr die Erlaubnis empfing, die Stadt zu passieren.
Roncourt liegt ungefähr zwei volle Wegstunden im Süden von Sedan. Damals waren die Wege zwischen diesen beiden Orten sehr mangelhaft. Der Argonner Wald, zu welchem jene Gegenden gehören, war im höchsten Grade verrufen, da sich dort allerlei Gesindel angesammelt hatte, welches sich in den tiefen Wäldern und Schluchten versteckt hielt, um nur dann hervorzubrechen, wenn es einen Raub oder sonst einen gesetzwidrigen Streich auszuführen gab.
Zwischen Roncourt und Sedan war der Weg jetzt allerdings sicher, da die militärische Verbindung, welche zwischen den beiden Hauptquartieren bestand, diesen Marodeurs und Vagabunden Achtung einflößte. Weiterhin, besonders nach Laon zu, wohin der Weg über Bethel führte, gab es zwar auch solche Verbindungen, aber die Wege waren doch militärisch nicht so frequentirt, dass eine vollständige Sicherheit geherrscht hätte.
Ein jeder Krieg erzeugt, wie jedes Gewitter, seinen Schmutz. Die Hefe der Bevölkerung, welche vielleicht bereits vorher mit dem Gesetze in Konflikt steht, wird von den Ereignissen in Bewegung gebracht und beginnt, im trüben Wasser die Angel auszuwerfen. Solche Hefe gab es damals in den Wäldern der Ardennen und Argonnen genug, so dass es keineswegs ohne Gefahr war, allein und unbewaffnet durch jene Gegenden zu wandern.
Als Königsau Roncourt erreichte, war es ihm leicht, den Weg nach dem Meierhofe zu erfragen. Dort angekommen, trat ihm Alles in einem kriegerischen Anstriche entgegen. An dem Tore stand ein Posten, welcher ihm, das Gewehr vorstreckend, den Eingang verwehrte.
»Wohin?«, fragte der Soldat.
»Herein«, antwortete Königsau kurz.
»Zum General?«
»Nein. Welcher General wohnt hier?«
»General Drouet. Zu wem wollen Sie sonst?«
»Zur Besitzerin des Hofes.«
»Zu Frau de Sainte-Marie?«
»Ja.«
»Die ist nicht da. Sie ist heut Morgen fortgefahren.«
»So wird Jemand da sein, der ihre Stelle vertritt.«
»Das ist der junge Herr. Kennen Sie ihn?«
»Ich habe ein Geschäft mit ihm abzuschließen.«
»Ah, das ist etwas Anderes! Sie können passieren. Herr de Sainte-Marie wohnt in dem Parterrelokale, dessen vier Fenster Sie dort rechts bemerken.«
Königsau bedankte sich für die Unterweisung, welche ihm zu Teil geworden war, und schritt nach der angegebenen Wohnung. Auf sein Klopfen hörte er ein lautes »Herein!« Als er eintrat, befand er sich, wie er auf den ersten Blick bemerkte, in dem Arbeitsraume eines unverheirateten Herrn. Es herrschte hier jene elegante, sorglose Unordnung, wie man sie oft bei den Junggesellen besserer Stände zu bemerken pflegt.
Während er die Tür hinter sich verschloss, erhob sich vom Sofa ein junger Mann, der ihn mit musterndem Blicke betrachtete. Die Züge desselben waren höchst angenehm, fast mehr weiblich als männlich. Er mochte höchstens zweiundzwanzig Jahre zählen, während die dünnen, seidenweichen Haare seines Schnurrbärtchens ihn noch jünger erscheinen ließen.
»Herr de Sainte-Marie?«, fragte Königsau.
»Ja«, antwortete der Angeredete, ihn mit forschenden Augen betrachtend. »Was wünschen Sie von mir?«
»Wollen Sie die Güte haben, mir zu sagen, ob Frau Richemonte zu sprechen ist?«
Über das Gesicht des Franzosen zuckte es wie eine Art von Überraschung; fast hätte man sagen mögen, dass sein Blick eine augenblickliche Besorgnis zeige.
»Ah, Frau Richemonte?«, fragte er. »Was wollen Sie von ihr?«
Er konnte diese etwas zudringliche Frage aussprechen, da Königsau ganz wie ein Mann gewöhnlichen Standes gekleidet war.
»Es sind persönliche Angelegenheiten der Dame, welche mich zu ihr führen«, antwortete Königsau. »Ich weiß leider nicht, ob sie mir erlauben würde, von denselben gegen eine dritte Person zu sprechen.«
»Ich will Sie zu keiner Indiskretion verleiten; aber Sie kennen die Dame?«
»Ja.«
»Woher?«
»Von Paris aus.«
Da verfinsterte sich das Gesicht des jungen Mannes plötzlich. Er fragte: »Sie sind Kapitän Richemonte?«
»Nein.«
»Ah! Also sonst ein Bekannter?«
»Ja.«
»Woher wissen Sie, dass Frau Richemonte sich hier befindet?«
»Ich habe sie selbst nach dem Meierhofe gebracht.«
»Wohl als Kutscher?«
»O nein«, lächelte Königsau, »als Begleiter.«
»Von Paris aus?«
»Ja.«
Da glitt ein eigentümlicher Zug über das Gesicht des jungen Mannes. Man konnte nicht sagen, ob es Schreck oder Freude sei, welches ihn zu der schnellen Frage bewegte: »Donnerwetter! So heißen Sie Königsau?«
»Ja.«
»Und Sie wagen sich – ah, kommen Sie, kommen Sie!«
Er fasste den Arm des Leutnants und zog den Letzteren rasch aus dem Zimmer fort zu einer Tür hinaus. Dort befand sich augenscheinlich der eigentliche Wohnraum. Hier betrachtete der Baron den Gast noch einmal vom Kopfe bis zu den Füßen herab und er sagte: »Mein Gott, wie können Sie es wagen, nach Roncourt zu kommen?«
»Halten Sie das wirklich für ein Wagnis, Baron?«
»Gewiss! Sie sind Deutscher, und noch dazu Offizier. Haben Sie nicht gewusst, dass General Drouet sich auf unserer Meierei befindet?«
»Ich erfuhr es erst in Sedan.«
»Und dennoch wagten Sie sich hierher? Wie nun, wenn man Sie festnimmt?«
»Das befürchte ich nicht«, lächelte Königsau.
»Und Sie als Spion behandelt?«
»Ich komme nur, um Frau und Mademoiselle Richemonte zu sprechen.«
Der Baron blickte wie ratlos im Zimmer umher und sagte dann, auf einen Stuhl deutend: »Setzen Sie sich, Herr Leutnant. Es gilt, dass wir uns klar werden. Sie sind ein Freund der Madame Richemonte?«
»Ein sehr aufrichtiger und ergebener«, antwortete Königsau, indem er sich niedersetzte.
»Als die Damen hier angekommen sind, war ich nicht anwesend, ich befand mich zu der Zeit in der Gegend von Rheims, um die Kellereien eines Freundes zu besichtigen. Sie müssen wissen, dass ich Landwirt und besonders Weinzüchter bin. Als ich nach Hause kam, fand ich die Damen vor. Ich hörte, dass ein Deutscher sie nach hier begleitet habe, ein Leutnant Namens Königsau.«
»Dieser bin ich.«
»Wie ich höre. Madame Richemonte sagte, dass sie Ursache habe, für nächste Zeit ihren Aufenthalt bei uns nicht wissen zu lassen; nur Sie allein seien ausgenommen. Sie scheinen also das Vertrauen dieser Dame zu besitzen –?«
»Ich hoffe es!«
»Sie haben ihr jedenfalls wichtige Dienste geleistet?«
»Es ist mir allerdings vergönnt gewesen, den Damen einigermaßen nützlich zu sein, doch bin ich weit davon entfernt, mir dies als Verdienst anzurechnen.«
Jetzt begannen die Züge des Barons sich wieder zu erheitern.
»Dann bin auch ich Ihnen Dank schuldig«, sagte er. »Sie wissen wohl, dass Frau Richemonte meine Verwandte ist?«
»Die Dame sprach davon, wenn auch nicht eingehender.«
»Meine Mutter ist ebenso, wie Madame Richemonte, eine Deutsche. Beide stammen aus demselben Orte und sind so das, was man Cousinen nennt. Mein Vater ist tot, und so habe ich« – fügte er mit einem heiteren, sorglosen Lächeln hinzu – »die ganze Last der Verwaltung unseres Besitztums auf meinen armen Schultern liegen. Es war sehr einsam hier; die Ankunft der beiden Damen hat Leben und Bewegung herbeigebracht, was ich ihnen herzlich danke. Leider ist diese Bewegung und dieses Leben bedeutend potenzirt worden durch die Ankunft des Militärs, welche Alles aus Rand und Band gebracht haben.«
»Ich kondoliere!«, sagte Königsau höflich.
»Danke! Als Sohn einer Deutschen bin ich nicht so raffiniert französisch gesinnt, dass es mir lieb sein kann, mich zum Diener einer anspruchsvollen Soldateska herabwürdigen zu lassen. Und nun zumal um Ihretwillen wünsche ich diese Herren alle zum Teufel.«
»Ich bitte, auf mich nicht die mindeste Rücksicht zu nehmen, Baron.«
»Wenn das so leicht wäre! Darf ich Sie fortweisen?«
»Ich hoffe es nicht!«, lachte Königsau.
»Aber darf ich einen deutschen Offizier bei mir aufnehmen?«
»Unter den gegenwärtigen Umständen, ja. Ich komme ja nicht als Offizier. Ich bin im Besitze einer Legitimation, welche man in Sedan respektiert hat.«
»Das ist etwas Anderes! Aber leider finden Sie Frau Richemonte nicht vor.«
»Wo ist sie?«
»Sie und Mademoiselle sind heute Morgen mit Mama nach Vouziers gefahren.«
»Nach Vouziers? Wann kehren sie zurück?«
»Heut Abend wahrscheinlich.«
Da machte Königsau eine Bewegung des Schreckes. »Heut Abend?«, fragte er. »Nicht morgen am Tage? Es sind von Vouziers bis hierher volle sechs Stunden zu fahren.«
»Allerdings. Aber bei den Lasten, welche die Einquartierung uns bereitet, kann ich die Mutter unmöglich länger entbehren.«
»Das glaube ich gern. Aber bedenken Sie doch die Unsicherheit des Weges!«
Da trat der Baron einen Schritt zurück, machte ein sehr verblüfftes Gesicht, schlug die eine Hand in die andere und rief: »Mein Gott, ja! Daran haben wir gar nicht gedacht! Mama nicht und ich nicht!«
»Der Weg führt durch Wälder, in denen allerlei Gesindel hausen soll, wie ich gehört habe«, bemerkte Königsau.
»Das ist richtig. Alle Teufel, was ist da zu tun?«
Der Baron schien eine vorzugsweise heitere, sorglose Natur zu sein. Jetzt aber sah man es ihm an, dass er keineswegs gleichgültig blieb.
»Welchen Weg schlagen die Damen ein?«, fragte Königsau. »Sie sind über La Chêne und Boule aux Bois gefahren.«
»Und sie kehren auf demselben Wege zurück?«
»Ganz sicher! Ich befinde mich da in großer Angst. Mein Gott, wenn ihnen Etwas wiederfährt! Wenn sie angefallen werden! Ich würde ihnen entgegenreiten, aber ich kann unmöglich fort, da dieser verteufelte General Drouet in jeder Minute einen Wunsch, ein Verlangen, einen Befehl zu erfüllen hat!«
»So lassen Sie mir ein Pferd satteln.«
»Ihnen?«, fragte der Baron, halb erstaunt und halb erleichtert.
»Ja, mir, wenn ich bitten darf.«
»Aber wissen Sie, in welche Gefahr Sie sich begeben?«
»Pah! Wegen dem Gesindel?«
»Ja. Und weil Sie ein Deutscher sind.«
»Diese Gefahr gibt es nicht für mich. Hier, lesen Sie meine Legitimation. Vielleicht wird es auch für Sie nötig, den Namen zu kennen, welchen ich gegenwärtig trage.«
Der Baron las das Document, gab es ihm zurück und sagte: »Ein Pferd können Sie haben; aber sind Sie auch bewaffnet?«
»Ich habe Pistolen und ein Messer.«
»Das ist nicht genug. Ich werde Ihnen noch zwei Doppelpistolen geben. Aber, kennen Sie den Weg, den Sie zu reiten haben?«
»Monsieur, ich bin deutscher Offizier!« Der Baron nickte und sagte: »Es ist wahr, mein Herr; die Deutschen haben bewiesen, dass ihre Karten von Frankreich besser und genauer sind, als die unserigen. Aber wollen Sie nicht vielleicht vorher Etwas genießen?«
»Ich danke! Das würde meine Zeit verkürzen, die ich notwendiger brauche.«
»So werde ich Ihnen einen Imbiss in die Satteltaschen tun lassen, während gesattelt wird. Man kann nicht wissen, was geschieht. Entschuldigen Sie mich!«
Er entfernte sich, um seine Befehle zu erteilen.
So befand sich Königsau also in der Höhle des Löwen. Er war abgeschickt worden, um so viel wie möglich über die Pläne des Feindes zu erkundschaften. Er hatte sich dazu selbst angeboten. Er wusste, wie gefährlich dieses Unternehmen war, denn man hätte ihn, wenn er entdeckt wurde, ganz einfach den schimpflichen Tod eines Spions sterben lassen: man hätte ihn aufgehenkt. Aber diese Gefahr wurde mehr als reichlich durch den Umstand aufgewogen, dass es ihm dabei möglich war, die Geliebte zu sehen und zu sprechen. Und ein großer Erfolg war ihm bereits geworden; er hatte den Platz entdeckt, an welchem die Kriegskasse verborgen lag.
Während er so allein im Zimmer saß, dachte er an den Baron. Dieser war jedenfalls ein leichtlebiger, gutherziger Kavalier. Wusste er, dass Margot die Verlobte Königsaus war? Jedenfalls nicht, wie sich aus seinen Reden vermuten ließ. Übrigens hatte Frau Richemonte bei ihrer Ankunft auf dem Meierhofe es unterlassen, den Leutnant als ihren künftigen Schwiegersohn vorzustellen. Sie hatte ihn einfach als ihren Freund bezeichnet. Königsau kannte den Grund, welcher sie dazu bestimmt hatte, nicht, aber er sagte sich, dass die vergangenen Ereignisse wohl Ursache geboten hätten, selbst gegen Verwandte vorsichtig zu sein.
Nach einiger Zeit kehrte der Baron zurück und meldete, dass gesattelt sei. Er öffnete ein Kästchen und zog zwei Doppelpistolen hervor, welche er Königsau überreichte.
»Sind sie geladen?«, fragte dieser.
»Nein. ich hin ein Mann des Friedens und habe nur selten geschossen. Diese Waffen aber sollen vorzüglich sein; sie sind ein Erbteil meines Vaters, welcher Offizier war. Aber Munition ist da.«
»So erbitte ich mir das Nötige.«
Der Baron brachte Kugeln, Pulver und Zündhütchen herbei. Königsau lud die Pistolen und fragte dabei: »Woran kann man das Geschirr erkennen, in welchem die Damen kommen?«
»Es ist eine ziemlich alte Staatskarosse aus der Zeit Ludwigs des Fünfzehnten.«
»Und die Pferde?«
»Ein Schimmel und ein Brauner.«
»Ist außer dem Kutscher noch Personal dabei?«
»Leider nein, obgleich ein Hintersitz für den Diener vorhanden war.«
»Ich danke, Monsieur! Ich werde mich sofort auf den Weg machen.«
»Werden Sie mit zurückkehren?«
»Ich werde die Damen bis zum Meierhof begleiten und dann sehen, ob die Frau Baronin mich veranlasst, mit einzutreten.«
»Gut. Auf alle Fälle aber empfehle ich Ihnen Vorsicht an.«
»Ich werde sie nicht außer Acht lassen.«
Die beiden Männer begaben sich in den Hof hinaus, wo ein brauner Wallach auf den Reiter wartete. Königsau stieg auf. Er gab sich hier das Aussehen eines sehr mittelmäßigen Reiters und wurde, da der Herr des Hofes bei ihm war, von dem Posten ohne alle Schwierigkeit durchs Tor gelassen. Er hatte dabei ganz das Aussehen eines gewöhnlichen Arbeitsmannes, der es gewagt hat, einen Botenritt zu unternehmen, sich aber recht unbehaglich auf dem Gaule fühlt.
So ritt er eine Strecke langsam im Schlendergange fort, sobald aber Roncourt mit dem Meierhofe hinter ihm lag, gab er dem Pferde die Fersen und setzte es erst in Trab und dann sogar in Galopp.
Der Weg zog sich fast ununterbrochen durch den Wald und war höchst einsam. Rechter Hand lief ein Flüßchen in zahllosen Windungen dahin, und zur Linken war nichts zu sehen als ohne alle Abwechslung Baum an Baum.
Nur einmal gab es ein einsames Häuschen, für den müden Wanderer zur Einkehr errichtet. Königsau stieg hier ab, um eine kleine Erfrischung zu genießen und sich zu erkundigen.
Als er eintrat, sah er ein junges Mädchen am Spinnrade sitzen; sonst war Niemand vorhanden. Sie erhob sich und fragte freundlich nach seinem Begehr, doch war zu bemerken, dass sie ihn mit einem – beinahe möchte man sagen – mitleidig besorgten Blicke betrachtete.
»Kann ich ein Glas Wein haben?«, fragte er. Dabei bot er ihr zum Gruße die Hand, die sie auch nahm und leise berührte.
»Ja, gern«, antwortete sie.
Sie brachte das Verlangte, setzte es vor ihm hin und griff dann wieder zum Rade. Während dasselbe fleißig schnurrte, flog ihr Auge öfters verstohlen zu ihm hinüber. Er bemerkte dies wohl, aber er tat nicht, als ob er es sehe. Es lag in diesen Blicken des Mädchens Etwas, was ihn aufmerksam werden ließ.
»Wie weit hat man noch bis Le Chêne popouleux?«, fragte er endlich.
»Sie müssen eine gute Stunde reiten«, antwortete sie. »Wollen Sie dorthin?«
»Ja.«
»Wohl gar noch weiter?«
»Allerdings. Ich reite möglicher Weise bis nach Vouziers.«
»O wehe«, entfuhr es ihr.
»Warum o wehe?«, fragte er.
Sie errötete, senkte verlegen die Augen und antwortete stockend: »Weil – weil es bis dahin Nacht sein wird.«
»Schadet das Etwas?«
Jetzt hob sie den Blick empor und antwortete: »Die Nacht ist keines Menschen Freund. Und dieser Wald ist so lang, so sehr lang.«
Da ging er näher auf sein Ziel los, indem er sie fragte: »Man hat mir gesagt, dass es in diesem Walde nicht so recht geheuer sei. Ist dies wahr, Mademoiselle?«
Sie zögerte mit der Antwort, blickte ihn abermals forschend an und fragte dann, anstatt ihm Antwort zu geben: »Sie sind hier fremd, Monsieur?«
»Ja.«
»Aber Sie reiten doch ein hiesiges Pferd.«
»Kennen Sie es?«
»Ja. Es gehört nach dem Meierhofe Jeanette.«
»Das stimmt. Sind Sie dort bekannt?«
»O, sehr gut. Ich bin sogar das Patenkind der Frau Baronin. Mein Großvater war Diener des seligen gnädigen Herrn.«
»Ah, so kennen Sie auch die Karosse der gnädigen Baronin?«
»Gewiss. Sie ist heut früh hier vorüber gefahren.«
»Nun, mein Kind, ich will der Frau Baronin entgegenreiten.«
Da fuhr sie beinahe von dem Schemel empor, auf welchem sie saß.
»Der gnädigen Frau entgegenreiten?«, fragte sie, indem ihr schönes Gesichtchen eine plötzliche Angst verriet. »Ist das wahr?«
»Jawohl«, antwortete er.
»Mein Gott, so kehrt die Baronin erst des Nachts heim?«
»Wahrscheinlich.«
»Aber wer soll da ihren Wagen erkennen!«
Dieser Ausruf war jedenfalls sehr zweideutig. Königsau fragte daher: »Ist es denn notwendig, dass ihr Wagen erkannt wird?«
»Ja, freilich!«, antwortete sie schnell, aber unbesonnen. »Es darf ihr ja kein Leid geschehen!«
»Wer könnte ihr denn etwas tun?«
Diese Frage brachte sie zu der Erkenntnis, dass sie mehr gesagt habe, als sie jedenfalls beabsichtigt hatte. Über ihr hübsches, aufrichtiges Gesicht legte sich die Röte der Verlegenheit, und sie antwortete erst nach einer kleinen Pause: »O, Monsieur, Sie fragten mich vorhin, ob es wahr sei, dass es hier im Walde nicht so recht geheuer ist. Man hat Ihnen richtig berichtet. Es gibt im Walde böse Menschen, denen nicht zu trauen ist.«
»Und Sie kennen diese Menschen?«, fragte er, einen eindringlichen Blick auf sie richtend.
Ihre Wimpern lagen längere Zeit tief und fast über den Augen, ehe sie antwortete: »Monsieur, ich wohne ganz allein hier mit meiner Mutter. Es kommen sehr oft Leute, welche wir nicht kennen dürfen, sonst würde es uns schlimm ergehen.«
»Aber, liebes Kind, warum bleibt Ihr da hier wohnen?«
»O, wir wollten gern fort, aber es geht nicht. Als Vater dieses Haus kaufte, da lebte er noch, und da war es im Walde sicher und gut. Es kamen nur ehrliche Leute, und wir hatten unsere Freude an dem Heimwesen. Da aber kam der Krieg, und nun füllte sich das Land mit schlimmen Leuten, welche alle bei uns einkehrten. Vater wurde von Einem erschossen. Großvater wurde von der Baronin entlassen und starb auch bald. Da war ich mit Mutter allein. Wir dürfen Niemand verraten, sonst sind wir verloren.«
»So verkauft das Haus.«
»Wer kauft es uns ab, Monsieur?«
»So bittet die Baronin um Hilfe. Sie ist gut und wird Euch den Wunsch nicht abschlagen.«
»Sie hat ihn uns bereits abgeschlagen«, antwortete sie leise und langsam.
»Warum?«
Jetzt zog eine tiefe, tiefe Glut über ihr Gesicht, und sie antwortete stockend: »Weil – weil – o, sie ist sehr böse auf uns.«
»Warum denn, mein Kind? Vielleicht kann ich helfen.«
Da legte sie plötzlich die Hand vor die Augen und bog das Köpfchen nieder. Königsau sah eine Fülle herrlichen Haares sich auflösen und er sah Tränentropfen zwischen den kleinen, zarten Fingern hervorquellen – sie weinte.
Eine Zeit lang herrschte tiefe Stille im Zimmer; dann sagte er im mildesten Tone: »Ich habe Ihnen sehr wehe getan, mein gutes Kind. Nicht wahr?«
Da hob sie langsam den Kopf, sah ihn durch Tränen an und antwortete: »O nein, Monsieur. Ich höre vielmehr, dass Sie es gut mit mir meinen. Und darum will ich Ihnen Etwas sagen. Kennen Sie den Weg, den Sie zu reiten haben?«
»Im Einzelnen nicht.«
»Nun, er macht von hier aus einige Krümmungen. Ist Ihnen das kleine Liedchen bekannt: ›Ma chérie est la belle Madeleine?‹«
»Ja.«
»Nun gut. Wenn Sie an der fünften Krümmung von hier ankommen, so steht am Rande des Dickichts rechter Hand ein Kreuz. Dort ist einmal Einer ermordet worden. Sobald Sie dieses Kreuz sehen, singen Sie dieses Lied. Sie können doch singen, Monsieur?«
»Ein Wenig.«
»Wenn Sie nicht gern singen, so pfeifen Sie wenigstens die Melodie.«
»Warum?«
»O, das darf ich ja doch nicht sagen.«
»So werde ich es Ihnen sagen. Hinter dem Kreuze stecken Die verborgen, welche zuweilen zu Ihnen kommen. Sie lauern den Wanderern auf. Wer aber das Lied singt oder pfeift, dem tun sie nichts, weil er unter ihrem Schutze steht.«
»Mein Gott, ich verbiete Ihnen streng, das zu verraten.«
»Ihr Verbot kommt zu spät«, sagte er lächelnd.
»Monsieur, ich bitte Sie um Gottes Willen, nichts zu verraten!«
»Ich werde keinem Menschen Etwas sagen.«
»O, Einem doch!«
»Wem?«
»Dem Kutscher der gnädigen Frau müssen Sie sagen, dass er heut Abend das Lied pfeifen soll, sobald er an das Kreuz kommt. Der gnädigen Frau geschieht nichts; aber da bei Nacht ihr Wagen nicht genau zu erkennen ist, kann er sehr leicht verwechselt werden.«
»Ich werde das besorgen, liebes Kind. Aber haben Sie noch nicht daran gedacht, dass Sie sich zum Mitschuldigen dieser Verbrecher machen, wenn Sie ihr Tun und ihre Schlupfwinkel kennen, ohne sie anzuzeigen?«
»Ich weiß das, Monsieur. Aber sie würden mich und Mutter töten. Soll ich die Mörderin meiner eigenen Mutter werden?«
»Sie könnten ja fliehen, bis Alle vernichtet sind!«
»Vernichtet? O, es stehen immer wieder Neue und Andere auf. Dieser Fabier –« Sie hielt inne und errötete abermals vor Verlegenheit.
Der zuletzt genannte Name fiel Königsau auf.
Es war aus den Mienen des Mädchens sicher zu erkennen, dass der Name Fabier ihm verhasst sei, und Königsau hielt sich davon sofort überzeugt.
»Fahren Sie weiter fort, Mademoiselle!«
»O bitte, ich wollte nichts sagen, Monsieur.«
»Aber Sie nannten ja einen Namen!«
»Er entschlüpfte mir nur so.«
»Sagten Sie nicht Fabier?«
»Ja.«
»So ist Ihnen vielleicht auch der Name Barchand bekannt?«
Da hob sie schnell den Kopf empor und fragte: »Barchand? O, kennen Sie ihn?«
»Ich weiß es nicht genau. Waren diese Beiden vielleicht auch hier im Walde?«
»Ja.«
»Nun, sie werden nicht wiederkommen.«
»Warum?«, fragte sie überrascht, und zwar sichtlich in freudiger Weise.
»Sie sind tot.«
»Tot? Gestorben? Ist's möglich? Ist es wahr? Monsieur?«
»Ja, es ist wahr.«
»Wo? Wo sind sie gestorben?«
»Sie haben einander getötet. Ich selbst habe ihre Leichen gesehen, jenseits Sedan.«
»Wann?«
»Heute Morgen.«
Da erhob sie sich von ihrem Sessel, kam langsam auf ihn zu, legte ihm das kleine Händchen auf den Arm und sagte: »Ist dies wahr, wirklich wahr, Monsieur?«
»Gewiss!«
»Sie können es beschwören?«
»Mit allen Eiden der Welt.«
»O, dann sei Gott tausendmal Lob und Dank! Wissen Sie, Barchand war einer der Anführer dieser bösen Leute, welche mich und Mutter so belästigen. Und Fabier war mein Dämon, mein böser Geist.«
»Ah, er liebte Sie?«
»Er sagte es. Noch gestern früh war er hier und sagte, dass er heute als ein sehr reicher Mann zurückkehren werde. Dann solle ich seine Frau werden oder sterben.«
»So hat er die Tochter Barchands betrogen!«
»Hat er das? Hat er ihr gesagt, dass er sie liebe?«
»Ja, um ihren Vater zu gewinnen.«
»Und woher wissen Sie das Alles?«
»Ich habe sie vor ihrem Tode belauscht. Ich will Ihnen nun aufrichtig sagen, dass Fabier Barchand getötet hat, aber zur Strafe und um meiner eigenen Sicherheit willen habe ich ihn dann selbst erschossen.«
»Sie? Ihn?«, fragte sie, als könne sie es nur schwer glauben und begreifen.
»Ja, mit dieser meiner Hand. Ich habe auch Beide eingescharrt.«
»Jenseits Sedan?«
»Jenseits Sedan!«, nickte er.
»Und sie kommen also nicht wieder?«
»Niemals!«
Da holte sie tief Atem und faltete die Hände.
»Monsieur«, sagte sie, »bereuen Sie Ihre Tat nicht! Sie haben ein gottgefälliges Werk vollbracht. Sie sind mein Retter und der Retter vieler Andern geworden. Dieser Fabier hätte mich noch in den Tod getrieben; denn ich verabscheute ihn.«
»Ja, Sie lieben ja einen Andern.«
»Einen Andern?«, fragte sie errötend.
»Gewiss! Sie selbst haben es mir ja gesagt und gestanden.«
»Ich? Unmöglich!«, antwortete sie.
»O, nicht Ihre Worte, sondern Ihr Erröten, Ihre Verlegenheit haben es mir verraten.«
Sie wollte sich abwenden, er aber hielt sie bei den Händchen fest und fragte: »Darf ich es sagen, wen Sie lieben, Mademoiselle?«
»Sie wissen es nicht! Sie können es nicht wissen!«, widerstrebte sie.
»Und doch weiß ich es. Der junge Baron ist es, dem Ihr Herz gehört.«
»Monsieur«, rief sie erbleichend.
»Darum wurde Ihr Großvater entlassen.«
»Sie irren.«
»Und darum wurde die Frau Baronin so bös auf Sie, mein Kind.«
»Sie sind sehr grausam, Monsieur!«
»O nein. Ich möchte Ihr Freund sein und Ihnen helfen. Hat der Baron Ihnen bereits gesagt, dass auch er Sie lieb hat?«
Sie schüttelte leise das Köpfchen.
»Aber er ist freundlich, liebreich und zuvorkommend gegen Sie gewesen? Er ist so zu Ihnen gewesen, wie man nur zu einem Mädchen ist, welches man lieb hat?«
Sie nickte langsam und zog dann ihre Hand aus der seinigen.
»Monsieur«, sagte sie, »ich weiß gar nicht, wie das kommt, dass ich Ihnen das Alles mitteile. Ich wage, Ihnen Dinge zu sagen, weiche ich niemals einem Andern mitgeteilt habe. Meine Aufrichtigkeit könnte mich in große Gefahr bringen.«
»Niemals, mein Kind, denn es wird kein Mensch erfahren, dass Sie es sind, welche mir dies Alles gesagt hat. Wenn ein wirklich guter Mensch zu einem Andern kommt, so öffnet sich selbst das verschlossenste Herz. Das ist die Macht, welche ein ehrliches, offenes Menschenangesicht ausübt. Nun aber ist meine Zeit abgelaufen. Ich hoffe, dass ich Sie wiedersehe. Kehrt die Baronin nicht bei Ihnen ein?«
»Niemals.«
»Kommt der Herr Baron auch nicht?«
»Zuweilen«, gestand sie.
»Wo ist Ihre Mutter?«
»Sie ist oben beschäftigt.«
»Und darf ich Ihren Namen wissen?«
»Ich heiße Bertha.«
»Und wie noch?«
»Bertha Marmont.«
»Ich danke. Leben Sie wohl, Mademoiselle Bertha! Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre freundliche Warnung. Gott lasse Sie recht, recht glücklich werden!«
Er reichte ihr seine Hand. Sie hielt dieselbe fest, sah ihm voll in die Augen und fragte: »Sie werden auch gewiss meine Warnung befolgen?«
»Gewiss.«
»Sie werden singen Ma chérie est la belle Madeleine!«
»Ich werde es pfeifen. Weiterhin, von dem Kreuze ab ist der Wald wohl sicher?«
»Ja, bis Le Chêne; jenseits aber kenne ich keinen Rat.«
»Sie meinen jedoch, dass es dort auch nicht geheuer ist.«
»Man hört von dort viel Böses erzählen. Nehmen Sie sich sehr, sehr in Acht, Monsieur.«
Er gab ihr ein Goldstück und ging, ohne sich Etwas herausgeben zu lassen. Sie begleitete ihn bis vor die Tür und sah ihn aufsteigen. Als er davongaloppierte, blickte sie ihm nach, bis er hinter der ersten Krümmung des Weges verschwunden war; dann sagte sie nachdenklich zu sich: »Das war ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch. Er hatte so treue, ehrliche Augen, viel treuer und guter als der Baron, den ich doch so unendlich lieb habe. Er trug ganz einfache Kleider, aber er war doch ein feiner Herr. Er ritt gerade wie ein Offizier. Er hat mir seinen Namen verschwiegen. Ich möchte wohl recht gern wissen, wer er ist. Wenn er nur um Gottes Willen nicht vergisst, das Lied zu pfeifen.«
Ganz ähnliche Gedanken hatte auch Königsau. »Ein schönes und ein braves Mädchen!«, dachte er. »So gut, rein und kindlich, obgleich sie von der Sünde und dem Verbrechen umgeben ist. Ich wette, dass sich zwischen ihr und dem Barone noch eine Art Roman entspinnt, und wünsche nur, dass er sich für sie nicht allzu unglücklich enden möge.«
Er ritt schnell seines Weges und legte eine Krümmung des letzteren nach der andern zurück. Kurz bevor er die fünfte erreichte, lockerte er seine Pistolen, um schnell zum Schusse bereit zu sein. Und als er das Kreuz erblickte, begann er das in ganz Frankreich damals bekannte Liebeslied Ma chérie est la belle Madeleine laut und fröhlich hinaus zu pfeifen. Dabei suchten seine Augen verstohlen etwas Verdächtiges zu entdecken.
Er war noch nicht vis-á-vis des Kreuzes angekommen, so bemerkte er, dass zwei Köpfe sich vorsichtig über die Zweige des Gebüsches erhoben, welches den Rand des Waldes besäumte; aber ebenso schnell, wie sie erschienen waren, verschwanden sie auch wieder. Er gelangte ohne alle Fährlichkeit vorüber. Im Weiterreiten kam ihm ein Gedanke. »Wenn ich diese Kerls belauschen könnte!«, dachte er. »Vielleicht würde ich Etwas erfahren, was mir Nutzen bringt. Soll ich es wagen? Pah, ich habe vier Doppelpistolen, also acht Schüsse, und stehe außerdem unter dem Schutze dieses Mädchens.«
Als er die nächste Krümmung erreichte, konnte er von den Marodeurs, selbst wenn ihn diese hätten beobachten wollen, nicht mehr bemerkt werden. Er sprang ab und zog sein Pferd ein genügendes Stück in den Wald hinein.
Dort band er es an einen Baum und kehrte dann in der Richtung zurück, aus welcher er gekommen war, natürlich aber nicht auf der Straße, sondern unter dem Schutze der Bäume des Forstes. Je mehr er sich dem Kreuze näherte, desto vorsichtiger wurde er. Er schlug sich noch tiefer in den Wald hinein, um von dort aus an das Kreuz zu kommen. Es gelang ihm gut. Sich leise von Baum zu Baum schleichend, konnte er bereits die Lichtung der Straße vor sich erkennen, als er die Büsche erreichte, welche als Unterholz zwischen den Stämmen standen. Er kroch langsam zwischen diesen Büschen vorwärts und hörte bald halblaute Stimmen vor sich. Seine Vorsicht verdoppelnd, schob er sich weiter, bis er nur um einen Strauch zu blicken brauchte, um Die zu sehen, welche er suchte.
Eng zwischen das Buschwerk eingeklemmt, saßen acht Männer. Ihre Kleider waren augenscheinlich aus Raubstücken zusammengesetzt, ein buntes Gemisch von Militär und Civil. Ihre Bewaffnung war ausgezeichnet, und ihr Äußeres zeigte ganz und gar deutlich auf das Gewerbe hin, welchem sie oblagen. Unweit von ihnen standen, hart am Rande des Gebüsches und fast in der unmittelbaren Nähe des Kreuzes, noch Zwei, welche Wache zu halten hatten. Es waren dies die Zwei, welche Königsau vorher gesehen hatte. Sie verhielten sich ruhig, während die Andern sich so laut unterhielten, dass der Lauscher Alles hören konnte.
»Ein Knecht? Nein, das war er nicht«, sagte Einer.
»Was sonst?«, fragte ein Anderer.
»Er ritt so militärisch. Er hatte so prachtvollen Schluss.«
»Und einen reinen Offiziersbart!«, fügte ein Dritter hinzu.
»Streitet Euch nicht!«, warnte ein Vierter. »Er ist ja nun vorüber.«
»Er sah nicht nach vielem Gelde aus!«, bemerkte der Zweite.
»Es wäre ein schlechter Fang gewesen. Übrigens hatte er unser Zeichen.«
»Wer mag es ihm gesagt haben?«
»Vielleicht pfiff er das Lied nur ganz zufällig.«
»Oder ist er bei Bertha Marmont eingekehrt?«
»Sollte er ein Bekannter von ihr sein?«
»Vielleicht ein Geliebter?«
Da schlug der Eine mit der Faust auf den Rasen und sagte: »Dann sollte ihn der Teufel holen. Die Bertha ist ein zu appetitlicher Bissen, als dass wir sie einem Fremden überlassen sollten.«
»Einer von uns oder Keiner.«
»Pah!«, brummte sein Nachbar, der zu alt war, um noch Liebesgedanken hegen zu können. »Streitet Euch nicht! Einige von uns haben sich die Finger an ihr verbrannt. Keiner gönnt sie dem Andern, und darum haben wir ausgemacht, dass Keiner sie bekommen soll. Es würde sonst Mord und Totschlag geben. Warum sollte sie da nicht Einen nehmen dürfen, den sie lieb hat?«
»O, ich weiß Einen, den sie wohl gern möchte. Aber er hängt ihr zu hoch.«
»Wer ist es?«
»Der Baron.«
Ein allgemeines »Ah!« ging im Kreise herum.
»Der junge Baron de Sainte-Marie?«, fragte Einer erstaunt.
»Ja.«
»Unmöglich!«
»Warum unmöglich?«
»Er ein Baron und sie die Tochter aus einer Waldschänke.«
»Pah! Es macht die Liebe Alles gleich.«
»Woher weißt Du es?«
»Ich habe es gesehen. Habt Ihr denn noch nicht bemerkt, wie sie errötet und lauscht, wenn von ihm die Rede ist? Sie ist in ihn verliebt bis über die Ohren.«
»Und er auch in sie?«
»Wer weiß es.«
»Das Mädchen wäre ganz und gar darnach. Ich traue ihr zu, dass es eine prachtvolle Baronin abgeben würde.«
»Er kommt öfters in die Schänke.«
»Weiß dies Fabier?«
»Vielleicht.«
»Nun, dann mag der Baron sich in Acht nehmen. Der Fabier jagt ihm eine Kugel durch den Kopf. Er ist ganz toll in das Mädchen.«
»Aber er darf es nicht bekommen; das wäre ganz gegen unsere Verabredung.«
»Übrigens«, stimmte ein Anderer bei, »soll er ja Barchands Tochter heiraten.«
»Die? Das fällt ihm gar nicht ein!«
»Warum nicht? Er und der Alte sind jetzt außerordentlich dicke Freunde. Immer liegen sie beisammen. Immer sprechen sie leise. Immer haben sie Heimlichkeiten. Wollen sie uns etwa übervorteilen?«
»Das sollte ihnen nicht gut bekommen.«
»Sei still! Du hättest nichts dagegen. Sind sie nicht seit gestern fort? Wollten sie nicht erst heute Abend wiederkommen? Was treiben sie? Sie gehen doch, um miteinander auf eigene Rechnung zu jagen!«
»Das leiden wir nicht! Alles für Alle. Alles muss geteilt werden.«
»Ja. Nun sind sie fort, und da ist kein Zusammenhalt. Da sind die Andern auch gegangen, so dass nur unserer Zehn hier sitzen. Was ist da anzufangen?«
»Richtig! Wären wir heute am Vormittage Alle beisammen gewesen, so hätten wir einen Fang gemacht. Dreißig Soldaten bei einem Wagen! Was muss das gewesen sein? Gewiss kein übler Fang.«
»Vielleicht gar eine Kriegskasse.«
»Das ist sehr leicht möglich. Nun aber ist sie vorüber. Wenn diese Beiden mit ihren Heimlichkeiten fortfahren, so jagen wir sie einfach zum Teufel. Wer weiß, wo und was sie für einen Fang machen, während wir hier brach liegen. Kommt hier ja einer vorüber, so singt oder pfeift er das Lied, und wir haben das Nachsehen.«
»Nur Geduld!«, lachte der Alte. »Der Kerl, welcher hier vorüberpfiff, hatte nicht drei Franken im Sacke. Warte bis heute Abend.«
»Wird es wahr sein?«
»Ich habe es ganz genau gehört.«
»Ein Marschall?«
»Sogar zwei Marschälle.«
»Donnerwetter! Welche?«
»Frage nicht ewig! Was tut der Name zur Sache!«
»Aber ob sie Geld haben!«
»Meinst Du, ein Marschall reise ohne einen vollen Beutel?«
»Und Ringe, Uhren, Dosen, Diamanten und Pretiosen!«, meinte ein Anderer.
»Aber auch mit großer Bedeckung.«
»Pah! Die wird niedergeschossen.«
»Und wenn sie zahlreich ist?«
»Wenn die Anderen kommen, sind wir zwanzig Mann. Das genügt vollständig.«
»Ja, vollständig!«, stimmte einer seiner Kameraden bei. »Wir liegen hier sicher im Hinterhalte. Wir geben uns ja nicht eher bloß, als bis sie alle erschossen sind.«
Hier handelte es sich also um den Überfall zweier Marschälle. Sollte Königsau weiter lauschen? Sollte er noch mehr zu erfahren suchen, um die Marschälle aufzusuchen und zu warnen? Was nützte das ihm? Was nützte es seiner Sache? Nichts. Es konnte ihm nur Schaden bringen. Übrigens brachen die Leute das Thema ab und begannen von gleichgültigeren Dingen zu sprechen.
Der kleinste Umstand konnte zum Verräter an ihm werden. Darum zog er sich zurück, erst langsam und leise; dann aber nahm er einen raschen Schritt an und eilte zu seinem Pferde. Er fand es noch so, wie er es verlassen hatte, zog es aus dem Walde auf die Straße heraus, stieg auf und setzte seinen Weg fort.
Nach einer halben Stunde erreichte er Le Chêne. Er wäre am Liebsten hindurchgeritten, doch hielt er es für besser, einmal einzukehren. Auf diese Weise konnte er vielleicht Etwas erfahren. Er führte sein Pferd hinter das Haus, ließ sich ein Glas Wein geben und fragte dann den Wirt, ob er ein wenig Heu bekommen könne.
»Für Ihr Pferd?«, fragte dieser.
»Denken Sie etwa, für mich?«, lachte er.
Der Wirt machte ein saures Gesicht und antwortete: »Heu ist nicht da. Aber gehen Sie in den Garten, da schneidet das Mädchen Gras. Das ist auch besser als Heu.«
Der gute Mann blieb ruhig auf seinem Stuhle sitzen. Königsau schritt über den Hof hinüber und öffnete die Gartenpforte. Er trat in einen Laubengang, welcher von Pfeifenstrauch und Weinreben gebildet wurde. Dieser Gang war sehr dicht belaubt, und es gab nur hier und da ein hinein geschnittenes Loch, welches als eine Art Fenster diente. Er führte in gerader Richtung nach einer Laube, aus welcher man in den eigentlichen Grasgarten gelangte.
Indem Königsau so dahinschritt, vernahm er eine Stimme. Er blieb überrascht stehen, denn es war ihm, als ob er den Namen Fabier gehört hätte.
Er lauschte. Jetzt vernahm er deutlich, dass draußen außerhalb des Ganges zwei Personen miteinander sprachen. Er unterschied eine männliche und eine weibliche Stimme. Sie ertönten gar nicht weit von ihm. Er brauchte nur noch einige Schritte zu gehen, so stand er innerhalb grad an der Stelle, an welcher sie außerhalb standen.
Er schlich sich leise vorwärts und lauschte.
»Also Du bist ihm nicht gut?«, fragte die männliche Stimme.
»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete die weibliche in einem tiefen, rauhen Alt.
»Aber er ist doch Dein Liebhaber.«
»Wer sagt das?«
»Ich habe es gesehen.«
»Wann?«
»Vorgestern am Zaune. Da habt Ihr Euch geküsst.«
»Er mich, aber ich ihn nicht.«
»Du brauchst es doch nicht zu leiden.«
»Er ist stärker als ich.«
»So brauchst Du noch nicht hinaus zu ihm zu gehen.«
»Dummkopf! Wusste ich, dass er draußen stand?«
»Aber Du hast mit ihm getanzt.«
»Mit Andern auch.«
»Aber mit mir nicht.«
»Dummkopf! Du wirst mein Mann und bist mir also sicher.«
»Ah so! Aber ich will doch mit meiner Geliebten auch einmal tanzen.«
»Warte, bis sie Deine Frau ist.«
»Und wenn ich Dich nun nicht zur Frau haben mag?«
»So lässt Du es bleiben! Aber dann wirst Du auch kein reicher Mann, der den Wein aus Krügen trinkt und den Tabak aus Meerschaumpfeifen raucht.«
»Du redest nur stets von Reichtum. Wovon soll ich reich werden?«
»Durch mich!«
»Durch Dich?«, ertönte es lachend. »Was besitzt Du denn? Einen Rock, zwei Hemden, zwei Strümpfe, eine Schürze, eine Jacke, ein Tuch und ein Paar Holzschuhe. Das ist Dein ganzer Reichtum.«
»Dummkopf! Muss man denn seinen Reichtum auf dem Leibe tragen?«
»Wo denn?«
»Den versteckt man.«
»Ah! Man gräbt ihn zum Beispiel ein?«
»Ja.«
»Dann wird es ein Schatz.«
»Ja, richtig, ein Schatz!«
»Aber man hat nichts davon.«
»Warum nicht?«
»Nun, wenn das Geld in der Erde steckt, was soll es Einem da helfen?«
»Dummkopf! Man holt sich zuweilen so viel, wie man grade braucht!«
»O, das wäre sehr gut! Wer es doch bereits so weit gebracht hätte!«
»Ich, ich habe es so weit gebracht!«, ertönte es in stolz knurrendem Tone.
»Du? Du hättest Geld vergraben?«
»Ja.«
»Wo denn?«
»Das geht Dich jetzt noch nichts an. Das erfährst Du erst, wenn Du mein Mann bist.«
»Donnerwetter! Wenn das wahr wäre! Ist's wahr?«
»Dummkopf! Würde ich Dir es sagen, wenn es nicht wahr wäre!«
»Ja, das mag richtig sein. Wie viel ist es denn?«
»Rate einmal!«
»Fünfzig Franken?«
»Viel mehr!«
»Hundert Franken?«
»O, viel mehr!«
»Tausend Franken?«
»Noch mehr!«
»Noch mehr? Das ist unglaublich! Woher solltest Du dies viele Geld haben?«
»Dummkopf! Das ist meine Sache! Rate also immer weiter!«
»Fünftausend Franken?«
»Viel mehr!«
»Zehntausend?«
»Noch lange nicht genug!«
»Aber Du machst mich ja ganz stupid! Für zehntausend Franken kann ich mir doch ein schönes Haus oder gar ein Bauerngut kaufen!«
»Dummkopf! Du bist ja schon stupid! Was liegt mir an einem Hause oder an einem Bauerngut! Ein Schloss will ich haben, ein Schloss mit Türmen und großen Fenstern!«
Es entstand eine Pause, welche jedenfalls durch ein Mienenspiel des ungeheuersten Erstaunens ausgefüllt wurde. Dann ertönte die männliche Stimme wieder.
»Aber dazu gehören ja mehr als hunderttausend Franken!«
»Die habe ich ja!«
»Oder gar eine Million!«
»Auch diese habe ich.«
»Mädchen, Du bist verrückt!«
»Dummkopf! Ist man denn verrückt, wenn man mehr als eine Million hat?«
»O nein! Da ist man im Gegenteil sehr gescheit. Aber wo hast Du das Geld?«
»Vergraben.«
»Und von wem hast Du es?«
»Von meinem Vater.«
»Der ist ganz arm, blutarm!«
»Hat er nicht erst vor zwei Wochen drin in der Gaststube achtzig Franken im Spiele verloren?«
»Ja, das ist wahr.«
»Nun, ist er arm?«
»Hm! Wo hat er das Geld her?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Warum nicht?«
»Weil Du noch nicht mein Mann bist.«
»Also, um Alles zu erfahren, muss ich erst Dein Mann sein?«
»Natürlich!«
»Hahahaha! Dann wäre ich in Wirklichkeit der Dummkopf, wie Du mich immer heißest!«
»Wieso?«
»Wenn Du dann meine Frau bist, dann hast Du nichts.«
»Ach, Du glaubst mir nicht?«
»Nein. Ich lasse mich nicht fangen. Jetzt lockst Du mich zum Heiraten; aber nach der Hochzeit hast Du keinen Franken, viel weniger eine Million.«
Wieder entstand eine Pause, nach welcher die weibliche Stimme fragte: »Also Du magst mich nicht?«
»Mit leeren Versprechungen nicht.«
»Aber ich sage ja die Wahrheit!«
»Beweise es!«
»Wenn ich Dir jetzt Alles sage, so verrätst Du es und heiratest mich nicht!«
»Unsinn! Ich möchte gar so gern reich sein, und wenn ich es durch Dich werden kann, so werde ich es doch nicht verraten!«
»Aber wenn nun ein Bischen Unrecht dabei wäre?«
»Das ist mir egal!«
»Wenn der Schatz einem anderen gehörte?«
»Das wäre ihm recht! Mag er nicht so dumm sein und sein Geld vergraben!«
»Er ist ja gar nicht so dumm gewesen. Es ist ihm genommen und dann vergraben worden.«
»Mag er es sich nicht nehmen lassen. Wer war es denn?«
»Kein Mann und keine Person, sondern der Staat.«
»Der Staat? Ach, dem können wir das Geld nehmen! Er hat es ja erst von uns! Es ist also wohl gar eine Kasse?«
»Ja.«
»Wer hat sie gestohlen? Wer hat sie ausgeleert?«
»Man hat sie nicht ausgeleert. Sie ist ganz vergraben worden, gleich mit dem Kasten.«
»Donnerwetter, eine Kriegskasse also?«
»Dummkopf! Brülle nicht so!«
»Wohl gar dieselbe, welche damals so gesucht wurde?«
»Ja.«
»Wo steckt sie?«
»Das erfährst Du jetzt noch nicht. Du weißt jetzt einstweilen genug.«
»Nein, ich weiß nicht genug. Das von der Kriegskasse kannst Du Dir erst ausgesonnen haben, um mich zu fangen; ich beiße aber an diese Angel nicht an.«
»Ja was willst Du denn noch wissen?«
»Wo sie liegt.«
»Droben in den Bergen.«
»In welchen Bergen?«
»Nicht weit von Bouillon.«
»Ah! Kennst Du den Ort?«
»Nein; aber mein Vater weiß ihn.«
»Woher weiß er ihn denn?«
»Dummkopf; weil er selbst die Kriegskasse dort vergraben hat!«
»Er selbst? Ach, so ist er es gewesen, der sie damals gestohlen hat?«
»Ja. Aber Du wirst ihn doch nicht verraten?«
»Fällt mir gar nicht ein! Aber teilen muss er mit mir! Verstanden?«
»Das tut er auch, wenn Du mich zur Frau nimmst.«
»Aber ich setze den Fall, er tut es nicht, wenn ich dann Dein Mann bin?«
»So schlage ich ihn tot und nehme ihm das Geld ab. Ja, gewiss, das tue ich.«
»Donnerwetter! So hast Du mich also sehr lieb?«
»Dummkopf! Würde ich Dich sonst zum Manne haben wollen und Dir so viel Geld geben?«
»Ja, Du hast Recht. Aber woher weißt Du, dass sie bei Bouillon vergraben liegt?«
»Der Vater sagte es mir.«
»Aber wenn er Dich belogen hat?«
»Ich bin ihm nachgegangen, als er Geld holte; ich habe mich überzeugt.«
»So musst Du doch den Ort gesehen haben!«
»Nein. Er lief mir zu schnell; ich verlor ihn aus den Augen. Ich musste also umkehren. Aber als er dann nach Hause kam, hatte er alle Taschen voller Goldstücke.«
»Du bist ihm wirklich bis Bouillon nachgegangen?«
»Ja, noch weiter.«
»Wohin?«
»Bis über den Ort hinaus, am Wasser hin. Dann geht es links ab am Berg empor.«
»Weiter.«
»Man kommt im Wald an eine Hütte. Dort verlor ich ihn aus den Augen.«
»Hm! Man müsste ihm nachschleichen!«
»Das ist nicht nötig. Er teilt ja mit Dir.«
»Wird er das wirklich tun?«
»Ganz sicher. Er wollte ja mit Fabier auch teilen. Aber diesen mag ich nicht. Ich kann ihn nicht leiden. Er ist klug und falsch; Du aber bist dumm und gut!«
»Ah, ich danke Dir! Dass er falsch mit Dir war, habe ich längst gewusst.«
»Inwiefern?«
»Er läuft der Tochter in der Waldschänke nach.«
»Ah, das hast Du also auch gewusst? Ja, er hätte mir mein Geld abgenommen und es zu ihr hingetragen. Aber ich bin pfiffiger als er. Ich nehme mir einen Mann, den ich eher betrügen kann, als er mich. So muss man es machen.«
Fast hätte Königsau laut aufgelacht und sich dadurch kläglich verraten. Doch wurde das Gelächter von der männlichen Stimme reichlich besorgt; dann sagte sie: »Du meinst also, mich betrügen zu können? Da muss ich außerordentlich vorsichtig zu Werke gehen, um nicht zu sehr über das Ohr gehauen zu werden!«
»Tue das immerhin! Deine Klugheit habe ich nicht zu fürchten. Aber jetzt habe ich nicht länger Zeit zu unnützen Gesprächen. Gehe fort und komme lieber heut Abend wieder, wenn meine Arbeit beendet ist. Adieu.«
»Adieu!«
Königsau hörte das laute, klatschende Geräusch eines schallenden Schmatzes und dann eilig sich entfernende Schritte. Er trat an eins der Laubengangfenster und blickte hindurch. Er sah ein klein aber sehr untersetzt gebautes Mädchen, schmutzig gekleidet und mit wirr um den Kopf hängenden Haaren, das Gesicht voller Blatternarben und Sommersprossen. Das Wesen sah eher einer Kretine als einem normal gestalteten Menschen ähnlich und der boshafte Blick des kleinen Auges machte es noch abstoßender. Das also war Barchands Tochter, die Nebenbuhlerin der schönen Bertha Marmont! Welch ein Unterschied zwischen Beiden!
Der sich Entfernende war ein Mensch mit Säbelbeinen und einem ungeheuren Kopfe. Als er sich noch einmal umdrehte, um seiner Geliebten zuzulächeln, bildete dieses beabsichtigte Lächeln eine höchst verunglückte Fratze, welche sich wie eine tragische Larve um sein Gesicht legte.
Diese Beiden passten allerdings zusammen wie selten zwei Andere.
Königsau zog es vor, auf das Gras für das Pferd zu verzichten, und lieber Brot für dasselbe geben zu lassen. Er wollte lieber von dem Mädchen gar nicht bemerkt sein. Im Laufe der belauschten Unterhaltung war es ihm fast bange um seine Kriegskasse geworden. Es hatte allen Anschein gehabt, als ob das Mädchen den Ort kenne, an welchem dieselbe versteckt lag. Als sich dann jedoch herausstellte, dass dies nicht der Fall sei, fühlte er sich so erleichtert, dass er tief Atem holte.
Aber während er nach dem Gastzimmer zurückkehrte, kam ihm doch wieder ein beunruhigender Gedanke. »Sollte sie den Ort dennoch wissen und sich gegen diesen Menschen nur verstellt haben?«, fragte er sich. »Das wäre möglich, aber nicht wahrscheinlich. Sie hätte dann sicher nicht erzählt, dass sie ihrem Vater fruchtlos nachgelaufen sei.« Damit beruhigte er sich. Er versorgte sein Pferd, bezahlte sodann seine geringe Zeche und ritt weiter.
2. Kapitel
Sein Aufenthalt in den beiden Schänken und die Belauschung der Marodeurs hatten doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als von ihm beabsichtigt worden war. Der Tag neigte sich bereits seinem Ende zu, und als er wieder in die schmale, von hohen Bäumen eingefasste Waldstraße einritt, dämmerte es bereits in derselben. Er gab seinem Pferde die Sporen, um rascher vorwärts zu kommen.
Es war so unheimlich still im Walde, eine Stille, ganz geeignet, den Gedanken und Befürchtungen eines besorgten Gemütes Audienz zu geben.
Er malte sich die Scene aus, wenn die von Vouziers zurückkehrende Geliebte von Vagabunden überfallen würde. Seine Einbildungskraft war dabei so lebhaft beschäftigt, dass er seine Pistole zog und das Pferd zu größerer Eile trieb.
Die Schatten der Nacht neigten sich tiefer und tiefer herab. Es war nun vollständig dunkel geworden, so dass er den Weg nicht mehr zu erkennen vermochte. Er verließ sich ganz auf das Pferd, dessen Huftritte auf dem weichen Boden des Waldweges fast gar kein Geräusch hervorbrachten.
Da war es ihm, als ob sein immer vorauslauschendes Ohr das dumpfe Rollen vernommen hatte. Da vorn blitzte zu gleicher Zeit ein Schuss auf, dem mehrere andere folgten, so dass die Echos derselben vervielfältigt durch den Wald erdröhnten. Weibliche Stimmen riefen um Hilfe.
Da spornte er sein Pferd zu größter Eile.
Jetzt tauchten vor ihm zwei dünne, schwache Lichter auf, sie kamen aus den beiden Laternen des überfallenen Wagens. Ein Gedanke kam ihm. Der Galopp seines Pferdes musste ihn den Vagabunden verraten. Er erhielt dann jedenfalls ihre Schüsse, ehe er in der Dunkelheit im Stande war, einen von ihnen zu erkennen und auf ihn zu schießen. Jetzt aber hatten sie sein Nahen jedenfalls noch nicht bemerkt.
Er hielt sein Pferd an, band es an den nächsten Baum und nahm die Pistolen des Barons aus den Satteltaschen, in denen sie stacken. Er steckte sie in die Außentaschen seines Rockes und nahm seine eigenen in die Hände. Dann eilte er vorwärts, indem er während des Laufens die Hähne aufzog.
Als er abstieg war er vielleicht zweihundert Schritte von dem Wagen entfernt. Er brauchte keine Minute, um diese Strecke zurückzulegen. Der weiche Boden dämpfte den Schall seiner Schritte. Als er nahe genug war, um die Scene zu erkennen, hielt er an und schlich sich im Dunkeln nun langsamer näher.
Er hörte die Stimme von Frau Richemonte, welche soeben versicherte: »Aber wir haben in Wahrheit kein Geld mehr bei uns!«
»Vornehme Damen und kein Geld? Hahaha!«, rief eine rauhe Stimme. »Steigt aus! Wir werden Alles durchsuchen, Euch auch und Eure Kleider. Ist eine halbwegs hübsche unter Euch, so wird sie für Euch Alle bezahlen, wenn Ihr kein Geld habt.«
Frau Richemonte wurde herausgezogen. Dann leuchtete der Kerl mit der einen Wagenlaterne abermals in das Innere des Wagens hinein.
»Alle Wetter!«, rief er. »Die ist hübsch, die ist reizend! Ein solches Püppchen haben wir noch nicht gefunden. Heraus, mein Schatz! Heraus!«
Das eine Pferd lag erschossen am Boden; das andre stand schnaubend und zitternd daneben. Der Kutscher saß auf seinem Bocke und rührte sich nicht, und um den Wagen herum standen neun dunkle, martialische Gestalten, welche neugierig versuchten, in den Wagen zu blicken.
»Ja, heraus mit ihr, wenn sie hübsch ist!«, rief Einer, sich näher drängend. »Das gibt endlich einmal ein Vergnügen, wie es Unsereinem willkommen ist.«
Er langte in den Wagen hinein, um Margot mit herauszuziehen. Sie stieß einen Ruf des Entsetzens aus und versuchte, sich zu wehren.
»Das nützt Dir nichts, feines Liebchen!«, lachte der Eine. »Heraus musst Du, dann halten wir Hochzeit zwischen neun Bräutigams und einer Braut.«
»Und ich gebe meinen Segen dazu, Ihr Halunken!«
Mit diesen Worten Königsaus krachte auch sein erster Schuss; der zweite folgte augenblicklich. Die beiden Kerls, welche dem Wagenschlage am Nächsten standen, stürzten, zum Tode getroffen, zur Erde nieder.
»Hugo, mein Hugo! Ist es möglich?«, jubelte Margot auf.
Sie hatte die Stimme des Geliebten erkannt, obgleich es ihr unerklärlich sein musste, ihn grade hier gegenwärtig zu sehen.
»Ja, ich bin es, Margot. Keine Angst weiter!«, antwortete er.
Während dieser Worte schoss er zwei Andere nieder, ließ die abgeschossenen Pistolen fallen und zog die geladenen hervor. Die Vagabunden waren von seinem Erscheinen so sehr überrascht, dass sie im ersten Augenblicke ganz vergaßen, sich zur Wehr zu setzen. Jetzt aber bemerkten sie, dass sie nur einen einzelnen Gegner vor sich hatten. Da erhob Einer sein Gewehr zum Kolbenschlage und rief: »Hund, das sollst Du büßen. Deine Pistolen sind nun abgeschossen. Fahre zur Hölle!«
»Fühle, ob sie abgeschossen sind!«, antwortete Königsau.
Er hielt ihm, ehe der beabsichtigte Hieb herniedersausen konnte, den Lauf vor die Stirn und jagte ihm eine Kugel durch den Kopf.
Da erscholl aus dem Wagen ein schriller Angstschrei: »Gott! Hugo, hinter Dir!«
Er drehte sich auf diesen Zuruf Margots blitzschnell um und hatte gerade noch Zeit, sich auf die Seite zu werfen. Einer der Kerls hatte von hinten auf ihn angelegt, um ihn zu erschießen. Der Schuss krachte, aber die Kugel verfehlte ihr eigentliches Ziel und fuhr einem seiner Kameraden in die Brust, welcher sich soeben auf den Leutnant hatte werfen wollen.
»Esel!«, röchelte er noch zornig, ehe er zu Boden sank.
Zu gleicher Zeit aber schoss Königsau auch den ungeschickten Schützen nieder.
Jetzt bekam auch der Kutscher Mut. Er sprang vom Bocke und fasste den Einen der beiden noch übrigen Marodeurs.
Dieser wehrte sich verzweifelt, konnte sich aber von dem stämmigen Knechte nicht losringen. »Ich werde Dir lehren, mir die Pferde zu erschießen!«, zürnte dieser. »Jetzt bist Du daran, Hundsfott.« Er riss ihn zur Erde nieder und kniete auf ihm.
Der Letzte suchte durch die Flucht zu entkommen, wurde aber noch zur rechten Zeit von der Kugel des Deutschen erreicht. Dieser trat nun rasch zum Kutscher, um diesem Beistand zu leisten.
»Ist nicht nötig!«, meinte dieser jedoch. »Der Kerl ist tot. Ich habe ihm die Seele aus dem Leibe gequetscht.«
Königsau untersuchte den am Boden Liegenden und fand allerdings, dass er von dem Kutscher erwürgt worden war. »Ja, er ist tot. Es war der Letzte von den Neun. Wir sind fertig!«, sagte er.
»Ist es wahr, Hugo? Ist der Sieg vollständig?«, klang es aus dem Wagen heraus.
»Ja«, antwortete er, zum Schlage tretend.
»O, wie danke ich, wie danken wir Dir.«
Sie stieg, nein, sie flog heraus und in seine Arme. Ihre Lippen legten sich wieder und immer wieder auf seinen Mund, bis sie, sich besinnend, plötzlich fragte: »Aber Mama? Wo ist Mama? Sie musste aussteigen!«
Es war Alles so schnell gegangen, und Königsau hatte seine Aufmerksamkeit so sehr auf die Feinde zu richten gehabt, dass er gar keine Zeit gefunden hatte, des Weiteren auf die Mutter der Geliebten zu achten.
»Hier liegt sie!«, antwortete der Kutscher, mit der noch brennenden Wagenlaterne zu Boden leuchtend.
Die andre war dem Räuber entfallen, als ihn Königsaus Kugel traf.
»Mein Gott, hier am Boden!«, rief Margot. »Sie ist doch nicht etwa von einer Kugel getroffen worden?«
Der Deutsche kniete nieder und untersuchte Madame Richemonte.
»Sie ist nur ohnmächtig, meine Margot«, sagte er. »Es hat nichts zu bedeuten. Aber war nicht die Frau Baronin bei Euch?«
»Ja. Dort im Wagen ist sie noch.«
Der Kutscher leuchtete hin, und so sah Königsau die Dame grad im Begriff, auszusteigen.
»Monsieur, wir haben Ihnen Vieles, vielleicht das Leben zu verdanken«, sagte sie. »Nehmen Sie einstweilen meine Hand, und sorgen Sie dann, dass wir diese Stelle verlassen können. Mir graut vor diesen Toten.«
Erst jetzt beachtete Margot, welche bei ihrer Mutter kniete, die umherliegenden Leichen. »Gott, wie entsetzlich!«, rief sie schaudernd. »So Viele waren gegen uns?«
»Neun Mann«, antwortete Königsau.
»Und die Alle hast Du besiegen müssen, Du Einziger?«
»Nicht Alle«, lächelte er. »Einen hat der Kutscher überwunden. Aber siehe, da erwacht Mama.«
Wirklich gab Frau Richemonte jetzt Lebenszeichen von sich. Nur die Angst um die Tochter, welche sie durch die bestialischen Menschen bedroht sah, hatte ihr das Bewusstsein geraubt. Jetzt erhob sie sich langsam in Margots Armen.
»Sind sie fort? Sind sie fort, diese Menschen?«, fragte sie ängstlich.
»Sie sind nicht mehr zu fürchten«, antwortete Margot. »Hugo hat gesiegt.«
»Hugo? Ah, ja, ich besinne mich; er war da. Wo ist er?«
»Hier bin ich, Mama«, antwortete er. »Wollen Sie nicht versuchen, wieder in den Wagen zu steigen?«
»Ja, das will ich«, antwortete sie. »O, wie viel haben wir Ihnen zu danken, mein lieber Sohn. Sie erschienen uns wie ein Engel. Aber wie sind Sie an diesen Ort gekommen? Und gerade im Augenblicke der größten Gefahr?«
»Ich kam über Sedan nach Roncourt, um Sie zu besuchen. Dort hörte ich von dem Herrn Baron, dass Sie nach Vouziers gefahren seien und des Nachts zurückkehren würden, ohne eine schützende Bedeckung bei sich zu haben. Ich hatte von der Unsicherheit dieser Gegend gehört und ließ mir darum sogleich ein Pferd geben, um Ihnen entgegen zu reiten.«
»Welche Aufmerksamkeit, welche Courtoisie! Und welche Tapferkeit haben Sie hier bewiesen!«, sagte die Baronin. »Aber, meine liebe Margot, ich werde mich ganz gehörig mit Ihnen zanken müssen.«
»Warum?«, fragte das schöne Mädchen.
»Ich bemerke jetzt, dass Herr von Königsau Ihnen näher steht, als Sie mich ahnen ließen. Sie hatten kein Vertrauen zu mir.«
»Verzeihung, meine Liebe!«, sagte da an Margots Stelle ihre Mutter. »Ich allein trage die Schuld, dass Dir verschwiegen blieb, dass Margot die Verlobte des Herrn von Königsau ist. Ich bin überzeugt, dass Du meine Gründe billigen wirst, sobald ich sie Dir mitgeteilt habe.«
»Ich zürne Dir nicht, denn ich werde Deine Gründe anerkennen müssen. Aber, Monsieur, wie werde ich Sie jetzt in Roncourt zu nennen haben? Sie sind natürlich zu mir eingeladen.«
»Ich werde Sie bis nach Hause begleiten, Madame«, antwortete Königsau. »Wenn Jemand nach mir fragt, so nennen Sie mich einfach – hm.«
»Ah, ich habe einen Verwandten meines Namens in Marseille. Der sollen Sie sein.«
»Was ist er?«
»Seekapitän.«
»Der Marine?«
»Nein, des Handels.«
»Gut, ich akzeptiere. Aber, was ist das? Das Sattelpferd stürzt auch.«
»Es muss auch eine Kugel erhalten haben«, meinte der Kutscher.
»So wollen wir nachsehen.«
Als er nach dem Tiere leuchtete, fand er es am Verenden. Es hatte eine Wunde in der Brust. Das andere war längst tot.
»Was ist da zu tun?«, fragte die Baronin ratlos. »Wir müssen ja fort!«
»Mein Pferd befindet sich in der Nähe«, meinte Königsau. »Wir schirren es ein, nachdem wir die beiden toten Tiere entfernt haben. Es wird uns nach Hause bringen, wenn auch langsam. Im Notfalle leihen wir uns in Le Chêne ein zweites. Wir sind ja gezwungen, dort einzukehren, um Anzeige zu machen.«
Er ging und brachte bald den Braunen herbei. Es machte sich bei der mangelhaften Beleuchtung schwer, die beiden getöteten Pferde aus dem Riemenzeuge zu bringen. Noch waren Königsau und der Kutscher damit beschäftigt, als sich das Rollen einiger herankommenden Wagen vernehmen ließ.
»Man kommt«, sagte der Kutscher. »Es kann hier Niemand vorüber; die Straße ist zu schmal. Diese Leute werden einige Minuten halten müssen.«
Königsau ging den Wagen entgegen und rief dem Vordersten derselben ein lautes Halt zu. Er sah, dass es drei waren, und so weit die Dunkelheit es zuließ, bemerkte er, dass sie von Reitern eskortiert wurden.
»Warum?«, fragte der vorderste Kutscher.
»Man ist hier überfallen worden. Es liegen Leichen und erschossene Pferde im Wege, welcher erst frei gemacht werden muss.«
Da öffnete sich der Schlag des vordersten Wagens, und eine befehlende Stimme sagte: »Überfall? Hinanfahren, Jan Hoorn! Die Sache ansehen!«
Margot hörte diese Worte. »Mein Gott«, sagte sie zu den beiden anderen Damen. »Jan Hoorn ist der berühmte Kutscher des Kaisers, und das war auch die Stimme Napoleons!«
Die Wagen kamen langsam herbei und hielten dann. Aus dem zweiten stieg eine hohe Gestalt, weicher aus dem dritten eine andere folgte. Er trat zu Königsau heran und sagte: »Monsieur, ich hoffe, dass wir nicht lange Zeit hier aufgehalten werden. Ich bin Marschall Ney, und da kommt Marschall Grouchy. Wer sind Sie?«
»Diese Damen sind Baronin de Sainte-Marie, deren Verwandter ich bin, und Madame und Mademoiselle Richemonte aus Paris. Die drei Damen wurden von neun Marodeurs überfallen, welche hier tot am Boden liegen. Die Pferde sind erschossen. Geben Sie uns nur eine Minute Zeit, so sollen Sie freie Bahn haben.«
»Marodeurs? Wirklich?«, fragte der Marschall. »Oder waren es wirkliche Banditen?«
»Professionierte Räuber pflegen anders aufzutreten. Genau aber weiß ich es nicht.«
»Die Kerls haben sich wohl gar nicht gewehrt?«
»O doch, sie schossen nach mir.«
»Und alle sind tot?«
»Ja.«
»Wer hat sie getötet?«
»Einen der Kutscher, die Andern ich.«
Da ergriff Ney die Wagenlaterne, welche der Kutscher in der Hand hielt, und leuchtete Königsau in das Gesicht. Dabei war auch er selbst deutlich zu erkennen. Der Marschall war ein starker, doch nicht dicker, wohlgebauter, kräftiger Mann von schwarzbrauner, lebhafter Gesichtsfarbe, mit blitzenden Augen und einem befehlenden Äußeren. Er sah den jungen Mann scharf an und fragte: »So waren diese Leute bewaffnet?«
»Ja. Sogar sehr gut.«
Da trat auch Grouchy herbei und sagte in dem Tone des Unglaubens: »Und Sie haben trotzdem acht von ihnen getötet?«
»Ja«, antwortete Königsau.
»Womit?«
»Ich hatte glücklicherweise vier Doppelpistolen bei mir.«
»So waren Sie auf diesen Überfall, diesen Kampf vorbereitet?«
»Ich ritt den Damen entgegen, weil ich gehört hatte, dass diese Gegend sehr unsicher sei. Ich traf sie an dem Augenblicke, in welchem sie überfallen wurden.«
Da öffnete sich der Schlag des ersten Wagens und der Insasse sprang heraus. Er war ein kleiner, nicht allzu schmächtiger Mann, trug ein kleines Hütchen auf dem Kopf, und einen grauen Überrock. Die Beine stacken in hohen Schaftstiefeln.
»Der Kaiser!«, sagte Marschall Ney.
Napoleon trat mit einigen raschen Schritten näher. »Umherleuchten!«, befahl er in seiner eigentümlichen scharfen, kurzen Weise.
Der Marschall gab sich selbst die Mühe, den Platz zu beleuchten. Der Kaiser betrachtete jeden Einzelnen der Toten sehr genau. Es war von ihm bekannt, dass er trotz der vielen Hunderttausende, welche er befehligt hatte, einen Jeden kannte, den er einmal gesehen, oder dessen Namen er einmal gehört hatte.
»Marodeurs«, sagte er dann. »Kenne Einige; haben gedient, aber schlecht.«
Dann trat er auf Königsau zu, welcher sich unwillkürlich eine stramme militärische Stellung gab, so wie man vor einem Vorgesetzten zu stehen pflegt.
»Wie heißen Sie?«, fragte er ihn.
»Sainte-Marie.«
»Offizier?«
»Nein.«
»Bloß Soldat?«
»Auch nicht. Seekapitän von der Handelsmarine.«
»Ach schade! Sind ein Tapferer, ein Braver! Acht Mann getötet! In welcher Zeit?«
»In ungefähr einer Minute.«
»Fast unglaublich. Keine Lust zu dienen?«
»Ich glaube, Frankreich auch in meiner gegenwärtigen Stellung nützlich zu sein.«
»Richtig, wahr! Aber hätte Ihnen ein Schiff anvertraut. Brauche solche Leute. Marine Frankreichs befindet sich noch in Entwickelung. Die Damen!«
Königsau stellte die Damen vor, erst die Baronin, dann Frau Richemonte und zuletzt seine Geliebte, welche alle Drei sich tief vor Napoleon verneigten.
Er nickte ihnen in seiner kurzen Manier, aber freundlich zu; als sein Blick aber auf die schönen Züge des Mädchens fiel, griff er unwillkürlich an den Hut. Die seltene Zeichnung dieses reizenden Gesichtes fiel ihm auf.
»Mademoiselle Richemonte?«, sagte er. »Welcher Name?«
»Margot, Majestät«, antwortete sie.
Sie hatte eine so sonore, reine klangvolle Stimme, von einer eigentümlichen, zum Herzen sprechenden Tonfarbe. Man sah, dass er die Lippen leicht öffnete, wie als ob er die Deliciösität dieses Wohllautes nicht bloß mit dem Ohre, sondern auch mit dem Munde genießen wolle.
»Margot?«, sagte er. »Die Deutschen würden ›Gretchen‹ sagen oder Margarethe; das heißt, glaube ich, die Perle. Mademoiselle ist sicherlich eine Perle, und man muss dem Kapitän Sainte-Marie sehr danken, dass er dieses Juwel so tapfer verteidigt hat. Wo wohnen Sie, Mademoiselle?«
»Ich bin mit Mama Gast bei der Frau Baronin auf dem Meierhofe Jeanette bei Roncourt, Sire«, antwortete Margot.
Ney bemerkte, welchen sichtlichen Wohlgefallen der Kaiser an dem Mädchen fand. Er ließ daher das Licht der Laterne, welche er noch immer in der Hand hielt, voll auf Margot fallen. Napoleons Auge ruhte mit Bewunderung auf ihrer herrlichen Gestalt; sein Auge leuchtete erregt. Er fragte: »Ah, Roncourt! Liegt der Meierhof nahe bei dem Orte?«
»Nicht sehr fern.«
Er wandte sich rasch an Ney, um sich zu erkundigen: »Marschall, sagten Sie nicht, dass Drouet sein Hauptquartier nach Roncourt gelegt habe?«
»Ja, Sire«, antwortete der Gefragte. »Sein Hauptquartier ist in Roncourt; sein Stab liegt dort; er selbst aber auf dem Meierhofe Jeanette.«
»Also bei Ihnen, Baronin?«, fragte Napoleon rasch.
»Ja, Majestät. Ich habe die Ehre, die Wirtin des Herrn Generals zu sein.«
Da sah Napoleon zu Boden, warf nachher einen raschen Blick auf Margot und fragte: »Ist der Meierhof ein bedeutendes Gebäude?«
»Man könnte ihn ein Schloss nennen, Sire.«
»Es sind zahlreiche Wohnungen da?«
»Gewiss. Der frühere Besitzer liebte gesellschaftliche Vergnügen; er sah sehr oft viele Gäste bei sich, und sein Haus reichte zu, sie alle aufzunehmen.«
»So kommt es Ihnen auf einen Gast mehr oder weniger nicht an?«
»Gewiss nicht.«
»Selbst wenn ich es bin, der Sie um Gastfreundschaft ersucht?«





























