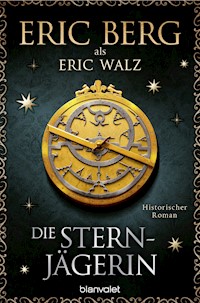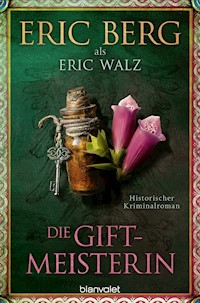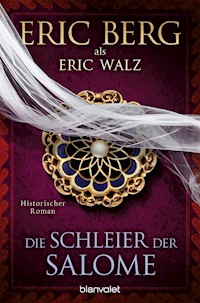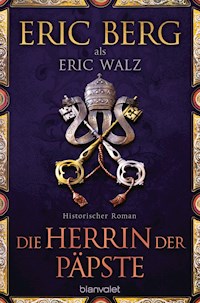9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Doro Kagel
- Sprache: Deutsch
Ein ermordetes Mädchen, ein freigesprochener Täter, ein Dorf in Aufruhr ... Der neue Küstenkrimi mit Doro Kagel
Frühsommer: Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, angeklagt des Mordes an einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trenthin, wird freigesprochen. Er und seine Familie hoffen, damit sei nun endlich alles überstanden. Doch im Dorf herrscht Misstrauen, nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. Dann wird erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden …
Spätsommer: Schockiert steht die Journalistin Doro Kagel vor den Ruinen eines ausgebrannten Hauses in Trenthin. Vor Monaten hatte Bettina Simonsmeyer sie inständig gebeten, ebenso ausführlich über den Freispruch ihres Mannes zu berichten wie zuvor über den Mordprozess. Doro hatte abgelehnt. Nun hat die Familie einen schrecklichen Blutzoll bezahlt. Von Schuldgefühlen geplagt beginnt Doro, den Fall neu aufzurollen …
Doro Kagel ermittelt in:
Das Nebelhaus
Die Mörderinsel
Beide Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 564
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Frühsommer: Der Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer, angeklagt des Mordes an einer jungen Frau aus seinem Heimatdorf Trenthin auf Usedom, wird freigesprochen. Er und seine Familie hoffen, damit sei nun endlich alles überstanden. Doch im Dorf herrscht Misstrauen, nur wenige glauben an die Unschuld des Hoteliers. Dann wird erneut ein junges Mädchen ermordet aufgefunden.
Spätsommer: Schockiert steht die Journalistin Doro Kagel vor den Ruinen eines ausgebrannten Hauses in Trenthin. Vor Monaten hatte Bettina Simonsmeyer sie inständig gebeten, ebenso ausführlich über den Freispruch ihres Mannes zu berichten wie zuvor über den Mordprozess. Doro hatte abgelehnt. Nun hat die Familie einen schrecklichen Blutzoll bezahlt. Von Schuldgefühlen geplagt beginnt Doro, den Fall neu aufzurollen.
Autor
Eric Berg zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. 2013 verwirklichte er einen langgehegten schriftstellerischen Traum und veröffentlichte seinen ersten Kriminalroman »Das Nebelhaus«, der 2017 mit Felicitas Woll in der Hauptrolle der Journalistin Doro Kagel verfilmt wurde. Seither begeistert Eric Berg mit jedem seiner Romane Leser und Kritiker aufs Neue und erobert regelmäßig die Bestsellerlisten. In seinem neusten Kriminalroman »Die Mörderinsel« ermittelt Doro Kagel in ihrem zweiten Fall.
Von Eric Berg bereits erschienen
Das Nebelhaus (Doro Kagel 1) · Das Küstengrab · Die Schattenbucht · Totendamm · So bitter die Rache · Die Mörderinsel (Doro Kagel 2)
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ERIC BERG
Die Mörderinsel
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Limes Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: mauritius images (Bildagentur-online/McPhoto-Kerpa/Alamy; Westend61/Pure.Passion.Photography)
WR · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16921-3V001
www.limes-verlag.de
Für Anna und Micha
»Die Schlauheit des Fuchses ist genauso mörderisch wie die Brutalität des Wolfes.«
Thomas Paine, angloamerikanischer Philosoph
1
Noch 34 Tage bis zum zweiten Mord
»Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Auslagen des Angeklagten hat die Staatskasse zu tragen. Bitte setzen Sie sich.«
Wie ein Fallbeil sausten die Worte durch die Luft, grell und scharf, und beendeten, nein, töteten mit einem einzigen Schnitt. Sie töteten das Ungeheuer – so hatte Bettina den Prozess gegen Holger getauft. Das Ungeheuer hatte ihr fast ein Jahr lang den Mann genommen, den Schlaf geraubt, es hatte ihre wirtschaftliche Existenz, ihren guten Namen, die Zukunft ihrer Familie bedroht. Daher mischte sich in den Sekunden nach dem Urteilsspruch in die Erleichterung, die Dankbarkeit und die Freude, die wohl jeder an Bettinas Stelle empfunden hätte, auch eine finstere Genugtuung über das elende Ende des Ungeheuers.
Vorbei, dachte sie, es ist vorbei! Sofort sprudelte der Gedanke in die Welt, wurde hör- und sichtbar, als sie die Arme in die Höhe reckte, zur Bank des Angeklagten lief und gleich danach ihren Mann an sich drückte.
»Holger, es ist vorbei! Wir haben es geschafft.«
»Ja, wir haben es geschafft«, wiederholte er lächelnd.
Gefühlsausbrüche waren nicht seine Art, daran war sie nach fünfzehn Jahren Ehe gewöhnt, und es machte ihr nichts aus. Aber dieses eine Mal fand sie es schade, dass Holger immer gefasst, immer ausgeglichen war.
»Ich bin so froh, so unfassbar glücklich. Holger, Holger, Holger«, wiederholte sie seinen Namen wie eine Beschwörungsformel. Dann fiel ihr Finn ein, ihr Sohn, den sie zu sich rief und an dem sie sich festhielt, während er seinem Vater die Hand gab.
»Glückwunsch, Papa. Aber eigentlich Formsache, oder? Die Freaks mussten dich freisprechen. Alles andere wäre ein Skandal gewesen.«
Bettina wischte sich die Tränen aus den Augen, und dabei fiel ihr Blick auf die erfahrene Staatsanwältin, eine Frau Ende fünfzig, Anfang sechzig im schicken dunkelblauen Kostüm. Während des Prozesses hatte Bettina ihr kaum Beachtung geschenkt, war ihren Ausführungen ferngeblieben. Sie hatte all die Lügen über Holger, die mühsam konstruierten Fantastereien des Polizei- und Justizapparats nicht hören wollen.
Die Staatsanwältin war monatelang das Gesicht des Monsters gewesen, und Bettina hätte allen Grund gehabt, den Triumph ihr gegenüber am deutlichsten zu zeigen. Doch seltsamerweise geschah genau dies nicht. Alles, was Bettina im Gesicht dieser Frau las, war Entsetzen, ehrliches, ungläubiges Entsetzen, mit dem sie zur Richterbank blickte. In diesem Moment wurde Bettina klar, dass es mindestens einen Menschen auf dieser Welt gab, der allen Ernstes fest daran glaubte, dass ihr geliebter Holger ein grausamer Mörder war. Bisher war sie davon ausgegangen, dass die Polizei, und später die Staatsanwaltschaft, mehr aus Verlegenheit gegen Holger vorgingen, weil sie keinen Besseren gefunden hatten und deshalb ein paar lose Indizienfäden zu einem irrsinnigen Gespinst zusammenwoben. Ihrer Meinung nach glaubten die Vertreter des Staates gar nicht an den eigenen Unfug und hätten den Freispruch daher mit einem bedauernden Achselzucken abtun müssen. Doch die Staatsanwältin war kein junges, hungriges Ding mehr, das sich einen Namen machen wollte. Sie stand kurz vor der Pensionierung, hatte schon Hunderte Fälle gewonnen, Dutzende verloren, und doch wirkte sie aus allen Wolken gefallen. Ihr Blick schien den vorsitzenden Richter zu fragen: Was soll das? Wie können Sie nur? Und er schien ihr auf demselben Weg zu antworten: Sehen Sie nicht mich an. Ich wollte ja, aber …
»Bitte nehmen Sie Platz für die Urteilsbegründung«, sagte er, zunächst an den ganzen Saal und dann noch einmal an Bettina und ihren Sohn gewandt. Die drei Richter und zwei Schöffen ließen sich nieder.
Leicht irritiert, schon fast ernüchtert, ging sie zurück zu ihrem Platz. Im Saal war es nun mucksmäuschenstill, die Zuschauer murrten weder noch applaudierten sie. Ein paar junge Leute, Studenten vermutlich, legten sich Zettel und Stift auf die übereinandergeschlagenen Beine, um sich Notizen zu machen. Noch bevor der vorsitzende Richter mit seinen Ausführungen begann, durchstieß ein einzelnes verzweifeltes Schluchzen die Stille.
Die Eltern der ermordeten jungen Frau, um die es bei diesem Prozess ging – gegangen war! –, saßen nur wenige Stühle entfernt. Genau wie Bettina hatten sie keinen Verhandlungstag versäumt, nur dass sie den Ausführungen der Staatsanwaltschaft naturgemäß aufmerksamer gefolgt waren als denen von Holgers Verteidiger. Bettina hatte die räumliche Nähe zu den Illings stets als unangenehm empfunden, und umgekehrt war es dem Ehepaar sicherlich nicht anders ergangen. Man hatte sich immer mit einem kurzen Nicken begrüßt und war sich ansonsten aus dem Weg gegangen. Mit Äußerungen während des Prozesses hatten sich beide Parteien zurückgehalten. Sowohl Bettina als auch Frau Illing waren als Zeuginnen aufgerufen worden, und Bettina musste zugeben, dass Frau Illing bewundernswert sachlich geblieben war, sobald es bei der Befragung um Holger ging, und nur dann emotional wurde, wenn die Sprache auf ihr totes Mädchen kam – was allzu verständlich war.
Die Urteilsverkündung brachte dieses aus Höflichkeit gebaute Konstrukt zum Einsturz. Hier der deutlich gezeigte Triumph, dort die furchtbare, immer noch ungesühnte Tragödie und dazwischen ein Raum voll Akademiker und Journalisten, für die dieser Fall entweder ein Studienobjekt oder eine Meldung war – diese Spannung war einfach nicht mehr auszuhalten. Der Richter hatte erst ein paar Sätze gesprochen, als Mareike Illing sich laut wimmernd an die Brust ihres Mannes warf, was dieser nur wenige Momente aushielt, ehe er aufsprang und mit dem Finger auf Holger zeigte. Sein Mund öffnete sich, als würde gleich ein gewaltiger Schrei, ein böser Fluch daraus entweichen. Doch kein Laut kam ihm über die Lippen. Stattdessen rann ihm eine einzelne Träne über die Wange. Sie tropfte zu Boden mit dem Gewicht seines stummen Vorwurfs.
Betroffen senkte Bettina den Blick und bemerkte, dass sie sich den linken Zeigefinger blutig gekratzt hatte. Jene Bilder kamen wieder in ihr hoch, die sie beharrlich zehn Monate lang erfolgreich verdrängt hatte. Es waren dieselben Bilder, die sicherlich auch die Eltern des toten Mädchens unentwegt verfolgten, beim Einschlafen und Aufwachen, beim Warten an einer roten Ampel, im Supermarkt, beim Essen. Die Fotos aus den Medien wurden angereichert durch die eigene Fantasie, die sich wiederum aus Kriminalfilmszenen speiste, immer wieder unterbrochen von den Erinnerungen an eine fröhliche, hübsche, vor Tatendrang strotzende junge Frau, die es nun nicht mehr gab. Ein Schnitt von links nach rechts, an ihrer Kehle entlang, ausgeführt von hinten, überraschend, entschlossen und tief, hatte ihr Leben binnen einer Sekunde ausgelöscht. Röchelnd ging sie zu Boden, mit zuckenden Gliedern, die Augen weit aufgerissen, benetzte Laub und Farn mit ihrem Blut.
Einige Tropfen liefen über Bettinas Fingerkuppe, doch sie war außerstande, ein Taschentuch hervorzuholen. Voller Entsetzen und Mitleid wanderte ihr Blick zu den Illings, schnellte zurück zu ihrem pulsierend schmerzenden Finger, wurde erneut angezogen von dem Elend, das nur wenige Meter weiter aus zwei Menschen herausbrach.
Der vorsitzende Richter schritt ein, und nachdem sich die Gemüter dank der Gerichtsdiener beruhigt hatten, empfahl er dem Ehepaar, den Saal zu verlassen, was die beiden auch taten.
Bettina sah ihnen hinterher. Wie würde es ihr ergehen, wenn sie an Stelle der Illings wäre? Konnte man inmitten von Leid und Wut überhaupt noch klar denken? Ernüchtert stellte sie fest, dass es unmöglich war, sich in die Lage der Illings zu versetzen, auch wenn man es noch so sehr versuchte.
Bettina bemühte sich gar nicht erst, der seitenlangen Urteilsbegründung des vorsitzenden Richters zu folgen. Dazu war sie viel zu erregt, und das Juristendeutsch machte die Sache nicht besser. Seltsamerweise hörte sie die Ausführungen wie durch einen Schleier, wohingegen ihre übrigen Sinne wie von einem Schleifstein frisch geschärft waren. Tausend Dinge nahm sie auf einmal wahr, die ihr während der vielen Prozesstage entgangen waren: die Täfelung des Gerichtssaals, das Holzkreuz an der Wand, das Wappen von Mecklenburg-Vorpommern, die Bundesflagge, die weiten Roben der Richter.
Wie vor einer Prüfungskommission hatte sie die Tage und Stunden bei Gericht erlebt, ganz fokussiert auf die Hoffnung, alles werde gut ausgehen. Nun fragte sie sich, wer von den drei Richtern und zwei Schöffen der großen Strafkammer des Landgerichts wohl gegen ihren Mann gestimmt hatte? Seinem Gesichtsausdruck nach zumindest der Vorsitzende. Wie knapp war die Abstimmung ausgefallen? Hatten die beiden Schöffen, ein Mann und eine Frau wie du und ich, für Holger votiert? Der eine sah aus wie ein Sozialarbeiter, die andere wie eine Supermarktkassiererin – das waren natürlich nur Klischees, aber Bettina war total aufgedreht von ihren Gedanken und Gefühlen, die sie nicht alle mochte und von denen einige ihr sogar Angst machten.
Die Tragödie der Illings war furchtbar, und als Mutter verstand sie nur zu gut ihre Verzweiflung. Aber scherte sich in diesem Saal irgendjemand auch nur einen Deut um ihre eigene Verzweiflung? Wie sie sich herausgewunden hatte, wenn Stammgäste des Hotels fragten, wo denn Holger sei und wie es ihm gehe. Und dann die Blicke derer, die von Holgers Inhaftierung wussten: der anderen Kunden beim Bäcker, der Kassiererin im Supermarkt, des Paketboten, von Spaziergängern … Überall Blicke, mitleidige, skeptische, irritierte, verstohlene, anklagende, durchdringende Blicke, denen man entweder widerstehen oder unterliegen konnte. Es war ebenso beschämend wie anstrengend, die Ehefrau eines vermeintlichen Mörders zu sein, selbst wenn ihm die Medien immer brav das Adjektiv »mutmaßlich« zubilligten.
Bettina schloss die Augen. Die Welt um sie herum erlosch. Sie atmete tief durch, versuchte, die Hände ruhig zu halten, versuchte, nicht zu weinen vor Freude, versuchte, sich nicht vom Glück überrollen zu lassen. Als sie die Augen wieder öffnete, beendete der Richter gerade die Urteilsbegründung.
»Holger Simonsmeyer ist umgehend auf freien Fuß zu setzen. Die Verhandlung ist geschlossen.«
Geschlossen.
Während Holger noch einige Formalitäten mit seinem Rechtsanwalt erledigte, wartete Bettina mit Finn auf dem Flur vor dem Gerichtssaal. Die Illings waren zum Glück schon gegangen, die Staatsanwältin war mit fassungslosem Blick an ihr vorbeigerauscht, und auch die meisten Jurastudenten hatten, munter diskutierend, das Gebäude verlassen. Nur ein paar Medienvertreter lungerten noch herum, kritzelten ihre Blöcke und Notebooks voll, riefen die verpassten Handynachrichten ab oder reservierten Tische fürs Mittagessen in angesagten Rostocker Fischrestaurants. Die meisten Gesichter kamen Bettina aus dem Gerichtssaal bekannt vor, einigen Reportern hatte sie zu Beginn des Prozesses kurze Interviews gegeben; zwei, drei Antworten, in denen sie den Fragenden ihren unerschütterlichen Glauben an Holgers Unschuld diktiert hatte.
Nur eine Journalistin kannte Bettina etwas besser. Vor einigen Monaten hatte sie sich ihr für ein ausführlicheres Gespräch zur Verfügung gestellt. Ganz wohl war ihr zunächst nicht gewesen. Doch die Freie Journalistin, wie auf ihrer Visitenkarte stand, hatte einen guten Eindruck gemacht. Sie wirkte kompetent und verständnisvoll, nahm sich Zeit und wohnte sogar zwei Nächte in Bettinas und Holgers Hotel auf Usedom. Unter der Bedingung, dass weder ihr Name noch der des Hotels oder des Ortes in dem Artikel auftauchte, hatte Bettina kooperiert. Die Journalistin war mit Hotelangestellten ebenso ins Gespräch gekommen wie mit Bürgern aus dem Dorf. Dann reiste sie wieder ab, und Bettina vergaß das Ganze.
Als der Artikel schließlich erschien, hatte sie ihn dreimal lesen müssen, um sicherzugehen, dass sie keine Albträume hatte.
»Guten Tag, Frau Kagel. Sie erinnern sich an mich?«
»Natürlich, Frau Simonsmeyer. Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Finn, nicht wahr? Gratulation zum Freispruch Ihres Mannes und Vaters.«
Sie gaben sich die Hand.
»Danke«, erwiderte Bettina. »Ich muss Ihnen leider sagen, dass mich Ihr Artikel sehr unglücklich gemacht hat.«
»Oh. Das ist schade. Darf ich fragen …?«
»Allein der Umfang … sechs Seiten!«, unterbrach sie die Journalistin. »Und nicht etwa in einer Regionalzeitung, sondern in einem der bekanntesten deutschen Wochenmagazine. Sie haben sich zwar an die Absprachen gehalten, aber ich frage Sie: Wie viele Bettinas, deren Nachname mit S beginnt, gibt es schon auf Usedom? Und wie viele von denen wohnen in einem Dorf, dessen Anfangsbuchstabe ein T ist? Etwas wirklich Falsches haben Sie nicht geschrieben, das gebe ich zu. Sie haben halt sehr viel über Susann geschrieben, das Opfer, aber wissen Sie, wir sind auch Opfer, meine Familie und ich, vor allem mein Mann.« Sie holte tief Luft. »So, das musste einfach mal raus. Nichts für ungut. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel.«
Das war typisch für Bettina. Erst ging sie lange mit ihrem Frust spazieren und rang sich irgendwann dazu durch, Vorwürfe zu erheben, um sie im nächsten Atemzug selbst zu entkräften und sich schlussendlich zu entschuldigen. Bettina konnte einfach niemandem böse sein, weder Angestellten, die allzu oft die Snooze-Taste ihres Weckers benutzten, noch Lieferanten, die sich seltsamerweise immer zu Ungunsten der Kunden verrechneten. Im Nachhinein ärgerte sie sich stets, erneut nachgegeben und Verständnis geäußert zu haben, doch kurz darauf war alles wie gehabt.
Wenn sie ehrlich war, hatte es schlimmere Artikel über ihre Familie gegeben als den von Doro Kagel.
Bettina ging einen Schritt auf die Journalistin zu und berührte sie an der Schulter. »Ich hoffe sehr, dass Sie jetzt noch einen Artikel schreiben und den Freispruch meines Mannes kommentieren werden. Das sind Sie uns schuldig, finden Sie nicht?«
»Ich verstehe Ihre Sichtweise, Frau Simonsmeyer. Aber …«
»Sie werden natürlich keinen zweiten Artikel schreiben. Weil man ja jetzt auf niemanden mehr zeigen kann. Weil es plötzlich keinen Mörder mehr gibt. Und weil die Angehörigen eines brutal ermordeten Opfers mehr hermachen als die Angehörigen eines freigesprochenen Angeklagten. Als eine Ihrer Leserinnen würde es mir wohl genauso gehen, nur dummerweise lese ich die Geschichte nicht, sondern ich bin die Geschichte. Sehen Sie mir also bitte nach, dass ich anders darüber denke.«
»Natürlich«, antwortete Doro Kagel leicht irritiert.
Bettina fasste ihr an den Ellbogen. »Habe ich recht? Sie schreiben nicht mehr darüber.«
Die Journalistin wich zurück. »Ich finde, Sie haben die Gründe dafür gut zusammengefasst, Frau Simonsmeyer.« Damit wandte sie sich zum Gehen.
Vorbei. Das Wort schwebte über der Heimfahrt nach Usedom wie die Sonne, der sie entgegenfuhren. Ein Glück, dass gerade kein Wildschwein über die Straße rannte und die Strecke zumeist über gerade Alleen führte, die man schlafwandlerisch durchfahren konnte. Als Verkehrsteilnehmerin war Bettina an diesem Tag untauglich, denn sie war mit ihren Gedanken überall, nur nicht vor Ort.
»Hast du das Gesicht der Staatsanwältin gesehen, Holger, als das Urteil verkündet wurde? Der ist die Kinnlade heruntergefallen, dass es nur so gekracht hat. Geschieht ihr ganz recht.«
»Muss der Staat in solchen Fällen keine Entschädigung zahlen?«, fragte Finn.
Bettina jauchzte. »Ha! Ich habe mich schon erkundigt, die Summen sind echt lachhaft. Selbst wenn ich der verlorenen Arbeitszeit deines Vaters nur den Mindestlohn zugrunde lege, dann komme ich schon auf den doppelten Betrag, den die uns bewilligen wollen. Dass einem Hotelmanager wie dir, Holger, mehr als der Mindestlohn zusteht, steht ja wohl nicht zur Debatte. Also ehrlich, wir sollten dagegen klagen.«
»Ja, warum nicht?«, rief Finn. »Wir gehen bis vors Verfassungsgericht.«
»Dein Sohn hat recht. So dürfen die nicht mit uns Bürgern umspringen. Vierzigtausend Euro, so viel schulden die uns mindestens.«
Eine Stunde, die Bettina wie wenige Minuten vorkam, und gefühlt zehntausend Wörter später hatte sich ihr Zorn halbiert, und das ganze Thema war erledigt. Ihr war klar, dass es keine Klage geben würde. Holger war nicht der Typ dafür und sie selbst noch weniger. Dennoch hatte es gutgetan, darüber zu reden.
Ein Moment der Stille genügte, damit Bettina ein neues Thema fand.
»Die Journalistin, die diesen unsäglichen Artikel geschrieben hat, war auch da, und ich habe ihr gehörig die Meinung gegeigt.«
Holger lächelte kurz. Er war mit ihrer speziellen Art vertraut, anderen Leuten die Meinung zu geigen, und hatte sie schon oft damit aufgezogen.
»Diese Frau Kagel weigert sich, über den Freispruch zu schreiben. Zuerst war ich sauer, aber wenn ich es mir recht überlege, ist das eigentlich ein gutes Zeichen.« Sie wartete darauf, dass er sie fragte, von welchem Zeichen sie sprach. Sie wartete eine halbe Minute. »Du bist keine Story mehr. Wir sind keine Story mehr. Die Sache ist endlich und endgültig vorbei.«
Da war es wieder, dieses Wort, das ihr an diesem Tag honigsüß auf der Zunge lag. Vorbei.
Erneut wurde es ruhig im Auto, und wie immer hielt Bettina es nicht lange aus. Sie brachte Holger, was Hotel und Restaurant anging, auf den neuesten Stand, der sich allerdings nur wenig von dem einige Tage vor der Urteilsverkündung unterschied, ebenso von dem eine Woche, zwei Wochen, zwei Monate vorher … Die Stille hatte für sie etwas Beängstigendes. Vielleicht hing es mit dem Ende des Prozesses zusammen – oder mit dem Beginn eines ganz anderen Prozesses, denn sie hatte vor vier Tagen mit dem Rauchen aufgehört.
Mit aller Kraft kämpfte Bettina gegen die Tränen an, die ohne Vorwarnung in ihr aufstiegen – und verlor. Holger versuchte, sie in den Arm zu nehmen, aber sie bedeutete ihm, dass sie einen Moment allein sein müsse. Sie hielt an, ging ein paar Schritte um eine Pappel herum und gab Finn ein Zeichen, dass er nicht aussteigen solle, ehe sie kommentarlos mit geröteten, aber trockenen Augen auf den Fahrersitz zurückkehrte.
Als Holger fragte, ob er fahren solle, lehnte sie ab. Nur ungern war sie Beifahrerin, das war immer schon so. Es lag wohl daran, dass sie die Dinge gerne unter Kontrolle hatte. Genau deswegen – mal von allem anderen abgesehen – waren ihr die letzten zehn Monate auch unerträglich gewesen. Nicht anders, als wenn Holger gestorben wäre, war er ihr von einem Augenblick zum anderen genommen worden. Morgens hatten sie noch zusammen gefrühstückt, eine Stunde später holten sie ihn ab. Doch um einen toten Mann konnte man trauern, man konnte sich all die schönen Augenblicke mit ihm in Erinnerung rufen, um sich irgendwann auf sich selbst zu besinnen und über die Zukunft nachzudenken. Ein Mann im Gefängnis, noch dazu unter Mordverdacht, das war wie Klebstoff an den Füßen, der einen nirgendwo hingehen und an nichts anderes denken ließ.
»Du weißt ja gar nicht, wie schwer das alles für mich war«, blubberte es wie überkochende Milch aus ihrem Mund. Sie wollte es gar nicht aussprechen, es passierte einfach.
»Was hast du gesagt?«
»Ach, nichts.«
Ihr siebzehnjähriger Sohn begann: »Mama hat gesagt, dass es auch für sie …«
»Bitte nicht, Finn.« Ein kurzer Augenkontakt genügte, und er gab klein bei. Der Junge wusste, wie schwer es für sie gewesen war und umgekehrt, doch nur selten hatten sie den Fall thematisiert. Finn hatte seinen Fußball, sie ihre Arbeit – das war ihnen Gesprächsstoff genug gewesen.
Erneut wurde es beängstigend ruhig.
Holger war ganz anders als sie. Weder jetzt noch während der Untersuchungshaft hatte er wie jemand gewirkt, dem man den schwersten Vorwurf des Strafgesetzes zur Last legte. Allenfalls war er noch in sich gekehrter als sonst, und er wirkte erschöpft. Bettina hatte sich hingegen zehn Monate lang schrecklich aufgeregt. Von Erschöpfung war jedoch auch jetzt keine Spur, neben überschäumender Erleichterung empfand sie nur Wut und Empörung darüber, dass das Schicksal ausgerechnet ihrer Familie so hart ins Gesicht schlug.
Sag was, sag irgendetwas, dachte sie.
Holger redete weniger als andere Leute – weniger als Bettina sowieso –, doch das Gesagte hatte stets Hand und Fuß, so als entspringe es langem Nachdenken und tiefer Überzeugung. Er war immerzu konzentriert, fasste stets nur eine Sache an und brachte sie zu Ende. Auch darin unterschied er sich von ihr, die zwanzig Dinge anfing und an allen ein bisschen herumbastelte. Man musste sie beide nur ansehen und hätte fast alles über sie gewusst: sie zappelig und mit geröteten Augen hinter dem Steuer, er fast reglos auf dem Beifahrersitz, seine warme Hand in ihrem kalten Nacken, seine Augen so braun und kraftspendend wie zwei eichene Krücken, an denen sie sich aufrichtete.
Perfekt spiegelte Holgers Gesicht sein Wesen wider – geschmeidig, ohne Kanten, symmetrisch. Wie sehr sie sein Lächeln vermisst hatte, diese leichte Ironie auf seinen Lippen, mit der er sich über ihre Emotionalität, die Sprechdurchfälle, die Ruhelosigkeit und die vielen Wiederholungen amüsierte. Oft hatte allein dieses Lächeln es geschafft, dass sie innegehalten und mit Holger herzlich gelacht hatte.
»Ich bin froh, dass du wieder da bist«, sagte sie. Nach diesem Satz, so unscheinbar er auch war, fühlte sie sich deutlich besser, so als sei erst damit sichergestellt, dass alles wieder wie früher war.
Am Hotel angekommen, ging Holger nicht sofort ins Foyer, auch nicht ins benachbarte Cottage, in dem sie wohnten, sondern verharrte eine Minute vor dem Eingang. Gut Trenthin lag auf einem Hügel, links und rechts Mischwald, dazwischen eine Schneise von siebzig, achtzig Metern mit Pferdekoppeln, die den Blick auf Peenestrom und Achterwasser freigaben. Die Mischung aus Grasduft, spielenden Fohlen und dem Bodden, der mal wie geschmolzenes Blei, mal wie flüssiges Gold unter dem weiten Himmel Usedoms ruhte, war das Geheimnis, der Zauber, der die Ruhe suchenden Gäste wiederkommen ließ. Es gab schickere, aufregendere Orte auf Usedom, aber Bettina und Holger hatten damals voller Überzeugung entschieden, das ererbte Hotel im stillen Achterland weiterzuführen.
Bettina stammte nicht aus der Region, sie war in der Pfalz aufgewachsen. Doch die Landschaft hier, in der das Wasser allgegenwärtig war, wo es nach Schilf, alten Stegen und Bootsrümpfen roch, wo man keinen Spaziergang machen konnte, ohne auf das Meer, einen See oder einen Kanal zu stoßen, diese Landschaft hatte sie vom ersten Tag an in ihren Bann gezogen.
Und Holger ebenfalls. Wenn sie ihn in diesem Augenblick betrachtete, während sein Blick über die Landschaft schwebte und er eine Buchecker vom Boden aufhob, die er langsam öffnete und aß, dann war sie nicht nur in ihren Mann verliebt. Sie war auch in seine Gesten verliebt, in seine Haare und die Art, wie er sich kleidete, halb Junge vom Land und halb Landedelmann, bodenständig, mit einem Touch zum Eleganten. Sie hatte seinen Stil kopiert, damit sie auch optisch perfekt zusammenpassten.
Im Foyer, zugleich Café und Bar, hatte sich nichts verändert. Es war ganz und gar Holgers Schöpfung. Wie eine Gralswächterin hatte Bettina seit seiner Verhaftung über die stilvoll-legere Melange gewacht, die sich in jedem Detail ausdrückte. Natürlich war ihr gar nichts anderes übriggeblieben, als am laufenden Band Entscheidungen zu treffen, angefangen damit, welches Begrüßungsherzchen sie aufs Kopfkissen legen sollte bis hin zur Ausgestaltung des Wellnessbereichs. Allerdings hielt sie sich nicht für besonders talentiert, ein Hotel zu leiten, zu schnell wurde sie unruhig, wenn ein Plan nicht aufging. Die Übersicht verlor sie dagegen nie, ganz einfach deshalb, weil sie keine Übersicht hatte.
Das war ihr weder in die Wiege gelegt noch anerzogen worden. Ihrem Vater, einem Physikprofessor, war die Ordnung des Universums stets weit wichtiger gewesen als die Ordnung zu Hause, und ihre Mutter war bereits damit überfordert, einen Terminkalender zu führen. Ihre Eltern waren sehr herzliche Menschen – auf ein Leben an der Seite eines besonnenen, vorausschauenden Unternehmers hatten sie Bettina jedoch nicht vorbereitet.
Für Holgers Heimkehr war sie über sich selbst hinausgewachsen und hatte alles picobello herrichten lassen, ein i-Tüpfelchen ans andere gereiht. Aus unsichtbaren Lautsprechern tröpfelte Wohlfühlmusik, neue Deckenventilatoren verbreiteten den Duft frischer Blumensträuße, und die Hotelgäste saßen eingesunken in von Bettina ausgewählten Designersesseln bei Longdrinks und Prosecco. Die Keramiken und aus Schilfrohr gefertigten Skulpturen einer ortsansässigen Künstlerin hatte noch Holger ausgesucht. Alles zusammen prägte den Saal, dessen Eleganz mit der Schlichtheit der Region korrespondierte.
Durch das Foyer rannte ihr jüngerer Sohn Patrick auf seinen Vater zu und stürzte sich in seine Arme. Der Rezeptionist begrüßte Holger mit ausgestreckter Hand und einem formvollendeten Glückwunsch zum Freispruch, gerade so laut, dass es nicht genuschelt und trotzdem für die Gäste unhörbar war. Neugierige Fragen waren das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnten. Er war ein erfahrener Hotelangestellter, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt hatte und seit vierzig Jahren ausübte, trotzdem bemerkte Bettina den Zweifel in seinen Augen, ob er nicht gerade einem Mörder die Hand schüttelte.
Wie ein Blitz traf sie die Angst, dass ein solcher Zweifel aus ihrem tiefsten Innern irgendwann auch in ihre Augen wandern könnte.
Das lasse ich nicht zu, dachte sie mit einer Entschiedenheit, dass sie einen Moment lang nicht wusste, ob sie den Satz laut ausgesprochen hatte.
Energisch stellte sie sich der Angst entgegen.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei.
Am liebsten hätte sie sich auf der Stelle eine Zigarette angezündet. Stattdessen tat sie, was sie sonst nie tat. Vor den Augen des Personals, ihrer Söhne und einiger Gäste umarmte sie ihren Mann und küsste ihn.
Einige Monate später, September
Ich stand vor Trümmern, und dies gleich in zweifacher Weise. Die einen waren physisch, unübersehbar lagen sie mir schwarz und stinkend zu Füßen. Die sieben steinernen Stufen zum Eingang waren so gut wie das Einzige, was von dem Gebäude intakt geblieben war. Das alte Fachwerkhaus, in dem bis vor einhundert Jahren die Bediensteten der Gutsherren untergebracht waren, hatte in der Stunde seines Endes vier Menschen mit in den Tod genommen. Etwa ein halbes Jahr zuvor war ich an diesem Ort zum ersten Mal auf Bettina Simonsmeyer getroffen. Genau an der Stelle, wo wir uns zur Begrüßung und zum Abschied die Hand gegeben hatten, verlief nun das Absperrband der Feuerwehr.
Ich ignorierte es, tauchte darunter hindurch und befand mich mitten in der Hölle. Über mir verkohlte Holzbalken, die nichts mehr zusammenhielten, vor mir ein entzweites Treppengeländer, auf dem vielleicht jemand in die Tiefe gestürzt war. Hier ein Handy, mit der Hülle verschmolzen, dort eine Programmzeitschrift, in der jemand eine Dokumentation über die Bretagne angekreuzt hatte und nicht mehr dazu gekommen war, sie anzuschauen. Jeder Gegenstand bekam in diesem erloschenen, erstarrten Inferno eine tragische Note – der zerplatzte Fußball mit den Unterschriften darauf ebenso wie die von Brandlöchern übersäte Spitzenbluse oder der selbstgebastelte Pferde-Bildband mit der Widmung: »Für Papa von Patrick – alles Gute zum Geburtstag.«
An die Einrichtung des Cottages, wie die Familie Simonsmeyer ihr Haus nannte, konnte ich mich noch gut erinnern. Es kam tatsächlich meiner Vorstellung von einem englischen oder irischen Landhaus nahe. Sehr gemütlich, gedeckte Farben, ein Karomuster hier und da …
Ein Windstoß wirbelte Asche auf und trieb sie in meine Richtung. Instinktiv wandte ich mich ab, um meine Augen zu schützen, in Wahrheit wohl eher angeekelt von der Vorstellung, welche Überreste sich da gerade in meinen Haaren verfingen. Das Lieblingsbuch eines der Opfer oder ein Kissen zum Knuddeln?
Ich streifte die Asche von den Armen. Wenn es nur genauso leicht gewesen wäre, die Selbstvorwürfe abzustreifen, die mich inmitten dieser Zerstörung noch stärker plagten als in den Tagen zuvor.
»Sie dürfen sich hier nicht aufhalten«, sagte eine Stimme aus dem Off.
Ich drehte mich in alle Richtungen, aber da war keiner. Wieder wirbelte der Wind Asche auf, eine graue Wolke stob um den Ziegelkamin herum, der früher in der Mitte des Wohnzimmers gestanden hatte. Ein Mann kam dahinter hervor.
Ich blinzelte. Wer auch immer das war, einen theatralischeren Auftritt konnte man nicht hinlegen.
»Falls Sie den Wind unter Kontrolle haben«, rief ich ihm noch immer blinzelnd zu, »könnten Sie ihm bitte befehlen, sich zu beruhigen?«
Er kam näher. »Es wird meine Vorgesetzte freuen, dass Sie unserer Behörde so viel Macht unterstellen.« Als er direkt vor mir stand, sagte er: »Was tun Sie hier?«
In meinem Job ist man besser darin, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. »Wer sind Sie?«
Dem Körperbau nach zu schließen, gehörte er einer Soko der Polizei an, und dem hellgrauen Anzug, dem nachtblauen Hemd und der karminroten Krawatte nach in eine höhere Charge. Er war knapp einen Meter fünfundachtzig groß, etwa so alt wie ich und hatte nur noch ein paar Haare auf dem Kopf, die einen Millimeter lang waren. Ich fand, mit diesen Augen und dem Kinn hätte er glatt einen toughen Fernsehkommissar abgeben können.
Statt eines Dienstausweises überreichte er mir eine Visitenkarte.
»Carsten Linz, Staatsschutz«, murmelte ich. »Das heißt, die Generalbundesanwältin in Karlsruhe hat den Fall an sich gezogen?«
»Die Pressemitteilung ist vor einer Stunde raus.«
Bereits einen Tag nach dem Brand bei den Simonsmeyers war der vorläufige Bericht der Feuerwehr durch alle Medien gegangen. Man hatte Brandbeschleuniger am Tatort gefunden. Es handelte sich also um ein Verbrechen, und da der Staatsschutz sich eingeschaltet hatte, ging es vermutlich um mehr als einfache Brandstiftung.
»Sie vermuten demnach ein staatsgefährdendes Delikt? Lynchjustiz? Wutbürger?«
»Alles, was Sie da aufzählen, wäre geeignet, einen Anschlag auf die Grundfesten der Bundesrepublik darzustellen. Aber Sie müssen zugeben, dass Sie sehr viel mehr von mir wissen als umgekehrt.«
»Ja, das gebe ich zu.« Ich überreichte ihm meinerseits eine Visitenkarte. »Presse.«
»Wie überraschend«, entgegnete er ironisch. »Und ich dachte, Sie wären eine normale Gafferin. Dabei sind Sie eine mit Lizenz.«
Ich atmete tief durch. »O ja, ich war ein böses Mädchen und habe das Absperrband der Feuerwehr ignoriert.«
»Ich kenne Sie irgendwoher. Doro Kagel, Doro Kagel. Aus dem Fernsehen. Sie tingeln regelmäßig durch die Talkshows.«
»So wie Sie das ausdrücken, hört es sich an, als ginge ich auf den Strich.«
»Dies ist ein freies Land. Sie dürfen gehen, auf was Sie wollen. Hauptsache, Sie machen dabei nichts kaputt.«
»Verlassen Sie das Haus immer ohne Ihren Charme?«
»Meinen Charme habe ich in einer Kiste im Keller eingelagert und lasse ihn nur einmal im Jahr zu Weihnachten raus. Wollen wir zusammen essen?«
Mir verschlug es drei Sekunden lang die Sprache. »Natürlich nicht. Ich bin verheiratet«, sagte ich, was ich gleich danach ein bisschen blöd fand.
Er wohl auch, denn er erwiderte: »Ich bin mir nicht bewusst, Ihnen einen Heiratsantrag gemacht zu haben. Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich Ihren Namen nicht bloß aus dem Fernsehen, sondern auch aus den Ermittlungsakten kenne, und ich dachte, in einem Restaurant spricht es sich besser als in einer rauchenden Ruine.«
Ich vermied es, auf sein Angebot einzugehen, nicht etwa, weil ich keinesfalls mit ihm in einem Restaurant sitzen wollte. Vielmehr wollte ich das Gespräch nur schnellstens hinter mich bringen.
»Ich stehe in den Ermittlungsakten, weil mich Frau Simonsmeyer zwei Tage vor ihrem Tod angerufen hat.«
»Bettina Simonsmeyer?«
»Ja. Sie hat sich bedroht gefühlt und …«
»Von wem?«
»Namen hat sie, glaube ich, keine genannt. Sie hat von Leuten aus dem Dorf gesprochen …«
»Welchen Leuten?«
Ich weiß es nicht. Sie hat eine Minute lang ohne Punkt und Komma geredet. Ich bin fast überhaupt nicht zu Wort gekommen.«
»Mich interessiert nicht weiter, was Sie erwidert haben, Frau Kagel, sondern was Frau Simonsmeyer gesagt hat. In einer Minute wird man eine Menge Information los. Sie muss doch in irgendeiner Weise konkret geworden sein.«
»Das habe ich alles schon den Herren von der Kripo erzählt. Sie wurde nicht konkret, zumindest erinnere ich mich nicht.«
»Das Telefonat war vor vierzehn Tagen, nicht vor vierzehn Jahren.«
»Was ich meine, ist, dass ich nicht … nicht …«
»Was?«
»Nicht richtig … hingehört habe.«
»Sie haben ihr nicht zugehört?«
»Ich weiß, wie das klingt, aber …«
»Ich weiß auch, wie das klingt. Eine verzweifelte Frau ruft Sie an, eine Person, die Sie kennen und die wenige Wochen zuvor ihr Innerstes vor Ihnen ausgebreitet hat. Jemand, von dessen Informationen Sie sehr profitiert haben, nehme ich an.«
»Ja.«
»Angeklagt im Paradies«, zitierte Linz den Titel meines Artikels über den Fall Simonsmeyer.
»So ist es.« Ich vermochte seiner Stimme nicht zu entnehmen, ob da Ironie mitschwang, und auch ein kurzer Blick in sein Gesicht half mir nicht weiter. Stand der Titel einfach nur in den Akten? War die ganze Reportage beigefügt? Oder hatte er sie gelesen, als sie Ende Januar in einer Auflage von mehr als einer Million Exemplaren erschienen war?
Angeklagt im Paradies. Ich war sechs Monate zuvor genau dort, wo ich nun stand, auf der Schwelle des Simonsmeyer-Hauses, darauf gekommen, und zwar gleich nachdem ich aus dem von behaglichem Kaminfeuer erwärmten Wohnzimmer in die windstille Kälte getreten war. Einen schöneren Januartag konnte es in diesen Breiten nicht geben – verzaubert von einer weißen Sonne, die starr über dem milchig schimmernden Bodden schwebte, starr wie ein Gemälde, von dem man die Augen nicht abwenden konnte. Mir war noch warm vom Früchtetee, mit dem die Hausherrin mich bewirtet hatte, und der Geschmack des Kandis lag mir noch im Mund. Es war still. Ein paar Möwen schrien, das war alles. Nirgendwo ein Windrad oder ein Strommast, der daran erinnerte, dass wir das einundzwanzigste Jahrhundert schrieben. Zwischen den kahlen Ästen schimmerte eisblau das einstige Gutshaus, das die Simonsmeyers als Hotel führten. Stolz und nobel, familiär und heimelig ruhte es zwischen den Stallungen, den winterlichen Weiden und Wassern.
Angeklagt im Paradies. Meine Augen suchten den Apfelbaum mit dem Vogelhäuschen, fanden jedoch nur den verkohlten Stamm.
Bei meinem ersten Besuch hier kam der jüngere Sohn der Simonsmeyers hinter mir aus dem Haus gerannt, sagte »Hallo«, streute Sonnenblumenkerne und Haferflocken in das Häuschen und hängte einen Knödel dazu. Anschließend rief er mir ein fröhliches »Tschüss« zu und schloss glücklich die Tür. Ich glaube, das war der Moment, als ich mir ein paar Sekunden lang wünschte, der Vater des Jungen würde freigesprochen.
»Und Sie haben Bettina Simonsmeyer nicht zugehört, als sie Sie nach dem Prozess noch mal anrief?«
»Sie hatte einfach einen blöden Moment erwischt, okay?«, blaffte ich, entfernte mich ein paar Schritte von ihm und wandte mich ab, da ich mit den Tränen rang. Dreckig und nackt, so fühlte ich mich. Wie eine ertappte Kaufhausdiebin, nur zehnmal so schlimm. Man schaute auf mich. Man schüttelte den Kopf. Man zeigte mit dem Finger auf mich.
»Wir haben etwas gemeinsam«, sagte Linz, und als ich ihm einen befremdeten Blick zuwarf, ergänzte er: »Wir sind beide hier, weil wir unserer inneren Stimme gefolgt sind.«
Eine halbe Stunde später saßen wir in einem Imbiss am Ostseestrand in Bansin. Mein Mittagessen bestand aus einer Tasse Cappuccino, seines aus einer lokalen Spezialität, zwei Rauchwürsten, die er mit der Hand aß, sowie einem alkoholfreien Insel-Bier, mit dem er die Würste hinunterspülte. Um uns herum herrschte reges Treiben, denn der Septembertag war mild.
Ich lächelte. Seit jeher war mir die Hochsaison verhasst, wenn sich an den Stränden Europas von Schweden bis Portugal die Menschen drängten. So sehr ich den Hoteliers, Gastronomen und Ladenbesitzern diese Phase gönnte, in der sie sich die Taschen füllen konnten, um die kargeren Monate zu überstehen, so wenig trug ich selbst dazu bei. Mich im Juli oder August in Urlaub zu schicken, wäre eine Strafe, keine Erholung. Der September hingegen war mein Monat. Die größte Hitze war vorüber, aber es war noch nicht kühl, das Licht war schon leicht blässlich, doch noch nicht herbstlich, die Küsten und Landschaften waren nach wie vor belebt, jedoch nicht mehr überfüllt. Fast überall bekam man einen Platz, auch ohne zu reservieren, die Preise fielen leicht, und in den Hotels atmete das Servicepersonal auf und widmete sich den Gästen mit größerer Aufmerksamkeit. Doch verglichen mit Trenthin war Bansin sogar im September ein Rummelplatz.
Meines Erachtens bestand Usedom im Grunde aus drei Inseln. Nicht im geografischen Sinn, natürlich. Die Orte an der Ostseeküste von Peenemünde bis zur polnischen Grenze bei Ahlbeck waren im Sommer quirlig und vergleichsweise mondän – Seebäder eben, denen die Gemütlichkeit trotz des Touristenansturms zum Glück nicht verloren gegangen war. Besonders die drei »Kaiserbäder« Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck präsentierten sich herausgeputzt. Entfernte man sich allerdings von der Küste und fuhr ein paar Kilometer nach Süden ins sogenannte Achterland, war man in einer anderen Welt. Die Landschaft war besprenkelt mit Waldschlösschen, alten Steinhäusern, idyllisch gelegenen Gehöften, Mühlen, schilfgesäumten Kanälen sowie Mohn- und Rapsfeldern, an denen man auf scheinbar endlosen Alleen vorbeiglitt. Die Küsten des Achterlandes waren der offenen See abgewandt, und die Wasser dieses Boddens waren glatt und friedlich, sie rochen grasig, erdig und schwer.
Die »dritte Insel« bestand aus dem Lieper Winkel, benannt nach der Ortschaft Liepe. Alles, was man am Achterland schätzte, war auch dort reichlich vorhanden. Doch die Gezeiten und die Zeit hatten es so gewollt, dass der Lieper Winkel sich von der übrigen Insel fast abgelöst hatte und wie eine große grüne Blase in den graublauen Bodden ragte. War das Achterland ländlich, so war der Lieper Winkel abgeschieden, war das Achterland malerisch, so war der Lieper Winkel romantisch. Bei Spaziergängen kam man an Katen vorbei, vor denen die Fischer ihre Netze zum Trocknen spannten. Vor einsam gelegenen Reetdachhäusern wuchsen riesige Hortensienbüsche, und man wäre kaum überrascht gewesen, hätte die Goldmarie aus dem Fenster gewunken. Die Waldwege waren noch idyllischer, die Obstbäume noch älter, die umherwandernden Störche noch zahlreicher als anderswo auf der Insel.
Und genau dort waren binnen eines Jahres sechs Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben – zwei hatte man mit durchtrennter Kehle im Wald gefunden, vier waren einem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Einige deutsche Medien hatten dem betulichen Usedom daraufhin den Titel »Mörderinsel« verliehen, was ich ungerecht fand.
»Wollen Sie wirklich nichts essen?«, fragte Linz und unterbrach meine Gedanken.
»Nein, danke. Ich esse recht wenig und mittags gar nichts.«
»Das sieht man«, sagte er, und ich wusste nicht, auf welchen Teil meiner Antwort sich seine Bemerkung bezog.
Tatsächlich hatte ich in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen und passte inzwischen problemlos in italienische Designerklamotten, die ich mir dann doch nicht kaufte. Yim sagte manchmal, andere Frauen würden für meine Figur morden und ich würde noch nicht einmal einen Finger dafür krumm machen. Tatsächlich trieb ich weder Sport noch zählte ich Kalorien. Ich arbeitete einfach nur höllenmäßig viel. Immerhin ließ ich mir regelmäßig für teures Geld hellblonde Strähnen in die schulterlangen Haare machen. Und ich war auf den Trick mit dem Etuikleid gekommen: morgens einfach eines dieser schlichten Kleidungsstücke überstreifen, es durch ein schickes Accessoire wie eine Weste oder einen Schal ergänzen, und fertig ist die mondäne Frau von heute. Yim gefiel es. Er sagte, mit dem Look könnte ich sowohl die Happy Hour in New York bestreiten wie auch den Mekong auf einer Dschunke überqueren. Na, wenn er meinte …
Linz, der ein Gesicht machte, als interessierten Kleider ihn nicht sonderlich, wischte die Finger an der Papierserviette ab, trank einen großen Schluck Bier, lehnte sich über den Tisch und sah mich ziemlich direkt an, ohne etwas zu sagen.
Ich wusste auch so, welche Frage ihm auf der Zunge lag.
»Sie wollen immer noch wissen, wieso ich Frau Simonsmeyers Anruf nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt habe?«
»Das haben Sie ganz wunderbar formuliert. Darüber hinaus wäre ich Ihnen zutiefst verbunden, wenn Sie so freundlich wären, die Behörden bei der Mordermittlung zu unterstützen. Aber nur, wenn es Ihnen keine allzu großen Umstände macht.«
Er machte sich offenbar gerne über mich lustig.
»Frau Simonsmeyer war nicht in meinen Kontakten gespeichert, daher habe ich nur eine Handynummer auf dem Display gesehen.«
»Heißt das, Sie hätten das Gespräch weggedrückt, wenn Sie vorher gewusst hätten, wer dran ist?«
»Ist das von Belang für Ihre Ermittlungen?«
»Nein«, sagte er und fuhr mit der Zunge über die Zähne. »Ich würde nur gerne verstehen, wie Sie ticken.« Er zögerte. »Sie ticken doch, oder? Ich meine, wir alle ticken … irgendwie.«
»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen.«
»Ich auch nicht.« Er holte seinen Notizblock hervor und notierte etwas. Zwei weitere Würste und ein Bier hätte ich ihm ausgegeben, um zu erfahren, was er da kritzelte. Dann legte er den Stift auf den Tisch und sagte: »So, Fall gelöst.«
Ich schaute ihn an wie ein Hund, der keine Ahnung hat, was Herrchen von ihm will.
»Kleiner Scherz.« Er lachte kurz und wurde gleich wieder ernst. »Ich möchte, dass Sie eines verstehen. Sie waren die letzte Person von außerhalb der Insel, mit der Bettina Simonsmeyer gesprochen hat.«
»Ich? Sind Sie sicher?«
»Zumindest soweit wir wissen.«
Das war mir nicht klar gewesen, und selbstverständlich fühlte ich mich in dieser Rolle äußerst unwohl. Krampfhaft versuchte ich, mich an Details zu erinnern – vergeblich. Der Anruf war ja kein expliziter Hilferuf gewesen. Sie hatte weder geweint noch geschrien, sondern einfach nur sehr schnell gesprochen, mit zunehmender Vehemenz.
»An eine Bemerkung erinnerte ich mich dann doch noch. Im Hinblick auf den Titel meines Artikels im vergangenen Winter sagte sie, aus Angeklagt im Paradies sei inzwischen Angeklagt vom Paradies geworden.«
Kommentarlos kritzelte Linz in seinen Block.
»Das ist alles«, sagte ich.
»Wie sind Sie mit ihr verblieben?«
»Ich sagte ihr, dass ich sie zurückrufen würde.«
»Und? Haben Sie sie zurückgerufen?«
»Auf meinem Tisch lag die Sache mit dem Polizisten, der seine Eltern und die Verlobte mit der Dienstwaffe erschossen hat. Und die der Krankenschwester, die im Hospiz fünf Menschen vergiftete. Dazu die in Kürze erwarteten Urteile gegen die Oberhäupter der mazedonischen Mafia, nicht zu vergessen der Prozess gegen den Kindermörder von Hohen Pelchgau …« Ich versuchte im Gesicht meines Gegenübers zu lesen, das mich direkt ansah, doch es war wie eine aufgeschlagene Buchseite ohne Buchstaben. »Nein«, gestand ich ein. »Ich habe sie nicht zurückgerufen, da ich mich mit meiner Arbeit völlig eingekapselt hatte. Natürlich war ich bestürzt, als ich von dem Geschehen erfuhr.«
Das klang alles so abgedroschen, schon tausendmal, gefühlt eine Million Mal benutzt. Selbstverständlich hatte mich die Brandkatastrophe von Trenthin erschüttert, immerhin hatte ich die vier Toten gekannt. Was ich Linz über den Anruf und meine Arbeit erzählt hatte, entsprach der Wahrheit. Weshalb ich Bettina Simonsmeyer nicht zurückgerufen hatte, hatte jedoch einen anderen, viel banaleren Grund, den ich Linz gegenüber unerwähnt ließ, auch weil er für seine Ermittlungen bedeutungslos war. Inzwischen war es mir peinlich, aber ich hatte Bettina Simonsmeyer nicht besonders gut leiden können. Mir ist bewusst, dass das äußerst unprofessionell erscheint, und wäre dies der einzige Grund, wäre ich eine miserable Journalistin. Immerhin ist der Umgang mit Menschen, die man unsympathisch findet, das Brot meiner Zunft, erst recht für Gerichtsreporter. Zusammengenommen mit den anderen Gründen kann das jedoch den Ausschlag geben.
Was fand ich denn eigentlich so unsympathisch an ihr?
Die Redseligkeit? Sie war äußerst mitteilsam, bis an die Grenze des gerade noch Erträglichen. Vielleicht hatte sie deswegen so wenige Freunde gehabt. Doch es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, davon abgesehen könnten Journalisten ohne gesprächige Menschen einpacken. Ihre plumpe, fast schon penetrante Art, mir ihre Sichtweise in den Block zu diktieren? Das hätte sie zwar ein bisschen subtiler anstellen können, aber letztlich würde das jeder in ihrer Situation versuchen: sich und den Ehegatten im besten Licht erscheinen zu lassen, der bösen Welt die Schuld zuzuschieben und sämtliche Ungereimtheiten unter den Tisch fallen zu lassen. Dafür hatte ich Verständnis.
Dass sie geraucht hatte wie ein Schlot, viel zu viel für meinen Geschmack? Nein, auch das war ich von anderen Interviewpartnern gewöhnt.
Nein, es war viel profaner. Während der beiden mehrstündigen Treffen hatte sie permanent meine Komfortzone durchbrochen. Andauernd hatte sie mir an den Arm gefasst, mehrmals meine Schulter gestreichelt. Sie hatte meine Hand ergriffen, um den geerbten Ring zu bewundern, hatte meine Halskette betastet, ohne vorher zu fragen, war mehr als einmal dicht mit ihrem Gesicht an meines gekommen … Eine solche Körperlichkeit gestattete ich guten Freundinnen, nicht jedoch einer Fremden. Ich mochte es nicht, ständig angefasst zu werden, und erduldete die allzu große physische Vertrautheit nur deshalb widerspruchslos, um die Atmosphäre des Treffens nicht zu zerstören. Immerhin hatte sie – da ihr Mann mir ein Interview verweigert hatte – neben den Eltern des Opfers im Mittelpunkt meiner Reportage gestanden.
Hatte diese Eigenart Bettinas es mir so leicht gemacht, den Rückruf zu vergessen? Hätte ich womöglich für jemanden, der mir überaus sympathisch war, einen zweiten Artikel verfasst? Und hätte dieser zweite Artikel irgendetwas an dem geändert, was geschehen war?
Zumindest auf die letzte Frage gab es eine eindeutige Antwort. Nein, er hätte nichts geändert, allein aus dem Grund, dass er nicht mehr rechtzeitig publiziert worden wäre. Und zwar selbst dann nicht, wenn ich mich sofort nach Bettinas Anruf an die Arbeit gemacht hätte.
Seltsamerweise änderte diese Tatsache wenig an meinem schlechten Gewissen. Der Mann vom Staatsschutz hatte recht – ich war wegen meiner inneren Stimme nach Usedom gekommen.
»Ich war wirklich bestürzt«, ergänzte ich meine Aussage, so als ob dieses eine Wörtchen einen Unterschied machte.
Der Blick, den Linz mir zuwarf, schien mich in eine Ecke zu drängen, aber vielleicht bildete ich mir das auch nur ein, denn wenn man Selbstzweifel hat, meint man überall Zweifel zu erkennen. Jedenfalls wollte ich unbedingt raus aus dieser Ecke, wenn möglich auf elegante Weise.
»Sie sagten vorhin, Sie seien ebenfalls einer inneren Stimme gefolgt, Herr Linz.«
Er klappte sein Notizbuch zu und nickte. »Ich habe die Generalbundesanwältin um diesen Fall gebeten.«
Am liebsten hätte ich nun mein Notizbuch aufgeklappt. »Was ist an diesem Fall so speziell?«
»Das meinen Sie nicht im Ernst!«
»Bevor Sie einen Herzkasper kriegen … ich formuliere neu. Was ist an diesem Fall so speziell, dass Sie die Ermittlungen nicht einem Ihrer Kollegen überlassen wollten?«
Er leerte sein Bierglas und leckte sich den Schaum vom Mund. »Werden Sie über die Tragödie recherchieren?«
Ich überlegte kurz. »Das ist eigentlich nicht mein Metier, solange Sie niemanden angeklagt haben.«
»Haben Sie nicht schon einmal ein Verbrechen aufgeklärt?«
Er war wirklich gut informiert. Tatsächlich hatte ich vor Jahren schon einmal in einem ungeklärten Mordfall recherchiert, der sogenannten »Blutnacht von Hiddensee«, bei der drei Menschen ums Leben gekommen waren. Letztendlich hatten meine Nachforschungen zum Ermittlungserfolg geführt, wodurch ich mir einen Namen als Kriminaljournalistin machte. Sowohl beruflich als auch privat hatte das schreckliche Ereignis von Hiddensee mein Leben zum Besseren verändert, denn meine Karriere machte einen Sprung, und ich lernte Yim kennen.
»Falls Sie befürchten, dass ich Ihnen in die Quere komme, kann ich Sie beruhigen«, sagte ich. »Damals lag der Fall bei den Akten, da war schon eine Staubschicht drauf.«
»Es gibt noch einen weiteren Fall, der zu verstauben droht, nämlich der, ohne den es gar nicht erst zu dem Brandanschlag gekommen wäre.«
»Sie meinen Susann Illing?«
»Wenn die Staatsanwaltschaft sich einmal auf einen Täter festgelegt und ihn vor Gericht gebracht hat und wenn derjenige dann freigesprochen wird, müsste sie theoretisch den Fall neu aufrollen. Praktisch ist der Fall so kalt, dass jede Hand gefriert und abfällt, die nach ihm greift.«
»Schon, aber da gibt es ja noch den zweiten Mord.«
»Denselben Mann noch einmal vor Gericht bringen? Bei dünnerer Beweislage als beim ersten Mal? Klar, warum nicht? Man müsste bloß einen Staatsanwalt finden, dem es egal ist, dass seine Karriere den Verlauf der Aktienkurse am Schwarzen Freitag nimmt.«
»Man hat demnach Holger Simonsmeyer auch für den zweiten Mord in Verdacht?«
Dazu wollte und konnte Linz sich verständlicherweise nicht äußern.
»Wie auch immer«, sagte ich, »das ist nun wirklich Aufgabe der Staatsanwaltschaft, mehr noch, es ist deren Pflicht, so lange zu ermitteln, bis es quietscht.«
»Völlig d’accord. Aber es fehlt in unserem Rechtsstaat an allen Ecken und Enden an Polizisten, Richtern, Staatsanwälten, einer schlanken Bürokratie. Nur an einem fehlt es nicht: an Rechtsanwälten. Davon gibt’s genug, und die legen erst mal gegen alles Widerspruch ein, noch bevor sie es gelesen haben. Davon abgesehen sitzt die Staatsanwaltschaft in der Tinte. Der Brandanschlag hat die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Überlegen Sie mal: Wenn die offen gegen Holger Simonsmeyer ermitteln würden, dann hieße es doch gleich, die geben dem Wutbürger nach. Ermitteln sie dagegen in eine andere Richtung …«
»… sind sie Ignoranten, Dilettanten, Hasenfüße«, ergänzte ich seufzend.
Linz war so höflich, den Absender derartiger Vorwürfe unerwähnt zu lassen – die Presse. Irgendwo hatte er ja recht. Und doch auch wieder nicht. Es ist nun einmal eine der Aufgaben der Presse, das staatliche Tun kritisch zu begleiten. Zugleich ist die Medienlandschaft derart vielfältig, dass man es kaum jemals allen Journalisten recht machen kann.
»Es gibt Fälle«, sagte Linz, »bei denen die Öffentlichkeit einem andauernd auf die Finger haut, wenn man sie nicht anrührt. Tut man dann was, macht einen die Öffentlichkeit schnell einen Kopf kürzer, wenn nicht das herauskommt, was sie will. Oder wenn gar nichts herauskommt. Und wenn man sich zwischen der Rute und der Guillotine entscheiden muss …«
Ich nickte. »Alle warten ab, was Ihre Untersuchung ergibt, damit sich die Lage beruhigt, und dann sehen sie weiter.«
»Hinzu kommt, dass die hiesigen Kollegen derzeit alle Hände voll zu tun haben und angewiesen sind, die Kriminalstatistik zu verbessern. Es wird ihnen also leicht gemacht, sich zurückzuhalten.«
»Ihre Untersuchung dauert wie lange?«
»Bis zum Jahresende habe ich mir nichts weiter vorgenommen.«
»Selbst die heißeste Kartoffel ist bis dahin abgekühlt.«
Natürlich erzählte er mir das alles, damit ich hier und da auf den Busch klopfte, in der Hoffnung, die Staatsanwaltschaft würde davon aufgeschreckt. Seine Ermittlung beschränkte sich auf den oder die Täter des Brandanschlags, während die zwei toten Frauen, die ja erst zur Tragödie geführt hatten, vorläufig ungesühnt blieben. Linz hatte mir keine Geheimnisse verraten, wenigstens keine großen, und unser Gespräch war inoffiziell. Auch hatte er mich zu nichts direkt aufgefordert. Wenn ich zu weit ging, konnte er seine Hände in Unschuld waschen. Andererseits – die beiden toten Frauen schienen ihn zu kümmern, und im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchte er, eine Ermittlung anzustoßen.
»Ich soll also ein bisschen für Sie herumschnüffeln?«
Linz zog ein Gesicht wie zu einer uralten Geschichte.
»Und was bekomme ich dafür?«
»Meinen ergiebigsten Dank.«
Ich sah ihn abwartend an.
»Und das gute Gefühl, die Behörden bei ihrer mühevollen Arbeit im Dienst der Bürger unterstützt zu haben.«
»Das ist ja wohl nicht Ihr Ernst.«
»So langsam verblasst der Ruhm, den Sie sich bei der Aufklärung der Blutnacht von Hiddensee erworben haben. Könnte nicht schaden, ihm eine Frischekur zu verpassen.«
»Was denken Sie eigentlich? Dass ich die Protagonistin einer Krimireihe bin? Miss Kagel, oder wie?«
Er dachte einen Augenblick nach, schob den Teller von sich, beugte sich vor und sah mir in die Augen.
»Wenn auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit besteht«, betonte er jedes einzelne Wort, »dass der wahre Mörder nicht in Rauch aufgegangen, sondern noch quicklebendig ist, dann sind wir es den Familien der Opfer schuldig, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihnen Genugtuung zu verschaffen.«
»Ja, aber warum ich?«, konterte ich knapp. »Das ist der Job der Polizei.«
»Verdammt noch mal, wenn Sie es weder für mich tun wollen noch für die Opfer, dann vielleicht zur Beruhigung Ihres schlechten Gewissens. Und bevor Sie behaupten, Sie hätten keins … Sie haben eins. So!«
Dieser blöde Bulle! Wenn er genauso gut mit der Pistole feuerte wie mit der Zunge, dann war der innere Kreis der Zielscheibe auf dem Schießstand voller Löcher.
Ich spürte, dass die tragischen Ereignisse von Usedom irgendetwas mit mir machten. Aber was? Und warum? Ich war betroffen, nicht nur im Allgemeinen, sondern unmittelbar, und ich war irgendwie involviert. Zunächst glaubte ich, es läge an dem, was ich über den Fall geschrieben hatte. Wieder und wieder war ich in den Tagen zuvor den Artikel durchgegangen, den ich sechs Monate zuvor über den Prozess gegen Holger Simonsmeyer verfasst hatte. Ich hatte jeden Abschnitt, jeden Satz geprüft, ob ich darin zu voreingenommen, zu parteiisch gewesen war. Befand: nein. Gab es einem Kollegen zu lesen, der urteilte: nein, Doro, mach dir mal keinen Kopf. Bat meinen Sohn um eine Meinung, der sagte: Mum, was willst du, das ist dein Stil. So gehst du nun mal an die Sache ran.
Ja, als Gerichtsreporterin für schwere Kapitaldelikte war mein Stil, meine Herangehensweise schon immer gewesen, nicht einfach nur den Mordprozess zu beleuchten, auch nicht bloß die Tat an sich, sondern das Licht in jene finsteren Regionen zu richten, die sich abseits des Spots befinden, der auf den Angeklagten gerichtet ist. Selbstverständlich ist es eine Binsenweisheit, dass ein Verbrechen nicht erst in der Stunde der Sichtbarkeit zu existieren beginnt, so wenig wie ein Kunstwerk oder ein junges Leben. Jeder gute Gerichtsreporter wird daher die Vergangenheit des Angeklagten wie auch die des Opfers in Szene setzen, um eine Zeitlinie zu zeichnen, eine Art Fieberkurve bis zum Exitus.
Ich hatte allerdings noch mehr getan. Denn wie kann man ein Verbrechen in all seinen Facetten, mit seinen Hintergründen beschreiben, wenn man nur eine einzige Dimension erfasst, die der Zeit? Also hatte ich eine ganze Region zum Schauplatz des grausamen Mordes an Susann Illing gemacht. Hat da wirklich nur ein verlassener Liebhaber der Ex-Geliebten aufgelauert, wie die Staatsanwaltschaft behauptet hatte? Wie ist Holger Simonsmeyer, der Angeklagte, durch die Insel geprägt worden, auf der er aufwuchs? Und inwieweit hatte er nun seinerseits die Insel geprägt und verändert, ganz egal, ob er für schuldig befunden würde oder nicht. Eine ganze Gesellschaft hatte ich porträtiert, hatte mit Dutzenden von Leuten gesprochen, hatte mir ein Bild vom Usedomer Leben vor dem Mord gemacht, und was fast noch wichtiger war – vom Leben nach dem Mord. Als hätte ich unbewusst bereits gespürt, dass dieser Prozess mit der bevorstehenden Urteilsverkündung nicht beendet sein würde. Oder hatte ich nicht vielmehr erst durch meinen monumentalen Artikel in einem der größten Polit-Magazine Deutschlands eine Entwicklung in Gang gesetzt, zumindest befeuert, die zum Tod weiterer Menschen, zur Brandkatastrophe führte?
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass nicht das, was ich geschrieben hatte, mich schuldig fühlen ließ, sondern das, was ich nicht geschrieben hatte.Als mich Bettina Simonsmeyer unmittelbar nach dem Freispruch ihres Mannes bat, einen weiteren Artikel zu schreiben, lehnte ich das erste Mal ab. Das Warum lag für mich auf der Hand. Die Geschichte war erzählt, wenigstens aus meiner Sicht. Denn so seltsam sich das für Laien anhören mag – das Urteil ist lediglich ein Detail der Geschichte, und nicht einmal das wichtigste. Um nicht falsch verstanden zu werden – für die Angehörigen der Opfer und natürlich für den Angeklagten ist das Urteil absolut entscheidend. Aber solche Storys, wie ich sie schreibe, werden ungefähr nach drei Viertel der Prozesszeit verfasst, wenn die meisten Fakten bereits auf dem Tisch liegen, wenn die Leser sich eine eigene Meinung bilden können, aber noch nicht wissen, ob ihre Meinung sich letztendlich durchsetzt, sie also recht behalten.
Es ist eine Frage der Dramaturgie, wann man einen solchen Artikel veröffentlicht, und der Zeitpunkt, als Bettina Simonsmeyer mich um einen zweiten bat, war der denkbar schlechteste, nämlich als die Katze frisch aus dem Sack war. Selbst wenn ich ihrem Wunsch entsprochen hätte – die Redaktion eines anspruchsvollen Blattes möchte ich sehen, die noch einmal mehrere Seiten für einen Bericht frei macht, der im Grunde schon einmal geschrieben wurde, nur ergänzt durch wenige zusätzliche Informationen. Kurz gesagt, die Umstände schienen mir eine neue Reportage nicht zu rechtfertigen.
Als sie mich zum zweiten Mal um Hilfe bat, hatten die Umstände sich offenbar geändert. Ihre letzten Worte werde ich nie vergessen: Sie müssen uns helfen, Frau Kagel, Sie sind unsere letzte Hoffnung.
Achtundvierzig Stunden später war sie tot.
Deswegen saß ich nun dem Staatsschutz gegenüber und ließ mich auf eine Sache ein.
Vor dem geistigen Auge blätterte ich meinen Terminkalender durch: Allein in der darauffolgenden Woche hatte ich zwei Abgabetermine, wobei ich mit den Recherchen noch ganz am Anfang stand. Eigentlich unmöglich, auch nur einen Tag länger auf Usedom zu bleiben, und doch war ich eigens von Berlin hergekommen – eine Strecke von drei Stunden –, nur um durch die Trümmer des niedergebrannten Hauses zu laufen.
Ich sah auf die Uhr: Abends konnte ich locker wieder am Schreibtisch sitzen. Mein Laptop hatte ich dabei, und wo ich die Artikel schrieb, war egal.
»Wissen Sie zufällig, wo es hier noch freie Zimmer gibt?«
»Auf Gut Trenthin, wo ich auch wohne«, antwortete er trocken. »Dort gibt es jede Menge freier Zimmer.«
2
Noch 32 Tage bis zum zweiten Mord
Wenn es nach Ben-Luca gegangen wäre, hätte es ein ganz normaler Tag werden sollen. Seit er vor einigen Monaten die Schule abgeschlossen hatte, schlief er aus, so bis zehn, auch schon mal elf Uhr. Und dann sah er weiter.
Aber an diesem Morgen weckten ihn seine streitenden Eltern, und zwar zu jener unmöglichen Zeit, zu der Arbeitnehmer sich in ihre Autos oder Busse setzen. Auch ohne den genauen Wortlaut zu verstehen, ahnte er, worum es ging. Monatelang hatten sie das Thema erfolgreich umschifft, doch nach dem gestrigen Gerichtsurteil in der Sache Holger Simonsmeyer krachten sie zusammen wie Klippe und Schiff. Anfangs zog Ben-Luca die Bettdecke über den Kopf, doch die schrille Stimme seiner Mutter hätte auch drei Daunenkissen durchdrungen. Wenn er sowieso schon wach war, konnte er genauso gut den Streit schlichten. Meistens schaffte er das durch sein bloßes Erscheinen.
»Ben-Luca Waldeck«, rief seine Mutter, als er die Küche betrat. Seltsamerweise nannte sie ihn immer beim vollen Namen, wenn sie etwas an ihm auszusetzen hatte. Warum, erschloss sich ihm nicht. »Hättest du dir nicht etwas mehr als eine Unterhose zum Frühstück anziehen können.«
»Ich frühstücke doch gar nicht«, erwiderte er, holte eine Flasche Apfelsaft aus dem Kühlschrank, trank einen großen Schluck, stellte sie zurück und fuhr sich mit der Handfläche über den Mund. »Außerdem sind das Boxershorts.«
Sein Vater lehnte gelassen am neuen Induktionsherd, dessen Abzug den Dampf der brodelnden Hafergrütze nicht nach oben, sondern nach unten einsog. Seine Mutter stützte sich mit einer Hand auf dem Tisch ab, die andere hatte sie in die Hüfte gestemmt, als sei sie dort zementiert. Sie trugen Anzug und Kostüm in dunklen Farben, und auch ohne etwas über sie zu wissen, hätte man annehmen können, dass sie den gleichen Job hatten.
»Ist das heute Morgen eine spezielle Aggression zwischen euch oder nur die übliche?«, fragte er und biss von einer Banane ab.
»Dein Vater und ich harmonieren normalerweise hervorragend«, korrigierte sie ihn.
»Eure normale Harmonie hat mich geweckt.«
»Oh, du armer Junge. Da schuftest du so sehr, und wir bringen dich um deinen wohlverdienten Schlaf.«
»Das ist Ironie, oder?«
»Was haben wir für einen klugen Jungen in die Welt gesetzt, Alexander. Ich staune jeden Tag aufs Neue.«
Ben-Lucas Strategie war aufgegangen. Sobald er auf der Bildfläche erschien, stand er im Fokus seiner Mutter, und alles andere trat zurück. Eigentlich hatten sie immer ein gutes, zumindest ein unproblematisches Verhältnis gehabt, aber wenn sie etwas nicht leiden konnte, dann war es Ziellosigkeit, und seit dem Schulabschluss konnte man dieses Wort durchaus als Überschrift seiner Tage betrachten. Seine Eltern wollten ihn als Lehrling im eigenen Betrieb, wozu er sich bisher nicht durchringen konnte. Vielleicht hing es damit zusammen, dass die Kunden seiner Eltern tot waren, und mit Toten hatte er aus irgendeinem rätselhaften Grund nicht gerne zu tun.
»Wie wär’s, wenn du heute wahrmachst, was du mir seit Wochen versprichst, und das Praktikum bei uns beginnst?«, fragte seine Mutter. Im Grunde war es keine Frage, sondern eine verhüllte Drohung. Der Schleier fiel nur Sekunden später. »Du weißt, dass du keinen Cent von uns für deinen Führerschein bekommst, solange du dich nicht um eine Arbeit bemühst.«
»Okay, vielleicht nach der Sommerpause«, gestand er zu.
»Welche Sommerpause? Gestorben wird immer.«
»Euer Firmenmotto, was?«
»Das inoffizielle.« Sie schmunzelte.
»Ich müsste echt mal in mich gehen und überlegen, warum der Beruf des Leichenbestatters als uncool gilt. Ob es daran liegt, dass man Leichen eine Krawatte umbinden und die Haare kämmen muss? Was meint ihr?«