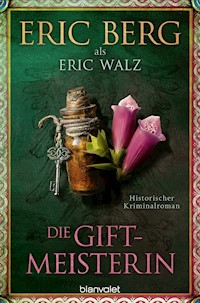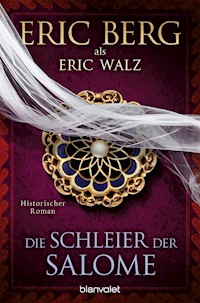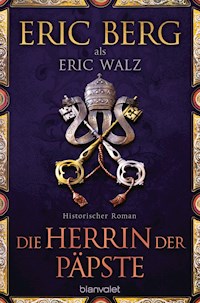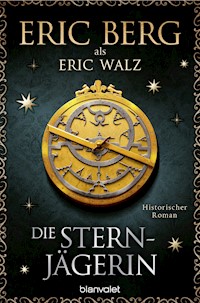
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau lässt sie sich eins nicht nehmen: ihren Lebenstraum, die Sterne zu erforschen!
Danzig, 1662. Die junge Elisabeth hat eine große Leidenschaft: die Sterne. Und sie weiß, dass nur eine Ehe mit dem um einiges älteren, bekannten Danziger Astronom Johannes Hevelius ihr garantieren kann, das Firmament zu erforschen. Ihr Herz hat sie allerdings an einen anderen verloren – und diese Liebe droht, ihre Familie zu zerstören. Als ein entsetzlicher Feuersturm ihr Observatorium vernichtet, scheint ihr Leben endgültig sinnlos. Doch Elisabeth lässt sich nicht unterkriegen …
Eine faszinierende, widersprüchliche und mutige Frau geht ihren Weg in der Wissenschaft und in der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Danzig, 1662. Die junge Elisabeth heiratet den um einiges älteren, bekannten Danziger Astronom Johannes Hevelius. Nur eine Ehe mit ihm kann ihr eines garantieren: Die Freiheit, nach Herzenslust das Firmament zu erforschen. Doch für ihre Leidenschaft für die Sterne zahlt Elisabeth einen hohen Preis: ihre Gefühle für ihre große Liebe Marek zerstören beinahe ihre Familie. Alles scheint verloren, als dann auch noch ein entsetzlicher Feuersturm ihr Observatorium vernichtet. Doch Elisabeth lässt sich nicht unterkriegen …
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz
Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die Sternjägerin
Glasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze Papst
Die Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Eric Bergals Eric Walz
Die Sternjägerin
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2009 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung und – motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com. (LeitnerR, Andrey Kuzmin, magicpics1806, markrhiggins) LH ˑ Herstellung: DiMo E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-30252-8V001
www.blanvalet.de
Für Moni und Ebi
Prolog
26. September 1679, nachts
In dem Moment, als Elisabeth das Feuer entdeckte, schrie auch schon jemand von irgendwoher: »Die Sternenburg brennt!«
Dichter Qualm stieg aus den oberen Fenstern des Hauses Pfefferstadt 15, des größten Gebäudes in Danzig, bedeutender als das Rathaus oder die riesigen Kornspeicher, berühmter sogar als die nahe gelegene Katharinenkirche.
Die umliegenden Gassen waren binnen Augenblicken ein einziges Durcheinander aus Leibern und Geschrei. Mütter zogen ihre Kinder wie Gegenstände hinter sich her, Alte stolperten aus Hauseingängen und fielen auf das Pflaster, Männer hasteten mit Geldkassetten davon, vornehme Frauen trugen Berge von Kleidern und Schmuck mit sich. Ein paar Jüngere und ein halbes Dutzend Halbbetrunkene aus den Schänken bildeten eine Kette und schafften mehr schlecht als recht Wasser aus einem Brunnen herbei, wobei manche lachten und andere es sich anders überlegten und wegrannten. Wo ein halb voller Eimer das Ziel erreichte, klatschte das Nass wahllos ins Erdgeschoss des Hauses, dorthin, wo es gar nicht brannte.
Inmitten des Lärmens der Welt stand Elisabeth vor dem brennenden Haus wie eine einzelne reglose Ameise in einem wirren Haufen.
Er beobachtete sie, eine Frau Anfang dreißig. Sie zog ihre Kapuze herunter, die offenen Haare schimmerten rötlich im Widerschein des Feuers. Was ihr Heim war, was sie mit erschaffen hatte, wofür sie seit mehr als fünfzehn Jahren gelitten und gekämpft hatte, das größte Observatorium Europas, die Sternenburg, stand in Flammen. Im Vorbeilaufen stießen Fliehende sie an, alle schrien und stöhnten, sie jedoch war stumm und starr. Die Dinge geschahen ohne sie. Den Kopf in den Nacken gelegt wie schon unzählbare Male zuvor, wie in Tausenden wacher Nächte, als sie allein mit einem Brot, einer Tasse Tee und dem »Auge Gottes« auf der Sternenburg saß und hinaufblickte, schien sie in einer anderen Welt als die anderen Menschen zu leben, eine Insel im Wind.
Er konnte nicht anders, als sie zu bewundern – obwohl ihre letzte Begegnung nicht gerade freundlich verlaufen war. Überhaupt war das ganze Haus, die Sternenburg und seine Bewohner, in den letzten Wochen in Aufruhr gewesen. Zu viele schlechte Gefühle – Misstrauen, Eifersucht, Neid und simple Boshaftigkeit – hatten sich wie eine Pestilenz hinter jenen Fenstern ausgebreitet, die nun den schwarzen Rauch in den Nachthimmel schickten.
Und er hatte ungewollt dazu beigetragen, ja, vielleicht den letzten Grund für diese Katastrophe geliefert. Wer war es, wer hatte den Brand gelegt?
Elisabeth erwachte aus ihrer Versunkenheit, zurückgeholt von panischen Schreien im Haus. Er folgte ihrem Blick. Zuerst glaubte er an eine Täuschung, aber dann sah er den Umriss eines Menschen hinter dem Fenster. Er hatte angenommen, dass alle das Haus rechtzeitig verlassen konnten, denn so weit oben gab es weder Zimmer für die Dienerschaft noch für die Herrschaft.
»Ein Laken«, schrie einer der Helfer, der ebenfalls den gespensterhaften Schatten bemerkt hatte. »Jemand soll schnell ein Betttuch bringen!«
»Hemma«, murmelte er, und seine Gedanken überschlugen sich. Wieso war die alte Hemma nicht die Treppe nach unten gegangen, sondern hinauf? Und wenn sie beim Ausbruch des Feuers bereits so weit oben gewesen sein sollte, nahe dem Observatorium, was hatte sie dort zu suchen gehabt, noch dazu bei nachtschlafender Zeit?
Hatte Hemma den Brand gelegt? Dieser Verdacht schien ihm völlig selbstverständlich zu sein, etwas absolut Naheliegendes. Oder war sie – im Gegenteil – das eigentliche Ziel des Brandes?
Hemmas Schatten wankte. Sie stieg, umgeben von Qualm, auf den Fenstersims.
Keine Regung in Elisabeths Gesicht verriet ihre Gedanken, und gerade das verriet ihre Gedanken. Sie empfand kein Mitleid. Zu viel hatte diese Frau ihr angetan.
Dann aber, nur einen Lidschlag später, zuckte Elisabeth entsetzt zusammen. Hemmas Körper verwandelte sich in eine Fackel, kippte langsam nach vorn – und schlug nur wenige Meter vor Elisabeth auf. Das dumpfe Geräusch ihres Aufpralls ging im allgemeinen Aufschrei unter.
Mit weit aufgerissenen Augen wich Elisabeth einen Schritt zurück. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, ihre Knie wurden weich, und sie konnte sich gerade noch auf einem Kutschrad abstützen. Den Oberkörper vorgebeugt, holte sie tief Luft. Die Tränen drohten sie zu ersticken.
Er verstand sie gut. Ihr Leben mit allen seinen Triumphen und Rückschlägen und Tragödien, ein Leben, das sie trotz allem geliebt hatte, zog in einer gewaltigen Rauchsäule in die Schwärze der Nacht, um dort irgendwo zu verschwinden, sich aufzulösen wie eine abgebrannte Kerze.
Und er konnte nichts tun. Niemand konnte etwas tun. Ihm blieb nur, zu ihr zu gehen und sie zu stützen, damit sie nicht zu Boden sank.
Er nahm ihre Hand. Erst jetzt bemerkte sie, dass er die ganze Zeit in ihrer Nähe gewesen war.
Sie sagte nichts, sah ihn nur an, und in ihren Augen erkannte er das ganze unermessliche Ausmaß ihrer Verzweiflung.
»Das Haus stürzt ein«, schrie jemand und löste damit eine alles zersetzende Panik aus. Die Kette der Wasserträger fiel auseinander, der letzte Rest von Ordnung schwand dahin. Alle Neugierigen, die sich weit vorgewagt hatten, kannten kein Halten mehr, stießen sich gegenseitig zur Seite, stiegen über die Gestrauchelten hinweg. Die Pferde einer soeben eingetroffenen Feuerwache gingen mitsamt dem Pumpwagen durch, der wiederum mit einer Kutsche kollidierte. Mit einem Knall zerbarst das gewaltige Wasserfass, dessen Inhalt sich über das Pflaster ergoss und sogar noch seine und ihre Schuhe benetzte sowie ein Buch, das gleich neben ihnen lag.
Er hob es auf. Es war ein frühes Buch von Galilei. Da Elisabeth keine Bücher aus dem Haus getragen hatte – und das Buch mit ziemlicher Sicherheit keinem der Leute auf der Straße gehörte – musste es wohl …
Elisabeth und er verstanden gleichzeitig und sahen nach oben.
Das Haus stürzte nicht ein. Was von oben herunterfiel, waren keine Steine, keine Gebäudeteile, sondern Bücher, Schriften, lose Blätter. Ein Band, eine Seite Papier nach der anderen regneten vom Himmel. Jemand versuchte zu retten, was noch zu retten war, Bruchstücke eines Lebenswerks.
Doch wer?
Durch Qualm und Nacht konnte man nichts erkennen.
Lil? Sollte es etwa Lil sein, die auf die Plattform gegangen war, auf die Sternenburg? Jemand dort oben riskierte sein Leben für Bücher, für Zeichnungen von Sternenkonstellationen, Berechnungen von Planetenbahnen, für Sonnenfeuer und Mondmeere.
»Nein, großer Gott«, flüsterte Elisabeth.
Dann, noch ehe er begriff, was passierte, rannte sie in das von Feuer beherrschte Haus, und keiner seiner Rufe hielt sie davon ab.
Erster Teil
Die Insel der ewigen Stille
© AKG, Berlin
1
Siebzehn Jahre früher
Elisabeth liebte die Sterne zu sehr, um die Nacht zu fürchten.
Inmitten der Dunkelheit fühlte sie sich nicht bedroht, obwohl ihr Herz schneller schlug. Sie irrte barfuß durch den Garten, streifte mit dem wollweißen Nachthemd die knospenden Sträucher und achtete nicht auf das Geraschel der Tiere oder das Wispern des Windes. Ihr Blick war nach oben gerichtet, zu ihren nächtlichen Gefährten. Sie war nicht allein. Sie beobachtete die Sterne, und die Sterne beobachteten sie. Sie gab sich der Tiefe des Unbekannten hin und lauschte auf alles, was es ihr sagte, lauschte auf das Geräusch von Himmel und Erde.
Sie war nicht verrückt. Sie hörte keine Stimmen und sah keine Lichtpunkte tanzen oder sich zu spektakulären Formationen vereinigen, trotzdem wurde sie beim Anblick der Gestirne von einem mächtigen Gefühl durchströmt, und dieses Gefühl wiederum kam ihr wie eine Botschaft vor. Zwischen den Sternen und ihr gab es eine unbestimmte, eine magische Verbindung, so wie eine Musik, die von einem Instrument ausgehend direkt in die Herzen der Menschen dringt. Hier draußen waren ihre Gedanken frei und erhoben sich in schwindelerregende Höhen, dorthin, wo alles möglich war.
Sie stolperte über einen Maulwurfshügel und fiel hin, wobei sie sich mit den Händen abstützte und aufstöhnte. Sofort blickte sie zum Haus, das wie ein monströser schwarzer Schatten von der Nacht eingehüllt wurde, und sie wartete nur darauf, dass die Fenster aufleuchten und sie wie wütende Augen anstarren würden.
Ihre Augen, Hemmas Augen. Hemma war ein Dämon, ein Ungeheuer, und sie beherrschte das ganze Haus.
Doch es blieb ruhig. Verstört darüber, dass ein hässlicher, unterirdischer Bewohner es auf eine recht profane Art geschafft hatte, sie aus weit entfernten Sphären wieder zu Boden zu zwingen, blieb sie auf dem Gras sitzen. Bisher war die Nacht immer ihr Verbündeter gewesen, derjenige, der es ihr ermöglichte, für eine Stunde aus der kleinen Welt ihres Alltags, in der alles seinen Platz hatte und vorherzusehen war, hinauszutreten in eine Welt der Rätsel und Geheimnisse. Sie wusste kaum etwas über das Firmament und über Sonne und Mond, außer das, was jeder spüren und sehen konnte – die Wärme, die Gezeiten, die sich verändernden Positionen am Sommer- oder Winterhimmel – und sie wusste das, was die Geistlichen darüber erzählten. Der Himmel, so sagten sie, sei von göttlichen und teuflischen Gestalten bevölkert, und der Mond, die Sterne und Planeten, allesamt aus reinstem Kristall gefertigt, würden vom Atem Gottes bewegt. So schön dieser Gedanke, der von Malern in den Kuppeln mancher Kirchen verewigt wurde, auch war: Wenn Elisabeth bei einer ihrer heimlichen Nachtwanderungen die Mücken vor dem vollen, gelben Mond tanzen sah, wenn Sternbilder, deren Namen sie nicht kannte, am Horizont aufstiegen und nach Stunden an einem anderen Horizont wieder versanken, wenn sie das unterschiedlich flimmernde Licht der Gestirne, einem Zwinkern gleich, beobachtete, dann fragte sie sich, weshalb Gott Hunderte von fehlerlosen, kristallinen Himmelskörpern geschaffen haben sollte, die nur dazu gedacht waren, eine fehlerhafte Welt wie die Erde zu umkreisen, eine Welt voll von Pestilenz, Hunger, Krieg und Tyrannei.
Im Moment war alles friedlich. Elisabeth lag am Rande des Gartens, wo er an die Mottlau grenzte. Das Mondlicht glitzerte auf dem ruhigen Wasser des Flusses und spiegelte sich im Blattwerk der Bäume. Die Mottlau-Fischer warfen ihre Netze auf die Wellen. Elisabeth beobachtete das Spiel ihrer jungen Muskeln, wenn sie die Netze wieder einholten, und die von zerrissenen Hosen dürftig umhüllten Beine, die das Boot ausbalancierten. Dieses Schauspiel war es gewesen, das Elisabeth vor einem Jahr erstmalig aus dem Haus in die Nacht gelockt hatte. Für ein paar Augenblicke frei und unbeobachtet zu sein, übte einen Reiz auf sie aus, wie ihn die Todsünde selbst nicht stärker hätte hervorbringen können.
In jener Nacht im Garten war sie zu froh gewesen, um ängstlich zu sein wegen der Eulenrufe und Fledermäuse. Sie hatte die feuchte Erde unter den Füßen gefühlt und den Nieselregen auf ihren flachsblonden Haaren, die sonst immer mit einer Haube bedeckt waren. Die Kähne der Fischer waren vorübergezogen, ihre leisen Unterhaltungen mischten sich mit dem Plätschern der Wellen, und sie tauschte einen Blick mit einem der Schemen, für den sie auch ein Schemen war. Sie winkte ihm zu, ohne Angst, dass er ihr zu nahe kommen könnte, im Gegenteil, sie wünschte sich, er käme ans Ufer. Diese Männer waren für sie allesamt gut und schön, denn außer ihnen und dem Lehrer und dem Probst gab es für Elisabeth keine Männer.
Erst als die Boote verschwunden waren, hatte sie sich – beinahe zufällig – ins Gras gelegt und zum Sternenzelt aufgeschaut. Von ihrem Fenster aus hatte sie natürlich schon oft in die Nacht geblickt, aber zum ersten Mal überhaupt lag sie damals auf der Erde mit nichts anderem über sich als diesen Myriaden von Lichtern. Da war kein Fensterrahmen, der störte, nicht die leiseste Ahnung von Tageslicht, nur schwarze, unglaubliche Nacht.
Lange hatte sie so dort gelegen. Da geschah es. In ihrem Wechselspiel von Groß und Klein und Hell und Trüb und mit allen ihren Tönen ins Blau, Silber oder Rot schienen ihr die Sterne plötzlich atmende Wesen zu sein, und wenn sie es doch nicht waren, so waren sie zumindest von einer geheimnisvollen, unbegreiflichen Lebendigkeit. Die Sterne erzeugten Gefühle in ihr, also sprachen sie mit ihr.
Nichts davon hatte sich seither geändert, im Gegenteil, ihre Fragen wuchsen ins Unendliche, doch nur ein einziger Mensch in ganz Danzig würde sie beantworten können. Hevelius! Bei diesem Namen pochte Elisabeths Herz schneller. Johannes Hevelius war, außer Stadtrat und Besitzer einer großen Bierbrauerei, nebenbei auch noch der einzige Danziger, der sich mit dem Nachthimmel beschäftigte. Auf dem Dach der Brauerei in der Pfefferstadt, so hieß es, habe er eine Warte gebaut, von der aus er den Lauf der Gestirne beobachtete. Elisabeth brannte seit Wochen in Vorfreude darauf, ihn endlich kennen zu lernen, denn in Kürze sollte sie anlässlich einer kleinen Feier in seinem Haus in die Gesellschaft eingeführt werden. Sie würde unter dem Dach eines Sternenguckers sitzen, eines Mannes, der ihr so viel erzählen konnte vom Himmelsgefüge, so viel zeigen konnte … Sie würde sich bei Tisch nahe zu ihm setzen, ein Gespräch über die Gestirne beginnen und ihn schließlich bitten, einen Blick in die Sternwarte werfen zu dürfen. Natürlich würde er sich ein wenig sträuben, es war ja sein Reich, in das sie eindrang, aber schließlich würde er ihrer ungestümen Begeisterung nicht widerstehen können. Wenn sie erst einmal im Observatorium war, konnte er sie unmöglich wieder hinausschicken, ohne ihr wenigstens ein paar der Fragen zu beantworten, die sie hatte. Und dann, nach einigem Drängen ihrerseits, würde er es endlich hervorholen, das Wundergerät, von dem Gerüchte erzählten, und es einen Atemzug lang in ihre Hände legen: das Auge Gottes.
Elisabeth fuhr auf. Ein Zimmer des Hauses erhellte sich im zuckenden Schimmer einer Kerze.
Elisabeth huschte hinter die Eiben, und das war ihr Glück, denn sie konnte eben noch in Deckung gehen, als die Gestalt mit der Kerze in der Hand ans Fenster trat.
Hemma. Sie hatte es gespürt, gerochen, gewittert. Sie war kein normaler Mensch.
Die Tante trat vom Fenster zurück. Jetzt zählte jeder Augenblick.
Elisabeth rannte quer über den Rasen und sprang über niedrige Beete hinweg, immer in der Hoffnung, dass Tante Hemma nicht zum Fenster hinaussah.
Wo könnte Tante Hemma jetzt sein? Sie hatte nach dem Aufstehen immer Rückenschmerzen und brauchte eine Weile, um aufrecht und in normalem Schritt gehen zu können. Vom Fenster aus musste sie ans Ende ihres großen Zimmers schlurfen, dann hinaus auf den Gang und bis an dessen anderes Ende.
Sie kann noch nicht in meinem Zimmer sein, beruhigte sich Elisabeth, als sie das Dach des Vorbaus betrat und sich an den flachen Zinnen und Giebeln entlanghangelte. Die Ziegel waren glatt von einem kurzen, abendlichen Regenguss, und sie musste aufpassen, um nicht vom Dach zu fallen.
Jetzt, dachte Elisabeth. Jetzt könnte sie mein Zimmer erreicht haben. Wenn ich hineinkomme, steht sie vielleicht schon drin.
Sie rutschte aus. Ihr linker Fuß glitt ab und hing über dem Abgrund, während der rechte Fuß, auf dem das ganze Gewicht ruhte, auf einem Ziegel Halt suchte und ihre Arme eine Zinne umspannten. Mit aller Kraft gelang es ihr, sich wieder zu fangen.
Dann waren es nur noch ein paar Schritte – und sie befand sich in ihrem Zimmer.
Elisabeth hörte, wie sich die Türklinke knarrend bewegte. Sie sprang mit einem gewaltigen Satz ins Bett und zog sich die Decke bis zur Nase.
Das schlurfende Geräusch der Stoffpantoffeln, von dem das Zimmer im nächsten Moment erfüllt war, hörte sich an wie das Zerreißen von Papier. Durch die geschlossenen Lider bemerkte Elisabeth das Kerzenlicht, das auf ihr Gesicht fiel, und obwohl sie vom Laufen und Klettern völlig außer Atem war, musste sie ein ruhiges, leises Luftholen vortäuschen. Ihre Tante kam ihr so nahe, dass sie den warmen Hauch aus Hemmas Mund auf ihrem Gesicht spürte wie den eines Gespenstes.
Eine Weile, die Elisabeth wie eine Ewigkeit vorkam, beugte die Tante sich über sie auf der Suche nach etwas Verdächtigem. Elisabeth konnte sich Hemmas Blick vorstellen, wie er auf ihr hin und her wanderte und nur darauf wartete zuzustoßen, wie er das Fehlen der Nachthaube bemerkte, das offene Haar, die erhitzten Wangen … Hemma schlug die Decke an den Füßen zurück, leuchtete die Stelle mit der Kerze aus und berührte Elisabeths Füße.
Am liebsten hätte Elisabeth sie einfach weggestoßen.
»Geh weg, du gemeines Biest«, murmelte sie mit geschlossenen Augen, so als träume sie schlecht. »Du bist widerlich. Geh weg, hörst du? Geh weg.«
Elisabeth konnte Hemmas empörtes Stöhnen hören, dann das Schlurfen, und schließlich fiel die Tür ins Schloss.
Vorsichtig wartete sie noch eine Weile, dann öffnete sie behutsam das Lid des rechten Auges und suchte, nur durch einen schmalen Spalt blickend, den Raum ab.
Hemma war gegangen.
Elisabeth lächelte vor sich hin. Es kam ihr vor, als habe sie einen gewaltigen Triumph errungen.
Sein Mund glitt über ihre Brüste. Er ließ sich Zeit, Eile war etwas für Ungeübte oder Ängstliche. Äußerst behutsam setzte er Zähne und Lippen ein, und zwischendurch vergewisserte er sich, dass sie es genoss. Sie murmelte unverständliche Worte, die Augen waren halb geschlossen. Unter seinen Händen wand sich ihr nicht mehr ganz schlanker Körper. Er kannte diese Anzeichen. Sie war in jenem Zwischenreich von Erde und Himmel, in das es alle Menschen wie sie und ihn zog, Menschen, die mit dem Leben auf der Erde haderten und denen der Himmel verschlossen bleiben würde. Dort, in der Welt halb Traum und halb Wirklichkeit, lebte sie jetzt für eine kleine Weile, ungezähmt und selig zugleich.
Seine Lippen glitten über ihren Hals, und gleichzeitig drang er in sie ein. Die Zähne zusammengebissen, packte sie ihn am Nacken, so wie man eine Katze packt, und drückte ihn noch fester an sich. Obgleich er in ihr war, war sie weit weg. Ihre Augen waren jetzt ganz geschlossen, und ihr kastanienbraunes Haar, schon ein wenig feucht, lag wie ein Schleier über ihrem Gesicht. Einmal rief sie seinen Namen, Marek, dann war sie wieder entschwunden. Gelegentlich lächelte sie, um gleich darauf den Mund bis zum Zerreißen anzuspannen.
Das war eine Stunde! Ihr Glück wurde zu seinem, denn er hasste es, allein zu genießen, darin steckte für ihn keine Freude. Und um die ging es hierbei doch, um Freude und um nichts anderes.
Gemächliches Hufgeklapper von draußen erinnerte ihn an die Kindheit auf dem Land. Diese Bilder tauchten immer mal wieder auf, in den seltsamsten Momenten, so wie Ängste sich auch ohne Vorwarnung einschleichen. Erinnerungsfetzen: die Birken am Haus, das galizische Hügelland, gespickt mit Kohleminen, Salzminen, Glashütten, schwarze niedrige Häuser zwischen Felsen, so ewig wie das Elend. Ein Bett neben dem Herd. Glasstaub überall auf dem Boden, auf dem Tisch, auf der Haut des Vaters. Eine Frau, deren Bauch sich einmal im Jahr füllte und wieder leerte und die seine Mutter war. Ihre zärtliche Hand. Seine Flucht.
Das Hufgeklapper wurde ihm jetzt zum Taktgeber. Marek wurde schneller. Sein Nacken schmerzte unter dem Druck ihrer Finger. Mit seiner ganzen Kraft hob er ihren Oberkörper ein wenig an, und seine Knie pressten sich an ihre Schenkel.
»Mein Gott«, rief sie ekstatisch. Bestimmt dachte sie in diesem Moment nicht an ihn.
Als Kind hatte Marek an Gott geglaubt. Seine Mutter war auf naive und stille Weise fromm gewesen: Das Leben war Schicksal, und das Schicksal kam von oben. Sie ertrug vier Totgeburten, den Tod ihrer elfjährigen Tochter, ertrug Arbeit von Dunkelheit bis Dunkelheit, die Armut, den fortwährenden Staub der nahen Glashütte, einen Mann, der nicht schlecht war, aber auch kein gutes Wort für sie hatte – sie ertrug alles. Sie nahm es auf sich, weil sie glaubte, dass sie eines Tages dafür belohnt würde, dass sie geliebt werden würde. So sehr hatte sie geliebt werden wollen, aber da war niemand, der es tat. Nicht einmal er, das einzige überlebende Kind. Heute, da sie tot war, liebte er sie, ja. Aber damals war sein Mitleid für sie so groß, dass die Liebe keinen Raum hatte. Als sie krank wurde und es zu Ende ging, hatte sein Vater, ihr Mann, schon die nächste Frau ausgesucht, die Schwester eines anderen Glasbläsers. Sie stand mit am Sterbebett und blickte beinahe neugierig auf die Todkranke hinab. Der letzte Blick seiner Mutter galt ihrer Nachfolgerin.
An diesem Tag hatte Marek Gott weggewischt. Es gab keine Liebe, also gab es auch keinen Gott. Hier und da fand man womöglich Überreste davon, so wie der Boden manchmal die Gerippe längst gestorbener Tiere freigab, doch die lebendige, sprühende, fortdauernde Liebe, die tief aus dem Herzen kommt, war nur eine Legende. Diese Überzeugung steckte so unerschütterlich in seinem Herzen wie ein Fels in der gefrorenen Erde.
Aber Freude konnte es geben, Lachen, Genuss und Vergnügen. Man konnte nicht das ganze Leben, jedoch einen Teil des Lebens in die eigene Hand nehmen. Zwei Menschen konnten sich aneinander wärmen, sich beleben, sich berühren, sich Hoffnung geben, sich zum Träumen bringen, die Wünsche für die Spanne einer Nacht greifbar machen, und das alles, ohne festzuhalten.
Er stieß zu.
Einen Atemzug lang war das Zimmer von ihrer und seiner Stimme erfüllt.
Dann war Reglosigkeit. Wenn man sich bewegte, ging eine Spur der Seligkeit verloren, die er und sie empfanden. So verharrten sie, sein Atem an ihrem Ohr, der ihre an seinem. Die Feuchtigkeit ihrer Körper vermischte sich, sie spürten die Knochen des anderen.
Irgendwann küsste er sie auf die Lider. Er wurde von einem Gefühl der Zärtlichkeit überschwemmt und gab es an Romilda weiter. In diesem Moment gab es nur sie und ihn, ein herrliches Gefühl, dessen Lebensdauer, das wussten sie beide, gering sein würde.
Diesmal war es nicht er, der es umbrachte.
»Schließ bitte das Fenster«, sagte Romilda, »die Nacht ist frisch, und ich bin keine junge Frau mehr.«
Sie war Mitte dreißig, zehn Jahre älter als er, und ihre Haut wurde in Schüben von winzigen Hügeln übersät, Gänsehaut, die mit jedem kalten Luftzug kam und ging. Er war durch tausend kühle Nächte abgehärtet. Offizier in der polnischen Armee zu sein, hieß, in einen Krieg nach dem anderen zu ziehen.
»Ich genüge dir wohl nicht mehr als Wärmespender«, scherzte er.
»Schließ es«, sagte sie nur und schlang sich die Arme um ihre Brust wie ein schüchternes Mädchen.
Er glitt erschöpft aus dem Bett. Es fiel ihm schwer, sich aus diesem kleinen, gemütlichen Reich von zwei mal zwei Metern loszureißen, aber er wollte, dass sie sich in seiner Gegenwart wohl fühlte, und gab ihr, was sie wünschte. Bevor er das Fenster schloss, warf er noch einen Blick auf den Rauch über der Stadt, der aus hundert Schornsteinen grau in die Nacht dampfte.
Er fühlte ihren Blick auf seinem Rücken, und eine Weile blieb er so stehen. Dann wandte er sich ihr zu. Die Kerze, die in einem Halter an der Wand steckte, warf ihr schwaches Licht gleichmäßig auf Romilda und ihn. Ihre Augenaufschläge erinnerten Marek an die Reiterattacken tatarischer Horden: Sie waren einschüchternd.
»Gefällt dir Danzig?«, fragte sie überraschend nüchtern. Wie konnte jemand, der solche Blicke aussandte, eine derart belanglose Frage stellen!
»Eine Stadt wie andere auch.«
»O nein, eine Folterkammer«, korrigierte sie ihn. »Hier ist so ziemlich alles verpönt, das mit Hochgefühl zu tun hat, vor allem das, was wir gerade getan haben. Aber wir haben es trotzdem getan, verstehst du, und das ist ein Sieg.«
Marek lächelte. »Wie häufig siegst du pro Jahr?«, fragte er amüsiert.
Sie ließ sich von seinem Lächeln anstecken, und die Falten, die sich auf der Stirn gebildet hatten, glätteten sich.
»Dreimal, viermal«, schätzte sie. »Das brauche ich, sonst gehe ich kaputt in dieser aus Anstand und Gottesfurcht gebauten Festung. Mein Mann weiß nichts davon, er ist ein Äffchen, und falls er doch etwas weiß, hält er den Mund. Deswegen habe ich ihn ja zum Mann genommen.«
Sie richtete sich halb im Bett auf und lehnte sich mit dem Rücken an das Kopfteil. Die langen Haare fielen ihr wie ein kupferfarbener Wasserfall bis zu den Brüsten. Sie war schön, so wie der Spätsommer schön ist, warm, fruchtbar und von verblassender Üppigkeit. Gegen ihre Opulenz wirkte er wie ein magerer Jüngling.
»Und du?«, fragte sie zärtlich.
Ich bin Offizier, hätte er antworten können. Offiziere, überhaupt alle Soldaten, galten als lockere Gesellen. Aber erstens wusste Romilda, dass er Offizier war, und zweitens erklärte das nichts, zumindest nicht in seinem Fall. Anders als Romilda suchte er solche Stunden nicht, um zu siegen. Er bezahlte die Frauen nicht, er eroberte keine Frauen. Wie im Tierreich konnte es Sinnlichkeit nur zwischen ihm und Frauen geben, die von der gleichen Art waren wie er, die dachten, wie er dachte. Es war eine gegenseitige Hilfe wie unter Bekannten, die eine Reise planten, um sich danach wieder zu trennen.
Mit dreizehn Jahren hatte er es zum ersten Mal getan, in der Woche, bevor er von zu Hause weggelaufen und dem Leben unter Glasstaub und Freudlosigkeit entkommen war. In seiner ersten Stunde mit einem Mädchen, eigentlich einer jungen Frau, hatte er verstanden, dass es noch anderes auf der Welt gab als Demut und Arbeit, und er verließ die Heimat um Tarnow in Polens Süden. Die Armee nahm ihn als Trommler auf, in dem Glauben, er sei schon sechzehn Jahre alt, und ohne dass er es beabsichtigt hätte, machte er dort Karriere, oder besser gesagt, die Kriege machten die Karriere für ihn. Die Ukrainer und die Tataren schossen ihm den Weg nach oben frei, indem sie seine Vorgesetzten töteten, und nun war er mit vierundzwanzig Jahren Leutnant und Waffenmeister im Stab des Marschalls. Und in all den Jahren hatten er und ein paar Frauen ihre Freude aneinander gehabt.
»Etwa ebenso oft«, antwortete er Romilda.
»Du könntest öfter«, sagte sie und musterte ihn von oben bis unten. »Wenn du noch ein paar Wochen in Danzig bleibst, würde ich darauf wetten, dass ein paar sittsame Damen schwach werden.«
»Ich kann höchstens noch zwei Wochen bleiben, dann sind meine Einkäufe für die Armee hier beendet, und ich muss meinen Vorgesetzten Bericht erstatten.«
»Wie schade, du verpasst etwas. Gut, auf dem Land ist man leidenschaftlicher, aber dafür ist es eine weitaus anspruchsvollere Aufgabe, eine verschlossene Danzigerin zu verführen. Der Reiz ist größer, du verstehst, was ich meine.«
Er setzte sich auf die Bettkante und spürte sofort Romildas Hand auf seinem unteren Rücken. »Diese Art von Reiz bedeutet mir nichts«, sagte er.
»Heuchler«, rief sie lachend. »Warum sonst wolltest du wohl, dass ich dich mit Lil Koopman, dem schönsten Fräulein der Stadt, zusammenbringe?«
Marek biss sich auf die Lippe und schmunzelte. Als Romildas Hand auf seine Brust glitt und sie ihn zu sich zog, gab er nach und ließ sich in Romildas Schoß fallen. Sein Blick ging zur Zimmerdecke.
»Lil«, sagte er und ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen, »Lil leidet unter diesem enthaltsamen Leben, und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als auszubrechen, sei es auch nur für eine Stunde. Als ich sie bei der Gesellschaft sah, die du gegeben hast, merkte ich das sofort. Es liegt in ihren Augen, weißt du? Diese Augen wollen leuchten, dürfen aber nicht.«
»Hast du sie zum Leuchten gebracht?«
»Ein wenig. Ich habe ihr Komplimente gemacht.«
»Wie hast du sie genannt? Eine Rosenranke? Einen Paradiesvogel? Hoffentlich nicht ›italienische Fürstin‹, so hast du nämlich mich genannt, als wir uns kennen lernten.«
Er lächelte sie an. Ja, er gab Frauen gerne Namen, denn es schuf stets eine persönliche, unverwechselbare Beziehung zwischen ihnen. Sicherlich übertrieb er manchmal, aber er sagte nie etwas, was nicht wenigstens ein bisschen passte. Romilda hatte tatsächlich ein italienisches Renaissancegesicht, wenn man den Bildern im Königsschloss zu Krakau glauben durfte.
Er erwiderte: »Lils blonde Locken, ihr zaghafter, schwebender Gang, die blasse, glatte Haut: Sie hat etwas Engelhaftes.«
»Einen Engel hast du sie also genannt, und mehr war nicht?«
»Wenig. Ein kleiner Kuss. Du weißt ja, wir hatten immer nur ein paar Momente für uns. Diese grässliche Tante bewacht sie wie eine heilige Flamme.«
Romilda nickte. »Tante Hemma. Wer sie als Verwandte hat, hat einen Grund zum Sterben. Lils jüngere Schwester, Elisabeth, hat es noch schlimmer erwischt: Sie wird wie eine Gefangene im Haus gehalten. Keine Gesellschaften, keine Besuche.«
Sie spielte mit seinen schwarzen Locken, und er fragte: »Kannst du dafür sorgen, dass ich Lil wiedersehe?«
»Schon, aber du wirst wieder nur wenig Zeit mit dem Engel haben.«
»Das macht nichts. Sie soll nicht denken, dass ich sie schon vergessen habe.«
»Ich sorge dafür, dass du bei Johannes Hevelius eingeladen wirst, dem Stadtrat.«
»Der die Sternwarte auf das Dach seiner Brauerei gebaut hat?«
»Seine Frau und er geben in einigen Tagen eine steife Gesellschaft, und zufällig weiß ich, dass die Koopmans auch dort sein werden. Mehr kann ich nicht für dich tun.«
»Wenn ich dich nicht hätte …«
»Hättest du eine andere.«
Ihr Gesicht schwebte über seinem, ihre Lippen über seinen Lippen. Sein müder Körper lebte wieder auf, spannte sich noch einmal, zum dritten Mal, zum letzten Mal in dieser Nacht.
2
Das Haus der Koopmans war der Feind des Zufalls. Alles hatte seine Zeit und Abfolge, so als habe Moses persönlich ein elftes Gebot vom Berg Sinai mitgebracht. Alles begann und endete stets zur selben Zeit, das Waschen wie das Beten, das Aufstehen wie das Schlafen, das Lernen wie das Essen.
Nur an jenem Morgen nicht.
Meistens wachte Elisabeth von allein auf, um zu sehen, wie der Morgenstern dicht über dem Horizont funkelte und gleich darauf wieder verschwand. An diesem Tag jedoch wurde sie schon vor der Zeit von Nore, der Zofe, geweckt.
»Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Bitte waschen Sie sich gleich, damit ich Sie zurechtmachen kann.«
»Ist Lil denn schon angezogen?« Lil war ihre zwei Jahre ältere Schwester, die nebenan schlief und immer als Erste angekleidet wurde.
»Nein, gnädiges Fräulein.«
Mehr sagte Nore dazu nicht. Mit ihren gewohnt raschen, präzisen Bewegungen stellte sie die Waschschüssel auf den Tisch, holte eines der sieben sehr ähnlichen grauen, braunen oder schwarzen Kleider aus dem Schrank, platzierte es neben die passende Haube auf das Bett, faltete das Nachthemd zusammen und legte es dorthin, wo sie es immer hinlegte und abends wieder herausholte, in das mittlere Fach des kleinen Schrankes, ganz so, als gehöre es zur architektonischen Formel des Hauses.
Ja, alles an Nore war wie jeden Morgen, nur die Reihenfolge stimmte nicht. Zum ersten Mal seit sieben Jahren, seit dem überraschenden Tod des kleinen Frans, als die Ordnung für einige Stunden zusammenbrach, würde Elisabeth nun vor ihrer Schwester angekleidet werden.
Irritiert beugte sie sich über die Schüssel mit Wasser und begann, ihren Körper nach und nach zu benetzen.
»Bist du sicher, dass du zuerst mich ankleiden willst?«, fragte Elisabeth nach.
Nores Gesichtsausdruck ließ erkennen, wie überflüssig diese Frage war. Aus dem Haushalt von Tante Hemmas letztem Mann übernommen, war sie seither fester Bestandteil des Uhrwerks, nach dem der Haushalt lebte.
Seit dreitausend Tagen.
Nach dem Ankleiden der beiden Töchter gingen diese stets zur selben Zeit ins Speisezimmer hinunter, und zwar exakt zum siebten Schlag der Glocke. Dort wurde jedem Hafergrütze gereicht, die wie eine schmutzige Pfütze in den Schüsseln lag und innerhalb einer Viertelstunde verzehrt werden musste. Um halb neun begann für Lil und Elisabeth der Unterricht bei Magister Dethmold, dem Hauslehrer, der sie an fünf Tagen in der Woche vier Stunden lang Deutsch, Polnisch, Mathematik und Geschichte lehrte. Am sechsten Tag teilte er sich seinen Unterricht mit dem örtlichen Probst, der die Koopman-Töchter so lange den Glauben eintrichtern sollte, bis sie vom Scheitel bis zu Sohle damit ausgefüllt wären, zwei wandelnde Gebetbücher in schwarzen Einbänden. Um halb eins wurde ein leichtes Mahl eingenommen, und von eins bis drei herrschte Mittagsruhe, die jeder allein in seinem Zimmer verbrachte. Den Höhepunkt des Tages bildete der nachmittägliche Spaziergang mit Tante Hemma von drei bis vier Uhr, allerdings nur bei schönem Wetter und nur, wenn Tante Hemma sich wohl fühlte – zwei Voraussetzungen, die selten genug gegeben waren. Der kurze Ausflug führte stets den Altstädtischen Graben entlang bis zur Katharinenkirche, niemals weiter, und es war typisch für Tante Hemma, dass sie nicht auf den Gedanken kam, wenigstens einen anderen Weg zum Haus zurückzunehmen. Elisabeth war die Strecke bereits dermaßen häufig gegangen, dass sie jeden Stein und jedes Kräutlein auswendig kannte und sie sich manchmal wunderte, warum sie noch keine Vertiefung in das Pflaster gelaufen hatte. Nach dem Spaziergang gab es eine Tasse Kaffee ohne Kuchen oder Gebäck, danach war eine Stunde Sticken oder Nähen oder Häkeln vorgesehen, jeweils im Wechsel, damit es – wie Tante Hemma sagte – nicht zu langweilig würde. Bis zur Abendtafel um sechs Uhr war auch ihr Vater Cornelius wieder aus seinem Handelskontor am Hafen zurückgekehrt, und nach einer Stunde Beisammensein hatte jede der Töchter unaufgefordert auf ihr Zimmer zu gehen.
Alles war eingespielt, alles dem Ablauf unterworfen, das Personal, die Lehrer, die Familie, ja, selbst die Gäste. Unangemeldete Besucher waren unerwünscht, Änderungen des täglichen Hergangs nicht vorgesehen.
Und nun das: Eine Regel wurde einfach umgestoßen.
Elisabeth schlüpfte in das knöchellange graue Kleid, und während Nore es zuschnürte, blickte Elisabeth zum Fenster hinaus. Danzigs ziegelrote Dächer leuchteten in der Morgensonne, umkreist von tausend Möwen, deren vertrautes Geschrei über allem lag. Elisabeth mochte es, da sie es mit Freiheit und Weite verknüpfte, ebenso wie die Masten der Segler unten am Hafen. Täglich liefen mehrere Schiffe aus, beladen mit Eisen, Kupfer und Blei aus den Minen im polnischen Süden sowie Glas aus dem deutschen Reich und Wein aus Frankreich. Umgekehrt fuhren in steter Folge Schoner und Korvetten ein, die außer Salz, Hanf und Häuten aus dem riesigen, unbekannten Russland auch noch Scharen von Matrosen ausspuckten. Die trinkfreudigen Seefahrer waren ein gutes Geschäft für die Wirte, vielen Danzigern jedoch ein Dorn im Auge.
Unglaublich, dachte Elisabeth, dass eine Stadt am Meer so muffig sein kann. Die meisten Einwohner waren Deutsche, denn im Jahre 1309 war Danzig an den Deutschen Orden gefallen und bald darauf Hansestadt geworden. Auch die Rückeroberung durch die Polen hatte daran wenig geändert. Man war eine »Freie Stadt«. Und man war protestantisch. Im Laufe der letzten Jahrzehnte waren vor allem aus dem von Religionszwisten zerrissenen deutschen Reich viele protestantische Zuwanderer hierhergekommen, aber auch aus den spanisch besetzten Niederlanden. Vor allem letztere Bevölkerungsgruppe, beeinflusst von der harten, aller Freuden abgewandten Zucht des Calvinismus, lehnte jedwede Lustbarkeit in der Stadt ab und versuchte, den Handelsplatz Danzig frei zu halten von allen Vergnügungen, die in ihren Augen die Sünde in sich bargen.
»Erledigt«, sagte Nore, als habe sie soeben einen Schießbefehl ausgeführt.
Elisabeth strich sich das schmucklose Kleid glatt und wartete auf das zustimmende Nicken der Zofe. Da Tante Hemma alle Spiegel im Haus abgeschafft hatte, weil sie von ihr als Sinnbild der Eitelkeit erkannt worden waren, musste man sich auf den prüfenden Blick der Zofen verlassen. Nore zerrte noch ein Weilchen an der Haube herum, schnürte sie unter dem Kinn noch etwas fester zusammen als sonst, und erst danach durfte Elisabeth sich auf den Weg machen.
Langsam ging sie den Gang entlang, das Holz der Dielen knarrte leise und vorhersehbar unter ihren Schritten. Sie passierte Lils Zimmer, das Zimmer ihres Vaters, das Zimmer Tante Hemmas, und nirgends war ein menschliches Geräusch zu hören. Von den Wänden starrten die Ahnenporträts sie an, öde, steinerne Gesichter mit leeren Augen, ein Kabinett der Trostlosigkeit. Als sie am letzten Raum vor der Treppe vorbeikam, blieb sie einen Moment stehen, hoffend, ein Geräusch zu hören, und sie dachte an den Kummer, der sich jeden Tag hinter dieser Tür abspielte.
Sie hörte ein Schluchzen.
Mutter, dachte sie. Mutter, halte durch.
»Gnädiges Fräulein«, hallte Nores mahnende Stimme von hinten, »man erwartet Sie im Frühstückszimmer.«
Elisabeth wünschte sich von einem Frühstückszimmer, dass es ein einziges weiches Lichtbündel wäre, ein Liebling der Sonne, ausgestattet mit weißem Damast auf Tisch und Stühlen. Früher, als sie noch ein kleines Mädchen war, hatte sie im Geiste das Haus neu ausgestattet, hatte den schweren, braunen Samt von den Fenstern gerissen, die groben Tücher und Decken durch Spitze ersetzt und statt der strengen niederländischen Ahnenporträts an den Wänden französische Landschaftsmalerei aufgehängt. Auch die hässlichen Kleider hatte sie weggeworfen und die Hauben lockerer in den Nacken gesetzt. In Gedanken war sie die Treppe hinuntergehüpft, statt sie gemächlich zu beschreiten. Sie hatte ihren Vater in den Arm genommen, mit ihrer Mutter Ausfahrten in der Kutsche gemacht und mit Tante Hemma und Lil Karten gespielt.
Nichts davon war je wahr geworden. Das Koopman-Haus glich dem Boden eines vertrockneten Brunnenschachts, und Elisabeth kam sich wie ein Pflänzchen vor, das um jeden Tropfen Licht kämpfen musste. Nirgendwo wurde die Düsternis des Hauses sinnfälliger als im Frühstücksraum, wo einzig durch einen schmalen Schlitz der Vorhänge ein wenig Sonne fiel.
Genauso wie die Tische und Stühle, so standen auch die beiden Menschen, die Elisabeth empfingen, immer am selben Platz: ihr Vater hinter einem Stuhl stehend, aufrecht, mit gepflegtem Oberlippen- und Spitzbart, das Gesicht eine starre Maske. Wie üblich trug er seinen schwarzen, geknöpften Gehrock mit schwarzen Strümpfen, schwarzen Schuhen und weißem Kragen, makellos und unübertroffen in der Schlichtheit, so dass man ihm den Kaufmannsreichtum nicht ansah. Schon Cornelius Koopmans Vater hatte, kaum in Danzig angekommen, sein Geld mit dem Erwerb und der Verschiffung von Waren verdient. Daran hatte sich auch bei Cornelius nichts geändert. Er hatte eine Frau aus einer Kaufmannsfamilie geheiratet, so wie es üblich war, und hatte Söhne haben wollen, die ebenfalls Kaufleute werden und Frauen aus Kaufmannsfamilien heiraten sollten. Doch dann war Frans, kaum fünf Jahre alt, gestorben, und nur die zwei Töchter waren ihm geblieben. An jenem Tag hatte Elisabeth zum letzten Mal ein Gefühl in ihm gespürt.
Hemma saß in der dunkelsten Ecke des Zimmers. Ihr kleines, rundes und unheimlich glattes Porzellanpuppengesicht wurde von der mächtigen Haube verschluckt, und das schwarze, mantelartige Kleid mit dem weißen Tellerkragen schien ein Eigenleben zu führen und eher Hemma mit sich herumzutragen als umgekehrt. Nur ihre Hände schienen zu leben und beschäftigten sich mit einer Näharbeit, wobei die Nadeln wie winzige Pfeile über den Stoff sirrten.
Keinem von ihnen wäre es eingefallen, morgens an einem anderen Platz zu stehen oder zu sitzen, um die übrige Familie zu empfangen. Für Elisabeth war es, als trete sie in ein Gemälde ein.
»Guten Morgen, Elisabeth«, sagte Cornelius und deutete ein Kopfnicken an. Seine rechte Hand hielt er hinter dem Rücken, die Linke lag vor ihm auf der Stuhllehne. »Tritt näher.«
Elisabeth knickste. »Guten Morgen, Vater.«
»Wie ich höre«, begann Cornelius mit dem trockenen Ton eines Kontoristen, »hast du in der letzten Nacht ungehörige Bemerkungen gemacht. Du nanntest das Wort ›Biest‹, und du hast gesagt, jemand solle verschwinden.«
»Ich erinnere mich«, sagte Elisabeth.
Mit dieser Antwort hatten die beiden wohl nicht gerechnet, denn sie sahen einander kurz an. Während Hemma sich jedoch dazu zwang, wieder zu nähen, blieb die steinerne Miene von Elisabeths Vater unverändert.
»Du erinnerst dich also, ja? Das heißt, du hast diese Bemerkungen in voller Absicht gemacht?«
»Ich habe schlecht geträumt, Vater, das wollte ich damit sagen. Da erschien immer wieder ein Ungeheuer. Alt war es und hässlich, an mehr erinnere ich mich nicht. Ich vermute, es war eher ein Sinnbild.«
»Ein Sinnbild wofür?«
»Nun, für irgendeine Gefahr eben, einen Kummer. Vom Probst wissen wir doch: Gott und die Engel schicken uns die Träume zur Warnung.«
»Du hast also nicht etwa ein Mitglied der Familie in deinem Traum gesehen?«, fragte Cornelius und deutete auf Hemma, die auf ihrem Stuhl zusammengesunken war, ein Ausbund an Bescheidenheit, wie ihn selbst eine Franziskanerin nicht besser hätte verkörpern können. Sie schien stets den Jammer der Welt auf ihren Schultern mit sich herumzutragen, und man verspürte in ihrer Gegenwart unwillkürlich den Zwang, leise zu sprechen, damit die arme Frau nicht zerbrechen möge.
Elisabeth wusste es besser.
Seit sie denken konnte, lebte die Schwester ihres Vaters in diesem Haus, dem Haus der Koopmans. Ihr Gatte, ein Reeder, hatte nach dem Untergang von zwei Schiffen in einer einzigen Sturmnacht kurz vorm Bankrott gestanden und war in die Weichsel gegangen und von ihr wieder tot ans Ufer ausgespuckt worden. Kinderlos und mittellos und sogar um ihre Mitgift gebracht, war Hemma vor zehn Jahren zu ihnen gezogen. Und von diesem Tag an hatte sich das Leben im Haus verändert, jeden Tag ein winziges Stückchen, so als würde es dahinschmelzen.
Die bekümmerte Stimme der Tante drang hinter dem Taschentuch hervor, mit dem sie sich Augen und Wangen betupfte. »Das ist nun der Dank, den ich bekomme für meine jahrelangen Dienste. Aber ich beklage mich nicht, noch trage ich den lieben Kindern irgendetwas nach. Ich bin bloß ein Gast, eine arme Witwe …«
Elisabeth verzog den Mund vor Abscheu, wenn auch nur ganz leicht, so dass ihr Vater es nicht bemerkte.
»Bestätige mir, Elisabeth«, drängte er, »dass du deine Tante gestern Abend nicht beschimpft hast.«
»Was für ein Gedanke, Vater! Eine solche Tat wäre ja geradezu aufrührerisch, nicht wahr? Wenn die Tante nicht mitten in der Nacht in mein Zimmer gekommen wäre, dann würde sie sich heute nicht betroffen fühlen.«
Noch bevor Hemma etwas erwidern konnte, setzte Cornelius der Diskussion ein Ende. Er warf einen Blick zur neuartigen mechanischen Wanduhr, die er jüngst erworben hatte und seither wie eine Reliquie verehrte. Er ging drei steife, wie abgemessene Schritte nach links, drei nach rechts, atmete kurz und heftig durch die Nase, so als würde er Tabak schnupfen, und sagte: »Lassen wir diesen Traum auf sich beruhen und reden wir über das Gras. Hemma berichtete mir, dass du Gras an den Füßen hattest, feuchtes, grünes Frühlingsgras, und auf dem Boden lag auch etwas davon.«
Elisabeth hielt die Luft an. An das Gras hatte sie nicht gedacht, und selbst wenn, sie hätte gestern keine Gelegenheit mehr gehabt, es abzustreifen. Wie sollte sie das erklären?
»Elisabeth«, sagte ihr Vater, »warst du im Garten?«
Es gab keinen Ausweg mehr. Würde sie jetzt leugnen, stünde sie als Lügnerin da, und dann würde man ihr auch die Geschichte mit dem Traum nicht mehr glauben.
»Ja, Vater«, gestand sie.
»Nachts im Garten?«
»Ja, Vater.«
»Was hast du dort gemacht?«
»Ich bin einfach nur so im Garten gewesen, wegen der Nachtluft.«
»Nachtluft bekommt man auch am Fenster.«
»Schon, aber …«
»Du verschweigst mir etwas, Elisabeth, und das habe ich nicht gern. Geheimnisse sind der Anfang aller Sünden.«
Wie zur Bestätigung blickte er zu Hemma und fragte: »Was sollen wir in diesem Fall tun, Schwester?«
Die Last dieser Frage schien Hemma niederzudrücken. »Ach je, Bruder, ich bin doch nur eine Verwandte, die zufällig hier lebt, ich habe nichts zu sagen.« Sie wartete einen Atemzug lang, der sich wie ein gedehnter Gedankenstrich ausbreitete, und fügte hinzu: »Aber wenn du mich fragst, gehört eine Lügnerin diszipliniert.«
»Welche Strafe schlägst du vor?«
»Oh, ich würde es nicht Strafe nennen, denn es geschieht ja zum Wohle der Sünderin. Nenne es Hilfe.« Die Uhr tickte dreimal, bevor sie hinzusetzte: »Mir blutet das Herz, aber es ist wohl notwendig, der Sünde keinen Raum zu geben, sich Elisabeths zu bemächtigen.«
Cornelius sah weder Elisabeth noch seine Schwester an, sondern blickte zur Uhr. »Du wirst wissen, wie das zu bewerkstelligen ist«, sagte er, verabschiedete sich rasch und ließ Elisabeth mit Tante Hemma in dem düsteren Raum zurück.
Es ergab sich nur selten, dass sie mit Hemma allein war, meistens waren ihre Schwester oder die Eltern anwesend, zumindest eine Zofe. Sie sprachen so gut wie nie miteinander, Elisabeth hätte auch nicht gewusst, worüber. Hemma hatte weder ein besonderes Interesse noch irgendwelche Talente geerbt oder entwickelt. Wenn doch, so waren diese im Keim erstickt worden. Hemmas Eltern hatten sie mit puritanischer Strenge erzogen, dazu gehörte auch das Verbot, Musik zu machen, zu tanzen, zu malen oder Gedichte zu schreiben. In den zehn Jahren, seit die Tante bei ihnen lebte, war es Elisabeth nicht gelungen, auch nur eine einzige Tätigkeit zu entdecken, an der Hemma Freude fand oder zumindest Gefallen. Stattdessen führte sie unentwegt Wörter wie Sünde und Versuchung im Mund, so als wären es die Namen verfeindeter Nachbarn.
Hemmas Miene, eben noch fleischgewordener Klagegesang, bekam plötzlich einen harten Zug.
Sie holte aus.
Der Schlag traf Elisabeth aus dem Nichts.
Schmerz zuckte über ihr Gesicht.
Sie torkelte, stürzte.
Elisabeth rieb sich die Wange, die wie Feuer brannte.
Hemma zeigte mit dem Finger auf sie. »Immer schon warst du widerborstig und trotzig gegen mich, siehst mich mit diesen teuflischen Augen an, und das, wo ich nur das Beste für euch alle will. Oder habe ich dir je etwas Schlimmes getan?«
»Das weißt du genau«, schrie Elisabeth.
»Bleib mir mit dieser alten Geschichte weg, die ist zehn Jahre her.«
»Ich hasse dich. Dich Biest zu schimpfen, ist noch viel zu nett.«
Hemma krallte ihre Finger in Elisabeths Haube und zog sie an den Haaren, schleifte sie herum mit einer Kraft, die man diesem schmächtigen Körper mit der Totenglockenstimme nicht zugetraut hätte. Ihr Toben war wie eine Eruption aus den finstersten Tiefen.
»Es gibt Mittel«, rief sie, »den Teufel auszutreiben. Und dies hier ist eines davon.«
3
Diese Nachricht würde die Welt erschüttern.
Der Himmel der Menschheit hatte sich ins Endlose gesprengt und war ein Stück feindlicher geworden, fand Johannes Hevelius und vergewisserte sich ein letztes Mal, dass seine unglaubliche Beobachtung kein Irrtum war.
Vor einigen Stunden, nach Einbruch der Dunkelheit, hatte er damit begonnen, sein Fernrohr auf das diffuse, neblige Band am Firmament auszurichten, das die alten Griechen galaxis genannt hatten, Milchstraße. Mit dem bloßen Auge betrachtet, schien es aus reinem Licht zu bestehen, angestrahlt von hinten, und nicht Wenige meinten, dass dort Gott zu suchen sei – diejenigen, die das vermuteten, waren natürlich keine Astronomen. Hevelius hatte zwar nicht gewusst, was er mit seinem neuen, verbesserten Instrument finden würde, Gott jedoch stand nicht auf der Liste seiner Erwartungen.
Zunächst war er enttäuscht gewesen. Das Nebelband war mittels des Fernrohrs näher an ihn herangerückt, wie es zu erwarten gewesen war, doch viel mehr als zuvor war nicht erkennbar. Zu schemenhaft war das Gebilde, zu verstreut sein Licht. Wozu, fragte er sich, gab es dieses Band? Es schien zu nichts nutze zu sein, strahlte kaum Helligkeit auf die Erde aus, beeinflusste keine Gezeiten, bildete keine Konstellation … Nicht einmal die Sterndeuter, von denen er wenig hielt, konnten etwas damit anfangen und es in ihre Voraussagen einbauen. Wenn man nicht annahm, dass Gott dahinter wohnte, und wenn man der antiken Mythologie nicht folgte, dass die Göttin Hera ihre nährende Muttermilch über den Himmel vergossen habe – was beides Unsinn war –, was für eine Erklärung blieb dann noch? Dass es, wie manche Astronomen fantasiereich mutmaßten, das Rückgrat der Nacht sei? Oder die Säule des Himmelszelts?
Diese Erklärungen waren ihm allesamt zu lyrisch und bilderreich. Astronomie war eine der ältesten Wissenschaften der Geschichte, und man durfte sie nicht den Träumern überlassen. Darum hatte er auch nicht aufgegeben, nachdem er gute zwei Stunden nichts als Nebel und Licht und Licht und Nebel gesehen hatte.
Und dann war es plötzlich da gewesen: ein einziges, winziges, isoliertes Strahlen, ein unbedeutendes Pünktchen inmitten der Milchstraße und doch separiert. Hevelius glaubte, seinen Augen nicht mehr trauen zu können. Fast wagte er nicht, sich vom Fleck zu bewegen, doch er musste es. Er musste seinen Augen etwas Ruhe gönnen, nur dann war gewährleistet, dass der Schein nicht trog, dass ihm keine Phantome vor den Augen tanzten, von der Wunschvorstellung geschickt. Denn er hatte ja zuvor genau das erhofft zu finden, was er nun tatsächlich gefunden hatte.
Viermal, fünfmal lief er im Kreis, maß die große, halb überdachte Dachterrasse ab, blickte vom Rand hinunter auf das schlafende Danzig mit seinem Gassengewirr – dann hielt er es nicht mehr aus und eilte zurück zum Fernrohr, das auf einem Untersatz angebracht war.
Der Lichtpunkt war immer noch da, und zwar an der selben Stelle. Kein Zweifel mehr, er, Hevelius, hatte einen neuen Stern entdeckt. Das Himmelszelt, wie es seit Tausenden von Jahren stand, wie es Babylonier, Ägypter, Griechen, Römer, Araber und Christen aufgebaut hatten, brach heute endgültig in sich zusammen.
Im Januar 1610 bereits hatte Galileo Galilei daran gesägt, als er vier Monde des Jupiter entdeckte, die ersten Monde überhaupt – außer jenem Mond natürlich, der die Erde begleitete. Weshalb, so fragte man sich daraufhin, sollte Gott Monde um andere Planeten kreisen lassen, um unbewohnte Welten? Am 7. November 1631 hatte Pierre Gassendi die Vorstellung vom Himmel weiter beschädigt, indem er Flecken auf der Sonne ausmachte, und das, wo die Sonne nach allgemeinem Glauben eine vollkommene Lichtkugel war. Und heute, am 7. Juni 1662, war der letzte Zweifel beseitigt, dass die Milchstraße eine Ansammlung von Sternen war, so weit entfernt, dass sie mit bloßem Auge nicht erkennbar waren. Wieso erschuf Gott Welten, die von der Erde aus ohne Hilfsmittel nicht gesehen werden konnten? Was ergab das für einen Sinn, wo doch der Himmel für die Erde geschaffen worden war? Viele Jahrtausende lang hatte es die Sterne in der Milchstraße nicht gegeben, jedenfalls nicht für Menschen, und daraus folgerte: Sie waren nicht für die Menschheit gemacht.
Eine Revolution! Hevelius stand eine Weile nur so da, nach oben blickend, und dachte nach. Ein Himmelszelt, wie Aristoteles es gebaut hatte, gab es von nun an nicht mehr. Der enge Raum um die Erde herum dehnte sich plötzlich in eine gewaltige, schwarze Sphäre aus, in der die Erde nur noch eine Provinz des Kosmos darstellte.
Der Raum war feindlicher geworden.
»Johannes?«
Katharina war gekommen. Noch bevor er sich zu ihr umdrehte, wusste er, dass sie ein Tablett voll chinesischem Porzellan vor sich hertrug. Wenn er sich manchmal in der Nacht, während er hier in seiner Sternwarte arbeitete, das Antlitz seiner Gattin in Erinnerung rief, dann war es stets mit einem sanften Lächeln versehen, gütigen Augen – und Händen, die etwas trugen. Katharina musste immer irgendetwas bringen. Sie kam nie einfach nur so bei ihm vorbei, weil sie sich für den Fortgang seiner Arbeit interessierte oder um sich mit ihm über die Sterne zu unterhalten, sondern stets, um ihm eine Tasse Tee zu bringen oder einen Krug Wasser.
»Ich stelle den Tee hier ab, er ist noch schön warm, also bediene dich schnell. Soll ich dir eine Tasse einschenken?«
Sein Blick streifte sie bloß. »Nein, danke«, sagte er. Er spürte wieder diesen unerklärlichen leisen Zorn auf sie in sich wachsen. Das Weltsystem des Aristoteles lag zerschmettert am Boden, die Erde war zu einem verlorenen Glühwürmchen im All geworden – und Katharina brachte ihm Tee. Sie kam nicht einmal auf den Gedanken, nach seinen Forschungen zu fragen.
Während er wieder hinaufblickte, reichte sie ihm eine Tasse, obwohl er sie zuvor abgelehnt hatte. Sanft drängte sie ihm das Porzellan in die Hände und versenkte ihren Blick in seine Augen. Katharina hatte die milde, unaufdringliche Schönheit einer Heiligenstatue, jener Skulpturen, die von den Kirchenfassaden des alten, katholischen Glaubens herablächelten.
»Ich habe heute einen Stern entdeckt«, sagte er.
»Tatsächlich?«
»In der Milchstraße, ja. Die Milchstraße scheint ein riesiger Sternhaufen zu sein, sehr weit von uns entfernt, unermesslich weit. Galilei und Huygens haben so etwas schon geäußert, jetzt ist auch für mich der letzte Beweis erbracht.«
»Dann hast du ja übermorgen Abend ausreichend Gesprächsstoff. Du hast doch die kleine Tafel nicht vergessen, die wir geben, oder? Die Bergs kommen, die Berechtingers, die Melchiors, die Koopmans und der junge Janowicz. Ich decke nur etwas Brot, Wurst und Käse auf.«
Da war es wieder, das, was immer geschah. Er sprach über die Sterne, sie über Käse.
»Wer ist Janowicz?«, fragte er lustlos, und die Enttäuschung über ihr Desinteresse ließ seine Hand zittern.
»Marek Janowicz, ein junger polnischer Offizier, Waffenmeister, glaube ich. Romilda Berechtinger hat mich gebeten, ihn einzuladen.«
»Du weißt, dass ich Offiziere nicht mag. Sie sind fast durchweg Befehlsempfänger von schwerfälligem Geist.«
»Ich setze ihn neben dich, das wird ihn befruchten.«
»Wir haben keinen Platz für einen dreizehnten Gast am Tisch.«
»Koopmans haben für ihre jüngste Tochter abgesagt. Sie ist wohl krank geworden, das arme Ding. Mit fünfzehn in die Gesellschaft eingeführt zu werden, ist schon arg spät, und nun verpasst sie auch noch dieses Ereignis. Ich frage mich, ob man sie jemals gehen lässt. Sie kann einem leid tun. »
Hevelius seufzte. Das Schicksal einer Kaufmannstochter interessierte ihn recht wenig, alles interessierte ihn wenig, außer seinem Stern.
»Setze diesen Janowicz meinetwegen neben mich«, sagte er. »Ich werde es überstehen.«
Er stellte die Tasse ab, weil das Zittern zu stark wurde. Da kam ihm eine Idee, eine wunderbare Idee, wie er seine Frau doch noch würde begeistern können für seine Entdeckung.
»Katharina«, rief er enthusiastisch, »bitte gib ihm einen Namen.«
»Marek Janowicz?«
»Vergiss diesen Janowicz. Ich spreche von meinem Stern, Katharina. Gib ihm einen Namen. Stell dir vor, du taufst einen Stern, und noch in tausend Jahren trägt er einen Namen, den du dir nun ausdenkst.«
»Mir fällt so schnell keiner ein.«
»Lass dir Zeit. Ich trinke noch einen Tee, und du überlegst so lange.«
»Also, ich weiß nicht, Johannes.«
»Möchtest du ihn sehen? Vielleicht inspiriert dich das.«
»Ich kenne mich mit Sternen nicht aus.«
»Das macht doch nichts. Man muss sich auch nicht mit Kindern auskennen, um ihnen einen Namen zu geben.«
Sie räumte mit ruhigen, gemessenen Bewegungen Kanne und Tasse auf das Tablett zurück. »Ich möchte das nicht, Johannes.«
Verdutzt betrachtete er sie. »Aber – warum denn nicht?«
»Ich – ich finde es vermessen, einen Stern zu taufen.«
»Vermessen?«
»Oh, frag nicht weiter, Liebster, mir liegen diese Dinge einfach nicht.«
»Was ist denn daran vermessen, einem neuen Stern einen Namen zu geben?«, fragte er gereizt. »Wie soll er denn genannt werden, wenn man über ihn spricht, einfach Stern? Es gibt Hunderte von Sternen, sollen die alle Stern heißen? Stern Nummer eins, Stern Nummer zwei und so weiter?«
»So meinte ich das nicht, Liebster. Ich fühle mich bloß nicht berufen dafür …«
»Entschuldige«, unterbrach er sie. »Vergiss, worum ich dich gebeten habe. Ich sehe jetzt, dass es zu viel verlangt war, sich von dir einen Namen ausdenken zu lassen. Du bist sicher müde. Gute Nacht.«
»Gute Nacht«, erwiderte sie in unverändert sanftmütigem Ton, aus dem er heraushörte, dass seine Vorwürfe und sein Ärger sich verloren hatten wie in einem stillen Teich. Sie hatte sie einfach verschluckt, und nichts würde morgen noch an sie erinnern.
Das milderte jedoch sein schlechtes Gewissen nicht, das ihn nun plagte. Er hätte nicht so harsch sein sollen. Katharina konnte nichts dafür, dass sie plötzlich mit einem Astronomen verheiratet war, denn als sie heirateten, war er ein angehender Kaufmann. Die Ehe war seinerzeit, vor sechsundzwanzig Jahren, arrangiert worden. Er war der einzige Sohn eines Danziger Brauereibesitzers und sie das einzige Kind eines benachbarten Brauereibesitzers gewesen, so einfach war das. Gekannt hatte er Katharina kaum, und sie ihn auch nicht, denn fast seine ganze Jugend hatte er an Universitäten in Graudenz und Leiden Mathematik, Jura und Ökonomie studiert und sich nur nebenbei, fast heimlich, während seiner Reisen nach London und Paris mit Astronomie beschäftigt. Der Ruf seines kränkelnden Vaters hatte ihn nach Danzig zurückgeholt, und eilig wurden damals alle Vorkehrungen getroffen, damit er, Johannes Hevelius, die Geschäfte übernehmen konnte. Die Fusion der beiden Unternehmen nach dem Tod der Väter ließ die größte Brauerei der Freien Stadt Danzig entstehen, und schon bald war er in den Stadtrat berufen worden.
Nach und nach hatte er sich jedoch der Himmelskunde zugewandt und schließlich diese Sternwarte auf den Dächern der Brauereigebäude und des Privathauses errichtet. Er hatte ein Buch über den Mond verfasst und den Saturn näher erforscht, hatte Kometen beobachtet, Finsternisse berechnet, neue Winkelmessinstrumente gebaut und damit die Stellung von Sternen am Himmel genau vermessen. In Paris, London und Bologna kannte man ihn einzig als Astronomen, bloß in Danzig sahen die Leute in ihm noch den Kaufmann und Stadtrat, der auch noch ein wenig am Himmel forschte.
Katharina nahm ihm eine Menge Arbeit in der Brauerei ab, führte die Bestelllisten, überwachte die Produktion, kontrollierte den Transport des Bieres in andere Länder … Den Haushalt meisterte sie ganz nebenbei mit gelassener Hand. Es gab niemanden vom Personal, der sie nicht achtete und sogar liebte. Nie kam ein böses Wort über ihre Lippen, nie war ihr Blick strafend, nie zeigte sie sich bekümmert, weil ihre Ehe keine Kinder hervorgebracht hatte. Wie eine von allen verehrte Äbtissin streifte sie geräuschlos durch die Räume und behielt die Dinge im Auge.
Sie war wunderbar, das wusste er, doch sie war auch leidenschaftslos. Katharinas ganzes Glück schien darin zu bestehen, andere mit Blicken und Gesten froh zu machen – und mit Tee. An einem Abend wie diesem jedoch, wo er eine Welt entdeckt und dadurch eine andere verändert hatte, hätte er mehr als das gebraucht. Er platzte geradezu vor Stolz, und sobald er seine Beobachtung kundmachen würde, träfen gewiss Briefe aus ganz Europa ein, von gelehrten Theologen und Astronomen, die mit ihm die Auswirkungen des weiter veränderten Weltbildes besprechen wollten.
Doch hier, in seinem eigenen Haus, war die Wirkung seiner Entdeckung nicht größer, als wenn er ein Blümlein von einer Wiese mitgebracht hätte. Niemand freute sich mit ihm, niemand gratulierte. Er verlangte ja gar nicht, dass Katharina durch Fernrohre blickte, den Sextanten bediente und mathematische Berechnungen anstellte – im Gegenteil, sie hätte ihn nur durcheinandergebracht und gestört, denn diese Arbeit war nichts für Frauen. Frauen besaßen einfach keinen mathematischen Verstand.
Aber ein wenig Bewunderung! War das denn zu viel verlangt?
Die ganze Erde war in Sünde eingehüllt, und für Hemma lauerte sie überall. Sie konnte sich hinter einem Lachen verbergen, in einem Augenaufschlag, in der Freude über ein Kompliment, im Genuss eines guten Essens, in der Neugier, im Gefallen, den man einem Freund erwies, und da man als Protestant die Sünde nicht einfach im Beichtstuhl abladen konnte – wie bei den Katholiken –, schichtete sie sich zu gewaltigen Ungetümen auf. Im Traum erschienen sie ihr manchmal, diese aus Sünde gebauten Ungetüme, und nahmen entsetzliche Gestalten an, peitschten sie durch die Nacht, bis sie schweißgebadet erwachte und Blut auf der Zunge schmeckte. Kein Kraut und keine herkömmliche Medizin waren dagegen gewachsen.
Ihr Gatte, der Reeder, hatte vor zehn Jahren die Todsünde eines Selbstmordes begangen, und seitdem wurde Hemma von der Hölle gejagt. Vorher war es ihr recht gut ergangen, ihr Gatte war fromm, arbeitsam und geachtet gewesen, und sie hatte jede Nacht den Schlaf des Gerechten geschlafen. Ein Kind sollte dieses vollkommene Sittengemälde komplettieren, doch ein Sturm, eine simple Wetterlage, hatte gereicht, um ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Anton, der Ruinierte, hatte nicht mit ihr gesprochen, bevor er sich ertränkte, nein, er hatte ihr noch nicht einmal einen Abschiedsbrief hinterlassen, sondern war einfach so ins Wasser gegangen, als habe er keine Frau zu Hause, mit der er vier Jahre lang zusammengelebt hatte. Sie hatte sich – bestärkt von den stechenden Augen des Pastors – Vorwürfe gemacht, nicht für ihn da gewesen zu sein, als er sie brauchte, nicht auf die Anzeichen der sündhaften Gedanken geachtet zu haben, die in ihm entstanden: seine Pupillen, die nach einem Ausweg suchten, die Papiere in seinen zitternden Händen … Eine ganze Woche lang hatte sie das gesehen, ohne es wirklich zu sehen.
In der Nacht, nachdem man seine nackte Leiche, angeschwemmt wie ein verendeter Fisch, am Ufer der Mottlau gefunden hatte, war sie zum ersten Mal von der Hölle berührt worden. Anfangs hatte sie geglaubt, durch Gebete der Angst Herr zu werden, doch trotz wunder Knie hörten die Albträume nicht auf. Sie konnte sich nicht mehr umdrehen, ohne die ganze böse Welt in ihrem Rücken zu spüren. Die einzige Möglichkeit, von der Angst nicht erdrückt zu werden, war, künftige Sünden zu verhindern. Sie musste sie bekämpfen, jeden Tag, wo sie stand und ging, und zwar nicht nur die eigenen, sondern die aller Menschen um sich herum, nur dann war ihr etwas Ruhe gegeben.