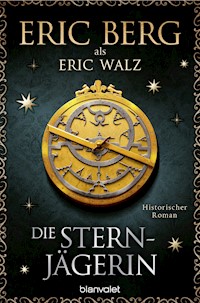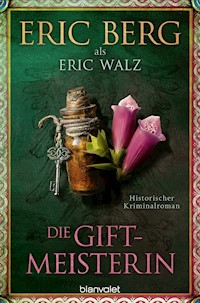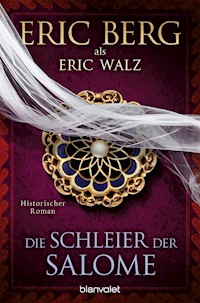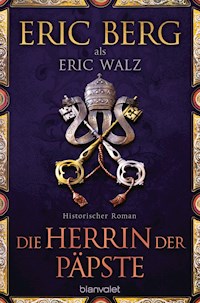9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Porzellan-Dynastie
- Sprache: Deutsch
Zwei Schwestern zwischen Krieg und Liebe, eine glanzvolle Familie zwischen Überleben und Untergang.
Frankfurt 1936: Nach harten Jahren scheint sich das Schicksal der Familiendynastie der Blankenburgs wieder zum Besseren zu wenden. Die Streitigkeiten zwischen den Schwestern Ophélie und Elise sind beigelegt, der französische Zweig der Porzellanmanufaktur unter der Leitung von Ophélies Mann prosperiert, und im Königsteiner Stammhaus führt Elise erfolgreich die Geschäfte.
Doch dann bricht Krieg über Europa herein, und die Gräben innerhalb der Familie vertiefen sich erneut: Der ungeliebte uneheliche Neffe Tankred steigt als strammes Parteimitglied in der SS weiter auf, und ein grauenvoller Verrat bringt ein Familienmitglied in tödliche Gefahr.
Die Porzellan-Dynastie:
Die Blankenburgs
Das Schicksal der Blankenburgs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Frankfurt 1936: Nach harten Jahren scheint sich das Schicksal der Familiendynastie der Blankenburgs wieder zum Besseren zu wenden. Die Streitigkeiten zwischen den Schwestern Ophélie und Elise sind beigelegt, der französische Zweig der Porzellanmanufaktur prosperiert, und auch im Königsteiner Stammhaus führt Elise erfolgreich die Geschäfte. Doch dann bricht Krieg über Europa und die Blankenburgs herein. Die Verbindungen zum französischen Teil der Familie reißen ab, und die persönlichen sowie ideologischen Gräben innerhalb der Familie vertiefen sich erneut: Der ungeliebte uneheliche Neffe Tankred steigt als strammes Parteimitglied in der SS weiter auf, und ein grauenvoller Verrat bringt ein Familienmitglied in tödliche Gefahr. Bevor der Krieg endet, werden Intrigen, Verrat, Liebe und Hass die Mitglieder der Familie Blankenburg weiter auseinanderreißen, andere zusammenschweißen – Allianzen werden geschlossen und wieder gebrochen, die einstigen Verlierer werden hoch steigen, die vermeintlichen Gewinner werden tief fallen.
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen Kriminalromanen – fast allesamt SPIEGEL-Bestseller –, in denen er bereits starke Frauenfiguren ins Zentrum rückt, widmet er sich jetzt dem historischen Roman und beeindruckt mit detailreichen Schilderungen, pointierten Dialogen und hervorragender Recherche. »Die Blankenburgs« erzählt vom Aufstieg und Fall einer imposanten Porzellandynastie und von den Frauen der Familie, die dem Schicksal die Stirn bieten und im Angesicht großer Not über sich hinauswachsen.
Von Eric Berg bereits erschienen
Die Blankenburgs (1) · Das Schicksal der Blankenburgs (2) · Die Herrin der Päpste
Kriminalromane:
Das Nebelhaus (Doro Kagel 1) · Das Küstengrab · Die Schattenbucht · Totendamm · Die Mörderinsel (Doro Kagel 2) · Die Toten von Fehmarn (Doro Kagel 3)
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
ERIC BERG
Das Schicksal
der Blankenburgs
Band 2
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Eric Berg
Copyright © 2022 by Blanvalet
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von
Richard Jenkins Photography, stock.adobe.com (Andrey Kiselev, Piotr Wawrzyniuk, sforzza), Shutterstock.com (wacomka, Be_your_self, Ysbrand Cosijn) und Colin Thomas / bookcoversphotolibrary.com
WR · Herstellung: sam
Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss
ISBN 978-3-641-27663-8V002
www.blanvalet.de
Stammbaum
Für Mutsch.
Ich liebe Dich, und ich wünschte, ich könnte viel mehr für Dich tun.
»Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.«
Georg Büchner, deutscher Literat
Erster Teil
In der Falle (1936)
1
Es war der Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Berlin, der Tag, an dem die Welt ein großes Fest veranstaltete, und Elise stand vor der grausamsten Entscheidung, die ein Mensch treffen konnte – jener zwischen ihrem Mann und ihrem Kind.
Immer wieder durchmaß sie die Suite des Hotels Adlon mit schnellen Schritten, blieb am Fenster stehen, schob die Gardine zur Seite und warf einen Blick auf das Brandenburger Tor, als sei von dort Hilfe zu erwarten. Die Straßen waren mit zahllosen Hakenkreuzfahnen und den Flaggen der neunundvierzig Nationen geschmückt, die an der Olympiade teilnahmen. Ein Strom von Menschen bewegte sich auf dem Boulevard Unter den Linden von Ost nach West. Die Euphorie drang von allen Seiten an Elises Ohren, von draußen durch die Fenster und von den Fluren des Adlon durch die Tür. Es war wie ein stechender Schmerz, zusätzlich zu den anderen Leiden, die Elise gerade ausstand.
Sie griff zum Telefon. »Empfang? Ich erwarte ein Gespräch, das mir für neun Uhr avisiert wurde. Nun ist es bereits zehn, und ich … Was meinen Sie mit überlastet? Das Telefonat ist äußerst wichtig.«
Ungeduldig lauschte sie den nichtssagenden Beschwichtigungen des Rezeptionisten.
»Die Olympischen Spiele sind mir egal, hören Sie? Mein Mann versucht, mich zu erreichen, es geht um Leben und Tod … Nein, ich werde mich nicht beruhigen. Tun Sie einfach Ihre Arbeit.«
Sie warf den Hörer auf die Gabel. Natürlich war sie ungerecht. Hunderte von Hotelgästen wollten ihre ersten Eindrücke von den Feierlichkeiten nach Hause melden. Das Hotel war ausgebucht. Für zwei Wochen war Berlin so etwas wie die Welthauptstadt, und das Adlon war die beste Adresse. Absichtlich hatte Elise übertrieben, als sie von Leben und Tod sprach, und zudem verschwiegen, dass der Anruf, den sie erwartete, aus dem Gefängnis kommen würde. Dieses Detail wäre einer bevorzugten Bearbeitung durch die Telefonzentrale gewiss nicht förderlich gewesen. Der Gedanke jedoch, dass Isaac sie wegen einer pompösen Nazi-Parade nicht erreichte und sie seine Stimme, die sie seit Monaten entbehrte, nicht hörte, ließ sie fast verrückt werden.
Im Zimmer nebenan quengelte ihr Sohn, der kleine Noah. Mit seinen zwei Monaten war er in einem Alter, in dem selbst seine Quengelei Elises Mutterherz höherschlagen ließ.
Sie öffnete die Tür zum Nebenzimmer. »Alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Er hat schon wieder Hunger«, antwortete Biene und legte den Säugling an die Brust. Sie war für eine Frau recht groß und korpulent und hatte Wangen so rot wie Weihnachtssterne.
Elise hätte Noah gerne selbst gestillt, aber das war eines der Dinge, in der sie ihre Erziehung über ihren Instinkt stellte. Eine Frau ihres Standes tat so etwas nun mal nicht selbst, schon gar nicht, wenn sie Mitte vierzig war und bereits Großmutter hätte sein können. Biene, die eigentlich Eberhardine hieß, war eine mehr als würdige Stellvertreterin. Seit vielen, vielen Jahren in den Diensten der Familie Blankenburg, hatte sie sich zum ersten Hausmädchen und, mehr noch, zum Faktotum entwickelt. Ihr konnte Elise alles sagen, jede Wahrheit und jede Schmach anvertrauen.
»Immer noch nichts?«, fragte Biene, während sie ihre üppige Brust an Noahs Lippen führte.
»Da draußen ist die Hölle los«, sagte Elise kopfschüttelnd.
»Ein wahres Wort, gnädige Frau. Das ist wirklich die Hölle: ein Fest des Friedens, ausgerichtet von Raubrittern. Eine Schande, dass kein Land diese Scharade boykottiert, nicht einmal die Franzosen und Engländer, denen Hitler seit Jahren auf der Nase herumtanzt.«
»Ach, als ob ein Boykott etwas ändern würde …«
Es war schon Ironie, dass Biene, die sich noch vor ein paar Jahren nicht im Mindesten für Politik interessiert hatte, sich plötzlich als Aufwieglerin verstand, wohingegen Elise als Tochter eines zeitlebens hochpolitischen Wirtschaftsmagnaten die Politik am liebsten mit all dem anderen stinkenden Zeug auf den Kompost geworfen hätte. Seit dem Börsensturz von 1929, dem »Schwarzen Freitag«, der ihren ersten Mann und ihren Vater das Leben gekostet hatte, stand Elises Welt Kopf – zuerst der drohende Ruin der ererbten Porzellanmanufaktur, die hoch verschuldet war, dann die Nazis, die ihre Familie spalteten und zerpflückten. Sie wollte der Politik einfach nicht verzeihen, dass sie sich in ihre intimsten Belange einmischte, vor allem in ihre noch junge Ehe mit einem Juden.
Im Türrahmen stehend, schweifte Elises Blick über Bienes Dienstbotenzimmer, das obligatorisch war für ein Hotel wie das Adlon, in dem kaum ein Gast ohne Hausangestellte anreiste. Die Einrichtung war solide, aber unpersönlich: Bett, Schrank, Tisch und Stuhl aus ungeöltem Kiefernholz. Die Wiege des kleinen Noah stach daraus hervor wie eine Schwarzwälder Torte zwischen lauter Rührkuchen. Für einen kurzen Moment erfasste Elise die Diskrepanz der beiden Zimmer – früher hatte sie sich um solche Dinge keine Gedanken gemacht –, und sie verstand, warum die Nazis mit ihrer Idee der Gleichheit und der Abschaffung der Stände einen solchen Erfolg bei den Massen hatten. Doch dann klingelte das Telefon, und alles andere war vergessen.
»Isaac«, rief sie in die Sprechmuschel. »Liebster.«
»Ein Gespräch für Sie, Frau Löwenkind. Aus dem Gefängnis Moabit.« Der Unterton des Rezeptionisten troff von unverhohlener Verachtung. Auch das war die neue Zeit: Die Privilegien des Respekts und der Höflichkeit genossen nur diejenigen, die mitspielten. Frauen, deren Ehemänner im Gefängnis saßen, gehörten zu den Spielverderbern.
In der Leitung knackte es, woraufhin Elise erneut rief: »Isaac? Bist du es? Liebster?«
»Kriminalsekretär Koppe.« Die Stimme des Gestapo-Mannes klang kühl und distanziert, war jedoch frei von Herablassung. »Man hat Ihrem Gatten gestattet, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben fünf Minuten, die Zeit läuft.«
»Isaac«, presste sie hervor. »Liebster?«
»Ich bin hier.«
»Isaac!«
»Ja.«
Einige Sekunden lang brachte sie kein Wort hervor, nur Laute, die sich in ihren Ohren seltsam anhörten, als stammten sie nicht von ihr, von überhaupt keinem menschlichen Wesen.
»Was …?«, begann sie endlich, hielt sich jedoch im letzten Augenblick zurück, ihn zu fragen, was sie mit ihm gemacht hatten. Gewiss hörten sie mit.
»Wie geht es dir?«
»Gut. Aber erzähl mir lieber von unserem Kind.«
Seit Isaacs Verhaftung war viel passiert, weshalb Elise manchmal vergaß, dass er seinen Sohn noch nie zu Gesicht bekommen hatte, ja, noch nicht einmal wusste, welches Geschlecht sein Kind hatte.
»Wir haben einen Sohn, Isaac. Er ist gesund. Er hat andauernd Hunger. Er schläft sehr viel, fast zu viel für meinen Geschmack. Ich mag es, wie er mit seinen Ärmchen fuchtelt. Und wie er lächelt. Er lächelt für drei. Er ist … ist so … wunderschön.«
Obwohl Elise sich vorgenommen hatte, auf keinen Fall zu weinen, brach sie in Tränen aus. Sie bemühte sich zwar, es zu überspielen, doch den Mann, der sie aufrichtig liebte, konnte sie nicht täuschen.
»Du musst nicht tapfer sein«, sagte Isaac, der seinerseits versuchte, etwas vor ihr zu verbergen, und ebenso scheiterte.
Die Erschöpfung lag wie ein öliger Film auf seiner Stimme, sosehr er sich auch bemühte, sie mittels übertriebener Lautstärke zu verhüllen. Elise schob seinen Zustand auf die Haft, weil der Gedanke, dass er noch Schlimmeres über sich ergehen lassen musste, sie zu sehr niedergedrückt hätte. Es gab Gerüchte.
»Vier Minuten«, rief der Gestapo-Mann dazwischen.
»Er heißt Noah«, berichtete sie weiter, wischte sich die Tränen von den Wangen und nannte Isaac das Gewicht, die Farbe der Augen, der Haare, der Gesichtshaut … »Er kommt sehr nach dir.«
Das war nicht ganz die Wahrheit, man könnte auch sagen, es war geschwindelt. Eine Lüge, um der Liebe willen.
»Noah«, wiederholte er, als handele es sich um eine Verheißung.
»Ja. Ich hoffe, der Name gefällt dir. Wir haben vorher ja nie darüber gesprochen.«
»Ja, er gefällt mir. Noah, der Neubeginn.«
»Drei Minuten.«
Elise ertappte sich dabei zu hassen. Es war ein neuartiges Gefühl für sie, so unangenehm wie kratzende Wäsche. Den Gestapo-Mann, seine Behörde, deren Erfinder, den vorherrschenden Ungeist und die Unmoral – alles zusammen wünschte sie zum Teufel. Genau das wollten diese Leute. Sie beschränkten sich nicht darauf zu verhaften, zu verhören, auszugrenzen, sie drängelten sich nicht nur in das Leben der Missliebigen, sondern auch in ihre Gedanken und Gefühle. Sie sollten werden wie diese Leute selbst, verachtend.
»Geht es dir wirklich gut?«, fragte sie.
»Ja. Erzähl mir von dir.«
»Sie wollen dich in Kürze vor Gericht stellen.«
»Ich weiß. Sprechen wir lieber von dir.«
Die Nachricht hatte Elise eine Woche zuvor brieflich erreicht, und seltsamerweise war sie daraufhin für eine Minute getröstet, ja, geradezu glücklich gewesen. Isaac lebte. Und nicht nur das, er verschwand nicht einfach, so wie einige Jahre zuvor sein Sohn Esra oder wie kürzlich Elises Schwägerin Chen Lu, die von den Nazis verschleppt worden waren. Erst ein paar Atemzüge später war ihr bewusst geworden, dass dieses Gerichtsverfahren nur Makulatur sein und zu einem Schauprozess gegen den »verbrecherischen Juden« verkommen würde.
»Ich werde dabei sein«, sagte sie.
»Nein.«
»Doch, Isaac. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen.«
»Du bist in Berlin?«
»Um in deiner Nähe zu sein. Und um für dich auszusagen.«
»Nicht doch!«
»Aber ja. Die Anschuldigungen sind lächerlich. Drogenschmuggel, so ein Mumpitz. Wir wissen beide, wer der wahre Übeltäter ist. Ich zumindest bin mir sicher. Am Abend deiner Verhaftung hatte ich eine Unterredung mit …«
»Zwei Minuten«, blaffte der Gestapo-Offizier dazwischen.
»Hör mir bitte zu, Elise«, bat Isaac in jenem Tonfall, in den sie sich sechs Jahre zuvor als Erstes verliebt hatte: sanft und friedlich, ohne alles Belehrende. Ein paar Worte nur, das warme Timbre seiner Stimme, und Elise erlebte all die Gefühle für ihn aufs Neue, die Erinnerungen an die schönen Tage und den Schmerz über deren nahenden Verlust.
Sie setzte sich und schloss die Augen.
»So ist es gut«, sagte er, als befände er sich im Raum und sähe sie vor sich, als blicke er auf sie nieder, streichle ihre Haare … »Liebste, du musst nach Frankreich fahren, zu deiner Schwester. Dort allein bist du sicher. Tu es für Noah. Tu es für mich.«
»Aber der Prozess …«
»… ist bedeutungslos. Seien wir ehrlich, ich bin verloren.«
Dieses Wort stach tief in ihr Herz, wo es erbarmungslos wütete. Schlimmer als alles, was die Gestapo ihr antun konnte, war die Tatsache, dass Isaac sich aufgab. Objektiv hatte er allen Grund dazu. Doch war die Objektivität der Feind der Hoffnung, und Elise konnte nicht verhindern, dass sich in ihre Liebe für Isaac nun auch ein wenig Groll mischte.
»Verloren bist du erst, wenn du tot bist«, erwiderte sie bockig. »Und das bist du nicht.«
»Glaub mir, ich bin es.«
»Wie kannst du das nur sagen!«, fuhr sie auf, bereit und willens, ihren Mann mit Durchhalteparolen zu traktieren.
»Eine Minute«, rief der Gestapo-Mann.
Es war nicht der Moment, um zu grollen. Ein furchtbarer Gedanke, dass sie die letzte Minute mit Isaac, vielleicht die letzte Minute für immer, im Streit verbrachte.
Was sagt man einem geliebten Menschen, wenn einem nur noch wenige Augenblicke bleiben?
»Isaac, ich …«
»Bitte, Elise. Erfüll mir diesen letzten Wunsch und fahre mit unserem Sohn nach Frankreich. Wenn das bisschen Leben, das ich noch habe, für irgendetwas gut ist, dann dafür, euch fortzuschicken.«
Sie schwieg. Die Sekunden rauschten an ihr vorbei, beinahe greifbar.
»Elise?«
»Ja.«
»Versprichst du es mir?«
Sie schwieg.
Plötzlich nahm sie die stickige Luft wahr, die den Raum unter sich begrub. Es war der erste August, und sie spürte, dass sie diesen Tag mit seiner drückenden Hitze, den zahllosen Fliegen, den Aufmärschen, Hakenkreuzfahnen, falschen Reden und Desillusionen nie vergessen würde. Er stellte sich in eine Reihe mit dem 25. Oktober 1929, als ihr erster Mann Richard an einem Schlaganfall starb und ihr Vater Adalmar an einer Kugel, die er sich in den Kopf jagte. In eine Reihe mit dem 22. Februar 1933, als sie den einzigen Mann geheiratet hatte, den sie je wirklich liebte. Mit dem 7. März 1933, als sie in den Flitterwochen mit Isaac zusammen einen Kuchen buk in dem einfachen Bauernhaus auf Fehmarn und sie abends mit einem Glas Glögg am Kamin saßen. Es waren die besonders blauen und die besonders schwarzen Tage, die aus dem hell- bis dunkelgrauen, oft diffusen Alltag hervorstachen. Dieser Tag war ein rabenschwarzer.
»Versprichst du es mir?«, wiederholte er.
Mit der flachen Hand wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Die Suite, stellte sie fest, war mit cremefarbenen Möbeln bestückt, die viktorianisch wirkten und zugleich seltsam beruhigend, vielleicht weil sie an eine gemütlichere Zeit erinnerten. Das Parkett war kürzlich frisch abgezogen worden. Ein dicker blutroter Teppich, in dem eine Münze sich verlieren könnte, lag zu ihren Füßen.
»Elise.«
Es war vielleicht die letzte Gelegenheit, Isaac all das zu sagen, was er zu hören verdient hätte, doch sie kämpfte nur mit dem Schweiß. Sie betrachtete die Einrichtung und die Gemälde von Pissarro an der Wand, stand auf, fuhr mit der linken Hand am Telefonkabel entlang, öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Es war die letzte selbstlose Bitte eines Todgeweihten, mit der sie rang.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie.
»Das Gespräch ist beendet«, sagte der Gestapo-Mann.
Dreimal so lange, wie das Telefonat gedauert hatte, knapp eine Viertelstunde, blieb Elise auf dem Sessel sitzen, fassungslos, ihrem Mann das abverlangte Versprechen nicht gegeben zu haben. Vielleicht, wenn er noch einen Moment länger gebettelt hätte … Doch nein, auch dann wäre sie stark geblieben. Oder nicht? Es war ein klassisches Dilemma, mit lauter schlechten Lösungen und ohne eine gute. Was immer sie tat, es wäre zum Schaden eines Menschen, den sie liebte. Liebe ließ sich nicht gewichten. Den einen liebte man mehr, den anderen weniger – das gab es für sie nicht. Liebe war immer gleich stark, sonst war es keine Liebe. Noah und Isaac, Isaac und Noah, das war untrennbar für Elise. Ebenso hätte man sie fragen können, ob sie lieber einen Arm oder ein Bein verlieren wolle.
Zwei Pagen betraten das Zimmer und baten darum, etwas anschließen zu dürfen. Elise fragte gar nicht, um was es sich handelte. Sie war in Gedanken ganz woanders und nahm die blutjungen Hotelangestellten erst wieder wahr, als sie eine Art Schranktür öffneten, hinter der sich ein seltsames Gerät befand.
»Alle unsere Suiten werden jetzt damit ausgestattet«, sagte der eine Page stolz.
»Es ist eine Neuerung, Madame, Sie werden staunen«, fügte der andere fröhlich hinzu.
Sie betätigten einen Schalter, und einige Sekunden später erschien das Olympiastadion auf einer Glasscheibe, wie im Kino, nur deutlich kleiner. Was für ein seltsames Ding.
»Es nennt sich Fernsehgerät. Über Drähte wird ein Bild von anderswo übertragen«, erklärte der eine.
»Über Funk«, korrigierte sein Kollege.
»Drähte.«
»Nein, Funk.«
Plötzlich erschien Hitler. Er war ganz nah, wie in den Kino-Wochenschauen, in die sie seit einiger Zeit nicht mehr ging. Und nun suchte dieser Unmensch sie in ihrem Hotelzimmer heim.
Sie erschrak. »Machen Sie das weg.«
»Aber das ist der Führer. Er wird gleich die Olympiade eröffnen.«
»Sie sollen das wegmachen, hören Sie nicht!«
Besonders erbaut wirkten die Pagen nicht von dem Befehl, doch der Gast war König, zumindest vorläufig noch, und so betätigte einer der beiden erneut einen Schalter, woraufhin das Bild verschwand.
Elise fiel in den Sessel zurück. »Bitte gehen Sie.«
Der Anblick Hitlers lag ihr wie Klumpen aus halbgarem Maisgrieß im Magen. Doch er bewirkte seltsamerweise auch etwas Gutes.
Taktvoll hatte Biene zu Beginn des Telefonats die Tür zum Dienstbotenzimmer geschlossen, nun öffnete Elise sie wieder. Noah schlief in den schweren, weichen Armen seiner Amme. Es war das Glück der Ahnungslosen, das seinem Gesicht Schönheit verlieh. Eine Schönheit, die Elise die Sprache verschlug. Lange stand sie schweigend da und betrachtete dieses Wunder.
Irgendwann gab sie Biene ein Zeichen, woraufhin diese Noah in seine Wiege legte. Nacheinander gingen die beiden Frauen leise in die Suite, und nur ein Türspalt zum Dienstbotenzimmer blieb offen.
»Schlimm?«, fragte Biene, obwohl sie die Antwort bereits von Elises Gesichtsausdruck abgelesen hatte.
»Sehr schlimm.«
Biene nahm sich das Privileg heraus, welches sie sich durch die Dauer und Wertigkeit ihres Dienstes erworben hatte, und ließ sich in Anwesenheit von Elise auf die Chaiselongue plumpsen. Das Möbelstück ächzte unter ihrem Gewicht.
»Was hat er gesagt?«
»Er will, dass ich mit Noah nach Frankreich zu Ophélie fahre.«
Biene zog eine Schnute und nickte anerkennend. »Ich dachte nicht, dass ich das mal über einen Mann sagen würde, aber je länger ich Ihren Gatten kenne, umso mehr Bewunderung ringt er mir ab. Er steckt mittendrin in der Scheiße, und alles, woran er denkt, ist seine Familie.«
Elise hatte sich schon vor langer Zeit mit Bienes derber Ausdrucksweise abgefunden, wenn auch widerstrebend. Sie nahm das in Kauf. Die beiden waren gleich alt, aber Biene war die Weisere, vielleicht weil sie zwischen der Welt der Armen und jener der Reichen pendelte, wohingegen Elise von Ersterer kaum Ahnung hatte.
»Mag sein, dass er Bewunderung verdient«, entgegnete Elise. »Ich bin sogar ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz werde ich ihn nicht im Stich lassen.«
»Was?«
»Wer, wenn nicht seine Ehefrau, vermag für ihn einzutreten? Er benötigt meine Fürsprache.«
»Wie kommen Sie bloß darauf, dass ihm das irgendetwas nützt? Das sind Gauner, die treten Ihre Fürsprache in die Tonne.«
Elise seufzte. »Genau das hat mir zu denken gegeben. Ja, die Nationalsozialisten sind Gauner, die weder Recht noch Anstand kennen, trotzdem haben sie Isaac erlaubt, mit mir zu sprechen. Warum wohl? Er sollte mich auffordern, das Land zu verlassen.«
»Sie meinen, die haben Ihren Mann gezwungen, das zu sagen?«
»Eher nicht. Aber sie haben seine Ansichten erkannt und sie sich zunutze gemacht. Vergraulen wollen sie mich, denn wenn ich fliehe, können sie sich doch noch unter den Nagel reißen, was sie schon so lange haben wollen.«
Elise musste ihrer Vertrauten die Umstände nicht näher erläutern. Seit Jahren schon versuchte die SS unter Heinrich Himmler, gegen den Widerstand Isaacs, Elises und ihrer Schwester, die vereinigten Porzellanmanufakturen von Blankenburg und Löwenkind zumindest teilweise zu übernehmen. Vermutlich aus Prestigegründen. Zunächst hatten sie dafür Tankred instrumentalisiert, Elises jungen Neffen, der in der Hierarchie dieser Truppe aufgestiegen war, dreißig Prozent der Firmenanteile hielt, aber die volle Kontrolle anstrebte. Doch je länger ein martialisches Regime im Sattel sitzt, umso arroganter schwingt es die Peitsche. Sie hatten Elise finanziell in die Ecke gedrängt und den großen Coup geplant. Erst wenige Wochen war das her, und nur dank des Zusammenhalts aller Mitglieder, was äußerst selten vorkam, war es der Familie gelungen, das Vorhaben in buchstäblich letzter Minute zu durchkreuzen. Elises Schwester Ophélie hielt jetzt die Mehrheit der Anteile, Elise war als Geschäftsführerin eingesetzt. Würde sie Deutschland verlassen, bedeutete das mit Sicherheit das Ende der Unabhängigkeit für das rund einhundertsiebzig Jahre alte Familienunternehmen.
»Irgendjemand muss den Räubern doch die Stirn bieten«, schloss sie ihre Rechtfertigung ab. »Dann übernehmen das eben Isaac und ich.«
»Über Ihre Stirn lachen die sich doch kaputt«, widersprach Biene. »Damit bringen Sie sich selbst, Ihren Neffen und den kleinen Noah nur in Gefahr, weiter erreichen Sie nichts.«
»Was mich selbst angeht, bin ich mir des Risikos bewusst. Tankred ist einer von denen, die hacken sich gegenseitig kein Auge aus. Außerdem wissen sie weder, dass Tankred uns geholfen hat, die Übernahme zu vereiteln, noch, dass eigentlich er hinter dem Schmuggel der Anti-Opium-Pillen steckt.«
Im letzten Moment hatte sich Tankred, bevor es zur Übernahme durch die SS gekommen wäre, seines Gewissens und seines Blutes besonnen und hinter Himmlers Rücken agiert, sodass dessen Plan scheiterte. Dem vorausgegangen waren allerdings Tankreds zahlreiche Versuche, die alleinige Kontrolle über Blankenburg zu erlangen. Weil er sich als unehelicher Sohn beim Erbe benachteiligt fühlte, hatte er sich auf kriminelle Machenschaften eingelassen, um sich die Taschen zu füllen, eben jenen Pillenschmuggel, der nun Isaac zur Last gelegt wurde.
»Im Übrigen ist er ein Schlingel, der sich aus allem herauswindet«, schloss Elise das Thema ab. »Was nun Noah betrifft …«
Sie steckte ihren Kopf durch den Türspalt und lauschte den friedlichen, gleichmäßigen Atemzügen des Winzlings. Schlafende Kinder haben etwas Beruhigendes, und sie verleiten zum Träumen. Elise stellte sich vor, wie Noah eingeschult würde. Er hätte ein zartes, etwas scheues Gesicht und klammerte sich fest an sie, während er verwundert auf die vielen anderen Kinder und ihre Mütter blickte. Er wäre gut im Schönschreiben – alle Löwenkinds hatten eine bewundernswerte Handschrift – und im Lesen. Vor allem Huckleberry Finn und Jim Hawkins, der Junge aus der Schatzinsel, hätten es ihm angetan. Er würde sehr jung heiraten, mit Anfang zwanzig …
Elise war sich im Klaren darüber, dass diese Szenen noch weniger als Mutmaßungen waren, reine Fantasien, die jeder Grundlage entbehrten. Vor mehr als zwanzig Jahren hatte sie schon einmal vor einer Wiege gestanden und sich ein Leben ausgemalt, das von ihrer Tochter Emma. Am Ende war alles ganz anders gekommen. Und doch schöpfte sie Trost aus diesen Luftschlössern, denn es war gut möglich, dass sie weder Noahs Hochzeit noch seine Einschulung, vielleicht nicht einmal seinen ersten Geburtstag erlebte.
Sie ging wieder zu Biene. »Du wirst mit dem Kleinen zu Ophélie an die Loire fahren, noch heute Abend. Ich buche euch ein Schlafwagenabteil nach Paris und schicke ein Telegramm, dass jemand euch abholen soll.«
Biene fiel aus allen Wolken. »Sie … Sie wollen Ihren Sohn weggeben?«
»Nicht weg. Ich gebe ihn in die Obhut meiner Schwester. Sie hat drei Kinder großgezogen, nennt ein Schloss auf dem Land ihr Eigen, lebt in Saus und Braus …«
»Aber Ihre Schwester hasst Sie. Schon vergessen? Sie haben ihr als Kind ein Auge ausgestochen.«
»Wir haben uns versöhnt.«
»Oberflächlich und auch nur, um den Nazis ein Schnippchen zu schlagen.«
»Sollte Ophélie noch einen Groll gegen mich hegen, wird sie ihn gewiss nicht an Noah auslassen. Sie hat zwar Haare auf den Zähnen, aber auch Gold im Herzen.«
»Na schön, wie Sie meinen, aber ich bleibe hier bei Ihnen.«
»Und wie soll Noah nach Frankreich gelangen? Ich kann ihn schlecht als Paket hinschicken. Wenigstens solange er gestillt wird, musst du bei ihm bleiben. Danach sehen wir weiter.«
»Ich kümmere mich um alles, außer um das Stillen.« Die Stimme kam aus der Diele, und einen Augenblick später trat eine vornehme Dame mit pompösem Hut in den Türrahmen, die einen Hauch von neunzehntem Jahrhundert versprühte.
»Tante Arabella!« Elise ging ihr entgegen. »Was machst du denn hier? Und wie bist du hereingekommen?«
»Ich habe den beiden Bengels, die aus deiner Suite kamen, eine Münze in die Hand gedrückt, woraufhin sie glatt vergaßen, die Tür hinter sich zu schließen. Zufällig war ich gerade unten an der Rezeption, als sie Isaac zu dir durchgestellt haben, und wurde neugierig. Zu lauschen schickt sich zwar nicht, aber es ist immer noch die beste Methode, Dinge zu erfahren, die alten Tanten gerne verheimlicht werden.«
Sie küssten sich auf die Wangen. »Bist du wegen des Prozesses in Berlin?«
»Sie erlauben mir nicht, daran teilzunehmen. Meine connections in die USA, denen ich meinen diplomatischen Status verdanke, sind äußerst hilfreich, um mich gegen Übergriffe der Nazi-Bande zu schützen. Nur leider verhindert eben dieser Status, dass ich dem Gerichtsverfahren beiwohnen darf. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten nennt das Nichteinmischung. Ich nenne es verbissenes Wegsehen. Nein, ich bin hier, weil ich Damian begleite, Ophélies Ältesten. Seine Schwester Marie habe ich auch mitgebracht.«
Elise hatte völlig vergessen, dass ihr Neffe als Stabhochspringer an den Olympischen Spielen teilnahm.
»Hat er denn Chancen?«
»Aber ja. Auf einen Platz zwischen eins und zweiunddreißig … so viele Männer nehmen nämlich an diesem irrwitzigen Wettbewerb teil, von dem mir bisher niemand überzeugend erklären konnte, wofür er gut sein soll. Aber lass uns endlich über dich und Isaac sprechen. Und über die Manufaktur.«
»Ich will nicht nur dabei sein, wenn Isaac angeklagt wird, sondern auch für ihn aussagen.«
»Und ich bin dagegen«, rief Biene aus dem Hintergrund. »Man darf sein Kind nicht alleinelassen.«
»Soso. Und Sie sind?«
»Das ist Biene, Tante Arabella. Du weißt schon, das Faktotum in der Villa Vanora, unser langjähriges Hausmädchen und neuerdings Noahs Amme.«
»Jetzt erinnere ich mich.« Sie hob pikiert eine Augenbraue. »Vielleicht, liebe Elise, möchtest du noch jemanden von der Rezeption nach seiner Meinung in dieser Sache fragen?«
»Ich bin sehr enttäuscht von dir, Tante Arabella. Du kannst Biene doch nicht mit wildfremden Menschen gleichsetzen. Ihre Meinung bedeutet mir sehr viel.«
»Und was ist mit meiner Meinung?«
»Die natürlich auch.«
Arabella trat zwischen Biene und Elise und wandte sich an alle beide. »Ich finde, dass weder Tanten noch Faktoten in dieser existenziellen Frage mitreden sollten. Es zählt nur das, was dein Herz dir sagt. Die Entscheidung liegt allein bei dir, der Ehefrau und Mutter, und du bist alt und reif genug, sie zu fällen.«
»Natürlich bin ich hin- und hergerissen.«
»Wärst du es nicht, würde etwas nicht mit dir stimmen.«
Elise dachte noch einmal darüber nach. Mit Isaac waren das Glück und die Liebe in ihr Leben getreten. Er hatte Besseres verdient als eine Frau, die beim ersten Sirenengeheul ins Rettungsboot hüpfte. »Mein Sohn wird es eines Tages verstehen.«
»Das bleibt abzuwarten«, wandte Biene ein.
Arabella fuhr sie an. »Können Sie das Unken nicht lassen?«
»Ich habe die gnädige Frau früher selbst dazu gedrängt, mehr Widerstand zu zeigen. Aber da hatte sie noch nicht den ganzen Nazi-Apparat gegen sich, und genau das wird passieren, wenn …«
»Die Nazis lassen Sie mal meine Sorge sein, meine Teure.«
»Na, da bin ich gespannt, wie die zittern werden.«
»Passen Sie bloß auf. Wenn Sie noch mehr solcher galligen Bemerkungen machen, wird die Milch sauer. Außerdem gibt es bei dieser Entscheidung etwas zu berücksichtigen, von dem Sie nichts verstehen.«
»Und was wäre das, Tante Arabella?«, hakte Elise nach.
»Dass ausgerechnet du mich das fragst … Welcher Name ist auf deiner Geburtsurkunde eingetragen? Wessen Tochter, wessen Enkelin, wessen Urenkelin bist du? Blankenburg, meine Liebe, ein Name, der seit fast zweihundert Jahren für exquisites Porzellan steht, tatsächlich aber noch für sehr viel mehr … für Werte, Fürsorge, Anstand, Loyalität, Zusammenhalt. Deine Schwester hat dich zur Geschäftsführerin gemacht, was bedeutet, dass du die Geschäfte führen sollst. Also tu es gefälligst.«
»Unmöglich, ich muss für Isaac da sein.«
»Die Manufakturen von Löwenkind und Blankenburg gehören jetzt zusammen, dadurch hat sich deine Verantwortung verdoppelt.«
»Die Mehrheit gehört immer noch Ophélie. Soll sie doch herkommen und sich selbst darum kümmern. Ich habe es satt, nach ihrer Pfeife zu tanzen.«
Elise ließ ihre Tante stehen und begann demonstrativ, Noahs Sachen zusammenzusuchen, während er weiterhin schlief. Murrend füllte Biene die Koffer. Einen Teil behielt Elise zurück, einen gelb-weiß gestreiften Strampler, der nach Noah und Puder duftete. Ewig würde der Geruch nicht daran haften, doch Elise konnte sich einreden, dass es so war.
Einhunderttausend Menschen im Olympiastadion, die tosten, als der letzte Fackelläufer mit schwebenden Schritten über die vierhundert Meter lange Aschenbahn lief. Einhunderttausend Menschen, die mit einer Stimme zu jubeln schienen. Einhunderttausend Menschen, deren Begeisterung sich brüllend in den Äther erhob, als wolle sie die ganze Welt erobern. Die über dem Stadion kreiste, an- und abschwoll und wieder auf die Ränge zurückglitt, als der Läufer die Treppenstufen zum Feueraltar erreichte.
Der Moment war feierlich, heilig beinahe. Stille erfüllte den Ort, der eben noch gebebt hatte, und es war dieses Schweigen, das Tankred einen Schauer über den Rücken jagte. Der Flügelschlag der Tauben war zu hören, die den Himmel über der Sportstätte umrundeten.
Stufe um Stufe erklomm der germanisch blonde Modellathlet, bis er die gigantische Schale erreichte. Er blieb stehen, hob den Arm mit der Fackel, grüßte die Massen und entzündete das Feuer. Erneut brandeten Beifall und Freudengeschrei auf, eine Glocke ertönte, und vom Altar schlugen Flammen in die Höhe.
»Heil!«, hörte auch Tankred sich rufen. Hundertmal am Tag benutzte er dieses Wort, gedankenlos und ohne Stolz, so wie früher »guten Tag« und »auf Wiedersehen«. Das ständige Strammstehen und Hackenschlagen ging ihm inzwischen sogar auf die Nerven. Doch in jenem Augenblick fühlte er sich tatsächlich als Teil der Gesamtheit, als Teil einer großen Idee und Ordnung.
Der Einmarsch der Athleten begann. Das Deutsche Reich stellte das größte Kontingent, mehr noch als die Amerikaner. Viele Mannschaften entboten den olympischen Gruß, der dem deutschen Gruß ähnelte: den Arm ausgestreckt, doch die Faust geballt.
»Es ist einsam auf dem Olymp, und jetzt weiß ich auch, warum«, ertönte eine Stimme, und er wandte sich um.
Seine Großtante Arabella schleppte sich die Stufen zu seinem Sitzplatz ganz oben hinauf, deutlich übertrieben angezogen für den Anlass und den warmen Sommertag und auch deswegen völlig aus der Puste.
»Was machen Sie denn hier?«
»Wenn ich diese Frage heute noch einmal höre, stürze ich mich in die Spree.«
Tankred lachte. »Was machen Sie denn hier?«
Sie zog eine Schnute, er stand auf und half ihr die letzten Stufen hinauf.
»Ihre Manieren haben sich verbessert«, stellte sie fest. »Sie brechen mir zwar fast den Arm mit Ihren Teutonenhänden, aber vor ein paar Jahren wären Sie nicht mal aufgestanden, wenn eine Dame sich Ihnen nähert.«
»Ich glaube, Sie sind schwerer geworden, Tante Arabella. Und Sie hinken ein wenig.«
»Ich habe mich geirrt, was Ihre Manieren betrifft. Abgesehen davon wird eine Dame nicht schwerer, wenn sie zunimmt, sondern würdevoller.«
»Ich werde es mir merken. So, wir wären da.«
Sie blickte sich um. »Die Aussicht auf das Stadion ist grandios. Aber wo sind die Sportler? Sind das etwa diese winzigen Ameisen da unten?«
Nun zog er eine Schnute. »Diesen Sitzplatz habe ich unserer Scharade vor zwei Monaten zu verdanken.«
»Hat Ihr Herr Himmler gemerkt, dass Sie sein Vorhaben absichtlich torpediert haben?«
»Dann hätte ich jetzt einen Sitzplatz im Zuchthaus. Dass wir ihn hinters Licht geführt haben, hat er nicht bemerkt. Aber da er sein Ziel nicht erreicht hat und die SS die Manufaktur Blankenburg nicht übernehmen konnte, hat er mich nun auf dem Kieker. Meine gleichrangigen Kameraden haben weit bessere Plätze bekommen.«
»Nicht jammern, bitte. Sie haben ein traditionsreiches Familienunternehmen vor der Übernahme durch eine Bande von Nichtskönnern in schwarzen Strampelhosen bewahrt.«
»Ich trage normalerweise selbst so eine Strampelhose.«
»Heute nicht, wie ich sehe.«
»Wir wurden aufgefordert, in Zivil zu erscheinen, damit das internationale Publikum nicht denkt …«
»Damit es nicht sieht, dass es sich in einem Polizeistaat befindet. Plump, aber wirkungsvoll, wie alle Maßnahmen der Nazis. Möchten Sie mir vielleicht einen Platz anbieten, oder wäre es Ihnen lieber, wenn ich hier Wurzeln schlage und austreibe?«
Er wies auf die fast leere, lange Reihe. »Suchen Sie sich einen Sitz aus. Sie sind alle gleich unbequem.«
Arabella ließ sich nieder und entfaltete einen Sommerschirm, den sie bisher als Stock genutzt hatte.
Tankred freute sich, sie zu sehen, auch wenn sie fast immer, wenn sie sich begegneten, Ärger mitbrachte. Obwohl sie wie ein Relikt der Kaiserzeit daherkam, scheute sie das offene Wort nicht – vermutlich ein Nebeneffekt jener zehn Jahre, die sie nach dem Tod ihres Mannes und dem Ende des Weltkrieges in den Vereinigten Staaten verbracht hatte. Sie hatte ihm in der Vergangenheit mehr als einmal die Leviten gelesen, und zwar nicht zu knapp. Dennoch hatte er stets das Gefühl, dass sie ihn eigentlich nicht verletzen wollte, sondern im Gegenteil um ihn besorgt war.
»Welches Land läuft da unten gerade ein?«, fragte sie. »Ich kann es nicht erkennen. Gar nichts erkennt man von hier oben. Die Athleten könnten Gorillas sein, und man würde sie für Boxer halten.«
»Dänemark.«
»Gut, dann dauert es nicht mehr lange, bis Frankreich dran ist. Ihr Cousin Damian ist einer der Teilnehmer, wissen Sie?«
»Ja, ich weiß.«
»Schon seltsam … Ich halte seinen Sport, nein, eigentlich jeden Sport, für ausgemachten Unsinn. Aber wenn der eigene Großneffe zusammen mit weiteren fünfzig Hampelmännern in ein Stadion einläuft, kribbelt es einen dann doch.«
»Mich kribbelt es auch, und zwar weil ich ahne, dass Sie die zweihundert Stufen nicht zu mir hinaufgeklettert sind, um mir Ihren Schirm ins Gesicht zu halten.«
»Oh, Pardon.« Sie wechselte ihn in die andere Hand. »Recht haben Sie, ich will mit Ihnen über Isaac und den Prozess sprechen. Gehen wir das mal durch. Sie und Ihr Kumpel Schimmi haben im Auftrag einiger Chinesen mitgeholfen, eine verbotene Pille nach Europa zu schmuggeln, die die Opiumsucht heilt und durch eine Heroinsucht ersetzt.«
»Das wussten wir damals nicht.«
»Ruhe, jetzt rede ich. Ist das da unten die französische Olympiamannschaft?«
»Nein, die estnische.«
»Also weiter. Sie haben mit Ihren krummen Geschäften einen Batzen Geld gemacht, den Sie dafür verwendet haben, sich zuerst den Stammsitz der Familie, die Villa Vanora, und schließlich einen Teil der Manufaktur anzueignen. Bis dahin bin ich ganz bei Ihnen. Die chinesische Pille geht mich nichts an, und dass ein uneheliches Kind versucht, das Erbe seines Vaters an sich zu reißen, ist in meinen Augen noch kein Verbrechen. Wenn dafür aber ein Unschuldiger büßen soll, der mir sehr am Herzen liegt, werde ich grantig.«
»Das war Schimmis Werk, ich hatte nichts damit zu tun. Ich würde Onkel Isaac niemals …«
»Das ist der springende Punkt, mein Guter. Er ist Ihr Onkel. Also verhalten Sie sich tunlichst wie ein guter Neffe und holen Sie ihn da wieder heraus. Egal wie, aber sehen Sie zu, dass es bald passiert. Denn wenn nicht, steuert alles auf eine Katastrophe zu, die sich auf die ganze Familie ausweiten könnte.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ist das die französische Mannschaft?«
»Die finnische. Wieso auf die ganze Familie?«
»Elise hat vor auszusagen.«
»Ist sie verrückt? Das bringt sie in Teufels Küche.«
»Sie ist schon mittendrin. Und Sie stehen in der Küchentür. Elise weiß genug, um Ihnen zu schaden. Allein Ihre Rolle bei der vereitelten Übernahme der Manufaktur durch die SS. Natürlich kann sie Ihnen nichts beweisen, und selbst wenn … Dummerweise, mein Bester, leben Sie in einem Land, in dem Beweise etwa so viel gelten wie Nieten auf einem Jahrmarkt. Umgekehrt reicht bereits ein Verdacht, und man ist weg vom Fenster. Wem erzähle ich das?«
Aus vielerlei Gründen hatte Tankred gehofft, dass Elise den Prozess gegen Isaac Löwenkind nicht abwarten, sondern das Land vorher verlassen würde. Der geringste Grund war, dass ihre Abwesenheit es ihm erleichterte, die Geschicke der Manufaktur zu bestimmen. Mehr denn je sah er sich als der einzig wahre und alleinige Erbe, und wäre er nicht illegitimer Herkunft gewesen, hätte das gewiss auch niemand bestritten. Hart hatte er dafür gekämpft, überhaupt als Blankenburg zu gelten und auch diesen Namen zu tragen. Andererseits, wenn er der wahre Erbe war, dann war er auch das Familienoberhaupt. Dass die Nationalsozialisten seine Angehörigen bedrohten, verfolgten, verschleppten und vor Gericht stellten, traf ihn zunehmend in seinem Selbstverständnis und seiner Ehre als Beschützer und Bewahrer. Und nicht zuletzt – das war der wichtigste Grund – mochte er seine Tante Elise. Sollte sie tatsächlich in dem Prozess aussagen, würde das am Urteil nur wenig ändern, sie selbst aber in Gefahr bringen.
Und ihn ebenfalls, da lag Arabella nicht falsch.
»Sie wissen um meine besondere Rolle.« Arabella sah ihn eindringlich an. »Da Isaac der Neffe meines verstorbenen Mannes ist und Elise die Tochter meines verstorbenen Bruders, betrachte ich mich gewissermaßen als Scharnier oder vielmehr Patin dieser Verbindung. Ich werde alles daransetzen, meine Liebsten zu beschützen. Ich bin wie ein Wirbelsturm, mein Bester. Dass ich kurz weg bin, bedeutet keineswegs, dass ich nicht zurückkomme. Sollte Isaac oder Elise Unrecht geschehen, werden Sie, mein lieber Tankred, Ihres Lebens nicht mehr froh. Dafür sorge ich, und ich werde jeden, den ich zu fassen bekomme, in diesen Kampf hineinziehen. Sie werden keine Familie mehr haben, ganz egal, ob Sie den Krieg gewinnen oder verlieren … Ist das jetzt die französische Mannschaft?«
»Ja.«
Die Franzosen zeigten den Olympischen Gruß, den das deutsche Publikum mit dem deutschen Gruß verwechselte, woraufhin das Stadion erbebte. Zehntausende, die aufsprangen und deren Stimmen sich zu einem ohrenbetäubenden Tosen vereinten, so als würde eine Fliegerstaffel über die Arena hinwegdüsen.
»Erstaunlich«, sagte Tankred. »Unser erstes Gespräch, bei dem wir nicht über die Manufaktur und das vergiftete Erbe sprechen.«
»Ich wusste, dass Sie davon anfangen würden, daher musste ich es nicht tun.«
Sie sahen sich gegenseitig mit listigem Blick an, eine alte Füchsin und ein junger Wolf. Von der ganzen Familie mochte Tankred seine Großtante am liebsten, obwohl oder gerade, weil sie ihm Paroli bot. Doch hatten ihre Scharmützel, die sie in vorhersagbarer Regelmäßigkeit austrugen, nichts von der Feindseligkeit und Herablassung, mit der Tante Ophélie ihm begegnete, oder von der vorwurfsvollen Traurigkeit, die Elise ihm gegenüber an den Tag legte. Arabella war imposant, eine aristokratisch anmutende weißhaarige Dame, die sich für Schrotschüsse nicht zu schade war. Vielleicht hatte sie das in Amerika gelernt, wo sie die zehn Jahre nach dem Großen Krieg bis zum Schwarzen Freitag verbracht hatte. Wie auch immer, sie war genau sein Kaliber, auch wenn man es ihr nicht ansah.
»Beabsichtigen Sie immer noch, eines Tages Blankenburg und Löwenkind zu kontrollieren?«, fragte sie. »Unsere Allianz gegen die Nazis war zu erfolgreich, um sie durch neuerlichen Zwist zu gefährden.«
»Halten Sie mich für blöd?«
»Ich halte Sie für vieles, aber nicht für blöd.«
»Ich bin der Sohn des ältesten Sohnes meines Großvaters Adalmar, Ihres Bruders. Das Erbe steht mir zu. Das ist nicht etwa meine persönliche Meinung, sondern Fakt. Im Moment sieht es so aus, als hätte Ophélie gewonnen, aber glauben Sie mir, dieser Eindruck täuscht.«
Arabella seufzte. »Stellen Sie sich vor, ich wäre eine gute Fee.«
Er lachte, sie schmunzelte.
»Raffen Sie alle Fantasie zusammen, die Sie haben, dann bekommen Sie das hin. Ich bin also die gute Fee, und Sie können von mir verlangen, was Sie wollen, unter der Bedingung, dass Sie den Erbstreit für alle Zeit beilegen … Nun ja, was man so alle Zeit nennt. Wenigstens fürs Erste.«
»Was ich will?«
»Ganz genau.«
Dafür schätzte er Arabella besonders. Sie begegnete ihm stets auf Augenhöhe, eine Kaufmannstochter ohne Allüren, aber immer mit einem gefüllten Sack, von dem man nicht wusste, was sich darin verbarg.
»Darüber muss ich erst nachdenken.«
»Das wird bei Geschäften allgemein empfohlen. Damians Wettbewerb findet erst in einer Woche statt.«
»So lange bleibe ich nicht in Berlin, ich muss in Kürze zurück nach Königstein.«
»Gut, dann treffen wir uns dort. Sie erinnern sich an das Café auf der Zeil, wo wir unser erstes Geschäft abgeschlossen haben? Café Kaiser, diesen Freitag, vier Uhr nachmittags. Bringen Sie gute Manieren mit, einen realistischen Vorschlag und vor allem einen anständigen Anzug. Was Sie gerade tragen, kann man vielleicht auf der Hunderennbahn anziehen, aber unmöglich zum Tee im Kaiser.«
Schimmi saß gut dreißig Ränge weiter unten, nur einen Steinwurf von der Führerloge entfernt. Sein schicker Zweireiher war maßgeschneidert, der Hut vom besten Berliner Hutmacher, und er trug Schuhe, in denen man sich spiegeln konnte.
»Der Anzug steht dir gut«, sagte Tankred, der den Freund auf Anhieb gefunden hatte, und befühlte den feinen Stoff des Sakkos. »Mein eigener wurde gerade als schäbig kritisiert.«
Wie niedlich der kleine Schimmi darin aussah, irgendwie nicht ganz ernst zu nehmen. Doch Tankred wusste, dass der Eindruck täuschte. Sein Freund hatte ihn in fast jeder Hinsicht überflügelt. Sie teilten jede Menge Erinnerungen und Gemeinsamkeiten, wie etwa das Schicksal, ein Bastard zu sein – Tankred der einer reichen, Schimmi der einer armen Familie. Zusammen hatten sie nicht nur das Elend der Zwanziger Jahre, sondern auch den eher zufälligen Einstieg in die Nazi-Hierarchie Anfang der Dreißiger erlebt und ein paar äußerst gewagte Unternehmungen hinter sich, von denen einige ihrer Karriere, andere ihrer Börse gutgetan hatten. Ebenso einte sie der Verlust ihres gemeinsamen Freundes Dubbe, der vor zwei Jahren der Ausschaltung der SA zum Opfer gefallen war. Noch keine dreißig Jahre alt waren sie und hatten bereits so einiges zusammen durchgemacht. Schimmi hatte letztendlich immer zu Tankred gehalten. Dafür hatte Tankred ihn mit einem Anteil von zehn Prozent an der Porzellanmanufaktur belohnt. Dreißig Prozent hielt er selbst, die restlichen sechzig seine ungeliebte Tante Ophélie, die im sicheren Frankreich unangreifbar war.
»Wir müssen reden, Schimmi. Aber nicht hier.«
Sie verließen die Ränge auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, das innerhalb des Olympiastadions jedoch unmöglich zu finden war. Also gingen sie hinaus auf das Reichssportfeld, wo in den kommenden Tagen viele der Wettkämpfe stattfinden sollten, das zurzeit aber noch für die Zuschauer gesperrt war. Einhundertzwölftausend Quadratmeter, konzipiert für zweihundertfünfzigtausend Besucher, sollten für ein Gespräch unter vier Augen genügen. Schimmis Ausweis öffnete ihnen die Tore. Der Polizist am Eingang salutierte.
Schimmi zündete sich eine Zigarette an und gönnte sich einen Schluck aus dem Flachmann, den er aus dem Sakko zog. Seit drei Jahren trank er zu viel, aber dass er rauchte, war neu. Tankred lehnte die ihm angebotene Zigarette mit einer Handbewegung ab. Manchmal hatte er Angst vor Schimmi. Nicht, dass er glaubte, der Freund könnte sich eines Tages gegen ihn wenden. Im Gegenteil, er fürchtete, Schimmi könnte ihn eines Tages dazu bringen, so zu werden, wie er war, oder besser, wie er geworden war.
»Ich versuche schon seit Wochen, dich zu erreichen«, sagte Schimmi. »Wird mal wieder Zeit für ein Bierchen unter alten Kumpels.«
»Ich war ständig unterwegs«, erwiderte Tankred.
In letzter Zeit hatten sie ihn, der eine wichtige Aufgabe in der Wirtschaftsabteilung der SS übernommen hatte, mit Arbeit überschüttet und quer durch das Reich geschickt, von Lübeck nach Breslau, weiter nach Heidelberg und Münster. Himmler wollte, dass die SS zum Staat im Staate wurde, und Tankred sollte alles aufkaufen, was seinem Chef gefiel, meist enteignetes jüdisches Eigentum zum kleinen Preis. Das war keine Aufgabe, der er etwas abgewinnen konnte, aber zumindest versetzte der Reichsführer SS ihn nicht auf einen Posten, der ihm noch weniger lag.
»Lass mich raten, du hast gerade erfahren, dass dein jüdischer Onkel vor Gericht gestellt wird«, sagte Schimmi. »Und dass deine Tante in den Zeugenstand treten will.«
»Woher weißt du das?«
Schimmi holte ein zerknittertes Telegramm aus der Tasche. »Vor einer halben Stunde bekommen.«
»Sie wird beschattet?«
»Und abgehört.«
»Was? Wie das?«
»Abhörgeräte sind die neueste Erfindung. Ein kleines Ding, das man in den Telefonhörer einsetzt, und schon sind wir dabei«, leierte Schimmi die Erklärung gelangweilt herunter.
»Ich werde mit ihr reden, vielleicht bekomme ich sie dazu …«
»Hast du Kartoffelbrei in den Ohren, Tanke? Man darf euch beide nicht im vertraulichen Gespräch sehen, das wirkt verdächtig. Nein, besser, du lässt dich in nächster Zeit nicht mit ihr blicken. Ich werde mit deiner Tante reden, das ist sicherer und wahrscheinlich auch erfolgreicher. Weißt du, mit gutem Zureden kommt man bei der nicht weiter. Ich habe die ganze Zeit mit solchen Leuten zu tun und weiß, wie man sie am besten packt.«
»Ich will aber nicht, dass man sie packt, Schimmi. Ich wollte auch nicht, dass man meinen Onkel packt.«
»Das war, um uns zu retten. Oder wärst du gerne aufgeknüpft worden?«
»Es hätte andere Optionen für uns gegeben, als meine Familie zu zerpflücken.«
Schimmi richtete sich zu voller Größe auf. »Ich bin nicht hier, um zwei Monate alte Wäsche mit dir zu waschen, du Flitzpiepe.«
Der gute alte Schimmi, einen Meter dreiundsiebzig groß und fünfundsechzig Kilo schwer, hatte neuerdings die Klappe eines Zwei-Meter-Mannes mit Oberarmen wie Max Schmeling.
»Es genügt, dass deine ach so geliebte Tante Zweifel streut, und wenn die Kollegen hinter den Kulissen erst mal eine Untersuchung einleiten …« Er kam ins Grübeln, zog an der Zigarette. »Lass mich das machen.«
»Immer, wenn du übernimmst, beißt irgendwer ins Gras oder löst sich in Luft auf, bevorzugt Mitglieder meiner Familie. Was ich jetzt sage, meine ich bitterernst, Schimmi. Du wirst Tante Elise kein Haar krümmen. Außerdem boxen wir Isaac da wieder raus, verstanden?«
Vom Stadion drang die martialische Stimme des Führers über Lautsprecher bis zu ihnen auf das Sportfeld.
»ICH VERKÜNDE DIE SPIELE VON BERLIN ZUR FEIER DER ELFTEN OLYMPIADE NEUER ZEITRECHNUNG ALS ERÖFFNET.«
Tankreds Freund zog erneut an der Zigarette, warf den Stummel auf den Boden und zerquetschte ihn mit dem Fuß. »Lass mich das machen.«
Tankred verließ die Spiele bereits am zweiten Tag. Für Sport hatte er sich noch nie interessiert, und er wollte die beiden dienstfreien Wochen lieber nutzen, um sich verstärkt um die Manufaktur zu kümmern. Obwohl er bereits morgens losfuhr und sein SS-Chauffeur einen rasanten Fahrstil pflegte, kam er erst kurz vor Sonnenuntergang im hessischen Königstein an.
Die Villa Vanora war mit Hakenkreuzen beflaggt und herausgeputzt, wie es sich für den Wohnsitz eines Hauptsturmführers gehörte. Dem romantischen Charakter des Hauses konnte die pompöse Symbolik jedoch nichts anhaben. In der Gründerzeit erbaut, ruhte es auf einem soliden Steinfundament, über dem sich Mauer- und Fachwerk abwechselten und von hölzernen Türmchen und Treppengiebeln gekrönt wurden. Schottisches Landhaus, deutsches Märchen und spanisches Mobiliar verschmolzen zu einem Unikat, das auf einem gepflegten Rasen mit Blick auf die ferne Frankfurter Mainebene stand. Damit spiegelte das Gebäude die Familiengeschichte der Blankenburgs wider, in der lange Zeit die Männer urdeutsche Solidität und die Frauen ausländische Exotik verkörpert hatten.
Kaum angekommen, knöpfte Tankred die Uniformjacke auf und warf sie achtlos auf eines der Sofas. Dasselbe tat er mit dem Hemd. Gleich darauf goss er sich einen Brand ein, den er im Nu austrank. Den zweiten ließ er stehen. Er wollte Shuilian weder mit einer Fahne noch als Offizier gegenübertreten, sondern einfach nur als ihr Mann.
Er war müde, was aber nichts mit der langen Autofahrt zu tun hatte. Seit Wochen machte die Erschöpfung sich in seinem Kopf breit, genauer gesagt, seit Gitti ihn gebeten hatte, aus ihrem Leben zu verschwinden. Mehr als zehn Jahre lang war sie seine Freundin, Vertraute und Ratgeberin, zwischendurch immer auch mal seine Geliebte gewesen. Es gab einfach keinen Begriff für das, was sie ihm bedeutete. Doch dann, vor zwei Monaten, hatte sie unverhofft mit ihm gebrochen.
Zögernd griff er zum Telefon. »Vermittlung? Bitte Gallus eins-acht-zwo-drei. Ja, ich warte.«
Gitti selbst besaß keinen Fernsprechapparat, aber es gab einen in der Kneipe und dem Bordell, das sie betrieb. Noch nie hatte er mit ihr telefoniert, er war immer spontan bei ihr aufgekreuzt wie ein verlorener Sohn, und sie hatte ihn stets mit Liebe und Wärme empfangen. Nie hatte sie ihn weggeschickt, ihn niemals warten lassen. Eine Nacht bei ihr, ob im Bett, am Tresen oder am Küchentisch, bedeutete Kraft für mehrere Wochen.
»Hallo?«
Es war nicht ihre Stimme, und die Enttäuschung rann ihm vom Kopf abwärts in den Magen wie ein Schluck eiskalten Wassers an einem frostigen Tag.
»Hier ist Blank… Hier ist Tankred. Ist Gitti da?«
»Oh, hallo Tankred.« Die Frau nannte ihren Namen, aber er konnte sich nicht an sie erinnern. Gitti hatte ihm mal gesagt, dass die Hälfte ihrer »Mädchen« in ihn vernarrt sei, weil er sie nicht nur anständig behandelte, sondern auch Geld und ein hübsches Gesicht hatte – eine unschlagbare Kombination.
»Ist Gitti da?«, wiederholte er.
»Man hat sie vor ein paar Wochen abgeholt.«
»Abgeholt? Und wer ist man?«
»Die Polizei. Das Bordell haben sie geschlossen, nur die Kneipe ist noch geöffnet. Wegen Olympia und so.«
»Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wohin hat man sie gebracht?«
»Als würden die uns so etwas verraten.«
»Danke.«
Er legte auf, stinkwütend. Sein Zorn richtete sich zunächst gegen die Polizei. Doch dabei blieb es nicht. Die Behörden taten nur, was von oben angeordnet wurde.
»Gitti«, murmelte er und sank auf den Schemel neben dem Telefon.
Der Gedanke, dass sie irgendwo eingesperrt war, lähmte ihn für Minuten. Ebenso wie das, was sie zuletzt zu ihm gesagt hatte: Früher sei er ein liebenswertes Schlitzohr gewesen, auf seine Weise aufrichtig, einer, der immer mit offenem Visier kämpfte, ein guter Verlierer und nachsichtiger Gewinner. Keiner, der nachtrat. Keiner, der Tiefschläge verpasste. Kein Arschloch. Das sei jetzt anders, deswegen wolle sie nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Wie ein Gesteinsbrocken lagen ihre Worte in der einen Waagschale, während in der anderen seine Erfolge ins Gewicht fielen, das Geld und die Stellung, zu denen er gekommen war. Zu seinem Erstaunen wogen Gittis Worte schwerer, als er gedacht hatte, an diesem Tag mehr denn je.
Sie war von seinesgleichen verhaftet worden, von Männern, wie er einer war, und ihm wurde übel bei dem Gedanken.
Eines der Hausmädchen bemerkte ihn. »Brauchen Sie etwas, gnädiger Herr?«
Gnädiger Herr – vor ein paar Jahren noch hatten die Leute ihn wie einen lästigen Bettler fortgeschickt, und im Grunde genommen war er genau das gewesen: ein Bettler.
»Schläft sie schon?«, fragte er die junge Bedienstete.
»Fräulein Blankenburg hat noch nicht nach ihrer Zofe verlangt.«
Fräulein Blankenburg, Shuilian Blankenburg. Offiziell war sie Tankreds Cousine, die Tochter seines Onkels Wido, der in jungen Jahren nach China ausgewandert war und lange Zeit als verschollen gegolten hatte. Seine Heirat mit der Chinesin Chen Lu war absolut unstandesgemäß, weshalb es keine Rolle mehr spielte, dass ihre vermeintlich gemeinsame Tochter in Wahrheit ein Kuckuckskind und deswegen mit keinem Blutstropfen eine Blankenburg war. Außer Tankred, der immer seltener vor Ort war, lebte nur Shuilian in der Villa Vanora. Damit war sie so etwas wie die Dame des Hauses, eine Rolle, die sie nun offensichtlich einzunehmen gedachte, ebenso wie die Rolle als seine feste Geliebte. Das war keineswegs immer so gewesen …
»Soll ich ihr sagen, dass Sie da sind, gnädiger Herr?«
»Ich weiß nicht.«
Vor drei Wochen hatte er Shuilian zuletzt gesehen, und mit jedem Tag hatte er sich mehr nach ihr verzehrt. Es war ein Gefühl, als ginge ihm nach und nach die Luft aus. Sein Schlaf war kürzer, seine Müdigkeit größer geworden. Nach ein paar Tagen bereits war sie ihm irgendwie »verloren gegangen«, ihre Augen, ihre Lippen, ihre Brüste, all das rann ihm aus der Erinnerung wie Honig durch die Finger. Natürlich trug er immer ein Foto von ihr bei sich, doch das nutzte nichts, schließlich schwand nicht Shuilians Bild an sich, sondern ihre Wirkung auf ihn. Dazu brauchte er sie ganz nah bei sich.
Doch auf einmal war er sich nicht mehr sicher, ob er sie an diesem Abend wiedersehen wollte oder ob er sich lieber allein betrinken sollte.
Er schenkte sich einen Whisky ein, und durch die breite Terrassentür betrat er den Garten. Auf dem Rasen zog er Schuhe und Socken aus. Das Gras war warm und weich, die Nacht mild und mondlos, ohne Sterne am Firmament, jedoch am Horizont. Durch die Bäume südlich von ihm, phantomhafte Riesen, blitzten die Lichter Frankfurts, das etwa dreißig Kilometer entfernt war.
Früher, als Herumtreiber und Tunichtgut in Berlin, hatte Tankred sich für die Nacht nur deshalb interessiert, weil dann auch alle anderen lichtscheuen Herumtreiber und Tunichtgute der Hauptstadt unterwegs waren, mit denen er das eine oder andere Geschäft machte. Vor allem Glücksspiel. Seine kranke Mutter hatte sich so sehr gewünscht, dass er eine normale Arbeit annahm, aber er hatte ihr wieder und wieder versichert, dass er mehr verdiente, wenn er die Nacht und ihre Gesellen als Freunde hatte. Meistens stimmte das auch. Erst nach ihrem Tod hatte er ihr, geplagt von Reue, den Wunsch erfüllt. Gott, was war in den zehn Jahren seit ihrem Tod alles geschehen!
Es waren, überkam es ihn jäh, sogar schon zwölf.
Er wandte sich zur Villa um. Sein Urgroßvater hatte sie für seine aus Schottland stammende Urgroßmutter gebaut. Jeder der zahlreichen Erker und Türmchen hatte eine Geschichte, von denen Tankred die wenigsten kannte. Er war nicht im und mit dem Haus aufgewachsen, er hatte nie darin gespielt, war nicht in die Geheimnisse eingeweiht, hatte keinen seiner Vorfahren darin erlebt. Herrje, wie hart hatte er gekämpft, um seinen Platz als ältester männlicher Abkömmling der Blankenburgs einzunehmen, die Villa zu besitzen. Nun fragte er sich, ob das den Preis wert gewesen war. Fragte sich, ob seine Mutter stolz auf ihn wäre oder enttäuscht von ihm. Ob das, was er fühlte, schon wieder Reue war.
Tankred traute seinen Augen kaum, als er eine weibliche Gestalt in den hell erleuchteten Salon treten sah.
Shuilian bemerkte ihn nicht gleich, da er in der Dunkelheit des Gartens stand, nur schwach und indirekt von den Lampen des Hauses beleuchtet. Sie trug ein Abendkleid, keins von den flotten Teilen, in denen sie früher die Frankfurter Nachtclubs erobert hatte, sondern ein biederes cremefarbenes. Doch sie machte es allein mit ihrer exotischen Schönheit, den feuerrot geschminkten Lippen und der schwarzen Locke, die an ihrer Schläfe tänzelte, zum Ereignis. Als sie die offene Terrassentür bemerkte, trat sie ins Freie und starrte in die Nacht, ohne nach ihm zu rufen.
Er konnte es kaum erwarten, ihre Stimme zu hören, deren Anmut, die von einem dünnen, kalten Belag überzogen war, den sie sich in ihrer Jugend in den Ghettos von Shanghai angewöhnt hatte.
Da entdeckte sie ihn und schritt vornehm auf ihn zu, wobei sie das Abendkleid leicht mit den Händen raffte, wie es Baroninnen zu tun pflegen, und begleitet von einem würdevollen Lächeln. Als sie bemerkte, dass er nur ein Unterhemd trug, änderte sich ihr Gesichtsausdruck ins Begehrliche, und damit wusste er, dass sie sich entschieden hatte, seine Geliebte zu bleiben. Oder, man konnte das auch anders betrachten, es zum ersten Mal wirklich zu werden.
»Bitte sag etwas«, murmelte er.
»Wozu?«
»Mehr«, bat er nur.
»Du siehst furchtbar müde aus.«
»Und?«
»Ich bin froh, dass du da bist.«
»Und?«
»Ich liebe dich.«
Tankred zog die Brauen hoch. »Gleich die drei ganz großen Wörter? Nicht doch lieber eine abgespeckte Version davon?«
Sie wandte ihm den Rücken zu, wobei sie ihm mit einer Geste zu verstehen gab, was er als Nächstes tun sollte.
Eine Schlaufe nach der anderen zog er auf, bis das Kleid an ihr herab ins Gras glitt. Ihre goldfarbene Haut, von nichts mehr bedeckt, keinem Mieder, keinem noch so winzigen Fetzen Stoff, schimmerte ölig in dem Licht, das die Villa spendete. Shuilian war eine klassische Mätresse, die sich auf Verführung verstand. Eine andere Gabe besaß sie nicht. Das war ihr ganzes Kapital, und mit dem verstand sie zu wuchern.
Sie wandte sich zu ihm um und stand schutzlos vor ihm, wie Gott sie geschaffen hatte, doch ihr Blick sagte: Es ist mein tausendstes Mal. Tankred legte die Hände auf Shuilians Wangen, von wo sie auf ihre Schultern glitten. Dort hielten sie inne, so als wären sie unschlüssig. Der Moment dauerte an. Shuilians Mund öffnete sich leicht, und Tankred erwartete im nächsten Augenblick ihre Zunge, die hinter den strahlend weißen Zähnen spielte.
Da war sie.
Tankreds Hände glitten weiter an ihr hinab, die linke über ihre straffe Brust, die die Größe einer Reisschale hatte, die rechte an ihrem Rücken entlang, der so glatt war wie lackiertes Ebenholz.
Als er ihre Hüfte berührte, schloss sie kurz die Augen, und als sie ihn wieder ansah, war ihr Blick noch bereitwilliger als zuvor.
Langsam drückte er Shuilian ins Gras. Sie lag unter ihm, ohne dass er sie berührte, sein Gesicht schwebte eine Handbreit über dem ihren, seine Fäuste waren zu beiden Seiten in die Erde gerammt.
Geschickt öffnete sie die Knöpfe seiner Uniformhose, schob sie ein Stück an den Oberschenkeln hinunter. Sie hatte alles vorbereitet. Was ihm jetzt noch zu tun blieb, hatten er und sie schon oft gemeinsam getan.
Und sie war schöner als je zuvor. Nicht mehr die Kindfrau von vor sechs Jahren, die er mit Ausflügen ins Frankfurter Nachtleben beeindrucken wollte, wobei sie den Spieß zu seiner Überraschung umdrehte. Nicht mehr das quirlige Nachtclubsternchen, das die Mainmetropole aufmischte. Nicht mehr die Frau, die ihn bei Nacht und Nebel zugunsten eines anderen verließ, als ihr bewusst wurde, dass Tankred sie nie würde heiraten können. Nicht mehr das heulende, zitternde Elend, das vor einigen Monaten zu ihm zurückgekehrt war, nachdem man ihre Eltern und ihren neuen Beschützer kurzerhand ausgeschaltet hatte.
Shuilian hatte reichlich Zeit gehabt, ihre neue Rolle zu finden. Sie mimte jetzt die schutzlose, reuevolle Frau, die ihm ausgeliefert war, aber so tat, als könnte sie ihn nach Belieben verführen. Sie versuchte, beides gleichzeitig zu sein, Sklavin und Herrscherin. Wie üblich spielte sie ihre Rolle sehr souverän.
Als er über ihr lag, nicht auf ihr, und ihre Hände an seinem Geschlecht spürte, als er in ihre perfekten schwarzen Augen blickte und ihr Atem seine Lippen streichelte, da erfasste ihn ein Gefühl, das er nicht kannte: Er hatte keine Lust mitzuspielen.
»Was ist?«, fragte sie, als er zur Seite rollte, bis er auf dem Rücken lag, und die Hose wieder hochzog. Da er nicht antwortete, ergänzte sie: »Ich habe zwar gesagt, dass du müde aussiehst. Aber doch nicht so müde.«
Da war es wieder, dieses Wort: Müdigkeit. Er hatte Shuilian endlich dort, wo er sie immer haben wollte. Sie war seine Geliebte, passte sich ihm an und stellte keine unerfüllbaren Forderungen. Er war ihr einziger sicherer Hafen, alle anderen, in denen sie Schutz hätte finden können, waren von Stürmen hinweggefegt worden, die er entfacht hatte. Sie gehörte ihm.
Doch das war nicht stimmig. Nicht so. Viel zu viel stimmte nicht mehr oder hatte noch nie gestimmt.
Er sah sie an, obwohl ihr Gesicht in Dunkelheit getaucht war. Ihr glattes schwarzes Haar war von dem gelblichen Lichtschein aus dem Haus umgeben wie bei einer Madonna.
»Ich habe dich zuerst zerbrochen und dann wieder zusammengesetzt«, sagte er leise. »Und jetzt bist du eine dienstbare Maschine.«
»Maschine?«, wiederholte sie. »Ich bin doch keine Maschine.«
Sie nahm seine Hand, führte sie an ihren Busen, der warm und weich war wie ein Kissen. Mit sanfter Gewalt entwand er sie ihr wieder, und Shuilian verstand sichtlich die Welt nicht mehr.
»Ich dachte, du willst das.«
»Willst du es denn?«
»Sicherlich. Du bist der Mann, den ich liebe.«
»Vor einem Jahr hast du noch anders geredet.«
Vor einem Jahr war er vom Nürnberger Reichsparteitag zurückgekehrt, auf dem die neuen Rassengesetze beschlossen worden waren. Von da an galten nicht nur Juden, sondern auch Asiatinnen wie Shuilian als minderwertig. Tankred war an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen, das war überhaupt nicht sein Ressort, aber Shuilian hatte sich von ihm, dem Nazi, abgewendet und sich in die Arme eines indischen Geschäftsmannes geflüchtet.
»Das Kapitel Rawat ist erledigt. Du hast dich als der Stärkere erwiesen«, sagte sie.
»Kommt es darauf an?«
»Worauf denn sonst?«
Als Kind und Jugendlicher hatte Tankred immer der Cleverste sein wollen. Er war ausgefuchst für sein Alter, mit allen Wassern gewaschen – alles Ehrentitel, die ihm schmeichelten, verliehen von ausgefuchsten und mit allen Wassern gewaschenen Gestalten der Berliner Halbwelt. Ihre Bewunderung war am Ende des Tages das Einzige, was zählte. Mehr als einmal übernahm er höchst gefährliche Botengänge und erhielt dafür nichts weiter als ein Schulterklopfen. Mehr verlangte er auch gar nicht, und die Typen, die ihn losschickten, wussten das.