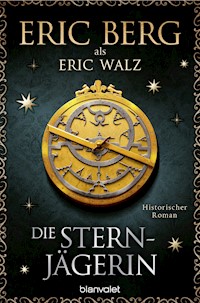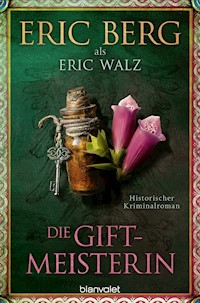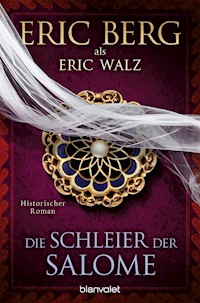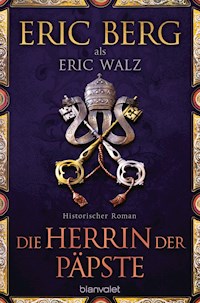2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Neuausgabe von »So bitter die Rache«! Ein spektakulärer Küstenkrimi von SPIEGEL-Bestsellerautor Eric Berg.
Nach Jahren im Ausland kehrt Ellen Holst mit ihrem Sohn nach Deutschland zurück – und hofft, in dem kleinen Haus in der beschaulichen Siedlung »Vineta« in Heiligendamm an der Ostsee endlich zur Ruhe zu kommen. Erst beim Einzug erfährt sie, dass in ihrem neuen Zuhause vor sechs Jahren drei Menschen ermordet wurden. Ellen will sich von der schrecklichen Vorgeschichte ihres Hauses nicht irre machen lassen, doch plötzlich kommt es zu beunruhigenden Vorkommnissen: Gegenstände verschwinden spurlos aus dem Haus. Ellen fühlt sich beobachtet. Und es gibt merkwürdige Parallelen zu den Geschehnissen vor sechs Jahren …
Dieser Roman ist bereits unter dem Titel »So bitter die Rache« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Nach Jahren im Ausland kehrt Ellen Holst mit ihrem Sohn nach Deutschland zurück – und hofft, in dem kleinen Haus in der beschaulichen Siedlung »Vineta« in Heiligendamm endlich zur Ruhe zu kommen. Erst beim Einzug erfährt sie, dass sich in ihrem neuen Zuhause vor sechs Jahren ein schreckliches Gewaltverbrechen ereignet hat – drei Menschen wurden ermordet. Ellen will sich von der schauerlichen Vorgeschichte ihres Hauses nicht irre machen lassen, doch plötzlich kommt es zu beunruhigenden Vorkommnissen: Gegenstände verschwinden spurlos aus dem Haus. Ellen fühlt sich beobachtet. Und es gibt merkwürdige Parallelen zu den Geschehnissen vor sechs Jahren … Dieser Roman ist unter dem Titel »So bitter die Rache« als Paperback erschienen.
Autor
Eric Berg zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Autoren. 2013 verwirklichte er einen langgehegten schriftstellerischen Traum und veröffentlichte seinen ersten Kriminalroman Das Nebelhaus, der 2017 mit Felicitas Woll in der Hauptrolle verfilmt wurde. Seither begeistert Eric Berg mit jedem seiner Romane Leser und Kritiker aufs Neue und erobert regelmäßig die Bestsellerlisten.
Von Eric Berg bereits erschienen
Das Nebelhaus · Das Küstengrab · Die Schattenbucht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
ERIC BERG
Totendamm
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotive: mauritius images (Markus Lange; Ingo Boelter; imageBROKER/Günter Lenz); www.buerosued.de
JaB · Herstellung: wag
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25189-5V001
www.blanvalet.de
Für Christian Zeller, in Freundschaft
»Kann wohl des großen Meergotts Ozean dies Blut von meiner Hand rein waschen?«
William Shakespeare, Macbeth
1
Ende Mai 2016
Es wäre wohl für jeden ein seltsames, verstörendes Gefühl, in ein kleines Haus einzuziehen, in dem sechs Jahre zuvor drei Menschen ermordet worden sind. Hätte Ellen das doch nur früher gewusst …
Aber sie hat es gerade erst erfahren, rein zufällig, wenn man Dorfklatsch als Zufall bezeichnen will. Die Maklerin hat es ebenso wenig erwähnt wie der Notar, aus verständlichen Gründen, und selbst wenn, nach einem weiteren Blick auf ihr neues Zuhause ist sie sich ziemlich sicher, wie sie entschieden hätte. Es ist einfach zu schön. Ganz Heiligendamm ist einfach zu schön, um es sich von einer abstrakten Tragödie aus vergangenen Tagen kaputtmachen zu lassen.
Ellen stellt die beiden Einkaufstaschen ab, reibt sich die vom Tragen leicht geröteten Finger und blickt den breiten gepflasterten Weg hinauf, wo hinter zahlreichen Bäumen, Büschen und Sträuchern der Dachfirst zu erkennen ist. Obwohl … ist das überhaupt ihr Haus? Sie ist gerade erst eingezogen und findet sich noch nicht zurecht.
Die Anlage, die vier Häuser umfasst, liegt am Rand eines Buchenwaldes. Sonnenstrahlen dringen an diesem Frühlingsmorgen durch das junge Blattwerk und werfen Spots auf die lindgrünen Farne, das tiefe Violett der Rhododendren und das frische Gelb der Forsythien. Hunderte Iris, Tulpen und Narzissen säumen die verschlungenen Wege, zwischen den Gebäuden und zum Haupteingang. Das Gelände strahlt die Noblesse eines Kurparks aus, die jedoch durch den sie umgebenden Wald gemildert, sozusagen geerdet wird. Auch der schlechte Zustand der zu den Häusern gehörenden privaten Gärten konterkariert das gepflegte Erscheinungsbild der Anlage.
Obwohl, je länger sie verweilt und sich umsieht, desto mehr fallen ihr Anzeichen von Verfall auf, die ihr zwei Wochen zuvor beim Termin mit der Maklerin entgangen sind. Etwa ist die Siedlung von einer Mauer umgeben, die aussieht, wie von einer entstellenden Krankheit befallen. Wozu überhaupt eine Mauer, wenn der Haupteingang für Autos und Fußgänger frei passierbar ist? Gittertor und Schranke sind gewiss schon ewig nicht mehr geschlossen worden, sehr zur Freude alteingesessener Spinnenfamilien. Das Pförtnerhäuschen steht verlassen da, durch das verschmierte Fenster könnte man gefahrlos eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Die drei Fahnenmasten daneben haben, wie zwangspensionierte Senioren, ihre Bestimmung verloren.
»Jetzt werd bloß nicht mäkelig«, raunt Ellen sich selbst zu und lässt den Blick in die andere Richtung schweifen, auf die Küste und das Meer. Wunderbar, wie sich dort, wo sie steht, alles versammelt, was Sinne erfassen können. Die Uferböschung ist nur zwei Steinwürfe entfernt, und vom Strand dringen gedämpft die Geräusche sanfter Wellen und spielender Kinder herauf, die sich mit dem Summen des Waldes vermengen. Das Meer ist wie blaues Perlglas. Alles strotzt von Leben und ist doch ganz ruhig, geradezu meditativ. Auf dem Weg die Uferböschung entlang ziehen, beinahe unwirklich, die schwarzen, stummen Silhouetten einiger Spaziergänger und Fahrradfahrer vorüber.
Wie um ein letztes gutes Argument vorzubringen, atmet sie das Gemisch aus aerosolhaltiger Brandung und moosigem Holz tief ein.
Alles richtig gemacht, denkt sie und nimmt die beiden Taschen wieder auf, um die letzten Meter hügelauf zu gehen.
Ellen ist am Morgen mit der Bäderbahn Molli, einem dampfenden Unikum mit nostalgischen Waggons und einem markanten Pfeifen aus einer anderen Zeit, nach Bad Doberan gefahren, um ein paar Lebensmittel einzukaufen. Eigentlich unvernünftig, gleich am ersten Tag nach dem Umzug einen umständlichen Ausflug zu unternehmen, doch ihre zweiundvierzig Jahre sind binnen Sekunden auf fünfundzwanzig zusammengeschmolzen. Sie wurde wieder zu jener jungen Frau, die sie mal war, abenteuerlustig und neugierig, voller Ungeduld, diesen Ort und alles, was dazugehört, zu ihrer neuen Heimat zu machen.
Im Café bekam ihre Euphorie einen unerwarteten Dämpfer versetzt. Ellen ließ sich gerade von der Chefin ein paar Tipps geben, als sie erwähnte, dass sie in die Vineta-Siedlung gezogen sei. Die Reaktion der Cafébesitzerin war ein »Oh«, und zwar eines von der Sorte, das sich wie »Autsch« anhört. Es folgte etwas, das man eine grauenhafte Geschichte hätte nennen können, hätte die Frau wenigstens mit ein paar Details aufgewartet. Doch als die Tragödie vor sechs Jahren passierte, hatte sie noch in Greifswald gewohnt und alles, was sie wusste, von einem Gast erfahren. Der Tourist hatte es wiederum von einem polnischen Saisonarbeiter erzählt bekommen.
Zog man alles ab, was unklar oder widersprüchlich war, blieben nur die Anzahl der Todesopfer übrig und die Tatsache, dass sie alle drei – merkwürdig genug – auf unterschiedliche Weise gestorben waren. Da eines der Opfer mit einem Schürhaken erschlagen worden war, ging die Polizei zunächst von mehreren Tätern aus. Allerdings fanden sich keine fremden DNA-Spuren am Tatort, und es fehlte auch nichts, weshalb Raubmord als Motiv ausschied. Irgendjemand aus dem Umfeld der Opfer war angeklagt worden, aber an diesem Punkt endete das Halbwissen der Erzählerin.
»Na ja, Hauptsache, Sie wohnen nicht im Haus ›Sorrento‹«, schloss sie. »In der Siedlung haben doch alle Häuser so komische Namen, oder? Jedenfalls herzlich willkommen bei uns. Und bis bald mal wieder, ja?«
Die Worte der Cafébesitzerin noch im Ohr, blickt Ellen auf den schmiedeeisernen Namenszug über der Haustür: Sorrento. Ein Städtchen am Golf von Neapel, bekannt für malerische Sonnenuntergänge und uralte Orangen- und Zitronenhaine, ist hier zum Synonym für ein brutales Verbrechen geworden.
Die anderen Häuser der Vineta-Siedlung sind durch das dichte Buschwerk kaum zu erkennen, allenfalls ragt mal ein Giebel über Hecken und Holunderbüschen heraus, oder ein Zipfel eines gelben Erkers lugt zwischen den Bäumen hervor. Beim ersten Rundgang am vorherigen Abend hat Ellen bemerkt, dass die Häuser zwar von ähnlichem Baustil, aber von unterschiedlicher Größe, Farbe und Form sind, sodass sie ein normales Dorf imitieren. Es gibt sogar einen Dorfplatz mit einer Linde und einem Brunnen, der jedoch stillgelegt ist.
Ellens Garten ist fast völlig zugewuchert, allerdings hat jemand vor Kurzem den schlimmsten Wildwuchs zurückgeschnitten, sodass man zumindest um das Haus herumgehen kann, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Es gibt also noch viel zu tun, was sie nicht im Geringsten stört. Dann hat sie wenigstens eine Beschäftigung, die jene Grübeleien fernhält, die mit der Trennung von einem Lebenspartner einhergehen. Besonders schön – und ausschlaggebend für den Kauf des Hauses – sind die beiden Terrassen, eine große im hinteren Garten, die man vom Wohnzimmer aus betritt, und eine kleine im Vorgarten, die an die Küche grenzt. Beide sind ansprechend möbliert.
»Tris?«, ruft Ellen ins Obergeschoss hinauf, sobald sie das Haus betritt.
Es bleibt still.
Sie verstaut die Lebensmittel. Um die Küche hat sie sich schon am Vortag gekümmert. Sie hasst es, ihren morgendlichen Kaffee auf einer Baustelle zu trinken und das Mittag- und Abendessen zwischen Kisten zuzubereiten. Mit ihren zweiundvierzig Jahren ist sie bereits an die zwanzigmal umgezogen, zehnmal mehr als viele andere in achtzig Jahren, und immer war die Küche nach zwei, höchstens drei Stunden einsatzbereit. Das einfache Silberbesteck aus der Erbmasse ihrer Mutter lag in den Schubladen, die Kupfertöpfe ihres Vaters hingen an den Haken, die Backformen und altmodischen Gerätschaften der Großeltern standen in den Regalen.
Die Küche macht es ihr leicht, sich darin wohlzufühlen. Der weiße viktorianische Vitrinenschrank und der lange Tisch aus Erlenholz strahlen die Gemütlichkeit eines alten Ehepaares aus, wohingegen die Technik inklusive des imposanten Induktionsherds auf dem neuesten Stand ist.
Das gesamte Haus ist möbliert. Wer auch immer es eingerichtet hat, versteht etwas davon, wie man modernes Wohnen durch vereinzelte Antiquitäten behaglicher macht und umgekehrt Landhausstil durch futuristische Elemente vor Kitsch bewahrt. Je nach Zimmer dominiert mal das eine, mal das andere, mal die Vergangenheit und mal die Zukunft. Nur im Wohnzimmer gibt es neben einem offenen altmodischen Kamin auch ein riesiges Gemälde mit Meeresmotiv, das von einem zeitgenössischen Künstler stammt.
Ellen ertappt sich bei der Überlegung, in welchem Raum das Verbrechen wohl stattgefunden hat. Sie zieht es vor, das Geschehen von vor sechs Jahren als »Verbrechen« zu bezeichnen, da es trotz allem harmloser klingt als »Mehrfachmord« oder gar »Massaker«.
Wer wohl umgekommen ist? Und warum? Ist der Täter gefasst und verurteilt worden?
»Tris?«
Auf der Wendeltreppe ins Obergeschoss bemerkt sie, dass zwei der hölzernen, weiß lackierten Sprossen des Geländers angeknackst sind, eine war wohl sogar gebrochen. Statt sie zu ersetzen oder zu kleben, hat man sie an der Bruchstelle einfach mit einem gleichfarbigen Klebeband umwickelt. Unwillkürlich prüft sie, ob noch weitere Spuren von was auch immer auf der Treppe zu finden sind. Flecken? Schrammen?
Wenn es je welche gegeben hat, so sind sie vollständig beseitigt worden.
Eine Minute lang bleibt sie auf der Treppe stehen, bewegt sich kaum. Dann geht sie weiter und klopft an die Zimmertür ihres Sohnes.
»Tris?«
Sie öffnet, er ist nicht da. Seine Sachen sind zur Hälfte ausgepackt, offenbar hat er die Lust verloren. Tristan ist so rastlos und umtriebig wie die Kindheit, die er so gut wie hinter sich hat.
Ellens erste Vermutung bestätigt sich, als sie hinterm Haus entdeckt, dass sein Fahrrad verschwunden ist.
Mit seinen vierzehn Jahren ist Tristan in einem Alter, in dem die Kinder des einundzwanzigsten Jahrhunderts sich weigern, noch länger Kinder zu sein. Das war zu Ellens Zeit nicht anders, bloß dass sie erst mit sechzehn Jahren oder noch später rebelliert hatte. Mit vierzehn, mein Gott, da las sie die Schatzinsel und Der kleine Prinz, mühte sich in der Turnmannschaft der Schule am Balken ab, trug eine Schleife im Haar und sammelte Abziehbildchen gutaussehender Fußballer. Viel mehr interessierte sie nicht. Viel mehr gab es auch nicht.
Das hat sich geändert. Die um die Jahrtausendwende Geborenen wissen schon in der sechsten Klasse, ob sie Sarah Connor, Justin Bieber und Xavier Naidoo mögen oder grässlich finden und was genau sie grässlich oder cool an ihnen finden. Sie wissen, ob ihnen Quinoa, Red Bull und Latte macchiato schmecken und ob bei Herrenunterwäsche gerade eher Replay, Calvin Klein oder G-Star Raw angesagt ist. Sie haben zu fast allem eine Meinung, auch wenn diese hirnverbrannt ist oder wechselhaft wie der Wind, und bestehen deswegen darauf, im Grunde schon volljährig zu sein.
Ellen sorgt sich nur kurz, weil Tristan aus dem Haus gegangen ist. Bislang ist er in ganz anderen Gegenden aufgewachsen als dem beschaulichen Heiligendamm im relativ sicheren Deutschland und dort auch manchmal ausgebüchst. Da er sein neues Surfboard mitgenommen hat, geht sie davon aus, dass er es am Strand ausprobieren will. Das Meer ist ruhig und glatt, und Tristan ist ein hervorragender und leidenschaftlicher Wassersportler. Ihm wird schon nichts passieren.
Genau deswegen ist Ellen an die Ostsee gezogen und nicht etwa nach Lüneburg, woher sie stammt. Ihre dort lebende Familie besteht aus einer einzigen, ungefähr tausendjährigen Großtante, von der sie nur weiß, dass sie gerne Beethoven hört und dazu Heideschnaps trinkt. So schön Lüneburg auch ist – was soll sie dort? Oder in Berlin, wo sie vor fünfzehn Jahren ihren Mann kennengelernt hat? Tristan soll endlich die Kindheit und Jugend bekommen, die sie ihm von Herzen wünscht, an einem Ort am Meer, an dem er seinen Hobbys nachgehen und Freunde finden kann.
Sie macht sich daran, die restlichen Umzugskartons auszupacken. Viel Arbeit ist das nicht. Sie hat nur wenige Habseligkeiten mitgenommen, von denen sie die Hälfte allein deshalb überallhin mitschleppt, weil sie sie an ihre Eltern oder Großeltern erinnert, die schon lange nicht mehr leben. Am Ende ihrer Kindheit war der Tod wie ein außer Kontrolle geratener Mähdrescher in ihre Familie gefahren: Eine Blinddarmentzündung, ein Autounfall, ein Stromschlag und ein paar Krankheiten haben die Menschen, die ihr bis dahin am nächsten standen, binnen weniger Jahre dahingerafft. Zuletzt ist ihre Mutter gestorben. Sie hat sich zwei Monate nach Ellens achtzehntem Geburtstag das Leben genommen, so als habe sie nur warten wollen, bis ihre Tochter auf eigenen Füßen steht. Diesen letzten Wunsch hat Ellen ihr dann auch posthum erfüllt.
Sorgfältig packt sie die Figuren aus Meißner Porzellan aus und sucht den passenden Standort dafür. In der hellen Wohnung kommen sie gut zur Geltung.
Das Handy klingelt.
»Ellen Holst.«
Zwei Sekunden lang ist es still in der Leitung, abgesehen von dem für Überseegespräche typischen eigentümlich dumpfen Rauschen, das ihr sofort verrät, wer anruft.
»Du hast deinen Mädchennamen wieder angenommen.«
Robert klingt weder vorwurfsvoll noch beleidigt, eher müde, resigniert. Genau der richtige Tonfall, um ihren wunden Punkt zu berühren. Aggressivität würde sie trotzen. Roberts Schwäche hingegen macht sie sofort schwach.
»Den Kaufvertrag habe ich mit ›von Ehrensee‹ unterschrieben«, erklärt sie äußerlich ruhig und zugleich innerlich aufgewühlt. »Aber als ich heute Morgen das provisorische Klingelschild geschrieben habe, da … Das war rein instinktiv.«
Er braucht erneut einige Sekunden, um zu antworten. »Ich weiß, du hast die heutzutage leider selten gewordene Angewohnheit, deiner inneren Stimme nachzugeben.«
Ellen kann sich nicht helfen, sie ist immer noch verliebt in seine Sätze und die Art, wie er sie ausspricht. Robert hat die Begabung, die Sprache zu beherrschen wie ein Musiker sein Instrument. So wenig wie ein Pianist seinen Zuhörern einfach nur die Noten vom Blatt vorspielt, so wenig benutzt Robert die Sprache ausschließlich, um Informationen zu vermitteln.
Ihn zu verlassen war das Schwerste, was Ellen je getan hat. Ihre Eltern nach deren Tod loszulassen war ihr leichter gefallen, denn damals hatte sie keine Wahl gehabt. Manchmal ist es die Hölle, die Wahl zu haben.
»Mein Gott, bei dir muss es mitten in der Nacht sein«, sagt sie, als es ihr bewusst wird.
»Ich komme von einem Empfang in der spanischen Botschaft. Du weißt ja, die Spanier stellen vor zehn Uhr abends kein Essen auf den Tisch. Heute haben sie es besonders spanisch gemeint und erst um halb elf serviert. Während wir sprechen, schwappt ein ganzer Tintenfisch in einem Liter Tempranillo in meinem Magen herum.«
»Dazu Serrano-Schinken, Garnelen in Knoblauchsud, cremacatalana …«
»Und einen ron miel als Absacker.«
»Das komplette Programm also.«
»In drei, vier Minuten werde ich explodieren.«
Ellen lacht, woraufhin sie einen Moment lang schweigen.
»Kann ich Tristan sprechen?«, fragt Robert. »Er geht nicht ans Telefon.«
»Er ist am Meer, und ich glaube, er hat das Handy hiergelassen.«
»Wie geht es euch?«
»Gut. Du solltest das Haus sehen. Es ist etwas …« Sie überlegt kurz, ob sie Robert gegenüber das Verbrechen erwähnen soll. Übrigens, auf meiner Treppe wurde vor sechs Jahren jemand gekillt. »… etwas Besonderes«, sagt sie stattdessen.
»Sicherlich. Wenn du es ausgesucht hast. Du hattest schon immer Geschmack.«
Wieder bleibt es still, aber es ist kein beklommenes, sondern ein einvernehmliches Schweigen.
Dann sagt er: »Joan würde gerne mal mit dir sprechen. Darf ich ihr deine neue Nummer geben?«
»Wer ist Joan?«
»Die Frau des amerikanischen Handelsattachés in Malaysia. Du erinnerst dich bestimmt. Ihr habt euch damals angefreundet.«
Ellen lässt sich auf das weiße Ledersofa fallen und schließt die Augen. Joan, du meine Güte. Ellen hat sie insgeheim »Schnapspraline« genannt, weil sie zuckersüß war und immer ein Aroma von teurem Alkohol verströmte. Ausgerechnet diese Person hat Robert dazu auserkoren, auf sie einzureden, dass sie zu ihm zurückkehrt. Nicht nur, dass diese Frau keineswegs ihre Freundin ist, nur weil sie mal zusammen einige viel zu starke Martinis in einer Villa am Rand von Kuala Lumpur geschlürft haben. Joan ist vielmehr der Inbegriff für das Leben, das Ellen endlich hinter sich lassen will. Ebenso gut hätte man Al Capone entsenden können, um einen jugendlichen Straftäter davon zu überzeugen, dem Verbrechen abzuschwören.
Schon merkwürdig – solange sie mit Robert allein ist, kann sie das ganze Drumherum vergessen, so als befänden sie sich in einem dunklen, schalldichten Raum, in dem es nur ihre Stimmen und Körper gibt. Die Erwähnung der Diplomatengattin ist, als hätte er einen Scheinwerfer eingeschaltet. Mit einem Mal ist all das wieder präsent, was sie zurückgelassen hat.
»Nein, Robert, ich möchte nicht mit dieser Joan reden. Offen gesagt, bin ich nie richtig warm mit ihr geworden. Sie isst mir zu gerne Schnapspralinen.«
»Wie bitte? Schnapspralinen?«
»Ach, ist nicht wichtig. Robert, ich habe hier jede Menge Arbeit, und du musst hundemüde sein. Lass uns die nächsten Tage sprechen, ja? Ich sage Tris, dass du angerufen hast.«
Nach dem Telefonat öffnet sie die Terrassentür und tritt hinaus in die Nachmittagssonne. Wie schon am Tag zuvor lässt sie sich trotz der unausgepackten Kisten von der schönen Anlage zu einem Spaziergang verlocken.
Das Licht an der Ostsee ist milder als an den Orten, an denen sie die letzten eineinhalb Dekaden gelebt hat, Orten mit einer glühenden, wabernden Sonne hinter feuchtem Dunst, Orten mit schönen Namen und hässlichen Gesichtern der Armut: Jakarta, Abidjan, Yaoundé, Antananarivo, Manila … Im Schnitt ist ihre kleine Familie alle eins Komma sieben Jahre umgezogen. Auch die Luft in Heiligendamm ist viel erfrischender, salzig und frei, nicht schwer und tröpfchenbeladen wie in den äquatorialen Tropen. Ellen hat fast vergessen, wie es ist, tief durchzuatmen und dabei für einen Moment zu glauben, sie schwebe ein paar Zentimeter über dem Boden.
Inmitten ihrer Tagträume bemerkt sie aus den Augenwinkeln zwischen den Büschen am Rand des Weges eine Bewegung – eigentlich nicht ungewöhnlich, geht doch ein Wind, in dem sich die Blütenzweige biegen. Sie hat die Stelle schon ein paar Meter hinter sich gelassen, als sie sich plötzlich umdreht.
Zwischen zwei Schlehen steht ein junger Mann, nicht älter als fünfundzwanzig, in Shorts und T-Shirt, mit einem seltsamen Grinsen im teigigen, weichen Gesicht. Er hebt die linke Hand auf Schulterhöhe, dreht ihr die Handfläche mit ausgestreckten Fingern zu und winkt, wie es Kinder oder Clowns tun.
»Hallo«, sagt er in leicht infantilem Tonfall.
Ellen nickt verhalten. »Hallo.«
»Hallo«, wiederholt er und winkt noch einmal. Dann holt er etwas aus der Hosentasche und streckt es ihr stolz entgegen. »Neues Telefon. Von heute. Ganz neu. Ist lustig.«
Sie betrachtet es höflich. Ein neues Modell, ziemlich teuer. Ellen lächelt. »Sehr schön.«
Er steckt es ein und winkt ihr ein drittes Mal zu, jedoch nicht, um sich zu verabschieden, denn er wendet sich keineswegs ab, sondern grinst und wiegt den Körper von links nach rechts, immer wieder.
Die Begegnung erwischt Ellen eiskalt, und sie überlegt, wie sie mit der Situation umgehen soll. Der junge Mann ist mental offensichtlich ein wenig … nun ja, zurückgeblieben. Darf man das so ausdrücken? Soll sie sich vorstellen? Oder einfach weitergehen?
»Ich heiße Ellen Holst.« Sie streckt die Hand aus, zieht sie jedoch aus Unsicherheit gleich wieder zurück. Ein wenig ärgert sie sich über sich selbst.
»Ellen«, wiederholt der junge Mann. »Holst.«
»Ja, genau. Und Sie?«
»Ellen. Holst. Ellen Holst.«
Ein paar Sekunden lang verharrt sie. Der junge Mann zwischen den Sträuchern wiegt sich hin und her. Er grinst. Er wiederholt ihren Namen. In Endlosschleife.
Etwas packt Ellen. Keine Hand oder Ähnliches. Nichts Physisches. Es berührt sie von innen her und bringt sie dazu, sich abzuwenden und fortzugehen, schneller als sie zuvor gelaufen ist. Vor der nächsten Biegung blickt sie sich um.
Der junge Mann ist ihr nicht gefolgt. Zwischen den Sträuchern steht er jedoch auch nicht mehr.
Das Gelände ist in drei Richtungen einigermaßen übersichtlich, nur ein paar kräftige Buchenstämme und ausladende Rhododendren bieten Versteckmöglichkeiten. Oder der Junge ist in ein nahes Haus gegangen. Das ist wohl die plausibelste Erklärung.
Sie spaziert weiter, betrachtet interessiert ihre Umgebung. Nach einer Minute, als sie ihren Garten erreicht, kommt sie wieder zur Ruhe.
Was ist nur in sie gefahren? Zwar scheint ein Gespräch mit dem Jungen unmöglich zu sein, doch sie hätte sich wenigstens verabschieden können. Ein »Tschüss« wäre ja wohl drin gewesen. Sie ist doch sonst nicht so. In ihrer Jugend hatte sie keinerlei Berührungsängste, mit der geistig behinderten Nachbarstochter ist sie völlig unbefangen umgegangen.
Und nun das.
Ellen seufzt und schüttelt die Begebenheit ab.
»Tris?«
Er ist noch immer nicht vom Strand zurückgekehrt. Wie eine kühle Böe erreicht sie ein Anflug von Sorge, lässt ihre Haut sich kurz zusammenziehen und ist im nächsten Moment auch schon wieder vorbei. Sie entspannt sich binnen eines Atemzuges, geht ins Schlafzimmer im Obergeschoss und hängt die eleganten Kleider in den Schrank, die sie aus Manila mitgebracht hat. Die anderen Sachen stammen aus der Zeit vor ihrer Ehe. Ihre Figur ist unverändert, und die meisten Stücke sind gut erhalten, ein paar Jeans, Caprihosen, leichte Pullis und Blusen.
Irgendwie hat sie ambivalente Gefühle bei dem Gedanken, sie in den kommenden Tagen zu tragen. Eine wärmende Nostalgie zieht Ellen zu ihnen hin, zugleich lässt die Kälte der Trennung sie zurückschrecken. Es wäre ein weiterer Schritt fort von Robert, und als die Emotionen in ihr aufwallen, kommt er ihr genauso groß vor wie der Flug von den Philippinen nach Deutschland. Während sie die Gegenstände einräumt, die Betten bezieht und einige Möbel verrückt, wird ihr klar, dass sie noch lange nicht angekommen ist in ihrem neuen Leben, ja, dass sie vielleicht gar nicht ankommen will.
Roberts Name hallt als ewiges Echo in ihr wider, doch sein Klang hat nichts Vergangenes, eher etwas Zukünftiges, und vor ihrem inneren Auge läuft ein Film, der nur ein einziges Motiv kennt: sein Gesicht.
Sie will zu ihm zurück.
Sie will in Heiligendamm bleiben.
Ihn nicht verlieren.
Ihn abschütteln.
Wie eine Geisteskranke sinkt sie auf die Bettkante, starrt vor sich hin und beginnt zu weinen. Was zum Teufel macht sie am anderen Ende jener Welt, in der Robert lebt? Der Ort, an dem sie gerade erst eingetroffen ist, ist nicht ihr Platz. Mit einem Mal fühlt sie sich hier so fremd, als hätten Aliens sie entführt und auf einem unbewohnten Planeten ausgesetzt. Sie ist mutterseelenallein, ohne Freunde, ohne Bezugspunkte, mit einem Sohn, der bisher kein einziges klares Wort zu ihrer Trennung von seinem Vater gesagt hat. Tris ist mit ihr gegangen, ohne sich zu beschweren, ohne ihr zuzureden. Die Last der Entscheidung trägt sie allein, und plötzlich hält sie es für möglich, davon erdrückt zu werden.
Zunächst nimmt Ellen das aufdringliche Geräusch kaum wahr, das sich langsam in ihre Verzweiflung schiebt: ein Klappern, tack-tack-tack-tack, etwa in der Geschwindigkeit, in der man vor sich hin zählt. Bildet sie es sich nur ein? Kommt es aus dem Haus? Nein, eher von draußen.
Wie sie von der Bettkante aus an den Bäumen erkennt, ist der Wind abgeflaut, daher kann sie sich das Klappern nicht erklären. Je mehr sie sich darauf konzentriert, umso deutlicher vernimmt sie noch etwas anderes: ein Summen.
Sie geht zum Fenster, blickt hinunter und findet ihre Fragen unschön beantwortet.
Der junge Mann, dem sie in der Anlage begegnet ist, steht mit dem Rücken zu ihr vor dem Gartentor und bewegt die Beine vor und zurück. Seine Flipflops verursachen auf dem Pflaster das unangenehme Klacken.
Er summt und wiegt sich dabei unentwegt vor und zurück. Was ist er – ein Wächter oder ein Belagerer? Was geht nur vor im Kopf des Jungen? Warum muss er ausgerechnet vor ihrem Garten stehen?
Sie würde ihn gerne ignorieren. Im Haus gibt es genug zu tun, um sich abzulenken. Doch die Sonne geht bereits unter, und Tris ist noch immer nicht zurück. Am liebsten würde sie ihn suchen gehen, aber ihr Sohn hasst es, wenn sie auf seine Regelverstöße mit zu großer Sorge reagiert. Strafen erträgt er eher als Bemutterung. Alle paar Minuten blickt sie zum Fenster hinaus und nimmt dabei zwangsläufig den jungen Mann wahr, der nimmermüde im gleichen Takt pendelt, eine Viertelstunde schon, dann eine halbe, eine ganze …
Ellen kämpft dagegen an, kann aber den leisen Zorn auf den summenden Belagerer nicht unterdrücken. Jedes Mal, wenn sie zum Fenster geht, hofft sie auf ihren Sohn, erblickt jedoch nur den seltsamen Burschen. Er wirkt einerseits harmlos, andererseits verunsichert er sie. Die größer werdende Sorge um Tris vermischt sich mit der irritierenden Anwesenheit des Unbekannten, auch wenn das eine mit dem anderen höchstwahrscheinlich nichts zu tun hat.
2
Juli 2010
Während er im Auto auf seine Frau wartete, betrachtete Paul die Schicksalslinie seiner Hand. Sie sprach die Wahrheit. Nach einem steilen Anstieg bis zur Mitte der Handfläche knickte sie waagerecht ab wie ein vom Sturm gebrochener Zweig und verlor sich dann in etlichen winzigen Furchen. Das war eine verblüffend realistische Spiegelung seines Lebens. Natürlich glaubte er nicht an solchen Hokuspokus, die Ähnlichkeit war purer Zufall, doch in seiner Lage bekam sogar Hokuspokus für einige Augenblicke den Anschein des Möglichen.
Als eine Amsel zwitschernd auf der Mauer neben der Tankstelle landete, ließ er das Beifahrerfenster herunter und lauschte dem Gesang. Irgendwo hatte er mal gelesen, dass Amseln eine durchschnittliche Lebenserwartung von drei Jahren haben, und ihm kam der Gedanke, dass er noch vor der Schwarzdrossel sterben könnte. Überhaupt nahm er die Lebendigkeit seiner Umwelt viel stärker wahr als früher: die Schwärme winziger Fliegen, die über der benachbarten Wiese tanzten, ein paar Bäume, deren Blätter weiß im gleißenden Sonnenlicht schimmerten, ein Hund, der neben seinem Herrchen herlief und ungeduldig auf den nächsten Befehl wartete.
Wie idyllisch das alles war. Sogar die mecklenburgischen Tankstellen sahen besser aus als die in Berlin, von der Landschaft ganz zu schweigen. Kiefern und Birken, Holunder und Schlehen, Spazierwege und Alleen, wohin das Auge blickte.
In Berlin hatte Paul in einem Gebäude von abstoßender Hässlichkeit gearbeitet, und obwohl ihn an der Küste im Allgemeinen und in Heiligendamm im Speziellen das genaue Gegenteil erwartete, zudem gute Luft und viel Ruhe, konnte er nicht anders, als sich an seinen hektischen Arbeitsplatz neben einer vielbefahrenen Straße zurückzuwünschen. Die Sehnsucht war von der schlimmsten Sorte – der unerfüllbaren.
Vor achtzehn Monaten hatte er einen leichten Schlaganfall erlitten, ein halbes Jahr später einen zweiten, die beide keinen bleibenden Schaden hinterlassen hatten, zumindest keinen sichtbaren. Ihm jedoch kam es vor, als wäre ihm zweimal ein Blitz in den Kopf gefahren, zu den Füßen wieder ausgetreten und hätte alles dazwischen in eine vibrierende Unordnung gebracht. Er erkannte seinen Körper nicht wieder, litt seitdem unter Verdauungsproblemen, Nervosität, Übelkeit, Herzrhythmusstörungen und was sonst noch alles. Doch damit nicht genug.
Zum zweiten Mal an diesem Tag kramte er das Röntgenbild aus der Tasche. Die Metastase hatte die ungefähre Form des Plattensees in Ungarn, wo er früher so gerne Urlaub gemacht hatte, oder mit etwas Fantasie auch die Form eines schwarzen Pfeils, der sich mitten in das Organ gebohrt hatte. Zuerst die Prostata, nun die Niere. Man hatte ihn, den siebenundfünfzigjährigen Oberstaatsanwalt Derfflinger, unter Lobeshymnen sowie tausendfachen Glück- und Genesungswünschen frühpensioniert.
Als er Julia aus dem Gebäude kommen sah, steckte er das Röntgenbild eilig weg und verstaute die Tasche hinter dem Sitz. Zu spät bemerkte er, dass er sich damit ruhig hätte Zeit lassen können. Julia sprach einen jungen Angestellten im Blaumann an. Worum es ging, konnte Paul nicht verstehen.
Tränen stiegen in ihm auf. Wie hübsch seine Frau aussah in ihrem Outfit: weißer, knielanger Einteiler mit großen roten Blüten, den transparenten rosafarbenen Schal locker um ihren blassen, schlanken Hals geschlungen, dazu silbrige Sandaletten, die ihn an ihren letzten gemeinsamen Urlaub an der italienischen Riviera erinnerten. Obwohl sie bereits im fünften Monat war, war die Schwangerschaft kaum zu erkennen.
Selbstverständlich verübelte Paul es dem jungen Mechaniker mit italienischen Vorfahren, dass er Julia hinterhersah, als sie leichtfüßig zum Auto schritt. Er hatte es schon oft erlebt, aber daran gewöhnt hatte er sich bis heute nicht. Dann fiel der Blick des Mechanikers auf ihn, und Paul las in seinen Gedanken, dass er sich fragte, ob der Mann auf dem Beifahrersitz wohl ihr Vater oder ihr Ehemann war. Seinem höhnischen Gesichtsausdruck nach entschied er sich für Letzteres, und sein Urteil stand binnen einer Sekunde fest. Paul fuhr einen nagelneuen Mercedes, hatte eine deutlich jüngere Frau und keine Haare mehr auf dem Kopf – der Inbegriff eines alten, reichen Sacks.
Man sollte annehmen, dass das schlechte Voraussetzungen für eine gute Ehe waren, wenn der eine Teil leichtlebig und der andere ordnungsliebend, der eine Teil unbekümmert und der andere eher ernst war. Aber ihre Beziehung war von Anfang an kein Tauschgeschäft à la »Du bist schön, ich habe das Geld« gewesen. Julia hatte frischen Wind in Pauls monotones Leben gebracht, dafür hatte er ihr, die zuvor ziemlich chaotisch gelebt hatte, eine gewisse Struktur gegeben.
Als Julia sich noch einmal zu dem Mechaniker umdrehte, der ihr einen ziemlich koketten Abschiedsgruß zuwarf, wäre Paul beinahe ausgestiegen. Noch vor drei Jahren hatte ihn so etwas nicht gestört. Da war er aber auch noch ein vor Energie strotzender Mann auf dem Höhepunkt seiner Karriere gewesen, der frisch verheiratet war – zum ersten Mal – und vom Ruhestand so weit entfernt schien wie der Äquator vom Polarkreis. Jetzt lag er manchmal auf dem Bett und rang um Luft. Selbst wenn er sich gar nicht regte.
»Es gab kein Wasser mit Kohlensäure mehr, also habe ich stilles gekauft«, sagte Julia, warf die Flaschen auf den Rücksitz und setzte sich ans Steuer. Mit einem Lächeln fügte sie hinzu: »Und eine Packung Kekse mit Zitronengeschmack. Die magst du doch, oder?«
»Sehr, danke.«
Solange Julia in seiner unmittelbaren Nähe war, war alles in Ordnung. In ihrer Gegenwart fühlte er sich, als könne ihm nichts etwas anhaben. Dann freute er sich, Vater zu werden, und vergaß sogar seine Krankheit für eine Weile.
»Ich habe mir eine andere Strecke nach Heiligendamm empfehlen lassen«, sagte sie.
»Habe ich mitbekommen. Der Weg führt nicht zufällig über Italien?«
»Wie süß, du bist eifersüchtig. Sieh mal hier, das ist zwar ein Umweg, aber wir müssen nicht die ganze Zeit auf der Bundesstraße fahren. Die ist so … gerade. Was meinst du?«
»Gute Idee.«
»Sicher?«
»Ganz sicher.«
»Wenn du lieber …«
»Ab die Post!«, rief er lachend und berührte die Stupsnase in ihrem noch immer leicht kindlichen Gesicht, dem man die dreißig Lebensjahre nicht ansah.
Das Glück in ihren blauen Augen und der auf seine Wange gehauchte Kuss entschädigten ihn für die Tortur des bevorstehenden Umwegs. Lieber jetzt als gleich wäre er in ihrem neuen Haus in Heiligendamm angekommen, hätte sich hingelegt und ein Nickerchen gemacht.
»Fühlst du dich gut?«, fragte sie nach einer Weile. »Du bist so still.«
»Alles bestens.«
Sollte er ihr beichten, dass er das Gefühl hatte, in seiner Brust atme die Lunge eines Spatzes? »Die Landschaft ist einfach unschlagbar«, sagte er.
»Ja, das ist sie. Du wirst sehen, das Meer und die Ruhe werden Wunder bei dir bewirken.«
»Ein wenig hoffe ich auch auf die Spezialklinik in Rostock«, schränkte er ein.
Nun war es Julia, die still wurde. Nicht, dass sie Gesprächen über seinen Gesundheitszustand auswich. Wenn es ihm schlecht ging, war sie besonders rührend zu ihm. Sie begleitete ihn zu allen wichtigen Terminen und sorgte dafür, dass er sich strikt an die Anweisungen der Ärzte hielt. Der Umzug an die Ostsee war ihre Idee gewesen. Trotzdem war sie nicht ganz bei ihm. Sie konnte nicht wirklich nachfühlen, was er durchmachte. Eine Frau in seinem Alter hätte es vielleicht eher vermocht. Aber Julia – so wenig wie ein kleines Kind den Tod begreift, so wenig begriff sie das innere Ausmaß seiner schweren Krankheit.
Von der Welt, in der er seit achtzehn Monaten lebte, hatte sie keine Ahnung. Jener Welt, in der die Zeit gegen den Menschen arbeitet, der Körper gegen den Menschen arbeitet, der Welt des Gemetzels. Seine Frau war topfit, hübsch, voller Elan, eine Grazie, bald Mutter.
Ihre Eltern, die in Pauls Alter waren, sogar ein wenig jünger als er, lebten glücklich in Ulm, beide noch berufstätig. Und ihre Großeltern machten mehrmals im Jahr Wandertouren. Zum Club der Schwachen und Todkranken, dem er unfreiwillig beigetreten war, hatte Julia weder geistigen noch emotionalen Zugang, noch hatte sie bis vor Kurzem geahnt, dass es den Club überhaupt gab. Wie konnte sie, die gerade ein Kind in sich trug, wissen, wie sich Zukunftslosigkeit anfühlte? Wie konnte sie, die dem geliebten heranwachsenden Wesen in ihr bereitwillig von ihrer Kraft spendete, nachempfinden, dass er dem Feind, der in seinem Körper wuchs, voller Furcht und Hass begegnete? Dass er ihm nichts gönnte und dennoch nahezu hilflos zusehen musste, wie er seine Kraft anzapfte? Nein, davon verstand Julia nichts – und er wollte auch nicht, dass es so weit kam.
Heiligendamm, ihr neuer Wohnort: etwa dreihundert Einwohner, dreieinhalb Millionen weniger als Berlin, zumeist Betuchte. Das Cannes der Ostsee – so jedenfalls hatte Julia das Örtchen angepriesen, vermutlich um es ihm schmackhaft zu machen. Denn er hatte sein Haus mit dem großen Garten in Köpenick nur unwillig verkauft. Allerdings musste er zugeben, dass das 1793 gegründete älteste Seebad Kontinentaleuropas, das die »Weiße Stadt am Meer« genannt wurde, durchaus etwas hermachte, nun da es im alten Glanz erstrahlte.
»Wirklich hübsch«, sagte er, als sie das Ortsschild passierten und im Kutschentempo die Villen passierten. Seltsamerweise war er noch nie in Heiligendamm gewesen, immer nur vorbeigefahren. Doch er hatte im Internet nachgelesen und sich Bilder angeschaut.
»Marcel Proust hat hier schon Urlaub gemacht«, sagte Julia. »Außerdem Schiller, Rilke und Kafka.«
Wie jedes Mal, wenn von Kunst und Literatur die Rede war, war Paul beunruhigt. Er verstand davon so viel wie Julia vom Strafgesetzbuch, von Beugehaft, eidesstattlicher Versicherung und Revision.
»Etwa gemeinsam?«, fragte er, um seine Unsicherheit humorvoll zu überspielen.
Julia lachte. »Da ist auch schon der Wegweiser nach Vineta.«
»Der Wegweiser nach Vineta«, wiederholte Paul und ließ sich jedes Wort auf der Zunge zergehen. »Und wo geht es nach Atlantis?«
»Sieh mal an, du hast dich also mit Geschichte beschäftigt.«
Er fühlte sich äußerst wohl unter ihrem amüsierten Blick. »Ich fand, dass sich ›Vineta‹ nach Eiscreme anhört, aber so doof kann nun wirklich keiner sein, eine luxuriöse Wohnanlage nach etwas zu benennen, mit dem man sich regelmäßig bekleckert. Also habe ich gegoogelt. Vineta war eine sagenhafte Stadt, die irgendwann in der Ostsee versunken ist. Immer dasselbe mit den Immobilienunternehmen, die solche Siedlungen bauen. Sie geben ihnen hochtrabende Namen, um sie noch ein paar Prozent teurer zu machen. In Italien heißen sie wahrscheinlich nach großen Opern, in England nach siegreichen Seeschlachten und in Griechenland Achilles, Herakles oder Zeus. Wir müssen wohl froh sein, dass die Anlage nicht ›Wotan‹ heißt.«
Julia bog ab und kam abrupt zum Stehen, sodass sie beide ein bisschen durchgeschüttelt wurden.
»Entschuldigung, ich habe es erst im letzten Moment gesehen.«
»Was denn?«
»Das Schild. Wir sind da.«
»Ach.«
Sie standen in einer breiten, ansteigenden Einfahrt und blickten über den Stern auf der Motorhaube hinweg in einen blühenden, bewaldeten Garten. Nur eine Schranke trennte sie noch von diesem Paradies. Zur Linken prangte der Name der Siedlung in weißer, geschwungener Schrift auf einer meerblauen Tafel von der Größe eines Fußballtores. Daneben stachen drei Masten in die Höhe, an denen imposante blaue und gelbe Fahnen mit dem Stadtwappen im Wind flatterten. Zur Rechten stand ein nagelneues Pförtnerhäuschen und zu beiden Seiten erstreckte sich eine mit Kameras versehene Mauer.
»Nicht schlecht«, sagte Paul. »Aber wer lässt uns herein? Gibt es hier eine Klingel?«
»Der Erbauer hat gesagt, wir bekommen eine Chipkarte.«
»Der Erbauer, mächtiger Himmel.«
»So hat er sich selbst bezeichnet.«
»Hat er schon an den Pyramiden mitgewirkt, oder was?«
»Er ist eigentlich ganz nett.«
»Das da ist er aber nicht zufällig?« Paul deutete auf einen jungen Mann von nicht mal zwanzig, der neben dem Pförtnerhäuschen stand, grinste wie ein Honigkuchenpferd und winkte wie ein kleines Kind.
Er ging in das Häuschen, und siehe da, ein paar Sekunden später hob sich die Schranke.
»Ein seltsamer Pförtner«, seufzte Paul. »Aber ich will mich nicht beklagen. Hauptsache, wir gelangen in diese Festung.«
Kaum hatte er den Satz beendet, senkte sich die Schranke wieder, bevor der Mercedes sie auch nur zur Hälfte passiert hatte. Mit einem Rumms landete sie auf der Kühlerhaube.
»So ein Idiot!«, rief Paul.
Als der Junge sah, was er angerichtet hatte, rannte er erschrocken davon.
»Nicht zu fassen«, schrie Paul. »Hey du, komm zurück und mach die Schranke auf. Wird’s bald.«
»Ist doch nichts passiert«, beschwichtigte Julia.
»Und wie kommen wir nun hier weg? Weit und breit ist kein Pförtner zu sehen. Vineta ist so gut gesichert, dass nicht einmal die eigenen Bewohner hineinkommen.«
Julia seufzte und öffnete die Wagentür. »Ich sehe mal nach.«
Sofort tat es ihm leid, dass er sich so gereizt gezeigt hatte und dass Julia losgehen musste. Die letzten Tage vor dem Umzug hatten ihn vollends aufgerieben, obwohl er so gut wie nichts dazu beigetragen hatte. Die Tatsache, dass seine schwangere Frau sich um all das kümmerte, was eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, ärgerte ihn maßlos.
Sobald sie aus seinem Sichtfeld verschwand, wurde er unruhig. Ihm fehlte dann jedes Mal etwas, so als stünde er nur auf einem Bein. Was für ein beschissenes Leben, sagte er sich. Auf alles konnte er immer nur warten, auf den nächsten Arzttermin, die nächste Übelkeit, Julias Rückkehr …
Eine halbe Minute verging, dann schwindelte ihm leicht, und langsam stieg eine brennende Säure in ihm auf. Nach einigen Sekunden glaubte er sich übergeben zu müssen, öffnete die Beifahrertür und hielt den Kopf hinaus. Seltsamerweise fiel ihm auf, dass das würfelförmige Pflaster der Einfahrt, auf die er sich übergab, aus hochwertigem, verschiedenfarbigem Basalt geschmackvoll zu einem Ornament arrangiert worden war. Die Arbeiten mussten ein kleines Vermögen gekostet haben.
Im nächsten Augenblick ergoss sich ein zweiter Schwall aus seinem Mund.
Er presste den Hinterkopf gegen den Sitz, atmete tief durch und wartete, bis die Übelkeit abklang.
Julia trat aus dem Pförtnerhäuschen, gefolgt von einem Mann in Pauls Alter in einer beigefarbenen Uniform, in der er ein bisschen wie der Paketbote einer amerikanischen Lieferfirma aussah. Nur der Gummiknüppel, der an seiner Hüfte baumelte, gab einen Hinweis auf seine wahre Funktion. Höflich blieb er einen Schritt hinter Julia stehen und öffnete ihr die Autotür, während Paul seine Tür schloss und hoffte, dass keiner das Malheur auf dem Pflaster bemerkte. Rasch schob er sich noch ein Pfefferminz in den Mund, bevor ihm der Angestellte eine dunkel behaarte Hand durch das geöffnete Fahrerfenster an Julia vorbei entgegenstreckte.
»Josip Vukasovic«, stellte er sich vor. »Herzlich willkommen, Herr Doktor Derfflinger.«
»Oh, vielen Dank.« Paul mochte es, mit seinem Titel angesprochen zu werden, den er sich einst hart erarbeitet hatte.
»Ich bin der Wachmann hier. War nur mal kurz für kleine Pförtner, bitte entschuldigen Sie.«
»Da war ein Junge, der die Schranke geöffnet und viel zu schnell wieder geschlossen hat. Sie sehen ja selbst.«
»Das war Ruben, der arme Kerl. Keine Sorge, der ist harmlos. Nichts passiert, oder? Nein, sieht gut aus. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt? Ihre Rosen sind vor zwei Stunden angekommen. Ich habe den Lieferanten bis zu Ihrem Haus begleitet.«
Das Deutsch des Wachmanns war tadellos, lediglich der leichte Akzent, das Aussehen und natürlich der Name wiesen ihn als Migrant vom Balkan aus.
»Vor zwei Stunden?«, sagte Paul. »Das ist gut. Dann sind die Stöcke vermutlich schon eingepflanzt.«
Ohne die Rosen wäre Paul nicht umgezogen. Seit über zwanzig Jahren waren sie in seinem Köpenicker Garten gediehen, französische, englische, damaszenische Rosen, gelb, rot, rosa und weiß, getupft und meliert, inzwischen zu imposanten Büschen gewachsen. Mit Frauen hatte Paul nie viel Glück gehabt, seine Beziehungen hatten mal einen Monat, mal ein Jahr und im besten Fall drei Jahre gehalten. Bei seinen Rosen dagegen hatte er stets ein gutes Händchen gehabt. Einst waren sie der Ausgleich zu seiner aufreibenden Arbeit gewesen. Inzwischen waren sie zusammen mit Julia das Einzige, was ihm noch uneingeschränkt Freude bereitete, und dass seine Frau ihn bei dieser Passion unterstützte, vergrößerte sein Glück noch. Sie hatte eine Gartenbaufirma beauftragt, die Rosen auszugraben und in Heiligendamm einzupflanzen. Nachdem Paul ihr auf einem Lageplan des Gartens die Position der einzelnen Stöcke aufgezeichnet hatte, war sie eigens noch einmal zu der Firma gefahren und hatte mit dem Chef alles durchgesprochen.
Auf Paul kam nun die Herausforderung zu, die Rosen noch intensiver zu pflegen als bisher. Die empfindliche Königin der Blumen mochte keine Umzüge, schon gar nicht im Hochsommer, und die salzige Meeresluft könnte ihre Schönheit beeinträchtigen. Dies zu verhindern war eine Aufgabe, der er sich gewachsen fühlte, weit mehr als dem Kampf in seinem Inneren.
»Nochmals vielen Dank, Herr Vulk … Vulkano …? Ich habe leider Ihren Namen vergessen«, sagte Paul zerstreut.
»Einfach Josip, Herr Doktor«, antwortete der Wachmann freundlich und tippte auf das Namensschild an seiner Uniform. »Einen schönen Tag wünsche ich. Und wenn Sie etwas brauchen, Ihre Frau hat alle nötigen Informationen bekommen, auch die Telefonnummer vom Wachhaus.«
»Er heißt Vukasovic«, stellte Julia klar, nachdem sie das Fenster geschlossen hatte.
In angemessener Geschwindigkeit fuhr sie die Auffahrt hinauf, während Paul durch die Heckscheibe beobachtete, wie sich Josip Vukasovic der unansehnlichen Pfütze näherte, die er auf dem Pflaster hinterlassen hatte. Der Wachmann sah dem Auto hinterher, und Paul richtete den Blick augenblicklich starr nach vorne.
»Was ist?«, fragte Julia.
»Nichts.«
»Ein netter Mann.«
»Sehr.«
»Beruhigend, dass es einen Wachdienst gibt, oder? Um acht Uhr abends werden die Tore geschlossen. Man sieht sie tagsüber nicht, sie sind in die Mauer eingelassen. Wir haben eine Chipkarte bekommen, mit der sich die Tore und Schranken öffnen lassen. Es gibt Klingeln, Kameras und eine Gegensprechanlage. Von unserem Haus aus haben wir alles im Blick und können die Schranken auch von dort aus öffnen. Besucher müssen sich tagsüber beim Concierge melden, oder wie immer das hier heißt. Also bei Josip. Nachts übernimmt ein Sicherheitsdienst die Videoüberwachung.«
Keiner wusste besser als Paul, wie wichtig es war, Häuser gegen Einbrecher zu sichern. Siebenundzwanzig Jahre lang hatte er sich zehn Stunden am Tag mit Verbrechen beschäftigt, natürlich auch mit Einbrüchen und Raubüberfällen, deren Zahl fast überall in Deutschland stetig anstieg. Eine noble Anlage wie diese wirkte auf Diebe wie ein Magnet. Dazu die Nähe zur Grenze … Was er bislang an Maßnahmen gesehen hatte, stellte ihn jedoch zufrieden.
»Das hast du toll ausgesucht«, lobte er Julia.
»Ich weiß doch, was dir wichtig ist.«
Paul lächelte, zum ersten Mal an diesem Tag aus tiefster Überzeugung.
Auch das Haus gefiel ihm. Noch vor ein paar Jahren wäre es für seinen Geschmack ein bisschen zu verspielt gewesen. Damals hatte für ihn ein Haus weiß angestrichen zu sein, und fertig. Keine Pastellfarben, keine Erker, keine Aussparungen, keine in die Konstruktion eingelassenen Terrassen oder gar Innenhöfe, sondern klare, gerade Linien. Sein neues Zuhause erfüllte keine dieser Bedingungen. Doch Julia hatte seinen Geschmack verändert oder, wie er es lieber formulierte, erweitert.
Natürlich war Heiligendamm nicht mit Köpenick zu vergleichen: die Lage am Meer, der Hauch von Belle Époque, die noble Siedlung mit Park, der Wachdienst … Er hätte es nie von sich erwartet, aber er war dabei, sich in die kleine Villa Kunterbunt im Neubaustil zu verlieben.
Der Lieferwagen der Gartenbaufirma nahm den ganzen Privatparkplatz ein, daher stellte Julia das Auto daneben ab.
»Seltsam«, sagte Paul. »Wo sind denn die Gärtner? Und wo sind meine Rosen?«
»Vermutlich haben sie an der hinteren Terrasse angefangen, und die anderen Stöcke sind noch im Lieferwagen, wegen der Sonne.«
»Die brauchen aber lange. Typisch Berliner Arbeiter. Bloß nicht hetzen. Ick bin doch nich uff de Flucht, Meester.«
Paul meinte den Satz durchaus nicht herablassend. Alles in allem kam er gut mit der Berliner Seele zurecht, auch wenn er kein gebürtiger Hauptstädter, sondern Brandenburger war. Was ihn selbst betraf, war ihm diese Einstellung zu Arbeit und Zeit allerdings fremd.
Julia ging voraus, um die Haustür aufzuschließen, und während sie nach dem richtigen Schlüssel suchte, fiel Paul der seltsame Teenager auf, der so unbeholfen mit der Schranke hantiert hatte. Er stand ein paar Meter entfernt auf der anderen Seite des Fahrweges im Gras und winkte ihm auf kindliche Weise zu.
»Na, der hat Nerven«, sagte Paul und wandte sich ab. »Was die hier für komische Leute wohnen lassen. Hoffentlich sind nicht alle so.«
»Der Erbauer hat bei unserem Treffen gesagt, dass er sehr stolz ist, die verschiedensten Persönlichkeiten in Vineta zusammenzubringen, und er hat auch irgendwas von einem behinderten Jungen erzählt, der mit seiner Mutter hier lebt.«
»So. Würde es dir etwas ausmachen, den Bauherren nicht länger als Erbauer zu bezeichnen? Ich habe dann immer das Gefühl, es mit einem Monarchen zu tun zu haben.«
»Aber gerne. Würde es dir im Gegenzug etwas ausmachen, ein bisschen freundlicher zu dem Jungen zu sein?«
»Freundlicher? Ja, wie denn?«
»Etwa so«, sagte sie und winkte dem Jungen mit ausgestrecktem Arm zu.
Das liebte er so an seiner Frau. Vom ersten Tag an hatte sie Seiten an ihm entdeckt und hervorgebracht, von denen er gar nicht gewusst hatte, dass er sie besaß, geschweige denn dass er sie ausleben wollte. Noch vor fünf Jahren hätte man ihm mit Picknicks im Grünen, Filmkomödien oder Kirmesbesuchen nicht zu kommen brauchen. Julia veränderte ihn jeden Tag ein bisschen. Das Verrückte dabei war, dass er den nächsten Tag mit ihr, die nächste Bekehrung gar nicht erwarten konnte – auch wenn ihm manche Dinge nicht sofort leichtfielen. Sie sprühte meist vor Lebenslust. Wenn sie über eine Spreebrücke gingen, winkte sie den Touristen auf dem Ausflugsdampfer unter ihnen zu, mit jedem Taxifahrer, jeder Floristin, jeder Marktfrau kam sie ins Gespräch, und andauernd servierte sie ihm neue Lebensmittel, grünen Tee, Eselsalami, Elchbraten. Mit Julia an seiner Seite kam es Paul vor, als lernte er die Welt ein zweites Mal kennen. Er wünschte nur, er könnte ihr mehr zurückgeben.
Endlich hatte sie den richtigen Schlüssel gefunden und öffnete die Tür, sodass er einen Blick hineinwerfen konnte.
»Sehr schön.«
»Du hast ja noch gar nichts gesehen. Komm rein.«
Zögerlich setzte er einen Fuß vor den anderen, bis Julia verstand.
»Ach ja, die Rosen …« Sie lächelte nachsichtig. »Einverstanden, sehen wir erst einmal nach, was deine Königinnen machen. Sei froh, dass ich keine eifersüchtige Person bin.«
Die Arme ineinander verschränkt, schlenderten sie durch den Vorgarten, vorbei an der Küchenterrasse in Richtung der Rückseite mit dem großen Garten und einer weiteren ausladenden Terrasse. Julia erläuterte ihm, wo sie den Gartenteich anlegen, einen marokkanischen Kacheltisch mit zwei schmiedeeisernen Stühlen aufstellen und einen Kirschbaum pflanzen wollte.
»Ich mag Libellen. Ich mag es, wie sie in der Sonne glänzen. Und ich mag das Geräusch von plätscherndem Wasser. Kannst du dir vorstellen, wie wir unter dem Kirschbaum sitzen und den Geburtstag unserer kleinen Tochter feiern? Kannst du dir vorstellen, wie wir abends den Sonnenuntergang über dem Wald genießen? Kannst du dir vorstellen …?«
Er konnte. Jedes einzelne dieser von seiner bezaubernden Frau in die Luft gezeichneten Gemälde nahm Gestalt an. Mit ihr an seiner Seite war alles möglich.
Genau in diesem Moment sah er, wie ein junger Mann auf der Rückseite des Hauses einen der Rosenstöcke in einer viel zu flach gegrabenen Mulde versenkte und mit Erde bedeckte.
»Was machen Sie denn da?«, rief Paul und stürzte auf den Gartenarbeiter zu. »Sehen Sie denn nicht, dass das Loch nicht annähernd tief genug ist?«
Der Mann war ungefähr fünfundzwanzig Jahre alt, hatte glattes, schulterlanges braunes Haar und einen athletischen Körperbau. Das Achselshirt brachte seine Muskeln besonders gut zur Geltung. In zahlreichen Rinnsalen floss ihm der Schweiß über Schläfen, Arme, Brust und Rücken.
»Das ist eine kostbare Damaszenerrose«, ergänzte Paul. »Sie haben den Wurzelballen ja nur zu drei Vierteln eingegraben, das ist viel zu wenig. Und vorgewässert haben Sie ihn auch nicht.«
»Wollte ich ja«, rechtfertigte sich der junge Mann. »Aber …«
»Wo sind überhaupt Humus und Hornspäne?«, unterbrach ihn Paul. Er konnte dem Gesicht des Jüngeren ansehen, dass er keinen Schimmer hatte, wovon die Rede war.
»Hallo und guten Tag erst mal«, sagte der Arbeiter.
»Guten Tag«, erwiderte Paul in einem Tonfall, dem man nicht anmerkte, dass er meinte, was er sagte. Verzweifelt musterte er die weiße Rose, deren Blüten erste Anzeichen von Wassermangel erkennen ließen.
Dass der Dilettant über seinen Rücken hinweg Julia anstarrte, sich kokett auf den Stiel seiner Schaufel stützte und dabei die Mundwinkel zu einem Grinsen hob, machte die Sache nicht besser.
»Was ist?«, fragte Paul barsch. »Wollen Sie vielleicht mal etwas unternehmen? Wenn Sie künftig weniger Workouts und dafür mehr Sudokus machen, werden Sie vielleicht begreifen, dass ein Job mehr ist, als die Zeit bis zum Feierabend irgendwie zu überstehen.« Jetzt erst bemerkte er, dass ein paar Meter entfernt ein Dutzend weitere Rosenstöcke unter einem Kastanienbaum wie zu einer Parade aufgestellt waren.
»Die habe ich da deponiert«, sagte der junge Mann.
»Sie müssen sie wässern und einpflanzen«, entgegnete Paul, »nicht einfach irgendwo hinstellen. Wirklich unfassbar. Ihr Dilettantismus ist mit normaler Dummheit schon nicht mehr zu erklären. Wo ist Ihr Chef? Warum arbeiten Sie allein? Holen Sie sofort jemanden her. Ich brauche dringend Wasser, viel Wasser. Nun machen Sie schon!«
Der junge Mann ließ die Schaufel fallen und trottete in provozierend gemütlichem Tempo davon, wobei Paul nicht entging, dass er mit seinem muskulösen Arm den zierlichen von Julia für den Bruchteil einer Sekunde streifte.
Paul hielt sich damit jedoch nicht lange auf, sondern begutachtete die Rosen unter dem Kastanienbaum. Dass sie im Schatten standen, hatte ihnen wenigstens einen schweren Schaden erspart.
Julia trat neben ihn und legte ihm eine Hand auf die Wange. »Beruhige dich«, bat sie sanft.
»Ich zittere nicht und knirsche auch nicht mit den Zähnen. Du siehst, ich bin völlig ruhig.«
»Das ist eine Zeitbombe auch, kurz bevor sie hochgeht.«
Er ließ einige Sekunden verstreichen, so als müsse er seine nächsten Worte erst zusammensuchen. »Ich explodiere ganz bestimmt nicht. Es geht mir gut.« Er küsste Julias Hand dort, wo der Puls schlug, und gab sie ihr sacht zurück.
Ein greller Ruf unterbrach die Intimität des Augenblicks. »Huhu … Huhu …«
Eine Frau stürmte so schnell auf Paul und seine Frau zu und umarmte sie beide, dass er zunächst nicht begriff, was überhaupt vor sich ging.
»Ich bin Hanni. Und das ist mein Mann Alfred. Wir sind die Frohweins. Das ist unser Nachname … und unser Motto.« Sie lachte schrill auf, was gar nicht zu ihrer dunklen Stimme passte. »Wir duzen uns hier alle. Mein Mann und ich wohnen gleich da drüben. Als ich Ihr Auto gesehen habe, habe ich gleich zu Alfred gesagt, komm, pack die Sachen zusammen und lass uns rübergehen. Warum lange warten?«
Hanni Frohwein, eine Frau von knapp siebzig Jahren, hatte den rosa Teint einer von Pauls englischen Rosenblüten und war ebenso füllig wie diese. Ihr imposanter Körper, zusammen mit ihrer überwältigenden Kontaktfreudigkeit, wirkte einschüchternd auf Paul. Alfred Frohwein stand in mehrerlei Hinsicht im Schatten seiner Frau. Nicht nur, dass er eher schmächtig gebaut war, er besaß auch nicht ihre Redseligkeit.
Ehe er sichs versah, drückte Hanni Frohwein Paul einen Korb mit Brot und Salz in die Hand. Julia erhielt eine Flasche ohne Etikett.
»Birnensaft, frisch gepresst. Wir haben einen Baum, der früh trägt. Und Schwangere sollen ja …« Sie breitete vor Überraschung die Arme aus. »Ach Gottchen, man sieht ja noch gar nichts. Ein Bäuchlein, mehr nicht, wie süß. Ich hatte seinerzeit schon eine Riesenkugel. Sie sind im fünften Monat, nicht wahr? Ja, wir wissen alles über Sie. Vom Erbauer natürlich, von Herrn Kessel.« Wieder lachte sie fröhlich. »Eine große Familie sind wir hier. Oder besser gesagt, wir werden es. Das geht ruck, zuck. Tom kennen Sie ja schon, nicht?« Hanni blickte sich um. »Ja, wo ist er denn?«
»Tom?«, fragte Paul.
»Tom Kessel, der Sohn des Erbauers. Ein fescher junger Mann. Oh, là, là«, sagte Hanni in Richtung von Julia. »Er wollte eigentlich mit anpacken. Ein Rockertyp mit allem Drum und Dran, auf den ersten Blick beängstigend, aber man muss ihm nur in die Augen sehen und weiß, dass er einfach nur ›irre cool‹ ist, wie man heute so sagt.«
Schrill lachte sie auf, dann fiel ihr etwas ein. »Alfred, wo hast du denn den Eimer hin? Ach, da drüben. Hol ihn doch bitte mal her.« Sie wandte sich wieder an Paul und Julia. »Wissen Sie, das war nämlich so … Tom kam vorhin zu uns rüber. Er hat zufällig mitgekriegt, dass Ihre Rosen angekommen sind … wirklich hübsche Stöcke sind das, ganz entzückend, die werden sich hier prächtig machen. Na ja, jedenfalls wollten die Angestellten der Gärtnerei auf Sie warten. Irgendwas wegen der Position der Rosenstöcke, die hatten den Zettel mit dem Plan verloren. Als Sie nicht kamen, sind die Kerle mittagessen gegangen. Tom meinte, dass die Rosen nicht so lange in der Sonne rumstehen sollten, daran sehen Sie, dass er das Herz am rechten Fleck hat. Er wollte den Blumen Wasser geben, aber aus dem Hahn an der Terrasse kam nichts raus, es ist wohl noch abgedreht. Da hat er uns gefragt, ob wir ihm einen Eimer rüberbringen könnten. Natürlich, hab ich gesagt, machen wir. Na ja, und dann sind Sie auch schon angekommen. Komisch, dass Tom nicht hier ist. Ob er schon wieder Streit mit Josip hat? Das ist der Wachmann, müssen Sie wissen.« Sie lachte auf. »Aber was rede ich, den kennen Sie bestimmt schon, unseren Josip. Wirklich ein netter Mann. Aber er und Tom sind sich mal in die Haare gekommen und … Ach, Alfred, gib doch dem netten Herrn Derfflinger den Eimer, damit er seine Rosen wässern kann. Falls Sie noch mehr Wasser brauchen … Wahrscheinlich müssen Sie nur den Haupthahn aufdrehen. Bei uns ist er in der Küche unter der Spüle.«
Ihr Redefluss endete so abrupt, dass einige Sekunden lang Stille herrschte, während sie schweigend im Kreis standen und sich gegenseitig anblickten, als wäre der Bus gerade ohne sie abgefahren. Hanni Frohweins Atem pfiff leicht, bedingt durch Korpulenz und Mitteilsamkeit.
»Also dann«, ergriff Alfred Frohwein das Wort. »Wir sollten unsere neuen Nachbarn jetzt erst einmal ankommen lassen, Hanni.«
»Du hast absolut Recht«, rief sie, als hätte ihr Mann soeben eine brillante Idee geäußert, auf die sie nie gekommen wäre.
»Unser täglicher Spaziergang steht an«, erklärte er. »Und dann kommt auch schon Hannis Lieblingskochsendung im Fernsehen.«
Sie lachte schrill. »Die verpasse ich um nichts in der Welt. Der Koch ist ja so fesch, haha. Wenn Sie etwas brauchen sollten, die Telefonnummern der Bewohner von Vineta liegen in allen Häusern aus. Einfach anrufen, ja?«
Als der Mann seine kleine Hand in die größere seiner Frau schob und die beiden äußerlich so unterschiedlichen Menschen einen kurzen vertrauten Blick wechselten, konnte Paul nicht umhin, dieses Paar zu bewundern und zu beneiden.
Würde es zwischen ihm und Julia jemals so werden? Eine solche Nähe ließ sich vermutlich nicht durch bloßen Willen herstellen. Das benötigte Zeit. Als könne er den Weg dorthin wenigstens ein bisschen abkürzen, ergriff er die Hand seiner Frau und zwinkerte ihr verliebt zu.
»Vielen Dank!«, rief er den Frohweins hinterher. »Wirklich sehr freundlich. Das Brot und alles. Nochmals danke.«
Als die Nachbarn gegangen waren, sagte Julia: »Und ich dachte, die Leute waren dir unangenehm.«
Sie spielte auf sein Unbehagen an, was körperliche Nähe anging. Er mochte es nicht, wenn wildfremde Menschen ihn umarmten. Wer mochte das überhaupt? Eigentlich wollte er von niemandem umarmt werden, außer von seiner Frau und natürlich von seinen Kindern, sollte es mal so weit sein. Auch diese Nachbarschaftsbräuche, Brot und Salz und so weiter, waren ihm eher peinlich. Nun fühlte er sich verpflichtet, die Nachbarn einzuladen, woraufhin sie ihn einladen würden und stillschweigend eine weitere Gegeneinladung erwarteten. Erfolgte sie, wären sie in einem ewigen Teufelskreis aus Einladungen gefangen, erfolgte sie nicht, würden sie als abweisend gelten.
Seltsamerweise konnte er sich die Frohweins sehr gut als seine oder sich und Julia als ihre Gäste vorstellen. Vielleicht lag es an der guten Laune, die Hanni verbreitete, oder an der geradezu sprichwörtlichen Eintracht des ältlichen Paares. Möglicherweise waren Umarmungen, selbst von Fremden, genau das, was er derzeit brauchte. Vermutlich mochte er sie auch Julias wegen. Sie hatte in den letzten Jahren einige Freundinnen verloren, weil sie sich nur noch um ihn gekümmert hatte. Somit war sie oft allein. Hanni Frohwein, wenngleich deutlich älter, war für den Anfang sicher besser als gar niemand.
»Mir ist keiner unangenehm, der mir einen Wassereimer bringt«, erwiderte er und verteilte das Nass auf den Rosenstöcken.
»Ich glaube, da ist eine Entschuldigung fällig«, sagte Julia.
»Hm?«
»Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Der junge Mann, Tom, er hat deine Rosen gerettet.«
»Warum hat er denn nicht gleich gesagt, wer er ist?«
»Vielleicht weil du ihn nicht hast zu Wort kommen lassen. Oder weil du ihn als Dummkopf bezeichnet hast. Vielleicht ist er aber auch einfach nur zurückhaltend und bescheiden.«
»Bescheiden? Der? Deswegen trägt er wohl auch ein Shirt, das mehr freilässt als bedeckt, was?« Paul gab sich unter dem tadelnden Blick seiner Frau einen Ruck. »Andererseits … ja, er hat es nur gut mit meinen Rosen gemeint, und ich habe mich geirrt. Bei Gelegenheit werde ich mich entschuldigen.«
»Was für ein Glück, dass die Gelegenheit nur ein paar Meter entfernt ist«, sagte Julia schmunzelnd. »Du hast Frau Frohwein gehört. Die Nummer der Familie Kessel liegt im Haus.«
»Erst stauche ich die Leute der Gartenbaufirma zusammen und kümmere mich um die Rosen, dann entschuldige ich mich beim Sohn unseres erleuchteten Erbauers.«
»Versprochen?«
»Versprochen.«
Zufrieden schritt Julia mit ihren schlanken Beinen über den Rasen, und als Paul ihr nachblickte, zündete ein Feuerwerk des Glücks in seinem Herzen. Er hätte diesen Moment am liebsten eingefangen, ihn mit einem Foto festgehalten oder in eine Skulptur gegossen, etwas, das man später hervorholen und anfassen konnte.
Und dann wurde es wahr. Julia drehte sich noch einmal zu ihm um und lachte leise. Mein Gott, wie schön sie war, wie jung, wie froh. Er wusste, dieses Bild war für immer in sein Gedächtnis eingebrannt.
»Kannst du dir vorstellen«, rief sie belustigt, »dass in einem Berliner Mietshaus die Telefonnummern der Nachbarn in allen Wohnungen ausliegen?«
Gemeinsam lachten sie, Sekunden der Unsterblichkeit.
15:42 Uhr. Er ist online. Siebenundsechzig Kameras, in ganz Vineta verteilt, schicken ihre Bilder auf seine Computer. Er kann jetzt sehen, was in der Anlage und darum herum passiert, außer in den Häusern. Doch er bekommt auch so genug mit. Erstaunlich, was Menschen so alles tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, obwohl sie eigentlich davon ausgehen müssen, dass sie beobachtet werden. Sie popeln ungeniert in der Nase, wechseln die Klamotten oder geben sich Zungenküsse, so als wären sie alleine auf weiter Flur – dabei sitzen sie in ihrem Auto vor einer roten Ampel in der Innenstadt.