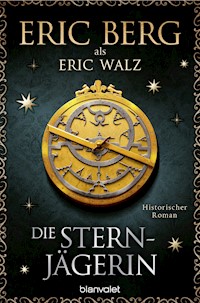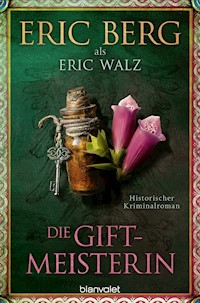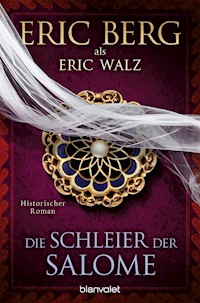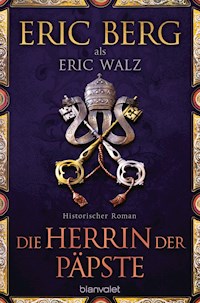6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Machtspiele und Liebe, Verrat und Rache
Eine Grafschaft am Oberrhein, anno domini 907. Der alte Graf wird in der Burgpfalz hinterrücks ermordet. Von dem Täter keine Spur. Kurz darauf heiratet seine Witwe, Gräfin Claire, seinen schärfsten Kontrahenten, Aistulf, einen Idealisten, der für mehr Gerechtigkeit eintritt. Hat Claire ihren Gatten ermorden lassen, ihn womöglich selbst getötet? Claires Tochter Elicia will den Tod ihres Vaters nicht ungesühnt lassen und stellt Ermittlungen an. Hatte ihre Mutter schon seit Längerem eine Liebesaffäre mit Aistulf? Von Tag zu Tag werden ihr die Mutter und der neue Stiefvater immer verdächtiger …
Von Liebenden und Lieblosen, von Blendern und Verblendeten und der zerstörerischen Macht von Rache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Eine Grafschaft am Oberrhein, anno domini 907. Der alte Graf wird in der Burgpfalz hinterrücks ermordet. Von dem Täter keine Spur. Kurz darauf heiratet seine Witwe, Gräfin Claire, seinen schärfsten Kontrahenten, Aistulf, einen Idealisten, der für mehr Gerechtigkeit eintritt. Hat Claire ihren Gatten ermorden lassen, ihn womöglich selbst getötet? Claires Tochter Elicia will den Tod ihres Vaters nicht ungesühnt lassen und stellt Ermittlungen an. Hatte ihre Mutter schon seit Längerem eine Liebesaffäre mit Aistulf? Von Tag zu Tag werden ihr die Mutter und der neue Stiefvater immer verdächtiger…
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz
Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die Sternjägerin
Glasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze Papst
Die Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Eric Bergals Eric Walz
Die Sündenburg
Historischer Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2011 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung und – motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com. (Marcin, magicpics1806, Олег Светлов, luuuusa) LH ˑ Herstellung: DiMo E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-30254-2V001
www.blanvalet.de
Für Jürgen Erhardt, den wiedergefundenen Freund
Prolog
Im Jahr 1987 stieß man bei Waldarbeiten am Oberrhein auf die verschütteten, kniehohen Grundmauern einer Burganlage. Sie wurden nur notdürftig freigelegt und nicht genauer untersucht. Zehn Jahre später traf sich dort eine Gruppe Jugendlicher zum Rauchen, stieß eine der Mauern um und fand zwischen den Steinen, von denen einige verwitterte Inschriften trugen, eine silberne Kassette. Sie befand sich äußerlich in einem schlechten Zustand, ihr Inhalt war jedoch nahezu unversehrt: mehrere Rollen Pergament, einige Dokumente, Gerichtsprotokolle, etliche Seiten beschriebenen Lumpenpapiers sowie ein Ring und ein Dolch. Die Waffe, die Kassette und den Ring verkauften sie und teilten den Gewinn. Die Spuren dieser Gegenstände konnten leider nicht wieder aufgenommen werden.
Da Pergamente und Papiere in einer kaum lesbaren Sprache beschrieben waren, schenkten die Jugendlichen ihnen keine weitere Beachtung. Glücklicherweise hob sie einer von ihnen auf. Nicht ahnend, welchen Schatz er besaß, lagerte er sie jahrelang auf dem Dachboden seines Elternhauses, bis er sie einem Antiquar anbot, der ihn an einen Sammler und Kenner verwies. Dieser kaufte ihm die Schriften für dreitausend Euro ab.
Auf über zweihundert Seiten – und in verschiedenen Handschriften – werden dort ungeheuerliche Ereignisse geschildert, die sich zwischen September 912 und Mai 913 in der Burg zutrugen und mit dem Mord an einem Grafen beginnen. Im Mittelpunkt stehen fünf Menschen: ein Richter und eine Gräfin in mittleren Jahren, eine schon etwas ältere, stumme Dienerin sowie die junge Tochter des ermordeten Grafen. Auf manchem Schriftstück befanden sich verblichene Blutflecken. Die halb verwitterten Inschriften im Mauerwerk der Burg wurden inspiziert und als altungarisch identifiziert. Sie stammen von einer an den Oberrhein verschleppten jungen Frau.
Auf der Grundlage all der auf Pergament, Lumpenpapier und Mauerwerk verfassten Schilderungen beruht die folgende Geschichte.
Erster Teil
September bis Dezember des Jahres 912
Bilhildis
Der Schrei war von erschreckender Schönheit wie aus einem Albtraum. Ich hätte nie gedacht, dass es eine Frau gibt, die so entsetzlich schön schreien kann. Ich wünschte, ich könnte es. Aber alles, was aus meinem zungenlosen Mund kommt, sind zermahlene Brocken von Wörtern, noch nicht einmal die Vokale treffe ich richtig. Sie verlaufen in meinem Mund ineinander und werden zu etwas Breiigem, das die Leute ekelt, und deswegen versuche ich erst gar nicht, zu sprechen, es sei denn, ich will jemanden ärgern. Elicias Schrei war ein klares, helles A. Ich erwachte erst davon, als Elicia nahe an meiner Kammer vorbeilief, und ich benötigte einen Moment, um ihren Schrei von dem Lärm der im Burghof feiernden Krieger unterscheiden zu können. Wie ein Wind fegten die junge Frau und ihr Schrei an mir vorüber. Ich öffnete die Tür und sah, wie Elicia in die Kammer ihrer drei Zofen stürmte, doch nur, um sogleich ihren verzweifelten Irrlauf durch die Burg fortzusetzen. Ihre Zofen folgten ihr wie ein Schweif. Das klare A wurde zu einem weichen, klagenden E, das stets von Neuem wiederholt wurde: ein E, Atemluft holen, wieder ein E, Atemluft holen … Zu diesem Zeitpunkt rannte Elicia bereits durch den großen Hof, bekleidet mit einem von der Hüfte abwärts nassen, leicht rötlichen Nachtgewand. Ratlos standen die Leute herum – Wachen, Gesinde –, und keiner durfte es wagen, Elicia, die Tochter des Grafen, aufzuhalten. Die Einzigen, denen das außer mir gestattet gewesen wäre, waren ihr Vater, ihre Mutter und ihr Gemahl, aber von denen war keiner zu sehen. Manche von den Wachen und vom Gesinde sprachen Elicia an und wollten ihr helfen, doch sie bahnte sich ihren Weg, ihr jammerndes E vor sich herschickend und hinter sich herziehend.
Schließlich holte ich sie ein, oder besser gesagt, sie lief mir geradewegs in die Arme, und ich schnappte sie mir, so wie ich manchmal die Mäuse schnappe, die nachts um mein Schlaflager huschen.
Sie versuchte, mich von sich zu stoßen, aber wenn ich auch alt und dünn bin, so bin ich doch nicht schwach. Sie schrie und jammerte, sie fuchtelte mit den Händen herum, und wir lieferten uns, umringt von der staunenden Festgesellschaft, ein albernes Handgemenge, bis ich die Geduld verlor und ihr eine Maulschelle gab, die sich gewaschen hatte. Dann gleich noch eine, aber nur, weil die eine Wange weniger wehtut, wenn auch die andere was abkriegt. Nun gut, das ist ein Ammenmärchen, im wahrsten Sinn des Wortes, also gestehe ich, dass es mir auch ein bisschen Spaß machte. Ich war ihre Amme – was heißt »war«. Amme bleibt man allezeit, auch wenn das Kind bereits zweiundzwanzig Jahre zählt. Nur darf man ihm da normalerweise keine Maulschelle mehr geben, auch wenn es eigentlich eine verdient, weil es sich wie ein bockiges Kind verhält. Diese Maulschelle war schon lange fällig gewesen, und ich nutzte die Gelegenheit.
Elicia hörte sofort auf zu schreien. Na bitte, ich sag’s doch, es gibt drei Gruppen von Menschen, bei denen man mit Vernunft nicht weit kommt: Blödsinnige (die gar nicht wissen, was Vernunft ist), Kinder (die noch nicht in sie hineingewachsen sind) und Krieger (die sie freiwillig abgegeben haben). Meiner Meinung nach ist Elicia zwei dieser drei Gruppen zugehörig. Und wenn man stumm ist wie ich, hat man’s noch schwerer zu überzeugen.
Elicia rang nach Worten und deutete in Richtung des Wohnturms. »Vater … tot … im Bad … Blut … überall Blut«, sagte sie im Tonfall eines kleinen Kindes, und dann fiel sie mir in die Arme. Drei Wachen rannten sofort los, um im Bad nachzusehen. Mein Gatte Raimund half mir, Elicia in ihr Gemach zu bringen, wo ich sie rasch auszog und zur Ruhe bettete. Sie fing an, zu wimmern und sich zu krümmen. Ich streichelte ihr Haar, ließ sie dann aber allein.
Elicia
Das Schrecklichste, Grauenhafteste, Undenkbarste ist passiert. Wie soll ich dieses Bild je wieder vergessen, wie kann ich es loswerden? Das Zittern meiner Hände, so glaube ich, wird nie mehr aufhören, bis an mein Ende. Vor etwas mehr als zehn Stunden erst, am Nachmittag des vergangenen Tages, haben diese Hände meinen Vater gefeiert, der nach Monaten des Feldzugs gegen die Ungarn triumphal in die Burg zurückkehrte, und ich habe ihn freudig umarmt. Etwas später hat er meine Hände in seine genommen, und wir haben getanzt. Und nun …
Einen klaren Gedanken zu fassen fällt mir schwer. Ich habe immer wieder dasselbe vor Augen, wohin ich meinen Blick auch wende – sei es auf mein Nachtlager, sei es auf die Öllampe auf dem Spiegeltisch, sei es zu den Sternen –, immer wieder und wieder gehe ich das Erlebte durch wie einen Vorgang aus einem Trauerstück: Ich erwache von entsetzlichen Schreien, die sich in meinen Traum geschlichen zu haben scheinen, sich dann aber als wirklich herausstellen. Ich springe von meinem Nachtlager auf, entzünde eine Fackel und renne durch die Gänge in Richtung der Schreie. Aus dem Hof dringt das laute Gelächter der Festgesellschaft heran, die ihr Vergnügen nicht unterbricht. Die Tür von meines Vaters Gemach steht offen, und das Licht meiner Fackel strömt in den finsteren Raum. Ich rufe: Vater? Vater, wer hat hier geschrien? Ich bin es, darf ich eintreten? Ich bekomme keine Antwort. Auch die Schreie haben aufgehört. Da sehe ich, wie eine junge, schwarzhaarige Frau in einer Ecke kauert, und von nebenan, aus dem Bad, höre ich Plätschern und Gurgeln. Ich sage: Vater, bist du da drin? Dann trete ich ein.
Der Raum ist feucht und warm. Meine Fackel knistert. Das Licht der zuckenden Flamme fällt auf das Becken, das in den Boden eingelassen ist. Das Wasser darin wirkt schwarz. Ich sehe einen Kopf aus diesem Wasser ragen.
Nach einem kurzen Moment frage ich: Soll ich wieder gehen, Vater? Doch er antwortet nicht. Ich trete einen Schritt näher, der Lichtkegel erfasst nun meinen Vater, und ich sehe, dass sein Kopf nach vorn gesunken ist.
Vater? Vater!
Ich eile in das Becken, das Wasser steht mir bis zum Bauchnabel, ich spüre seine Wärme, mein Kleid klebt mir an den Beinen. Mit der linken Hand halte ich noch immer die Fackel, mit der rechten Hand berühre ich seine Stirn. Sein Kopf kippt in den Nacken. Die Kehle ist durchschnitten. Seine Augen sehen mich mit starrem Blick an, als wollten sie mich anklagen. Sehen mich an. Schon die ganze Nacht.
Bilhildis
Als ich im Bad eintraf, lag Graf Agapets Leiche unter einer Pferdedecke auf dem Boden. Ich lupfte einen Zipfel der Decke hoch und sah ihm ins alte, wettergegerbte Gesicht. Seine anklagenden grauen Augen starrten mich an. Sie ließen sich nicht schließen. Was ging mir da nicht alles durch den Kopf. Ich hätte seinem Blick stundenlang standhalten können, aber die Wachen schauten schon zu mir herüber. Wie armselig! Der große Graf nackt auf dem Boden unter einer stinkenden Decke, blutentleert, blutverschmiert. Das hätte er sich wohl anders vorgestellt. Ja, so ein Mord kann einem das ganze Leben versauen. Und den Tod dazu.
Baldur, Elicias Gemahl, kam hinzu, ziemlich spät und angetrunken. »Wie ist das passiert?«, fragte er und sah mich an, als würde er ernsthaft eine Antwort von mir erwarten. Ich drückte einige Vokale aus meiner Kehle hervor, die dafür sorgten, dass Baldur sich von mir abwandte. Während er sich von einem der Wachleute, die ihm unterstanden, berichten ließ, ging mein Blick in den hintersten Winkel des Bades, wo, nur schwach beleuchtet, das ungarische Aas kauerte. Die Beine angewinkelt und die Brüste mit den Knien und Armen bedeckend, hockte sie nackt auf dem Boden, immer mal wieder angestarrt von den Wachleuten, auch von Baldur, eine bronzierte Skulptur von einer Schönheit, die man nur leidenschaftlich begehren oder leidenschaftlich hassen kann, nichts anderes.
»Jemand muss es der Gräfin sagen«, sagte Baldur plötzlich, als wäre das der lange erwartete Geistesblitz eines großen Mannes. »Bilhildis, du gehst.«
Nun stimmt es zwar, dass die Gräfin in den Jahrzehnten, die ich ihr diene, verstehen gelernt hat, was ich ihr zu sagen wünsche, aber meistens ist es ja doch nur sie, die mir etwas zu sagen hat, und wenn es sich einmal umgekehrt verhält, so sind es einfache Dinge: Ich hole sie zur Tafel, wenn es an der Zeit ist, und ich gebe ihr zu verstehen, dass ein bestimmtes Kleid, das sie zu tragen wünscht, gerade gewaschen wird. Ihre Geheimnisse, an denen ich teilhabe, sind so gut wie nie Gegenstand unserer »Gespräche«, und falls es notwendig wird, schreibe ich ihr eine kurze Bemerkung, die ich ihr überreiche.
Ich stelle mir vor, wie eine solche Bemerkung am vergangenen Abend hätte aussehen können. Vielleicht: »Verzeiht die späte Störung, Herrin, Eurem Gemahl wurde die Kehle aufgeschlitzt.« Oder: »Während Euer Gemahl ein Bad mit einer wunderschönen jungen Frau nahm, lebte er ab.« Oder: »Er hat einer Frau seinen Prügel zwischen die Schenkel gestoßen, und das hat ihr anscheinend nicht gefallen, also hat sie ihm ihren Dolch in den Hals gestoßen.«
Eben kam Raimund zu mir. Der alte Sack, der mein Mann ist, fragte, warum ich lachte – denn lachen, das kann ich –, und er wies mich darauf hin, dass es mitten in der Nacht sei und zudem Trauer herrsche. Ich gab ihm mit einer eindeutigen Geste zu verstehen, dass er sich zum Teufel scheren solle. Etwas Ähnliches, nur ungleich höflicher, gab ich auch Baldur zu verstehen, als er mich als Unglücksbotin zur Gräfin schicken wollte. Ich nahm ihn an der Hand und zog ihn hinter mir her bis vor die Tür zum Gemach der Gräfin.
Claire
Mein Schwiegersohn Baldur teilte mir im Beisein von Bilhildis und unserem Burggeistlichen zu später Stunde mit, dass mein Gemahl einem tückischen Angriff zum Opfer gefallen war.
»Kannst du das bitte wiederholen, Baldur?«
»Er wurde ermordet – im Bad – wir – wir nehmen an – er hatte – es sieht so aus, als hätte eine Barbarin – er hat sie in den Feldzügen erbeutet – und vielleicht hat sie ihm den – den Rücken gebürstet – und ihn dann von hinten heimtückisch …«
Ich fiel sofort auf die Knie, faltete die Hände, führte sie an die Lippen, küsste die Fingerspitzen und schloss die Augen. Jeder der Anwesenden erwartete von mir, dass ich das tat, und ich gab es ihnen. Wie alle Menschen zu jeder Zeit, so hatte auch ich über Jahre und Jahre ein Bild von mir gestochen, ein ganz bestimmtes Bild, das den Leuten, wenn sie den Namen »Gräfin Claire« hörten, sofort in den Sinn kam. Es ist dies die wahre Signatur des Menschen, bedeutender und fortwährender als alles, was man sagt. Dabei kann es sich um ein gewisses Lächeln handeln, um ein Stirnrunzeln, eine pochende Ader an der Schläfe, eine aufreizende Gangart, eine zupackende Hand, aber immer nur um etwas, das einem entspricht, also in einem größeren Zusammenhang mit der Gesinnung steht. Ich bin für meine Frömmigkeit bekannt, und zehntausendmal und öfter hat man mich gesehen, wie ich niederkniete, auf eine bestimmte Art meine Hände faltete und die Fingerspitzen küsste. Das ist meine Signatur, das gestochene Bild von Gottesfurcht. Wie alle guten Bilder ist es für andere ebenso gemacht wie für mich selbst. Ich, die ich es erschaffen habe, glaube an seine Wahrheit, an meine Frömmigkeit, und doch ist es nur ein kleines Stück aus einem großen Ganzen, das von dem Bild nicht eingefangen wird.
Die anderen taten es mir gezwungenermaßen nach und knieten nieder. Der Riese Baldur konnte sich vor Trunkenheit kaum aufrecht halten, er musste sich mehrmals mit der rechten Hand abstützen. Außerdem roch er stark, und zwar nicht nur nach Bier, sondern auch nach Latrine. Pater Nikolaus, mein kleiner, rundlicher, glatzköpfiger Beichtvater, hatte Schluckauf, da auch er auf dem Fest Schluckviel betrieben hatte. Und Bilhildis … Sie hat mit Gott nicht viel zu tun, aber ich nahm ihr ab, dass sie nicht nur mir zuliebe betete.
Als ich mich erhob, sagte Baldur: »Ich werde das ungarische Weib befragen. So bald wie möglich.«
»Ja, mach das.«
»Es tut mir so – ich kann gar nicht sagen …«
»Danke, Baldur.«
»Er war ein großer Mann. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.«
»Ja.«
»Es ist tragisch, dass auch er ermordet wurde, nachdem – Ihr wisst schon …«
»Gewiss.«
»Ich werde Euch beschützen. So etwas wird nie wieder passieren. Ihr und Elicia werdet ein Leben in Sicherheit führen.«
»Sehr beruhigend. Vielen Dank. Wie geht es Elicia? Das arme Kind ist gewiss völlig durcheinander.«
»Ja, sie – sie …«
»Ich möchte zu ihr.«
»Sie will im Moment niemanden sehen, noch nicht einmal mich. Jedenfalls hat Bilhildis das angedeutet.«
Bilhildis nickte, und da ich das Wesen meiner Tochter gut kannte, wusste ich, dass es sinnlos wäre, mich ihr in diesen Stunden aufzudrängen.
»Falls du sie wach antriffst, Baldur, so richte ihr bitte aus, dass ich in Gedanken bei ihr bin.«
Als Baldur gegangen war, setzte ich mich auf eine Truhe. Noch war ich nicht allein. Bilhildis betrachtete mich. Stumme betrachten einen auf andere Weise als Menschen, die eine Zunge haben. Intensiver und durchdringender. Sie wissen, dass man sie nicht einfach fragen kann, was sie denken. Und sie müssen nicht lügen. Das ist ihre größte Gnade, das macht so manchen Nachteil, den sie erleiden, wieder wett. Nicht lügen zu müssen macht sie uns überlegen. Bilhildis weiß das. Sie weiß um so manche meiner Lügen und Geheimnisse.
Nachdem sie gegangen war, ließ ich eine Weile verstreichen, in der ich in meinem Gemach auf und ab schritt. Dann griff ich mir eine Öllampe, schlich durch die zweite Tür hinaus, den niedrigen Gang entlang ins Nebengebäude und dort in Aistulfs Gemach. Er lag mit dem Rücken zur Tür auf seinem Lager nahe dem Fenster. Da es eine laue Nacht war, war das Fenster nicht mit Tierhäuten bespannt, sodass ein wenig Mondlicht in das Gemach fiel. Ich schmiegte mich von hinten an Aistulf an, wobei ich seine Körperhaltung einnahm. Er wachte auf.
»Claire?«, fragte er mit verschlafener Stimme. »Was tust du hier?«
»Dasselbe, was ich seit Monaten hier tue.«
»Wir waren uns einig, dass wir noch vorsichtiger sein müssen, jetzt, wo Agapet zurückgekommen ist.«
»Du hast ja ganz kalte Füße, was ist denn los?«
»Ich war auf dem Abort. Es hat ein bisschen länger gedauert.«
Ich verzog das Gesicht. »Hu, nicht gerade ein anregendes Thema.«
»Du hast gefragt.«
»Und wo warst du während des Festes? Ich habe dich vermisst. Ich sehe dir gerne dabei zu, wenn du dich vergnügst.«
Er wandte mir wieder den Hinterkopf zu. »Ich war nur kurz dort, ich hätte mich nicht vergnügt. Du dort, ich da, kaum ein Wort möglich und jeder Blick zu viel.« Er gähnte. »Entschuldige, ich bin sehr müde.«
»Ist gut, schlaf weiter«, sagte ich und lehnte mich auf das Lager zurück.
Ich liebe diese Nächte, es sind Liebesnächte, selbst dann, wenn wir nur nebeneinanderliegen, den Atem des anderen hören, gelegentlich die Haut des anderen unter den Fingerkuppen spüren. Nächte, die ich erst seit einem knappen halben Jahr kenne, seit Agapet auf Feldzug gen Osten ging und ich den Mut fand, mich mit Aistulf des Nachts zu vereinen.
Ich vergrub meine Nase in Aistulfs langen Locken, seinem vollen, knisternden Haar, das er auf meinen Wunsch hin ein Mal wöchentlich mit Lauge wäscht. In der Burg und in der gesamten Domäne bringt ihm das so manches kopfschüttelnde Belächeln ein, aber Aistulf ist viel zu beliebt, als dass das seinem Ansehen ernstlich schaden würde.
Nach einer Weile flüsterte ich in sein Ohr: »Agapet ist tot.«
Zeit verstrich.
Ich sagte: »Das ändert alles.«
Ich bin mir nicht sicher, ob er mich hörte oder ob er schlief. Ich glaube nicht, dass er schlief.
Zeit verstrich.
In der Dunkelheit forschte ich nach unserer Zukunft.
Kara
Ich wollte bloß baden. Mit entsprechenden Gesten – denn Ungarisch hätten sie nicht verstanden – bat ich um ein bisschen Wasser, damit ich meinen Körper waschen könnte. Ich hatte immerhin eine ganze Weile in einem Becken mit Blut gelegen. Alles, was ich wollte, war, dieses Blut von meinem Körper zu entfernen, aber man stieß mich in eine Ecke. Die Tropfen rannen an mir herunter, ich stand in völliger Nacktheit im Raum, beäugt von Wachen, deren Begehren mit Verachtung sich mischte und um die Herrschaft kämpfte. Ich widerte sie an – und zog sie an, das wussten sie, dafür verachteten und begehrten sie mich noch mehr. Als man endlich Decken brachte, gab man sie dem Toten und hatte keine einzige Decke, keinen noch so kleinen Fetzen Tuch für mich übrig. Ich wollte mich einem von ihnen sogar an die Brust werfen, um mich an seinem Mantel reibend zu reinigen, doch er umklammerte meine Handgelenke und stieß mich fort. Ich versuchte, das rötliche Wasser mit meinen eigenen Händen von meinem Körper abzustreifen, zuerst mithilfe von Staub, dann mit meinem Speichel, aber sosehr ich auch wischte, es gelang mir nicht gut, und so verkrustete ich im Blut des Feindes.
Ich sollte nicht weinen. Die Götter mögen Tränen nicht. Mein Volk ist stolz und tapfer, nicht nur die Männer, auch die Frauen und sogar die Kinder. Manchmal denke ich, es ist ein bisschen zu früh für Kinder, die Tränen zu unterdrücken, man sollte sie in jungen Jahren herauslassen. Aber wenn dann einer meiner drei Lieblinge weint, fürchte ich, dass in dem Trost, den ich ihnen spende, auch ein wenig Tadel mitschwingt.
Ich sehne mich nach ihnen. Alles will ich an ihnen besser machen als in der Vergangenheit, und noch mehr will ich sie lieben. Wo sind sie jetzt, meine Söhne Zoltán und Levdi, meine Tochter Emese? Was tun sie gerade? Denken sie an mich? Und Lehel, der Vater meiner Kinder und Gefährte Tausender Nächte – denkt auch er noch an mich? Zweifel sind wie Menschen: Sie wachsen mit der Zeit und kriegen ihren eigenen Kopf. Drei Monate sind vergangen, durch eine ganze Welt hat man mich geschleppt. Werde ich je wieder bei den Meinen sein?
Die Zukunft ist ein schwarzes, Angst machendes Loch, das ich mit Schreiben fülle. Ich schreibe auf eine Mauer, die mein Kerker ist.
Bilhildis
Das Erste, was ich morgens tue, ist, nach dem Gewächs zu fühlen. Es ist in meinem Bauch, auf der rechten Seite gleich unterhalb der Rippen. Drei Kinder sind in mir gewachsen, gute Söhne, das ist lange her. Was nun heranwächst, ist ein Monster. Es verursacht Übelkeit, und manchmal gluckert es in meinem Innern, als würde etwas gären. Jeden Morgen reibe ich die Stelle mit Ölen ein, seit zwanzig Monden. Mir ist, als täte ich dem Ding sogar noch Gutes, und so bin ich vor einiger Zeit dazu übergegangen, mir abends zum Schlafengehen eine Zwiebel auf den Bauch zu legen, die mir feuchte Augen macht. Was für eine Narretei. Ich sollte es besser wissen: Das Schlechte lässt sich durch Tränen nicht besänftigen.
Noch nicht einmal am heutigen Morgen, wo es viel zu tun gab, habe ich das Gewächs vergessen. So wie sich Augen an die Nacht gewöhnen, gewöhne ich mich an das räudige Ding, das meine Finger täglich streicheln. Ich spreche mit ihm. Wieso auch nicht mit dem Tod reden? Der Verlust meiner Sprache vor vielen Jahren hat mir einen Gewinn an Gespür gebracht, und ich spüre, dass dieses Ding es ernst meint.
Das Aufstehen fiel mir – die ich mir zugutehalte, sommers wie winters vor der Sonne aufzustehen – schwerer als sonst. Aber wohl nicht nur mir. Über der Burg lag die gewöhnliche Ruhe eines Morgens nach einem Gelage, vermischt mit der außergewöhnlichen Ruhe eines Morgens nach einem Mord. Auch Raimund, ein paar Schritte entfernt auf seinem eigenen Lager, schlief noch. Ich wusch mir Hände und Gesicht und hörte mich dabei zwei- oder dreimal ächzen. Es kam mir vor, als hätte ich verschlafen, aber als ich die Ziegenhaut vom Fenster nahm, sah ich, dass die Welt noch grau war, so wie ich es kannte.
Ich ging in die Burgküche, in der zu dieser Stunde normalerweise bereits eine Köchin zugange war, die Getreidebrei für das Gesinde anrührte. Sie war jedoch nicht da, also aß ich eine kleine Schale Birnenkompott, die vom Fest übrig geblieben war, und packte einige weitere Speisen für die Gräfin und für Elicia in einen Korb, denn ich diene ihnen beiden.
Zunächst suchte ich Elicia auf. Sie lag neben ihrem schnarchenden Gemahl und warf ihr Haupt unruhig hin und her. Ich dachte, sie würde fiebern, aber sie hatte wohl nur einen schlechten Traum – keine Überraschung nach der vergangenen Nacht.
Ich nutzte die seltene Gelegenheit, mir Baldur in seiner Gänze anzusehen. Ich hielt mich schadlos an den Muskeln, Ambosshänden, Goliath-Beinen, der Samson-Brust, dem Bullengeschlecht, an all den Säften und Kräften, die für die Liebe und den Krieg gemacht sind und deren Anblick mir, einer alten Dörrpflaume, immer noch guttut. Auf dem Schlaflager liegend scheint Baldur der ideale Gatte, und auf dem Pferd sitzend der ideale Krieger. Doch wehe, er spricht mit etwas anderem als dem Schwert, wehe, er benutzt Zunge und Kopf. Er rühmt sich, einen festen Apfel zwischen seinen Knien zerdrücken zu können und mit seiner Faust aus einem Rettich Saft zu pressen. Wofür das gut sein soll – außer wenn man Rettichsaft mag –, sagt er nicht. Er trinkt jeden Abend, egal, wo er sich befindet, und er braucht auch nicht eigens ein großes Gelage dazu. Bier und Wein versickern in ihm, als wäre er aus Rheinsand gemacht. Zumindest was die Füllung seines Kopfes angeht, trifft das unbedingt zu.
Wird er der neue Graf? Wer sonst dürfte Anspruch darauf erheben? Die Gräfin hat keinen männlichen Erben mehr, Agapet hatte keine Brüder und Neffen. Und wenn Baldur der neue Graf ist, wie lange wird es wohl dauern, bis er sich in blutige Händel verstrickt und, wo auch immer, erbärmlich endet. Denn so trifft es viele aus dem Geschlecht der Agapiden. Agapets Urgroßvater, der ebenfalls Agapet hieß, lockte einen Feind unter Bruch des Rechts in einen Hinterhalt und metzelte ihn und dessen Söhne nieder. Manche sagen, dass da das Elend des Geschlechts begann. Der besagte Urgroßvater starb bald darauf in der Schlacht, zusammen mit seinem Sohn. Dieser hatte zwei Söhne, beide erst halb erwachsen, und schon bald tötete der eine den anderen – versehentlich im Spiel, wie er sagte. Seine Mutter glaubte ihm das nicht, sie wünschte ihm die Pest an den Hals und verhungerte freiwillig. Dieser junge Mann war Agapets Vater.
Eines Tages, als Vater und Sohn einen Ausritt unternahmen, geriet der Vater nicht weit von hier in ein Moor, das ihn verschluckte. So zumindest sagte Agapet, der Sohn und neue Graf, welcher nun seinen Tod im Bad gefunden hat, des Blutes seiner Ahnen beraubt, auf das er so viel Wert legte und das doch so wenig in der Gunst des Schicksals steht.
Es gibt Stimmen im Volk, die sagen, dass das Elend viel früher begann und sich nicht auf die Agapiden beschränkt, dass es die Burg ist, die vor Jahrhunderten ein Fluch getroffen hat.
Ha! Fluch! Mögen sie es Fluch nennen, das ist mir gleichgültig. Doch dann ist es ein Fluch, der nicht von oben oder unten kommt, der nicht das Siegel Gottes oder Satans braucht.
Anschließend ging ich zur Gräfin. Ich staunte nicht schlecht, als ich sie wach und angekleidet vorfand. Sie trug, wie es die Trauerzeit vorsah, ein weißes Kleid, das sie mit ihrer blassen Haut und dem blonden Haar fast wie ein Engel aussehen ließ. Meinen Augen entnahm sie die Frage: Herrin, wieso habt Ihr Euch allein angekleidet? Doch sie antwortete nicht darauf. Es ist traditionell das Vorrecht einer Edlen, die dir die Suppe bezahlt, nur dann Stellung zu beziehen, wenn es ihr beliebt, und es ist zusätzlich das Vorrecht einer Sprechenden, so zu tun, als hätte sie die Frage der Stummen nicht verstanden.
Ich flocht ihre Haare zu einem Kranz, wie sie es gern hat und wie es dem Anlass geziemte. Dann bereitete ich das Rosenwasser zu, mit dem sie ihren Mund spülte. Sie wirkte gefasst, überhaupt nicht müde oder angeschlagen, daher wusste ich, dass sie nicht im Mindesten trauerte. In meiner Gegenwart – und nur dann – hatte sie sich stets gegeben, wie sie sich fühlte, hatte jeder Träne, jedem Lächeln, jeder Klage, jeder Freude ihren Lauf gelassen, während ich von jeher Gesten und Mimik mit dem Bedacht einer Schaustellerin setzte.
»Bilhildis, warst du schon bei Elicia? Wie geht es ihr?«
Ich bedeutete ihr, dass sie unruhig schlafe.
Wir wechselten einen langen Blick.
»Ja, so hat sie schon als kleines Kind auf schlimme Ereignisse reagiert. Jedes Mal, wenn ihr Vater auf Reisen oder Feldzüge aufgebrochen ist, hat sie darum gebettelt, mit ihm gehen zu dürfen, und als es ihr verwehrt wurde, hat sie sich im Schlaf hin und her geworfen bis zum Mittag. Und dieses Mal ist es ein endgültiger Abschied, da wird alles noch weit schwieriger für sie. Wir müssen ihr helfen, wo immer wir können. Ich glaube, die Bestattung wird sie kaum überstehen. Sie wird zusammenbrechen.«
Die Gräfin geriet ins Grübeln.
»Vielleicht ist es eine glückliche Fügung, dass sie noch schläft. Wir nehmen die Bestattung sofort vor. Bitte bereite die Kapelle vor, Bilhildis, und gebe Pater Nikolaus Nachricht. Ich bitte Aistulf, die übrigen Vorbereitungen zu übernehmen.«
Aistulf! Das fand ich sogleich bemerkenswert. Er war der Verweser der Burg in Abwesenheit des Grafen und Baldurs, des Hauptmanns der Wache. Aber mit der Rückkehr Agapets und Baldurs vom Feldzug galt er eigentlich als dieses Amtes verlustig, und die Tatsache, dass Agapet nun tot war, änderte nichts daran. Baldur war der Hauptmann und zudem Agapets Schwiegersohn. Es wäre an ihm gewesen, die Bestattung in die Wege zu leiten, und die Gräfin wusste das sehr gut. Entsprechende Belehrungen durch mich, auf welche Weise auch immer nahegebracht, wären also überflüssig.
»Ach, noch etwas, Bilhildis. Bitte beeile dich. Es soll alles sehr schnell vonstattengehen.«
Das tat es. Ich ließ das Gesinde zusammentreiben, die kleine Kapelle reinigen und notdürftig schmücken, den Geistlichen herbeiholen und den Weg bis zum Friedhof kehren. Aistulf ließ die Wache antreten – die ihm im Grunde nicht unterstand –, das Grab ausheben und den Leichnam umkleiden. Niemand stellte seine Anordnungen infrage, denn er ist äußerst beliebt, und es gibt nur zwei Gesichtspunkte, die stärker sind als die Autorität des Rechts, und das sind die starke Angst vor und die starke Hinwendung zu einem Menschen. Als Baldur aus seinem tiefen Schlaf, der halb dem Bier und halb der durchwachten Nacht geschuldet war, erwachte, war die Zeremonie bereits im Gange. Der Leichnam wurde von der Kapelle in den Hof getragen, von dort in den Vorhof, durch das Tor einen schmalen Weg entlang bis zum Friedhof am Fuße der Ostmauer. Soweit ich es mitbekam, hat sich Baldur weder während noch nach der Grablege bei seiner Schwiegermutter beschwert, dass er und Elicia nicht geholt worden sind. Die Gräfin, nunmehr ganz Witwe, flüsterte ihm einige brüchige Worte zu, die ich nicht verstand, und damit gab er sich wohl zufrieden. Er ist eben ein Tor.
Es wäre falsch, die Zeremonie schmuck- oder würdelos zu nennen, es wurde allen Bräuchen Genüge getan. Und doch fehlte etwas. Ich musste eine Weile überlegen, bis ich den richtigen Begriff dafür fand: die große Klage. Gewiss, es gab einige Traurigkeit, doch nur unter denen im Gesinde, für die Traurigkeit eine Lebenseinstellung ist. Auf Baldur trifft weder das eine noch das andere zu; die Gräfin hat keinen Grund, ihrem bisherigen Leben nachzuweinen; für die Mehrzahl des Gesindes ist ein Herr wie der andere. Entsetzen trat an die Stelle des Grams. Eine aufgeschlitzte Kehle und ein Blutbad waren die rechten Zutaten für Todesangst und abergläubischen Schrecken.
Man stellte schließlich einen Schemel auf das Grab, auf dem die Gräfin Platz nahm, und dann ließ man sie entsprechend dem Brauch allein die Trauerwache halten.
Wenn ich aus meinem Fenster blicke, sehe ich sie dort sitzen, aufrecht, unbeweglich, den Blick aufs Tal gerichtet, ein weißer Punkt im schweren Grün des Septembers, und ich beneide sie. Ja, noch immer, verborgen in all dem Hass, beneide ich sie.
Elicia
Als ich am heutigen Morgen – ich sollte eher Mittag sagen – aufwachte, fühlte ich mich leer, wie ausgewrungen, es war nichts mehr in mir drin, gar nichts. Ich konnte nicht weinen, und es war mir eine Qual, aufzustehen. Nach zwei Weintrauben war ich satt. Ich dachte an gar nichts, notwendige Bewegungen machte mein Körper ohne mich, jedenfalls ohne dass ich eine Absicht mit den Bewegungen verknüpfte. Eine Weile lang saß ich einfach nur da.
Der erste Gedanke, an den ich mich erinnere, beschäftigte sich mit einer Haarnadel und war noch völlig wirr. Kurzzeitig erweckte sie in mir den Wunsch, mich damit zu verletzen, und das war unheimlich, weil ich diese Gefühle zuletzt als Kind spürte. Dann, als ich sie in der Hand hielt, wollte ich jemand anderen damit verletzen, ich weiß auch nicht, wen, irgendjemanden, den Täter, vermute ich. Aber nach wenigen Augenblicken, in denen die Haarnadel eine Waffe gegen mich und andere gewesen war, erinnerte sie mich nur noch an Bilhildis. Sie steckt mir mit Nadeln wie dieser jeden Tag die Haare, aber ich glaube nicht, dass ich deswegen an sie dachte.
Bilhildis ist für mich der Inbegriff der Trostlosigkeit. Ich mag sie, sie war meine Amme, und ich erinnere mich nicht, dass sie je gemein zu mir gewesen ist. Aber sie war immer schon … Das Wort, das mir hierzu einfällt, klingt reichlich merkwürdig: unbewohnt. Ja, sie macht auf mich denselben Eindruck wie ein verlassenes Haus. Ihre Wesensart hängt sicherlich mit den furchtbaren Ereignissen in ihrer Jugend zusammen, die zu ihrer Stummheit geführt haben. Wie viel Trostlosigkeit seit damals in ihr steckt, lässt sich daran ermessen, dass der Tod ihrer drei Söhne ihren Zustand nicht verschlimmert hat. Sie schlurft heute wie seit jeher von hier nach dort, treibt die Zofen zur Arbeit an, kämmt mein Haar, kämmt Mutters Haar, bindet ihr eigenes zu einem Knoten, der wie ein glatter, grauer, uralter Flussstein auf ihrem Kopf liegt, und trägt schmucklose Kleider. Ich musste wohl an sie denken, weil mein Zustand mich an den ihren erinnerte. Würde ich fortan so sein wie sie? Würde Vater eine solche Tochter wollen?
In diesem Augenblick begann sich die Leere in mir langsam zu füllen. Vaters Tod empörte mich. Es wäre für mich ebenso traurig gewesen, aber weniger unerträglich, wenn er im Kampf gestorben oder dem Fieber erlegen oder einfach tot umgefallen wäre. Dass er einen gewaltsamen, wenngleich nutzlosen Tod gestorben war und dass ich in seinem Blut gestanden hatte …
Ich erbrach die beiden Weintrauben. Ich spülte mir den Mund mit einem ganzen Krug voll Wasser aus, ließ mich auf mein Lager fallen und versuchte mit aller Kraft, zu weinen. Erneut misslang es mir. Dafür beschimpfte ich mich, und über all dieser Verzweiflung muss ich wohl eingeschlafen sein, denn das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie Baldur in unser Gemach hereinkam.
Er trug eine herbe Miene. Baldur verfügt bloß über zwei Mienen: die herbe des Kriegers vor der Schlacht, mit Stirnfalten und Adlerblick, und die gelöste des Kriegers am Abend nach der Schlacht, ausgelassen lachend.
»Du bist wach«, sagte er.
Zu sprechen machte mir Mühe. Ich hatte auch keine Lust dazu. »Seit gerade eben.«
»Hat der Schlaf dir gutgetan?«
»Ich bin mir nicht sicher. Er war wohl nötig, aber ich fürchte mich, das nächste Mal einzuschlafen.«
Mit dieser Bemerkung konnte er vermutlich nichts anfangen, was mir sehr entgegenkam. Ich setzte mich vor das polierte Metall und kämmte meine Haare.
»Soll ich deine Zofen rufen?«, fragte er.
»Nein.«
»Soll ich Bilhildis rufen?«
»Lass nur.«
»Willst du nicht das Gemach verlassen?«
»Doch.«
»Dann wirst du jemanden brauchen, um dein Haar zu stecken.«
»Ich gehe mit offenem Haar. Vater hat es gemocht, mich mit offenem Haar zu sehen. Wenn ich das letzte Mal bei ihm bin, möchte ich so aussehen, wie er es gewollt hätte.«
»Wir haben ihn vorhin bestattet.«
Es dauerte einen Augenblick, bis diese Worte mich erreicht hatten. Ich riss meinen Kopf zu Baldur herum.
»Du meinst doch nicht – nein, du meinst, ihr habt ihn aufgebahrt.«
»Ich kenne den Unterschied zwischen aufgebahrt und bestattet. Dein Vater ist unter der Erde, Elicia. Sie hielt es für das Beste.«
»Sie hielt es – wer ist ›sie‹?«
»Deine Mutter. Sie hat alles veranlasst.«
Ich warf den Kamm zu Boden; er zerbrach. »Oh, das hätte ich mir denken können. So eine gemeine, bösartige, heimtückische, hinterhältige, missgünstige, eifersüchtige …«
»Elicia.«
»Sie war immer schon eifersüchtig, weil ich lieber mit Vater als mit ihr zusammen war. Aber das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Sie hat meinen Bruder immer viel, viel mehr geliebt als mich, sie hat mich jahrelang kaum beachtet, und plötzlich, als sie Orendel verlor, erinnerte sie sich daran, dass sie eine Tochter hatte. Aber sie konnte mir nichts vormachen. Ich war nebensächlich für sie, und das habe ich sie spüren lassen, und deswegen hat sie nun …«
»Ich stimme ihr zu.«
»Wie bitte?«
»Ich stimme ihr zu, dass die Bestattung zu viel für dich gewesen wäre. Deine Gesundheit hätte darunter gelitten.«
»Wie du sagst: Es ist meine Gesundheit, sie gehört nur mir allein und ein kleines bisschen noch Gott. Alles, was meine Gesundheit betrifft, mache ich mit ihm aus. Außerdem war das bloß ein Vorwand meiner Mutter. Sie wollte meinem Vater einen letzten Hieb versetzen. Es wäre sein Wille gewesen, dass ich ihn bei seinem letzten Gang begleite, aber sie hat ihn zeit ihrer Ehe verletzt, wo sie nur konnte.«
»So oder so, es war richtig, den Leichnam rasch zu beerdigen. Denk bitte daran, wie spätsommerlich warm der Tag heute ist.«
»Du bist geschmacklos, widerwärtig.«
»Ich bin Soldat und denke praktisch. Nach einer Schlacht zum Beispiel …«
»Wir befinden uns in unserem Schlafgemach, und du sprichst von einem Schlachtfeld?«
»Dein Vater hätte mich verstanden.«
»Er hätte eher ein Wiesel verstanden als dich.«
»Mit dir ist heute nicht zu reden. Morgen gehen wir gemeinsam an deines Vaters Grab, dann kannst du Abschied nehmen.«
»Ich werde bestimmt nicht bis morgen damit warten.«
»Gemäß dem Brauch hält deine Mutter alleinige Totenwache am Grab, und zwar bis zum morgigen Sonnenaufgang. Keiner darf sie dabei stören.«
Ich versuchte, mich an ihm vorbei zur Tür zu drücken, aber er blockierte sie.
Ich sagte: »Sie hat sich, als er noch lebte, einen Dreck um meinen Vater geschert, das wird sich nach seinem Tod nicht ändern, und deswegen ist es ihr auch völlig gleichgültig, ob ich sie störe.«
»Mir ist es jedoch nicht gleichgültig.«
»Und warum, wenn ich fragen darf?«
»Nur aus einem Grund: Du bist nicht die Witwe Agapets, sondern die Waise.«
Ich geriet völlig aus der Fassung, ich schrie, trat einen Stuhl um, nahm das Schlaflager aus Fellen auseinander, warf einen Wasserkrug gegen die Wand, öffnete die Truhen, zerriss ein Kleid …
Schlimm. Ich benahm mich wie eine Wahnsinnige und gab vor meinem Gemahl ein furchtbares Bild ab. Das war falsch und – was kann ich noch dazu sagen, mir fehlen die Worte. Trotzdem versuche ich, mich zu verstehen. Es war mir verwehrt worden, mich von Vater zu verabschieden. Unsere letzte Begegnung, die letzte Berührung wird auf ewig diejenige sein, wo ich sein blutiges Haupt in meinen Händen hielt, und nie wird dieses Erlebnis, das tief in mich eingeschrieben ist, von einem sanfteren Abschied überschrieben werden. Dazu kam, dass mir von Baldur sogar die Trauer an seinem Grab verwehrt wurde, wenn auch nur für einen, nämlich den heutigen Tag. Das alles war zu viel für mich, die ich ohnehin genug zu tragen hatte, auch ohne dass mir mehr oder weniger liebmeinende Menschen noch weitere Unbill hinzupackten.
Die Leere in mir füllte sich mit Zorn.
Als ich mich ausgetobt hatte, sank ich erschöpft zu Boden. Wieder versuchte ich, zu weinen, doch erneut gelang es mir nicht. Ich muss sagen, dass Baldur sich in dieser Stunde ritterlich zeigte, denn er zog mich vom Boden hoch, legte mich auf mein Lager und verbrachte einige Zeit schweigend am Fenster. Er ließ mich in Ruhe durchatmen, und tatsächlich spürte ich, wie in mir eine innere Kraft entstand, die ich mir noch nicht ganz erklären konnte und von der es mir schwerfiel, sie zu akzeptieren. So rasch aufzuleben, das bedeutete für mich, Verrat an meinem Vater zu begehen. Dann aber begriff ich, dass ich diese Kraft erhielt – oder mir selbst zum Geschenk machte –, um sie in meines Vaters Dienste zu stellen. Was würde er von mir erwarten? Dass ich seinen Mörder fände!
»Hast du die Ungarin bereits verhört?«, fragte ich Baldur.
Er sah, am Fenster verharrend, zu mir herüber und sagte kein Wort.
Ich schlug die Augen nieder. »Es tut mir leid, was ich gesagt und wie ich mich verhalten habe. Es tut mir ehrlich leid.«
Obwohl es mir ein bisschen widerstrebte, las ich die Scherben vom Boden auf, stellte den Stuhl wieder an seinen Platz und räumte die Kleider wieder in die Truhen – all das natürlich als Zeichen meiner Entschuldigung und Unterwerfung. Manchmal muss man nun einmal Dreck fressen, um die Absolution zu erhalten.
Mitten in meiner Arbeit sagte Baldur: »Nein, habe ich nicht.«
Das hatte ich mir gedacht.
»Ich wäre gerne dabei, wenn du sie befragst. Wie wäre es jetzt gleich?«
»Es ist Brauch, dass die Familie am Tage der Bestattung als Ehrerbietung an den Toten nicht arbeitet.«
Mit seinen ständig zitierten Bräuchen machte er mich rasend, aber dieses Mal ließ ich mir nichts anmerken. Mir lagen eine ganze Reihe Erwiderungen auf der Zunge, die ich allesamt hinunterschluckte. Baldur war ganz Krieger: Auf ein Zücken des Schwertes reagierte er mit einem Heben des Schildes; auf eine weiße Fahne reagierte er mit Entgegenkommen.
»Ich könnte mir vorstellen, dass die schnellstmögliche Bestrafung der Mörderin die größte Ehre ist, die man meinem Vater erweisen kann. Arbeit würde ich das nicht nennen. Eher Pflicht. Aber bestraft werden kann sie erst, wenn ihre Schuld feststeht.«
Er nickte. »Also gut, einverstanden. Aber du wirst dich zurückhalten.«
»Selbstverständlich.«
Ich dachte: Zum Teufel damit.
Das Verhör fand im Bad statt, wo ich mich sehr unwohl fühlte. Das Becken war noch immer nicht abgelassen worden, und im Raum hing ein süßlicher, ekelhafter Geruch. Baldur war ihn vermutlich gewöhnt – man kann die Schlachten, die er geschlagen hat, nur noch mit drei Händen zählen. Als man die Heidin hereinführte, machte sie einen verunsicherten Eindruck. Sie war ohne Zweifel die Hauptverdächtige, und ich fühlte den Hass in mir, der sich gegen sie richtete. Zugleich aber – und ich merke, wie widersprüchlich sich das liest – war sie mir dennoch ein wenig angenehm. Sie war ungefähr in meinem Alter und sehr schön, schien mir jedoch nicht zu jenen Schönen zu gehören, die viel Aufhebens um sich machen. Und sie konnte bei aller Verunsicherung eine gewisse Wildheit ihres Wesens nicht verbergen, von der ich glaube, dass sie auch mir zu eigen ist.
Das Verhör verlief zunächst nicht zufriedenstellend. Die Ungarin sprach Ungarisch – was auch sonst? Baldur stellte ihr Fragen, die sie mit einem Schulterzucken beantwortete, und wenn sie von sich aus etwas sagte, verstanden wir nicht, was sie meinte.
»Habt ihr noch andere Ungarn gefangen genommen?«, fragte ich Baldur.
»Nein, sie war die Einzige. Nachdem das herzogliche Heer die Heiden an der Mur geschlagen hatte, drangen wir ziemlich schnell und weit in ungarisches Gebiet vor. Wir plünderten. Gefangene hätten uns nur aufgehalten. Aber sie … Sie schöpfte Wasser aus einem Bach. Als dein Vater sie bemerkte, befahl er mir, sie zu ergreifen. Bald darauf kehrten wir um. Den Rest kennst du. Dass die Heidin eine fremde Sprache spricht, hat deinen Vater nicht gestört. Wieso auch? Er hat sie bestimmt nicht zu sich ins Bad geholt, um sich mit ihr zu unterhalten.«
Und er fügte lachend hinzu: »Wenngleich ihr Mund vielleicht nicht ganz unbeteiligt bleiben sollte.«
An Baldurs Geschmacklosigkeiten werde ich mich wohl nie gewöhnen. Aber ich riss mich zusammen und ging nicht auf ihn ein.
»Und nun?«, fragte ich.
»Es sieht nicht gut für sie aus. Sie hat neben einem Ermordeten im Bad gesessen.« Er hörte sich nicht so an, als wäre er von ihrer Schuld überzeugt, aber auch nicht, als habe er vor, sie zu verschonen.
Da fing die Heidin an, mit Händen und Füßen zu reden. Es war ein wenig mühsam, sie zu verstehen, aber schließlich ergab sich, dass Bilhildis sie irgendwann aus ihrem Gemach geholt und in den Vorraum des Bades gebracht haben musste. Dort war sie von ihr ausgekleidet und ins Bad geschubst worden, wo – wie sie uns verdeutlichte – nur ein einziges Öllämpchen brannte.
»Und du bist ins Becken gegangen?«, fragte ich die Heidin, wobei ich die Frage gestisch darstellte.
Sie bejahte dies. Nach etlichen Fragen und Nachfragen Baldurs ergab sich das Bild, dass die Ungarin sich langsam ins Becken hatte gleiten lassen, wo sie im Wasser, das ihr bis zum Hals stand, verharrte, auf den Kopf meines Vaters starrend, der sich jedoch nicht bewegte. Im Halbdunkel nahm sie an, er würde sie ebenfalls anstarren. Erst später hat sie gemerkt, dass sie mit einem Toten im Bad sitzt, und geschrien. Daraufhin war ich gekommen.
Sollten wir ihr glauben? Tatsächlich stellte Baldur fest, dass die Öllampe leer war. Aber was besagte das schon? Die Ungarin hätte, nachdem sie Vater getötet hatte, das Öl ins Becken gießen können. Dass eine verschleppte Frau sich zunächst an den Beckenrand drückt und nicht von sich aus den ersten Schritt macht, erscheint mir verständlich. Dass eine verschleppte Frau den Mann, der sie verschleppt hat, bei erster Gelegenheit tötet, erscheint mir jedoch nicht weniger verständlich.
Plötzlich fiel mir auf, dass der Pegel des ekelhaften Blutwassers im Becken sank. Zum Ablaufen gab es eine Vorrichtung in Form eines kleinen Kanals, der quer durch das Mauerwerk bis zur äußeren Burgmauer verlief und den wir – so wie das Bad und die ganze Burg – dem königlichen Geschlecht der Merowinger verdankten, das vor dreihundert Jahren hier gebaut, gelebt und gebadet hat und das vor bald zweihundert Jahren so elendiglich untergegangen ist. Man musste nur einen Hebel bedienen, und schon lief das Wasser langsam ab.
»Wer hat den Hebel betätigt?«, fragte ich. »Du, Baldur? Die Ungarin vielleicht?«
»Sie hat nichts angefasst«, sagte Baldur, »das weiß ich genau.«
»Dann muss noch jemand hier gewesen sein, kurz bevor wir kamen. Anders ist es nicht zu erklären. Wie auch immer, gleich werden wir der Wahrheit einen kleinen Schritt näher gekommen sein.«
»Wieso das?«
»Falls die Ungarin Vater getötet hat«, sagte ich, »muss sie die Waffe irgendwo gelassen haben. Du sagst, sie war völlig nackt, als die Wachen hier eintrafen, also hatte sie die Waffe da schon nicht mehr bei sich. Ihr habt das Bad, den Vorraum und die Gänge vergeblich abgesucht. Und das nächste Fenster ist in Vaters Gemach, die Tierhaut wurde nicht abgenommen. Es gibt also nur einen Ort, wo die Waffe abgeblieben sein kann, und zwar das Becken.«
»Angenommen, wir finden nichts. Was dann?«
»In diesem Fall steht fest, dass die Ungarin nicht die Mörderin ist, denn wo soll sie die Waffe gelassen haben?«
Baldur, die Heidin und ich starrten ins ablaufende Blutwasser, wo sich unsere Gesichter spiegelten, und wurden magisch vom Grund des Beckens angezogen, dem sich unsere Oberkörper langsam zuneigten, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Atemzüge lang.
Da – ein Gegenstand. Zunächst nur ein Schemen, ein heller Schimmer wie ein kleiner Haufen Münzen auf dem Grund eines dunklen Brunnens, und dann sich verformend, deutlicher werdend, ein länglicher Gegenstand, ein silberner Griff, eine Klinge, ein ganzer Dolch. Die Waffe.
Baldur, die Heidin und ich schwiegen. Ich beugte mich über den Beckenrand und fischte nach dem Dolch. Als ich ihn zu fassen bekam, durchzog mich ein Schauer. Ich bewegte mich nicht und war drauf und dran, das kalte Metall fallen zu lassen, doch es war nur ein kurzer Moment, dann zog ich den ausgestreckten Arm langsam zurück, richtete mich auf und betrachtete das Fundstück eingehend: Silbergriff, feine Ornamente, eine Inschrift, drei winzige blaue Edelsteine, eine schöne Arbeit.
Ich war beinahe atemlos, denn ich hatte diese Waffe schon einmal gesehen.
Ehe ich mich versah, hatte Baldur den Haarschopf der Ungarin mit der linken Hand ergriffen und schlug mit der flachen rechten Hand in ihr Gesicht. Die Heidin, halb benommen, blutete aus der Nase.
»Gestehe!«, rief er, beschimpfte sie mit üblen Worten und schlug zu. Es war ein grauenhafter Anblick. Ich war völlig verdutzt. So hatte ich Baldur noch nie gesehen. Er war im Allgemeinen ein grober Klotz, der sich mit Männern alle möglichen Scharmützel lieferte und vor keinem Schlag zurückschreckte. Aber gegenüber Frauen war er immer zurückhaltend gewesen, weder Galan noch Wüstling, sondern eher scheu. Und nun wie aus dem Nichts diese Gewalt. Er war völlig außer sich.
Ich fiel Baldur in den Arm.
»Nicht, das tut mir weh«, rief ich.
»Dir? Ihr soll’s wehtun.«
Seltsamerweise – das berührt mich auch jetzt noch – standen ihm die Tränen in den Augen, und wenn man genau in seine Stimme hineinhörte, schwang dort ein leises Schluchzen mit.
»Was ist mit dir?«, fragte ich.
»Was mit mir ist? Sie hat deinen Vater umgebracht.«
Mir war entgangen, dass Baldur meinen Vater geliebt hatte. Gewiss, er hatte großen Respekt vor ihm gehabt, aber man weint nicht aus Respekt.
»Das wissen wir nicht sicher«, sagte ich. »Ihre Geschichte könnte stimmen.«
»Dort ist der Dolch. Sie hat ihn die ganze Zeit bei sich getragen.«
»Sie wurde doch gewiss durchsucht, als sie auf dem Feldzug gefangen genommen wurde. Du musst es wissen, du warst dabei.«
»Ja, natürlich hat man sie durchsucht, aber …« Er wurde ungeduldig, und er ließ den Schopf der Ungarin nicht los. »Ist doch gleichgültig. Dann hat sie den Dolch eben vom Tross gestohlen, dazu hatte sie mehrere Wochen lang Gelegenheit. Sie muss getötet werden.«
»Wir sind hier nicht auf der Jagd, Baldur. Sag mir bitte, ob gewöhnliche Waffenträger und Gesinde des Trosses einen derart kostbaren Dolch besitzen.«
Ich zeigte ihm den Dolch, aber er betrachtete ihn nur kurz.
»Beutegut«, sagte er und zuckte mit den Achseln. »Wir haben den Ungarn einiges abnehmen können.«
»Das ist eindeutig ein im Reich gefertigter Dolch.«
»Also haben die Ungarn diesen Dolch auf ihren Raubzügen im Reich gestohlen. Was glaubst du, warum wir den Feldzug geführt haben? Um unsere Sachen zurückzuholen und es ihnen mit gleicher Münze heimzuzahlen.«
»Bitte sieh dir die Inschrift an.«
»Wozu?«
»Sieh sie dir an.«
Widerstrebend sah er sie sich an. »Ich kann nicht lesen, das weißt du doch.«
»Konradus Rex«, las ich ihm vor.
»Und?«
»König Konrad herrscht erst seit einem guten halben Jahr, und in diesem Jahr haben die Ungarn keinen Raubzug ins Reich unternommen. Woher also soll die Ungarin die Waffe bekommen haben? Wenn ich ihn mir genau betrachte … Das scheint der Dolch zu sein, den Vater im Frühling vom König geschickt bekommen hat. Erinnerst du dich, ich hatte dir damals von ihm erzählt. Ein kostbarer silberner Ring und ein ebenso kostbarer, silbern verzierter Dolch in einer silbernen Kassette. Vater schenkte mir den Ring. Die Kassette mit dem Dolch wurde meines Wissens während Vaters Feldzug in der Schatzkammer aufbewahrt.«
»Bist du sicher?«
»Dir wäre ein solcher Dolch doch bestimmt aufgefallen, wenn Vater ihn getragen hätte.«
»Ja, aber …«
»Er hat ihn nicht getragen. Er hat die Kassette am Tag, nachdem er sie bekommen hatte, in die Schatzkammer neben seinem Gemach gelegt. Wie hätte die Ungarin an den Schlüssel zur Schatzkammer kommen sollen? Und wieso, wenn sie nicht wusste, dass sich dort drin eine Waffe befindet? Das ergibt keinen Sinn, Baldur.«
Er ließ – halbwegs überzeugt und auch ein wenig erleichtert – von der Ungarin ab. Sie glitt zu Boden, geschwächt von den Schlägen. Baldur lehnte sich erschöpft gegen die Wand, so als wäre er selbst gemartert worden.
Was war nur mit ihm?
»Trotzdem bleibt sie im Arrest«, bestimmte er.
»Wieso? Sie hat es nicht getan.«
»Sie ist Ungarin. Sie ist unsere Gefangene.«
»Nenne mir einen besseren Grund.«
»Wie du willst. Ahnst du, welche Unruhe und Gerüchte es auslösen würde, wenn feststünde, dass der Mörder deines Vaters noch frei herumläuft? Die Heidin muss hinter Schloss und Riegel bleiben, auch wenn sie den Mord nicht begangen hat, und zwar so lange, bis der Mörder aufgespürt ist.«
Widerwillig musste ich ihm beipflichten.
Baldur veranlasste, dass man sie in das Quartier zurückbrachte, das mein Vater ihr zugebilligt hatte, wo sie weiterhin unter Arrest steht.
Baldur ist gewiss noch nicht mit ihr fertig. Und ich bin es, ehrlich gesagt, auch nicht. Über vieles bin ich mir noch nicht im Klaren, über eines jedoch schon: Ich werde den Mörder selbst suchen, finden und anklagen. Das ist es, was mein Vater von mir, seinem einzigen Fleisch und Blut, erwarten würde. Und wenn es mir gelungen ist, dann werde ich die Kraft finden, zu weinen.
Claire
Der Totenwache konnte ich mich nicht entziehen. Einen Tag und eine Nacht lang war es mir aufgegeben, auf einem Schemel auf Agapets frischem Grab zu sitzen, ich allein mit ihm, er drei Ellen unter mir verwesend. Zum Schutz vor der Spätsommersonne hatte man einen Baldachin für mich aufgespannt, ein riesiges Leichentuch über meinem Haupt, das mich zu ersticken suchte, während Agapets Nähe mich von unten erstickte. Dazu raubten die schreienden Zikaden mir fast den Verstand. Ich hielt mir die Ohren zu und wäre am liebsten aufgesprungen und fortgerannt. Man sollte nicht glauben, wie erdrückend die Luft und die Zeit auf einer Burg hoch über dem Rhein sein können; man sollte meinen, der Thron über einem weiten Land voller Sonne und Wein garantiere Reinheit, Frieden und Frische. Doch die Luft stand still, so wie die Zeit, siebenundzwanzig Jahre lang und ein letztes Mal.
Dort saß ich also Stunde um Stunde und wartete auf das Ende meines bisherigen und den Beginn eines anderen Lebens. Ein fremdes Terrain. Ich hatte noch nie viel Zeit auf diesem Friedhof zu Füßen der Burg verbracht. Auf meinen Spaziergängen hatte ich ihn stets gemieden, und musste ich, was selten vorkam, an einer Bestattung teilnehmen, starrte ich fast immer nur auf das Grab und entfernte mich so schnell wie möglich. Zu meiner Überraschung bemerkte ich jedoch, dass der von Hagebuttensträuchern umgebene Friedhof der schönste Fleck des Areals um die Burg ist. Der Blick geht – anders als auf der hügeligen, bewaldeten Westseite – weit über das rheinische Land bis zum östlichen Horizont. Es gibt um den Friedhof herum weder blühende Wiesen noch Weinreben wie auf der flach abfallenden Südseite, sondern bloß wuchernde Gräser, aber dafür stört nicht der Wirtschaftsweg, auf dem von morgens bis abends Wagen rattern und Pferdehufe klappern. Der Hang ist nicht so steil und spektakulär wie auf der Nord- und Teilen der Westseite, wo die Schroffen in die Tiefe stürzen, aber zum Nachmittag hin verwandelt sich der Fluss im Tal zu einem goldglühenden Band, welches das Licht hangaufwärts gegen die Ostmauer wirft und der Burg und dem Friedhof eine schillernde, beinahe traumhafte Erscheinung gibt, deren Teil ich in diesem Augenblick war. Wie oft habe ich den Rhein von meinem Fenster oder den Burgmauern aus betrachtet, doch nie hatte er diese Wirkung auf mich wie in jenen Stunden, über die ich schreiben muss, um sie festzuhalten. Früher habe ich nie geschrieben. Erst an Agapets Tod hat sich der Funke entzündet.
Zum Abend hin hörte ich die Gesänge meiner drei Zofen Frida, Franka und Ferhild, die ich mir mit Elicia teile. Sie singen seit jeher gern, aber seit ihre Verlobten im Krieg gefallen sind, sind ihre Lieder oft traurig und ahnungsvoll, sodass manche in der Burg glauben, sie hätten seherische Fähigkeiten. Verse hallten heran: Des Hauses Träumerin, aufgeschreckt im Schlaf, das Grauen erblickt, mitternächtgen Angstschrei ausgestoßen, zu uns ins Gemach taumelwild sich hineingestürzt. Sonnenlos umhüllt tiefes Dunkel das Haus, in dem drinnen ward der Herr erschlagen.
Als sie verstummten, wurden die Zikaden mir langsam lieb, dann wurde es bald still, und durch die Stille kam ich zur Ruhe und zur Traurigkeit. Meine Kindheit dämmerte vor mir auf, die an meinem sechzehnten Geburtstag, dem Tag meiner Heirat mit Agapet, zu Ende gegangen war: sieben laute Geschwister; lange Ausritte über das Plateau; die Glocken von Langres; der verdrückte Kuss eines gleichaltrigen Verehrers; ein unermüdlich Recht sprechender Vater; eine Mutter, die ein Kind nach dem anderen verheiratete; ein Krieg zwischen den Königreichen Ostfranken und Westfranken, der schwer auf dem Land lastete … Er sollte mit einem Vertrag beendet und mit mehreren Hochzeiten zwischen hüben und drüben – unter anderem meiner Hochzeit – besiegelt werden. Für mich war Agapet vorgesehen, ein schwäbischer Edler, der besonders unbarmherzig gegen die Unseren gekämpft hatte und dabei auch einen Mann, der zu dieser Zeit um mich warb und den ich gerne zum Gemahl gehabt hätte, in einer Schlacht tötete. Ich wollte Agapet, der meinen Geliebten und meine Zukunft erschlagen hatte, nicht heiraten. Nur der Gehorsam gegenüber meinen Eltern, die auf der Hochzeit zum Wohle des Landes beharrten, zwang mich dazu. Aber als ich Agapet zum ersten Mal begegnete – vor dem Altar –, war es mir unmöglich, Ja zu sagen. Ich hasste seine Augen. Es gab Empörung – und neues Blut. Schrecklicher denn je wüteten Agapets Horden, sie drangen bis Langres vor, sie ergriffen einige unserer Diener, leider auch Bilhildis, und dann … Eine Woche später gab ich Agapet mein Jawort.
All das zog noch einmal an mir vorbei.
Mit dem Einbruch der Nacht wurden vier Fackeln entzündet, die in der Finsternis meine einzige Gesellschaft waren. Als zur Mitte der Nacht die letzte Fackel erloschen war, erlitt ich einen Rückfall. Mir kam es plötzlich so vor, als würde die Erde sich unter mir bewegen, und ich sprang vom Schemel auf. Dann hörte ich Geräusche von allen Seiten, ich wandte mich hierhin und dorthin. Ich sah Katzenaugen leuchten. Die Mücken fielen über mich her. Die Burg war wie ein riesiger, unbelebter Felsen in meinem Rücken. Ich war allein, verlassen. Als ich mich im Gras niederließ, packte mich die Angst angesichts des gewaltigen Sternenzelts über mir, ja, ich fühlte mich dem strafenden Gott anheimgegeben, und schließlich weinte ich.
Die meinen Körper erfassende Kälte brachte die Wende. Ich erinnerte mich des Mantels, den Aistulf mir zum Schutz vor der Kühle der Nacht – doch vielleicht nicht nur deshalb – neben dem Schemel zurückgelassen hatte, und ich legte ihn mir um die Schultern. Augenblicklich besserte sich meine Lage. Um auch die letzten Geister zu vertreiben, flüsterte ich, wieder auf dem Schemel sitzend, Aistulfs Namen in die Dunkelheit, an die tausend Mal, wie man eine Erwartung beschwört. Von meinem Sohn abgesehen, dessen Gegenwart ich seit sieben Jahren schmerzlich entbehre, habe ich mir noch nie einen Menschen stärker herbeigewünscht als Aistulf.
Die Nacht zerbrach vor meinen Augen. Vom Horizont stiegen Farben auf und flossen ineinander, der Fluss nahm Konturen an, der Himmel wurde wieder blau, der Wald grün und die Felder strohgelb. Es war überstanden. Nie wieder, so sagte ich mir, würde ich mich vor Gott oder Agapet fürchten müssen. Ich war ein neuer Mensch, getauft von der Nacht.
Ich hatte Agapet endgültig verlassen. Weder ich noch ein Teil von mir würden je wieder ihm gehören. Er besaß keine Macht mehr über mein Leben, würde nur noch ein kleiner Erdhügel sein, weniger noch als eine Erinnerung. Ich würde vergessen, welche Farbe seine Augen hatten, welchen Klang seine alles beherrschende Stimme, welche Festigkeit seine kalten Umarmungen.
In die Welt hinaus hätte ich es schreien mögen, der Morgensonne entgegen, das Tal hinunter zu den Rheinwogen, über die Wipfel der Bäume und alle Dörfer hinweg: Agapet ist tot. Er ist tot. Tot.
Und wer weiß, vielleicht hätte ich es getan, wenn Elicia nicht in diesem Moment des Triumphs den Friedhof betreten hätte.
Kara
Vergangene Nacht hatte ich wieder einen dieser Träume. Ich frage mich, was es mit ihnen, für die ich in meiner Heimat belächelt worden bin, auf sich hat. Vor ungefähr fünfzehn Jahren habe ich den Traum von letzter Nacht schon einmal geträumt, ich war höchstens sieben Jahre alt.
Ich sehe das flache Land vor mir. Kein Hügel und kein Wald stört die Fernsicht. Alles ist Weite, die kniehohen Gräser biegen sich im Wind, der so wohltuend in den Ohren rauscht. Am Himmel spielen die Wolken nach, was auf Erden vor sich geht, denn es sind deren tausend und mehr, unzählbare Horden, sie kommen von Osten und ziehen nach Westen wie wir. Immer wieder wende ich meinen Blick zurück und zu den Seiten, ich kann mich nicht sattsehen an den Pferden und Reitern und den kleinen Sandwolken, die sie bei ihrem gemächlichen Ritt durch das neu eroberte Land aufwirbeln. Dazwischen trotten die Ziegenherden. Unsere Familie reitet mit anderen Fürsten und ihren Familien fast an der Spitze des Volkes. Ich sitze auf dem gleichen Pferd wie mein Bruder, dessen Hüfte ich umklammere, und meine Mutter reitet nur einen Steinwurf weit von uns entfernt, sich an meinen Vater Álmos klammernd, so wie auch meine Schwestern und Kusinen sich an ihren Brüdern und Vettern festhalten, obwohl diese manchmal um Jahre jünger sind als sie. Ich verstehe nicht, wieso sie nicht selbst reiten, und nehme mir vor, so bald wie möglich ein eigenes Pferd zu bekommen.
Als jemand »Wasser, da ist Wasser« ruft, bricht Jubel aus, und von der Spitze sich langsam nach hinten fortsetzend, verbreitet sich die Nachricht. Im Galopp geht es nun voran, die ganze Ebene hinter mir ist gelber Staub, leuchtend in der Sonne. Und dort vor mir, tatsächlich, ist Wasser, ein See, so blau und groß, wie ich noch keinen gesehen habe. Kaum dass man das andere Ufer sieht. Wir trinken neben unseren Pferden aus diesem See, wir lachen, toben und baden.