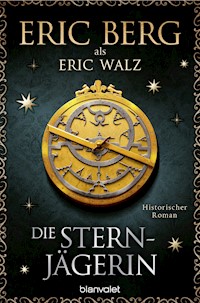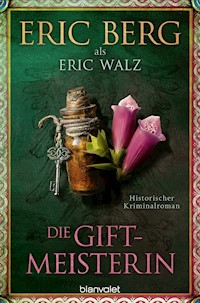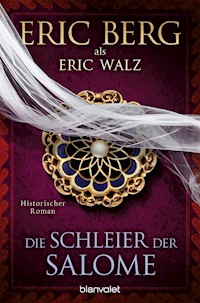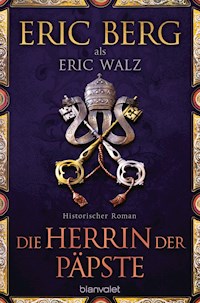
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine faszinierende Frau im alten Rom zwischen Liebe und Macht! Vergessen von der Geschichte, die ohne sie eine andere gewesen wäre ...
Rom, Anno Domini 963: Eine der mächtigsten Frauen steht vor Gericht. Marocia, Senatrix von Rom, wird des Hochverrats angeklagt! Der Prozess bietet Anlass, auf ihr Leben zurückzuschauen. Als blutjunges Mädchen von der eigenen Mutter verschachert, wird sie Geliebte des Papstes Sergius III. und will doch nur eins: ihr Leben selbst bestimmen. Wie kaum eine andere Frau zu dieser Zeit erkämpft sie sich raffiniert Macht und Einfluss. Als sie, über 90-jährig, im Kloster stirbt, war sie Geliebte, Mutter, Großmutter und Tante je eines Papstes, kreuzte den Weg der Großen des Jahrhunderts und begegnete der Liebe ihres Lebens ...
Das außergewöhnliche Leben einer faszinierenden historischen Frauengestalt des Alten Roms mitreißend erzählt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 961
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Rom, Anno Domini 963: Eine der mächtigsten Frauen steht vor Gericht. Marocia, Senatrix von Rom, wird des Hochverrats angeklagt! Der Prozess bietet Anlass, auf ihr Leben zurückzuschauen. Als blutjunges Mädchen von der eigenen Mutter verschachert, wird sie Geliebte des Papstes Sergius III. und will doch nur eins: ihr Leben selbst bestimmen. Wie kaum eine andere Frau zu dieser Zeit erkämpft sie sich raffiniert Macht und Einfluss. Als sie, über 90-jährig, im Kloster stirbt, war sie Geliebte, Mutter, Großmutter und Tante je eines Papstes, kreuzte den Weg der Großen des Jahrhunderts und begegnete der Liebe ihres Lebens ...
Eric Berg alsEric Walz
DieHerrinderPäpste
Historischer Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2003 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (e55evu, Kraft74) und Shutterstock.com (Eky Studio, pavila, ollen)
WR · Herstellung: DM
ISBN 978-3-641-29160-0V002
www.blanvalet.de
Für Mutsch, in Liebe und Dankbarkeit
Erster TeilZwischen Himmel und Hölle
Der vierte Adventstag, Anno Domini 963
»Eine Leiche?«, rief Liudprand von Cremona und reckte seinen Schildkrötenkopf aus der schwarzen Kutte. Er hielt die Luft an und überflog das Pergament noch einmal mit zusammengekniffenen Augen. Seine Arme zitterten leicht. Als er es merkte, blickte er aus den Augenwinkeln zu dem Mann neben ihm und stützte die Ellenbogen auf der wuchtigen Platte des Sekretärs ab. Er schmatzte und schluckte mehrmals, legte das Pergament auf den Stapel mit den restlichen Papieren des Berichts zurück und hauchte: »Tatsächlich! Eine Leiche vor Gericht.«
Liudprand zog den Umhang um seine Schultern enger, krampfte seine Hände um den Stock und hinkte langsam zum Kamin. Er versuchte vergeblich, sich dort zu wärmen. Das kleine Feuer kam nicht gegen den Winter an. Dieser östliche Teil der Engelsburg war schlecht ausgestattet. Kein Teppich zierte Wand oder Boden, die Fensterläden ließen den Wind durch Löcher und Spalten pfeifen, und außer dem Bett und dem Sekretär verlor sich nur noch ein kleiner Tafeltisch in dem lang gezogenen Raum. Liudprand knurrte, doch welche Wahl hatte er? Schließlich konnte er ja wohl schlecht seine Erzrivalin um eines ihrer Gemächer bitten. »Und diese … diese Person war dabei?«, fragte er in den lodernden Kamin hinein.
»Mittendrin.«
Wieder knurrte Liudprand.
»Ich wusste nichts davon«, gab er widerwillig zu.
Suidger von Selz lehnte sich entspannt zurück. Es war ihm eben geglückt, den Bischof von Cremona und kaiserlichen Gesandten für einen kurzen Moment zu verunsichern, und das war viel wert in der Auseinandersetzung gegen jemanden, den alle den »Jagdhund Gottes« nannten. Doch Suidger wusste auch, dass er noch ganz am Anfang seiner heiklen Aufgabe stand. Liudprand hatte Witterung aufgenommen, und es würde viel Geschick brauchen, ihn von der Fährte wegzulocken.
»Es ist auch schon siebenundsechzig Jahre her«, erklärte Suidger. »Weder Ihr, Exzellenz, noch ich waren damals schon geboren. Sie aber war zarte sechs Jahre alt und …«
Liudprand wandte sich um. »Das genügt«, rief er. »Der Vorfall ist von keinerlei Bedeutung für meine Untersuchung. Sie wird morgen vor Gericht gestellt, und dabei bleibt es.«
»Aber Exzellenz«, empörte Suidger sich. »Der Vorfall erklärt anschaulich, dass Marocia entgegen Eurer Annahme bereits von frühester Kindheit an auf unserer Seite …«
Das Stampfen von Liudprands Stock hallte von den Wänden wider. »Genug, habe ich gesagt. Ich will nichts mehr davon hören.« Liudprand wandte sich wieder dem Feuer zu, doch als er ihm seine Hände entgegenstreckte, zitterten sie. Wie zum Schutz umfassten seine Finger erneut den Stock. »Die Kindheit dieser … Person mag Euch einen Bericht wert sein, denn Ihr seid ihr Verteidiger …«
»Verhandlungsführer«, berichtigte Suidger.
Liudprand murrte in sich hinein. »Meine Untersuchung jedoch befasst sich nicht mit Dingen, die vor fast zwei Menschenaltern vorgefallen sind, sondern«– er fuchtelte mit dem Stock in Richtung des geschlossenen Fensters –»mit dem, was da draußen geschehen ist – mit Verrat.«
»Damit hat sie nichts zu tun. Sie hat lediglich versucht …«
»Schweigt«, befahl Liudprand mit einer Kraft, die man seiner dürren Kehle kaum zugetraut hätte.
Suidger war zu klug, um sich mit dem Gesandten jetzt ein Wortgefecht zu liefern. Er rieb sich seinen vollen braunen Bart, der sein halbes Gesicht bedeckte, und ging stumm zu einem der Fenster. Ein knapper Stoß seiner kräftigen Rechten genügte, um den Laden aufzuklappen. Sofort wehte Suidgers Ordensgewand im eisigen Abendwind und schmiegte sich eng um seinen rundlichen Bauch. Es dauerte eine Weile, bis seine Augen sich an die Böen gewöhnt hatten und aufmerksam die Umgebung beobachten konnten. Tausende kleiner Rauchfäden stiegen aus Schornsteinen und von Lagerfeuern in den grauen Himmel über Rom. Auf dem anderen Tiberufer standen verlassene Katapulte und sonstige Belagerungsgeräte herum, vom Raureif einer bitterkalten Nacht überzogen. Und unten im Hof lagerten jene Bewaffneten, mit denen Liudprand vor einigen Tagen die Engelsburg und die Basilika des heiligen Petrus aus der Umklammerung der aufständischen Römer befreit hatte. Doch keine fünfhundert Schritte von hier endete Liudprands Macht bereits. Er hatte viel zu wenige Soldaten mit auf den Weg bekommen, um die ganze Stadt zu erobern. Da draußen, hinter den Mauern der Uferhäuser, lauerten die Gegner und warteten. Sie warteten ebenso wie Liudprand und die Soldaten der Burg, wie Marocia und wie er selbst, auf Nachrichten aus dem Norden und dem Süden Italiens. Dort schlugen die kaiserlichen Heere entscheidende Schlachten, und je nachdem, wie diese ausgingen, würden sie auch über Leben und Tod der hiesigen Kontrahenten entscheiden.
»Eine äußerst subtile Methode, mich ins Grab zu bringen«, rief Liudprand und stellte sich noch näher an das Feuer heran. »Wollt Ihr, dass ich wie Lots Frau auf ewig erstarre?«
Suidger schloss den Laden und schmunzelte. »Verzeiht, Exzellenz. Dieses Quartier entspricht wirklich in keiner Weise Eurem Rang. Darf ich Euch im Namen Marocias eines ihrer Gemächer überlassen? Sie besitzen allen Komfort.«
Liudprands Finger krampften sich derart fest um den Knauf seines Stocks, dass die Knöchel bleich wurden, und sein Kinn bewegte sich mit der Geschwindigkeit seiner Gedanken hin und her.
»Ihr wagt es?«, schimpfte er schließlich. »Sie ist eine Papsthure und ein untreues Weib. Sie behext Männer, damit sie das tun, was sie will. Wenn sie dann doch einmal verheiratet ist, sterben ihre Gatten seltsamerweise wie die Fliegen. Ihr Leib ist verflucht. Ihre Kinder sind Monstren, und noch ihre Kindeskinder tragen die Verderbnis in ihrem Blut. Seht ihn Euch doch an, den Papst, den Verräter am Kaiser und an Gott. Eine Ausgeburt der Hölle ist sie, jawohl, und ich hacke mir eher meine frierenden Hände ab, als in einer ihrer Höhlen zu wohnen.«
Suidger schüttelte kaum sichtbar den Kopf. Liudprands moralisches Urteil über Marocia war längst bekannt, und vom rechtlichen Standpunkt aus betrachtet waren solche Vorwürfe nichtig. Aber der Bischof war dafür bekannt, dass er Moral und Gesetz gerne durcheinander warf, und es war keiner hier, der über seinen vom Kaiser verliehenen Gerichtsvollmachten stand.
»Ich muss um Vergebung bitten, Exzellenz«, sagte Suidger und verneigte sich leicht. »Mir hätte bewusst sein sollen, dass Teppiche und größere Kamine bereits eine Versuchung des Bösen für Euch darstellen. Ich glaube, dann ist für heute alles besprochen.« Er verneigte sich nochmals, jedoch tiefer, und ging hinaus.
Liudprand rührte sich nicht und starrte zur Tür, als erwarte er, dass Suidger zurückkehre. Nach einer Weile gespannter Aufmerksamkeit versenkte er seinen Schildkrötenkopf ganz langsam wieder in der schwarzen Kutte. Er humpelte zum Sekretär, griff sich einen Stuhl und zog ihn nahe an das Kaminfeuer. Dann ging er nochmals zum Sekretär, holte Suidgers Bericht, setzte sich nieder, legte den Stapel auf seinen dünnen Knien ab und beugte sich darüber. Seine Lippen formten zitternd die Worte nach. »Ein Leichnam vor Gericht.«
1
Es war der achte Tag im elften Monat Anno Domini 896, und eine päpstliche Order hatte Marocia dazu verholfen, erstmals die heimische Villa Sirene verlassen zu dürfen. Mit ihren sechs Jahren fühlte sie sich alt genug dafür. Nur weil ihr Zwillingsbruder Leon bei jedem Windstoß eine triefende Nase und bei jedem Sonnenstrahl das Gefühl bekam, seine Haut verbrenne, war sie mit ihm in dem Haus in der Via Lata eingesperrt. Täglich dieselben Menschen, dieselben Gegenstände, dieselben Geräusche und Düfte. Sie kannte die Welt nur aus den Erzählungen ihrer Eltern. Aber wie viel aufregender war es, hier in der düsteren Kirche des Lateran zu stehen, dem jahrhundertealten Sitz der Päpste, und die umherziehenden Weihrauchschwaden zu betrachten, den Atem der Leute in die kalte Luft aufsteigen zu sehen, die herrlichen Gewänder rascheln zu hören, Dinge also wahrzunehmen, für die niemand sonst sich zu interessieren schien. Nicht einmal der von den mächtigen steinernen Gewölben rieselnde Sandstaub und das gelegentliche Knarren der Turmbalken fanden bei den Versammelten Beachtung, jeder achtete nur auf das, was unter dem großen goldenen Kreuz geschah, oder besser – nicht geschah.
Vor dem Altar stand, bewegungslos wie eine Statue, Papst Stephan VI., flankiert von Kardinal Sergius und von Johannes, dem hübschen, nicht einmal fünfundzwanzigjährigen Erzbischof von Ravenna. Die drei Dutzend Edlen von Rom, die sich in vollem Ornat im Kirchenschiff versammelt hatten, blickten schon seit einer Weile mit gespannter Erwartung auf das schweigende Trio. Das leise Klirren ihrer bronzenen Amulette, den Abzeichen weltlicher Würden, war, zusammen mit dem Gewisper der Leute, die einzige Unterbrechung der Stille.
»Wir hätten Marocia nicht mit uns nehmen dürfen«, flüsterte Theophyl, Marocias Vater, der als praetor urbanus, als Oberster Richter, zu den erlauchtesten der weltlichen Gäste zählte. »Was immer in dieser Kirche geschieht, es ist für ein Mädchen nicht geeignet.«
Theodora, seine Gemahlin, grinste spöttisch. »Gott wird ihr schon nichts tun.«
Theophyl kraulte nachdenklich seinen grauen Bart. »Mir gefällt das alles nicht, Theodora. Dieser seltsame Befehl an die römischen Würdenträger, hierher zu kommen und die Frauen und Kinder mitzubringen – und so plötzlich! Niemand weiß, weshalb diese Synode einberufen wurde. Nicht ein Einziger.«
Theodora ignorierte den Kommentar ihres Gemahls und konzentrierte sich darauf, den Blick des jungen Erzbischofs zu suchen, so lange, bis er ihn erwiderte. Sein leichtes, fast unmerkliches Kopfnicken beruhigte sie, und sie belohnte seine Geste mit einem genüsslichen Schmunzeln und einem langsamen Streicheln ihres von der Schwangerschaft leicht gewölbten Bauches.
Das dumpfe Geräusch der zufallenden Kirchenpforte brachte Bewegung in die Menge. »Ageltrudis ist gekommen!«, flüsterte Theodora, und sobald Marocia diesen Namen hörte, reckte sie den Kopf. Tausend Male hatte ihre Mutter ihr Geschichten über Ageltrudis erzählt. Auch gestern wieder, vor dem Einschlafen. Die Herrscherin des Herzogtums Spoleto, das gleich neben dem Kirchenstaat lag, wurde von Theodora seit langem wegen ihrer Unerschrockenheit bewundert. Vorgestern hatte Ageltrudis – auf ausdrückliche Einladung des Papstes, wie es offiziell hieß– zusammen mit ihrem jungen Sohn Lambert die Stadt Rom mit einem Besuch überrascht und mehrere hundert Bewaffnete mitgebracht. Seither hatte man sie nicht mehr gesehen, vermutete aber, dass sie irgendwo im Lateran Quartier bezogen hatte. Der Papst und sie – war überall zu hören – planten etwas Spektakuläres.
»Im Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes«, hallte die Stimme Stephans VI. durch das Haus Gottes und unterbrach Marocias vergebliche Versuche, einen Blick auf die Heldin zu erhaschen. »Dies ist ein Tag des Gerichts. Und vor Gericht steht kein Geringerer als ein Heiliger Vater. Ich klage hiermit meinen Vorgänger Formosus an, und zwar der Missachtung und Entwürdigung seines Amtes als höchster Diener Christi auf Erden.« Stephan VI. ließ seine Worte wirken und beobachtete die Reaktionen.
Ein deutlich vernehmbares Raunen ging durch die Menge. Theodora flüsterte zu ihrem Mann: »Ist er verrückt geworden? Formosus ist seit neun Monaten tot.«
»Vielleicht will er böse Geister verjagen?«, orakelte Theophyl. »Man erzählt sich, dass der Papst schlecht träume, dass er nachts wie ein Verirrter durch die Gänge des Lateran laufe, weil er Formosus mit Gift umgebracht habe.«
»Ich glaube«, erwiderte Theodora, »dass dabei noch etwas anderes im Spiel ist, etwas Politisches. Ich verstehe nur nicht, wie er einen Toten …«
Sie wurde durch ein Klatschen Stephans VI. unterbrochen, auf welches hin sich die schwere Kirchenpforte öffnete. Eine von vier Mönchen getragene Sänfte erschien am Eingang, und auf ihr saß– ein verwester Leichnam.
Marocia schrie auf und verbarg ihr Gesicht im Gewand der Mutter.
Stephan VI. hatte befohlen, den Leichnam des Formosus aus seinem Sarkophag zu holen. Von dem ehemaligen Papst war kaum etwas zu erkennen; nichts war von ihm geblieben als Knochen, dicke Knorpel an den Ellenbogen und Knien sowie seine ergrauten Haare, die ihm in zotteligen Büscheln auf die blanken Schulterknochen fielen. Manche sackten auf die Knie und bekreuzigten sich, als der Leichnam an ihnen vorüberzog, einige Frauen fielen in Ohnmacht. Theodora aber fasste sich schnell und zog den Schopf ihrer Tochter aus dem Gewand. »Stell dich nicht so an. Du wolltest die Welt sehen, also sieh hin.« Als Marocia sich sträubte, hielt Theodora sie an den Haaren fest, so dass sie hinsehen musste.
Die Sänfte wurde vor dem Altar abgestellt. Stephan VI. entledigte sich seines päpstlichen Umhangs und der Tiara und kleidete das Skelett damit ein. Auf sein Zeichen hin kam ein blasser, kaum mündiger Diakon des Benediktinerordens herbei und stellte sich hinter dem thronenden Toten auf. Er sollte wohl im Namen des Formosus als Verteidiger agieren und antworten. Marocia, die noch immer von ihrer Mutter festgehalten wurde, zitterte beim Anblick des Schädels und der unter dem Umhang hervorstehenden Fußknochen.
»Formosus, Bischof und Metropolit von Rom!«, rief Stephan. »Warum hast du dich vom Ostfranken Arnulph verleiten lassen, ihn zum König der italischen Länder zu krönen?«
»Ich war schwach«, piepte es fast unhörbar hinter dem Leichnam hervor. Der kindliche Diakon war nicht originell in seiner Antwort, oder sollte es vielleicht auch nicht sein. Noch etliche Fragen wurden dem toten Papst gestellt, unzählige Verfehlungen beanstandet, von der Bestechlichkeit bis zur Sodomie, bis Stephan VI. von den anwesenden Geistlichen endlich ein Urteil abforderte: schuldig. Nach diesen Worten ging Stephan zur Leiche, entriss ihr Umhang und Tiara und scheute sich nicht, ihr die drei Schwurfinger der linken Hand abzubrechen.
»Damit enthebe ich dich, Formosus, rückwirkend deines Papstamtes, und alle Edikte, Bullen, Verordnungen und alle sonstigen Amtshandlungen sind unwirksam, einschließlich der Krönung des Karolingers Arnulph zum König Italiens. Arnulph ist abgesetzt, und die Krone ist frei. Du selbst bist geächtet und gebannt, und ein jeder, der dir Übles tat, der tat recht.« Wenige Augenblicke später kniete Ageltrudis’ Sohn Lambert, der Herzog von Spoleto, nieder und empfing von Stephan VI. eine neue, funkelnde Königskrone.
»Gott, war das widerlich«, stöhnte Theophyl, als sich die Pforten der Laterankirche öffneten und die Zeremonie damit beendeten. »Werden wir denn nur von Abartigen regiert?«, rief er zu den Gewölben hinauf.
Theodora sah sich um und hoffte, dass keiner der anderen Edlen Theophyls Worte beachtet hatte. In Rom hörten die Menschen besser als irgendwo anders, und die Würdenträger hörten am besten von allen, immer auf der Suche danach, das Amt eines politisch oder im Glauben Fehlgeleiteten übernehmen zu können. »Gott ist nicht hier«, zischte sie, »dafür aber jede Menge menschlicher Ohren. Sei leiser.«
»Wozu? Sie denken alle wie ich.« Es war ein trauriger Tag für die Ewige Stadt und Italien, dachte Theophyl, und jeder anständige Römer würde darin seiner Meinung sein. Der Versuch des ostfränkischen Königs Arnulph, die italischen Staaten auf friedliche Weise in den Verbund der deutschen Stämme zu führen und so die Entstehung eines neuen Reiches zu fördern, war mittels dieses makaberen Auftritts gescheitert. Von jetzt an war Arnulph nicht länger König von Italien, und Italien daher wieder der Gegenfraktion ausgeliefert. Ageltrudis! Ihr Hass gegen die Ostfranken, insbesondere gegen das karolingische Königshaus, grenzte an Irrsinn. Aber sie war nur die Herrscherin eines italischen Teilstaates, Spoleto, und vermochte alleine wenig auszurichten. Doch hinter ihr stand eine ganz andere Macht: das autoritäre Byzantinische Imperium, das Italien als sein Einflussgebiet ansah und dessen Eifersucht auf das aufstrebende Reich des Nordens offensichtlich auch nicht vor einer Grabschändung Halt machte. Und Theodora verteidigte diese Abscheulichkeit auch noch!
»Ich gebe es ja zu«, flüsterte sie und rückte die zahlreichen Ringe an ihren gepflegten Händen zurecht. »Es war eine absonderliche Synode. Aber sie war auch sinnvoll. Ageltrudis und ihr Sohn sind Verbündete des Imperiums und …« Theodora redete und redete, wie immer, wenn Ageltrudis das Gesprächsthema war.
Schmerzlich dachte Theophyl an die Frau zurück, die er einmal geheiratet hatte. Theodora, Tochter einer reichen Adelsfamilie aus Tusculum, hatte eine beachtliche Mitgift in die Ehe eingebracht, aber das war es nicht, was Theophyl bewogen hatte, sie zu heiraten. Sie war stolz, neugierig und impulsiv gewesen – alles das, was er nicht war. Die ersten Jahre mit ihr waren die glücklichsten seines Lebens. Was Theodora dann zu dem gemacht hatte, was sie heute war – er wusste es nicht. Jedes Gefühl hatte sie dem Streben nach Macht geopfert, jede ihrer und anderer Leute Überlegungen prüfte sie danach, ob sie den Richtlinien des Byzantinischen Imperiums entsprachen. Nun, es war eine Sache, vor diesen Verbrechern den Rücken zu beugen, wie er es in seinem Amt tun musste und wie die meisten anderen Würdenträger Italiens es taten, aber eine ganz andere Sache, mit ihnen einer Meinung zu sein.
Er sah seine Tochter an, nahm ihre Hand und drückte sie gerade so fest, dass es ihr nicht wehtun würde. Ihm fiel schmerzlich auf, wie verstört sie aussah, doch ein leichter Stoß von Theodora riss ihn wieder aus seiner Sorge um das Mädchen heraus.
»Ageltrudis schaut schon herüber«, zischte sie. »Du musst ihrem Sohn gratulieren. Und dem Papst.«
»Diesem Leichenschänder gratulieren? Niemals!« Aber kaum hatte Theophyl es ausgesprochen, wusste er auch schon, dass er es dennoch tun würde. Es waren gefährliche Zeiten. Die Herzogin und ihre Lakaien vom Lateran achteten auf alles, was man tat und was man nicht tat. Theophyl gönnte sich ein letztes Streichen seines Bartes, bevor er seiner Frau den Arm darbot und mit seiner üblichen, leicht nach vorne gebeugten Körperhaltung den schweren Gang antrat.
Ageltrudis und ihr Sohn standen noch dort, wo Lambert die Krone empfangen hatte, und waren umringt von Gratulanten. Die Älteren unter ihnen verbeugten sich gemessen oder begnügten sich mit einem knappen, ruckartigen Kopfnicken, bevor sie sich wortlos, aber mit Zügen des Abscheus auf ihren Lippen wieder entfernten. Die Jüngeren hingegen, die ihre Laufbahn noch vor sich hatten, die sich Pfründen vom Papst oder Ämter von der Herzogin und ihrem nun königlichen Sohn erhofften, hatten allen Schauder vergessen und übten sich bereits wieder in überschwänglichen Gesten. Sie lüfteten ihre modischen schiffförmigen Hüte, streckten sie übertrieben weit in die Höhe oder zur Seite, schwangen ihre farbigen Umhänge, schwatzten wild durcheinander auf die Machthaber ein und drängelten sich wechselweise zur Seite, so dass der Haufen vor Ageltrudis waberte wie eine dickflüssige Giftbrühe.
Die Frauen hingegen in ihren langen mantelartigen Kleidern scharten sich auf der anderen Seite des Kirchenschiffs zusammen. Einige reckten gespannt die Köpfe zu ihren Männern und feuerten sie mit aufgerissenen Augen und stummen, heftigen Bewegungen der Hände an, wenn ihnen die Ehrenbezeugungen noch zu fad vorkamen. Die meisten jedoch hielten den Blick gesenkt und trösteten ihre verstörten oder schluchzenden Kinder.
Theodora erlegte sich eine solche weibliche Zurückhaltung nicht auf. Ageltrudis, das wusste sie, schätzte Selbstbestimmtheit an Frauen. Zwar würde es heute wegen des Gedränges kaum möglich sein, einen bleibenden Eindruck bei der Herzogin zu hinterlassen, vielleicht aber konnte sie einen Anfang machen. Wenn sie nur dicht genug an Ageltrudis herankäme …
Sie packte trotz Theophyls Protesten Marocia an den Schultern und schob sie wie einen Schild vor sich her. Dabei bemerkte sie den Sand auf den Schultern ihrer Tochter. »Wie siehst du denn aus?«
Marocia fiel es schwer, zu antworten. Sie fror, und doch stand ihr Schweiß auf der Stirn. »Dort drüben, wo ich stand, Mutter … Wie Goldregen rieselt …«
»Ja, ja, schon gut.« Sie hatten sich endlich einen Weg zu König, Herzogin und Papst gebahnt und standen ihnen gegenüber. Ihre Gratulationen gingen zwar in dem Geschwätz fast unter, aber dafür wurde Ageltrudis sofort auf das einzige kleine Kind inmitten dieser Horde aufmerksam.
»Meine Tochter, Durchlaucht«, erklärte Theodora, als sie das Interesse der Herzogin bemerkte.
Marocia sah zu Ageltrudis auf. Sie hatte sich die sagenhafte Heldin ihrer Mutter anders vorgestellt. Die vielen Geschichten von einer kämpferischen Frau, die ein Bündnis mit dem Oströmischen Imperium in Byzanz geschlossen hatte, die sich weder von den Päpsten noch von den jenseits der Alpen herrschenden Karolingern etwas gefallen ließ, hatten in Marocia das Bild einer jungen Amazone im Harnisch heraufbeschworen. Aber nun blickte sie auf ein kalkweißes altes Gesicht, das an eine Totenmaske erinnerte und von den kupferfarbenen Haaren und der pompösen Kleidung noch betont wurde. Sie leistete sanften Widerstand, als Ageltrudis sie an sich zog und ihr mit kalter, zittriger Hand über die Haare streichelte.
»Wie ist ihr Name?«, fragte die Herzogin. Ihre Stimme war rau und heiser.
Theodora nannte ihn. »Wir haben noch einen Sohn, Durchlaucht, doch der konnte …«
Ageltrudis unterbrach. »Marocia, sagt Ihr? Das kommt von Maria, nicht wahr? Nun, meine kleine Jungfrau«, wandte die Herzogin sich jetzt direkt an das Mädchen. »Wie hat dir unsere Krönung gefallen, sag mir das.«
Marocia verstand nichts von den Dingen, die sie eben gesehen hatte, war aber überzeugt, dass Leute, die Toten die Finger brachen oder so etwas gut fanden, nicht Recht haben könnten. Die Krönung hatte sie überhaupt nicht wahrgenommen. Ihre Gedanken drehten sich nur noch um das Skelett. »Was passiert jetzt mit … mit ihm?«, fragte sie laut, weil die Horde noch immer auf König Lambert einredete.
Sofort breitete sich Schweigen aus. Wo eben noch König und Papst hofiert worden waren, blieb es nun still und starr. Jeder wusste, wer gemeint war, und alle richteten ihre Blicke auf die alte Herzogin und das kleine Kind, das es gewagt hatte, eine solche Frage zu stellen. »Sei still«, zischte Theodora. »Dummes Ding.« Würde Ageltrudis die Kleine nicht mit ihren Fingern umkrallen, könnte ihre Tochter jetzt eine Tracht Prügel erleben.
»Gott hat Formosus vernichtet«, krächzte Ageltrudis schließlich. Sie hustete heftig und bog sich verkrampft, dann fügte sie hinzu: »Und der Teufel wird sich ihn nun holen.«
Der Papst hatte eine weniger geheimnisvolle Antwort. »Er wird in den Tiber geworfen«, kicherte er. »Endlich wird er für alle Zeiten schweigen, niemanden mehr stören. Alle haben es gesehen, auch die Kinder. Noch in Jahrzehnten wird man davon reden, und mein Pontifikat wird als eines der größten in die Bücher geschrieben werden.«
Ageltrudis schob Marocia wieder von sich weg und sah den Papst an. Sie verzog den blutrot geschminkten Mund zu einem falschen Grinsen. »Wie schön, Heiligkeit. Also hat jeder von uns das bekommen, was er wollte. Nun aber muss jeder für sich selbst sehen, dass er es auch behält.«
Ein unheimliches Grollen ließ alle aufhorchen. Es wurde lauter und lauter, und dennoch konnte niemand genau sagen, woher es kam. Manche blickten aus den kleinen Kirchenfenstern in der Erwartung eines Gewitters in den Himmel, andere vermuteten, dass draußen eine große Anzahl Reiter vorbeipreschte. Doch das Grollen verstärkte sich, ohne dass man die Ursache dafür fand. Theodora war seit langer Zeit zum ersten Mal wieder dankbar dafür, dass Theophyl sie beschützend um die Schultern fasste. Er zog sie mit einer Hand an sich und hielt mit der anderen Marocia fest.
»Gott!«, rief plötzlich ein am Altar stehender Mönch mit irrer Stimme. »Gott bestraft uns!«
Stephan VI. war der Erste, der das knarrende, ja fast stöhnende Geräusch aus dem Nichts nicht mehr aushielt und die Hände gegen die Ohren presste. Die Masse um Ageltrudis löste sich nun rasch auf, die Herzogin selbst brach in heftiges, aufgeregtes Husten aus und musste von ihrem Sohn gestützt werden. »Lauft!«, rief jemand von irgendwoher. »Um Himmels willen, lauft!« Augenblicke später krachte ein schwerer Gesteinsbrocken aus dem Gewölbe, gleich darauf ein zweiter und ein dritter. Die Menschen kannten kein Halten mehr. Sie drängten zur Pforte, die jedoch schnell von Leibern verstopft war. Kinder wurden niedergetrampelt, Ältere zur Seite geschoben. Wildes Geschrei übertönte das Donnern einstürzender Mauern. In alle Richtungen liefen die Leute nun davon. Manche schlugen die Kirchenfenster ein und versuchten, ins Freie zu klettern. Andere rüttelten an den verschlossenen Seiteneingängen oder versuchten, sie mit ihrem Körpergewicht einzudrücken.
Theophyl nahm Marocia auf den Arm und lief zum Altar. Unter der schweren Steinplatte fühlte Theophyl sich sicher, und tatsächlich hielt sie mehreren Aufschlägen niederstürzender Quader stand. Er betete die Litanei der Fürbitten herunter, wieder und wieder, bat für Marocia, für sich, für Theodora. Sie war ihm in dem Gewimmel verloren gegangen, aber Marocia hatte gesehen, wie sie mit Ageltrudis und dem König in eine andere Richtung gerannt war. Stattdessen kauerte sich nun der Papst an ihre Seite. Sein Gesicht war gelb von Staub, sein Körper zitterte, und er blinzelte unentwegt mit den Augen. Abwechselnd kicherte und jammerte er, und seine irren Gebärden machten Marocia mehr Angst als das Unglück um sie herum.
Nachdem Theophyl die Litanei viermal gebetet hatte, hörte der Lärm auf und wich einem elenden Stöhnen. Marocia kroch als Erste unter der Platte hervor. Über ihr breitete sich ein klarer Novemberhimmel aus, nur getrübt durch die Schleier aufsteigenden Staubes. Die nahe gelegenen Häuser waren intakt geblieben. Doch dort, wo sich eben noch die ehrwürdige Laterankirche erhoben hatte, stand jetzt nur noch eine Ruine. Und zwischen den Hügeln aus grauen Gesteinsbrocken leuchteten die bunten Farben kostbarer Gewänder hindurch.
Ein schriller, lang gezogener Schrei hallte durch die nächtliche Dunkelheit der Villa Sirene, dann ein zweiter, kürzerer, schließlich ein dritter, ein erschöpftes Piepsen fast nur. Marocia saß aufrecht in ihrem Bett. Ihre kleinen Hände suchten in der Schwärze des Zimmers aufgeregt nach einem Halt, nach einer Latte oder einer Wand. Doch sie fanden nichts dergleichen. Das Bett, ein teils hölzernes, teils schmiedeeisernes Gestell, war kostbar gearbeitet und mit einer weichen, aus Fellen und Wolle gestopften Matratze ausgestattet, aber es stand mitten im Raum und war ohne Kopf-, Fuß- oder Seitenteile. Marocia sprang auf und flüchtete sich in eine Ecke des Zimmers, die vom schwachen Mondschein in ein diffuses Licht getaucht wurde. Hier kauerte sie am Boden, bis die Tür aufging und eine Gestalt mit einer Kerze hereinkam.
»Bist du es, Mama?«
»Nein, ich bin es nur. Egidia.« Die Amme raffte ihr weites, sackartiges Nachthemd etwas hoch, so dass ihre fülligen Beine bis zu den Knien frei waren, und setzte sich umständlich neben Marocia auf den Boden. Dann seufzte sie, strich sich ihre dünnen braunen Haare aus der Stirn, stellte die Kerze neben sich ab und küsste Marocia auf die Wange.
»Mama!«, beharrte Marocia und ergriff Egidias dargebotene Hand. »Du bist da.«
»Hast wieder geträumt?«, fragte Egidia.
»Der Papst. Ageltrudis. Theodora.«
»Sie leben«, erklärte Egidia geduldig, obwohl sie es der Kleinen in den vergangenen Wochen gewiss schon zwanzigmal wiederholt hatte, fast in jeder Nacht. »Musst dir keine Gedanken um sie machen. Niemand, den wir kennen, ist beim Einsturz der Kirche gestorben. Darfst dich nicht länger ängstigen, mein Kleines.«
»Der Papst. Ageltrudis. Theodora.«
»Es geht ihnen gut«, bestätigte Egidia sanft und wischte Marocia die Schweißperlen von der Stirn. »Träume nicht schlimm von ihnen, Kleines.«
»Ich träume nicht von ihnen«, sagte Marocia und blickte ins Mondlicht. »Es ist das … der … der …«
Egidia bekreuzigte sich. Auch sie brachte den Namen nicht mehr über die Lippen. Zum einen hatte der Heilige Vater verfügt, dass sein verurteilter Vorgänger aus dem Gedenken der Menschen zu löschen sei, und Egidia tat immer, was die Heiligkeiten verlangten, auch wenn sie die Entscheidungen nicht immer guthieß. Aber sie war doch nur ein einfaches Ding, während die Väter voller Weisheit waren. Sonst hätte Gott sie schließlich nicht auf seinen weltlichen Thron berufen. Dieses Mal jedoch fiel Egidia die Befolgung der päpstlichen Anordnung nicht schwer, denn der Name des unheiligen, geächteten Vaters war mit der schaurigsten Vorstellung verknüpft, von der die Christenheit je betroffen war. »Weiß schon, Kleines«, tröstete Egidia. »Musst mir nichts sagen.«
Marocia warf sich der Amme in die Arme. Sie liebte es, ihre Wärme zu spüren, ihre rundliche Weichheit, ja sogar ihr borstiges Nachthemd. Wenn sie den seifigen Duft ihrer Haut roch, fühlte sie sich geborgen, als könnte ihr niemand etwas antun. Allein Egidias helle Stimme zu hören und ihren plumpen Bewegungen zuzuschauen, gab ihr das Gefühl, zu Hause zu sein, in ihr ihre wirkliche Mutter zu haben. Nur ihr allein konnte sie sich anvertrauen. »Weißt du was? Ich hasse sie«, sagte Marocia. »Den Papst. Ageltrudis. Theodora. Sie sind schuld, dass ich ihn sehe.«
Egidia schreckte auf. »Du … Jesus und alle Heiligen! Darfst so etwas nicht sagen.« Sie bekreuzigte sich und schaute Marocia eindringlich in die Augen. »Darfst so etwas auch nicht denken. Deine Mutter hassen! Die Heiligkeit hassen!«
»Magst du sie denn?«
»Fragen kannst stellen, du lieber Himmel.«
»Also?«
»Nicht mögen ist eine Sache. Hassen …«
Marocia gähnte gedehnt und schmiegte sich an Egidias Brüste. Mit halblauter, müder Stimme sagte sie: »Sie behaupten, Gott habe … habe ihn vernichtet. Nein, nein. Gott macht so etwas nicht. Gott macht gar nichts. Sie waren es. Irgendwann werden sie dafür bestraft. Aber nicht von Gott …«
Egidia drückte ihre Kleine noch fester an sich. Was für eine Zeit, in der kleine Kinder solche schrecklichen Dinge erleben mussten. Aber es stimmte ja, was das Mädchen ahnte. Auf den Märkten, in den Tavernen, in den Winkeln der Gassen schimpften die Leute auf die Heiligkeit und die Edlen. Der Einsturz der Laterankirche, munkelten sie, sei dem Zorn des geschändeten Formosus zuzuschreiben, und weitaus Schlimmeres würde die Ewige Stadt heimsuchen, wenn der Verfemte nicht gerächt und alle Überlebenden des Einsturzes getötet würden. Neulich hatte der Gehilfe des Holzhändlers ihr zugeflüstert, es wäre besser für sie, aus dem Haushalt des praetor urbanus zu verschwinden, solange es noch ginge. Und nach Einbruch der Dämmerung rannten gelegentlich Männer an der Villa vorbei und riefen: »Ihr seid auch mit dran, wenn es soweit ist!« Doch hier im Haushalt wurden diese Anzeichen nicht ernst genommen. Verhaften und aufhängen, war Theodoras einziger Kommentar zu solchen Vorfällen, und sie nutzte sie bloß, um mit ihrem Mann, dem milden Richter, einen weiteren Streit anzufangen.
Egidia fasste sich an die Kehle. »Wird alles gut, mein Töchterchen«, murmelte sie beschwörend in das Dunkel hinein, wieder und wieder, auch als Marocia längst in ihren Armen eingeschlafen war.
2
Theodoras Sandalen klackten auf dem Marmor wie Pferdehufe, als sie über die Mosaike ihrer Villa in der Via Lata eilte und Kardinal Sergius mit ausgestrecktem Arm entgegenlief.
»Eminenz! Was für eine Freude! Euer zehnter Besuch in fünf Monaten. Unser Haus scheint etwas Faszinierendes zu haben.« Obwohl Theodora sich im achten Monat der Schwangerschaft befand und sie sich außerdem Mühe geben musste, ihr wissendes Grinsen zu verbergen, leistete sie den Knicks und den Kuss seines Ringes formvollendet.
»Faszinierend sind die Menschen, die in ihm leben«, entgegnete Sergius höflich und klappte seinen stämmigen, ungelenken Oberkörper zu einer ungewöhnlich tiefen Verbeugung herunter.
Theodora führte ihren Gast in das peristyl. Einen solchen antiken Garten, rings umgeben von einem Säulengang und den Wohnräumen der Villa, hatten nur noch wenige Häuser in Rom vorzuweisen. Die Villa Sirene war schon mehr als fünfhundert Jahre alt und nach allem, was man wusste, noch von einem Senator der heidnischen Kaiserzeit errichtet worden. Zwar hatte es immer wieder Umbauten und Renovierungen gegeben, das peristyl jedoch war erhalten geblieben. Heute, da es kaum noch ältere herrschaftliche Häuser in der Ewigen Stadt gab, galt ein peristyl als Symbol von Tradition, und Theodora präsentierte ihren deshalb, wann immer es möglich war.
Die quadratische Anlage war feierlich umrahmt von gelben und pfirsichfarbenen Rosensträuchern, deren Ordnung hier und da von einigen violetten Fliederbüschen unterbrochen wurde. Von dieser schweren Pracht durch einen Kiesweg getrennt, wetteiferten durcheinander gepflanzte Gewächse wie Mohn, Fingerhut und Sonnenblume um das Sonnenlicht. Zu dem plätschernden Brunnen in der Mitte war ein Orangenbaum gesellt worden, der hoch genug war, um wohltuenden Schatten zu spenden und sogar einem Vogelpaar als Nistplatz zu dienen. Die träumerische Atmosphäre jedoch wurde dem Garten von den zwei halb verwitterten Statuen eines Mannes und einer Frau verliehen, von denen niemand mehr wusste, wer sie gewesen waren.
Amüsiert beobachtete Theodora, wie der Kardinal sich förmlich auf die Bank zwischen den Statuen setzte und die Hände auf dem geistlichen Gewand ineinander verknotete. Was für ein Unterschied zu ihrem Geliebten, dem Erzbischof Johannes! Kardinal Sergius war Anfang dreißig und damit nur sechs oder sieben Jahre älter als Johannes, aber sein vornehmer Habitus und der steife Gesichtsausdruck ließen ihn wie einen alten Mann wirken. »Edle Theodora«, begann er mit einem höflichen Kopfnicken. »Ich habe mir erlaubt, ein halbes Dutzend Bewaffnete mitzubringen, über die Ihr in den nächsten Wochen verfügen könnt. Die Unruhe in der Stadt wächst beständig.«
Theodora schmunzelte. »Sehr aufmerksam, Eminenz. Aber ein wenig Aberglaube stellt wohl keine Gefahr dar. Die Laterankirche war schon lange baufällig und ihr Einsturz eine Frage der Zeit. Das Volk wird das einsehen müssen.«
»Ich bitte Euch«, erwiderte Sergius. »Schlagt den Schutz nicht aus, schon wegen Eurer Kinder.«
Theodora hatte diese Bemerkung erhofft. Bei Sergius’ ersten Besuchen kurz nach der Synode hatte sie noch geglaubt, es handle sich um die Höflichkeit eines päpstlichen Beraters gegenüber dem praetor urbanus. Als die Besuche nicht abrissen, mutmaßte sie, dass ein Mann, der es so weit gebracht hatte wie Sergius, nichts aus purer Höflichkeit unternahm und somit irgendein vertracktes politisches Motiv hinter seinen Aufwartungen steckte. Dann war ihr aufgefallen, dass er immer jene Zeiten wählte, in denen er sicher sein konnte, dass Theophyl nicht zu Hause war, weil er irgendeinen Prozess leitete. Wollte er sie Johannes ausspannen? Er und Johannes waren zwar beide Gefolgsleute des Bündnisses zwischen Rom, Spoleto und Byzanz, aber sie wetteiferten um den Anspruch, eines Tages Papst zu werden.
Erst bei seinem letzten Besuch war es ihr dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Amme hatte Leon und Marocia für einen Gute-Nacht-Gruß vorbeigebracht. Theodora hatte sofort den Blick bemerkt, den Sergius auf das Mädchen warf. Er war offensichtlich völlig vernarrt in Marocia. Auf der Synode musste er sie gesehen haben, und alle seine Besuche waren nur von der Hoffnung motiviert, noch einmal dieses Kindes ansichtig zu werden.
Nicht eine Minute lang hatte Theodora Bedenken gegen die Faszination des über dreißigjährigen Mannes für ihre sieben Jahre alte Tochter. Entscheidend war, dass er eine einflussreiche Position hatte und ein Gefolgsmann von Ageltrudis war. Mein Gott, was war schon dabei, wenn er es liebte, das Kind anzusehen? Seine eigenartige Zuneigung war nichts anderes als ein glücklicher Umstand, der ihr nur Vorteile bringen konnte. Deshalb hatte sie vorhin, gleich, nachdem der Diener ihr gemeldet hatte, dass Sergius im Atrium warte, der Amme Befehl gegeben, Marocia einige Minuten später in das peristyl zu schicken. Sie musste jeden Moment eintreffen.
»Meine Kinder, ach ja«, rief Theodora kummervoll. »Sie verdienen wahrhaft, behütet zu werden. Vor allem Marocia, nicht wahr? Ist sie nicht wie eine …« Sie suchte scheinbar nach einem Wort, dann stand sie auf und tänzelte trotz ihrer hohen Schwangerschaft einige Schritte bis zu den gelben Rosen. »Ist sie nicht wie eine dieser Blüten? So rein, so königlich?« Mit einer schnellen Handbewegung fuhr sie in den Rosenbusch und rupfte eine der schweren Blütendolden ab und roch daran.
Ein gedehntes Räuspern unterbrach die Gesprächspartner. »Hier!«, sagte Egidia mürrisch. »Habe Euch Marocia gebracht, Herrin. Wie befohlen.«
»Gut«, sagte Theodora. Sie hatte einige Mühe, Marocias Hand Egidias festem Griff zu entwinden. »Es ist gut«, wiederholte sie scharf und machte eine abweisende Geste.
Widerwillig entfernte Egidia sich einige Schritte, dann besann sie sich anders, blickte abwechselnd den Kardinal und Theodora an und presste empört hervor: »Muss Euch aber sagen, dass es schlecht ist, die arme Kleine derart vorzuführen, kaum dass es ihr ein bisschen besser …«
Ein völlig unmissverständlicher Blick Theodoras brachte die Amme dazu, zu schweigen. Erst, als Egidia das peristyl verlassen hatte, wandte Theodora sich wieder ihrem Gast zu. Wie zur Begutachtung stellte sie Marocia vor den Kardinal.
»Was meinte die Amme damit«, fragte Sergius, »als sie sagte, es sei Marocia nicht gut gegangen?«
»Was weiß das dumme Weib schon?«, winkte Theodora ab. »Seht Euch meine Kleine doch an. Sieht sie etwa nicht gesund aus?« Sie bemerkte zufrieden, wie Sergius’ ausdruckslose hellbraune Augen plötzlich etwas Weiches und Sanftes bekamen, und sie trat einige Schritte zur Seite, damit er Marocia ungehindert zulächeln konnte.
Sergius ging mit seinem weiten Gewand vor Marocia in die Hocke und sah sie eine Weile an. War dieses Mädchen glücklich? Freute sie sich über seinen Besuch? Mochte sie ihn? Er wünschte es sich mehr als alles andere, aber er war kein Menschenkenner. Oft übersah er die deutlichsten Zeichen einer Gemütsregung. Vielleicht lag es daran, dass er kein geselliger Mensch war, dass er weder wie der eine Teil des höheren Klerus weltliche Vergnügungen auf nächtlichen Gelagen suchte noch wie der andere Teil das Zusammensein mit Gläubigen. Am liebsten war er mit sich allein.
Nur dieses Mädchen berührte Sergius. So etwas passierte ihm zum ersten Mal. Ihre großen schwarzen Augen konnten scheinbar unendlich lange einem Blick standhalten, und ihr rundliches, oft ausdrucksloses oder beherrschtes Gesicht war ihm ein Geheimnis. Zaghaft streckte er seinen Arm aus und ergriff einen ihrer Ohrringe, in dessen silberne Fassung eine winzige schwarze Perle eingearbeitet war. »Sehr hübsch. Ist das dein liebster Schmuck?«
Theodora antwortete aus dem Hintergrund für ihre Tochter. »Ich habe ihn anfertigen lassen, Eminenz. Die dunklen Farben stehen Marocia am besten.«
Sergius ging nicht weiter darauf ein. Seine Fingerspitzen strichen nun vorsichtig an einigen der schwarzen Strähnen entlang. »Du hast, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, deine Haare hochgesteckt, junge Dame. War das deine Idee?«
»Leider redet sie sehr wenig«, bedauerte Theodora sofort. »Es hat aber nichts mit Euch zu tun, Eminenz, denn zu uns ist sie nicht anders. Den lieben Tag spricht sie bisweilen nur zehn Worte, schaut aber viel herum und beobachtet alles, was man tut. Neugierig ist sie und …«
»Vielleicht kommt sie nicht dazu, etwas zu sagen«, unterbrach der Kardinal seine mitteilsame Gastgeberin.
Für einen flüchtigen Moment huschte ein Lächeln über Marocias Mund, und diese flüchtige Geste stillen Einverständnisses war genug, um Sergius glücklich zu machen. Sichtlich entspannt richtete er sich auf. »Im Übrigen«, fügte er an Theodora gewandt hinzu, »habe ich die Erfahrung gemacht, dass nicht die Menge des Gesagten wichtig ist, sondern der Inhalt. Mir jedenfalls gefällt ihr Schweigen.«
»Nun, wenn das so ist …«, bemerkte Theodora und überreichte dem Kardinal den Rosenzweig, den sie vorhin gepflückt hatte. Sie hatte allen Grund, zufrieden zu sein. Ihre Tochter würde fortan ein hervorragendes Pfand für Sergius’ Wohlwollen gegenüber ihrer Familie sein. Vielleicht würde man es eines Tages brauchen.
Sergius war gerade im Begriff, sich mit Theodora und Marocia auf die Bank zu setzen, als einer der Bewaffneten in das peristyl stürmte. »Herr, Herr!«, rief er. »Der Mob – er stürmt den Lateran. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Überall werden Edle erschlagen.«
Sofort entstand ein großes Durcheinander. Hausdiener, Zofen und Bewaffnete liefen richtungslos im Haus umher. Egidia kam mit dem weinenden Leon herbeigeeilt. »Wo ist der Herr?«, rief sie. »Im Gericht? Wird ihm dort doch hoffentlich nichts geschehen, Eurem Gemahl?«
»Du hast Sorgen!«, rief Theodora verzweifelt. »Sein Gerichtsgebäude ist wie eine Festung gebaut. Sag mir lieber, wo wir uns verstecken sollen. In der Speisekammer? In der Latrine vielleicht? Oder hier, zwischen den Rosen?«
»Hier können wir nicht bleiben«, ging Sergius mit energischem Tonfall dazwischen, den ihm niemand zugetraut hätte. »Meine Wache allein kann gegen den Mob nichts ausrichten. Wir müssen mit allen Bewohnern der Villa zum Lateran durchbrechen. Euer Mann wird das Gleiche versuchen.«
»Ich soll auf die Straße?«, rief Theodora. »Wo der Pöbel marodiert? Und nur mit«– sie zeigte auf sein geistliches Gewand –»mit Euch und den paar Männern? Das ist doch Wahnsinn!«
Die umstehenden Hausdiener stimmten ihrer Herrin raunend zu. Hier in der Villa würden die Aufständischen, deren Wut sich nur gegen die Edlen richtete, den Dienern nichts tun. Sie gehörten doch selbst zu den einfachen Leuten, trugen die gleiche grobe Kleidung wie sie, hatten die gleiche ledrige Haut, ja teilten sogar ihre Furcht vor der Rache des ausgegrabenen, verstümmelten Papstes. Vielleicht würde die Villa verwüstet und angezündet, vielleicht die Herrin erschlagen, aber ihnen selbst würde kein Rebell etwas zuleide tun. Da draußen aber würden sie, umringt von Bewaffneten und in Begleitung des Kardinals, wie Verbündete der Edlen wirken.
»Wir bleiben hier!«, meinten einige von ihnen. Und andere schimpften: »Kümmert Euch um Eure Sachen, wir wissen selbst am besten, was gut für uns ist.«
Sergius hob die Augenbrauen. »Hört zu«, rief er. »Ich rechne mir aus, dass die Rebellen den Lateran bereits erfolgreich gestürmt und dort gewütet haben. Bald werden sie sich auf die Residenzen der Edlen stürzen. Wenn wir also dorthin gehen, wo die Marodeure schon gewesen sind, wird die Gefahr am geringsten sein. Für uns alle. Denn glaubt mir, der Mob macht keinen Unterschied zwischen den Edlen und denen, die ihnen dienen.«
Doch die Leute hörten nicht. Einige liefen davon, bevor die Bewaffneten sie zurückhalten konnten, andere setzten sich demonstrativ mit verschränkten Armen auf den Boden. Nur Egidia blieb an der Seite des Kardinals, Leon und Marocia mit ihren schweren Armen umfassend.
»Hast du Angst?«, fragte Sergius das Mädchen und strich ihm tröstend über die Haare.
Marocias Herz schlug bis zur Kehle. Ihr war noch lebhaft in Erinnerung, wie beim Einsturz der Kirche vornehme Edle in Panik zu Ungeheuern geworden waren. Nun stellte sie sich die Fratzen der Besessenen da draußen vor: glühende Kohlen in den Augenhöhlen, gefletschte Zähne und geballte Fäuste. Sie blickte kurz zu ihrer Mutter, die neben ihr stand, die Hände rang und hektisch nach allen Seiten blickte, so als suche sie dort irgendwo einen Ausweg. Daraufhin krampfte sich Marocias Hand um die ihrer Amme, doch ihr Kopf hob sich gelassen und voll Stolz.
»Sehr Ihr«, sagte Sergius zu Theodora. »Wenn Eure Tochter den Mut hat, findet Ihr ihn doch auch, oder?«
Sergius wartete ihre Zustimmung nicht ab, sondern erteilte sofort einem seiner Bewaffneten den Befehl, aus der Stadt auszubrechen und nach Spoleto zu reiten, um der Herzogin Bericht zu erstatten. Die fünf anderen Milizionäre, wenig genug, bildeten einen Ring um die Frauen und Mädchen. Der Kardinal selbst blieb, mit einem langen Kücheneisen bewaffnet, dicht bei Marocia. So gingen sie hinaus, auf die Via Lata.
Anfangs kamen sie gut voran. Die wenigen Menschen, die ihnen begegneten, rannten an ihnen vorbei, und überall waren die schweren hölzernen Fensterläden geschlossen und die Türen verrammelt. Einige der herrschaftlichen Häuser brannten anscheinend bereits, denn dichter Qualm drang aus ihnen heraus, aber da die Straßen hier breit und übersichtlich waren, konnten Sergius und die anderen diese Brände gut umgehen. Weiter östlich, jenseits der Foren, trafen sie auf sieben Soldaten, die herrenlos durch die Straßen irrten und sich nun dem Kommando des Kardinals unterstellten. Derart gestärkt, trauten sie sich sogar dicht am Kolosseum vorbei, aus dem die heftigen Reden und das Beifallsgeschrei des aufgebrachten Volkes drangen.
Als sie jedoch an den mehrstöckigen Gebäuden der ärmeren Römer vorbeikamen, wurden sie beschimpft und aus den Fenstern mit allen möglichen Gegenständen und sogar Lebensmitteln beworfen. Ein schwerer Kohlensack streckte einen der Soldaten nieder, und ein Tongefäß traf Leon an der Schulter, woraufhin der Kleine so laut und andauernd weinte, dass Egidia ihm den Mund zuhalten musste, damit er nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf die Gruppe lenkte.
Bald war auch Theodora den Tränen nahe. Beschimpft und beworfen zu werden zerrte an ihren Nerven. »Wir hätten nie die Villa verlassen dürfen«, klagte sie. »Der Pöbel wird uns zerreißen. Oh, diese Tiere. Diese undankbaren Scheusale.«
»Ich bitte Euch«, entgegnete Sergius. »Behaltet die Fassung. Seht Marocia an. Sie zeigt weniger Angst als Ihr.«
Theodora war es mittlerweile leid, ständig mit ihrer Tochter verglichen zu werden. Eine heftige Erwiderung lag ihr auf der Zunge, aber sie kam nicht mehr dazu, sie dem Kardinal entgegenzuschleudern, denn eine Gruppe Aufständischer versperrte ihnen in einer engen Gasse den Weg. Ohne Zögern befahl Sergius der Hälfte seiner Männer vorzurücken. Die Lanzen in Angriffshaltung, stürmten die Soldaten nach vorne und streckten mit ihren ersten Stößen eine ganze Reihe Aufständischer zu Boden. Doch die Gegner wehrten sich, und in der Enge der Hauswände gewannen sie mit ihren einfachen, aber beweglichen Waffen, den Dolchen, Halbschwertern und Schmiedehämmern, die Oberhand über die Soldaten mit ihren repräsentativen, aber umständlichen Lanzen. Nun griff der Rest von Sergius’ Männern in den Kampf ein und brachte den Umschwung. Die Aufrührer mussten weichen. Je ungeordneter sie sich zurückzogen, desto mehr von ihnen blieben von Lanzen durchbohrt auf dem Pflaster zurück.
Über Verwundete und Leichen steigend gelangten Sergius, Theodora, Egidia und die Kinder schließlich unbeschadet auf den lateranischen Hügel. Dort bot sich ein Bild der Zerstörung. Der Platz vor dem Papstpalast war an mehreren Stellen aufgerissen, die schweren Pflastersteine hatten als Wurfmittel gedient. Vereinzelt lagen tote und verwundete Bürger, Mönche und Soldaten herum. Egidia machte sich sofort daran, einige der Verletzten zu versorgen, Theodora jedoch zog nur ein angeekeltes Gesicht. Niemand bemerkte, dass Marocia und Leon sich ein Stück entfernten und durch die Trümmer tapsten.
»Es ist zu gefährlich«, jammerte Leon. Der Rauch vor sich hin kokelnder Barrikaden brachte ihn zum Husten. »Einer der bösen Männer könnte sich hier verstecken.«
Marocia musste ihrem Bruder insgeheim zustimmen. Auch sie wäre viel lieber an der Seite Egidias geblieben, aber etwas anderes war stärker als ihre Furcht und trieb sie weiter. Immer einige Schritte vor Leon, aber doch nahe genug, um im Ernstfall seine Hand zu ergreifen, stieg Marocia über Balken und Pferdeleiber bis zum mächtigen Hauptportal des Lateranpalastes. Dort, quer über den Stufen, lag ein Mann in einem kostbaren, aber verschmutzten Gewand. Er blutete aus einer großen Wunde am Kopf, und seine geweiteten Augen starrten leblos in den Himmel. Ihn hatte Marocia gesucht.
»Wer ist das?«, fragte Leon angewidert, doch Marocia schwieg. Sie wandte ihren Blick nicht ab.
»Komm jetzt«, bat Leon.
Marocia rührte sich nicht. Ihr war, als habe jemand die nächtlichen Bilder aus ihrem Kopf gepustet. Was sie vor sich sah, war auch für sie kein schöner Anblick, aber sie konnte nicht anders, als erleichtert zu sein. Es lohnte sich also, zu kämpfen.
Von hinten kam die schwerfällige Egidia keuchend und schimpfend heran. »Ja, seid ihr noch bei Trost! Einfach davonzugehen. Wisst ihr nicht, wie gefährlich das ist? Was treibt ihr euch hier herum? Euer Vater ist gekommen. Müssen jetzt alle weg, sagt die Eminenz. Müssen uns in den nächsten Tagen verstecken, bis die Soldaten der Herzogin kommen, sagt die Eminenz. Ist noch nicht überstanden, sagt die Eminenz. Herr Jesus«, flüsterte sie, als sie den Erschlagenen sah. »Die Heiligkeit.« Sie bekreuzigte sich, dann nahm sie Marocia und Leon an der Hand und zog sie mit sich fort.
Sanctus Sebastianus war eine der Pilgerkirchen Roms. Gläubige aus allen Ländern kamen hierher an den südlichen Stadtrand, um die Fußabdrücke zu verehren, die Jesus auf einem judäischen Marmorstein hinterlassen hatte, und den eifrige Christen vor Jahrhunderten nach Rom gebracht hatten. Manche zogen es allerdings vor, in den unterirdischen Katakomben das schlichte Grabmal des Heiligen Sebastianus zu bewundern, denn hierbei konnte man sich wenigstens sicher sein, dass es sich um ein echtes Heiligtum handelte.
Wegen dieser beiden berühmten Schätze der Christenheit war das für Pilger hinter der Kirche angebaute Bettenhaus ständig belegt. So auch jetzt. Doch die Pilger, die häufig nicht mal die Landessprache Latein beherrschten, verstanden nicht, was derzeit vor sich ging. So hatten sie sich die Stadt des heiligen Petrus und seiner Nachfolger nicht vorgestellt. Gewalttätig und rumorend, wie Rom sich derzeit präsentierte, schien es ihnen eher ein Vorhof der Hölle zu sein, und sie verließen das Bettenhaus nur, um Fußabdrücke und Grab um eine sichere Rückkehr in ihre Heimat anzuflehen.
Seit drei Tagen hatte Pater Bernard, der Priester von Sanctus Sebastianus, noch weitere Gäste. Drei Dutzend Frauen und Männer lagerten mitten in der Kirche; allerdings interessierte sich diese Gästeschaft wenig für die Reliquien des Gotteshauses, sondern ausschließlich für das gute Versteck, das die Katakomben boten.
Kardinal Sergius, der zusammen mit dem praetor urbanus das provisorische Kommando über die Truppe führte, lief fast ständig auf und ab, während Theophyl unentwegt seinen Bart kraulte, aus den verrammelten Toren lugte und auf ausgesandte Späher wartete. Wirklich Neues erfuhren Kardinal und Richter von diesen nicht. Noch immer beherrschte das Volk die Straßen, aber die anfängliche Wut, die sich wie bei einem Gewitter entladen hatte, schien sich langsam zu verziehen. Es gab anscheinend weniger Morde an Edlen oder hohen Geistlichen, sei es, weil diese mittlerweile fliehen oder sich verstecken konnten, sei es, weil sie schon fast alle tot waren. Dafür wurde nun verstärkt das Eigentum geplündert. Doch so lange die Soldaten der Herzogin nicht eingetroffen waren, konnte es noch immer zu neuen Gewaltausbrüchen kommen, und die Mienen des Richters und des Kardinals hellten sich darum in diesen Tagen nicht ein einziges Mal auf.
Die meisten der anderen blieben die ganze Zeit über in ihren Ecken: Die Soldaten vergnügten sich mit Würfelspielen, Egidia hielt Leon bei Laune, und Theodora kaute auf den Fingernägeln, hielt sich abseits von den anderen und sprach kaum ein Wort.
Einzig Marocia nahm regen Anteil an den mystischen Geheimnissen der Kirche. Pater Bernard zeigte ihr alte Schriften längst verstorbener Päpste, die sie allerdings noch nicht lesen konnte, sowie alle Wandmalereien des verwinkelten, dreiteiligen Kirchenschiffs. Er musste Marocia jedes einzelne Bildnis erklären und eine Geschichte dazu erzählen, so dass beide nach drei Tagen noch so viel Gesprächsstoff hatten wie am ersten. Gerade, als Pater Bernard dem wissbegierigen Mädchen ein verwittertes Bild mit der Darstellung eines Kirchenheiligen beschrieb, unterbrach ihn eine etwas ironische Stimme von hinten.
»Ich sehe, Ihr unterrichtet noch immer gerne, Pater. Wie damals.« Theodora bedachte den Pater mit einem ebenso verächtlichen wie unsicheren Blick. »Man sollte meinen«, fügte sie spöttisch hinzu, »Ihr hättet mittlerweile die Illusion aufgegeben, durch Vermittlung von Wissen bessere Menschen formen zu können.«
Er überlegte einen Moment, dann beugte er sich zu Marocia hinunter: »Wie wäre es, wenn du deinem Bruder und der Amme ein wenig von dem erzählst, was ich dir gezeigt habe?«
Marocia nickte und sprang, ohne ihre Mutter ein einziges Mal anzusehen, davon.
Pater Bernard vergrub die Hände in den weiten Ärmeln seiner Kutte. »Ich bin froh, dass ihr alle hier Zuflucht gesucht habt.«
»Weil Ihr mir dann wieder einmal beweisen könnt, wie viel seliger ein gottgefälliges Leben macht?«
Pater Bernard ließ eine Weile verstreichen, bevor er mit milder, geduldiger Stimme antwortete. »Es zeigt ganz einfach, dass du mich noch nicht ganz vergessen hast, Theodora. Wie oft habe ich dafür gebetet! Es war doch dein Vorschlag, mit euch nach Sanctus Sebastianus zu flüchten, nicht wahr?«
»Also schön«, gestand Theodora gereizt. »Es war mein Vorschlag. Was heißt das schon?«
Der Pater bemühte sich, nicht zu lächeln. Stattdessen machte er eine höfliche Geste mit der Hand in Richtung einer Tür. Er öffnete sie und trat mit Theodora in einen Treppengang, der in eine wenig benutzte Seitenanlage der Katakomben führte. Sie gingen in einen großen, dunklen Raum, dessen Decke gerade so hoch war, dass der Kopf der hoch gewachsenen Theodora nicht anstieß. An den vereinzelt herumstehenden Sarkophagen konnte man auch in der Finsternis erkennen, dass es sich um eine Krypta handelte.
Pater Bernard entzündete eine der mit Pech bestrichenen Fackeln, führte Theodora langsam ein Stück in die Krypta hinein und setzte sich schließlich mit ihr auf eine Steinbank gegenüber eines besonders kostbar gestalteten Sarkophags. »Du weißt, weshalb ich dich hierher gebracht habe?«
»Meine Eltern liegen hier begraben«, antwortete sie ausdruckslos.
»Sie wären stolz auf dich«, behauptete Pater Bernard. »Ja, du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du bist gut verheiratet, hast einen anständigen Mann, zwei Kinder, erwartest ein drittes …«
»Es ist von Johannes, dem Erzbischof von Ravenna.«
»Oh«, entrang es sich der Kehle des Paters.
Theodora grinste. »Ja, oh, ehrwürdiger Vater. Das ist aus Eurer Schülerin von einst geworden, der Ihr Lesen, Rechnen und Schreiben beigebracht habt, der Ihr Heiligenbilder erklärt habt, wie der kleinen Marocia eben. Ein untreues Weib, eine lasterhafte Hure. Und ich schäme mich nicht deswegen. Ich bin ehrgeizig, und ich bin froh, dass ich es bin. Für die Macht über diese Stadt würde ich alles tun. Verraten, verkaufen, vernichten.«
»Was du liebst, vernichten? Deine Kinder verraten?«
Theodora riß sich von seinem Blick los, faltete die Hände und schloss die Augen. Nach einer Weile sagte sie: »Also, was haltet Ihr von mir?«
Pater Bernard entgegnete zuerst nichts. Er fuhr sich mit seiner von jahrelanger Arbeit zerfurchten Hand über die Bartstoppeln und die alten, müden Augen. Er war ein Mann, der in seiner schlichten braunen Kutte, den ledernen Sandalen und dem schmucklosen Holzkreuz um den Hals leicht als Geistlicher der alten Schule zu erkennen war, dem die Botschaft Christi am Herzen lag. Im Gegensatz zu anderen patres, diakones und höheren Prälaten Roms machte er sich nichts aus feinen Stoffen und üppigen Speisen, aus mondäner Unterhaltung und weinseligen Vergnügungen. Historische Studien in alten Büchern waren seine einzige Ablenkung, seit er vor fünfzehn Jahren aufgehört hatte, Theodora im Auftrag ihrer Eltern zu unterrichten. Aber gerade weil Pater Bernard sein Amt und die Botschaft Christi so ernst nahm, lagen ihm scheinheilige Empörung und Bigotterie völlig fern.
Er nahm Theodora bei der Hand, führte sie zum Sarkophag und kniete mit ihr davor nieder. Die im Marmor eingemeißelten Szenen der Auferstehungsgeschichte vor Augen, schwiegen sie. Nur ein gelegentliches Knistern der Fackel unterbrach die Stille. Keiner von beiden wusste, wie viel Zeit vergangen war, als Pater Bernard endlich flüsterte: »Du hast den anderen den Vorschlag gemacht, sich in dieser Kirche zu verbergen, weil du gehofft hast, mir von deinen Gedanken erzählen zu können. Du wolltest – beichten.«
»Mir war elend«, rechtfertigte Theodora sich. »Um mich herum waren nur Tod und Zerstörung. Ich wusste nicht mehr, was ich tat.«
Pater Bernard nickte in die Stille hinein. »So ist es. Du hast nicht nachgedacht, sondern getan, was dein Inneres dir gesagt hat. Genauso wie eben, als du mir alles erzähltest. Das ist die wahre Theodora. Das bist du. Wenn du nur willst, kannst du Ageltrudis, Johannes und die Byzantiner überwinden und dich selbst wieder finden.«
»Ihr habt die Byzantiner nie gemocht.«
»Ich habe die Anmaßung und die Gewalt nie gemocht.«
»Ihr wollt mich auf Eure Seite ziehen.«
»Seite! Aus deinem Munde hört sich alles immer so politisch an.«
»Himmel oder Hölle, Pater. Das sind die Seiten. Dazwischen ist nichts.«
»Dazwischen sind die Menschen«, korrigierte er. »Wir alle, Theodora, müssen uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, wohin wir wollen, wem wir dienen, was wir begehren. In jedem Wunsch, den wir haben – selbst dem harmlosesten –, kann bereits die Versuchung liegen, Böses für seine Erfüllung zu tun. Ich weiß, wovon ich spreche: Manchmal wünsche ich mir so sehr den Frieden, dass ich bereit wäre, die halbe Welt dafür zu zerschmettern, hätte ich die Macht dazu. Das ist unsere eigentliche Prüfung, Theodora. Auch du hast die Kraft, sie zu bestehen, doch du musst sie auch nutzen.«
Theodora ließ zu, dass seine Hand sich beschützend über die ihre legte. Ihre Lippen zitterten, und es schien, als versuche sie eine Antwort zu formen. In diesem Augenblick kam Marocia in die Krypta gerannt. »Pater, Mutter!«, rief sie. »Da seid Ihr also. Vater sagt, die Soldaten der Herzogin sind in Rom. Sie selbst ist auch mitgekommen. Der Aufstand ist vorbei. Wir können nach Hause.«
»Danke, mein Kind«, antwortete der Pater. »Wir kommen gleich.« Er wartete, bis Marocia die Krypta wieder verlassen hatte und die gleiche intime Atmosphäre eingekehrt war, die vorher geherrscht hatte. »Das Gericht der Herzogin wird erbarmungslos sein«, hauchte er. »Sie ist für ihre Härte gegenüber Versagern bekannt, und es scheint, als hätten die hohen Beamten sich in den vergangenen Tagen nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dein Mann braucht dich jetzt. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, ihm alles zu erzählen und mit Gottes Hilfe ein neues Leben zu beginnen. Du könntest deine Kinder lieben und …«
»Wisst Ihr«, unterbrach sie ihn, »dass es Zeiten in den letzten Jahren gegeben hat, in denen ich Euren Namen verdammt habe?«
Pater Bernard schluckte, und zum ersten Mal wandte er seinen Blick von Theodora ab, hinein ins Dunkel des tiefen, scheinbar unendlich langen Raumes.
»Ja, verdammt«, bestätigte Theodora. »Ihr habt mir durch Eure Lehren erst das Gefühl gegeben, etwas Unrechtes zu tun, wenn ich nach Einfluss strebe oder nach Reichtümern verlange, oder wenn ich einfach bewundert werden will. Es kostet mich heute noch viele wache Nächte, meine Bedenken dagegen einzuschläfern, und das ist allein Eure Schuld.«
Er sah sie wieder an. Seine Augen funkelten im Licht der Fackel. »Das ist ein gutes Zeichen, Theodora.«
»Es ist ein Fluch«, widersprach sie. »Wenn ich zu Gott um eines bete, dann darum, dass er mich loslässt.«
Theodora stand auf und sah ihren alten Lehrer mit ebenso ernster wie trauriger Miene an. Ihre Mundwinkel zuckten, als ziehe eine unsichtbare Kraft mit Fäden daran. »Ich möchte, dass Ihr meine Kinder fortan unterrichtet, ehrwürdiger Vater. Vielleicht habt Ihr bei ihnen mehr Erfolg als bei mir. Mehr ist nicht zu sagen.«
»Theodora …«
»Nein, Vater«, unterbrach sie ihn. »Es ist zu spät. Ich kann nicht anders.«
3
Der päpstliche Thronsaal im Lateran war hell erleuchtet, obwohl die Nacht schon vor Stunden hereingebrochen war. Ein heftiger Frühlingswind, der sich durch die kleinen Rundbogenfenster Einlass verschaffte, ließ die Fackeln zucken und die Gewänder der Edlen wehen. Ageltrudis saß auf dem schweren goldenen Thronsessel der Päpste und sah missmutig in die Gesichter derer, die ihr gerade ein weiteres Mal die Treue auf ihren abwesenden Sohn, den König, geschworen hatten.
Worte, dachte sie und ließ ihren Blick vom einen zum anderen schweifen. Wenn es darauf ankam, liefen diese widerlichen Memmen und Verbeugerlinge alle davon oder versteckten sich in Löchern, um noch ein paar Jahre länger zu leben. Menschen ohne Prinzipien! Sie gedachte, ihnen heute eine Lektion zu erteilen.
Ihre Truppen waren am vergangenen Tag in die Heilige Stadt eingerückt und hielten jetzt alle wichtigen Punkte besetzt: Kapitol, Kastell Sanctus Angelus und Lateran. Das war ohne jede juristische Handhabe passiert, quasi ein widerrechtlicher Einmarsch ins Patrimonium, den Kirchenstaat, denn nun gab es ja keinen Papst mehr, der sie zu einem »Besuch« einladen konnte. Aber Ageltrudis hatte in ihrem langen politischen Leben erkannt, dass Fakten die Welt regieren, nicht Gesetze. Und der Erfolg hatte ihr auch diesmal Recht gegeben. Widerstandslos, geradezu apathisch, hatte sich das Volk in die Häuser treiben lassen. Es hatte die Rache, die es wollte, aber es würde teuer dafür bezahlen müssen. Ageltrudis ließ niemals und niemandem das letzte Wort.
Ihre Finger krallten sich um die Lehnen des Thrones. »Es ist, wie ich hoffe, unbestritten unter uns, dass der Aufstand gegen den Heiligen Vater gleichzeitig als Aufstand gegen mich, gegen meinen Sohn wie auch gegen unseren Verbündeten, den Kaiser in Byzanz, zu verstehen ist, also gegen jede weltliche und geistliche Ordnung. Treueschwüre reichen nicht länger aus.«
Wie eine Medusa blickte Ageltrudis in die bleichen Gesichter der Versammelten. Die Beamten Roms und deren Frauen, auch Theophyl und Theodora, trauten sich nicht, sich zu bewegen, aus Angst, dadurch auf sich aufmerksam zu machen. Ageltrudis genoss diese Furcht der anderen ebenso, wie sie sie verachtete.
Sie begann mit einem Dank an Sergius. Er hatte ihr schnelle Nachricht zukommen lassen und sich als zuverlässig erwiesen. Doch damit schien ihre Gnade auch schon erschöpft. »Superista«, rief sie den Präfekten der städtischen Miliz eisig mit seinem Titel an. »Haben die Mannschaften sich in Bordellen vergnügt? Wie konnte es geschehen, dass dahergelaufener Pöbel Gewalt über die Ewige Stadt bekam?«
Der Präfekt trat vor. Er war ein Mann mittleren Alters und ein persönlicher Freund Theophyls. Gelegentlich trafen sie sich zu einem Krug Falerner und redeten über ihre gemeinsame Jugendzeit, als das Byzantinische und das Ostfränkische Reich noch nicht um die Vorherrschaft über Italien und den Einfluss auf die Päpste stritten, als es noch galt, kleine Diebe und Messerstecher zu fassen und zu verurteilen. »Gegen ein aufgebrachtes Volk vorzugehen lag nicht in unseren Möglichkeiten«, rechtfertigte er sich schnaubend. »Das alles wäre nicht geschehen, wenn …«
»Schweigt!«, rief Ageltrudis. »Ihr wart entweder unfähig oder unwillig, den Heiligen Vater zu beschützen. Ich glaube an das Letztere.«
Der Präfekt brauste auf. »Ich habt kein Recht, so mit mir …«