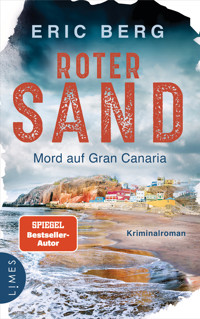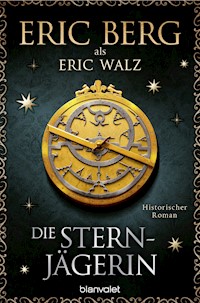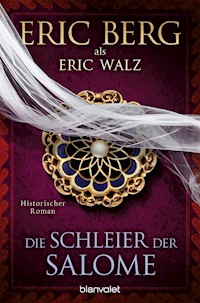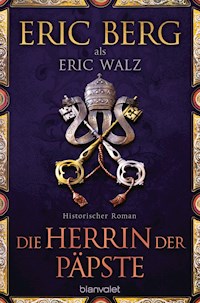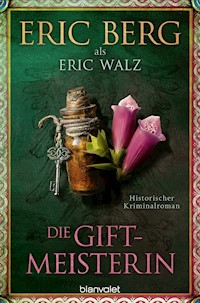
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Tod geht um am Hof Karls des Großen und eine ungewöhnliche Frau beginnt zu ermitteln …
Aachen im Jahre 799: Gräfin Ermengard leidet Qualen in ihrer Ehe mit Arnulf, Hauptmann der Leibwache und langjähriger Weggefährte Karls des Großen. Nur die Freundschaft des verwitwete Gerold, Quartiermeister des Königs, ist ihr ein Trost. Da geschieht in der Aachener Karlsburg ein Verbrechen: Hugo, der ältere von Gerolds Söhnen, wird ermordet aufgefunden – und das wenige Tage, bevor der Papst zu Besuch eintrifft. Ermengards Mann wird vom König mit Ermittlungen beauftragt. Misstrauisch gegen ihren Mann beschließt sie, selbst einige Fragen zu stellen, ohne dass Arnulf davon erfährt, doch was sie nicht weiß: Auch ihr Leben ist in Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Aachen im Jahre 799: Gräfin Ermengard leidet Qualen in ihrer Ehe mit Arnulf, Hauptmann der Leibwache und langjähriger Weggefährte Karls des Großen. Nur die Freundschaft des verwitwete Gerold, Quartiermeister des Königs, ist ihr ein Trost. Da geschieht in der Aachener Karlsburg ein Verbrechen: Hugo, der ältere von Gerolds Söhnen, wird ermordet aufgefunden – und das wenige Tage, bevor der Papst zu Besuch eintrifft. Ermengards Mann wird vom König mit Ermittlungen beauftragt. Misstrauisch gegen ihren Mann beschließt sie, selbst einige Fragen zu stellen, ohne dass Arnulf davon erfährt, doch was sie nicht weiß: Auch ihr Leben ist in Gefahr …
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen erfolgreichen Kriminalromanen überzeugt er als Eric Walz mit opulenten historischen Romanen wie seinem gefeierten Debütroman »Die Herrin der Päpste«.
Historische Romane von Eric Berg / Eric Walz
Die Herrin der Päpste · Der Schleier der Salome · Die Giftmeisterin · Die Sündenburg · Die Sternjägerin
Glasmalerin Antonia Bender: Die Glasmalerin · Die Hure von Rom · Der schwarze Papst
Die Porzellan-Dynastie: Die Blankenburgs · Das Schicksal der Blankenburgs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Eric Bergals Eric Walz
Die Giftmeisterin
Historischer Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2010 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung und – motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com. (jessicahyde, e55evu, ntipathique, Alex Shevchenko, emberiza) und shutterstock.com (Oleg Golovnev) LH ˑ Herstellung: DiMo E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-30253-5V001
Für Christoph Ostermann-Pflüger
1
Aachen, am Heiligen Abend im Jahr des Herrn siebenhundertneunzig und neun. Das Jahrhundert liegt in seinen letzten Zügen. Dies ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft: zwischen mir, der Gräfin Ermengard, und der Fremden Fionee, die von allen gemieden wird und von der ich mittlerweile weiß, dass sie eine Giftmeisterin ist. Und es ist die Geschichte eines Verbrechens. Ich sollte besser sagen, die Geschichte zweier Verbrechen: eins das ich aufgeklärt habe, und ein anderes, das ich beging.
Ich zögere weiterzuschreiben, so wie der Kranke zögert, den Arzt kommen zu lassen. Die Gespenster, mit denen ich mich während dieses Berichts – oder dieser Beichte – auseinanderzusetzen habe, werden mich quälen, bevor sie mich verlassen. Sie bewegen sich, durch mein Schreiben aufgeweckt, bereits in diesem Augenblick tief in mir drin. Ich spüre sie. Und ich habe Angst vor ihnen, vor mir selbst.
Von draußen dringen geistliche Gesänge bis zu mir in mein Zimmer, in dem ich unter Arrest stehe. Der Papst und der König führen eine Prozession durch Aachen und um die Pfalz herum an, die noch bis in die Nacht dauern wird. Der ganze Hof nimmt teil. Ich höre tröstende oder von Freude kündende Gesänge schon seit heute Nachmittag, und ich muss sagen, dass sie meine Not nicht gelindert haben. Im Gegenteil, die ständige, wenn auch verständliche Anwesenheit des wiedergeborenen Heilands hat meinen Zustand noch verschlimmert. Ich fühle mich außerstande, auf eine andere Weise als diese hier über das Rechenschaft abzulegen, was wie ein Gewicht auf mir lastet. Ich muss schreiben.
2
Wann die Geschichte meines Verbrechens begann, weiß ich nicht. War es, als mir die Idee dazu kam? Oder fängt ein Verbrechen nicht schon viel früher an, zu dem Zeitpunkt, an dem die Grundlagen dazu gelegt wurden? Ist der Tod meines ersten Kindes, das vor sechzehn Jahren noch vor der Geburt starb, die Wurzel der Geschehnisse der vergangenen paar Tage? Es folgten noch drei weitere unglückliche Geburten. Sind sie Teil des Übels, das mich befallen hat? Ich werde diese Frage jetzt noch nicht klären können.
Sehr viel leichter ist es zu bestimmen, wann die Geschichte des Verbrechens, das ich aufgeklärt habe, begann. Für mich begann sie vor ungefähr zwei Wochen, am Tag nach dem zweiten Adventssonntag. Die Ähnlichkeiten zum heutigen Abend sind übrigens verblüffend: Es war bereits dunkel, und meine Nichte Gerlindis saß – genauso wie in diesem Moment – am Kohlefeuer unten in der Wohnhalle und nähte an einem Tuch. Sie konnte mich nicht sehen. Ich beobachtete sie von der Treppe aus, und ich erinnere mich, dass meine Sinne ungewöhnlich wach waren, sodass ich sogar das Geräusch hörte, das der Faden macht, wenn die Nadel ihn durch den Stoff zieht, und das Rosenöl roch, das sie zweifellos aus meinem Zimmer gestohlen und hinter die Ohren getupft hatte. Meine enorme Wachheit und Erregung der Sinne hatte einen ebenso einfachen wie guten Grund, denn nur ein paar Schritte weiter war mein Gemahl in seinem Zimmer mit seiner Konkubine zusammen.
Ich fragte mich, soll ich zu Gerlindis gehen und Trost bei ihr suchen? Aber ich hätte zu viel von ihr erwartet, sie wäre nicht in der Lage, mich zu trösten. Absurderweise hätte niemand außer Arnulf, mein Mann, das fertiggebracht.
Ich ging ins Obergeschoss zurück, an meiner Kammer vorbei in Gerlindis’ Kammer. Sie unterschied sich von meiner nur durch eine Feinheit, die kaum jemandem auffiel, für mich jedoch ein bedeutendes Wesensmerkmal darstellte. Auf dem Tisch lag – die geschliffene Metallfläche nach unten – ein Handspiegel.
Ich nahm ihn auf. Es musste drei oder vier Jahre her sein, dass ich mich zuletzt betrachtet hatte. Ich besaß keinen Spiegel. Morgens machte mich stets die Zofe zurecht, und außer gelegentlich ein wackeliges Bild in einer Wasserschale bekam ich von meinem Gesicht nichts zu sehen. Mein burgundisches Naturell und meine Jugend in einfachen Verhältnissen hatten mich uneitel gemacht.
Zu sagen, ich wäre erschrocken, würde nicht wiedergeben, was ich in diesem Augenblick fühlte. Erschrecken gibt es nur, wenn etwas Unerwartetes eintrifft. Was ich hingegen im dürftigen Schein der Öllampe erblickte, hatte ich erahnt: eine Frau von über vierzig Jahren, deren Augen sich mit Schatten gefüllt hatten. Mit viel Mühe hatte ich jahrelang erfolgreich gegen Kummer und Traurigkeit und Groll angekämpft und erhielt jetzt die Bestätigung, dass mich dieser Kampf müde gemacht hatte. Von den Augen, die ja stets die ersten Künder der Gefühle sind, griff die Müdigkeit bereits auf meine Gesichtszüge über. Am Rand meiner Augen, an meiner Nase entlang und an meinen Mundwinkeln zogen sich feine Linien nach unten. Vielleicht war das der Lauf der Dinge, das Schicksal des Alters, aber gerade die kleinen Falten an den Mundwinkeln ließen mich, die ich mutig den Widernissen getrotzt hatte, mutlos erscheinen. Ich fühlte mich betrogen. Ja, genau das. Ich war eine Betrogene, Getäuschte, und zugleich war ich eine Täuscherin, die schwächer wirkte, als sie war. Denn dieses Gesicht spiegelte nur einen Teil meines Wesens wider. Noch immer besaß ich Humor und lachte gerne, wenngleich vornehmer als noch vor zwanzig Jahren. Und noch immer war Liebe in mir. Wo stand all das in meinem Gesicht geschrieben?
Allein auf meinen rosigen Wangen glänzte noch die Jugend, die ich längst verloren glaubte. Da waren sie, die rastlose Frische, die Erwartung einer gesegneten Zukunft, die Neugier, Frechheit und Beredsamkeit, die ich früher besessen hatte.
Kurz davor, den Spiegel zu Boden zu werfen, erinnerte ich mich gerade noch rechtzeitig daran, wie viel Freude er Gerlindis machte. Sie ist in ebenso bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen wie einst ich, und als ich sie vor einem Jahr, nach ihrer Ankunft in Aachen, fragte, was ich ihr schenken dürfte, wünschte sie sich den ersten Spiegel ihres Lebens. Siebzehnjährige Frauen wie Gerlindis fühlen sich nun einmal angezogen von ihren Spiegelbildern, in denen sie Gott weiß was zu erkennen glauben.
Ich verließ die Kammer einer Glücklichen und wandte mich jener von zwei weiteren Glücklichen zu. Hinter einer Zwischentür, der sich ein kurzer Gang anschloss, lag die Kammer meines Gemahls. Bisher war die Zwischentür für mich tabu gewesen; sie bildete die unausgesprochene und daher umso bedeutendere Grenze zu einem Reich, das auch meines hätte sein sollen, tatsächlich aber einer anderen Frau gehörte. Dort war ich eine widerrechtlich zurückgekehrte Exilantin.
Das Gelächter, das ich vernahm, als ich mein Ohr an die Kammertür drückte, kam mir wie die unmittelbare Bestrafung einer Sünde vor. Nicht das, was hinter dieser Tür vorging, war eine Überraschung für mich – war es vom ersten Tag an nicht gewesen –, wohl aber, welche ausgelassene Freude dabei herrschte.
Sofort trat ich die Flucht an. Ich nenne es absichtlich so, denn ein Rückzug geht geordnet vor sich.
Ich griff mir meinen Mantel und eilte die Treppe hinunter.
»Tante?«, hörte ich Gerlindis zaghaft fragen.
Ich wandte mich nicht zu ihr um. Wortlos verließ ich das Haus.
Nachdem ich eben diese letzten Zeilen geschrieben hatte, hob sich meine Hand unentschlossen, zitterte, ließ sich beruhigen, und ich schrieb weiter. Nur das kratzende Geräusch der Feder auf dem Pergament ist zu hören.
Eine Weile stand ich einfach so da, die Tür im Rücken und die Nacht vor Augen. Ich war unwillig, ins Haus zurückzukehren, und sah keinen Vorteil darin, in der Dunkelheit herumzulaufen. Wie festgefroren verharrte ich, umgeben von winterlicher Kälte und angefüllt mit einer anderen, inneren Kälte, die meinen Geist bewegungsunfähig machte. Vergeblich fragte ich mich, was ich fühlen sollte, welche Haltung die angemessene wäre, und kam doch nur zu dem Resultat, keine bestimmte Haltung einzunehmen. Gottes Wille – diese zwei Worte rief ich mir immer wieder ins Gedächtnis. So einschüchternd sie manchmal sein konnten, so beruhigend wirkten sie. Gottes Wille hatte meine vier Kinder ins Himmelreich geholt, und Gottes Wille hatte meinem Gemahl, der jahrelang geduldig auf einen Erben gehofft hatte, eine Konkubine zugeführt, die ihm Kinder gebar. Ich fragte mich: Muss ich nicht dankbar sein, dass Arnulf sich erst spät eine Konkubine genommen hat, nämlich vor drei Jahren, zu einem Zeitpunkt, als deutlich wurde, dass mir keine fünfte Schwangerschaft vergönnt war? Andere Gatten handelten viel früher, manche von ihnen gar ohne Not, da ihre Frauen ihnen längst mehrere Erben geboren hatten. König Karl, beispielsweise, der zurzeit zwei Konkubinen hatte, obwohl es reichlich Prinzen gab – und eine Königin. Wenn Königin Liutgarde ihr Schicksal klaglos ertrug – und danach sah es aus –, welches Recht hatte ich, Gräfin Ermengard, zu hadern?
Ich schloss den Mantel enger um meinen Körper und ging ein paar Schritte durch den Schnee. Es blieb also alles, wie es war. Ich würde keine bestimmte Haltung einnehmen. Alles, was ich tun musste, war, meinen Gemahl nicht länger als mein Eigentum zu betrachten und nicht ständig in der Bereitschaft zu leben, den Kampf um ihn aufzunehmen. Die Eifersucht war ein gefräßiges Tier, dem es galt, Einhalt zu gebieten.
Dermaßen zur Ruhe gebracht, setzte ich meinen bislang zaghaften Spaziergang entschlossener fort. Ich befand mich inmitten der Königspfalz, die bereits zu großen Teilen fertiggestellt, trotzdem noch im Bau befindlich war. Der hinter dünnen Wolken verborgene Mond spendete gerade so viel Licht, dass er die Konturen der Türme, Hallen, Mauern und Lastkräne sichtbar machte. Fast der gesamte Hof – auch Arnulf und ich – lebte in behelfsmäßig errichteten Häusern am Rand der Baustelle und wartete sehnsüchtig darauf, im nächsten Sommer die fertige Pfalz beziehen zu können. Ausgenommen davon waren nur König und Königin, die den fertigen Königsturm bezogen hatten, sowie die Prinzessinnen und königlichen Konkubinen, die im Frauenhaus wohnten. Die Pfalz sollte, dem Willen des Monarchen gemäß, der Mittelpunkt des fränkischen Reiches werden. Auch Quierzy, Reims und Worms waren im Gespräch gewesen, da sie, ebenso wie Aachen, von großen, wildreichen Wäldern umgeben und von Menschen bewohnt sind, die einen fränkischen Dialekt sprechen. Die warmen Quellen dieser Gegend, die der Gesundheit so zuträglich sind, übten auf Karl jedoch die größte Anziehungskraft aus. Für mich, die ich unter burgundischer Sonne aufgewachsen bin und den Winter lange Zeit nur als kurze Zeitspanne gekannt hatte, bedeutete die Entscheidung für das Dorf Aachen einen gewissen Trost. Wenn schon nicht Chalon oder Vienne zur wichtigsten Residenz gemacht wurden, wollte ich die kalten Monate wenigstens in einem warmen Bad sitzend verbringen.
Ich blieb stehen, lauschte … Wie wunderbar! Eine außergewöhnliche Stille, so wie der Raureif der Nacht, überzog den Hof. Ich hörte nichts, atmete unhörbar. Auch aus den Stallungen, in deren Nähe ich mich befand, kam kein Geräusch. Aachen schien weit weg, obwohl wir uns – nur umgeben von Palisaden – in seiner Mitte befanden. Kein Hund bellte. Kein Wind wehte. Ich atmete tief durch, und der Geruch von Stroh und Pferden kämpfte sich durch die Eiseskälte und stieg mir in die Nase, ebenso der Geruch trockenen Holzes, das am Rande der Stallungen lagerte. Die Welt war mit einem Mal wieder zu einem lebenswerten Ort für mich geworden, und der Schmerz, der mich vorhin noch heftig getroffen hatte, war wie die Erinnerung an einen schlimmen Traum.
Ich wandte mich in der Absicht um, zum Haus zurückzukehren – und stolperte über eine Leiche. Ich erkannte sofort, dass der Mann, der mit dem Gesicht nach unten lag, tot war, denn meine Hand wurde bei seiner Berührung rot von Blut und um ihn und mich herum hoben sich etliche dunkle Flecke vom Schnee ab.
3
Wie wäre das Leben, wenn wir um seinen geplanten Verlauf wüssten? Wenn es etwas oder jemanden gäbe, einen Erzengel vielleicht, der uns im Alter von fünfzehn Jahren darüber unterrichtete, was Gott beschlossen hatte? Würde ein junger Mann dann noch in einen von König Karls Kriegen ziehen, im Wissen, darin umzukommen? Würde eine junge Frau, wie ich einst eine gewesen bin, eine Ehe eingehen, in der sie alle Kinder verliert, oder nicht lieber gleich ins Kloster gehen, um dort Frieden zu finden? Und wenn eine innere Stimme uns auch nur einen Tag im Voraus sagen würde, was als Nächstes geschähe … Es wäre wohl das Ende göttlicher Allmacht. Man würde, ungeachtet der Aussicht auf das ewige Leben, sich gegen einen solch perfiden göttlichen Plan erheben.
Ich wünschte mir, ich hätte vor zwei Wochen gewusst, was ich heute weiß, denn dann wäre ich nicht über eine Leiche gestolpert, und selbst wenn, ich wäre meiner Wege gegangen und hätte mich aus allem herausgehalten, was folgte.
Doch das tat ich nicht, und das Ergebnis ist erschütternd. Es kommt vor, dass ich mich frage, worin für mich der Vorteil liegt, weiterhin an Gottes Plan zu glauben, wenn dieser mir im Diesseits wie im Jenseits nichts als Verderben bringt.
Ich rannte irgendwohin. Wieso ich nicht schrie, weiß ich nicht mehr. In der Nähe, auf den Palisaden, standen Wachen, doch in ihren schwarzen Mänteln waren sie von der Dunkelheit verschluckt worden.
Arnulf, das war mein einziger Gedanke. Ich musste Arnulf holen.
Doch ich lief einem anderen Mann in die Arme. Von dieser Körpergröße gab es – außer Arnulf – nur einen Mann am Hof: den König.
»Euer Gnaden«, sagte ich mit gebrochener Stimme.
»Gräfin Ermengard«, erwiderte er, und erst viel später, als ich die Begegnung in aller Ruhe vor meinem inneren Auge wiederholte, bemerkte ich, dass in seiner höflichen Stimme auch Argwohn mitschwang. Eine Frau, ganz allein mitten in der Nacht in der Nähe von Mannschaftsquartieren und Stallungen voller Stroh, offensichtlich in Eile … Er runzelte kurz die Stirn, fragte aber: »Ihr könnt wohl ebenfalls nicht schlafen, wie?«
Immerhin war ich noch vernünftig genug, mich nicht auf eine Plauderei einzulassen, sondern sagte: »Euer Gnaden, dort vorn liegt ein Toter.«
Der König kniete neben der Leiche, berührte sie am Nacken, dann am Handgelenk und sagte mit einem Erstaunen, das darauf schließen ließ, dass er dem Geschwätz einer nervösen Gräfin keinen Glauben geschenkt hatte: »Tatsächlich.«
»Nun, wie ich sagte.«
Er beachtete mich nicht, fasste den Leichnam an den Schultern und wälzte ihn auf den Rücken.
Keiner von uns sprach, da wir beide den Toten gut kannten. Hugo war der ältere der beiden Söhne eines hohen königlichen Beamten, des Seneschalls Gerold. Zugleich war Hugo ein hoher Offizier in der königlichen Leibwache.
Sein Gesicht war totenbleich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es sah wie die Maske des Teufels bei einem Mysterienspiel aus: entsetzlich verzerrt, graue Lippen … Ich wandte mich ab.
Der König suchte Hugos Körper nach der Wunde ab, fand jedoch keine. »Seltsam«, flüsterte er zu sich selbst, denn er hatte mich völlig vergessen. »Der Körper ist noch warm, aber das Gesicht ist schon erbleicht. Wie ist das möglich?« Dann schlug er Hugos Mantelkragen zurück, legte die Kehle frei – und bekreuzigte sich. »Durchgeschnitten.«
Vorsichtig wandte ich mich dem Leichnam noch einmal zu und trat einen Schritt näher, weil das Unbekannte seit jeher eine große Anziehungskraft auf die Menschen ausübt, auch wenn es nur Schlechtes bedeutet. Ich warf nur einen kurzen Blick auf den Toten, bevor sich alle meine Empfindungen gegen das Grauen sträubten und ich mich erneut abwandte. Durch die heftige Bewegung erinnerte der König sich meiner.
»Gräfin. Bitte schickt Euren Gemahl hierher.«
»Meinen Gemahl?« Ich muss arg konfus ausgesehen haben, also so, wie ich mich fühlte. Der Anblick eines Menschen, dem man die Kehle durchschnitten hatte, hatte mich schwindlig gemacht.
»Ja«, sagte Karl überdeutlich, »aber wenn Euch nicht wohl ist …«
»Nein, nein, Euer Gnaden, es geht schon. Ich werde also … meinen Gemahl schicken.«
»Das wäre sehr freundlich.«
Die Bitte des Königs war absolut verständlich. Arnulf war der Graf der Pfalz Aachen und somit der hiesige Vertreter königlicher Gewalt und Gerichtsbarkeit.
Der König konnte nicht ahnen, was er mit seiner Bitte anrichtete. Es war ihm darum gegangen, mich, den Gesetzen der Schicklichkeit entsprechend, auf gewandte Weise vom Schauplatz des Grauens zu entfernen und zugleich, den Gesetzen der Gerichtsbarkeit entsprechend, Arnulf schnellstmöglich an den Schauplatz des Grauens zu holen. Tatsächlich schickte er mich in die Liebeskammer meines Gemahls und der Konkubine.
4
Wieder stand ich vor der Tür, hinter der nun nicht mehr gelacht wurde. Hörte ich irgendetwas? Ich strengte mich an, doch da war nichts zu hören. Kein lustvolles Stöhnen.
Meine Hand ballte sich – der anerzogenen Pflicht gemäß – zur Faust und schickte sich an anzuklopfen. Mein Wille verhinderte es.
Ich wollte sehen. Einmal wollte ich es mit eigenen Augen sehen, es mir nicht nur vorstellen, es nicht in Albträumen träumen.
Ich fasste den Knauf.
Diese Stille … Beinahe wie die Stille von vorhin draußen im Schnee, kurz vor dem Stolpern.
Womöglich, so dachte ich, waren Arnulf und sie auseinandergegangen, und er schlief friedlich und allein. Oder sie schliefen nebeneinander.
Ich trat langsam ein. Ich spürte zunächst die Wärme. Im übrigen Haus war es bitterkalt, da die dünnen Tierhäute, die in den Fenstern aufgespannt waren, zwar den Wind, nicht jedoch den eisigen Frost eines Dezembertages fernhalten konnten. Und die Kohlefeuer wärmten nur, wenn man direkt vor ihnen saß.
Der Grund für die angenehme, ungewöhnliche Wärme in Arnulfs Gemach war schnell gefunden, denn es brannten rund zwanzig Öllampen im Raum verteilt, auf den Truhen, dem Tisch, dem Boden.
Dort waren Arnulf und sie, zwischen Öllampen auf dem Boden, auf einem Fell. Was sie taten, taten sie stumm. Das Geräusch ihrer sich aneinander reibenden Körper war das Einzige, das sie von sich gaben, so als hüteten sie das Geheimnis ihres Zusammenseins.
Sie bemerkten mich nicht. Da war ich also. Sah sie in vollem Licht. Sah die körperliche Liebe, die sie seit drei Jahren verband und der bereits ein Kind entsprungen war.
Mir wurde schlecht. So leise und rasch wie möglich schloss ich die Tür, eilte in mein Gemach und übergab mich in die Wasserschale neben meinem Bett.
»Das hat sein müssen«, flüsterte ich.
Kurz darauf kehrte ich zum dritten und letzten Mal in dieser seltsamen Nacht zu der Tür zurück, dieses Mal hochoffiziell. Ich klopfte an. Drinnen ein Rascheln, dann leise Stimmen. Ich klopfte erneut. Sie berieten sich.
»Arnulf«, rief ich. »Bitte öffne. Es ist wichtig.«
Arnulf hätte bei dieser dringenden Bitte kaum etwas anderes tun können, als die Tür zu öffnen, trotzdem fühlte ich eine gewisse Genugtuung darüber. Als seine Gestalt im Türspalt erschien, als er vor mir stand, fiel mir sofort wieder ein, weshalb ich diesen Mann liebte. Es hatte nicht nur mit seinem Körper zu tun, obgleich ich sagen muss, dass er mir sehr gefiel. Seine zahlreichen Schwertübungen und die Mäßigkeit, die er beim Essen und Trinken an den Tag legte, täuschten über die sechsundvierzig Jahre, die er zählte, hinweg. Sein kurz gehaltener Bart verdeckte die Narbe, die ein sächsischer Schwerthieb hinterlassen hatte, und gab dem Gesicht etwas Weiches. Seine Körpergröße entsprach der des Königs, ja, man könnte sagen, dass Arnulf dem König in Wuchs und Statur fast gleichkam.
Eine siebenundzwanzig Jahre alte Erinnerung: Hochzeitsnacht.
Arnulf öffnet mir die Tür zu einem mit Fackeln und Öllampen erleuchteten Gemach. Er trägt nur einen Schurz, und die dunkle Körperbehaarung, die er schon als Neunzehnjähriger hatte, jagt mir einerseits einen Schrecken ein, andererseits erregt sie mich. Ich, siebzehn Jahre alt, lasse mein Gewand zu Boden gleiten und setze Arnulf mit meinen wohlgeformten Brüsten und meiner schmalen Taille in Erstaunen. Wir gefallen uns vom ersten Augenblick an.
Nun stand er also wieder im Schurz vor mir. Für meine Liebe wesentlich war jedoch etwas ganz anderes. In seinen braunen Augen las ich jene zärtliche Sorge um mich, die er früh entwickelt und nie abgelegt hatte. Ihm war nicht gleichgültig, was ich fühlte, darum all diese dumme Heimlichtuerei, darum hatte er Emma – so lautet der Name der Konkubine – in einem kleinen Häuschen nicht weit von der Königspfalz untergebracht, darum aß sie nie mit uns, darum hielt er ihre gemeinsame Tochter von mir fern, und darum waren seine ersten Worte, nachdem er mir die Tür geöffnet hatte: »Geht es dir gut?«
Ich ging nicht darauf ein, schlug die Augen nieder. »Man hat im Hof eine Leiche gefunden. Es ist Hugo. Der König bittet dich zu kommen.«
»Hugo?«
»Ja.«
»Du meinst den Hugo … den … den Sohn von Gerold?«
»Ja.«
Er schwieg. Ich fragte: »Kommst du?«
»Sofort.«
Ich wartete, bis er ihr zugeflüstert hatte, dass er gehen müsse. Er kam zurück und zog die Tür so entschlossen hinter sich zu, als wolle er sie für lange Zeit nicht mehr öffnen. Während wir den Gang entlang und die Treppe nach unten gingen, zog er sich eine Tunika und eine Biberweste über, schließlich legte er sich noch den blauen Mantel seiner Grafenwürde um die Schultern.
Kein Wort über den Toten. Sein Blick ruhte auf mir wie auf einer Kostbarkeit.
»Und dir geht es gut?«, fragte er noch einmal.
Wir sahen uns an.
»Ich habe ihn gefunden. Du weißt schon, Hugo. Ich bin spazieren gegangen …«
»Ich verstehe.«
Ja, er verstand es. Das war ja das Schlimme. Er verstand, wieso ich mitten in der Nacht und bei eisiger Kälte im Schnee spazieren ging, und er wünschte, es bliebe mir erspart, das zu tun. In Momenten wie diesen wollte ich, dass ich ihn hassen könnte, doch es war unmöglich. Er machte es mir unmöglich. Stattdessen entfachte er wieder und wieder die glimmende Glut zwischen uns, diese Liebe.
Ich dachte, lass es doch. Bitte, lass es doch.
»Du solltest dich beeilen. Der König wartet.«
»Du hast recht.«
Er rannte voraus. Mit seinem flatternden Mantel sah er aus wie ein blauer Rabe, und ich ging, über dieses Bild lächelnd, in seinen Fußstapfen hinter ihm her. Ja, ich vermochte schon wieder zu lächeln. So war es immer. Eine kurze Weile allein mit Arnulf genügte, um mich wieder aufzurichten. Ich war über eine Leiche gestolpert, deren Kehle man durchgeschnitten hatte, und doch war meine Konfusion verflogen. Außerdem hatte ich den Mann, den ich liebte, zusammen mit der Frau, die ich verabscheute, gesehen, trotzdem gelang es ihm, dass ich ihm nicht böse war. Es mag völlig unverständlich klingen, aber derselbe Mann, der mir die Sicherheit, eine begehrenswerte Frau zu sein, immer wieder nahm, gab sie mir immer wieder zurück.
Ich blieb in einigem Abstand stehen. Hugos Leiche lag unverändert da, vorsichtig untersucht von Arnulf. Zwei Wachen steckten den Bereich mit Fackeln ab, deren Schein ein warmes gelbes Licht auf den Schnee warf, was mich merkwürdigerweise an die Sommer meiner Kindheit in Burgund erinnerte. Vielleicht sehnte ich mich in diesem Moment inmitten von Kälte, Mord und Tod dorthin zurück.
Der König stand abseits des Fackelkreises und sprach leise mit einem Mann, dessen Gesicht ich nicht erkannte. Doch die hängenden Schultern des Mannes ließen mich nicht zweifeln – es handelte sich um Gerold, Hugos Vater, der gerade vom König aufgeklärt und getröstet wurde. Ich fragte mich, welche Worte König Karl wohl finden würde. Wenn in der Vergangenheit Gefolgsleute von ihm gestorben waren, hatte er die Witwen und Kinder getröstet, indem er auf die Verdienste des Toten und den großen Verlust für sich selbst verwies. Hätte Arnulf dort im Schnee gelegen, würde Karl vermutlich sagen: War mir fünfundzwanzig Jahre lang treu ergeben … hat sich als Siebzehnjähriger bei der Belagerung von Zaragoza zwischen mich und einen Pfeil geworfen … hat jede ihm gestellte Aufgabe erfüllt. Und wäre Hugos jüngerer Bruder Grifo getötet worden, hätte er wohl von dessen unglaublicher Tapferkeit im Krieg gegen die Awaren an der pannonischen Donau gesprochen.
Bei Hugo hingegen war es schwierig. Dass er einer der besten Schwertkämpfer des Heeres gewesen war, immer das Letzte aus sich herausgeholt, jedes gesteckte Ziel mit unerhörter Anstrengung erreicht hatte und schon vor fünf Jahren, gerade zwanzig Jahre alt, den Befehl über die Vorhut im bereits erwähnten Awarenkrieg erhalten hatte – das waren allesamt Verdienste, die von der jüngsten Vergangenheit geschleift worden waren. In den letzten Monaten war Hugo oft betrunken angetroffen worden. Er hatte – wie Arnulf mir auf mein Drängen nach weiteren Einzelheiten hin erzählt hatte – seine Pflichten als Offizier der Leibwache vernachlässigt, seine Befugnisse übertreten, und sein Auftreten war zunehmend despektierlich geworden. Arnulf hatte gesagt, die Verwandlung sei plötzlich gekommen, so als wäre ein Teufel oder die Seele eines Rebellen in Hugo gefahren.
Arnulf hatte seine Untersuchung des Leichnams abgeschlossen und trat zu Gerold und dem König.
»Für mich sieht es folgendermaßen aus«, sagte er. »Hugo hat sich mit jemandem gestritten, Hugos Kehle wurde verletzt, durchschnitten. Dies hier habe ich im Schnee gefunden.«
»Ein Langmesser«, sagte der König. »Aber es klebt kein Blut daran.«
»Weil es sich um Hugos Waffe handelt, Euer Gnaden.«
»Ihr überseht etwas, Graf.« Gerolds Stimme drückte Empörung aus. Ich kannte Gerold nur als zurückhaltenden, geduldigen, schon ein wenig greisenhaften Mann. »Hugo hätte niemals einen Zweikampf mit dem Schwert oder dem Langmesser verloren. Er hätte jeden Mann in dieser Pfalz bezwungen, Euch eingeschlossen. Es ist mir daher nicht möglich zu glauben …«
Gerold unterbrach sich, als Arnulf einen Gegenstand, den er bislang in der anderen Hand gehalten hatte, ins Licht der Fackeln hob. Auch aus der Entfernung erkannte ich in dem Gegenstand einen Weinschlauch.
»Er ist fast leer«, sagte Arnulf widerwillig. Ich wusste, dass es ihm keine Freude bereitete, Gerold in diesem Augenblick des Verlustes mit den Schwächen seines Sohnes zu konfrontieren. Wenngleich Arnulf und Gerold keine Freunde waren, kamen sie gut miteinander aus.
Arnulf folgerte: »Ein Kampf hat nicht stattgefunden, sonst hätten die Wachen etwas bemerkt. Hugo, der seine Sinne nicht beieinanderhatte, zog sein Messer, aber er wurde sogleich tödlich getroffen.«
Während die drei Männer leise miteinander sprachen, näherte ich mich der Leiche und kniete mich neben sie in den Schnee. Inzwischen hielt ich mich für gefestigt genug, den Toten zu betrachten, ohne dass mir übel wurde. Doch wozu ihn betrachten? Wieso sollte ich mir das noch einmal zumuten?
Ich tat es. Mein Blick glitt über die Beine den Körper hinauf, über den bedeckten Hals bis zu Hugos Kopf. Erneut war ich erschüttert, aber dieses Mal nicht von der Totenblässe und den anderen grässlichen Merkmalen des Todes, sondern von der Jugendlichkeit des Gesichts und auch von der Schönheit, jener Art von ungestümer Schönheit, die Frauen neugierig und Männer argwöhnisch macht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich selbst dabei ertappt, wie ich Hugo bei den Zweikampfübungen der Leibwache ausgiebig betrachtete. Je größer die Bewunderung – gleich welcher Art – für einen Menschen, desto größer die Trauer, und ich gebe zu, dass mich der Tod eines rüpelhaften, zahnlosen und fetten Offiziers weniger erschüttert hätte, als es bei Hugo der Fall war.
Jene Übungen, von denen ich eben sprach, waren der Grund, weshalb ich mir Hugos tödliche Verletzung noch einmal ansehen wollte. Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten, dass ich die Angriffsverfahren der Waffenträger beim Kampf mit dem Langmesser studiert hätte, dennoch war mir aufgefallen, dass die Technik keine ausholende Armbewegung mit anschließendem Schnitt durch die Kehle des Gegners vorsah, sondern einen plötzlichen Vorstoß der Messerspitze, dem Hugo stets mit größter Gewandtheit ausgewichen war.
Mit einem in Erwartung des Schlimmsten verzogenen Gesicht nahm ich die Bedeckung vom Hals des Leichnams. Sowohl Arnulf als auch der König hatten von einem Schnitt gesprochen, mit dem Hugo getötet worden war. Und sie hatten recht.
Ein Schauer durchfuhr mich.
Ich konnte nichts mehr tun. Behutsam schloss ich Hugos schwarze Augen. Dann strich ich ihm die Haare aus der Stirn, diese langen, schwarzen Locken, die immer so verwegen um seine Ohren und Wangen getanzt waren.
»Eine Beule.« Ich war so überrascht, dass ich nicht nachdachte und sich daher die Entdeckung gleichzeitig mit dem Ausruf ereignete.
Arnulf, Gerold und der König bemerkten erst jetzt, dass ich neben der Leiche kniete, und blickten verwundert zu mir herüber.
»Eine Beule«, wiederholte ich nach einem Moment der Verunsicherung. »Oberhalb des Haaransatzes. Ich spüre sie deutlich. Da ist aber kein Blut. Hugo muss von einem stumpfen Gegenstand getroffen worden sein.«
Keiner der drei Männer bequemte sich herbei. Bei Gerold verstand ich es ja noch – den toten Sohn abzutasten ist eine schwere Prüfung. Und eines Königs Aufgabe ist es nicht, Morde aufzuklären. Aber Arnulf …
»Ist vermutlich beim Sturz zu Boden passiert«, erwiderte er lapidar.
Ich dachte, beim Sturz in den mehr als knöchelhohen Schnee zieht man sich keine Beule zu. Dem Gedanken wollte ich gerade Worte folgen lassen, als Arnulf mir einen inständigen Blick zuwarf. Da erst begriff ich, dass ich ihn in Verlegenheit gebracht hatte – ich glaube, zum ersten Mal in unserer Ehe.
Der König räusperte sich. »Eure Gemahlin wird sich noch erkälten, Graf.«
Und Gerold bot an: »Wenn Ihr erlaubt, Graf Arnulf, werde ich Eure Gemahlin zu Eurem Haus geleiten.«
Arnulf willigte ein, und so wurde ich mehr oder weniger abgeführt.
»Ich musste da weg«, sagte Gerold, als wir ein paar Schritte gegangen waren, und da hörte ich sie wieder, diese stoische, trotz ihrer Männlichkeit sanfte Stimme, die ich von ihm kannte. Und dann schwieg er. Vieles an ihm war lautlos. Es war die Art, wie er sich bewegte, wie er Menschen begrüßte, wie er ihnen geduldig zuhörte und seine eigene Meinung nicht über ihre stellte, die bewirkte, dass er am Hof kaum auffiel, obwohl er als Seneschall ein hohes Amt bekleidete. Ihm oblag immerhin die Versorgung des königlichen Haushalts, zu dem der gesamte Hof gehörte. Soweit ich wusste, hatte er keine Feinde. Noch nicht einmal seine Kinder hatten etwas gegen ihn, und das wollte viel heißen.
Ich betrachtete ihn aus dem Augenwinkel. Seine ruhige Art, der ansonsten eine große innere Kraft zugrundezuliegen schien, hatte in jener Nacht etwas Aschenes an sich, etwas Zerfallenes. Es tat mir weh, ihn leiden zu sehen, viel stärker, als es der Fall gewesen wäre, wenn er seine Trauer offen gezeigt hätte.
»Wie geht es Euren Töchtern?«, fragte ich, nicht um die Stille mit überflüssigen Fragen zu durchbrechen, sondern um Gerold für eine Weile auf gute Gedanken zu bringen. Mir war bekannt, dass er seine Töchter, die allesamt verheiratet waren und verstreut im Reich lebten, sehr liebte.
»Die Älteste hat jetzt fünf Kinder«, sagte er mit plötzlicher Freude. »Und die Jüngste hat ihr erstes Kind gesund zur Welt gebracht. Es heißt nach mir. Angeblich soll es mir ähnlich sein.« Er blieb stehen. »Könnt Ihr Euch das vorstellen, Gräfin? Wie kann ein so winziges Gotteskind einem beleibten, graubärtigen Greis wie mir ähneln?«
Gerold gab ein falsches Bild von sich ab. Gut, er war kein Athlet, aber sein Leibesumfang war maßvoll und das halbe Jahrhundert, das er auf dem Buckel hatte, hatte ihn nicht niedergedrückt. Im Übrigen waren Bart- und Kopfhaare noch fast schwarz, und das Einzige, was grau war, waren seine Augen, die aber stets mit milder Kraft und Aufmerksamkeit leuchteten. Wieso machte er sich älter, als er war? Hätte ich ihn nicht besser gekannt, wäre ich vielleicht auf den Gedanken gekommen, er wolle mit dem Mittel der Übertreibung den gegenteiligen Effekt erzielen.
»Ja, es geht ihnen allen gut«, sagte er, wobei die Freude wich und dem Schmerz um Hugos Tod Platz machte.
Den Rest des Weges schwiegen wir. Es war mir ein wenig peinlich, an seiner Seite zu laufen. Wir waren noch nie miteinander allein gewesen.
Als wir vor meinem Haus angekommen waren, blickte er zum Mond, der sich noch immer hinter dichten, dünnen Wolken verbarg und sie mit seinem Licht erhellte.
»Der Himmel ist ein vernebelter See«, sagte Gerold. »Man kann es fast glauben.«
Ich sah Gerold, der den Kopf in den Nacken gelegt hatte, im Profil, und sah auch seinen Atem in der kalten Luft.
Dann wandte er sich mir zu. Keiner von uns machte auch nur den Versuch zu sprechen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis er sich verneigte.
»Gute Nacht, Gräfin.«
»Gute Nacht.«
Mein Körper verlangte nach Schlaf, aber mein Geist war von den Ereignissen der Nacht hellwach. Ich machte Feuer in der Küche und hängte einen kleinen Kessel Wasser auf, um mir einen Sud beruhigender Kräuter zu bereiten. Insgeheim hoffte ich, Gerlindis käme herein, damit ich jemanden zum Reden hätte, aber sie war längst schlafen gegangen.
Dafür kam, noch bevor das Wasser kochte, sie herein. Sie schien sich nicht im Mindesten an meiner Anwesenheit zu stören, setzte sich mir gegenüber an den Tisch und spielte an ihren Fingernägeln herum.
»Es ist schrecklich langweilig, wenn Arnulf nicht da ist«, sagte sie und sah dabei die Finger an, als würde sie mit denen sprechen.
Ich war nicht in der Lage zu antworten, so einzigartig war meine Verblüffung. Emma und ich begegneten uns nie. Niemals! Wir haben in drei Jahren nicht ein einziges Wort miteinander gesprochen, haben uns nur aus der Ferne gesehen – und plötzlich spaziert sie in einem Nachthemd in die Küche, in meine Küche, und setzt sich mit größter Selbstverständlichkeit an meinen Tisch. Das war nicht vorgesehen, und es traf mich noch heftiger und unvorbereiteter als die Leiche, über die ich gestolpert war, weil es mich im Innersten aufwühlte.
Eine drei Jahre alte Erinnerung: Mein Leben wird auf den Kopf gestellt.
Ich habe selten etwas Schöneres gesehen. Zur einen Seite das königliche Gut vor dem Panorama der Berge, zur anderen Seite eine sattgrüne Wiese mit Faltern und Hummeln, dahinter die wohlhabende Marktstadt Konstanz mit ihrer Bischofskirche und dem römischen Kastell vor dem in der Sonne glitzernden Bodensee und über uns an die hundert Schwalben, die unermüdlich Kreise ziehen. Es scheint, als liege Gottes Segen über der Zeremonie, die vor mir stattfindet, und trotzdem rührt mich weder die Schönheit noch die Erhabenheit. Ich bin nicht undankbar. Ich freue mich für Arnulf und auch ein wenig für mich selbst, dass die Mühen der Jahre – und es waren deren viele Jahre und Mühen – gewürdigt werden. Mir ist im Leben einiges versagt geblieben, aber ich bin mit zweierlei Gutem entschädigt worden: mit der Zuneigung meines Mannes und von nun auch mit der Sicherheit meines Zuhauses. Das ist eine ganze Menge – geliebt zu werden und nicht arm zu sein. Ich war ein Mädchen aus einfachen Verhältnissen, und Arnulf war ein junger Mann, dem es nur wenig besser ging, und nun legt der König ihm das Schwert auf die Schulter und macht ihn zum Pfalzgraf von Aachen. Der blaue Mantel, den er ihm umhängt, komplettiert die Würde. Ab heute sind wir Edle, und Arnulf wird einer derjenigen sein, mittels derer Karl sein fränkisches Riesenreich regiert. Bedingungslose Treue und der Eifer, die Verhaltensweisen des Königs zu imitieren, haben Arnulf ganz nach oben gebracht. Dennoch bin ich nicht ergriffen.
In dem Moment, wo wir uns von Karl entfernen, sind wir nicht Gefolge, sondern wir haben Gefolge. Auf dem Weg nach Aachen begleiten uns zwölf Beamte, die der König erwählt hat, in unseren Diensten das Gebiet zwischen Rhein, Maas und Mosel zu verwalten, und ferner ein Trupp von zehn bewaffneten Reitern. Selbstverständlich gehören auch die Ehefrauen und Kinder dem Tross an. Ich bewirte sie, so gut ich kann. Eine der Frauen weicht einem Gespräch mit mir aus, und ich vermute, dass sie die Konkubine eines Beamten ist.
Was für eine Pfalz! Auf den ersten Blick die unbedeutendste zwischen Tiber, Seine und Elbe. Verglichen mit Konstanz ist Aachen ein Vogelnest. Vierzig, fünfzig Hütten entlang einer unzureichend befestigten Straße, das ist alles. Kein Markt. Keine Mauer. Keine Kirche. Nur ein Gutshof, den der König zu einer dauerhaften Residenz auszubauen entschlossen ist. Aachen soll das Zentrum des Reiches werden, ein zweites Konstantinopel. Die Bedeutung der Pfalz liegt somit in der Zukunft. Die Bauarbeiten sind seit zwei Jahren im Gange, und es wird zu Arnulfs wichtigsten Aufgaben gehören, sie voranzutreiben. Nach fast drei Dekaden der Feldzüge und Reisen bekommen Arnulf und ich unser erstes, festes Zuhause. Das ist mir tausendmal mehr wert als der Titel, den ich trage.
In unserer ersten Nacht im neuen Heim überschüttet Arnulf mich mit Aufmerksamkeit und vielen Küssen, und am Tag darauf stürzt er sich in seine Arbeit. Ich bekomme ihn tage- und nächtelang kaum zu sehen. Er muss die schönsten Steine und die besten Baumeister besorgen. All die Steinmetze, Handwerker, Maurer, Maler, Bildhauer und Gießer müssen irgendwo untergebracht werden.
Eines Abends bringt Arnulf den Zeichenentwurf für die zukünftige Königsresidenz mit, und zum ersten Mal verstehe ich, wie groß das sein wird, was hier entstehen soll. Fasziniert beuge ich mich über das Pergament, Arnulf lässt es mich studieren, während er im Raum auf und ab geht. Und dann höre ich Arnulfs Fingerknöchel knacken und weiß, dass er Schlimmes mit sich herumträgt und mir gleich unterbreiten wird.
»Du wirst sie überhaupt nicht bemerken, Ermengard. Sie wird sich von dir fernhalten. Selbstverständlich wohnt sie nicht bei uns, sondern in einem Häuschen – dem kleinen Haus oben am Weg. Ich werde nie von ihr sprechen, und du wirst niemals von ihr sprechen müssen.«
Arnulfs Tonfall ist verständnisheischend und entschuldigend. Er darf nach Recht und Gesetz eine Konkubine haben, ohne mich zu fragen oder auch nur zu verständigen, doch er zieht es vor, es sich schwer zu machen, vielleicht weil er weiß, dass er es mir schwer macht. Er quält sich, windet sich.
Sogar in dieser Situation denke ich zuerst an ihn, bevor ich an mich denke.
»Wie heißt sie?«
»Emma.«
»Sie ist die Frau, die auf dem Weg nach Aachen im Gefolge war, nicht wahr?«
»Ich habe sie in Konstanz kennengelernt.«
Ich sage leise: »Sie ist sehr schön.«
»Kümmere dich nicht um sie. Sie wird nichts zwischen uns ändern. Lass uns jetzt über etwas anderes reden, ja?«
»Wirst du mit ihr …? Wirst du sie …?«
»Ich werde eine Kebsehe mit ihr eingehen.«
Ich schlucke, aber mein Mund ist trocken. »Eine Konkubinenehe. Doch wozu?«
»Nur aus dem einen Grund, weil sie ein Kind von mir trägt. Ich möchte die Möglichkeit haben, es anzuerkennen.«
»Ich verstehe.« Auch darin, dass er sich Konkubinen nimmt, eifert er nun also dem König nach. Ich versuche, Arnulf zu hassen, doch ich spüre, wie unsagbar zehrend es ist, jemanden zu hassen, den man liebt. Es würde mir nicht lange gelingen, also gebe ich es sogleich auf. Alles, was ich an Schlechtem fühle, richtet sich gegen Emma – und gegen mich selbst.
Ich beuge mich über das Pergament, über die Striche und Zahlen, die künftige Burgpfalz. Ein Areal von 300 Acker im Quadrat, eingefasst von einer Mauer, mit vier Toren versehen; eine sechzig Schritt lange Aula als Thronsaal; eine einhundertfünfundzwanzig Schritt lange Galerie als Verbindung zur Basilika, gleichsam die Verbindung von weltlicher Herrschaft zu Gottes Allmacht; die Basilika ein achteckiger Kuppelraum; überall Marmor und Bronze, Gold und Silber; zahlreiche Nebengebäude für die Archive, den Kronschatz, die Leibwache und die Beamten; in einem alles überragenden Turm schließlich der Wohntrakt für die königliche Familie sowie für die Getreuesten, zu denen wohl auch Arnulf und ich gehören. Wenn die Arbeiten in ungefähr zehn Jahren abgeschlossen sein werden, sind Arnulf und ich, so Gott will, während der Abwesenheit des Königs Herr und Herrin eines Palastes. Mir ist übel. Mein Leben endet hier und jetzt, so kommt es mir vor.
Arnulf machte sein Versprechen wahr. Er hielt Emma beharrlich von mir fern, um meine Gefühle nicht zu verletzen – und vielleicht auch, um sich peinliche Momente zu ersparen. Sie hatte ihr Häuschen, in dem er mehrmals wöchentlich die Nacht verbrachte, und wenn er sie – was selten vorkam – in unser Haus holte, so geschah das mit großer, fast schon grotesker Diskretion. Gewiss sahen wir uns bisweilen aus der Ferne, doch der Abstand, den wir einzuhalten hatten, war Gebot. Arnulfs Standpunkt war: Diese Frau hat für mich nicht vorhanden zu sein, ihr Vorhandensein ist blanke Theorie. In dieser Nacht also, in der nichts so war wie sonst, wurde die Theorie zur Tatsache.
»Ich frage mich, wie lange das wohl dauert«, sagte Emma. »Kommt er heute Nacht noch mal zurück? Er hat mir nichts gesagt.«
Noch immer war nicht ausgemacht, ob sie mit mir oder ihren Fingernägeln sprach. Ich ging zum Kessel und brühte den Sud auf.
»Ich will auch etwas davon«, rief sie.
Ich wandte mich zu ihr um und sah sie wie ein ungezogenes Balg an, worauf sie immerhin ergänzte: »Bitte.« Also brühte ich ihr ebenfalls Sud auf, den ich wortlos in einer Schale auf den Tisch stellte. Ich sah ihr nachsichtig dabei zu, wie sie mit ihrem ein wenig kindlichen Mund den heißen Trank lautstark schlürfte. Eigentlich hatte ich nichts gegen sie, ich meine, gegen sie persönlich. Ich verabscheute nur die Aufgabe, die sie erfüllte. Da Arnulf ausgeglichener geworden war, seit sie ihm ein Kind geboren hatte, war ich ihr sogar ein wenig dankbar. Ich wiederhole: ein wenig …
Ich merke gerade, dass ich dabei bin, zu lügen oder zumindest einen Teil der Wahrheit zu verschweigen. Da ich jedoch diesen Bericht mit der Absicht begonnen habe, Rechenschaft abzulegen vor Gott, vor mir und der Welt, ermahne ich mich ernsthaft, nicht bei der ersten Prüfung, die mir abverlangt wird, zu versagen.
Also gestehe ich: Ich war eifersüchtig auf Emma. Gewiss, das war nicht verwunderlich; schon im Alten Testament sind die Haupt- und Nebenfrauen aufeinander eifersüchtig, weil sie nachts demselben Mann zur Verfügung stehen. Aber vielleicht hätte ich meine Eifersucht besser beherrschen können, wenn Emma nicht so unsagbar schön gewesen wäre: lange schwarze Haare, bronzefarbene Haut, große blaue Augen, Tänzerinnenarme – eine Mischung aus Verführung und unnahbarer Kälte. Sie war viel schöner und – was noch wichtiger ist – von stärkerer Wirkung als ich mit meinem braven braunen Haar und der gesunden burgundischen Fülle. Doch damit nicht genug. Emmas Schönheit übertrug sich auf ihre Umgebung. Einmal hatte ich sie aus ihrem unscheinbaren Häuschen kommen sehen, das Neugeborene auf dem Arm, und mit einem Mal hatte ich mir gewünscht, selbst in diesem Häuschen zu leben. Es gibt Frauen, die sind dazu gemacht, Flächenbrände unter den Männern auszulösen, und es gibt Frauen, die sind wie eine Kerze und erleuchten einen schmalen Bereich um sich herum. Sie gehörte der ersten und ich der zweiten Kategorie an.
Auch in jener Nachtstunde in der Küche an dem schlichten Tisch genügte ein einfaches Strecken ihrer Arme, um den Moment zu etwas Besonderem zu machen, ihn sozusagen zu veredeln. Sie hatte nichts Billiges an sich, außer ihren Umgangston. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden, ich musste ihr dabei zusehen, wie sie sich räkelte und den Kopf mal zur einen, dann zur anderen Seite neigte, wie sie die Augen schloss, wieder öffnete …
»Also, was ist?«, fragte sie. »Kommt er nun zurück oder nicht?«
Ich hatte mich schnell an ihre Anwesenheit, ihre Verwandlung von der Theorie zur Tatsache, gewöhnt und konnte ihr ohne Feindseligkeit antworten. »Ich kann mir nicht denken, dass er vor dem Morgengrauen zurückkommt. Der König wird sich mit ihm besprechen wollen, und dann muss er Spuren überprüfen, den Leichnam aufbahren lassen und so weiter.«
»Ach? Ist jemand tot?«
»Da es einen Leichnam gibt …«
Sie stellte die Schale mit penetranter Heftigkeit auf dem Tisch ab. »Und wer ist tot?«
»Hugo.«
Sie wickelte sich eine Locke um den Finger. »Ei, ei, ei. So was Dummes aber auch.«
Das schien mir, die ich noch immer Gerolds Trauer vor Augen hatte, eine unangemessene Reaktion zu sein, und ich drückte mein Missfallen mimisch aus.
»Du hast mir gar nichts zu sagen«, schleuderte sie mir entgegen.
Zum zweiten Mal blieb mir fast die Luft weg. Ihre Bemerkung war nicht nur aggressiv, sondern zudem mit der Pfeilspitze der ungebührlichen Anrede versehen. Außer Arnulf duzten mich in der Königspfalz nur meine Nichte Gerlindis und meine Freundin Berta, sonst niemand, und ganz gewiss nicht sie, die ich kaum kannte.
Erneut las sie in meinem Gesicht, was mir nicht passte. »Wir stehen auf gleicher Stufe. Du bist die Tochter eines burgundischen Sattlers, und ich bin die Tochter eines alemannischen Müllers.«
Nun wurde es mir zu viel. »Ich bin Gräfin, und du bist keine Gräfin. Das wirst du bitte respektieren.«
»Im Gegenteil, ich möchte selbst Gräfin werden.«
Ich musste zugeben, dass sie mich ein ums andere Mal verblüffte, nicht nur mit dem, was sie sagte, sondern mit der kaltschnäuzigen Selbstverständlichkeit, mit der sie es sagte. So ganz nebenbei, zwischen zwei Schlucken aus der Schale, warf sie mir gleichsam den Fehdehandschuh hin und machte sich noch nicht einmal die Mühe, schäbig zu grinsen. Ich wusste, was sie meinte, und sie wusste, dass ich es verstanden hatte. Mir ihr Vorhaben zu unterbreiten, bewies, wie sicher sie sich ihrer Sache war, und es traf mich doppelt hart, als wenn ich selbst hinter ihren Plan gekommen wäre.
Wir sahen uns an, verständigten uns sprachlos wie zwei Würfelspieler.
Ich sagte mir: Sie hat fast alle Vorteile auf ihrer Seite. Zwischen uns liegen zwanzig Jahre, ein Abgrund, der für mich schon jetzt nicht zu überwinden ist und von Monat zu Monat tiefer wird. In meinem Alter zählt jeder Tag dreifach, in zwei Jahren werden meine Haare angegraut und die Fältchen rund um Augen und Mund zu Falten geworden sein, während Emma noch immer eine junge Frau sein wird. Was für ein seltsamer Zufall, dachte ich, dass der Name Emma aus dem altgermanischen »Ermen« – »allumfassend« – stammt, so als sei sie wie ihr Name die natürliche Nachfolgerin Ermengards als Ehefrau und Gräfin. Aber nicht nur ihre Schönheit ist die Morgengabe, mit der sie sich empfiehlt, sondern mehr noch ihr Schoß. Sie hat Arnulf bereits eine gesunde Tochter geschenkt, und was, wenn das nächste Kind ein Sohn wird?
Wie hätte ich in jener Nacht noch schlafen können, wo doch mein Schoß ein Salzfeld war, in dem jeder Samen, den man hineingelegt hatte, verkümmerte.
5
Um das, was in den nächsten Tagen und bis heute folgte, verstehen zu können, ist es nötig, das Leben kennenzulernen, das ich in den letzten Jahren führte.
Ein beliebiger Tag im Leben der Pfalzgräfin Ermengard. Vor Sonnenaufgang steht sie von ihrem Lager auf. Ihr Gatte Arnulf ist – falls er die Nacht bei ihr gelegen hat – bereits in seine Kammer zurückgegangen. Eine Wasserschale steht bereit. Sie wäscht sich am ganzen Körper, wobei sie sich im Sommer mehr, im Winter weniger Zeit dafür nimmt, denn es herrscht eine Entenkälte. Sie trocknet sich mit Stofftüchern ab, bisweilen auch mit Stroh, weil sie das noch aus der Kindheit kennt, in der sie arm gewesen war.
Die Zofe kommt, kleidet Ermengard an und frisiert sie.
Sonnenaufgang. Ermengard geht in den Gottesdienst. Sie trägt ein gutes Kleid in dezenten Farben und steht in der vordersten Reihe auf der Seite der Frauen. Neben ihr stehen Königin Liutgarde sowie Ermengards Freundin Berta. Was die Männer angeht, so nimmt nicht jeder an allen Messen teil. Die Frauen und Männer niederen Standes, wie zum Beispiel Diener, sind von denen höheren Standes durch ein Gitter getrennt.
Nach dem Gottesdienst zieht sie sich um. Nun trägt sie ein weniger gutes Kleid in noch dezenteren Farben. Sie nimmt mit Arnulf eine Mahlzeit ein, die die Magd bringt: Brot mit Käse, Schinken und Salzhering, Linsen- oder Bohnengrütze und Eier.
Anschließend geht sie in Begleitung der Zofe durch das Dorf Aachen, entweder um dort Besorgungen zu machen oder weil man sie in einer Angelegenheit um mildtätige Hilfe gebeten hat, die sie stets leistet. Meist handelt es sich um Familien in größter Not, um Hunger, Krankheit, Tod … Niemals wendet man sich in Fragen an sie, die die Angelegenheiten Arnulfs betreffen. So etwas wäre unstatthaft.
Zur Mittagszeit besucht sie den zweiten Gottesdienst, wobei sie sich zuvor und danach wieder umzuziehen hat. Den Nachmittag verbringt sie mit den Näharbeiten an Arnulfs und ihren Kleidern. Vom Zuschnitt bis zu den Feinarbeiten geht alles durch Ermengards Hände. Diese Stunden verbringt sie manchmal allein, viel öfter jedoch mit Berta, gelegentlich mit Prinzessin Teodrada und selten mit der Königin.
Vor Sonnenuntergang besucht sie den dritten Gottesdienst. Zu Hause steht bei der Rückkehr das Abendmahl für Arnulf und sie bereit: ein Stück Fleisch vom Widder, Hammel oder Ochsen, Kohl, Erbsen, Bier für Arnulf, freitags Aal. Bald darauf geht Gräfin Ermengard zu Bett, ein äußerst bequemes Paradies aus Teppichen, Wollkissen und Pelzen, die auf dem Boden liegen. Zwei- bis dreimal wöchentlich wird sie dort von ihrem Gemahl besucht.
Ausnahmen von diesem Ablauf sind die gelegentlich stattfindenden Falken- oder Hetzjagden, denen Ermengard als Zuschauerin beiwohnt, sowie die hohen Feiertage und die Bankette. An dreihundertvierzig Tagen im Jahr gibt es keine Ausnahmen.
Ich nehme zwei gleich starke, sich widersprechende Gefühle wahr, wenn ich diese Zeilen, die ich soeben geschrieben habe, lese.
Zum einen Geborgenheit – ein seltsames Gefühl, das sich an den unmöglichsten Orten und trotz unmöglichster Zustände einstellt, wenn uns die Orte und Lebensumstände zur Gewohnheit geworden sind. Ich habe Frauen erlebt, die sich beharrlich weigerten, eine armselige, verfallene Behausung zugunsten einer besseren zu verlassen, und ich habe Frauen erlebt, die sich ebenso beharrlich weigerten, Traurigkeit, Schmerz oder Zorn zu verlassen, obwohl sie von ihnen zugrunde gerichtet wurden. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Jetzt frage ich: War auch ich eine jener Frauen? Zweifellos habe ich mich in meinem Leben sicher gefühlt, auch wenn es mir nicht das bot, wonach ich mich sehnte – ein Kind, eine Familie, gute Gespräche mit Freunden, die Freiheit, die ich als Mädchen gehabt hatte, als ich über Hügel spaziert war. Aber wenigstens war die unendliche Wiederholung der Tage und Stunden ein stabiles Bollwerk gegen …
Wogegen, das weiß ich nicht mehr. Wie doch zwei Wochen etwas vergessen lassen können, was jahrelang Bestand hatte. Heute empfinde ich ein wahnsinniges Glück – ich bitte das wörtlich zu verstehen –, ein wahnsinniges Glück, das Gleichmaß meines Lebens zu durchbrechen.
6
Am Morgen nach dem Fund von Hugos Leiche und dem Gespräch mit Emma ging ich durch Aachen. Ich war von Emmas Anspruch zutiefst verunsichert und suchte Halt in den üblichen Ritualen meiner Tage. Allerdings war dieser Gang durch Aachen die einzige Beschäftigung, die ich stets wirklich genoss. Und da ich durch Gottes Gnade in eine Stellung gekommen bin, die mich der Armut enthoben hat, kommt mir die Pflicht zu, die Armut anderer zu lindern.
An diesem Tag wandte sich ein Steinmetz an mich, dessen Frau von Krankheit niedergeworfen worden war. Drei Tage lang hatte er alles versucht, doch ihr Zustand verschlimmerte sich, und er konnte sich weder einen Arzt noch weiteres Fernbleiben von der Arbeit leisten. Ich ließ einen Arzt kommen und zahlte dem Steinmetz einen Wochenlohn, mit der Bitte, mich auf dem Laufenden zu halten.
Wegen der großen Kälte, die zu erwarten war, verteilte ich Wollstoffe, mit denen die Ärmsten sich die Beine und Arme einwickeln konnten.
Während ich durch die von Nebel durchwobenen Gassen ging, traten von links und rechts aus den Holzhütten Kinder in Lumpen hervor und grüßten mich stumm mit ihren kleinen Händen. Alte Frauen sammelten Schnee in Eimern, unterbrachen ihr Gespräch, nickten mir zu. Männer bei der Arbeit lüfteten ihre Kopfbedeckung. Die meisten Leute kannte ich, bei manchen hatte ich schon in der Hütte gesessen, einige sagten mir im Vorbeigehen nette Worte. In ihren Augen stand oft Dankbarkeit, aber wer glaubt, ich würde von ihnen geliebt, der irrt. Ich bin die Gräfin, man kann mich nicht lieben. Obwohl ich vertraut mit ihren Nöten bin, ihre Armut lindere, so manchen ihrer Söhne und Töchter, Mütter und Väter in schlimmer Lage geholfen habe, bin ich diesen Leuten so fremd wie eine Lilie dem Sumpf fremd ist, aus dem sie aufragt.
Als ich meinen Rundgang durch das seit einigen Jahren schnell wachsende Dorf fast beendet hatte, sah ich ihn wieder. Er war ein Junge von etwa zehn Jahren. Tag für Tag stand er in der Mitte des Dorfes und bot seine eigenen Schnitzereien feil, zumeist Gebrauchsgegenstände wie Suppenkellen und Schalen, aber seine besondere Zuneigung galt den Tieren, die er mit erstaunlicher Kunstfertigkeit darstellte. Er verkaufte wenig, denn die Händler verjagten ihn immer wieder. Ich jedoch hatte ihm im Laufe des Jahres eine Arche Noah voller Holztiere abgekauft.
Kürzlich hatte er gesagt: »Ihr kauft meine Tiere nur, um mir Gutes zu tun.« Den gekränkten Ausdruck in seinen Augen werde ich nie vergessen. Natürlich widersprach ich ihm, aber er sah nicht aus, als würde er mir glauben. Dazu bestand auch kein Anlass, denn leider war viel Wahres an seiner Behauptung. Er brauchte Geld, und ich besaß welches. Er verkaufte Schnitzereien, und ich kaufte sie ihm ab – aber nicht nur, weil er von ihrem Verkauf lebte, sondern auch wegen der Begeisterung, mit der er sie herstellte. Die Wildtiere, Hunde und Vögel aus Holz brachten ein wenig von dieser Begeisterung in mein leeres Haus.
Ihm das so zu erklären, wie ich es gerade getan habe, ging mir zu weit. An jenem Morgen also beschloss ich, einen Kniff anzuwenden, indem ich jemanden bat, ihm einige der Schnitzereien abzukaufen. Meine Zofe konnte ich nicht schicken, da sie mich bisher immer begleitet hatte und er die List durchschaut hätte.
Eine junge Schänkerin aus der Gegend, die gerade vorbeikam, schien mir die Richtige. Ich erklärte ihr, was zu tun sei. »Die Sachen darfst du alle behalten, und suche du dir auch eines seiner Tiere aus.« Ich drückte ihr eine Münze in die Hand und beobachtete aus einem Versteck, was passierte. Sie kaufte ihm vier Schalen und vier Löffel ab und wählte nach sorgfältiger Betrachtung eine Eule aus – eine wahrhaft weise Entscheidung. Als die junge Schänkerin gegangen war, sah ich die Freude auf seinem Gesicht, die nicht allein vom Geld hervorgerufen wurde.
Ich konnte lange meinen Blick nicht von ihm abwenden.
Als ich mich endlich auf den Heimweg machen wollte und mich zu meiner Zofe umdrehte, stand eine fremde Frau vor mir – fremd, weil ich sie nicht kannte, und fremd, weil sie fremdartig aussah. Ihre braunen Haare, die sie offen trug, hatten einen starken rötlichen Schimmer, die Farbe ihrer Augen war ungewöhnlich hell, die Haut war von pergamentener Bräune. Ich schätzte sie fünf bis sieben Jahre älter als mich ein. Auffälliger als ihr Aussehen war ihre Kleidung. Selbst heute fällt es mir noch schwer zu sagen, was das alles war, was sie trug. Man stelle sich zahlreiche Tücher vor, die sich in einer gewissen Anordnung – die sich meiner Fähigkeit der Beschreibung entzieht – um ihren Körper wanden.
»Wo ist meine Zofe?«, fragte ich.
Sie zog die Augenbrauen hoch und sah mich in einer Weise an, dass es mich nicht überrascht hätte, wenn ihre Antwort gewesen wäre, ich habe sie weggezaubert. Man hört ja immer wieder von solchen Vorfällen, von Spuk, den selbst die heilige Kirche nicht erklären kann, und immer sind Frauen daran beteiligt.