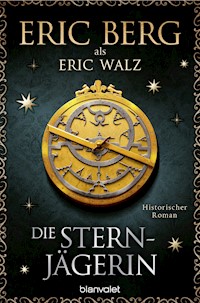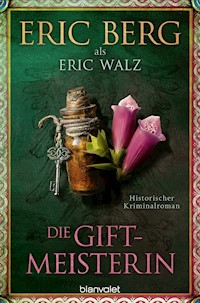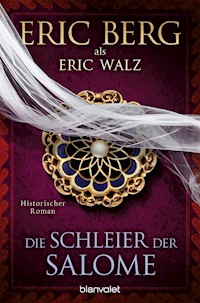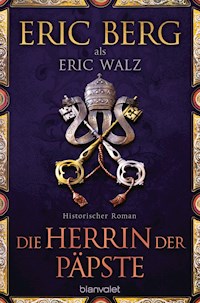9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Porzellan-Dynastie
- Sprache: Deutsch
Die Blankenburgs – eine mächtige Dynastie, eine dramatische Geschichte. Grandiose Unterhaltung von Bestsellerautor Eric Berg!
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs haben allen Grund zur Freude: Vor kurzem feierten sie das 150jährige Jubiläum der familieneigenen Porzellanmanufaktur, die Auftragsbücher sind voll, und die Krise der frühen Zwanzigerjahre liegt hinter ihnen. Aber das hart errungene Glück zerbricht mit einem Schlag, als Aldamar, das Familienoberhaupt, und sein Schwiegersohn Richard ihr Vermögen im großen Börsencrash verlieren und keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen. Zwischen den Schwestern Ophélie und Elise entbrennt ein erbitterter Erbstreit, der die Familie zu entzweien droht. Doch damit nicht genug. Mit dem Erwachen des Nationalsozialismus beginnt auch der Überlebenskampf der Blankenburgs. Um die Porzellanmanufaktur zu retten, sind die Schwestern bereit, neue Wege zu gehen und über sich hinauszuwachsen ...
»Die Blankenburgs« ist der Auftakt des großen Zweiteilers. Lesen Sie auch die Fortsetzung »Das Schicksal der Blankenburgs«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs haben allen Grund zur Freude: Vor Kurzem feierten sie das 150-jährige Jubiläum der familieneigenen Porzellanmanufaktur, die Auftragsbücher sind voll, und die Krise der frühen Zwanzigerjahre liegt hinter ihnen. Aber das hart errungene Glück zerbricht mit einem Schlag, als Adalmar, das Familienoberhaupt, und sein Schwiegersohn Richard ihr Vermögen im großen Börsencrash verlieren und keinen anderen Ausweg sehen, als sich das Leben zu nehmen. Zwischen den Schwestern Ophélie und Elise entbrennt ein erbitterter Erbstreit, der die Familie zu entzweien droht. Doch damit nicht genug. Mit dem Erwachen des Nationalsozialismus beginnt auch der Überlebenskampf der Blankenburgs. Um die Porzellanmanufaktur zu retten, sind sie bereit, neue Wege zu gehen und über sich hinauszuwachsen …
Autor
Eric Berg zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten deutschen Autoren und begeistert Kritiker und Leser immer wieder aufs Neue. Neben seinen Kriminalromanen – allesamt SPIEGEL-Bestseller –, in denen er bereits starke Frauenfiguren ins Zentrum rückt, widmet er sich jetzt dem historischen Roman und beeindruckt mit detailreichen Schilderungen, pointierten Dialogen und hervorragender Recherche. »Die Blankenburgs« erzählt vom Aufstieg und Fall einer imposanten Porzellandynastie und von den Frauen der Familie, die dem Schicksal die Stirn bieten und im Angesicht großer Not über sich hinauswachsen.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
ERIC BERG
Die
Blankenburgs
Band 1
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Eric Berg
Copyright © 2021 by Blanvalet in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Troni
Umschlagmotiv und -gestaltung:
© Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven
von Shutterstock.com und Richard Jenkins Photography
Frau: RJ-1920s Set 11-052 (Richard Jenkins Photography)
Blätter: shutterstock_696824716 (wacomka/shutterstock.com)
Blume: shutterstock_1699735675 (Be_your_self/shutterstock.com)
KW · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-26561-8V002
www.blanvalet.de
Stammbaum
Für Petra Hermanns, meine Literaturagentin, mit der mich seit zwanzig Jahren eine vertrauensvolle und herzliche Zusammenarbeit verbindet
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; unglücklich ist jede Familie auf ihre eigene Art.«
Leo Tolstoi (1828 – 1910), Anna Karenina
Erster Teil
Als die Erde bebte (1929 – 1931)
1
Oktober 1929
Elise blickte zur großen Treppe der Eingangshalle. Von dort weiter nach rechts auf die imposante Standuhr, die Viertel nach sieben zeigte. Auf ihre Tochter Emma, die summend an der Wand lehnte, mit den Schuhspitzen wippte und die Augen zur Decke richtete. Wieder zur Treppe. Das Schweigen war kaum auszuhalten.
Keiner von ihnen sagte ein Wort. Elise, weil das Ticken der Uhr sie nervös machte. Ihr Vater konnte Verspätungen nicht ausstehen, und ihr Mann wusste das. Emma, weil sie keine Lust hatte, weder auf die anstehende Geburtstagsfeier noch auf das Wiedersehen mit der Verwandtschaft und schon gar nicht darauf, einen rosafarbenen Hut samt den passenden Schuhen zu tragen. Mit siebzehn war sie in einem Alter, in dem viele Mädchen die Dinge ablehnten, einfach, weil es die Dinge waren. Rosa, vor einem Jahr noch heiß geliebt, war passé.
»Darf ich den Hut abnehmen?«
»Keinesfalls«, erwiderte Elise. »Es hat zwanzig Minuten gedauert, ihn dir aufzusetzen.«
»Das Viech juckt aber.«
»Mit der Farbe hat das gewiss nichts zu tun.«
»Rosa ist keine Farbe, Mama, Rosa ist ein Klischee. Ich könnte mir genauso gut ein Schild auf den Kopf setzen, auf dem steht: Ich bin ja so süß.«
»Die waren leider ausverkauft. Was willst du? Seit einem halben Jahr liege ich dir damit in den Ohren, dass wir Hüte einkaufen. Nun passt dir nur noch dieser hier, weil du deine Haare in die Wolken wachsen lässt, und ohne kannst du unmöglich gehen. Dein Großvater hasst Frauen ohne Hüte.«
»Und das ganze Tamtam nur für meine über alles geliebten Cousins. Der eine ist ein Langweiler, der immer nur von Sport und Politik redet, und der andere hat nichts als Albernheiten im Kopf.«
»Du sollst die beiden nicht mögen, du sollst ihnen zum Geburtstag gratulieren.«
»Das ist doch scheinheilig, jemandem Glück zu wünschen, den man nicht mag.«
»Sie wünschen dir auch immer Glück.«
»Doch bloß, weil man ihnen sagt, dass sie es tun sollen.«
»Du tust es auch nur, weil ich es dir auftrage. So etwas nennt man Höflichkeit, die hat schon Kriege verhindert.«
Argumente waren für Elises Tochter Eiszapfen im Frühlingswind, sie hatten ein kurzes Leben. Wenn Richard nicht in den nächsten Minuten erschien, war Emma glatt imstande, sich den Hut vom Kopf zu reißen, die Frisur zu zerwühlen und im Garten auf den nächsten Baum zu klettern. Dass das Kind inzwischen fast erwachsen war, hatte nichts an dieser über die Jahre kultivierten Marotte geändert. Ihr Vater ließ es ihr immer noch durchgehen.
Elise machte einige Schritte zur Treppe hin, so als wollte sie tatsächlich nachsehen, wo ihr Mann blieb. Am Geländer hielt sie inne. Ergriff es. Ließ es wieder los, als sei es zu heiß.
»Das machst du ja doch nicht!«, rief Emma quer durch das Atrium und wiegte sich zu einer Walzermelodie in ihrem Kopf. Das war ihre Art, den kleinen Sieg zu feiern.
Richard Dobel war dafür bekannt, dass er nie etwas vergaß, niemals. Schon gar keine Familienfeier. Wenn er also nicht aus seinem Büro herauskam, hatte er einen gewichtigen Grund. Es musste mit dem Telegramm zu tun haben, das eine Stunde zuvor eingetroffen war.
»Er drückt sich«, sagte Emma lachend. »Er hat so viel Lust auf diese verkrampfte Feier wie auf eine Woche mit Mumps im Bett.«
Elise kannte ihren Mann besser als Emma ihren Vater. Selbst wenn Richard das Familientreffen unwillkommen gewesen wäre – er bemaß einen Termin nicht nach dem Grad des Amüsements, das ihn erwartete, so wenig, wie ein Uhrzeiger sich fragte, ob er Lust auf die Zwölf hatte.
»Ach, Biene!«, rief Elise, als sie im ersten Stock eine Bewegung bemerkte. Selbst aus den Augenwinkeln und wenn man nur den Schatten sah, erkannte man, wenn das erste Hausmädchen vorüberging. Eigentlich hörte man es auch. Unter ihrem Schritt erzitterten die Gläser in den Vitrinen wie unter einem Vorbeben.
Bienes Oberkörper wölbte sich wenig elegant über das Geländer. »Ja, gnädige Frau?«
Eigentlich hieß sie Eberhardine, aber außer Richard, der Kosenamen grundsätzlich ablehnte, nannte sie niemand so. Ihrem Körperbau und ihrer Stimme nach hätte sie eigentlich Hummel heißen müssen, und wie es zu Biene gekommen war, wusste niemand mehr, auch sie selbst nicht. Seit einundzwanzig Jahren war sie inzwischen im Haus, seit Elises Eheschließung, und davor schon bei den Blankenburgs, Elises Eltern. Nicht nur deshalb war Biene längst nicht mehr wegzudenken.
»Du hast dem gnädigen Herrn vorhin das Telegramm gebracht, nicht wahr? Was stand denn drin?«
»Also wirklich, gnädige Frau«, brummte Biene und stemmte einen Arm in die Hüfte.
»So meine ich das nicht. Was hat er denn gesagt, als er es entgegennahm?«
»Er hat es nur groß angeglotzt. Verzeihung, interessiert besehen. Der gnädige Herr meint ja, ich drücke mich nicht vornehm genug aus.«
Elise seufzte. »Und mit welchem Gesichtsausdruck hat er es besehen?«
»Ehrlich, gnädige Frau, ich bin Ihr Hausmädchen und nicht die Schülerin dieses Professors Feudel.«
»Freud, liebe Biene«, korrigierte Emma. »Der Begründer der Psychoanalyse.«
»Derselbige.«
Biene hatte geholfen, Emma auf die Welt zu bringen. Später war sie für ein paar Jahre ihr Kindermädchen geworden, weil Emma mit niemand anderem zurechtgekommen war. Drei Erzieherinnen hatte die Vierzehnjährige, Fünfzehnjährige binnen zwei Jahren verschlissen.
»Mama denkt, dass Papa noch arbeitet, aber ich glaube, dass er das nur vortäuscht, damit er seinen großspurigen Neffen nicht die Hand geben muss. Was soll das alles? Das Rad wäre nie erfunden worden, wenn drei Frauen klug drüber geschwatzt hätten. Ich für meinen Teil habe genug davon, mit diesem albernen rosafarbenen Hut hier herumzustehen. Ich gehe jetzt rauf und …«
»Nein, lass mich!«, rief Elise, ohne zu überlegen. Das tat sie gleich danach, aber da war es zu spät. Vor ihrer Tochter, mehr noch vor Biene, wollte sie sich keinen Rückzieher leisten.
»Ma chère Maman«, sagte Emma lachend. »Was ist denn nur in Sie gefahren? Biene, was hast du Mama heute in den Tee getan? Ein Kraut namens Courage?«
Auch Biene lachte, und nun gab es wirklich keinen anderen Weg mehr für Elise als den in Richards Büro.
»Ich bin gar nicht so«, sagte sie, während sie mit übertrieben durchgedrücktem Kreuz die Treppe hinaufging. »Es macht mir nicht das Geringste aus und Richard auch nicht. Ich denke nur, er wird sowieso gleich herauskommen.«
Noch als sie den Gang entlang auf die Tür zuschritt, hoffte sie darauf. Ebenso, als sie die rechte Hand zum Klopfen hob. Im letzten Moment bemerkte sie, dass sie noch ihre Handschuhe trug, und als würde es einen bedeutenden Unterschied machen, wie man an eine Tür klopfte, zupfte sie das feine Linnen Finger für Finger von ihrer Haut. Das dauerte gewiss eine Minute. Doch auch die war irgendwann vergangen, ohne dass sich die Tür von selbst geöffnet hätte.
Ein Blick in den silbernen Prunkspiegel gleich daneben verlängerte die Frist erneut. Die schwarzen Haare passten, wenn man ehrlich war, nicht zu Hut und Kleid. In dieser Saison waren Ocker und Braun in Mode, was natürlich niemand so nannte. Die Caféhäuser, die Promenaden und die Salons in Frankfurt waren voll von Roben in Marone, Kakao, Kirschbaum und Terrakotta.
Ebendeshalb hatte Elise Weiß gewählt. Nicht Schnee, nicht Apfelblüte, sondern, falls jemand sie darauf ansprechen sollte, simples Weiß.
Weiß im Oktober, bei Regen.
Von Zeit zu Zeit sagte ihr Richard, dass sie auf ihre Weise genauso berechenbar sei wie jene Menschen, von deren Berechenbarkeit sie sich abgrenzen wolle, und dass sie gut daran tue, von Geschäften und Kartenspielen die Finger zu lassen. Was er anfasste, wurde zu Gold, daher wusste er vermutlich, wovon er sprach.
Was war das da in ihren Augen? Dort, hinter dieser Gleichmut? Traurigkeit, weil sie sich von Richard verkannt fühlte? Weil er niemals etwas lobte, was sie tat, sondern immer nur, was sie darstellte: ihre tadellose Haltung, ihre etwas zu stark ausgeprägten Wangenknochen, die ihr einen Anschein von Robustheit verliehen, den schlanken, faltenlosen Hals? Die Augen, immer wieder ihre schwarzen Augen, an denen er sich nicht sattsehen konnte. Darin lag ein Hauch von Flieder, so als hätte jemand eine Kelle voll Violett in einen Topf mit schwarzer Farbe gerührt. Vor seinen Freunden im Sportclub – Richard war Mitglied, spielte aber nur selten Tennis – prahlte er gerne mit seiner Frau, sie hatte es einmal zufällig mit angehört. Ihr war nicht wohl dabei, dass ihr Erscheinungsbild Gesprächsgegenstand in Männerrunden war, auch wenn sie dabei gut wegkam. Sie verfüge, sagte er außerdem über sie, über eine klassische Anmut, wie die Frauen in den Romanen Thomas Manns.
Vielleicht wäre dieses Kompliment etwas wert gewesen, würde Richard Dobel Romane lesen. Doch er bevorzugte Börsenberichte und ließ sich ansonsten von seinem Sekretär über den Inhalt der neuesten Belletristik informieren, falls – was eher unwahrscheinlich war – im Kreis seiner Sportkameraden, Freunde und Geschäftspartner die Sprache auf Literatur kommen sollte.
Durch die Bürotür drang der dumpfe Gong der Halbachtglocke. In diesem Moment hätten Elise, Richard und Emma eigentlich das Haus ihrer Schwester betreten müssen. In diesem Moment zückte ihr Vater sicher seine Taschenuhr und warf einen kritischen Blick darauf.
»Richard?«
Sie klopfte. Räusperte sich. Atmete tief durch.
»Richard?«
Ihre Hand schwebte über der Türklinke, senkte sich auf sie nieder. Sie öffnete die Tür gerade so weit, dass sie hindurchpasste.
»Richard, entschuldige bitte, der Wagen wartet. Und Papa, Ophélie und die Jungs gewiss auch schon. Bist du so weit?«
Er saß auf seinem ausladenden ledernen Schreibtischsessel, der sehr hart gepolstert war. Richard mochte nichts Weiches. Sein Händedruck, sein Schritt, sein Blick – alles war fest. Nicht streng, aber stramm. Umso überraschender war, dass er Elise an diesem Abend aus glasigen Augen entgegensah. Hätte sie es nicht besser gewusst, hätte sie auf Alkohol getippt. Allerdings trank Richard nie, keinen Tropfen, nicht einmal Champagner, der für die Familie ihrer Eltern gar nicht zu den Alkoholika zählte.
Erst als sie näher trat, erkannte Elise die wahre Ursache.
Als es acht Uhr durch war, winkte Ophélie den Diener heran. »Beginnen Sie, die Hors d’oeuvre anzubieten«, wies sie ihn an.
»Das werden Sie unterlassen«, befahl Adalmar Blankenburg.
»Aber Vater!«, rief sie. »Die Gäste trinken seit einer Stunde Champagner, ohne etwas im Magen zu haben.«
»Sie haben Champagner im Magen, das genügt ja wohl. Wenn sich einer beklagt von dem blaublütigen Gesocks, das du und dein Mann eingeladen habt, schickst du ihn zu mir. Solange Elise nicht eingetroffen ist, gibt’s nichts zu essen.«
»Meine kleine Schwester ist beklagenswert unpünktlich«, beschwerte sich Ophélie.
»Haben Sie nicht gehört, Lakai?«, herrschte Adalmar den jungen Diener an. »Treten Sie auf Ihren Platz zurück, und wehe, ich sehe Sie auch nur einen Krümel anbieten. Dann fliegen Sie hochkant raus.«
Ophélies Hals bebte. Es war ihr Haus. Es waren ihre Freunde, die ihr Vater brüskierte. Ihre Feier, die er ruinierte. Er wusste, was er ihr damit antat, und bemühte sich nicht, es zu verstecken. Die Wahrheit lag ihm auf den Lippen, die sich zu einem zynischen Lächeln formten, als der Diener seinen Anweisungen gehorchte, ohne noch einmal Rücksprache mit seiner Herrin zu halten. Spöttisch wandte Adalmar sich ihr zu.
»So, meine Liebe. Nun, wo das geklärt ist, bist du wohl so freundlich, deinem Vater Champagner nachzuschenken. Falls du das hinkriegst.«
Sie ergriff eine Flasche. Ihre Hände zitterten. Vor Wut natürlich, über die Demütigung. Doch auch weil sie seinen Blick auf sich spürte. Er las gerne in den Gesichtern nach, was er angerichtet hatte, und nach all den Jahren war Ophélie für ihn wie ein offenes Buch.
Immer, wenn er mit ihr sprach, fixierte sein Blick ihr linkes Auge, das seit dreißig Jahren nicht mehr existierte. Er hätte ihr problemlos ins rechte Auge sehen können, so wie ihr Mann, wie ihre Kinder, wie alle normalen, höflichen Menschen. Er bevorzugte jedoch das verlorene. Und erinnerte sich mit einem gewissen Amüsement an die dazugehörige Geschichte. Anfangs hatte er ihr ein Holzauge verpasst, mit dem sie aussah wie eine fleischgewordene Figur aus dem Marionettentheater. Später ein Porzellanauge, Marke Blankenburg natürlich. Nach ihrer Heirat hatte sie sich Gesichtsmasken aus Stoff anfertigen lassen, außerdem geflammte Brillen …
»Was ist denn das für ein neuartiges Geflitter um deinen Kopf herum?«, fragte Adalmar.
Ophélie war vor einiger Zeit dazu übergegangen, einen Federhut tief in die linke Gesichtshälfte zu ziehen und eine seidene Augenklappe auf die leere Höhlung zu heften. Wer nicht genau hinsah, kam gar nicht auf den Gedanken, da könnte was nicht stimmen.
»Seltsames Konstrukt. Sind das Rebhuhnfedern?«
»Paradiesvogel.«
»Damit siehst du aus wie eine Pariser Kokotte. War das etwa die verwegene Idee deines Mannes?«
»Edmond hat nichts damit zu tun. Mir gefällt es so besser.«
»Lächerlich.«
Adalmar versuchte, nach dem Hut zu greifen, doch sie wich ihm aus. Er setzte nach, sie trat einen Schritt zurück.
»Hab dich nicht so, alle hier wissen, was sich unter dem Geflitter verbirgt.«
Am liebsten hätte sie ihm entgegnet, dass auch alle wüssten, was sich hinter der Knopfleiste seiner Hose verbarg, und doch ließe er das Beinkleid nicht herunter.
»Wenn alle im Bilde sind, ist es kaum nötig, sie damit zu behelligen.«
»Ich habe als junger Mann bekanntlich die Hälfte meines kleinen Fingers verloren. Trotzdem habe ich mich nie damit lächerlich gemacht. Man muss zu seinen Unzulänglichkeiten stehen, das stählt den Charakter.«
Die Fingerkuppe eines Mannes mit dem Auge einer Frau zu vergleichen! Unzulänglichkeit … Erst mit dreißig Jahren hatte Ophélie geheiratet, lange nach Elise, die sechs Jahre jünger war. Eine Einäugige war nun mal keine gute Partie. Zudem hatte Ophélie nach dem Verlust ihres Auges sehr an Gewicht zugenommen und es nie wieder in den Griff bekommen. Zu allem Übel hatte beides über die Jahre zu einer Art Schwermut geführt.
Bis Edmond aufgetaucht war.
Auch jetzt trat er wieder an ihre Seite. Das genügte, damit Adalmar die Übergriffe sein ließ – vorerst. Es gab keinen Grund für ihn, seinen französischen Schwiegersohn zu respektieren oder gar zu fürchten, aber auch keinen für Edmond, Adalmar zu respektieren oder zu fürchten. Wo man ihn nicht fürchtete, fühlte Adalmar sich nicht wohl. Dies wiederum führte bei ihm nicht selten zu noch größerer Reizbarkeit als sonst.
Edmond holte sein Prunkstück von Taschenuhr hervor und sagte: »Damian sollte jetzt seine Glückwünsch und Trinkenspruch erhalten. Er ist die Erbe der Blankenburgs, und es macht keine gute Gesicht, ihn so stehen zu lassen und warten.«
Edmonds Deutsch war auch nach zwanzig Jahren in Frankfurt noch recht fehlerhaft, deshalb sprach er in der Regel nicht viel. Musste er auch nicht, denn Edmond hatte keine geschäftlichen und nur sehr wenige gesellschaftliche Verpflichtungen. Auf seiner Visitenkarte, die er verteilte wie ein Prediger Bibeln, stand »Privatier«. Dies war er aus voller Überzeugung, er ging sogar so weit zu behaupten, dass es durchaus eine Kunst sei, eine Rolle als Privatier, also als Nichtsnutz, sinnvoll auszufüllen.
»Schwiegersohn«, sagte Adalmar. »Deinem Kauderwelsch entnehme ich, dass du mir vorschreiben willst, wann ich meine Rede zu halten habe. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, du als Allerletzter.«
»Kaudewisch? Was ist das?«, fragte Edmond, womit er Adalmars Äderchen, die sich von der Nase bis zu den Ohren erstreckten, zum Pulsieren brachte.
»Hampelmann, du. Ich habe ein Porzellanimperium aufgebaut, als man dir noch Brei in die prallen Backen gestopft hat.«
»Imperium?«, wiederholte Edmond, steckte ein Zigarillo in die silberne Spitze und zündete es an. »Ist es nicht so, liebe Schwiegervater, dass du es geerbt hast nur? Einhundertundzwölf Person dieses Imperium gehabt hat? Und heute, fünfzig Jahr später, hat es wie viele Person? Einhunderteinunddreißig? Uuuh, eine spektakülär Steigerung um neunzehn Person in eine halbe Jahrhundert. Lass mich deine Hand schütteln, oh große Imperator.«
Tatsächlich ergriff er die Rechte von Ophélies Vater, die dieser ihm sogleich wieder entzog.
»Du lackierter Parvenü«, giftete Adalmar. »Wenigstens wissen wir, dass du das, was du bist, aus eigener Kraft geschafft hast, nicht wahr? Ein Verbannter, Ausgestoßener, ein Paria für seine eigenen Leute. Mieser kleiner Schwerenöter …«
»Damit das hier mal vorangeht«, ertönte eine Stimme aus der Mitte des Salons. Damian hob das Glas. »Auf meine Familien, die Blankenburgs und die Fleurys.«
Ein Fünfzehnjähriger rettete die Situation. Nach diesem Trinkspruch blieb Adalmar nichts anderes übrig, als die Geburtstagsrede auf Ophélies Erstgeborenen zu halten, und so geschah es. In den Stolz der Mutter mischte sich die Sorge, wie die Welt wohl morgen aussehen würde, nach diesem Disput.
»Wieso hast du ihn provoziert?«, fragte sie Edmond.
»Weil es dafür nur wenige Anstrengung braucht. Und weil deine Vater keine andere Sprach mehr hasst als die ironische.«
»Er ist alt.«
»Ja, aber du verteidigst ihn noch immer, tausend Kränkung später.«
»Er ist mein Vater.«
Edmond zuckte mit den Schultern und leerte das Champagnerglas, das er anschließend wie ein Kartenspieler sein Herzass zwischen den Fingern jonglierte, während er lange an der Zigarettenspitze sog. »Ich bin da viel ehrlicher. Meine Familie mich hat fallen gelassen, deshalb ich auch sie. Soll sie fahren zu Teufel.«
Für Edmond war alles einfach. Es lag an Frankreich, am Blut seiner Familie, am Geld, das er im Überfluss hatte. Er brach so schnell einen Streit vom Zaun, wie er ihn wieder beizulegen vermochte. Diese Leichtigkeit war sein Glück – und zugleich sein Unglück. Denn sie hatte ihm gewissermaßen die Verbannung eingebracht.
Ophélie hatte Edmond de Fleury vor sechzehn Jahren bei einer Abendgesellschaft in Königstein im Taunus kennengelernt, zu der Nachbarn der Blankenburgs eingeladen hatten. Sie fand ihn sogleich anziehend, und er störte sich nicht an ihren Makeln. Nach zehn Minuten war sie in seine dandyhafte Gelassenheit verliebt. Nach zwanzig Minuten war er in ihr verbliebenes Auge verliebt, mit dem sie ihn anhimmelte.
Noch am selben Abend sagte er zu ihr: »Ich muss Sie vor mir warnen, Mademoiselle. Meine Familie mich hat verstoßen, weil ich habe drei Kinder von drei verschiedene Frauen. Das nennt man hierzulande eine Windenhund, n’est pas?«
Wären diese Frauen Hausmädchen gewesen, Wäscherinnen oder Bauerntöchter, kein Fleury hätte ihm ernste Vorhaltungen gemacht. Doch hatte er sich die Schwester eines Bankiers ausgesucht, die Mutter eines jungen Ministers sowie die Tochter eines Romanciers, dessen Berufsstand in der Grande Nation weit höheres Ansehen genoss als jener der beiden anderen. Da Edmond unmöglich alle drei Geschwängerten ehelichen konnte und eine Heirat mit einer von ihnen unweigerlich die Familien der beiden anderen erbost hätte, schickte man ihn fort. Jeder andere Fleury wäre in den diplomatischen Dienst eingetreten und hätte die Interessen der Nation in Siam, Kolumbien oder Abessinien vertreten. Allerdings hätte das Arbeit bedeutet.
Zuerst war er nach England gegangen, doch ohne Titel, Posten oder Militärkarriere erhielt man dort als Franzose keine Einladungen und langweilte sich zu Tode. Die Niederländer waren ihm zu protestantisch, die Italiener zu chaotisch, die Schweizer zu ernst und die Österreicher zu charmant, also strandete er in Ermangelung von Alternativen eher zufällig in Deutschland. Er fand, die Deutschen hätten ihren Perfektionismus dermaßen perfektioniert, dass sie selbst die Sünden vervollkommneten, und das sei doch eine recht annehmbare Haltung.
Ophélie schlug seine »Warnung« in den Wind, auch weil er sie mit Charme vorgetragen hatte. Die Hochzeit fand sechs Monate später statt, was auch Adalmar nicht verhindern konnte. Schon bald kamen ihre Zwillingssöhne zur Welt und ein paar Jahre später Marie.
Ein einziges Mal hatte sich Ophélie gegen ihren Vater durchgesetzt.
Sie hoben das Glas, als der Patriarch auf seinen Enkel anstieß, den zukünftigen Erben der Manufaktur.
»Hier, mein Bester«, sagte Adalmar und überreichte dem Geburtstagskind eine kleine Kiste. Darin befand sich eine silberbeschlagene Pistole. »Stammt von achtzehnhunderteinundsiebzig. Damit hat der Bruder meines Vaters gewiss ein paar Franzmänner erschossen.«
Adalmar lachte und warf einen hämischen Seitenblick auf seinen Schwiegersohn, den er damit jedoch nicht treffen konnte. Edmond war so wenig Patriot wie Adalmar ein Gentleman.
»Ich weiß nicht recht«, wandte Ophélie ein. »Ist Damian nicht ein bisschen zu jung für eine Waffe?«
»Mumpitz«, bügelte Adalmar den Einwand nieder. »Ich war selbst erst fünfzehn, als ich diese Pistole von meinem Vater geschenkt bekam. Der Junge hat Muskeln, ein paar zu viele für meinen Geschmack. Wozu sollen die gut sein, wenn nicht, um sich mit einer massiven Pistole wie dieser zu einem Meisterschützen zu entwickeln? Ich treffe heute noch einer Maus auf eine Entfernung von dreißig Metern ins Auge, sagen wir ins linke.« Er lachte mit Schmelz über die Gemeinheit.
»Danke, Großvater«, sagte Damian, der so tat, als bemerke er nichts. Er hatte die schwarzen Haare der Blankenburgs, das markante Kinn der Fleurys und ein Lächeln, mit dem er in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich ein paar Mädchenherzen brechen würde.
»Mit Mamas und Papas Erlaubnis werde ich die Pistole vorläufig noch nicht benutzen. Ich wüsste auch gar nicht, worauf ich schießen sollte. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, fällt mir das Hinterteil meines Mathematiklehrers ein, der uns gerade mit Arithmetik triezt.«
Die Gesellschaft lachte.
»Im Ernst, Großvater. Die Kiste bekommt einen Ehrenplatz in meinem Zimmer, versprochen.«
»Mumpitz. Morgen kommst du zu mir nach Königstein, hast du verstanden? Im Wald machen wir Sport, also Schießübungen. Und weißt du, worauf wir schießen werden? Auf die Tassen der Konkurrenz. Dafür taugen sie gerade noch, zum Zerbersten.«
Er lachte und genoss es sichtlich, dass ein paar der Gäste einstimmten, darunter auch sein zweiter Enkel Maxim. Er war nur drei Stunden jünger als Damian, geboren eine halbe Stunde nach Mitternacht, und trotz der unverkennbaren Ähnlichkeit zu seinem Bruder hätte man die beiden niemals verwechseln können. Ihre Augen waren zwar identisch, die dunkle, fast schwarze Farbe, die Größe und Form, der wache Ausdruck, einfach alles. Leuchteten in den Augen des Älteren Interesse, Aufgeschlossenheit und Witz, so waren es Schabernack und Raffinesse in denen des Jüngeren.
Adalmar beugte seinen langen, hageren Oberkörper nach vorn und kniff dem jüngeren der Brüder in die Wange. »Na, wer in diesem Raum hat wohl als Nächster Geburtstag? Und worauf darf er sich dann freuen?«
Maxim kniff seinem Großvater zu dessen Verblüffung ebenfalls in die Wange. »Na, wer in diesem Raum wird wohl als Nächster ins Gras beißen? Und worauf darf er sich dann freuen?«
Elise starrte auf den schweren Türklopfer aus Messing direkt vor ihr. Er stellte die Medusa dar, mit Schlangen auf dem Haupt und weit aufgerissenem Schlund – der eigenwillige Humor ihres Schwagers Edmond. Den Türklopfer hatte Elise vorher nie bemerkt, obwohl die Gebrauchsspuren auf eine langjährige Nutzung hindeuteten. Gewiss war sie schon hundertmal daran vorbeigegangen … Aber war das wichtig?
Mit dem gleichen wohltemperierten, leicht benommenen Erstaunen stellte sie just in diesem Moment fest, dass sie Richard nicht liebte. Natürlich hatte sie das schon immer gewusst, so wie man weiß, dass man eines Tages sterben wird. Aber wenn es schließlich so weit ist, überrascht es einen doch.
War es in ihrer Ehe überhaupt je um Liebe gegangen? Vielleicht sollte man eher über Zuneigung oder Respekt nachdenken, davon war dann und wann etwas zu spüren gewesen. Sonntags, manchmal. An kalten Winterabenden. Wenn Freunde zu Besuch kamen und ein paar Tage blieben.
War das jetzt noch wichtig?
Elise klopfte.
Hinter ihr breitete sich die kalte Oktobernacht aus, unterbrochen von einer einzelnen Straßenlaterne, deren gelbliches Licht sich über das nasse Pflaster ergoss. Der Wagen, der sie gebracht hatte, war um die Ecke gefahren, wo er bis zu ihrer Rückkehr wartete.
Sie war allein.
Ich bin allein, dachte sie. Richard ist tot. Und ich trage Weiß.
Ein Diener öffnete, sie übergab ihm den Mantel und betrat das Haus. Ihre nassen Sohlen knirschten auf dem Marmorboden, der Duft von Rosen vermischte sich mit dem von gebratenen Gänsen und warmen Teigwaren. Stimmen wehten ihr entgegen, ein Zweiklang von gedämpften Ahs und Ohs, ausgestoßen von Salondamen und -löwen, die gleichsam einem Zirkuskunststück beiwohnten. Nicht lange und ein Gepolter eroberte die Hoheit. Unverkennbar die Stimme eines Mannes, der seit einem halben Jahrhundert herrschte.
Elises Vater wandte ihr den Rücken zu, als sie auf ihn zuging. Ophélie stand zwischen ihm und ihrem jüngeren Sohn Maxim, körperlich ein Bollwerk, tatsächlich aber kaum in der Lage, Adalmar länger als ein paar Sekunden die Stirn zu bieten. Sie trug – was sonst? – ein Kleid in Kakao, gekrönt von einem Hut in Mokkasahne.
»Elise«, sagte sie.
»Ophélie«, erwiderte Elise. »Guten Abend, Papa.«
Er wandte sich ihr zu, und der Zorn schien von ihm abzublättern, wie Eis an einer Fensterscheibe im Sonnenschein taut.
»Meine Liebste«, sagte er. »Endlich. Du wurdest heiß erwartet.«
»Richard ist tot«, murmelte sie, so als würde sie sagen: Der Wagen hatte eine Panne.
Es folgten die unvermeidlichen Beileidsbekundungen, ein paar stark beringte Hände legten sich auf stark geschminkte Lippen, einige Herren griffen sich in die Pomade.
»Hirnschlag, hat der Arzt gesagt. Es muss vor etwas mehr als einer Stunde passiert sein. Das hier lag vor ihm auf dem Schreibtisch. Ich habe nicht alles verstanden. Es ist ein recht langes Telegramm.«
Sie versuchte mit aller Kraft, feuchte Augen zu bekommen, und als es gelang, spürte sie tatsächlich, wie sich die Trauer in ihrem Körper ausbreitete.
Ophélie trat einen Schritt auf sie zu und streckte die Hand aus, als wolle sie sie auf ihren Arm legen. Doch es blieb bei dem Versuch. Auch schwesterliche Solidarität war etwas, das gelernt sein wollte.
»Ed… Edmond«, stammelte Adalmar, nachdem er das Telegramm gelesen hatte. »Ich muss … Ich müsste mal dein Büro benutzen. Für ein wichtiges Telefonat, du verstehst?«
Ein eigenes Büro wäre für Edmond in etwa so nützlich gewesen wie ein Bügelzimmer.
»Falls du ungestört telefonieren möchtest, liebe Schwiegervater, kannst du das machen von unsere Boudoir aus. Wie heißt das hier? Privatzimmer? Ruhezimmer? Möchtest du, dass der Hampelmann dich bringt dorthin? Bitte sehr, soll mir eine Vergnügen sein.«
Adalmar war nicht mehr derselbe Mann, als der er den Salon betreten hatte, und nachdem er gegangen war, fielen nicht wenige Blicke auf das Telegramm auf dem Boden. Es dauerte zwei, drei Minuten, bevor Maxim es aufhob. Wenig erstaunlich, dass er es als Einziger fertigbrachte. So etwas wie Furcht schien ihm seit jeher fremd zu sein. Respekt ebenfalls.
»Was steht darin?«, fragte seine Mutter mit zittriger Stimme.
Nachdem Adalmar zwei Telefonate geführt hatte, suchte er nach Stift und Papier. Schnell wurde er im Sekretär seines Schwiegersohns fündig und griff angewidert danach. Parfümierte Briefbögen und lavendelblaue Tinte in einem Raum, in dem Scheherazade gehaust haben könnte, erregten seinen Ekel.
Während er schrieb, dachte er an seinen Sohn Otto, den er an den Krieg verloren, und an Wido, seinen Jüngsten, den das Opium ihm genommen hatte. Mit aller Macht versuchte er, sich an die Liebe zu erinnern, die er ihnen entgegengebracht hatte, als sie noch klein waren, sehr klein. Doch wie das mit lange vergangenen Gefühlen nun einmal so war: Adalmar konnte sie nur durch die Schleier tausender Tage hindurch betrachten, weshalb sie ihm seltsam unwirklich vorkamen. Eher so, als wäre er der Zuschauer eines Theaterstücks, in dem er selbst die Hauptrolle spielte.
Die Hoffnungen, die er einst mit seinen Söhnen verknüpfte, waren vor ihnen gestorben. Der eine war dumm genug gewesen, sich in einen verlorenen Krieg zu stürzen, wo ihm – idiotisch und sinnlos – ein Doppeldecker auf den Kopf fiel. Der andere, noch dümmere, hatte sich weggeworfen an ein Gift und dessen Giftmischerin.
Was Adalmars Töchter anging … Mit Ophélie war es wie mit seinen Söhnen, er hatte sie nur als Säugling geliebt. Sobald sie alt genug war, um Unterwürfigkeit zu zeigen, war seine Verachtung stärker als das Blut, und nach dem Verlust ihres Auges fand er sie geradezu abstoßend.
Von Elise hatte er lange Zeit geglaubt, sie sei das einzige Kind, das er ins Herz geschlossen habe, stellte an diesem hässlichen Novembertag, als er den Brief schrieb, jedoch fest, dass er sie lediglich benutzt hatte, um sie Ophélie vorzuziehen.
»Pilar«, seufzte er.
Schön war sie gewesen, seine spanische Frau, nicht wirklich hübsch, aber schön auf ihre Art. Schwarze Haare, strenge Züge, eine Seele von Mensch. Elise kam ein bisschen nach ihr. Erstaunlich, dass sie jemanden wie ihn zu lieben vermochte. Ihr Herz war um einiges größer als ihr Verstand. Vielleicht nur deshalb hatte er sie ebenfalls geliebt. Seit vielen Jahren vermisste er sie, so wie ein Frierender die Wärme vermisst.
Seine Firma, die Manufaktur – dafür hatte Adalmar Blankenburg gelebt. Sie hatte ihn jung gehalten, wie es eine Mätresse nicht besser vermocht hätte, und war stets ebenso devot gewesen.
All diese Erinnerungen machten ihn alt. Und was alt machte, das tötete. Er empfand keine Liebe mehr, für gar nichts. Man hatte ihn betrogen, sein Schwiegersohn, das Glück, die Banken, die Kinder, die sich an Ideologien, Idiotien oder idiotische Männer verschenkt hatten, sie alle. Das Leben hatte sich von Adalmar abgewandt. In seiner üblichen Manier, Schlimmes mit Schlimmerem zu vergelten, wandte er sich nun konsequent von den Lebenden ab.
Er setzte seine lavendelblaue Unterschrift unter das Dokument.
»Pilar, ich komme.«
»Die Börse in New York ist zusammengebrochen«, las der junge Maxim vor. »Stahlwerte, Konsumwerte, Bankenwerte, fast alles ist nichts mehr wert. Onkel Richard hat anscheinend … Da laus mich doch der Affe! Der Trottel, pardon, aber Tante Elises Mann hat eins Komma vier Millionen Reichsmark in New York investiert, das sind über neunzig Prozent des Firmenvermögens. Wenn das stimmt … Wenn das Geld wirklich verloren ist, dann …«
»Dann was?«, fragte Ophélie.
»Dann ist die Manufaktur Blankenburg pleite.«
»Was du da redest! Du bist ja noch ein Knabe, woher willst du das wissen?«
»Zufällig interessiere ich mich für Geschäfte, Maman. Auch für die Börse.«
»Edmond, bitte sag mir, dass das Kind nur naseweis daherredet.«
Auch Edmond las das Telegramm, sogar zweimal, und kam zum gleichen Schluss. »Das Geld ist perdu, so viel steht fest. Richard hat fast alles in Aktien von Banke und Stahlkonzerne in Amerika investiert. Er hätte genauso gut Herbstlaub kaufen können, das hat ungefähr dieselbe Wert.«
»Wir … wir sind also tatsächlich bankrott?«
»Nichtwir, Chérie. Ich habe meine Vermögen zu die größte Teil in Gold angelegt, und hier steht, Gold ist um die Doppelte gestiegen. Damit sind wir zweimal so reich wie gestern. Wie sagt man hier? Stinkenreich.«
Ein Knall schreckte alle auf, so laut und scharf, dass er noch nicht einmal Ahs und Ohs auslöste, sondern nur Erstarren.
Die letzten Minuten hatte Elise in halber Bewusstlosigkeit verbracht. Sie hatte alles gehört, ohne irgendeinen Gedanken dazu zu haben oder eine Schlussfolgerung zu ziehen. Einzig das Bild ihres Gatten, der sie noch aus dem Tode heraus angestarrt hatte, stand ihr vor Augen. Und Emma, das arme Kind, das weinend zusammengebrochen war wie die New Yorker Börse. Biene war bei ihr. Biene vermochte Emma größeren Trost zu spenden als ihre Mutter.
Der Knall holte Elise zurück in die Gegenwart. »Ophélie, ihr habt doch nicht etwa eine Waffe in eurem Boudoir?«
»Gott behüte, nein!«
Damian rief: »Die Pistole, die er mir geschenkt hat, ist noch in der Kiste.«
Da sagte sein Bruder Maxim, so als hätte er gerade einen grandiosen Einfall gehabt: »Hey, ich sollte nachher doch auch eine kriegen.«
2
Am Donnerstag, dem 24. Oktober, bricht in den Vereinigten Staaten von Amerika die Börse ein, nachdem sie einen jahrelangen Höhenflug erlebt hat. Aus anfänglicher Unsicherheit wird Angst, und aus der Angst entsteht Panik. Daraufhin unternehmen einige große Banken Stützkäufe, wodurch sich die Lage kurzfristig beruhigt. Doch der Abwärtstrend setzt sich am darauffolgenden Montag fort. Der Aktienwert vieler Unternehmen sinkt so weit, dass deren Kredite nicht mehr gedeckt sind. Die Banken fordern ihr Geld zurück. Am Dienstag fallen die Kurse ins Bodenlose, manche Unternehmen haben nur noch ein Prozent des Wertes der Vorwoche. Als Folge davon brechen auch die europäischen Börsen ein.
So hatte Tankred es sich immer vorgestellt. Haargenau so. Das Herz der Blankenburgs. Königstein, ein Städtchen am Südhang des Taunus, umgeben von Wäldern, Obsthainen und Burgen. Der Herrensitz der Blankenburgs, die Villa Vanora, zwei, drei Steinwürfe von der Villa Rothschild entfernt mit Blick auf Frankfurt und die Mainebene. Ein großes schmiedeeisernes Tor, ein gewundener Weg, ein Park, ein Brunnen, ein Kasten von Haus. Die kalte Eingangshalle, Steinböden, stoffbespannte Wände, schwere Vorhänge. Die in solchen Häusern unvermeidliche Ahnengalerie in ewiger bewegungsloser Ernsthaftigkeit, neun Kaufmannsgesichter von frostiger Blässe. Und in der Mitte des Herzens der Blankenburgs befand sich deren Seele: die legendäre Porzellanblume.
In einem Bildband hatte er ein Foto davon entdeckt, in Schwarz-Weiß. Mit geschlossenen Augen hatte er sich das Symbol der Blankenburgs, das zum Gründungsmythos des Familienunternehmens gehörte, in Farbe vorgestellt. Seine Fantasie hatte ihn nicht getrogen.
Vor ihm, in einer Vitrine, ruhte auf einem Kissen ein gewundener, stricknadeldicker, etwa sechzig Zentimeter langer Stiel im vornehmsten Eierschalenweiß, von dem fünf sattgrüne Blätter abzweigten. Das Stielende barg den Blütenkopf wie eine kostbare Brosche. Die etwa zwanzig winzigen Blüten des halbrunden Kopfes schimmerten weiß und rosa, und man konnte ohne Übertreibung sagen, dass dieses Kunstwerk die Natur an Schönheit noch übertraf. Auch die echte, in Asien beheimatete Porzellanblume hatte jenes wächserne Kolorit, dem sie ihren Namen verdankte. Doch war das »Opus 1« der Blankenburgs so filigran, so detailliert gearbeitet, dass selbst Menschen wie Tankred, die sich im Grunde nichts aus Porzellan machten, kurz der Atem stockte.
Im Jahre 1768 hatte der Gründer des Familienunternehmens, Ludwig Emanuel Blankenburg, die Porzellanblume unter erheblichem Aufwand anfertigen lassen und sie der »Großen Landgräfin« Karoline Henriette von Hessen-Darmstadt zum Geschenk gemacht. Ein Coup, zweifellos. Die Blankenburgs avancierten dadurch zu Hoflieferanten. Ein beinahe identisches Modell ging an den »vielgeliebten König« Louis XV. von Frankreich, weil man immer schon gute Verbindungen in das Nachbarland gehabt hatte und sich Aufträge aus Versailles versprach. In den Wirren der Revolution wurde dieses Exemplar zerstört, wohingegen man die hessische Blume, fortan auch »Karolinenblume« genannt, im Jahre 1806 zurückkaufte und seitdem wie einen Gralsschatz hütete. Sie war der Inbegriff des Aufstiegs und ebenso unantastbar. Gewiss hatte sie seit Jahrzehnten keiner mehr in der Hand gehalten, denn es war Tradition, sie nur bei der Übergabe der Manufaktur vom Vater auf den Erben hervorzuholen.
Neun Patriarchen – Ludwig Emanuel, Emanuel Friedrich, Friedrich Moritz, Moritz Christian, Ethelbert, Konrad, Albert, Siegfried, Adalmar. Sie alle hingen in etwa drei Metern Höhe, von wo aus sie auf ihr Pantheon hinabblickten, und sah man einmal von der wechselnden Mode ab, der sie unterworfen gewesen waren, ähnelte die gebieterische Wirkung, die sie auf den Betrachter hatten, sich auf erschreckende Art. Unter ihnen waren deutlich kleinere Porträts ihrer jeweiligen Ehefrauen und Kinder gruppiert. Hier und da hatten sich doch tatsächlich so etwas wie eine individuelle Anmutung und ein schwärmerisches Flair in die Bilder eingeschmuggelt.
»Sie wünschen?«
Zwei Minuten, dachte er. Man hatte ihn lediglich zwei Minuten warten lassen.
»Ich habe soeben die Gesichter Ihrer Familie studiert«, sagte er nach einem kurzen Blick über die Schulter. »Ich habe das Vergnügen mit Elise Dobel, nicht wahr?«
»Ja, und Sie sind …«
»Wenn man es versteht, in Gesichtern zu lesen, ist das ein großer Vorteil, wussten Sie das?« Er deutete nacheinander auf die Porträts an der Wand. »Ophélie, Adalmars Erstgeborene … ihr verbliebenes Auge verschwindet beinahe im Fleisch, ebenso die Lippen, die nach innen zu wachsen scheinen. Sie verbirgt ihre Gefühle. Dann Wido, der Jüngste, ein Gesicht, so zart und wächsern, als wäre es zum Zerbrechen verurteilt. Ihres dagegen, gnädige Frau, strahlt Haltung aus, eine gewisse tragische Größe …«
»Sollte das Ihre Art sein zu kondolieren, Herr …«, sie warf einen kurzen Blick auf die Visitenkarte, die er dem Hausmädchen überreicht hatte, »Horch, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass …«
»Das ist nicht mein Name.«
»Wie bitte?«
»Sie ahnen nicht, was man im Frankfurter Gallusviertel alles für ein paar Mark kaufen kann. Ich hätte auch einen Säugling mitbringen können, aber für meine Zwecke wäre das wenig dienlich.«
»Ich verstehe nicht.«
»Ich habe gelogen, um vorgelassen zu werden. Überlegen Sie mal. Wäre ich tatsächlich ein Horch und somit Mitglied einer Dynastie von Autobauern, hätte ich nicht solche Klamotten an.«
Abgewetzte Schuhe, der Hemdkragen gammelig wie welker Salat. Zwar trug er einen dunkelgrauen Anzug, doch der war ihm mindestens eine Nummer zu groß. Seit zwei Jahren nahm Tankred kontinuierlich ein paar hundert Gramm pro Monat ab. Ihm war völlig klar, dass er aussah wie jemand, der etwas wollte und dafür keine Gegenleistung zu erbringen gedachte.
»Und wie lautet Ihr richtiger Name?«
»Schamitzke. Tankred Schamitzke.«
»Nun denn, Herr Schamitzke. Da Sie offenbar nicht vorhaben zu kondolieren, muss ich Sie bitten zu gehen. Dieses Haus befindet sich in Trauer.«
»Ich weiß. Es rafft die Männer dieser Familie in geradezu erschreckender Anzahl dahin. Ihre Brüder, Ihr Mann, Ihr Vater … Wer soll das Unternehmen nun führen?«
»Das werde ich kaum mit Ihnen erörtern.«
Tankred deutete auf das Porträt von Adalmars Zweitgeborenem. »Über Otto haben wir noch gar nicht gesprochen. Er hat das, was ich ein mittleres Gesicht nenne: weder ambitioniert noch gelangweilt, weder streng noch liebevoll, weder intelligent noch dumm. Na ja, wenigstens nicht allzu dumm. Man sieht ihm nicht an, ob er den ganzen Tag angeln gehen oder lieber ein gutes Geschäft abschließen will, und auch nicht, ob er überhaupt zu einem von beiden fähig ist. Andere haben das für ihn entschieden. Eine Feder im Wind, den Launen aller möglichen Kräfte ausgesetzt. Im Krieg ist ihm ein Doppeldecker auf den Kopf gefallen, nicht wahr? Was für ein passendes Ende für einen Luftikus. Übrigens, ich bin sein Sohn.«
Anders als die falsche Visitenkarte, log die Geburtsurkunde nicht. Tankred Schamitzke war der 1907 geborene leibliche Sohn von Otto Blankenburg und der Wäscherin Paula Schamitzke. Er war in der Nähe von Berlin zur Welt gekommen, wo Otto die Handelsschule besucht und viel Wäsche zu waschen gehabt hatte. Auch ohne Details zu kennen, ohne überhaupt etwas über die Geschichte von Paula und Otto zu wissen, konnte man sie sich gut ausmalen. Herrje, das passierte andauernd – in kleinen Kammern, im Heu, in Dachmansarden, hinter dem Waschzuber … Im besten Fall waren es rührselige Romanzen mit der Lebensspanne von Schmetterlingen, im schlimmsten eine Sache von fünf heftigen Atemzügen.
Immerhin hatte Otto zu seinem Abenteuer gestanden, was gemeinhin eher die Ausnahme war. Jahrelang schickte er Paula Schecks, und nachdem er gefallen war, übernahm sein Vater diese Aufgabe. Als Tankreds Mutter im Jahr 1922 an Tuberkulose starb, sorgte Adalmar dafür, dass sein illegitimer Enkel eine mittlere Schulbildung bekam, unter der Voraussetzung, er halte seine Herkunft weiterhin geheim.
»Eine Wäscherin«, sagte Ophélie kopfschüttelnd. »Ottos Geschmack war immer schon sehr simpel.«
»Geschmack oder nicht«, erwiderte Elise. »Er gehört zur Familie. Und er ist eine Waise.«
Sie saßen zu dritt im Arbeitszimmer des Verstorbenen, Tankred mit seinen beiden in Schwarz gehüllten Tanten, von denen keine wagte, den Sessel hinter dem massiven Schreibtisch zu belegen. Das Hausmädchen servierte Tee und musterte den Zweiundzwanzigjährigen mit unverhohlener Neugier und Skepsis.
Er zwinkerte ihr zu. Nicht auf diese Art, sondern als wollte er sagen: Hallo, schön dich wiederzusehen.
»Die Waise ist erwachsen«, konterte Ophélie. »Ich sehe nicht ein, dass wir uns mit den fleischgewordenen Hinterlassenschaften von Ottos Vorliebe für Frauen mit großen Brüsten herumschlagen sollen.«
»Sie waren normal groß«, widersprach Tankred.
Ophélie warf ihm einen feindseligen Blick zu. Mischen Sie sich nicht ein, das geht Sie gar nichts an, sollte das heißen.
Sie richtete sich auf und sagte genüsslich, als würde sie die Worte vorher lutschen: »Aber du warst ja schon immer auf Ottos Seite, Elise. Dein Lieblingsbruder. Nichts als Flausen hatte er im Kopf. Ein Handvoll Flausen und ansonsten gähnende Leere. Du hast ihn immer vor Papas Anwürfen in Schutz genommen. Lächerlich, ein großer Bruder, der sich von seiner kleinen Schwester verteidigen lässt.«
Elise sank ein wenig auf ihrem Stuhl zusammen, und Ophélie gab einen missbilligenden Laut von sich.
»Also, junger Mann, nun zu Ihnen. Was wollen Sie? Geld natürlich. Sie müssen wissen, dass kein Geld mehr da ist, das Sie abstauben könnten.«
»Ophélie!« Elise legte den Zeigefinger auf die Lippen.
»Was ist? Es gibt keine Kanalratte zwischen Frankfurt und Königstein, die nicht um die desaströse Lage der Manufaktur wüsste. Eine Lage, nebenbei erwähnt, die dein Mann verschuldet hat. Richard hat die Blankenburgs ruiniert, und er hat Vater auf dem Gewissen, das willst du doch wohl nicht leugnen?«
Unter Ophélies Trommelfeuer wurde Elise immer kleiner. Kaum dass sie wagte sich zu räuspern, geschweige denn den Blick ihrer Schwester zu suchen. Denn die bösartigsten Vorwürfe sind jene, die zutreffen.
»Ophélie, ich bitte dich. Wir haben Richard gestern erst bestattet«, erwiderte sie schwach. »Und übermorgen tragen wir Vater zu Grabe. Es ist unangemessen, wenn du …«
»Es war noch viel unangemessener, derart abenteuerliche Summen in Aktien zu investieren. Amerikanische Aktien.«
Auch um von der geknickten Elise abzulenken, fläzte Tankred sich provokant in den Sessel, legte ein Bein über die Armlehne, schob sich ein Konfekt in den Mund und sagte: »Vielleicht überrascht es dich, Tante Ophélie, aber ich bin nicht gekommen, um Ärger zu machen.«
»Unterstehen Sie sich, mich zu duzen und Tante zu nennen, Sie Schamitzke Sie.«
»Die paar Kröten für meine Alimente werden ja wohl aufzutreiben sein. Alles Weitere sehen wir dann. Sie wollen doch nicht, dass ein Blankenburg bettelnd durch Königstein läuft. Was sollen die Leute denken?«
»Jetzt hör sich einer diesen Schlingel an. Den Namen Blankenburg haben große Kaufleute getragen, Meister des Kunsthandwerks, Visionäre und …«
»Und bankrottierende Selbstmörder.«
»Sie sind keiner von uns, Sie sind ein Flegel mit einer Geburtsurkunde, die so vergilbt ist wie Ihr Hemdkragen. Auf der Stelle verlassen Sie unser Haus.«
»Ich habe noch nicht ausgetrunken. Was ist das eigentlich? Mit Tee kenne ich mich nicht aus.«
Ophélie entwand ihm die Tasse und kippte ihm den lauwarmen Inhalt ins Gesicht. »Ceylon, schwarz, nussiges Aroma. Es kommt besonders gut heraus, wenn man es sich von der Nase ableckt, wie Hunde es tun.«
Tankred grinste die resolute Frau an, folgte dem Rat und leckte sich einen Tropfen von der Nase.
»Wir sind am Ende«, sagte Ophélie nach einigen Sekunden, in denen sie sich wie Duellanten in die Augen gesehen hatten. »Ich bin sicher, Sie finden den Ausgang alleine. Leute wie Sie finden immer den Ausgang.«
Er verließ das Arbeitszimmer seines Großvaters und betrachtete ein letztes Mal dessen Porträt in der Eingangshalle.
Biene führte ihn wortlos hinaus. Bevor sie die Tür hinter ihm schließen konnte, wandte er sich ihr zu und sagte: »Hast du mich vorhin eigentlich erkannt?«
»Nein, sonst hätte ich dich nicht vorgelassen.«
»Ich habe mich also verändert?«
»Äußerlich.«
Sie wollte die Tür schließen, doch Tankred stellte einen Fuß dazwischen.
»Ich habe Briefe, sehr interessante Briefe. Bei Gelegenheit sprechen wir mal darüber. Einen schönen Tag wünsche ich dir.«
Bis zum Abend brauchte er, um vom Taunus zurück nach Frankfurt zu gelangen. Bis Niederhöchstadt ging er zu Fuß, ab und zu regnete es, dann stellte er den Kragen auf und zog die Kappe tiefer ins Gesicht. Dort nahm ihn ein gnädiger Lastwagenfahrer mit, und das letzte Stück fuhr er mit der Straßenbahn. Beinahe hätte der Schaffner ihn erwischt, aber er sprang im letzten Moment ab. Es war längst dunkel, als er die Bornheimer Wohnung betrat.
Dubbe und Schimmi, seine Mitbewohner, warteten schon auf ihn.
»Mensch, warum hat das so lange gedauert?«, begrüßte Dubbe ihn.
»Mein Mercedes hatte eine Panne. Warum wohl, Blitzbirne? Ich hab mir die Hacken abgelaufen.«
»Hast du Geld bekommen?«, fragten die beiden gleichzeitig mit dem hungrigen Blick räudiger Hunde.
»Einen Tritt in den Hintern habe ich bekommen. Meine dicke Tante hat Haare auf den Zähnen. Aber die andere scheint mich zu mögen, darauf kann ich vielleicht aufbauen.«
»Scheiß aufs Aufbauen, Mensch. Wir haben nichts mehr zu futtern. Schimmi hat heute seine Arbeit verloren, die Schuhfabrik hat erst mal dichtgemacht. Produktionsstopp nennen die das. Und ich hab den ganzen Tag umsonst mit dem Schild an der Straßenecke gestanden.«
Es lag auf dem Stapel Schmutzwäsche in der Ecke: NEHME JEDE ARBEIT AN, NUR 1 MARK AM TAG. Gebracht hatte es bisher kaum etwas. Erst ein einziges Mal, vorgestern, hatte einer von ihnen drei Laster mit Zementsäcken entladen und war mit einer lumpigen Mark nach Hause gekommen. Es gab einfach keine Arbeit. Dafür viele Leute mit Schildern. Und jeden Tag wurden es mehr.
»Mir hat heute einer angeboten, mit ihm auf die öffentliche Toilette zu gehen«, sagte Schimmi. Trotz seiner zwanzig Jahre sah er aus wie fünfzehn. Alles an ihm war ein bisschen kleiner als im Durchschnitt: die Nase, die Ohren, die Finger. Sein nettes Gesicht brachte ihnen mehr ein als ihrer sechs Hände Arbeit.
»Hast du’s gemacht?«
»Nee. Hab drei Mark verlangt, da hat er mir einen Vogel gezeigt, ist ein paar Meter weitergefahren und hat einen anderen eingesammelt.«
Schimmi kratzte sich. Nach Dubbes Zimmer hatten die Bettwanzen jetzt auch seines erreicht, und Tankred wusste, dass es nur eine Frage von Tagen war, bis er morgens mit den gleichen Pusteln aufwachen würde.
»Ich habe noch fünf Mark im Strumpf«, sagte er. »Dann ist Ebbe.«
»Deine Schecks haben uns bisher über Wasser gehalten«, sagte Dubbe. »Ohne die sind wir aufgeschmissen.«
»Weiß ich doch«, erwiderte Tankred. »Aber was soll ich machen? Ich habe nichts als eine Geburtsurkunde, und um vor Gericht zu gehen, fehlt mir das Geld. Ich könnte mir noch nicht mal den Busfahrschein dorthin kaufen. Also, ihr Schlaumeier, noch irgendwelche genialen Einfälle?«
Sie saßen um das Licht der Gasfunzel herum, deren Brennstoff wohl noch für zwei, drei Abende reichte.
»Lasst uns losgehen«, sagte Tankred.
Losgehen, das bedeutete üblicherweise drei Brötchen und Tunke kaufen, das Abendessen. Um die Häuser streifen. Wenn sich die Gelegenheit bot, eine Frikadelle mopsen. Schlimmere Sachen machten sie nicht. Keinem von ihnen wäre es eingefallen, jemandem eins überzubraten und die Geldbörse zu klauen. Noch nicht. Für drei junge Männer wie sie wäre das ein Leichtes. Beschissene Zeiten brachten beschissene Situationen hervor, und beschissene Situationen erleichterten es Menschen, sich beschissen zu verhalten. Frauen setzten ihre Säuglinge aus. Männer bestahlen ihre Eltern. Brüder schickten ihre Schwestern nachts auf die Straße. Fabrikanten prellten Angestellte um ihren Lohn. Und die Betrogenen zündeten die Häuser ihrer Chefs an. Das alles passierte im November 1929.
Nur Dubbe, Schimmi und Tankred hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Sie hatten sich im Kontor eines Kolonialwarenimports kennengelernt, wo ihre Abneigung gegen den Chefkontoristen sie vereinte. Zu dritt hatten sie ihm die Stirn geboten – und waren zu dritt entlassen worden. Seither teilten sie sich die Wohnung, das Geld und das Essen ebenso wie die Probleme und die Hoffnungen. Waren sie verschiedener Meinung, stimmten sie ab. Der Unterlegene schloss sich den beiden anderen an. Sie gingen um zwei Ecken zu einem Kiosk und kauften sich ein dürftiges Abendessen.
»Erzähl doch mal«, sagte Dubbe, während er das trockene Brötchen zerriss, in die Soße stippte und quer in die Backe stopfte. Seine Zähne waren schwarz, genau wie die viel zu großen Augen und das Haar, das ihm in Strähnen auf der blassen, pickligen Stirn klebte. Natürlich war Dubbe nicht sein richtiger Name, sondern der hessische Ausdruck für das Wort Tupfen. Auf der Nasenwurzel, zwischen den Augenbrauen, hatte er ein Muttermal, rot und kreisrund wie ein Alarmsignal. »Wie leben die so, deine Verwandten?«
»Bisher in Saus und Braus. Aber der Schwarze Freitag hat sie voll erwischt, glaube ich. Meine eine Tante, die jüngere, ist sehr hübsch und sehr traurig. Sie hat mir leidgetan.«
»Solche Leute fallen auf Seide«, sagte Dubbe. »Mach dir um die keine Sorgen. Jetzt mal Hand aufs Herz … irgendwas muss da doch für uns zu holen sein.«
Tankred nickte. »Ich habe die Angel ausgeworfen, und ein Fischchen schwimmt schon drum herum. Besser gesagt, ein Bienchen.«
Er kam nicht dazu, das Wortspiel zu erklären. Fünf Halbstarke in braunen Hemden sprachen sie an, umringten sie, die Beine scheinbar am Boden festgewachsen wie stramme Eichen. Von den Braunhemden hatten sie in letzter Zeit immer mehr auf den Straßen gesehen, einer großspuriger als der andere, aber irgendwie auch furchteinflößend. In der Regel schmierten sie Hauswände mit Parolen und komischen Symbolen voll, kloppten die Kommunisten zusammen oder wurden von ihnen zusammengekloppt.
Die Halbstarken luden sie zu einer Versammlung ein, wo es Freibier und Bratwurst geben sollte. Vor allem auf Tankred hatten sie es abgesehen, da er von den dreien – trotz der Gewichtsverluste der letzten Jahre – am kräftigsten war, wohingegen Dubbe sehr mager und Schimmi sehr kindlich aussah.
»Geht ihr nur«, sagte Tankred zu seinen Freunden. »Für mich ist das nichts.«
»Stell dich nicht so an, bei uns kannst du was werden«, maulte der Anführer der Braunhemden und packte ihn am Oberarm.
Ja, dachte Tankred. Zur Dumpfbacke kann ich bei euch werden.
Er entwand sich dem Griff und ging davon in die Nacht. Ein paar Straßenzüge weiter standen Bettler um eine brennende Tonne herum, um sich zu wärmen. Allerlei Zeug warfen sie hinein, ohne miteinander zu sprechen, die Gesichter tief in zerschlissenen Mänteln und Hüten vergraben. Tankred wollte sich schon zu ihnen gesellen, als ihm im letzten Moment schlecht wurde.
Bald schon, dachte er, werde ich ihr Schicksal teilen, spätestens wenn ich nächste Woche die Miete nicht mehr bezahlen kann. Der Hausmeister wird nicht lange fackeln, sondern uns am Kragen packen und auf die Straße werfen. Die Koffer wird er behalten, bis auf die Klamotten. Seine Frau wird uns hinterherrufen, dass wir Abschaum sind. Und das Ärgste ist, dass sie Recht hat.
Er ging weiter, scheinbar ziellos, landete nach einigen Umwegen aber doch dort, wo er immer landete, wenn er nicht mehr weiterwusste: bei Gitti. Ihre Wohnung lag nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt, gleich neben dem Etablissement, in dem sie früher gearbeitet hatte und das ihr inzwischen gehörte. Von der achtzehnjährigen Nutte zur Puffmutter in nur zehn Jahren, das war Frankfurter Rekord, und viele fragten sich, wie sie das geschafft hatte. Denn Gitti war keine ausgesprochene Schönheit, sie hatte rote Haare, Sommersprossen, eine Rubensfigur und eine von hunderten kleiner brauner Flecken übersäte blasse Haut. Einer ihrer Freier hatte ihr mal die linke Brust aufgeschlitzt. Mit dem Geld ihrer ersten Jahre hatte sie eine Kneipe aufgemacht, von dem dortigen Erlös nebenan das Etablissement eröffnet.
Tankred war nie ihr Kunde gewesen. Na ja, nicht so richtig. Zwei Jahre lang hatte er in der Kneipe am Tresen gesessen und sein Bier geschlürft, ohne dass sie, die kaum noch selbst dort ausschenkte und sich hauptsächlich um ihren Edelpuff kümmerte, ihn bemerkt hätte. Ein Nicken, ein paar unverbindliche Worte, das war alles. Eines Abends hatte einer der Gäste abfällig gerufen: »Ach, da kommt ja die Igitti!«, und schäbig gelacht. Tankred hatte ihm eins auf die Nase gegeben. Eigentlich hatte er mehr eingesteckt als ausgeteilt, aber genau das führte dazu, dass Gitti ihn in ihrer Wohnung verarztete. Ein paar Tage später schliefen sie das erste Mal miteinander und dann alle paar Wochen, etwa ein Jahr lang. Danach seltener, aber es kam noch vor. Gitti war für Tankred eine Mischung aus ehemaliger Geliebter, von der man nicht loskommt, und schwesterlicher Vertrauter.
»Bubi, so spät noch.« Sie nannte ihn immer schon so, ohne besonderen Grund. »Ich habe ein paar Löffel Linseneintopf übrig, willst du was? Wir schnippeln eine Bockwurst für dich rein, und fertig ist das Menü.«
Er setzte sich an ihren wackeligen Tisch. Gitti neigte nicht zum Prunk. Obwohl sie sich inzwischen neue Möbel leisten konnte, wohnte sie noch immer mit ihrem alten Zeug.
»Wie ist es gelaufen in den letzten … Wie lange ist das her, dass wir uns gesehen haben, hm?«
»Am Schwarzen Freitag. Nur wussten wir da noch nicht, wie schwarz er wird.«
»Ach ja, als die Erde bebte. Ich habe eine Handvoll Kunden seither verloren. Sie sind jetzt arm oder tot. Ein Jammer. Reicht dir eine Bockwurst?«
Nicht nur wegen Gittis ausgeprägtem hessischem Akzent hörte sich bei ihr alles nicht so schlimm an. Auch ihre Angewohnheit, Bedeutsames und Banales in einen Atemzug unterzubringen, nahm den Dingen die Schwere.
»Ich würde Dubbe und Schimmi gerne eine mitbringen.«
»Hier hast du noch zwei.« Sie drückte ihm die wabbeligen Würste in die Hände, was ein wenig anzüglich aussah. Gitti lachte. »Na, übst du schon mal für deine männliche Kundschaft?«
Er stimmte in ihr Gelächter ein, warf die Würste auf den Tisch, lehnte sich zurück und fuhr sich mit den Händen durch die Haare. Er wusste, dass es Gitti scharfmachte, wenn er das tat.
Es klappte. Sie trat neben ihn, blickte sinnlich auf ihn hinab und streichelte seinen Nacken.
»Also, wo brennt’s, Bubi?«
Er berichtete ihr vom Tod seines großväterlichen Geldgebers und dem Ausflug nach Königstein. »Es war naiv, von meinen Tanten Hilfe zu erwarten. Für die bin ich bloß ein Bastard. Aber weißt du, wen ich da getroffen habe? Biene.«
»Die Biene, von der du mir erzählt hast? Euer Verhältnis war ja nicht das beste.«
»Johannes der Täufer und Salome hatten ein besseres Verhältnis.«
»Also, was nutzt dir das?«
»Nichts. Außer ich bringe ihre Briefe ins Spiel.«
»Das wäre unanständig. Ich weiß, es sind harte Zeiten, und wir haben alle unsere schmutzigen Ecken … Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem schlauen Fuchs wie dir und einem miesen Arschloch, so wie es nicht egal ist, ob man tratscht oder mit finsterer Absicht falsche Gerüchte in die Welt setzt. Die Trennlinie ist nicht immer gut zu erkennen. Trotzdem, wenn ich mit einem Arschloch ins Bett gehe, dann weiß ich das am nächsten Tag. Und du bist keins, Bubi. Also, warum willst du eins werden? Herrje, wie deine Fingernägel aussehen. So bist du vor deine Tanten getreten? Jetzt mache ich dir erst mal die Hände schön, und dann wird gegessen.«
Was sollte er da noch erwidern? Gitti hatte Recht. Ja, es wäre arg lumpig, die Briefe zu verwenden. Und ja, seine Fingernägel sahen aus, als hätte er gerade den Garten umgegraben.
Während Gitti ihn manikürte, griff er mit der anderen Hand nach einer Zeitung. Gitti las regelmäßig drei verschiedene, sie sagte, die Hälfte der Stammgäste des Etablissements tauche namentlich dann und wann darin auf, und es sei nützlich, über die Kundschaft auf dem Laufenden zu sein. Doch Tankred war an diesem Abend nicht nach Lesen, und er wollte das Blatt schon wieder beiseitelegen, als er im letzten Moment den Namen Blankenburg bemerkte.
Es war der Gesellschaftsteil. Zwischen dem Bericht über den Selbstmord eines Juweliers und der Flucht eines Bankiers vor dem Zorn seiner Anleger ins rettende Kuba war die Fotografie einer älteren Dame in Schwarz abgedruckt.
Arabella Löwenkind, geborene Blankenburg, gestern aus New York mit dem Luxusliner America in Bremerhaven angekommen, wird in Kürze in Frankfurt erwartet, um an den Begräbnisfeierlichkeiten für ihren Bruder teilzunehmen. Frau Löwenkind war bis vor elf Jahren ein hochgeschätztes Mitglied der Gesellschaft und tat sich als Mäzenin hervor …
Und so weiter und so fort.
»Sieh einer an«, sagte Tankred.
Gitti musterte ihn fragend.
»The sly fox needs to think about a good plan.«
Ophélie tat, als stünde ihr Entschluss fest. Als sei er das Ergebnis langen Nachdenkens. Die Folge eines logischen Prozesses. Dabei war ihr der Einfall während der Morgentoilette gekommen, zwischen dem Auftragen des Lidschattens auf das rechte und dem Auftragen des Puders auf das verstümmelte linke Auge. Zwischen der Enttäuschung darüber, dass Edmond schon seit Monaten nicht mehr mit ihr schlief, und der Trauer, weil ihr Vater aus dem Leben geschieden war, ohne ihr ein gutes Wort zu schenken. Pariser Kokotte, das war die letzte Kränkung, die er ihr zugedacht hatte. Über die sechsundvierzig Jahre ihres gemeinsamen Weges waren hunderte Kränkungen zusammengekommen, und kaum eine hatte sie vergessen. Sie alle waren niedergeschrieben in dem Tagebuch, das sie seit ihrem siebten Lebensjahr führte.
18. Juni 1890, der allererste Eintrag: »Papa hat mich eine dumme Göre genannt«; 26. Oktober 1894: »Papa sagt, ich habe die Singstimme eines Kakadus«; 5. Februar 1900: »Papa lacht mich aus, als ich das Holzauge zum ersten Mal trage, und sagt, damit könne man ein ganzes Bataillon Kerle vertreiben.«
Räuberhauptmann, Taunushexe, Hippo, Kürbiskopf, Golem – stets vorgetragen mit jenem humorigen Schmelz, der ihm erlaubte, so zu tun, als wollte er sie nur necken. In sehr jungen Jahren war sie ein paarmal weinend davongerannt, was nur dazu führte, dass er ihr den Rufnamen »Tränenreich« verpasste. Spätestens mit zehn gewöhnte sie sich ab zu fliehen. An seinem Verhalten ihr gegenüber änderte das fast nichts. Doch es veränderte Ophélie.
Gleich nach dem Frühstück fuhr sie zu ihrer Schwester nach Königstein.
»Die Manufaktur nach Frankreich verlegen?«, fragte Elise. »Wozu?«
»Um sie zu erhalten, selbstverständlich. Ohne Edmonds Geld wird sie schon in wenigen Wochen nicht mehr existieren.«
Ihr Mann wusste nichts von Ophélies Plan. Noch nicht. Natürlich war es ein abwegiger Gedanke, Edmond könnte die Leitung der Manufaktur übernehmen, würde morgens zur Arbeit fahren und bis achtzehn Uhr hinter dem Schreibtisch sitzen. Die einzigen Tabellen, die Edmond zu lesen verstand, waren die mit den Beständen für Wein und Champagner, und selbst die langweilten ihn nach zwei Minuten. Wozu gab es Kellermeister?
»Mit Edmonds Geld«, wandte Elise ein, »könnten wir die Marke Blankenburg in Frankfurt sichern.«
»Wer dem Äffchen die Banane gibt, entscheidet auch, welchen Tanz es aufführt.«
»Warum Frankreich? Das will mir nicht in den Kopf. Ich dachte, Edmond hätte seinem Heimatland den Rücken gekehrt.«
Das hatte er. Ein Exil war nun einmal leichter zu ertragen, wenn man vor anderen und vor allem sich selbst so tat, als sei es das Schlaraffenland und die Heimat ein Misthaufen. Den wenigen Verwandten, mit denen er noch in Kontakt stand, schrieb er begeisterte Briefe über sein Leben in Frankfurt. Tief im Inneren jedoch zog es ihn in sein Geburtsland zurück. Mit keinem Wort hatte er sich Ophélie gegenüber je dahingehend geäußert, doch seiner Frau waren die Zeichen vergeblicher Sehnsucht allzu vertraut: die Idealisierung des Status quo, die kaum zu verbergende Freude, wenn das Objekt der Sehnsucht einem den kleinen Finger reichte, so wie ihr Vater, der sie an ihrem zwanzigsten Geburtstag in den Arm genommen hatte, einmal in einem Dutzend von Jahren. Wein von der Loire trank Edmond mit größerer Aufmerksamkeit als pfälzischen oder friulischen, den er achtlos in sich hineinkippte. Wagner und Verdi hörte er pflichtgemäß, bei Gounod und Bizet ging ihm das Herz auf.
Ophélie hatte vor, ihm die Rückkehr in seine Heimat zu ermöglichen. Nicht irgendeine Rückkehr, nachts durch das Stadttor, sondern im Triumph. Als Direktor der Manufaktur Blancbourg, so jedenfalls sollte es auf seiner Visitenkarte stehen. Das vorzüglichste Porzellan würden sie herstellen, elegante Skulpturen als Geschenke verteilen. Welcher Romancier, welcher Bankier oder Minister könnte dann noch erfolgreich gegen Edmond intrigieren? Sein Reichtum und ihre Manufaktur in Kombination waren unschlagbar, und Edmond wäre rehabilitiert.
»Hast du die Zeitungen gelesen?«, fragte Ophélie. »Massenentlassungen werden angekündigt, Investitionen gestrichen, Fabriken geschlossen, und das nur wenige Tage nach dem Schwarzen Freitag. Das wird noch viel schlimmer, glaub mir. Frankreich dagegen ist kaum von der Krise betroffen. Und für Qualität haben Franzosen immer eine zusätzliche Münze in der Brieftasche. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Neubeginn.«