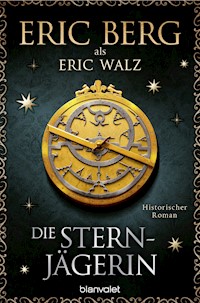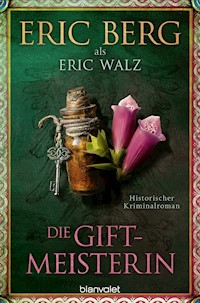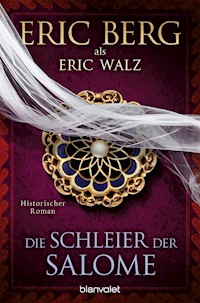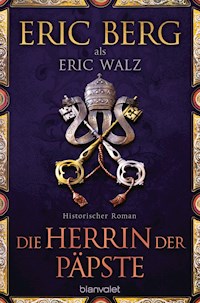9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Krimi
- Serie: Doro Kagel
- Sprache: Deutsch
Was geschah in der »Blutnacht von Hiddensee«?
Seit Jahren haben sich die Studienfreunde Timo, Philipp, Yasmin und Leonie aus den Augen verloren. Als sie sich im Internet wiederbegegnen, verabreden sie sich für ein Wiedersehen auf Hiddensee. Doch das Treffen endet mit einem grauenvollen Verbrechen: In einer stürmischen Septembernacht werden drei Menschen erschossen, eine Frau wird schwer verletzt und fällt ins Koma.
Zwei Jahre nach dem Massaker beginnt die Journalistin Doro Kagel, den Fall neu aufzurollen. Nach und nach kommt sie den tatsächlichen Geschehnissen jener Nacht auf die Spur, und bald keimt in ihr ein schrecklicher Verdacht auf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Eric Berg
Das Nebelhaus
Roman
1. Auflage
Originalausgabe März 2013 im Limes Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2013 by Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-09228-3www.limes-verlag.de
Für Ruth von Benda, Sandra Bräutigam, Armin Weber, Katja Hille, Katarina Pollner und Petra Miersch, mit denen mich seit vielen Jahren die Freuden und Leiden des Schreibens verbinden.
Lasst uns Böses tun, auf dass das Gute kommen mag.
Römerbriefe
1
Drei Tote und ein Komapatient, das war die Bilanz der »Blutnacht von Hiddensee«, die die Ostseeinsel zwei Jahre zuvor erschüttert hatte. Die Meldung vom Amoklauf hatte es bis in die Tagesschau geschafft, kurz vorm Sport, außerdem hatte eine Boulevardzeitung in großer Aufmachung berichtet und den Begriff der Blutnacht geprägt. Schwarzweißfotos in Passbildmanier, die auf Seite eins ein Schattendasein zwischen balkenhaften Buchstaben fristeten. Auf Seite zwei dann Betroffenheit, Überlebende, Angehörige, Nachbarn im Schock. Ganz unten ein wenig Zorn: die Frage nach dem Warum und der Schuld. Wer hat geschlampt, versagt? Nach den Beerdigungen war es wieder still um die Morde geworden, vor allem deshalb, weil es nie zu einem Prozess gekommen war. Denn ausgerechnet der mutmaßliche Täter lag noch immer im Koma und mit ihm der Fall.
Anlässlich des Jahrestages der Tragödie wollte eine norddeutsche Regionalzeitung eine Doppelseite über den Amoklauf füllen. Natürlich riefen sie eine Expertin für solche Artikel an: Doro Kagel, mich.
Meine Finger huschten in geübter Manier über die Tastatur.
Neuendorf auf Hiddensee vor zwei Jahren, am 2. September 2010: Zwei Frauen und ein Mann treffen im Haus Nummer 37 ein. Zu Besuch kommen Yasmin Germinal (35), Gelegenheitsarbeitslose, Leonie Korn (38), Erzieherin, und Timo Stadtmüller (33), Autor. Sie folgten der Einladung des Architekten Philipp Lothringer (45) und seiner Frau Genoveva Nachtmann (43), ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Montag bei ihnen und ihrer fünfjährigen Tochter Clarissa zu verbringen. Die in Kambodscha gebürtige Haushälterin, Frau Nian Nan (67), ging fast täglich in der Nummer 37 ein und aus. Wie sie waren auch ihr Mann Viseth und ihr Sohn Yim in die Ereignisse verwickelt, die in der Nacht vom 5. auf den 6. September stattfanden …
Ich seufzte und löschte den Text. Das war bereits mein dritter, aber immer noch schlechter Anfang für den Artikel, denn diesmal hatte ich es geschafft, den Leser mit neun Namen auf elf Zeilen zu verwirren.
Auf der Suche nach einem neuen Anfang saß ich wie so oft inmitten meines Schlafzimmers, das auch mein Arbeitszimmer war, vor der Maschine, in deren großes Auge ich unentwegt starrte, nicht selten elf oder zwölf Stunden am Tag. Stunden, die ich damit zubrachte, andere Artikel als diesen zu schreiben und doch irgendwie immer dieselben: Artikel über tödlich verlaufende U-Bahn-Schlägereien, Vergewaltigungen, Ehrenmorde, Prostituiertenmorde, Morde der Russenmafia, Berichte über den täglichen Wahnsinn, der in den Gerichtssälen der Hauptstadt und des weiteren Umlands angeschwemmt wurde wie ausgelaufenes Schweröl, das einem den Atem nahm.
Das Verbrechen ist mein Spezialgebiet, ich habe mich nicht darum gerissen, es hat sich einfach so ergeben. Das ist die eine Version. Die andere ist, dass der Tod meines elfjährigen Bruders Benny – ich war damals neun Jahre alt – etwas damit zu tun hat. Er wurde von einem Mann mittleren Alters im Wald stranguliert und in einen Weiher geworfen, man fand ihn erst nach vier Tagen, den Mörder zwei Tage später.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Version zutrifft. Tatsache ist: Ein Artikel von mir über junge Männer, die in einem Berliner Park ihre Kampfhunde gegeneinander aufhetzten und Wetten auf sie abschlossen, hat vor einigen Jahren bei einer Redakteurin für Begeisterung gesorgt und den Anfang gemacht. Ab da hat man mich immer öfter mit blutigen Themen beauftragt, haben mich immer mehr Zeitungen zu immer spektakuläreren Prozessen geschickt: häusliche Gewalt, Brandstiftung, Kindesentführung, gemeine Väter, rücksichtslose Jugendbanden … Bis ich schließlich eines Tages die oberste Stufe in der Hierarchie der Strafprozessordnung erklommen hatte. Seither schreibe ich über Morde und Mörder. Einerseits ist es gut, dass mehr und mehr Zeitungen und Zeitschriften den Namen Doro Kagel mit einem bestimmten Thema verbinden, selbst wenn dieses Thema die größte menschliche Tragödie umfasst, nämlich die menschliche Unfähigkeit, mit dem Töten aufzuhören. Andererseits mischen sich bei diesem Thema – auch bei mir – Faszination mit Abscheu, wirkt Anziehung gegen Abstoßung, und an manchen Tagen hätte ich lieber über die Bundesgartenschau geschrieben als über die Abgründe der Seele.
Hiddensee ist das Friedlichste, was man sich vorstellen kann. Nur mit der Fähre erreichbar, umgeben vom Meer, von Heidekraut bewachsen und einem Wind anheimgegeben, der die schlechten Gedanken fortweht, so könnte man hoffen. Im Norden ragt ein hübscher Leuchtturm auf, im Süden existiert mit dem Vogelschutzgebiet, das nicht betreten werden darf, ein natürlicher Schatz. Einen sanfteren Tourismus gibt es nirgends. Autoverkehr ist auf Hiddensee verboten, nur ein Bus, ein Lieferwagen und die Notdienste dürfen mit mehr als zwei Pferdestärken fahren. Eintausenddreihundert Menschen leben hier über vier Ortschaften verteilt.
Neuendorf im Süden liegt ein Stück abseits der drei anderen Dörfer. Es gibt dort keine Straßen, nur Wege, Pfade und Hausnummern. Die Nummer 37, ein relativ neuer und ungewöhnlicher, fast ganz aus Holz und Glas gefertigter Bau, nannten die einheimischen Inselbewohner schon vor den entsetzlichen Ereignissen des 5. Septembers 2010 das »Nebelhaus«.
Ein guter Anfang. Aber leider nur ein Anfang, zudem hatte ich fast eine Stunde dafür gebraucht. Dieser Amoklauf, der sich in Kürze zum zweiten Mal jähren würde, sperrte sich gegen mich, war nur scheinbar mein Thema. Eine Tat lebt erst durch den Täter – hier jedoch gab es keinen Täter, jedenfalls keinen, der in Handschellen vor einem Kammergericht stand, den der Staatsanwalt beschuldigte, der Verteidiger in Schutz nahm, Zeugen belasteten, die Angehörigen der Opfer beschimpften und Psychologen beurteilten. Es gab kein Für und Wider, kein Gutachten, keine Erklärung, keine Rechtfertigung oder Entschuldigung und auch kein Urteil – und schon gar kein Monster. Wer nicht entweder flüchtig oder lebendig gefangen und in einen Käfig eingesperrt war, der taugte nicht zum Monster, sondern nur zum Gespenst, und geriet in Vergessenheit. Ohne Monster gab es niemanden zum Draufzeigen. Tote sind extrem schlechte Monster, Komapatienten noch weit schlechtere.
Der Fall blieb rätselhaft und dunkel.
Ich blätterte in meinen Notizen und studierte das Recherchematerial auf der Suche nach Inspirationen. Noch einmal durchforstete ich die Polizeiberichte und Statements der Staatsanwaltschaft Stralsund, die es schafften, das Grauen in die schrecklichste Sprache der Welt zu packen: die Sprache der Behörden. Bemüht, sich unanfechtbar korrekt auszudrücken, schafften es die Beamten, sich weit von den Menschen zu entfernen. Ich suchte nach einer Stellungnahme der Überlebenden, fand jedoch keine. Offenbar hatten sie sich gegenüber der Presse nicht geäußert – möglicherweise eine Folge der Sensationsberichterstattung. Auch die Informationen zum vermuteten Tathergang und zu den Zeugen waren spärlich.
Ich leerte eine Tasse fast kalten Kaffees auf ex und legte die Mappe zur Seite. Schon seit Tagen wanderte die Blutnacht auf meinem Schreibtisch herum, kroch über die Stapel anstehender Arbeiten, über die Korrespondenz, Steuerunterlagen, Rechnungen, vorbei an einem Teller mit grünen Weintrauben und Zwetschgen, die den schweren Geruch des Spätsommers verströmten. Sie kroch über das Wohnzimmersofa und den Küchentisch bis auf die leere Seite meines Bettes und zurück auf den Schreibtisch. Der bestand aus einer Fülle von Anklagen, weil das Unerledigte dort immer das Erledigte überflügelte und mich am verwundbarsten Punkt traf: meinem schlechten Gewissen, nicht genug getan zu haben.
Einige Stunden zuvor hatte ich die Mappe nach langer Suche hinter dem Monitor hervorgefischt. Ich konnte mir nicht erklären, wie sie dorthin gekommen war. Der Bildschirm war am Rand mit bunten Haftnotizen beklebt, einer Korona aus Terminen, Telefonnummern und Gedankenstützen, und für gewöhnlich landete hinter dem Bildschirm nur Staub. Es war, als wollte diese Arbeit sich mir entziehen. Ständig fand ich etwas Dringenderes zu tun, andere Artikel, andere Recherchen, so auch an diesem Nachmittag.
Ich zog einen Schnellhefter von einem Stapel, der aus Einsendungen von Journalismus-Schülern eines Anbieters von Fernkursen bestand und die Höhe einer dreibändigen Enzyklopädie erreicht hatte. Um mein dürftiges Honorar als freie Journalistin aufzubessern, hatte ich diesen kleinen Nebenjob als Fernlehrerin angenommen, ohne glücklich damit zu werden. Er kostete Zeit, die ich nicht hatte, verlangte Konzentration, die ich mir mühsam abrang, und brachte gerade so viel Geld ein, dass es für die monatliche Zahlung an Jonas reichte, meinen Sohn, der in Marburg studierte. Sein lachendes Gesicht überstrahlte meinen Schreibtisch, der von Bürden und Morden überquoll.
Zwei Stunden lang reduzierte ich den Stapel auf zwei Drittel seiner ursprünglichen Höhe, redigierte und bewertete Artikel der Journalismus-Schüler, die sich mit dem unaufhaltsamen Niedergang der Woll- und Strickläden, dem Verfall der Abwasserkanäle in deutschen Großstädten, einem Vergleich internationaler Biere, der wirtschaftlichen Bedeutung der Schwarzarbeit und dem Aufstieg Berlins als Modestadt beschäftigten. Sonst passierte so gut wie nichts in diesen zwei Stunden, außer dass sich die Schatten auf dem Schreibtisch verlängerten; Zacken und Punkte, die in Zeitlupe über Papiere schwebten. Drei Tassen Kaffee erkalteten nacheinander, bevor ich sie an die Lippen führte.
Um kurz vor sechs Uhr stieß ich versehentlich die Tasse um. Der Inhalt floss über die Unterlagen zur Blutnacht, tränkte sie mit kalter schwarzbrauner Flüssigkeit und hinterließ nach dem Abwischen auf fast jedem Blatt eine zweifarbige Landkarte mit starken Konturen im unteren Teil und inselhaften Tupfern im oberen. Gänzlich verschont geblieben war nur die Telefonliste mit den Überlebenden der Blutnacht, den Verwandten und Lebenspartnern der Opfer, Hiddenseer Anwohnern, Zeugen, dem Krankenhaus, in dem die Komapatientin lag, sowie den Namen und Kontaktdaten von Psychologen, ermittelnden Polizeibeamten und Staatsanwälten.
Ich musste mich ans Werk machen. Es war achtzehn Uhr sieben, und in genau drei Wochen sollte der Artikel fertig auf dem Tisch des Chefredakteurs der Regionalzeitung liegen.
Ich holte mir einen neuen Pott heißen Kaffees aus der Küche, massierte mir kurz den Nacken, griff nach dem Handy und starrte unschlüssig auf die Liste. Wen sollte ich zuerst anrufen? Einen der Überlebenden? Eine Angehörige?
Normalerweise begegnete ich den unmittelbar Betroffenen einer Straftat im Zuge des Gerichtsverfahrens. Das Terrain dort war einfacher, die Leute waren auf Fragen eingestellt, ja, sie freuten sich geradezu, gegen den Täter auszusagen und den Gerichtsreportern ihre Abscheu vor dem Monster in den Block zu diktieren.
Ich wählte eine der Nummern.
»Viseth Nan«, ertönte die hohe Stimme eines schon älteren Mannes.
»Guten Tag, Herr Nan. Mein Name ist Doro Kagel. Ich schreibe einen seriösen Artikel über das, was vor zwei Jahren auf Hiddensee passiert ist. Darin soll es auch um Ihre Frau gehen. Sie war, wenn ich richtig informiert bin, die Haushälterin oder Reinemachefrau im Haus des Ehepaares Lothringer und Nachtmann, stimmt das?«
Keine Reaktion. Atmen.
»Sind Sie noch dran, Herr Nan?«
Keine Reaktion. Atmen.
Natürlich hatte ich schon mal von jenen Spinnern gehört, die einen anriefen und durch bloßes Atmen verängstigten. Dass auch Angerufene dieses Verhalten an den Tag legten, war mir neu.
»Ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen schwerfällt, über die schrecklichen Ereignisse zu sprechen, von denen ja auch Sie betroffen waren. Ich kann Ihnen versichern, dass ich nur das über Ihre Frau schreiben werde, was Sie ausdrücklich genehmigen.«
Wieder nur Atmen.
»Würden Sie mir einige wenige Fragen gestatten?«
Ein Knacken in der Leitung. Herr Nan hatte aufgelegt.
Journalisten sind wie Taxifahrer, sie wundern sich über gar nichts mehr. Daher hakte ich das Gespräch, das keines war, unter Skurrilitäten ab. Trotzdem: ein motivierender Beginn sah anders aus. Es war Viertel nach sechs, mein Rücken schmerzte, und die Augusthitze, die nicht weichen wollte und meine Wohnung wie eine feuchte Blase umfing, ließ mein Kleid an meinem Körper kleben wie eine zweite, eine synthetische Haut. Ich kam mir vor wie in Frischhaltefolie gewickelt. Fruchtfliegen stiegen von dem Obstteller auf, schwirrten um meine Haare herum. Ich sehnte mich nach Nacktheit, nach einer kalten Dusche. Auf einem der oberen Balkone des Altbaus, in dem ich wohnte, fanden sich Freunde zusammen, um zu grillen und zu feiern. So sollte ein Sommertag ausklingen, mit frisch gewaschenen, duftenden Haaren, einem kurzen, nackten Räkeln auf dem Bett, mit einem leichten Kleid, einem eiskalten Getränk, mit Lachen.
Doch ich war unfähig, dieses natürliche Verlangen länger als einige Sekunden zuzulassen. Der Schreibtisch war stärker. Seine magische Anziehungskraft fing mich immer wieder ein, beschleunigte mich, gab mir das gute Gefühl von Erfolg, ebenso davon, Hindernisse zu überwinden und böse Dinge wie Arbeit zu vernichten. Die Geschwindigkeit, mit der ich Aufgaben erledigte, berauschte mich. Entfernte ich mich zu lange vom Schreibtisch, fühlte ich mich seltsam nutzlos und verloren, da ich wusste, dass er sich während meiner Abwesenheit mit unerledigten Aufgaben, will heißen mit Anklagen, füllte.
Natürlich gab es auch Dinge jenseits der Arbeit – Einkäufe, Geburtstage, Telefonate mit Freunden, gelegentliche Treffen, Besuche bei Verwandten, Einladungen, Kinobesuche –, aber ich konnte sie immer seltener und kürzer genießen. Mein Kosmos verengte sich von Monat zu Monat, und übrig blieben die Texte, die Wörter, die Mörder, die Maschine, das große, verlangende Auge, in das ich schrieb.
Ich wählte erneut. Vielleicht hatte ich bei dem Sohn mehr Glück als bei dem Witwer.
»Nan.«
»Guten Tag, mein Name ist Doro Kagel. Ich hätte gerne Herrn Yim Nan gesprochen.«
»Am Apparat. Was kann ich für Sie tun, Frau Kagel?« Yim hatte eine sehr klare, milde und geduldige Stimme.
Sie schien mir aus einer anderen Welt zu kommen, zu der ich seit einigen Jahren keinen Zutritt mehr hatte, der Welt des Wohlbehagens. Der Klang dieser Stimme schien zu sagen: Und woher kommst du?
»Ich schreibe einen Zeitungsartikel über die Ereignisse von Hiddensee, die sich in Kürze zum zweiten Mal jähren, und hätte da ein paar Fragen. Wie Sie sich denken können, geht es dabei hauptsächlich um Ihre Mutter. Ich möchte dem Leser ein bisschen über Ihre Mutter erzählen, über sie als Mensch. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir Auskunft geben würden. Es wird auch nicht lange dauern.«
»Das sollte es aber, meinen Sie nicht?«
Ich zögerte, bevor ich antwortete: »Natürlich, Sie haben recht.« Innerhalb einer Sekunde gingen mir mehrere Filme durch den Kopf, in denen langmütige asiatische Lehrer ihren zumeist amerikanischen Kampfsportschülern als erste Lektion die Wichtigkeit von Ruhe und Konzentration, Bescheidenheit und Selbstreflexion beibrachten.
»Es tut mir leid. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Hätten Sie Zeit für mich?«
Nach weiteren schweigend verstrichenen Sekunden sagte Yim: »Ich will ehrlich sein. Eigentlich möchte ich Ihre Fragen nicht beantworten. Niemandes Fragen.«
»Ich will auch ehrlich zu Ihnen sein. Mir würde es an Ihrer Stelle nicht anders gehen. Aber … Sehen Sie, es werden mehrere Artikel in den verschiedensten Zeitungen erscheinen, darunter auch meiner, so oder so, und ich möchte, dass Sie mitbestimmen, was darin stehen wird. Darum meine Anfrage.«
Diesmal ließ Yim sich noch mehr Zeit mit der Antwort. »Einverstanden. Aber es ist gerade ungünstig.«
»Ich verstehe. Wann soll ich Sie anrufen?«
»Gar nicht.«
»Ich verstehe«, sagte ich erneut, doch diesmal war es gelogen. »Ich gebe Ihnen meine Nummer.«
»Mir wäre es lieber, wir würden uns treffen. Ich kann über die Dinge, die Sie mich vermutlich fragen werden, nicht am Telefon reden.«
Ich hätte mich freuen sollen. Einem guten Journalisten ist eine persönliche Begegnung mit einem Interviewpartner allemal lieber, weil man den Befragten leichter dazu bringen kann, aus sich herauszugehen. Für mich bedeutete der Vorschlag jedoch eine zusätzliche zeitliche Belastung, dabei wollte ich diesen Artikel so schnell wie möglich geschrieben und abgegeben haben. So viel anderes wartete auf mich.
»Sie müssten schon nach Berlin kommen, wenn Sie mit mir reden wollen«, sagte Yim.
»Ich wohne ebenfalls in Berlin.«
»Dann ist es ja kein Problem.«
»Nein, kein Problem«, sagte ich und rieb mir die Stirn. »Passt es Ihnen noch heute Abend?«
Erneut ließ er sich Zeit. »Einverstanden. Handjerystraße einhundertsechzehn. Das Restaurant heißt Sok sebai te. Kambodschanische Küche. Um einundzwanzig Uhr?«
»Geht es nicht früher?«
»Leider nicht.«
»Gut, dann … Einundzwanzig Uhr ist mir recht.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, sah ich auf die Uhr. Mir blieben zweieinhalb Stunden; wenn ich eine schnelle Dusche, einen Garderobenwechsel und die Fahrzeit einrechnete, noch eineinhalb Stunden. Ich griff mir die oberste von geschätzten zwanzig Mappen der Fernkurs-Einsendungen, las einen Artikel mit dem Titel »Die Energiesparlampen-Lüge« und trank, während ich den Text korrigierte, einen Pott kalten Kaffees.
2
Zwei Jahre zuvor, September 2010
Pistole, Schmerzmittel, Streichhölzer, Lexotanil. Zum wiederholten Mal an diesem Morgen kontrollierte Leonie, ob sie am vorigen Tag alles in die Handtasche gepackt hatte. Am liebsten wäre sie an ihrem Küchentisch sitzen geblieben, weshalb sie bis zur allerletzten Minute vor der Abfahrt nach Hiddensee an den Ritualen des Alltags festhielt.
Sie schnalzte ein paarmal mit der Zunge. Oft verbrachte sie eine ganze Stunde damit, die Nachbarskatzen zu rufen, und hatte sie Erfolg, standen einige Schalen voller Leckereien bereit. Leonie hatte ihnen Namen gegeben, da sie die richtigen Namen der Tiere nicht kannte. Sie unterschied zwischen Stammgästen und Gelegenheitsbesuchern, entsprechend verteilte sie ihre Fürsorge. Es kam vor, dass keine Katze erschien – es mochte dann am Wetter liegen oder an etwas, das Leonie nicht verstand.
So war es auch am Morgen der Abreise. Leonie schloss die Terrassentür mit einem Knall, sammelte die Schälchen ein und warf sie in die Spüle. Sie ließ einen Strahl Warmwasser darüberlaufen und kümmerte sich dann nicht mehr darum.
Plötzlich fiel ihr etwas ein, und sie ging zu ihrer Handtasche.
Pistole, Schmerzmittel, Streichhölzer, Lexotanil. Gut!
Der große Zeiger der Küchenuhr näherte sich der vollen Stunde. Noch zehn Minuten, sagte sie sich. Am Küchentisch trank sie einen letzten Schluck Kamillentee. Gedankenversunken griff sie zum Handy, drückte die Kurzwahltaste 1 und sprach Steffen eine Nachricht aufs Band.
»Schade, dass ich dich nicht erreiche, vielleicht schläfst du noch. Also, ich fahre jetzt los. Eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich weiß nicht, warum ich die Einladung angenommen habe, aber nun ist es zu spät. Am Dienstag bin ich wieder da. Ich freue mich auf dich und werde die ganze Zeit über an dich denken. Du kannst mich jederzeit anrufen, ja? Bis dann.«
Sie hatte auf Punkt und Komma genau die Wahrheit gesagt, bis auf einen Halbsatz: Sie wusste sehr wohl, warum sie die Einladung angenommen hatte.
Ihr Blick glitt über das Wachstuch mit dem Erdbeermuster und verharrte schließlich an dem einzigen Foto, das sie aus jener Zeit noch hatte, den Tagen mit Timo, Yasmin und Philipp. Genau genommen war es kein Foto mehr, sondern es waren nur noch Schnipsel eines Fotos, die sie in einem Schuhkarton gefunden und notdürftig zusammengesetzt hatte. Philipps Beine fehlten, aber die waren Leonie sowieso schnurz. Mit dem Finger berührte sie Timo. Sein lachendes Gesicht ließ Leonie ihre Nervosität für ein paar Sekunden vergessen.
Kurz darauf ertönte die Türklingel.
»Oh, Mama. Du bist es. Ich bin auf dem Sprung. Hättest du nicht anrufen können?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!