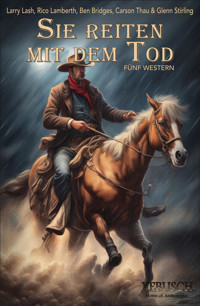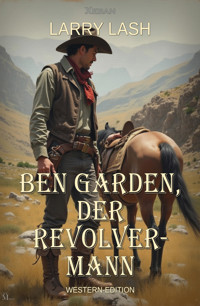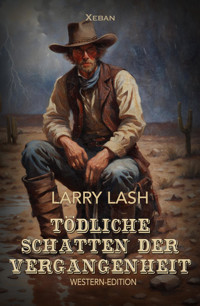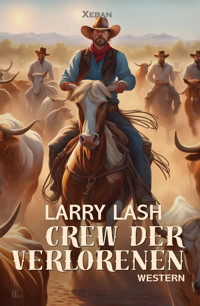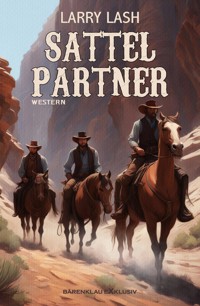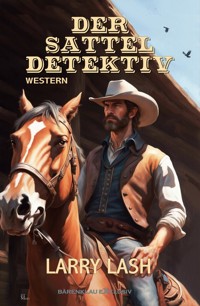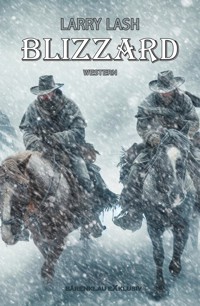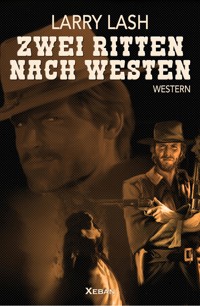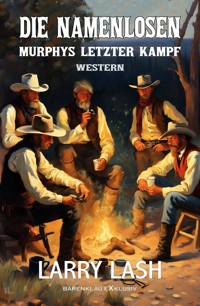
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ron Murphy hat sich aufgegeben. Im Alkohol sucht er Vergessen, Vergessen von den schlimmen Erinnerungen an seine Familie, die es nicht mehr gibt, und an die Verbrecher, die ihm das angetan haben. Der ehemals berühmte Revolvermann fristet bei den Namenlosen, den Ausgestoßenen am Rande der kleinen Stadt Dragon ein erbärmliches Dasein und lebt von kargen Almosen. Doch es gibt Menschen, die sich von Murphy Hilfe erhoffen, obwohl er selbst jede Hilfe brauchen kann:
Nina und Percy Stanton, die Kinder eines Farmers, leiden wie die ganze Stadt unter dem Terror fanatisch religiöser Sektierer, die ein neues irdisches Reich der Daniten errichten wollen. Als Murphy erkennt, wie die brutalen Fanatiker mit seiner eigenen Vergangenheit zusammenhängen, erhebt er sich aus der Gosse, um einen letzten Kampf zu kämpfen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Larry Lash
Die Namenlosen
- Murphys letzter Kampf -
Western
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Steve Mayer, 2023
Korrektorat: Falk Nagel
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Namenlosen
Murphys letzter Kampf
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Ron Murphy hat sich aufgegeben. Im Alkohol sucht er Vergessen, Vergessen von den schlimmen Erinnerungen an seine Familie, die es nicht mehr gibt, und an die Verbrecher, die ihm das angetan haben. Der ehemals berühmte Revolvermann fristet bei den Namenlosen, den Ausgestoßenen am Rande der kleinen Stadt Dragon ein erbärmliches Dasein und lebt von kargen Almosen. Doch es gibt Menschen, die sich von Murphy Hilfe erhoffen, obwohl er selbst jede Hilfe brauchen kann:
Nina und Percy Stanton, die Kinder eines Farmers, leiden wie die ganze Stadt unter dem Terror fanatisch religiöser Sektierer, die ein neues irdisches Reich der Daniten errichten wollen. Als Murphy erkennt, wie die brutalen Fanatiker mit seiner eigenen Vergangenheit zusammenhängen, erhebt er sich aus der Gosse, um einen letzten Kampf zu kämpfen …
***
Die Namenlosen
Murphys letzter Kampf
Western
1. Kapitel
Es schüttelte ihn durch und durch. Kälteschauer jagten durch seinen mageren, ausgemergelten Körper. Ekel und Widerwillen waren in ihm. Er stemmte sich aus dem Dreck der Fahrbahn, doch nur, um gleich wieder schwach und entkräftet zurückzufallen.
Es näherten sich Schritte. Eine Stiefelspitze berührte seine Schulter, und eine raue Stimme sagte:
»Schau ihn dir an, Jed! Hier liegt der große Murphy in der Gosse. Du kannst dich sicher nicht erinnern, von ihm schon einmal gehört zu haben? Nur schaudernd kann man auf dieses menschliche Wrack niedersehen, denn mit diesem vom Whisky schwer angeschlagenen Menschen ist nichts mehr los. Er suhlt sich wie ein Ferkel im Dreck und erinnert an die lausigen Agenturindianer, mit denen er oft zusammensteckt. Dieser Kerl hier, mein Sohn, war vor Jahren mein Freund, und jeder ehrbare Mann war stolz darauf, einen solchen Mann zum Freunde zu haben. Dieser Bursche hier ist nicht mehr der große Murphy, er ist namenlos wie die geworden, denen er sich anschloss, mit denen er jetzt paktiert. Er ist es nicht wert, dass man ihn mit der Stiefelspitze berührt.«
Heiseres, mehrstimmiges Gelächter drang zu den Männern herüber. Wie aus weiter Ferne drang es in Rons Ohren.
»Dad, es ist doch nicht möglich, dass dies der große Murphy sein soll, der mit Bridger, Carson und Nelson gekämpft und die Silbersporenbande von der Welt gefegt hat. Es kann doch nicht der Mann sein, der eine Karawane auf dem Trail …«
Mehr hörte Ron Murphy nicht. Es war ihm gleich gültig, was sie von ihm sagten, was sie von ihm hielten. Er war nur noch ein Wrack, und jeder Halbwüchsige konnte seinen Spaß mit ihm treiben. Aber was tat‘s schon! Die Zeit war vorbei, wo sich etwas in ihm geregt hatte, wenn man seinen Namen nannte. War er tatsächlich Murphy gewesen? Nun, dann war er von diesem Murphy durch eine Ewigkeit getrennt. Der Mann aus der Vergangenheit war in diesem Mann in der Gosse längst gestorben.
»Ein Held«, kam es über die zerschlagenen und verquollenen Lippen, »ein Held …«
Ein irres Lächeln geisterte um seine Lippen. Er wusste nicht, wer ihm die Lippen aufgeschlagen hatte, wer ihm einen Tritt gegeben und in die Gosse befördert hatte. Er fand sich allzu oft in ihr wieder, und ihm war es gleichgültig, nach wie vielen Stunden. Der Durst nach Brandy war wieder wie eine Flamme in ihm, die ihn auszubrennen drohte.
Damals, in jener Nacht, die jetzt viele Jahre zurücklag, als man ihn bis zum Kopf in der Wüste eingegraben hatte, als die Geier kamen, als alle Hoffnung in ihm erlosch, seit damals brannte es in ihm. Die Sucht nach Brandy war nach seiner Rettung das Einzige, was ihn noch antrieb.
Die Kälte in ihm ließ ihn erschauern. Wieder versuchte er, sich aufzustützen. Es gelang schließlich. Mit tiefliegenden Augen blickte er in die Dämmerung. Es wurde bereits wieder Nacht. Er musste also den ganzen Tag über in der Gosse gelegen haben. Seine Freunde würden ihn suchen, und richtig – sie kamen schon. Es waren zwei Kerle, denen ein Christenmensch nicht einmal am Tage begegnen mochte. Es waren zwei ausgedörrte Gestalten mit tiefbrauner Haut, vorstehenden Wangenknochen, Hakennasen, dünnen Lippen und schräggestellten Augen.
Wortlos kamen diese beiden schmutzigen Gestalten näher. Agenturindianer. Sie schienen nur in Decken gehüllt zu sein. In ihren ausdruckslosen Gesichtern zuckte kein Muskel. Die Gesichter schienen aus Stein gemeißelt zu sein, es waren Gesichter, die keinerlei innere Erregung verrieten und schon seit Ewigkeiten den immer gleichen, düsteren Ausdruck zu haben schienen. Wortlos bückten sich die beiden und hoben den weißen Mann auf und nahmen ihn in ihre Mitte. Jeder der beiden Agenturindianer nahm einen Arm des Weißen und legte ihn sich über die Schulter. Sie bewiesen eine solche Übung dabei, dass man annehmen konnte, dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht hatten.
Der weiße, schmutzbesudelte Mann hing mit zur Erde geneigtem Kopf zwischen ihnen. Es war tatsächlich kein gutes Bild, das Ron abgab, doch so hatte man ihn schon oft gesehen.
»Wir jagen dich aus der Stadt!«, sagte jemand herausfordernd. »Ich wundere mich nur, dass wir es nicht schon längst getan haben! Man sollte es jetzt gleich erledigen. Macht diesen Kerlen Beine! Los, Männer, machen wir uns einen Spaß, lassen wir die Kerle laufen!«
Mit ausdruckslosem Blick schaute Ron den Sprecher an. Es war fraglich, ob er überhaupt begriff, was der Mann da sagte, ob Angst in ihm hochkroch. Sah er überhaupt die Männer, die sich da eingefunden hatten und in Gruppen zusammenstanden?
»Dieser Kerl ist eine Schande für unsere Stadt«, sagte ein anderer böse. »Gestern warf Haggard ihn aus dem Saloon, und heute ist er immer noch hier.«
»Den ganzen Tag war er stockbetrunken«, sagte ein anderer höhnisch. »Ich wette, dass er nicht einmal wahrnahm, dass Elliot mit seiner verruchten Bande in die Stadt kam und erklärte, dass die Stadt nun ihm gehörte.«
»Amb«, meldete sich ein anderer mit rauklingender Stimme, »sei vorsichtig, wenn du von Elliot sprichst.«
Die scharfe Detonation eines Schusses dröhnte durch die Dämmerung, und dem Mann, der öffentlich gegen Elliot Stellung genommen hatte, flog der Hut vom Kopf.
Wie gelähmt standen die Menschen da, als hätte die eiskalte Hand des Todes nach jedem Einzelnen von ihnen gegriffen. Auf der Terrasse vor dem Saloon stand ein düster aussehender Kerl, der seinen rauchenden Revolver hin und her schwenkte und kalt sagte: »Ihr habt es wohl immer noch nicht begriffen! Diese Stadt gehört nun Elliot. Denkt gut darüber nach! Morgen werden wir uns dieses Nest einmal genau ansehen. Jetzt hört gut zu: Die Saloons sind nur noch für Angehörige aus Elliots Verein frei! Elliot hofft, dass seine Mannschaft Zuwachs bekommt.«
Der düstere Kerl redete noch weiter, doch Ron hörte es nicht mehr. Seine Begleiter hatten sich mit ihm in Bewegung gesetzt. Die scharfe Detonation eines Schusses hatte diesen Stadtmenschen wieder klar gemacht, dass mit Elliot und seiner Meute nicht zu spaßen war. Manch einer mochte sich jetzt fragen, warum man die Meute nicht mit heißen Kugeln empfangen hatte. Es hatte kein Feuergefecht gegeben. Elliot war mit seinem fünfzig Mann starken Reitertrupp offen in die Stadt geritten und hatte sie in Besitz genommen.
Wenn man gehofft hatte, dass Eliot weiterreiten würde, so konnte man diese Hoffnung getrost begraben. Es war im Gegenteil anzunehmen, dass seine Reiter die Stadt auseinandernahmen. In den nächsten Stunden würde es sich zeigen, wozu diese Meute fähig war.
Yeah, dieser heruntergekommene Freund der Indianer hatte plötzlich alles Interesse für sie verloren. Mochte er abziehen, man hatte jetzt ganz andere Sorgen. In manchen Augen stand Furcht und Sorge.
Von all dem bemerkte Ron nichts. Je weiter ahn die beiden Männer mitschleppten, desto nüchterner wurde er, umso besser konnte er die eigenen Beine gebrauchen. Niemand hetzte oder jagte sie. Diesmal kam keiner ins Stolpern und blieb unter Spott und Hohngelächter auf der Fahrbahn liegen. Zum ersten Mal konnten die beiden Indianer ihren weißen Freund, ohne belästigt und gedemütigt zu werden, aus der Gosse holen. Sie konnten die Mainstreet passieren, ohne dass Reiter von ihren Pferden aus mit den Bullpeitschen versucht hätten, ihnen ein paar Schläge überzuziehen. Heute standen die reiterlosen Pferde an den Holmen angebunden. Die unterschiedlichen Brandzeichen verrieten, dass es einige große Ranchen in der Gegend gab.
Die größte Ranch besaß jedoch Elliot. Keiner in der Stadt hatte geahnt, dass Elliot eine so kampfstarke Mannschaft besaß. Als er mit seiner Crew anritt, war keinem wohl gewesen. Die Cowboys dieser Mannschaft waren unbeliebt in der Stadt. Dass Elliot sich die Stadt sozusagen unterwerfen wollte, war eine Nachricht, die erst noch verdaut werden musste.
Was störte diese Tatsache Ron, der sich jetzt wieder so weit in der Gewalt hatte, dass er nicht mehr fror und ohne gestützt zu werden laufen konnte. Er ging jetzt aufrecht mit seinen beiden Begleitern. Sie hatten die letzten Häuser der Stadt fast hinter sich und konnten schon die primitiven Erdhütten der Namenlosen sehen. Sie lagen am Rande der Stadt und wurden von jenen Menschen bewohnt, die ohne Hoffnung waren, die nichts mehr um sich und die Welt gaben. Ja, die Erdhütten waren schon in Sichtweite, als eine Reitergruppe auftauchte, die rasch näher kam.
Der Dreck spritzte unter den Hufen der Pferde auf. Die Gruppe ritt dicht geschlossen und stob bei Erreichen der ersten Häuser auseinander. Ron und seine beiden Begleiter kamen nicht schnell genug von der Fahrbahn. Der Bug eines Pferdes warf Rons rechten Begleiter gegen die Holzwand eines an der Fahrbahn stehenden Schuppens. Der Anprall war so stark, dass man glauben konnte, der Agenturindianer hätte alle Rippen gebrochen. Ron bekam einen kräftigen Schlag gegen die Brust und sank zusammen. Er fiel einem dicht folgenden Pferde vor die Hufe. Das Tier schnaubte auf und setzte über ihn hinweg. Es hatte mehr Erbarmen als der zweite Reiter, der Ron einen Hieb mit der Bullpeitsche versetzte, dass er sich zusammenkrümmte und einen Schmerzensschrei von sich gab.
Lauter und gellender als Ron schrie der junge Mann, den Ron erst jetzt sehen konnte. Er wurde von einem Lasso über die Fahrbahn geschleift. Aus der Reitergruppe drang Gelächter. Einer der Reiter befahl zu halten und trieb sein Pferd an den jungen Mann heran, der stöhnend mitten auf der Fahrbahn lag.
»Dein Stolz ist nun dahin, Percy Stanton?«, sagte der Mann vom Sattel her, wobei sich sein pockennarbiges Gesicht höhnisch verzog. »Wenn ich jetzt das Zeichen zum Weiterreiten gebe, bist du in wenigen Minuten ein toter Mann. Aber das wäre zu einfach. Ich will, dass du am Leben bleibst, dass du auf allen vieren zur Ranch zurückkommst, dass du deine Leute veranlassen kannst, bei Nacht und Nebel mit dir zu verschwinden. Ich wünsche, dass alle wissen, was es heißt, mir zu trotzen. Heh, Jim, binde ihn los!«
Einer der Reiter glitt aus dem Sattel und tat, was ihm befohlen worden war. Der junge Mann am Boden lag schweratmend und mit offenen Augen da. Sein Blick war unverwandt auf den Reiter vor ihm gerichtet.
»Wir haben uns nie leiden können, dein Vater und ich. Das war schon so, als wir mit dem Treck hierher nach Utah kamen. Seitdem hat sich nichts daran geändert. Es hatte nichts zu bedeuten, dass wir zusammen gegen feindliche Indianer und später gegen die blutrünstigen Banditen der Mormonen kämpften. Ich beanspruche alles Land für mein Reich, das ich mir hier zu errichten gedenke.«
Die Augen des narbengesichtigen Reiters glühten. Der Hohn entstellte sein Gesicht zu einer teuflischen Maske.
»Ich werde mir nehmen, was mir gefällt!«, führ er mit heiserer, vor Erregung schwingender Stimme fort. »Lange war es nur ein Traum, jetzt bin ich dabei, ihn in die Wirklichkeit umzusetzen …«
Elliot, eines Tages wird dich das Gesetz erwischen, dachte müde und resigniert Ron, der sich von dem Peitschenschlag erholt hatte und zu den beiden Agenturindianern hinkroch, die sich in eine Wandnische gedrückt hatten. Ja, eines Tages wird auch das Gesetz bis nach Utah kommen, Elliot. Nur der Himmel weiß, wann das sein wird.
Ron wagte sich nicht zu rühren. Er hatte schnell in die Gesichter seiner Freunde geblickt und festgestellt, dass sie beide keinen Schaden erlitten hatten. Ihre Gesichter waren so unbewegt wie immer. Man konnte nicht einmal sagen, dass ihre Decken schmutziger geworden waren. Sie hatten die Demütigung wie ihr weißer Freund hingenommen und schienen immun gegen das Leid anderer zu sein. Sie schienen keine Gefühle zu haben, denn sie starrten auf den auf der Fahrbahn liegenden Mann, als ginge sie das Scheußliche überhaupt nichts an.
Der geschundene Mann stieß in diesem Augenblick einen Fluch hervor. Dann sank er in Ohnmacht. Keine Bitte, kein Flehen war über seine Lippen gekommen. Nur einen Fluch hatte er für seinen Peiniger, dessen Schlag einen bereits Ohnmächtigen traf.
Wer immer Percy Stanton auch war, er hatte sich trotz seiner Jugend als aufrechter und tapferer Mann gezeigt. Jetzt lag er wie leblos mitten auf der Mainstreet, zusammengekrümmt, ein Mensch, dem eine Ohnmacht weitere Demütigung, Schmach, Pein und Hohn ersparte. Elliot blickte auf den jungen Mann herab. Was in ihm vorging, konnte man seinem düsteren Gesicht nicht ansehen. Er gab seinen Leuten einen Wink, worauf die Reiter ihre Pferde wieder in Bewegung setzten. Keiner kümmerte sich weiter um den ohnmächtigen Mann mitten auf der Fahrbahn.
Als die Reitergruppe abgezogen war, setzte sich Ron mit seinen beiden Begleitern in Bewegung.
»Packt an«, sagte Ron zu seinen Begleitern. »Wir nehmen ihn mit. Für ihn ist bei uns noch Platz, Freunde.«
Zu dritt trugen sie den Ohnmächtigen zu den Erdhütten hin. Dort angekommen, betteten sie ihn auf schmutzige Lumpen, die als Lager dienten. Einer der Indianer glitt mit einem Weidenkorb hinaus.
»Ron, ich suche einige Kräuter«, sagte er. »Wir werden dem weißen Mann einen Trank bereiten, damit er wieder auf die Beine kommt.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, entfernte sich Adam, der ältere der beiden Agenturindianer. Er hatte einmal dem Stamme der Osagen angehört, einem Sioux-Volk, das in harten Kämpfen mit den Weißen fast vollständig aufgerieben worden war. Er und auch sein Bruder Josuah waren beide hoch gewachsene Männer. Sie führten jetzt ein Leben, das wohl kaum noch menschenwürdig zu nennen war. Beide hatten nichts mehr mit jenen stolzen Kriegern gemein, die es beim Stamme der Osagen gegeben hatte. Wer es sehen wollte, sah es bei ihnen mit aller Deutlichkeit, was das Wunder der Zivilisation aus den einstmals stolzen roten Männern gemacht hatte.
Die drei Bewohner der Erdhütte lebten kaum, sie vegetierten nur so dahin und mit ihnen die Bewohner der anderen Erdhütten und Tipis. Vor einigen Jahren noch hatten alle diese Menschen ein ausreichendes Auskommen gehabt. Sie hatten sich im Sog der Trecks bewegt, jener Trecks, die auf der sogenannten Medizinstraße zogen, um Oregon, Santa Fe, Utah oder die Goldfelder von Kalifornien zu erreichen. Im Sog dieser Trecks hatten die Namenlosen all das gefunden, was sie zum Leben brauchten, denn die Leute der Trecks warfen, um ihre Prärieschoner zu erleichtern, nicht nur Hausrat und alle sonstigen Dinge fort, die sie glaubten entbehren zu können, sondern auch Berge von Proviant. Dadurch hatten die Namenlosen etwas zu essen gehabt. Sie waren alle nicht anspruchsvoll. Ranziger Speck tat ihrem Appetit keinen Abbruch, wurmiges Mehl wurde vor dem Genuss ausgesiebt. Nur eines hatten die Namenlosen zu fürchten: jene Indianersippen, die ebenfalls von den Abfällen der Medizinstraße lebten. Sie gingen erbittert gegen die Namenlosen vor, wenn sie mit ihnen zusammenstießen. Die Schar der Namenlosen wurde von heruntergekommenen weißen Männern gebildet, von entlaufenen Sklaven, von aus ihren Stämmen ausgestoßenen Indianern und von anderem lichtscheuem Gesindel. Sie wurden von Weißen und Roten gleichermaßen gehasst. Die Verachtung für diese Menschen war seit jener Zeit erhalten geblieben.
2. Kapitel
Nacheinander kamen die Namenlosen aus den anderen Elendshütten herbei. Alle schienen unsichtbar das Kainszeichen auf der Stirn zu tragen. Sie hatten den Anmarsch der drei Männer mit dem Ohnmächtigen gesehen, ohne dass sie Neugier oder Interesse verraten hätten. Jetzt kamen sie heran, schweigend und leise. Sie betrachteten den Ohnmächtigen und sahen auch zu, wie Adam und sein Bruder Josuah vor der Hütte über einem offenen Feuer in einer Blechdose Kräuter kochten, ohne dass sie sich dabei durch die Besucher hätten stören lassen. Sie beugten sich über dem Ohnmächtigen nieder, blieben einige Minuten und verschwanden dann wieder fast lautlos. Es wurde nichts geredet dabei. Die Szene hatte etwas Gespenstisches an sich, wie sie mit unbewegten Gesichtern den Ohnmächtigen anstarrten, sich umsahen und wieder gingen. Sie schienen alle innerlich ausgebrannt zu sein, sie schienen kein Erbarmen, überhaupt keine Gefühle zu kennen, als ob sie anstatt eines Herzens einen Stein in der Brust hätten. In ihrem Gebaren waren sie sich alle ähnlich, die fünf weißen Männer, die mit der alten Frau kamen, und auch die zehn roten Männer. Der Himmel mochte wissen, aus welchen Stämmen die Roten alle stammten. Nach den Männern kamen die Squaws und die Kinder, halbnackt, auf dünnen Beinchen. Die dünnen Ärmchen und dicken Bäuche zeigten deutlich, dass sie unterernährt waren. In ihre großen, dunklen Augen schien das Wissen um den Untergang ihrer Rasse eingebrannt zu sein. Die Augen der Kinder blickten so uralt, dass einen frieren konnte. Als letzte kamen die beiden riesigen Farbigen Bob und Samuel, zwei Kerle mit starken Muskelwülsten. Beide waren nur spärlich bekleidet. Auch sie sagten kein Wort, gingen auch gleich wieder. Alle ohne Ausnahme schienen den Vorgang am Stadtrand von ihren Erdhütten und Tipis aus beobachtet zu haben. Jeder von ihnen mochte sich wohl fragen, ob es gut gewesen war, dass Ron den ohnmächtigen Mann herangeschafft hatte und ihm nun Hilfe gewährte. Alle schienen zu vermuten, dass er nur Schwierigkeiten damit heraufbeschwören würde.
Schwierigkeiten – das würde bedeuten, dass man von hier aufbrechen musste. Man würde sie weiterhetzen, der Elendstreck würde sich erneut in Bewegung setzen, es würde ohne Ziel weitergehen, in die feindliche Wildnis hinein, die kaum noch etwas zu bieten hatte; denn die Medizinstraße war verödet. Dort gab es nichts mehr zu holen. Was dort noch von vereinzelt ziehenden Trecks abgeworfen wurde, reichte nicht aus, um einen Mann satt zu machen, geschweige denn eine so starke Gruppe.
Der breitbrüstige Riese Bob strich über sein dunkles Kraushaar, rieb sich die Lippen und tastete über das Narbengeflecht auf seinem Oberkörper hinweg, das von den Schlägen einer Aufseherpeitsche verursacht worden war. Dann spuckte er zur Seite aus und ging ebenfalls.
Am Eingang der Erdhütte blieb er nochmals stehen, wandte sich um und sagte zu Ron:
»Seht zu, dass er wach wird, zu essen bekommt und sich davonmacht. Elliot wird uns sonst die Hölle heiß machen. Er ist dabei, die Stadt zu erobern, sich alles Land ringsum untertan zu machen. Er wird dann wie ein König herrschen können, sein Reich wird sich bis zum Mormonenstaat ausdehnen. Wir wollen keinen Ärger, wir haben in der Vergangenheit genug davon gehabt. Hier wollen wir weiterleben. Elliot wird uns nicht verjagen, wenn wir ihn nicht reizen. Der eine oder andere von uns wird hin und wieder etwas Geld als Kehrichtfeger, Tellerwäscher oder Handlanger verdienen können. Wozu sollen wir uns also Ärger auf den Hals laden?«
Bob wartete auf keine Antwort und ging. In diesem Moment dämmerte es Ron, wie tief er gesunken war. Selbst bei diesen Ausgestoßenen und Verfemten waren er und seine Freunde nichts als Auswurf. Die anderen arbeiteten hin und wieder, um sich etwas zu verdienen, um durch die Arbeit ihrer Hände dieses elende Leben etwas erträglicher zu gestalten. Was hatten er, Josuah und Adam getan?
Die Kehle zog sich ihm eng, und seine Hände zitterten. Billiger Handelswhisky und scheußlich schmeckender Brandy hatten ihn und seine Freunde ausgehöhlt. Sie waren zu menschlichen Wracks, zu Ruinen geworden. Sie alle drei bettelten nur noch um das scheußliche Gesöff, das ihnen farbige Träume und Vergessen schenkte. Brandy löschte Hunger und Durst, löschte die Vergangenheit aus und nahm die Angst vor der Zukunft, Brandy riss sie alle in die Tiefe.
Ein düsteres Lächeln spielte tun Rons Mundwinkel. Genau so und nicht anders hatte er es haben wollen, Elend, Not und den Tod. – Er hatte geglaubt, dass sich das alles schnell erfüllen würde. Jetzt begriff er, dass der Raubbau an seinem Körper noch lange nicht beendet war, um die Schatten des Todes über ihm zusammenschlagen zu lassen. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen gehabt, aber auf eine solche Stufe hatte er nicht abrutschen wollen. Das alles sollte sich viel schneller vollziehen. Vielleicht betrachtete er zum ersten Mal bewusst die schmierige Erdhütte, die primitiven Lager, das wenige, das ihnen ein Dahinvegetieren gestattete. Es war lächerlich wenig, alles Dinge, die andere weggeworfen hatten. Die Decken wimmelten von Ungeziefer, die Behälter und Blechtassen waren rostig. Ein rußfarbiger Topf und einige Konservendosen dienten zum Aufbewahren der wenigen Lebensmittel. Es gab keine Waffe, nur einige Messer, die man dazu benutzte, um sich einige Stücke Fleisch abzuschneiden, wenn es einmal etwas davon gab. Es war noch ein Beil vorhanden, das man zum Holzhacken benötigte, und ein rostiger Spaten.