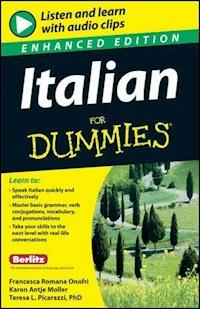19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
»Demokratie darf kein Luxus sein. Sie muss Grundlage von allem sein – in unseren Schulen und in unserer Gesellschaft. Dafür werde ich kämpfen wie eine Löwin.« Die Psychologin Marina Weisband ist davon überzeugt, dass Demokratie gelernt werden muss. Sie nur zu wollen, reicht definitiv nicht aus. Mit Demokratieförderung kann gar nicht früh genug begonnen werden, deshalb geht Marina Weisband in Schulen und arbeitet in verschiedenen Projekten mit Kindern und Jugendlichen. Denn unsere Schulen sind derzeit nicht gut aufgestellt. Viel zu selten bieten sie Gestaltungsspielraum. Statt selbständig zu werden, geraten Jugendliche in einen Zustand erlernter Hilflosigkeit – den sie auch als Erwachsene nicht mehr loswerden. Das wiederum ist ein ideales Einfallstor für Extremismus und Populismus. Marina Weisband weiß auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung zu erfahren. Demokratie will immer wieder neu erkämpft und gelebt werden, sie ist kein Naturzustand. Nur wenn wir das begreifen, können wir Jugendliche befähigen, als mündige Bürgerinnen und Bürger unsere Gesellschaft zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marina Weisband
Die neue Schule der Demokratie
Wilder denken, wirksam handeln
Über dieses Buch
»Demokratie muss man nicht nur wollen – man muss sie auch können.« Davon ist Marina Weisband überzeugt und deshalb geht sie in Schulen und arbeitet in verschiedenen Projekten mit Kindern und Jugendlichen. Denn unsere Schulen sind derzeit nicht gut aufgestellt. Viel zu selten bieten sie Gestaltungsspielraum. Statt selbständig zu werden, geraten Jugendliche in einen Zustand erlernter Hilflosigkeit – den sie auch als Erwachsene nicht mehr loswerden. Es ist das ideale Einfallstor für Extremismus und Populismus.
Die Psychologin und Bildungspolitikerin Marina Weisband weiß auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung zu erfahren. Demokratie will immer wieder neu erkämpft und gelebt werden, sie ist kein Naturzustand. Nur wenn wir das begreifen, können wir Jugendliche befähigen, als mündige Bürgerinnen und Bürger unsere Gesellschaft zu gestalten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Marina Weisband, geboren 1987 in der Ukraine, ist Diplom-Psychologin. Von einer unpolitischen Schülerin ist sie zu einer politisch engagierten Studentin geworden. Sie weiß daher, wie wichtig es ist, jungen Menschen politische Partizipation nahezubringen und zu ermöglichen. Sie war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und engagiert sich mittlerweile bei den Grünen in den Bereichen Digitalisierung und Bildung. Seit 2014 leitet sie hauptberuflich das Schülerbeteiligungsprojekt aula. Sie lebt mit ihrer Familie in Münster.
Inhalt
[Widmung]
Die Lust an der Demokratie
Erlernte Hilflosigkeit
Handeln lernen, Handeln ermöglichen
Demokratie in die Schule bringen
Die Onlineplattform
Der Vertrag
Die didaktische Begleitung
Der Prozess
Die Moderatoren
Bedenken, die ausgeräumt werden können
Ich bin gemeint
Neugierig sein
Kreativ sein
Aktiv werden
Position beziehen
Vertrauen haben
Unterschiede erkennen
Keine Angst vor Komplexität
Komplexität schätzen lernen
Regeln beachten
Verhandeln wollen
Kompromisse schließen
Langfristig denken
Entscheidungen treffen
Weiter wachsen und die Welt verändern
Handeln
Durchhalten können
Ein Motiv haben
Unterstützung suchen
Sich als wirksam erleben
Eine Idee fürs Leben
Den Stein ins Rollen bringen
Ein Ziel, aber kein Ende
Plädoyer für mehr Volkshochkneipen
Die Stimme erheben
Die Demokratie bin ich
Danksagung
Für Amalia, der die Welt geöffnet sein soll
Die Lust an der Demokratie
Demokratie muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können. In den letzten Jahren sieht es so aus, als ob demokratisches Handeln nicht mehr so selbstverständlich wäre, wie wir dachten. Die Wahlbeteiligung sinkt, bei Landtagswahlen bis auf knapp über 50 Prozent, in der Altersgruppe von 18 bis 20 Jahren sogar auf rund 40 Prozent (NRW 2022). 20 oder gar 30 Prozent der Wahlberechtigten können sich vorstellen, für die AfD zu stimmen. Die Partei stellt Landräte und Bürgermeister, womöglich in nicht allzu ferner Zukunft sogar Minister. Die Demokratie zerbröselt vom rechten Rand her. Wie konnte das passieren? Häufig hört man die Vermutung, dass es sich um »Protestwähler« handelt, um sozial »Abgehängte«, um Menschen in prekären Verhältnissen. Das mag auf viele zutreffen, aber mit Sicherheit nicht auf alle. Drei Viertel der AfD-Wählerschaft sind Angestellte, Beamte und Selbstständige, mittlere Bildungsabschlüsse überwiegen.[1] Und dass so viele Menschen gar nicht wählen, lässt sich ebenso wenig mit einem geringen Einkommen hinreichend erklären. Ich bin Psychologin und schaue nicht in erster Linie aus einer soziologischen Perspektive auf das menschliche Verhalten. Mich interessieren vor allem die psychisch motivierten Gründe für ein bestimmtes Tun, ihre Genese und die Möglichkeiten, sie zu verändern.
Was meines Erachtens einen Nichtwähler und einen Protestwähler verbindet, ist eine tief empfundene Ohnmacht. Es ist das Gefühl, in einem System zu leben, das mit einem selbst wenig zu tun hat und in dem man mit seinen Wünschen nicht durchdringt. Es ist das Gefühl, keinen Einfluss auf das Geschehen zu haben und nichts ausrichten zu können, mit den »normalen Parteien« sowieso nicht. Schon die Idee, sich zu beteiligen, erscheint absurd – »bringt doch eh nix«. Wenn Menschen mit dieser Einstellung leben, haben autoritäre Kräfte leichtes Spiel. Sie erzählen eine verlockende Geschichte: »Die Welt wird immer schlechter und unüberschaubarer. Und wer ist schuld? Die da oben! Du bist ein armes Opfer ihrer Machenschaften. Aber wenn du den guten Onkel wählst, einen wie mich, dann wird er es denen da oben zeigen. Ich mache die Welt wieder, wie sie früher war – nämlich normal.« Wer an der Komplexität der Welt zu scheitern droht, erkennt in fundamentalen, einfachen Antworten überzeugende Lösungen und sieht darin seine Chance.
Wenn wir uns die Entwicklungen der letzten Jahre anschauen – übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern –, hat dieses Ohnmachtsgefühl erheblich an Brisanz gewonnen. Es kann einerseits zu Resignation, andererseits zu Zorn führen. Manche Menschen ziehen sich ins Private zurück, andere bringen ihren Ärger in provokativen Aktionen zum Ausdruck oder gründen eine Partei, deren Programm schon im Namen steckt, wie etwa die »Bürger in Wut« in Bremen. Ich möchte nicht missverstanden werden. Keineswegs negiere ich, dass es differenzierte soziale und politische Faktoren gibt, die die Krise der Demokratie(n) mitverursachen. Ebenso wenig will ich das Verhalten von Jungen und Alten, Städtern und Landbewohnern, Männern und Frauen, Rheinländern und Sachsen usw. über einen Kamm scheren. Es gibt unendlich viele individuelle Gründe dafür, etwas zu tun bzw. zu unterlassen. Was aber für alle gilt und von manchen Analysten manchmal vergessen wird: Demokratie ist für jeden, auch für Motivierte, ein mühsames Geschäft. Diese Staatsform ist die anstrengendste, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ihre Abstimmungsprozesse sind langsam und kompliziert, die Ergebnisse erscheinen oft unbefriedigend, der Aufwand ist immens, die zu lösenden Aufgaben werden immer komplexer, immer weniger durchschaubar.
Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser Schwierigkeiten überfordert, sie haben keine Lust oder trauen sich nicht zu, die Mühen der demokratischen Beteiligung auf sich zu nehmen. Erst recht, wenn sie ihre Interessen nicht vertreten sehen und glauben, sowieso nichts ändern zu können, sondern nur als Alibi zu dienen. Doch woher soll die Lust an der Demokratie auch kommen? Wie soll man Demokratie können? Sie nur zu wollen reicht definitiv nicht aus. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Demokraten von selbst heranwachsen, gleichsam aus der Luft fallen und ab ihrem 16. oder 18. Lebensjahr, wenn sie das erste Mal wahlberechtigt sind, automatisch das tun, was man bei guten Demokraten eben voraussetzt. Sie tun es nicht, jedenfalls nicht alle. Aber warum erwarten wir das überhaupt? Was wären die Voraussetzungen dafür?
Wir machen uns oft nicht klar, dass nur die wenigsten von uns, egal ob jugendlich oder erwachsen, Demokratie »gewöhnt« sind. Denn wo bewegen wir uns im Alltag? Nur äußerst selten in wirklich demokratischen Strukturen. Schule oder Unternehmen sind in der Regel autoritäre Einrichtungen. Zum einen ist das Ziel vorgegeben: gute Noten zu erreichen oder erfolgreiche Produkte zu schaffen. Zum anderen sind die Hierarchien klar: »oben« der Lehrer oder Chef, »unten« der Schüler oder Angestellte. Wir sind natürlich keine totalitäre Gesellschaft und die unteren Etagen müssen weder Gewalt noch Gefängnis befürchten, wenn sie sich gegen die Autoritäten wenden. Aber sie haben Nachteile zu erwarten, und ganz generell wird belohnt, wer sich anpasst und das System nicht infrage stellt. Es ist ein bisschen überspitzt formuliert, das weiß ich. Schließlich sehen wir fast überall Mitbestimmungsorgane, Interessenvertretungen, Kummerkästen, Mitarbeiterumfragen und alle möglichen anderen Einrichtungen, über die es möglich ist, sich zu äußern. Dennoch ist das Maß an Einflussnahme für die meisten, die sich nicht direkt in Parteien oder anderen Vereinigungen engagieren können, sehr begrenzt. Und die jeweilige Autorität sieht auch nicht vor, das zu ändern. Der Effekt ist klar: Wer von der monatlichen Überweisung abhängt oder vom guten Schnitt auf dem Abschlusszeugnis, überlegt sich zweimal, ob er Reformbedarf anmeldet. Abgesehen davon, dass Engagement auch eine Frage der mentalen Kräfte ist, die zur Verfügung stehen.
Fußnoten
[1]
Bundeszentrale für politische Bildung: Wahlergebnisse und Wählerschaft der AfD, Stand 2.12.2022, abgerufen am 20.7.2023, https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/afd/273131/wahlergebnisse-und-waehlerschaft-der-afd/#node-content-title-1
Erlernte Hilflosigkeit
Die Schule beginnt um 8 Uhr, 45 Minuten Mathematik, 45 Minuten Deutsch. Wer zwischendurch zur Toilette will, muss um Erlaubnis fragen. Hunger hat man in der großen Pause zu haben, dann sind nämlich 20 Minuten zum Essen vorgesehen. Das System Schule sagt jedem Schüler, was er wann machen soll oder darf, wann er essen soll, wann er das Klassenzimmer wechselt, welchen Stoff er bis zu welchem Zeitpunkt gelernt haben muss, wie er dessen Beherrschung nachweist und so weiter und so fort. An den guten Schulen läuft das in freundlicher Atmosphäre ab, es gibt außerdem Extra-Angebote wie Orchester, Sport- oder Theater-AG und Ähnliches. Das ist schön, ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Prinzip, dass sich die Schüler in einem vorgegebenen, relativ eng gesteckten Rahmen bewegen, dass sie weder das Ziel noch den Weg dorthin mitgestalten, geschweige denn selbst entwickelt haben.
In diesem Raum ist für existenzielle Fragen, die gerade Kinder und Jugendliche bewegen und sie in ihrer Entwicklung voranbringen, wenig oder gar kein Platz. »Wer bin ich?«, »Was will ich?«, »Wer sind die anderen?«, »In welcher Gesellschaft leben wir?«, »In welcher Gesellschaft wollen wir leben?« – das kommt meist nur am Rande vor oder in Fächern wie Philosophie und Religion. Dass der Transfer von den curricularen Inhalten zum Einzelnen gelingt, so dass er den Bezug zu seinem Leben findet, wäre wünschenswert, aber ich glaube, dass das nur selten gelingt. Die Haupterfahrung, die die Schüler an der Schule verinnerlichen, lautet: »Ich kann hier nichts bewirken. Ich kann das System, in dem ich mich acht Stunden am Tag aufhalte, nicht beeinflussen.« Den Lehrern geht es übrigens häufig ähnlich, auch sie leiden darunter, streng nach Vorgaben agieren zu müssen. Wer diese Erfahrung über Jahre macht, insbesondere in einer prägenden Phase seines Lebens, hinterfragt sie nicht mehr. Selbst wenn sich irgendwann eine Gelegenheit zur Veränderung bietet, ist es schwierig, die Motivation dafür zu entwickeln und seine Fähigkeiten zu mobilisieren. Das Verharren ist gewissermaßen eine natürliche Reaktion, ein Mechanismus der Anpassung und Frustvermeidung.
Ich nenne das »erlernte Hilflosigkeit«. Es ist ein Begriff, der in der Depressionsforschung verwendet wird. Ich übertrage ihn auf das Phänomen der menschlichen Teilhabe generell. Er beschreibt, was passiert, wenn ein Mensch lange keine Kontrolle über eine negative Situation hatte. Erhält er plötzlich doch die Kontrolle, hat er weder die Fähigkeiten noch die Motivation, etwas zu verändern. Es handelt sich um einen Schutzmechanismus vor wiederholtem Frust. Man gewöhnt sich die Passivität an. Wir haben zwar schon einmal aus dem unselbständigen Zustand eines Neugeborenen herausgefunden, unsere gewonnene Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit aber wieder verlernt, weil wir in Systemen leben, in denen unsere Aktivität nicht erwünscht ist oder sogar als hinderlich angesehen wird. Wir lernen kollektiv, wieder hilflos zu sein und die Steuerung unseres Lebens anderen zu überlassen. Der Wille, unsere Umgebung, die Räume, in denen wir uns bewegen, selbst zu gestalten, kommt uns abhanden. Besser gesagt: Er wird uns weitgehend abtrainiert.
Eins meiner Lieblingsbeispiele dafür, dass es bei Schülern trotz oder wegen der ungünstigen Umstände einen Drang gibt, Veränderung zu bewirken, sind die Schultoiletten. In den meisten Schulen sind sie in einem katastrophalen Zustand. Mit Sprüchen und Graffitis übersät, abgerissenen Türklinken, verstreutem Klopapier, beschädigten Wasserkästen – ein Bild der Verwahrlosung. Ja, stimmt. Optisch wirkt der Zustand wie das Ergebnis eines Zerstörungswunsches. Ich würde jedoch radikaler interpretieren: Die Toiletten bieten den Kindern die einzige Möglichkeit, ihren Willen zur Veränderung, zur Inbesitznahme des Raums zu äußern – in diesem Fall des einzigen Raums, in dem sie sich unbeobachtet fühlen. Es ist ähnlich wie bei einem Kleinkind, das noch keine Türme aus Klötzen bauen kann. Es schmeißt einfach Klötzchen herum. Das ist seine Möglichkeit, seine Umwelt zu verändern. Bei der Zerstörung von Toiletteninventar verhält es sich nicht anders. Ich komme später noch einmal in anderem Zusammenhang auf die Toiletten zurück. Hier geht es mir zunächst nur darum, zu zeigen, dass ein Verhalten, das nach Rücksichtslosigkeit und Vernichtungswillen aussieht, ein anderes, ein konstruktives Motiv hat: nämlich den Wunsch, den Verhältnissen einen Stempel aufzudrücken, sie zu formen und zu gestalten. Doch das können die Schüler nicht, weil sie im Grunde den Status von Besuchern haben. Sie erleben sich nicht als wirksam Handelnde. Sie betreten die Schule: Herzlich willkommen, das Programm geht gleich los. Beschlossen haben es andere. Ihr seid hier, um es zu konsumieren.
Handeln lernen, Handeln ermöglichen
Nicht konsumieren, was einem vorgesetzt wird, sondern aktiv werden und handeln – das sind wesentliche demokratische Kompetenzen. Und ausgerechnet diese Fähigkeiten üben wir in den Schulen wenig. Natürlich wird in den sozialwissenschaftlichen Fächern und in Geschichte das »demokratische System der Bundesrepublik Deutschland« durchgenommen. Vielleicht gibt es auch mal eine Abstimmung, welche Farbe das Klassenmaskottchen haben soll, oder sogar ein paar Planspiele. Aber das ist »nur« Unterrichtsstoff. Schule an sich funktioniert nicht demokratisch. Dabei ist es essenziell für Kinder und Jugendliche, zu lernen und selbst zu erfahren, dass sie nicht hilflos einem System ausgeliefert sind, sondern Gestalter sein können. Dass es Spaß macht, sich nicht in den für sie vorgesehenen Bahnen zu bewegen, sondern neue auszuprobieren oder sogar zu konstruieren. Begeisterung für Demokratie beginnt bei der eigenen, aktiven Rolle, die man übernimmt.
Es reicht aber nicht, Kindern und Jugendlichen einfach zu sagen: »Macht doch mal, engagiert euch!« Demokratie und Sichbeteiligen muss man praktizieren – und zwar am besten systematisch und ganz praktisch in einem Bereich, der einen selbst betrifft. Dafür braucht man Hilfe und ein gutes Instrument. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne mich am besten aus mit »aula«, einem Instrument, das sich vielfältig einsetzen lässt und mit dem Demokratie schon von jungen Menschen erlernt werden kann. aula steht für »ausdiskutieren und live abstimmen«. Dieses Beteiligungskonzept für weiterführende Schulen liegt mir am Herzen, ich habe es, natürlich mit Unterstützung vieler Menschen, vor rund zehn Jahren entwickelt. Es läuft mittlerweile an zahlreichen Schulen in Deutschland und an einigen im Ausland. aula stellt sozusagen die Schnittstelle zwischen Bildung und Demokratie dar und ist ein Instrument, mit dem sich demokratische Teilhabe in der Schule verwirklichen lässt – und zwar für alle.
Ein Blick auf aula ist deshalb interessant, weil das Konzept eine konkrete Antwort auf die sehr allgemeine Frage darstellt, wie Demokratie zu erlernen ist. Nicht utopisch, nicht in der Zukunft, nicht mit zusätzlichen Ressourcen – sondern heute, an existierenden, normalen Schulen. Und natürlich geht diese Frage unmittelbar jeden an. Praktisch jeder Mensch in Deutschland durchläuft die Schule. In der Schule lernt die gesamte Erwachsenengeneration von morgen. Wenn wir alle erreichen wollen – auch die Stillen, auch die Passiven, auch die Verängstigten –, dann dort. Zu einer Zeit, wenn sich ein eigenes Rollenbewusstsein gerade erst formt. An einem Ort, an dem Kinder gerade erst beginnen, sich ein Bild von der Gesellschaft zu machen.
Darüber hinaus lässt sich aula in allen Einrichtungen einsetzen, in denen Menschen zusammenleben oder arbeiten, zum Beispiel in Altersheimen, Gewerkschaften und Unternehmen. Denn überall dort geht es darum, das eigene Umfeld in Abstimmung mit anderen Beteiligten zu gestalten. Selbst wer sich persönlich bereits als wackerer Demokrat bewiesen hat, profitiert von der systematischen Betrachtung der Faktoren, die demokratisches Handeln und Entscheiden ausmachen. Es tut immer gut, die eigenen Voraussetzungen zu reflektieren und vielleicht sogar – wer weiß? – zu erweitern.
Entlang dem praktischen Einsatz des Beteiligungskonzepts von aula stelle ich in diesem Buch jene Kompetenzen vor, die alle Demokraten erwerben und leben sollten. Es gibt zahlreiche Konzepte, wie diese Fähigkeiten erworben werden können. Meines ist nur eines von vielen Projekten, die sich dafür einsetzen, Demokratie für junge Menschen lebendig zu machen.
Demokratie ist die beste Staatsform, die wir haben. Aber sie ist anspruchsvoll und anfällig. Wir sollten sie sehr gut pflegen, damit sie frisch und lebendig bleibt. Demokratie zu lernen ist für jede Generation eine Investition in die Zukunft – und eine Notwendigkeit für die Gegenwart.
Demokratie in die Schule bringen
Es ist mein zentrales Anliegen, aus Konsumenten Gestalter zu machen, also einen Rollenwandel herbeizuführen. Dafür setze ich bei den jungen Menschen an, deren Rollenbewusstsein noch im Entstehen begriffen ist. Ich möchte alle erreichen und vor allem diejenigen, die sich derzeit am wenigsten als Gestalter begreifen. Was liegt da näher als Schule? Meine Ausgangsfrage für die Entwicklung von aula war daher: Wie schaffen wir es auf der inhaltlichen und auf der praktischen Ebene, allen Schülerinnen und Schülern die Chance zur Beteiligung zu geben? Praktisch gesehen wäre es unmöglich, für jede anstehende Entscheidung sämtliche Schüler zu einer Versammlung einzuberufen, an deren Ende abgestimmt wird. Ein solches Verfahren würde jede Menge Zeit verschlingen, wäre organisatorisch aufwendig und relativ unübersichtlich. Auf der inhaltlichen Ebene wäre das Verfahren ebenfalls unbefriedigend. In einer Versammlung von mehreren hundert Teilnehmenden ist die Entwicklung eines Vorschlags, das Beleuchten seiner Vor- und Nachteile, das Austarieren verschiedener Interessen kaum möglich. Und von den vielen Anwesenden wären vor allem diejenigen aktiv, die sich sowieso immer einbringen und kein Problem damit haben, sich öffentlich zu äußern und Position zu beziehen. Die Schüchternen, die etwas langsamer Abwägenden, die weniger Sprachgewandten kämen kaum oder gar nicht zu Wort. Also eine Schieflage und alles andere als ein wirklich demokratisches Verfahren.
Ich bin ein Nerd und programmiere seit meinem zwölften Lebensjahr, insofern lag es nahe, dass meine Lösung für das Versammlungsproblem eine digitale ist. Wesentlicher Bestandteil von aula ist die Onlineplattform, mit der die schulische Versammlungshalle virtuell nachempfunden wird – mit einigen zusätzlichen Elementen, die in einer analogen Aula fehlen. Natürlich entwickelt man eine solche Plattform nicht allein. Die Gründung fand 2014 unter dem Dach von politik-digital e.V. statt, die Bundeszentrale für politische Bildung unterstützte uns, die Software erstellte zunächst Liquid Democracy, ein Verein, der digitale Konzepte für demokratische Beteiligung entwickelt und realisiert, sowie verschiedene Einzelpersonen. 2016/17 starteten wir mit vier Pilotschulen: mit der Jenaplan-Schule in Jena, der Pestalozzi-Schule in Freiburg, der Stadtteilschule am Hafen in Hamburg und dem Rupert-Neudeck-Gymnasium in Nottuln. Vier Schulen in vier Bundesländern, vier unterschiedliche Schulformen, vier unterschiedliche Ausgangssituationen. Auch wenn die Verläufe an jeder Schule anders waren und wir im Einzelnen nach der Pilotphase und Evaluation noch einiges verbessert haben, war das Ergebnis eindeutig: aula funktioniert und demokratische Teilhabe in der Schule ist möglich. Mittlerweile sind wir eine eigenständige gemeinnützige GmbH und um einige Jahre Erfahrung – auch im Ausland – und viele Erkenntnisse aus unterschiedlichen Schulen reicher, aber an den drei Grundelementen von aula hat sich nichts geändert: aula besteht aus der Onlineplattform, dem Vertrag und der didaktischen Begleitung. Ich möchte zunächst diese praktischen Voraussetzungen erläutern. Im folgenden Teil geht es um die demokratischen Eigenschaften, die Basis jedes demokratischen Handelns sind – in jedem Alter, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Familie und überall sonst, wo Menschen gemeinsam leben und komplexe Probleme lösen wollen.
Die Onlineplattform
Die aula-Plattform ermöglicht, dass die gesamte Schülerschaft etwas beschließen kann. Sie strukturiert und bildet die Prozesse ab, die von einer Idee zur Abstimmung führen, und bringt auch Schüler aus verschiedenen Klassen miteinander in die Diskussion. Jeder in der Schule besitzt Zugang zur Plattform, alle Schüler, alle Lehrer und alle Angestellten – allerdings haben nicht alle Zugang überallhin. Das Ganze ist gegliedert in »Räume«, und die Benutzer sind verschiedenen Räumen zugeordnet. Wir haben die großen Schulräume, in denen sich alle befinden, im Prinzip eine ständige Vollversammlung. In den Klassenräumen agieren vorwiegend die Klassenverbände. Es gibt aber auch eine Art Interessenräume, beispielsweise kann die Musik-AG einen eigenen Raum besitzen. Dazu kommt noch das Lehrerzimmer.
Als Schüler sehe ich also nur meinen Klassenraum und den Schulraum. Wenn ich zusätzlich in einer AG bin, dann kann ich dort auch aufgenommen werden. Aber ich sehe nur die Räume, in denen ich auch mitbestimmen kann. Lehrer übernehmen meistens Moderatorenrollen und haben Zutritt zu allen Räumen. Wir haben außerdem Juniormoderatoren, das sind Schüler, die in ihren Räumen moderieren. Die Schüler können in der Schule oder von zu Hause aus jederzeit Ideen einstellen. Ideen können sich auf alles beziehen, was in der Schule vor sich geht und was man verbessern will. Auf der Onlineplattform können diese Ideen dann diskutiert, erweitert und abgestimmt werden. Wie der Prozess im Einzelnen funktioniert, erläutere ich später noch.
Der Vertrag
Bevor die Onlineplattform startet, arbeitet jede Schule einen Vertrag aus, sozusagen die Verfassung. Das ist ein hochpolitischer Prozess. Das »verfassunggebende Organ« ist die Schulkonferenz, sie ist das mächtigste Gremium der Schule. Die Einrichtung dieser Institution ist in allen Bundesländern über das Schulgesetz vorgeschrieben. Die Namen variieren ein wenig, in Rheinland-Pfalz etwa heißt das Gremium Schulausschuss. Aber im Wesentlichen besteht es überall aus der Schulleitung, Vertretern der Schülerschaft und der Elternschaft. Dieses höchste Gremium überträgt also seine Macht oder zumindest einiges davon auf die gesamte Schülerschaft. Es verpflichtet sich im Vertrag, alle Ideen mitzutragen, die per aula beschlossen werden.
Wir stellen der Schulkonferenz Musterverträge zur Verfügung, in denen Vorschläge zu finden sind, was über aula geregelt wird und was nicht. Beispielsweise können die Schüler keine Personalentscheidungen treffen, sie dürfen kein Geld ausgeben, das nicht vorhanden ist, und können nichts beschließen, was gegen die Gesetze verstößt. Der Vertrag führt aber auch explizit auf, was die Schüler dürfen, zum Beispiel die Hausordnung ändern, Veranstaltungen planen, in Absprache mit dem Fachlehrer den Unterricht beeinflussen und anderes mehr. Dieser Vertrag ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz. Das heißt, juristisch ist er nicht einklagbar, er sorgt aber trotzdem für eine gewisse Verbindlichkeit. Weil es natürlich ein Riesenproblem wäre, wenn die Schulkonferenz oder einer ihrer Teile gegen diesen Vertrag verstößt, zu dem sie sich selbst verpflichtet hat.
Die didaktische Begleitung
Zu Onlineplattform und Vertrag gehören außerdem Lehrmaterialien. Sie helfen, den aula-Prozess didaktisch zu begleiten. Denn es genügt nicht, einfach nur zu sagen: Hier habt ihr eine Plattform für Beteiligung, alles Gute und viel Spaß damit. Ein sehr wichtiges Element ist zum Beispiel die aula-Stunde. Das ist eine Unterrichtseinheit, die regelmäßig stattfindet. Wir empfehlen, einmal in der Woche eine aula-Stunde durchzuführen. Viele Schulen haben dafür jedoch keine Kapazität. Sie setzen die aula-Stunde dann einmal im Monat an oder regelmäßig in den ersten 15 Minuten eines Fachunterrichts oder in der Klassenratsstunde. Es gibt viele verschiedene Modelle. Auf jeden Fall ist es essenziell, dass die neuen aula-Ideen auch im Klassenraum besprochen werden. Denn mit aula zielen wir ja besonders auf den Schüler, der in der letzten Reihe sitzt, die Arme vor der Brust verschränkt und keine Lust auf irgendwas hat, erst recht nicht auf Beteiligung. Dadurch, dass aula nicht nur auf der Online-Plattform, sondern auch im Klassenraum stattfindet, bekommt er immerhin passiv mit, dass sich etwas tut. Vielleicht lässt sich sein Interesse durch gar nichts wecken. Vielleicht passiert aber etwas, das ihn aktiviert. Ich habe zum Beispiel einmal erlebt, wie so ein Letzte-Reihe-Junge sehr lebhaft wurde, als er in einer aula-Stunde in der Klasse mitbekam, dass auf der Plattform der Abbau des Fußballtors auf dem Sportplatz kurz vor der Abstimmung stand. Er merkte, dass sich etwas anbahnte, was sich gegen seine Wünsche richtete. Offenbar war für ihn das Toreschießen in der Pause das Interessanteste am Schulalltag. Also argumentierte er sehr eloquent für die Beibehaltung des Tors – ein echter aula-Erfolg. Die Auseinandersetzung und das Aushandeln von Veränderungen finden also sowohl online als auch analog statt, um wirklich alle zu erreichen. Die Unterrichtsstunde ist der Ort, an dem sich die beiden Sphären treffen.
Zusätzlich gibt es e-Learning-Einheiten, die bei der Einführung von aula helfen, Unterrichtskonzepte und pädagogische Prinzipien wie das »radikale Ernstnehmen«.
Der Prozess
Ich skizziere hier zunächst, wie die Plattform funktioniert und genutzt wird. Welche Fähigkeiten aula fordert und fördert und wie die Komplexität der demokratischen Entscheidungsfindung bewältigt wird – was für das Erwachsenenleben und die Gesellschaft extrem wichtig ist –, erläutere ich tiefergehend in den späteren Kapiteln. Hier geht es zunächst einmal darum, die Grundzüge des Prinzips aula nachzuvollziehen.
Der Prozess beginnt mit der Wilde-Ideen-Phase, einer Art Brainstorming: Als Schüler oder Schülerin kann ich mit wenigen Sätze eine Idee beschreiben und online einstellen. Langwierige Begründungen sind nicht nötig. Wir wollen die Schwelle der Beteiligung bewusst sehr niedrig halten. Nun können die anderen zwei Dinge tun: Sie können die Idee liken und damit ausdrücken, dass sie prinzipiell irgendwie daran interessiert sind. Es wird nicht unterschieden zwischen Quatschideen und ernsthaften Ideen. Was besprechenswert ist, entscheiden die Schüler selbst. Und darin liegt eine enorme Provokation. Wenn genügend Schüler zu einer verrückten Idee sagen: Ja, das ist ein interessanter Vorschlag, und er dann ein bestimmtes Quorum überschreitet, kommt er in die nächste Phase. Das heißt, die Idee wird ernsthaft diskutiert.
Es kann aber auch sein, dass Schüler Verbesserungsvorschläge zu der Idee verfassen und diese einstellen. Rein technisch gesehen handelt es sich um Kommentare. Wichtig ist dabei: Es gibt Regeln für das Verbessern. Jeder Vorschlag beginnt mit dem gedachten Satz: »Ich stimme deiner Idee zu, aber nur, wenn …« Der Kommentar »Deine Idee ist doof« ist kein Verbesserungsvorschlag. aula ermuntert also durch die Technik und die Umgangsregeln zu konstruktivem Feedback, zu konstruktivem Austausch. Die Autoren der Idee sehen die Verbesserungsvorschläge, die ebenfalls wieder gelikt werden können. Das heißt, sie erkennen auch, welche Verbesserungsvorschläge auf Resonanz stoßen, und können sie in ihre Idee einarbeiten. Das ist eine großartige Sache, die Ursprungsidee lässt sich immer weiter verändern, je nachdem, welche Informationen und Anregungen eingebaut werden. Sie bekommt mehr Inhalt, sie wächst durch die Beiträge der anderen.