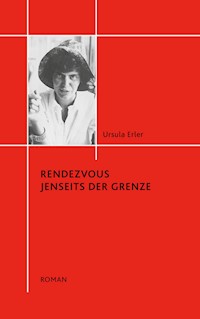Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erlers Roman ist ein weiblicher Entwicklungsroman als Antwort auf Rousseaus Erziehungsroman "Emile" und dessen bürgerlich pädagogische Maximen. Sie hatten Geltung für das 19. Jahrhundert und in Deutschland bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Roman stand am Anfang der Frauenbewegung in Folge der 68er Unruhen. Entsprechend offen zeigte er sich für die Suche nach neuen weiblichen Identitäten. Diese Offenheit in der Suche macht das Buch in vielfacher Hinsicht zu einer Provokation nicht nur angesichts hergebrachter Männerrollen und scheinbar fragloser gesellschaftlicher Strukturen, sondern auch innerhalb der sich herausbildenden neuen Frauenbewegung. Ein Roman, der auch 50 Jahre nach seinem ersten Erscheinen kaum etwas von seiner Aktualität eingebüßt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
ERSTER TEIL
Die Guillotine oder das Elternhaus zwischen den Klassen
Erste Begegnung mit meinem Geschlecht
Der großbourgeoise Hund
Ohne Paar
Integrationsversuche
Vorbereitung auf das Gymnasium
Kampf und Niederlage
Maria durch ein’ Dornwald ging
Der Schulausschluss
Die Klosterschwester
Der innere Monolog
Die Chansonette und die Flucht in die Großbourgeoisie
Die Pubertät
Zwei Passionen
Gaspard
Orientalisches Feudalsystem
ZWEITER TEIL
Die Suche nach dem Mann
Die Predigt
Der Anfang der Organisierung der Frau
Die Liebesnacht
Die Satzung
Nach der Sommerpause
Der Presseauftrag – Das Katzerl
Die Hexenverbrennung
Nachwort Helge Pross
Über die Autorinnen
ERSTER TEIL
Die Guillotine oder das Elternhaus zwischen den Klassen
Meine Familie mütterlicherseits hatte ihre Köpfe unter der Guillotine gelassen. Meine Familie väterlicherseits hatte die Guillotine bedient. Sie wurde jedoch nach dieser epochemachenden Aktion nach Deutschland verschlagen, ein Land, in dem die Revolution nicht gedeiht. Mithin degenerierte sie in der Abfolge der Generationen zu Nachtwächtern und Hundefängern, bis sich das proletarische Element, in Form meines Großvaters, wieder auf sich selbst besann und 1869 der durch Bebel und Liebknecht gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei beitrat. Es folgte der Aufstieg – in Gestalt der hochschulbeamteten Laufbahn meines Vaters –, im Hinblick auf welchen die Ehe mit meiner sich bestem Erbe der Großbourgeoisie – soweit es die Guillotine übrig gelassen – verdankenden Mama ein nicht unwichtiges Moment darstellte. Ein Parvenu jedoch war in der Familiengeschichte meiner Mama ein nicht dagewesener Fall. Die Einheirat bedingte einen kleinen Sprung in der bis dahin ohne Komplikationen verlaufenen Erbfolge von meiner Großmama – mit Aussparung meiner Mama – auf mich. Mein Erbe sollte mit dem Tag meiner Großjährigkeit an mich fallen. Es handelt sich bei ihm um ein nicht unbeträchtliches Aktienvermögen, eine kleinere Privatbank sowie ein reparaturbedürftiges barockes Lustschlösschen. Meine Mama allerdings wurde enterbt. Jedoch auch in Anbetracht dieser Tatsache stellte die Ehe, die mein Vater mit meiner Mama einging, eine glückliche Annäherung des bislang durch die unterschiedliche Relation zur Guillotine Entzweiten dar. Mein Vater flocht das lange Haar meiner entzückenden Mama vorm Zubettgehen in lose Zöpfe, um sie in Gestalt von Schnecken ihren aristokratisch kleinen Ohren aufzusetzen. Sie legte ein Batisthemd an und folgte ihm zu den Spielen, die sie sowohl die Guillotinespiele vergessen ließen, wie sie zur Zeugung meiner Person führten. Kurz vor dem – insofern er zu meiner Zeugung führte – für mich bedeutsamen Erguss seufzte meine Mama in Erinnerung an das französische Revolutionslied, das die Aristokratie an die Laterne wünscht, entschlossen ›ah! ça ira‹ und meinte die bevorstehenden langen Märsche durch die Institutionen, die sie mit meinem Vater zu gehen haben würde, wenn sie ihn in die hochschulbeamtete Laufbahn bekommen wollte.
Als der Frühling im Juni stand – ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem er in den Sommer übergeht –, kam ich zur Welt. Das Land war zerstört. Mein Weltbezug, der sich in reiner Spontaneität entfaltet hätte, wenn es sich bei meinem Geburtsland um eine Nation wie Frankreich gehandelt hätte, die es immerhin zur Erhebung des dritten Stands gebracht hatte, wurde abstrakt. Meine mir in die Wiege gelegte intakte Moralität registrierte das Phänomen, dass in meinem Land Millionen Juden durch die Kamine gegangen waren. Als meine Augen, Ohren, Hände, Füße, kurz, meine Person den vergeblichen Versuch gemacht hatte, diese Weise der Weltflucht mir kommensurabler zu machen, wandte ich mich von dem Land, das mich geboren hatte, ab. Den neugeborenen Till Eulenspiegel hatte man wissen lassen ›hier ist die gnädige Frau Sonne – sie kommt das flandrische Land zu grüßen‹. Die Sonne beschien in ihrer Unparteiischkeit nach wie vor auch mein Land, aber sie grüßte es nicht. Ich sog diesen Unterschied mit der mir reichlich gebotenen Muttermilch ein und wandte mich ausschließlich dem Umkreis dieser Brüste zu.
Sie vermittelten mir die Bekanntschaft meiner mit der Großbourgeoisie im Kampf liegenden Mama. Mit ›ah! ça ira‹ hatte sie meinen Vater in die hochschulbeamtete Position eines Musikprofessors eingebracht, die seinen Talenten entsprach, woselbst er im Klavierfach seine Meisterklassen zum Konzertexamen führte. Dabei war ein bemerkenswerter Umstand eingetreten. Meine sich bestem Erbe der Großbourgeoisie verdankende Mama war mit der werktätigen Klasse solidarisch geworden und kämpfte um ihre Rechte. Mein armer hochschulbeamteter Vater glaubte die Klasse, in der er angetreten war, hinter sich gelassen zu haben und strebte ins besitzende Bürgertum. Das Ergebnis dieser divergierenden Tendenzen war, dass sowohl Bourgeoisie wie Proletariat unser Haus verschlossen fand. Soviel als Hinweis auf mein lange Zeit klassenunspezifische Züge tragendes Außenseitertum.
Ich war ein mit der einfühlenden Zärtlichkeit der Sinnlichkeit begabtes Kind. So konnte mir manches nicht unverborgen bleiben, was sich gleichwohl verdeckt wähnte. Ich registrierte immer häufiger werdende Bestellungen von Ballen englischen Tuchs, das mein Vater sich im halbjährlichen Turnus zu Anzügen verarbeiten ließ, sowie einen stetig sich vermehrenden Hang zum Grübeln und ersah mit hellseherischem Spürsinn, dass der Gegenstand der Grübeleien meines Vaters das für mich in Aussicht stehende Erbe bildete. Ich folgte meinem Vater, wie er imaginäre Fässer rollte, verchromte Hähne betätigte und erriet, dass er damit beschäftigt war, sich mit meinem Erbgeld eine kolossale Bierbrauerei zu installieren. Diese Erkenntnis zwang mich, Schlüsse zu ziehen. Ich erinnerte mich des tragischen Unfalls meines 1869 der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei beigetretenen Großvaters, der kurz vor seinem Ende hinter einem gefüllten Maß dieses verhängnisvollen Gebräus gesehen wurde, woraufhin er sich an seinen Kohlenkarren zurückbegeben hatte. Statt aber auf den Sitz der Karre zu klettern, hatte er die Zugtiere umhalst und war unter ihnen zu Fall gekommen. Als ihn die Feuerwehr unter den Tieren hervorgezogen hatte, hatten ihn die Hufe der Pferde bereits zerstampft. Ich beobachtete meinen armen Vater, wie er zunehmend in seinen gewerblichen Spekulationen und Tagträumen versank und verständigte meine Mama über meinen Verdacht. Sie antwortete mir: »Das ist das proletarische Element.« Die Tatsache, dass er dozierender Hochschulbeamter war, bewog mich nicht, unsere Feststellung zu korrigieren. Im Hinblick auf meine Wertpapiere, die ohne meine Arbeit arbeiteten, war er ausgebeutet. Auf diese Weise wurde ich erstmalig mit dem grundlegenden Antagonismus der Geschichte vertraut: der in mir verkörperten besitzenden Klasse und der in meinem Vater verkörperten Klasse des Proletariats. Nichtsdestotrotz erwog ich es nicht, ihn so schnell mir das möglich wäre, an meinen Wertpapieren zu beteiligen, vielmehr, ich beschloss, den Tag meiner Erbübernahme hinauszuzögern, bis sich eine allgemeingültige Lösung dieser Generalaffäre der Geschichte einfände.
Nicht allein mein Vater, auch meine Mama umgab sich indessen mit imaginären Attributen. Sie attackierte nicht anwesende Gäste, die gesellschaftsfähig Hummern, Austern, Froschschenkel und Kaviar zu sich nahmen. Sie behauptete, dass auf meinem Grießbrei, zwischen zwei von ihr an die Tellerränder gedrängten Rosinenparteien, eine politische Auseinandersetzung im Gange sei. Die breiozeanische Auseinandersetzung sah sie wie folgt: Der kapitalistische Westen hatte attackiert. Die sozialistische Welt parierte. Mir fiel es einstweilen anheim, die Auseinandersetzung nicht zum Äußersten kommen zu lassen, was nur dadurch geschehen konnte, dass man ihr den Boden entzog, d. h. den Brei weglöffelte, ohne den kapitalistischen Angreifer indessen aus dem Auge zu lassen. Meine Mama verband im Unterschied zu meinem Vater, der rein seinen subjektiven Instinkten folgte, mit ihren imaginären Darbietungen stets eine pädagogische Absicht. So verhielt es sich auch im Fall meines imaginären Adoptivbruders. Auf einem hohen Kinderstuhl saß er mir, die ich mustergültig mein Essen zu mir nahm, angeblich gegenüber und wies jeden Löffel von sich. Er war destruktiv, zerschnitt Textilien, pisste auf Blumenbeete und aß Seife. Ich hingegen war ein ernstzunehmendes Kind. Jeder meiner Züge, selbst gelegentliche Anfälle von Sadismus, bezeugten meine glückliche Allseitigkeit. Man unterhielt sich mit mir über die Todesstrafe und den Bodenwucher, den ein bestimmter Papst geächtet hatte. Ich badete die seltenen Spielgefährten, die sich in unser Haus verirrten, verprügelte sie auch nach Neigung oder Notwendigkeit, studierte von der Fensterfront aus, die auf die Straße ging, die Körperhaltung von Frauen in anderen Umständen, stahl Silbersachen und ging auf Beerdigungen.
Die gelegentlichen Ausfälle meiner insichruhenden Person sehe ich in meinem ungeheuer eingeschränkten Wirkungsbereich begründet. Ich hielt mich beinah ausschließlich in dem – die einzelnen Räume auf einem Stockwerk unseres Hauses verbindenden – Flur auf. Hier hatte ich, in Anbetracht meiner Familiengeschichte, eine nicht mehr gebrauchte Nähmaschine zu einer Art Guillotine verkleidet, hatte sie auf einen Untersatz mit Rollen geschoben und fuhr mit diesem Gefährt an den offenen Zimmertüren vorbei durch den Flur. Mein Vater übte seinen Beruf mit Rücksicht auf die Nachkriegszeit teilweise in einigen Räumen unseres Hauses aus. Ich hatte mir, was die Schüler meines Vaters betraf, Listen angelegt, in denen ich ihre soziale Herkunft zu erfassen bemüht war. Erwies es sich, dass bedenkliche Fälle darunter waren, stellte ich die Guillotine ins Zentrum des Flurs. Es ging mir dabei weniger um praktische Resultate, als darum, eine Atmosphäre in unserem Flur entstehen zu lassen, die jedem, der ihn betrat, demonstrierte, dass seine Person und gesellschaftliche Herkunft von mir gekannt und rubriziert sei. Hinter der Guillotine stehend, das Auge auf den Schüler meines Vaters gerichtet, beobachtete ich ein gewisses Zögern desselben, der aufgehaltenen Tür des Dienstmädchens in einen der Räume zu folgen und sich vom Flur zu entfernen. Sodann bemächtigte ich mich des etwaigen Pelzwerkes, beroch es, durchsuchte die Taschen auf Wertsachen, nahm sie, soweit vorhanden, an mich und wartete auf den nächsten Fall. Es empörte meinen Sinn für wahre Sachverhalte, dass in regelmäßig vorherberechenbaren Abständen die jeweilig wechselnden Dienstmädchen des Besitzes des Diebsguts verdächtigt wurden. Aber es war mir durch tiefere Zusammenhänge unvergönnt, für sie einzutreten. Personen, die ich dazu ausersah, den Kopf für einen Augenblick unter die Guillotine zu halten, reichte ich anschließend einen schwarzen Seidenschal mit dem Rat, ihn um den Hals zu tragen, damit es nicht auffällig würde, dass der Kopf in Folge der Ansägung nicht mehr ganz fest säße. So ließ es sich nicht vermeiden, dass namentlich unter den weiblichen Fällen der Schüler meines Vaters eine gewisse Hysterie entstand.
Sah ich so mein Tagewerk erfüllt, legte ich mich nach dem Bad in den Schoß der Familie zum Schlaf. Es bestand für den knappen Übergang vom Tag- ins Nachtbewusstsein die Möglichkeit, mich zu küssen und liebkosend zu berühren. Ich lehnte es jedoch ab, mich vor dem Schlaf mit der Sammlung Grimm behelligen zu lassen. Desgleichen ordnete ich, nach einigem Nachdenken über die Art der Wiegenlieder, mit denen man mich zu Bett zu bringen für angemessen fand, an, das Gesinge einstweilen zu unterlassen. Ich ersah nicht, was im Hinblick auf die Nacht, die ich in erster Linie als einen Regenerationsprozess empfand, mit ›Eia Popeia, schlagt’s Gockele tot‹ zu beginnen war. Das ›Hört ihr Herrn und laßt euch sagen, unsere Glock’ hat acht geschlagen‹ ließ mich fragen, welches Kollektiv hier so insistent zu unverständlichen Pflichten ermahnt wurde, da sich im Schlafraum niemand als meine einzige weibliche junge Person befand. Das darauf folgende verhalten angestimmte ›Eia, Kindchen, ich wiege dich, wär ich so müd nicht, dann trüg ich dich‹ begriff ich als Hinweis auf die Sache des Proletariats, zumal, was meine Mama betraf, nichts darauf hindeutete, dass es autobiographisch gemeint sein könnte, da sie mir bei keiner Tätigkeit einfiel, die sie hätte müde machen können. Das russische, die Zeremonie weiterführende, schlicht als Wiegenlied bezeichnete ›Schlaf, Armer, zum letzten Mal, bald ist’s aus mit deiner Qual‹ hingegen zeitigte eine Wirkung, die mich keineswegs – wie ich annehmen musste, beabsichtigt war – dem Schlaf entgegen führte. Es handelt sich bei diesem die Lebensgeister ermunternden Gesang um einen jungen Menschen, auf den das Fallbeil wartet. Besänftigend schloss die Folge mit der christlichen Huldigung ›Schlaf, mein Kindchen, schlaf ein Schläfchen, bájuski-bajú, Silbermond und Wolkenschäfchen sehn von oben zu. Schlaf, mein Kindchen, sollst einst werden wohl ein großer Held, der ein Retter unsrer Erden und das Heil der Welt‹, die ich in Anbetracht der Tatsache, dass sich Christus an 57 Stellen des geheiligten Buches selbst als Menschensohn bezeichnet hatte, womit die Prophezeihung der Schlange ›Ihr werdet sein wie Gott‹ erfüllt war, als den Salut an meine junge Existenz entgegen nahm.
Erste Begegnung mit meinem Geschlecht
Ich blieb sechs Jahre das einzige Kind meiner Eltern. Ich verkehrte infolgedessen ausschließlich mit Erwachsenen und mit ihnen nur insoweit sie in unser Haus kamen. Ich ging ungern ins Freie. Ging ich doch, trug ich schwarze Knöpfstiefel, einen dünnen schwarzen Mantel sowie einen Muff. Ich besass helle Locken und war ein schönes Kind. Ich ging langsam, denn ich hatte keine Eile. Mein Geld arbeitete ohne mich. Ich durchsuchte die Stadt auf Altwarenhandlungen hin, zog aus dem Schrott das mir geeignet Erscheinende hervor und ließ es mir nach Hause schicken. Auf diese Weise füllte sich ein Raum unseres Hauses mit Ofenrohren, Porzellantassen, Puppengliedern, Säcken, in denen Mehl aufbewahrt worden war, zerstörten Instrumenten, Teilen von Partituren, verschlissenen Galanteriewaren, Knochen und Flaschen. Dann begab ich mich in den Park. Ich setzte mich auf eine Parkbank und suchte mit meinen Knöpfstiefeln die Erde zu berühren und dachte an den Tag, an dem ich wie Mama Brüste haben würde. Ich dachte an die Hingabe und dachte, dass ich mich nicht hingeben würde. Dieses Denken machte mich traurig. Ich begann, die abgefallenen Blätter mit meinen Schuhen zur Seite zu schieben und stand auf, um etwas auf und ab zu gehen. Ich stellte bei mir fest, dass Frauen angekleideter als Männer wirkten. Es würde mehr Zeit beanspruchen, sie auszuziehen. Ich sehnte mich danach, einige von ihnen auszuziehen, ging weiter auf und ab und wartete auf die Gelegenheit.
Inzwischen hatten zwei Damen, die ich unverzüglich der Gesellschaftsklasse zurechnete, in die ich später aufgrund meines Erbes eintreten würde, auf der von mir verlassenen Parkbank Platz genommen. Ich beobachtete sie scharf und ging auf sie zu. Ich fragte sie, um Konversation zu machen, obwohl die Angelegenheit für mich geklärt war, nach ihrer Familie. Sie unterbrachen ihr Gespräch und betrachteten mich. Ich sagte ihnen, dass sie keine Befürchtungen zu haben brauchten, ich käme ohne die Guillotine. Meine Rede musste ihnen befremdlich sein, da sie meine Familiengeschichte und die näheren Umstände meines Lebensraums nicht kannten. Sie schlossen unwillkürlich die Schenkel unter den Röcken und stellten die Schuhe eng nebeneinander. Ich setzte mich auf den Schoß der einen und sagte der anderen, dass ich sechs Jahre alt würde. Das schien sie beide in der Ansicht zu bestärken, dass es mit mir nichts Beunruhigendes auf sich haben könnte. Sie waren kinderlos. Sie schienen sogar der Gatten zu ermangeln. Es gefiel ihnen offensichtlich, mit einem so hübschen Kind, wie ich es war, zusammen auf einer Parkbank zu sitzen. Ich nahm ihnen die Hüte ab, und wir sahen alle drei zu, wie sie der Herbstwind an sich nahm.
Ich sagte ihnen, dass ich nur einen geringen Bezug zur Außenwelt hätte, dass meine Familie mütterlicherseits mit wenigen Ausnahmen, wovon ich eine darstellte, den Kopf unter der Guillotine verloren habe, dass ich mit dem Tag meiner Mündigkeit ein nicht unbeträchtliches Erbe antreten würde, dass ich für die Zeit meiner Jugend zwischen den Klassen und damit ohne die Möglichkeit eines Klassenbewusstseins würde leben müssen. Die Damen wurden sehr traurig und fragten nach meinem Vormund. Ich antwortete ihnen, dass ich keinen hätte, wohl aber einen Vater, der dem Proletariat angehöre. Dieses Wort rief sie zur Tat. Sie sprangen auf und beteuerten, dass sie mich mit sich nehmen würden. Ich ging zwischen ihnen und gab jeder von ihnen eine Hand. Wir hatten nicht lange zu gehen, da sie in einer bescheidenen Villa am Parkrand lebten. In dieser angekommen, gab ich an, Bauchschmerzen zu haben. Man legte mich auf ein großes Bett. Ich sagte, dass mein Bauch geliebkost werden müsse, was geschah. Ich sann der Empfindung nach, den diese Bewegung in mir auslöste, nahm ihre Hände, führte sie zwischen meine Beine und ließ sie meine Vagina berühren. Diese Berührung weckte mein Assoziationsvermögen, und ich bat sie, mir ihre Vaginas zu überlassen. Ihre Gesichter nahmen den Ausdruck von Gesichtern an, die einem steifen Wind ausgesetzt sind. Aber mir wurde die Wonne zuteil, sie zu entkleiden. Ich schlüpfte aus meinen Kleidern und verglich unsere Körper. Sie gerieten in eine übermütige Stimmung und wiesen mich auf meine fehlenden Brüste hin wie auf das fehlende hübsch gekrauste Haar, in das die untere Bauchhälfte bei ihnen überging. Ich erwiderte ihnen
– und suchte meiner Stimme einen perfiden Klang zu geben – , dass ich leider auch keinen Schwanz hätte. Das belustigte sie dermaßen, dass jeder Unwille, den sie zuvor über meinen Vater, der der Klasse des Proletariats angehörte, geäußert hatten, aus ihren Empfindungen gewichen zu sein schien. Denn sie ersuchten mich, mit meinem Vater zur gegebenen Stunde durch den Park zu gehen, so dass sie ihn im Vorübergehen unerkannt kennenlernen könnten. Ich erwiderte, dass sich das Rencontre kaum gestalten ließe, da mein Vater noch weniger als ich das Haus verließe, bat sie, sich wieder anzukleiden und ließ mir ein Bad zubereiten.
Als ich in Mantel, Muff und Knöpfstiefeln durch den Park zurückging, hatte es zu regnen begonnen. Die Blätter waren feucht. Ich suchte sie mit den Schuhen nicht zu berühren. Zu Hause nahm ich erneut ein Bad, jedoch in meiner eigenen Zinkwanne mit übermäßig heißem Wasser. Ich ließ sie mir im Flur aufstellen und bat um gefüllte Mohnkuchen. Diese aß ich langsam, bis an den Hals im Wasser versinkend.
An Büchern las ich zu diesem Zeitpunkt nichts als Grammatiken, setzte jedoch durch, dass ein zwei Dutzend Bände umfassendes Lexikon angekauft wurde, welches stets in meiner Reichweite zu bleiben hatte. Kurz darauf bat ich, mir zwei Tageszeitungen zu halten.
Der großbourgeoise Hund
Eines Tages machte meine der französischen Großbourgeoisie angehörende Großmama den Versuch, den Einlass in unser Haus zu erzwingen. Sie kaufte einen reizenden jungen Hund, nannte ihn Bobby und beauftragte ihren Gärtner und Chauffeur, den Hund nach Deutschland zu bringen und ihn mit einem Seidenband an unser Gartentor zu binden. Dieser Hund stand also in unserem Garten, um den Hals ein Medaillon, das anzeigte, dass er ein Geschenk meiner Großmama an mich sei. Ich nahm den Hund beim Halsband und trug ihn die Treppe hinauf, um Mama zu Rate zu ziehen, was mit ihm geschehen solle. Sie dachte nach und entschied: »Er kommt aus der Großbourgeoisie.« Ich sah sie an und fragte: »Die Guillotine?« Sie erwiderte: »Ich denke, ja, mein Engel.« Ich ging in die Küche und entnahm ihr einige Kochdeckel, schlug sie gegeneinander und begleitete mich mit ihrer Hilfe zu meinem deutlich skandierten, hoch angestimmten Revolutionsgesang ›Ah! ça ira, ça ira, ça ira‹. Der Hund sah mir vom äußeren Ende des Flurs, mit seinem an die Guillotine angebundenen Seidenhalsband, entgegen. Als der Tumult meines Gesangs, meiner trommelartigen Begleitung und seines Gebells ein katastrophales Ausmaß anzunehmen drohte, öffnete sich die Tür von meines Vaters Arbeitszimmer. Mein Vater und sein Schüler suchten die Situation zu erfassen. Die Angelegenheit schloss damit, dass sich der Schüler erbot, den Hund seiner in kleinbürgerlichen Verhältnissen lebenden Mutter zu bringen, die schon einige ihr zugeflogene Kanarienvögel versorgte. Er faßte das Tier am Kragen und zerrte es an seinem Seidenhalsband die Treppe herunter und verließ mit ihm unser Haus. Mein Vater sah ihm von der Fensterfront, die auf die Straße ging, nach und sagte: »Ein entzückender Hund.« Ich erwiderte traurig: »Ja.«
Ohne Paar
Es kam der Tag meiner Einschulung. Die Schüler bildeten im Schulhof lange Schlangen und bewegten sich in ihnen zu zwei und zwei auf das Schulgebäude zu. Es fügte sich, dass ich kein Paar bildete. Die Klasse faßte offensichtlich eine ungerade Schülerzahl. Ich ging abwechselnd hinter meinem einen und meinem anderen Vordermann her, um den Mangel auszugleichen. An einem nebligen Schulmorgen, als mein Leid über meine andauernde Paarlosigkeit seinen Höhepunkt erschritten hatte, überfiel ich den für meine Klasse zuständigen Kaplan, schleppte ihn in die Schülerschlange und stellte ihn neben mir auf. Da er ungehalten zu werden schien, beschloss ich, meine Weiblichkeit, soweit ich mich mit ihr vertraut gemacht hatte, ins Feld zu führen. Ich lächelte ihn an und bat, ihn sehr zart streicheln zu dürfen.
Er machte, von dieser Aussicht allem Anschein nach festgebannt, keine weiteren Ausbruchversuche aus der Schülerschlange. Ich führte meine Hand unter die Soutane, ließ sie eine kurze Weile in der sakralen Stoffülle untertauchen, um sie dann gezielt die kleine Schwellung in Angriff nehmen zu lassen, die unter dem Angriff eine neue zielstrebig gelängte und gehärtete Konstitution erlangte. Auf diese Weise beschäftigt, näherten wir uns in der Schülerschlange dem Schulgebäude, schritten über die Treppenstufen, vorbei an den zahlreichen Kruzifixen an den gekalkten Wänden. Der Rektor der Schule sah für einen Augenblick nachdenklich auf unser Paar, um die nachfolgenden Paare um so unnachgiebiger zur Ordnung zu rufen.
Ich legte derartigen Episoden stets wenig Gewicht bei. Sie zeugen lediglich von der tragischen Isolation meiner Familiensituation sowie meinen ersten Versuchen, ihr zu entrinnen. Die Tatsache, dass die unregelmäßige Schülerzahl die restlos aufgehende Paarbildung verunmöglichte, erzwang mein von mir selbst als nicht üblich eingeschätztes Vorgehen. Ich bin im weiteren Verlauf meines Lebens nie angestanden, mich – waren alle erprobten Mittel erschöpft – selbst des Außergewöhnlichen zu bedienen, um mir den Zugang zu der für mich lebensnotwendigen Kategorie der Sozialität zu verschaffen.