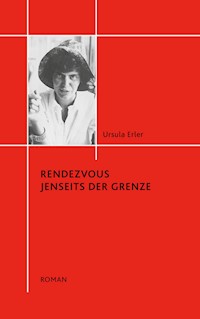6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt zuweilen Romane die so voller Atmosphäre stecken, dass sie in solcher Atmosphärik sich aufzulösen drohen. Manchmal hat man beim Lesen des Buchs von Ursula Erler diesen Eindruck. Denn man erlebt solchen intensiv atmosphärischen Prozess im Roman Vertrauensspiele. Die Handlung ist einfach und kompliziert zugleich: die tragische Geschichte zwischen einer verheirateten jungen Frau und einem um dreißig Jahre älteren Mann. Die Geschichte spielt zwischen zwei Ländern, zwischen Köln und dem französischen Charleville, Rimbauds Geburtsort. Man trifft sich und liebt sich, missversteht sich, und alles geht nicht gut aus. Der Mann nimmt sich das Leben und die Frau bleibt, das andere Leben memorierend, zurück. Sie erinnert nicht nur das Gemeinsame. Zum Gemeinsamen gehört sogleich und bis zuletzt das Missverstehen, das einander nicht erreichen. Dieses Nicht-Erreichbare wird von Ursula Erler in ihrem überaus lyrisch, sinnlich, empfindlich wahrgenommenen Monologspiel, diesem tragischen und unauffälligen Beziehungs- und Liebes- und Vertrauensspiel Anvertrauen genannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Für Tanya, für Elisabeth genannt Sabeth
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
I
Den Friedhof von Gentilly kenne ich nicht, ich habe ein schwarzes Kleid über die Haut gezogen, aber ich habe keine Einladung. Nur der Spiegel lächelt mich an, nur ich im Spiegel lächle mich an. Es gibt das, was nicht wiedergutzumachen ist: Anvertrauen. Ich habe mich dir anvertraut. Aber erst im November, was sage ich, im Februar. Seit du lächeln kannst – nein, lächeln kannst du schon im März. Der viele Schnee. Wollte nicht schmelzen. Die Stiefel habe ich nicht im Ernst an, auch nicht den Pullover, aber das Wetter ist immer noch unsicher. Du mußt dir denken, es ist ein Frühlingskleid. Manchmal ist das Jahr schon weiter im März. Du mußt ihm Zeit lassen – auch uns – wir waren nicht aufeinander gefaßt.
Außerdem war es ein Sommerfest. Die ernstzunehmenden Feste finden im Winter statt. Alles braucht eine Kulisse. Bei Sommerfesten weiß man nie, wie das ausgeht, was ist da wofür die Kulisse: der Sommer für das Fest oder das Fest für den Sommer. Ich weiß nicht, für wen ich gelächelt haben soll. Nicht einmal für den Sommer, glaube ich. Kein Wunsch. Gewünscht hast du. Nein, nur gefragt:
»Verheiratet?«
»Ja.«
»Kinder?«
»Ja.«
Doch, ich weiß, daß ich gelächelt habe. Aber erst jetzt, um es wegzulächeln, was ich dir angetan habe. Ich habe es dir nicht wirklich angetan. Du mußt nur glauben, was du siehst. Du siehst keinen Mann, du siehst keine Kinder, und jetzt stellen wir uns unter einen Baum.
Nein, von Ehebruch kann ich nicht einmal träumen, aber das muß dich nicht kümmern.
Doch, dreißig Jahre, das ist ein Unterschied, das könnte einer sein, aber ich fühle ihn noch nicht, du mußt mir Zeit lassen, wenn es einer ist.
Was siehst du mich so an? Ich kann das Kleid ausziehen, wenn du es dir wünschst. Nein, da muß ich nicht meinen Mann fragen, aber da müßte ich dich fragen, warum du es dir wünschst.
Nein, das mußt du mir nicht jetzt sagen, darüber kannst du nachdenken, und jetzt gehen wir zu den anderen zurück.
Nicht dieses Gesicht, ich bitte dich, was nützte es dir, du erwartest doch, daß ich dich liebe.
Ob das geht? Ich weiß es nicht, noch erinnerst du mich nur, aber ich kann mich nicht erinnern, an was, etwas fehlt.
Doch, wenn du es dir wünschst, dann doch, dann vielleicht doch. Nein, ich bin kein Traum, ich will nur nicht, daß Träume umsonst geträumt werden. Sie wären so leicht zu erfüllen, nein, ich weiß es nicht, nicht immer leicht zu erfüllen.
Ja, meine Kinder sind klein, aber ihre Wünsche wiegen genauso leicht oder genauso schwer wie die erwachsenen Wünsche.
Du hast keinen erwachsenen Wunsch? Du willst auch keinen mehr haben? Auch Wünsche brauchen Zeit, müssen wachsen lernen.
Selbstmord schreckt dich nicht? Ach, das ist nun wirklich dumm, was willst du, daß ich dir darauf antworte?
Nein, weibliche Unvernunft kenne ich nicht, ich glaube auch nicht, daß sie dich widerlegen könnte.
Vergessen? Du mußt mir sagen, was du vergessen willst, dann kann ich dich besser erinnern.
Dich küssen? Ja, aber nur, wenn du dazu lächeln kannst.
Du kannst es nicht? Du willst es auch nicht können? Laß mich nachdenken, so kann ich dich auch nicht küssen, wenn du nicht einmal lächeln kannst, wenigstens lächeln kannst.
Du kannst es. Aber nicht auf dem Sommerfest, auch nicht auf der kleinen Brücke – Oktober – du hast einen gefütterten Mantel an, aber im März, nach dem vielen Schnee.
Nein, es ist kein Frühlingskleid, du mußt es dir denken. Nur ein Pullover, Stiefel und darüber Schneewolken. Nur eine verheiratete Frau. Sie hat sieben Monate dazu gebraucht, um zu dir zu kommen. Zum Schluß hat sie den Himmel um Schneewolken gebeten und den Wind um Windstärke zehn und um einen Zigeuner, damit sie nicht mehr darauf warten muß, daß du wenigstens lächeln kannst. Und als er kam, mit dem Schneesturm, mit den abgerissenen Zweigen – und alles schneeverweht – ging es nicht ganz so leicht, Atem zu schöpfen gegen den Wind. Er hat nicht gelächelt, keine Spur, weit entfernt. Sie mußte dich nicht mehr fragen, ob du wenigstens lächeln kannst. Sie konnte zu dir kommen, wie es auch kommen würde.
Aber du lächelst, ganz deutlich. Sie ist nicht mehr sicher, ob es nötig war, sich so gegen dich zu wappnen.
Und als du lächelst, die erste Angst. März in Charleville. In der Rue de la République haben wir den Tee getrunken. In der Rue de la République hast du mich gefragt, ob ich mit dir schlafen werde. Und als ich hundertmal um die Place Ducale mit dir fahren will, sagst du, daß es in Charleville keine Kutschen gibt. Ich habe nichts von einer Kutsche gesagt. Warum nicht in deinem Wagen? Aber ich muß mich doch erst an dich gewöhnen, auch wenn ich mit dir schlafen will.
Vor dem kleinen Pavillon gegenüber dem Bahnhof habe ich dir gesagt, daß ich zurückfahre. Du gingst allein ins Hôtel du Nord. Es gab keinen Zug mehr, der zurückfuhr, aber es gab einen Zug nach Paris. Und am nächsten Morgen, so viele Gärten, Jardin des Tuileries, Jardin du Luxembourg, Jardin des Plantes. Ich habe dich angerufen, im Hôtel du Nord.
Und als du kamst, nein, Geschichten muß man von Anfang an erzählen, aber ich wollte keine Geschichte erzählen, ich wollte, daß du lächelst, wie du in Charleville gelächelt hast. Und so hast du noch oft gelächelt, bis ganz zum Schluß auf dem schnell verschneiten Feld, auch da flügelschlaglang, und ich habe dich allein gelassen. Und als ich zurückkam, steht das Auto nicht mehr da, und die Birken rechts und links um Rat gefragt, sie wissen mir nichts.
Was glaubst du denn, warum ich so viel weggelächelt habe – bei so unerwachsenen Wünschen?
Und als ich es einmal nicht zustande bringe, etwas wegzulächeln, wird nichts wieder gut.
Dreißig Jahre, das ist schon ein Unterschied, fast ein Dach, wo doch das Dach der Welt längst fortgeflogen ist, nur noch Löwenzahnsamen, sagt Nicole.
Ich weiß, woran du mich erinnerst, von Anfang an, auch wenn ich es lange nicht wußte, erinnert hast. Ich habe es dir gesagt. Nicht gesagt. Die Tapeten haben mich verraten, und die Wimperntusche hat mich nicht geschützt. Nein, ich habe mich verraten. Ich habe mich dir anvertraut.
Da bietest du mir eine Ehe an. Als ob unerwachsene Wünsche belohnt werden könnten. Und ich habe es nicht weggelächelt, einen Augenblick lang nicht.
Meine Ehe war ein erwachsener Wunsch. Sie hat mich einem Vaterhaus entführt, als die Hecke wuchs und wuchs. Und als er noch einmal durchs Haus ging, ob alle Türen geschlossen waren, stand eine weit auf, und das Zimmer leer, auch wenn ich nicht viel mitgenommen hatte.
Ich bin schuld, ich habe dich an einen Sieg glauben lassen. Nein, du. Hättest es weglächeln müssen, den Sieg verschenken müssen. Catherine sagt – ach, siehst du, jetzt wird alles Geschichte.
Nein, ich muß es dir doch sagen, Catherine sagt, du warst nur ein verhinderter Patriarch.
Laß, ich weiß es noch nicht, das schwarze Kleid trage ich wie zur Probe. Schon haben sich Zweifel in ihm eingenistet. Wie soll ich fahren, mit Zweifel im Kleid? In drei Tagen begraben sie dich. Du hast mich ausgeladen. Du schreibst: mit Rücksicht auf meine Frau. Ach, Liebster, hättest du doch lieber die Kahnpartie mit ihr gemacht. Catherine sagt, sie hat nicht geweint. Wie denn auch? Sie muß dich doch erst wiedererkennen – nach sechzehn Jahren. Ich hätte nicht einmal einen Namen für dich, wenn ich doch zu dir käme. Das ist nicht deine Schuld. Alle Namen, die du mir zugedacht hast, habe ich nicht angenommen. Nicht, weil du sie mir zugedacht hast, aber sie paßten nicht.
Ich war nicht dein Verhältnis, ich war nicht deine Geliebte, ich war nicht deine Frau. Alles auch, aber es ging nicht auf, auch Schwester nicht, auch Tochter nicht, wenngleich, alles auch, auch deshalb, weil du von allem enttäuscht zu sein vorgabst.
Du siehst, ich glaube es dir immer noch nicht. Ich kann es nicht, weil ich sie alle kenne, nicht alle, aber fast.
Was glaubst du denn, warum sich bei Catherine plötzlich die Näharbeiten so häuften? Deine erste Frau, deine zweite Frau, laß mich jetzt, später, es war unser erster Streit, Ehebruch.
Ich habe den Zug zurück genommen, weil du nicht zugeben wolltest, daß es dasselbe ist.
»Weiß dein Mann?«
»Natürlich weiß mein Mann, ich mußte ihm doch sagen, daß ich dich zu lieben versuche.«
»Hélène hat mir nichts gesagt.«
»Und wenn sie es dir gesagt hätte –?«
»Ich bitte dich – der jüngere Sohn war zwölf.«
»Du hast mich nicht gefragt, wie alt meine Töchter sind!«
Du siehst aus dem Fenster: »Das ist nicht dasselbe.«
»Warum nicht, weil du es bist, mit dem ich die Ehe breche?«
Du antwortest mir nicht. Du siehst zornig aus. Ich kann es nicht weglächeln, so lange du das Wort nicht zurücknimmst: Ehebruch. Und als ich zurückfahre, weiß ich nicht, ob ich nicht noch einmal sieben Monate brauche, um wiederzukommen. Ich brauche sie nicht. Du schreibst: »Balzac hat sich gelegentlich ›Wunderkind der Hoffnung‹ genannt.«
Aber du bist kein Wunderkind der Hoffnung – oder doch? Soll ich um Glocken bitten? Bei Onkel Eustache habe ich um einen fünf Kilometer langen Glockenzug gebeten. Aber Onkel Eustache war fromm. Wie für einen Kindersarg. Und klein. Auch das wie für einen Kindersarg.
Er hat mir gezeigt, wie man einen Pinsel in der Hand hält und eine Geige im Arm. Er hat mich dem ersten Patriarchen meines Lebens entwendet, nein, nicht entwendet, nur so ein bißchen gewinkt, auf die Speichertreppe, auf den Speicher: »Du mußt lernen, du mußt einen Pinsel halten, du mußt auf eigenen Füßen stehen. Wer nicht auf eigenen Füßen steht, kann auch nicht tanzen. Wenn es Abend wird, kommt es auf das Werk deiner Hände an.«
Onkel Eustache wohnt in unserem Haus, oben auf dem Speicher. Wenn wir abends die Speichertreppe hinunter gehen, ist der Tag vollbracht.
»Ich kann etwas, ich kann einen Pinsel halten, ich kann malen.« Mein Vater schüttelt den Kopf. Mein Vater sieht nach den Wolken: »Du kannst es ruhig abwarten, du brauchst nichts selbst zu können, die Welt hat ein Dach. Du mußt nur vertrauen lernen. Vertrauen ist alles, was du brauchst.« Und um den November, und um den Dezember, vom Ententeich diese Aufregung. Ich gehe an der Hand meines Vaters in den Park. Er hebt den Zeigefinger der anderen Hand. Er lächelt. Im Dezember kommt das himmlische Kind. Die Enten im Teich schnattern. Alle Türen werden verschlossen sein bis zur Ankunft des himmlischen Kinds. Ich muß leise gehen, auf Zehenspitzen, es ist für mich geboren, es wird für mich sterben, es hat alles erlöst. Die Enten im Teich schnattern leiser. Sie erinnern sich schon. Es hat auch die Enten erlöst. Ich gehe an der Hand meines Vaters aus dem Park.
Ach, Liebster, wie hätte ich wissen wollen, da schon wissen sollen, an was du mich erinnert hast? Du hast nicht gelächelt. Lange nicht. Doch, ich hätte es wissen müssen, und als ich es wußte, war es zu spät. Und der Spiegel dreht sich, dreht sich, ich drehe mich im Spiegel. Sehnsucht ist alles, was ich weiß. Auch Sehnsucht ist ein unerwachsener Wunsch. Hättest ihn weglächeln müssen. Februar – was weiß man im Februar, nichts Halbes, nichts Ganzes, kein Drittel, kein Viertel, nicht wahr?
Da mußte ich dir doch davonlaufen, wo doch das Dach der Welt längst fortgeflogen ist, nur Blätterschatten, immerhin Blätterschatten.
Jetzt lächelt mir lange nichts, wenn ich mir nicht selbst im Spiegel lächle. Du hast mich ausgeladen. Die Brüste unter dem Kleid sind nackt. Was soll ich ihnen sagen? Sie werden frieren. Ich werde frieren, bis auf die Hüften frieren, anders als auf dem schnell verschneiten Feld, und Birken rechts und links, die ganze Landstraße entlang, sie verraten mir nichts.
Ich habe ein Dach ausgeschlagen, zum zweiten Mal ein Dach. Eine kleine Zeit, wie Kindheit, also nicht sehr lang, hatte die Welt ein Dach. Vielleicht war es nur das schnellverschneite Feld und daß du lächeln konntest, auch da, augenblickslang, ich gebe zu, es war eine Verführung, noch da, augenblickslang, dann nicht mehr, du hast ja auch nicht mehr gelächelt, weit entfernt – nein, nicht auch den Pullover, du mußt ihn mir lassen, wo es doch so schneit, auch wenn ich nicht deine Frau werden kann. Das Land ist flach, was glaubst du denn, wer schneller ist, du oder ich. Ich bin schneller, ich laufe dir davon, in das flache, weit verschneite Land.
Und als ich zurückkomme, die Birken sind auf deiner Seite, sie schütteln mir nichts, kein Gold und Silber, geschweige einen Rat. Kein Spielgefährte, nur ein Mann, der einen Entschluß gefaßt hat. Wies mir einen Platz an seiner Seite zu, ich weiß es, Liebster, den höchsten, den er zu vergeben hatte, aber danach hatte ich dich nicht gefragt.
Laß mich. Nachdenken. Erzählen. Von Anfang an. Und Tintenfinger haben, meine Seele sagt, Tintenfinger sind nicht schlimm.
II
Ich stehe zwischen den Knien meines Vaters. Daß sie all ins Leben kamen – Gott der Herr rief sie mit Namen – daß sie all ins Leben kamen.
Man mußte es nur auswendig sagen und den Atem anhalten und die Augen geschlossen halten, dann war alles gut. Ich hatte einen Namen, ich konnte gehen. Auf Zehenspitzen, falls er sich anders besonne, er bleibt der Herr.
Onkel Eustache hört uns zu, winkt mich an seine Staffelei, gibt mir einen Pinsel in die Hand, zeigt auf das Wasser, zeigt auf die Farben: »Wasch die Hände, wasch die Pinsel, stell dich gegen das Licht, male. Sie macht immer die gleichen Fehler, die dumme Geschichte, die dumme deutsche Geschichte. Wenn du groß bist, wirst du einen dummen Hans heiraten, wieder ein Ritter mit geharnischter Brust, er wird dich erlösen, oder du wirst ihn Erlösen, so oder so, einstweilen male deinen Vogel, der Schnabel sitzt verkehrt.« Sieben Jahre habe ich gemalt. Mit Onkel Eustache. Nicht um die Wette, jeder für sich, jeder an seiner Staffelei.
Dann nicht mehr. Onkel Eustache war tot. Bekam ein jüdisches Begräbnis. Ich würde ein christliches bekommen, später, zuerst würde ich konfirmiert, gegen Ostern war Einsegnung.
Ich gehe im Trauerzug, ich werde dreizehn Jahre, gegen Ostern werde ich eingesegnet, auch wenn es hagelt und schneit. Der Pastor, der mich einsegnen wird, geht auch im Trauerzug. Er ist ein Freund der Familie. Ich muß stark im Glauben werden.
Ich bin stark im Glauben, nein, nicht wörtlich ich, aber Martin Luther, 95 Thesen an die Schloßkirche zu Wittenberg, die Konzilien sind nicht unfehlbar, die päpstliche Bulle verbrannt, trotz Acht und Bann nach Wittenberg zurück.
Onkel Eustache und ich malten Vögel. Hockende Vögel. Kein Vogel flog. Nur im Halbkreis hockende Vögel. Davor stand einer aufrecht, das war der Dirigent. Auf einigen Bildern dirigierte er mit dem Taktstock, auf anderen verteilte er Instrumente, auf wieder anderen ließ er Teppiche auslegen, eigentlich Läufer. Ein Bild zeigte ihn auf dem Läufer allein.
Der jüdische Friedhof liegt auf der rechten Flußseite. Ich habe Stiefel an und eine Mütze auf dem Kopf. Der Pastor, der mich einsegnen wird, geht schneller als ich. Ein‘ feste Burg ist unser Gott, ein‘ gute Wehr und Waffen. Das Kind braucht eine Zuversicht, das Kind braucht Gottvertrauen. Im Sarg tragen sie meinen kleinen jüdischen Onkel.
Ich kann nicht auf deinem Friedhof begraben werden, Onkel Eustache, ich muß in die Gnade, zwei Schritt hinter dem Pastor. Aber du willst es ja so einrichten, daß du mir im Himmel ein bißchen aufspielst, wenn ich komme, später, wenn ich christlich begraben bin.
Zwei Jahre davor. Onkel Eustache sitzt auf seinem Schemel. Onkel Eustache ist krank.
»Weißt du wie Rabbi Micha starb?«
»Nein, ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Sie werden dich auf dem jüdischen Friedhof begraben.«
Onkel Eustache lächelt: »Aber das will ich doch, das will ich doch.« Wir streiten. Er glaubt mir nicht, er glaubt mir nicht, was man glauben muß. Er glaubt mir nicht, was selbst die Enten glauben: Im Dezember kommt das himmlische Kind, es hat alles erlöst.
Er schüttelt den Kopf. Er kennt kein himmlisches Kind. Der Herr kommt, wann er kommt. Noch ist nichts erlöst. Wenn die Welt erlöst wäre, wäre sie gut. Sie ist nicht gut, also ist sie nicht erlöst. Aber wir können sie zu einem himmlischen Ding machen.
»Was ist ein himmlisches Ding?«
Er sieht auf seine Schuhspitzen, er winkt mich zu sich heran: »Kannst du tanzen, du mußt es lernen, und einen Fiedelbogen halten in der einen Hand und einen Pinsel in der anderen Hand und achtgeben auf die Mütze, sie darf dir nicht vom Kopf fallen, und viel Marzipan essen und nicht weinen, jedenfalls nie lange, und jetzt geh, ich will es so einrichten, daß ich dir im Himmel ein bißchen aufspiele, wenn du kommst.«
»Wann komme ich denn?«
»Später, wenn du christlich begraben bist.«
»Und wann wirst du begraben?«
»Bald. Der Friedhof liegt auf der rechten Flußseite. Kennst du den Weg?«
Ich kenne ihn nicht. Ich will ihn auch nicht kennen, ich laufe. Durch die Dreiköniginnenstraße bis zum Flußufer, Bismarcksäule, Ulmenallee, Kastanienallee, schon bin ich da. Der Pastor öffnet die Tür. Fräulein Mathilde steht hinter ihm. Fräulein Mathilde hat graues, in der Mitte gescheiteltes Haar. Die Diele ist kalt. Aber die Sonne steht schräg. Oktober. Der Pastor sieht mich an. Um sein Haus liegt der Garten, langes Gras, verwucherter Holunder, Fräulein Mathilde darf nichts in ihm tun.
»Herr Pastor – ich bitte, ich weiß nicht aus noch ein.«
Alle Zimmertüren von der Diele weg stehen offen. Die Fenster haben keine Gardinen. Der Garten sieht in die Zimmer. Der Herbst sieht in die Zimmer. Hier hilft mir nichts. Ich muß etwas aufsagen. Das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich sage es auf. Ich glaube – an Gott den Vater – den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde – und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn – unseren Herrn – der empfangen ist vom Heiligen Geiste, geboren von der Jungfrau Maria – gelitten unter Pontius Pilatus – gekreuzigt, gestorben, begraben – niedergefahren zur Hölle – am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten – aufgefahren gen Himmel – sitzet zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters – von dannen er wiederkommen wird – zu richten die Lebendigen und die Toten – Ich glaube an den Heiligen Geist – eine heilige, allgemeine christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen – Vergebung der Sünden – Auferstehung des Fleisches
– und ein ewiges Leben – Amen.
Der Pastor freut sich. Er hat mich getauft.