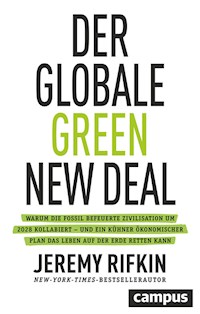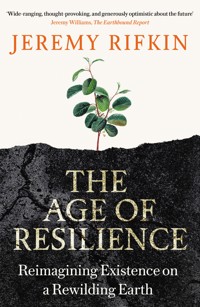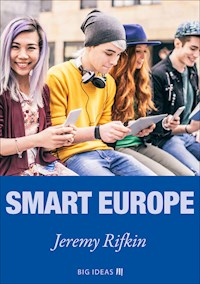Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Teilen ist das neue Besitzen Der Kapitalismus geht zu Ende? Eine gewagte These! Doch wer könnte eine solch spannende Zukunftsvision mit Leben füllen? Jeremy Rifkin - Regierungsberater, Zukunftsvisionär und Bestsellerautor. Kurz: "einer der 150 einflussreichsten Intellektuellen der Welt" (National Journal). Rifkin ist überzeugt: Das Ende des Kapitalismus kommt nicht von heute auf morgen, aber dennoch unaufhaltsam. Die Zeichen dafür sind längst unübersehbar: - Die Produktionskosten sinken. - Wir leben in einer Share Economy, in der immer mehr das Teilen, Tauschen und Teilnehmen im Fokus steht. - Das Zeitalter der intelligenten Gegenstände - das Internet der Dinge - ist gekommen. Es fördert die Produktivität in einem Maße, dass die Grenzkosten vieler Güter und Dienstleistungen nahezu null sind, was sie praktisch kostenlos macht. - Eine einst auf Knappheit gegründete Ökonomie macht immer mehr einer Ökonomie des Überflusses Platz. Ein neues Buch für eine neue Zeit Jeremy Rifkin fügt in seinem neuen Buch "Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus" die Koordinaten der neuen Zeit endlich zu einem erkennbaren Bild zusammen. Aus unserer industriell geprägten erwächst eine globale, gemeinschaftlich orientierte Gesellschaft. In ihr ist Teilen mehr wert als Besitzen, sind Bürger über nationale Grenzen hinweg politisch aktiv und steht das Streben nach Lebensqualität über dem nach Reichtum. Die Befreiung vom Diktat des Eigentums hat begonnen und mit ihr eine neue Zeit. - Wie wird dieser fundamentale Wandel unser Leben verändern? - Wie wird der Wandel unsere Zukunft bestimmen? - Was heißt das schon heute für unseren Alltag? Kein anderer könnte die Zeichen der Zeit besser für uns deuten als der Zukunftsvisionär Rifkin in seinem neuen Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 745
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeremy Rifkin
Die-Null-Grenzkosten-Gesellschaft
Das Internet der Dinge, Kollaboratives Gemeingut und der Rückzug des Kapitalismus
Aus dem Englischen von Bernhard Schmid
Campus Verlag Frankfurt /New York
Über das Buch
Der Kapitalismus geht seinem Ende entgegen. Das geschieht nicht von heute auf morgen und dennoch unaufhaltsam. Die Zeichen dafür sind längst unübersehbar: Sinkende Produktionskosten, Share Economy, Internet der Dinge. Jeremy Rifkin, Visionär und Bestsellerautor, fügt die Koordinaten der neuen Zeit endlich zu einem erkennbaren Bild zusammen. Aus unserer industriell geprägten erwächst eine globale, gemeinschaftlich orientierte Gesellschaft. In ihr ist Teilen mehr wert als Besitzen, sind Bürger über nationale Grenzen hinweg politisch aktiv und steht das Streben nach Lebensqualität über dem nach Reichtum. Wie dieser fundamentale Wandel unsere Zukunft bestimmen wird? Kein anderer könnte die Zeichen der Zeit besser für uns deuten als Rifkin.
Über den Autor
Jeremy Rifkin zählt zu den bekanntesten gesellschaftlichen Vordenkern unserer Zeit. In seinen Büchern, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, bringt er die großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Zukunftsthemen auf den Punkt. Seit Jahren ist der Experte als Berater für die Europäische Union und verschiedene Regierungen weltweit tätig. Er ist Dozent der renommierten Wharton School, in der er internationale Führungskräfte über Trends in Wissenschaft, Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft unterrichtet. Darüber hinaus ist Jeremy Rifkin Gründer und Vorsitzender der Foundation on Economic Trends in Washington, D.C.
Inhalt
Dank
1. Der große Paradigmenwechsel Vom Marktkapitalismus zu den kollaborativen Commons
TEIL 1 Die verschwiegene Geschichte des Kapitalismus
2. Die europäischen Einhegungen und die Geburt der Marktwirtschaft
3. Das Werben zwischen Kapitalismus und vertikaler Integration
4. Die menschliche Natur aus der Sicht des Kapitalismus
TEIL 2 Die Nahezu-null-Grenzkosten-Gesellschaft
5. Extreme Produktivität, das Internet der Dinge und kostenlose Energie
6. 3-D-Druck: Von der Massenproduktion zur Produktion durch die Massen
7. MOOCs und eine Nahezu-null-Grenzkosten-Bildung
8. Der letzte Arbeiter macht das Licht aus
9. Der Aufstieg des Prosumenten und der Ausbau der Intelligenten Ökonomie
TEIL 3 Der Aufstieg der kollaborativen Commons
10. Die Komödie der Commons
11. Die Kollaboratisten rüsten zur Schlacht
12. Das Ringen um Definition und Kontrolle der intelligenten Infrastruktur
TEIL 4 Sozialkapital und Sharing Economy
13. Der Umstieg von Eigentum auf Zugang
14. Das Crowdfunding von Sozialkapital, die Demokratisierung der Werbung, die Humanisierung des Unternehmertums und das Überdenken der Arbeit
TEIL 5 Die Überflusswirtschaft
15. Das nachhaltige Füllhorn
16. Ein Lifestyle für die Biosphäre
Nachwort: Eine ganz persönliche Bemerkung zum Schluss
Anmerkungen
Literatur
Personenregister
Sachregister
Dank
Ich bedanke mich bei Lisa Mankowsky und Shawn Moorhead für ihre außerordentliche Arbeit bei der Betreuung des vorliegenden Buchs. Ein Buch ist praktisch immer ein Gemeinschaftsprojekt. Ein Autor verdankt seine Effektivität zu einem Gutteil den Mitarbeitern am Manuskript. Mr. Moorhead und Ms. Mankowsky sind ein Dream-Team. Mr. Moorheads besondere Aufmerksamkeit galt der folgerichtigen Integration von Themen und konzeptuellen Details; Ms. Mankowsky sorgte für den glatten Erzählfluss und die Konsistenz der Darstellung. Beider Engagement für das Projekt, ihre klugen Vorschläge wie ihr scharfsichtiger redaktioneller Rat gaben dem Inhalt seine endgültige Form. Ihre Beiträge finden sich auf jeder Seite des fertigen Werks.
Außerdem geht ein Dankeschön an Christian Pollard, der mir nicht nur bei den redaktionellen Vorbereitungen zur Seite stand, sondern auch für die elegante Marketingkampagne und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich zeichnet.
Wir konnten während der zweijährigen Vorbereitungszeit für Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft auf die Hilfe einiger ausgesprochen talentierter Praktikanten zählen, deren Beiträge wesentlich zum Wert des fertigen Werks beigetragen haben. Ich bedanke mich in diesem Sinne bei Dan Michell, Alexandra Martin, Jared Madden, Elizabeth Ortega, James Partlow, Shuyang »Cherry« Yu, James Najarian, Daniel McGowan, Gannon McHenry, Kevin Gardner, Justin Green und Stan Kozlowski.
Außerdem bedanke ich mich bei meiner Lektorin Emily Carleton bei Palgrave Macmillan für ihre Begeisterung für das Projekt und die vielen scharfsichtigen redaktionellen Vorschläge während der Entstehung des Manuskripts. Ein Dankeschön außerdem an Cheflektorin Karen Wolny für ihren unermüdlichen Beistand während des ganzen Projekts.
Und schließlich bedanke ich mich wie immer bei meiner Frau Carol Grunewald für die vielen fruchtbaren Gespräche während der Vorbereitung zu diesem Buch, die mir bei der Ausformung meiner Gedanken ebenso halfen wie bei der Straffung der Argumentation im Text. Schlicht, aber ergreifend: Carol versteht sich nicht nur auf den Umgang mit Worten, sie ist auch die beste Lektorin der Welt.
Ich hatte großen Spaß an der Arbeit an diesem Buch; es ist buchstäblich aus Liebe zur Sache geschrieben. Ich hoffe, der Leser hat nicht weniger Freude bei der Lektüre als ich bei der Arbeit daran.
Kapitel 1Der große Paradigmenwechsel – Vom Marktkapitalismus zu den kollaborativen Commons
Ein neues Wirtschaftssystem – die Kollaborativen Commons – betritt die ökonomische Weltbühne. Sie sind das erste neue ökonomische Paradigma seit dem Aufkommen von Kapitalismus und Sozialismus im frühen 19. Jahrhundert, das tatsächlich Wurzeln zu fassen vermag. Und sie bringen einen grundlegenden Wandel in der Organisation unseres Wirtschaftslebens, der sowohl die Möglichkeit einer drastischen Verringerung der Einkommenskluft als auch einer Demokratisierung der Weltwirtschaft und die Chance zum Aufbau einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft in Aussicht stellt. Bereits heute werden wir Zeugen der Herausbildung eines Wirtschaftshybriden aus kapitalistischem Markt und kollaborativen Commons. In der Regel arbeiten die beiden Wirtschaftssysteme im Gespann; zuweilen stehen sie miteinander in Konkurrenz. Beide finden sie in ihren Randbereichen Synergien, die es ihnen ermöglichen, einander zu Mehrwert zu verhelfen und zugleich davon zu profitieren. Ansonsten sind sie erbitterte Gegner, die einander zu ersetzen versuchen – oder wenigstens zu absorbieren.
Beim Konkurrenzkampf zwischen den beiden ökonomischen Paradigmen wird keine Seite der anderen etwas schenken. Und er wird sich hinziehen. Aber selbst heute, in der Anfangsphase, wird bereits deutlich, dass das kapitalistische System, das uns – seit mehr als zehn Generationen – sowohl ein schlüssiges Narrativ der menschlichen Natur an sich als auch einen übergreifenden organisatorischen Rahmen für den geschäftlichen, sozialen und politischen Alltag unserer Gesellschaft liefert, seinen Höhepunkt überschritten hat und im langsamen Niedergang begriffen ist. Obwohl ich persönlich von der Vermutung ausgehe, dass der Kapitalismus auch auf lange Sicht Teil des gesellschaftlichen Entwurfs bleiben wird, bezweifle ich, dass er sich über den Beginn der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts hinaus noch als dominantes ökonomisches Paradigma hält. Die Indikatoren des groß angelegten Umstiegs auf ein neues Wirtschaftssystem mögen noch nicht robust genug und eher sporadisch sein, Collaborative Commons jedoch sind groß im Kommen und werden bis 2050 aller Wahrscheinlichkeit nach so gut wie überall auf der Welt wesentlicher Mittler wirtschaftlichen Miteinanders sein. In den Randbereichen der neuen Wirtschaft wird ein zunehmend entschlackter, perfektionierter Kapitalismus unbeirrt seinen Weg gehen und genügend Schwachstellen finden, die sich ausbeuten lassen, vor allem bei Organisation und Problemlösung im Netzwerkbereich. Er wird in der neuen ökonomischen Ära entsprechend als einflussreicher Nischenplayer florieren; herrschen wird er jedoch nicht mehr.
Ich kann verstehen, dass das den meisten meiner Zeitgenossen ganz und gar unglaublich erscheint, so sehr, wie wir auf die Überzeugung konditioniert sind, der Kapitalismus sei für unser Wohl so unerlässlich wie die Luft zum Atmen. Aber trotz jahrhundertelanger erheblicher Anstrengungen seitens Philosophie und Wirtschaftswissenschaft, ihre Leitsätze auf der Basis von Naturgesetzen zu formulieren: Ein ökonomisches Paradigma ist kein Naturphänomen, sondern lediglich ein vom Menschen erdachtes Konstrukt.
Was ökonomische Paradigmen anbelangt, war der Kapitalismus ausgesprochen erfolgreich. Bedenkt man, dass er relativ jung ist, kann man wohl getrost sagen, dass seine Auswirkungen auf die Entwicklung des Menschen, in negativer wie in positiver Hinsicht, dramatischer und weitreichender waren als die irgendeiner anderen ökonomischen Ära; nur der Wechsel von der Jäger-und-Sammler- hin zur Ackerbaukultur stellt hier eine Ausnahme dar.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Niedergang des Kapitalismus nicht unter dem Wirken feindlicher Kräfte beginnt. Mitnichten stehen Horden vor den Toren der kapitalistischen Festung, um sie zu schleifen. Ganz im Gegenteil. Was das kapitalistische System untergräbt, ist der spektakuläre Erfolg der grundsätzlichen Annahmen, die es bestimmen. Es ist der immanente Widerspruch in jener treibenden Kraft im Herzen des Kapitalismus, die ihn erst in schwindelnde Höhen hat aufsteigen lassen und ihn jetzt zu Tode hetzt.
Der Niedergang des Kapitalismus
Raison dʼêtre des Kapitalismus ist es, jeden Aspekt menschlichen Daseins in die ökonomische Arena einzubringen, wo er als zur Ware gemachtes Eigentum zum Tauschobjekt wird. Kaum ein Lebensbereich blieb von dieser Verwandlung verschont. Was wir essen, was wir trinken, unsere Gebrauchsgegenstände, die Beziehungen, die wir eingehen, die Ideen, die wir hervorbringen, die Zeit, die wir aufwenden, ja selbst die DNS, die unser Wesen in so hohem Maße bestimmt, alles ist im Kessel des Kapitalismus gelandet, wo es – neu geordnet – einen Preis bekommt, bevor man es auf den Markt wirft. Den größten Teil der Geschichte hindurch waren Märkte Treffpunkte, auf denen man gelegentlich zum Austausch von Gütern zusammenkam. Heute ist fast jeder Aspekt unseres Alltags auf irgendeine Art und Weise durch eine Wirtschaftsbeziehung miteinander verbunden. Wir sind durch den Markt definiert.
Aber genau hier liegt besagter Widerspruch. Schon die Grundprinzipien des Kapitalismus implizieren sein Scheitern durch den Erfolg. Lassen Sie mich das erklären.
In seinem Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen postuliert der Vater des modernen Kapitalismus Adam Smith, der Markt funktioniere praktisch auf dieselbe Art und Weise wie die von Isaac Newton entdeckten Gesetze der Schwerkraft. Wie in der Natur, wo jeder Kraft eine Gegenkraft von gleicher Größe entspricht, gleichen auf einem sich selbst überlassenen Markt Angebot und Nachfrage einander aus. Steigt auf Konsumentenseite die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, heben die Verkäufer ihre Preise entsprechend an. Wird die Ware zu teuer, sinkt die Nachfrage, was die Verkäufer zur Senkung der Preise zwingt.
Jean-Baptiste Say, Ökonom und Philosoph der französischen Aufklärung, ein weiterer früher Architekt der klassischen Nationalökonomie, fügte dem eine zweite Annahme hinzu, auch er mithilfe einer Metapher aus Sir Isaacs Physik. Seiner Ansicht nach entwickeln ökonomische Aktivitäten ein Eigenleben; sind ökonomische Kräfte erst einmal in Bewegung gesetzt, bleiben sie – ganz im Sinne von Newtons erstem Gesetz – in Bewegung, solange keine externe Kraft auf sie wirkt. Er vertrat die Ansicht, »daß jedes Product vom Augenblick seiner Erzeugung an für den ganze Betrag seines Werthes anderen Producten einen Absatzweg eröffnet …, daß die bloße Thatsache der Bildung eines Productes, sogleich wie sie erfolgt ist, für andere Producte einen Absatz herbeyführt.«1 Eine spätere Generation neoklassischer Ökonomen präzisierte das Say’sche Theorem durch die These, dass neue Technik zu erhöhter Produktivität führe, indem sie dem Hersteller erlaube, mehr Güter zu geringeren Stückkosten zu produzieren. Das erhöhte Angebot an billigen Gütern schaffe seine eigene Nachfrage und zwinge, als Nebeneffekt, die Wettbewerber zur Erfindung eigener Techniken, um ihre Güter noch billiger verkaufen und so die Kundschaft zurück- oder neue dazugewinnen zu können (oder beides). Niedrigere Preise infolge neuer Technik und gesteigerter Produktivität führten dazu, dass dem Verbraucher mehr Geld übrig bleibe, das sich anderweitig ausgeben lasse, was zu einer weiteren Wettbewerbsrunde zwischen den Herstellern führe.
Einen Vorbehalt freilich gibt es dabei: Diese Funktionsprinzipien setzen einen Wettbewerbsmarkt voraus. Wenn einer oder mehrere Hersteller ihrer Konkurrenz über den Kopf wachsen oder diese gar eliminieren und auf dem Markt – vor allem im Falle lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen – für ein Monopol oder Oligopol sorgen, können sie die Preise künstlich hochhalten in dem Wissen, dass der Käufer kaum Alternativen hat. In einer solchen Situation sieht der Monopolist sich weder genötigt, noch verspürt er die Neigung, sich um Produktivitätssteigerung und niedrigerer Preise willen nach arbeitssparender neuer Technik umzutun, da er sich keinem Wettbewerb ausgesetzt sieht. Wir haben das im Lauf der Geschichte immer wieder erlebt, und sei es auch jeweils nur für kurze Zeit.
Letztlich tauchten in jedem dieser Fälle unweigerlich neue Mitbewerber auf, die für technische Durchbrüche sorgten und diese wieder für einen Anstieg der Produktivität und ein Sinken der Preise für ähnliche oder alternative Güter und Dienstleistungen. Sie befreiten den Markt vom Würgegriff des Monopols.
Aber denken wir diese Leitsätze kapitalistischer Wirtschaftstheorie doch einmal durch bis zu ihrem logischen Schluss. Man stelle sich ein Szenario vor, bei dem der Erfolg der dem kapitalistischen System zugrunde liegenden Logik selbst die kühnsten Erwartungen übersteigt und der Wettbewerb zu »extremer Produktivität« führt und, wie der Ökonom sagen würde, »optimalem gesellschaftlichem Wohl«. Denken wir uns mit anderen Worten ein Endspiel, bei dem intensivster Wettbewerb zur Einführung immer schlankerer Technologien führt und damit die Produktivität auf einen optimalen Punkt zwingt, an dem jede zusätzlich zum Verkauf gebrachte Einheit Grenzkosten von »nahezu null« entgegengeht. Anders gesagt, die Produktionskosten jeder weiteren Ausbringungseinheit liegen – wenn wir die Fixkosten mal außen vor lassen – im Grunde bei null, was das Produkt nahezu kostenlos macht. Falls es dazu tatsächlich kommen sollte, blieben der Profit und damit der Lebenssaft des Kapitalismus aus.
In einer Marktwirtschaft wird Profit über Margen, d.h. Handelsspannen erzielt. Ich als Autor, um nur ein Beispiel zu nennen, verkaufe das Produkt meiner geistigen Arbeit an einen Verleger für einen Vorschuss und eine Beteiligung am Verkauf des Buchs. Dieses durchläuft auf dem Weg zum Endverbraucher mehrere Stationen, darunter Redakteur, Schriftsetzer, Drucker, Groß- und Einzelhändler. Jeder an diesem Prozess Beteiligte schlägt den Transaktionskosten eine Gewinnspanne in einer Höhe auf, die sein Beitrag zu rechtfertigen vermag.
Was wäre jedoch, fielen die Grenzkosten von Produktion und Vertrieb des Buchs auf nahezu null? Nun, genau genommen passiert das bereits. Eine wachsende Zahl von Autoren schreibt Bücher und verkauft sie unter Umgehung von Redakteuren, Schriftsetzern, Druckern, Groß- und Einzelhändlern für einen fast zu vernachlässigenden Preis im Internet, manche verschenken sie gar. Die Kosten für Marketing und Vertrieb pro Exemplar liegen bei nahezu null. Kosten entstehen letztlich nur durch die Zeit, die es braucht, das Produkt zu schaffen, sowie durch Rechnerzeit und die Zeit online. Die Grenzkosten für Produktion und Vertrieb eines E-Books liegen mit anderen Worten bei nahezu null.
Dieses Phänomen der Nahezu-null-Grenzkosten hat in den Verlags-, Kommunikations- und Entertainmentbranchen bereits enorme Schäden angerichtet, seit Milliarden von Menschen sich zunehmend zu nahezu Null-Grenzkosten mit Information versorgt sehen. So produziert heute mehr als ein Drittel der Menschheit seine eigenen Informationen auf relativ billigen Mobiltelefonen und Personal Computern und teilt sie über Video, Audio und Text zu Grenzkosten von nahezu null in einer kollaborativen, vernetzten Welt. Und mittlerweile beginnt sich die Null-Grenzkosten-Revolution auch auf andere Wirtschaftssektoren auszuwirken, etwa erneuerbare Energien, 3-D-Druck im Herstellungssektor und Online-Studium. Es gibt bereits Millionen von »Prosumenten« – Konsumenten, die ihre eigenen Produzenten geworden sind –, die bei nahe null Grenzkosten ihren eigenen grünen Strom produzieren. Man schätzt, dass weltweit bereits etwa 100000 Hobbyisten mit 3-D-Druckern zu Grenzkosten von nahezu null ihre eigenen Güter produzieren.2 Darüber hinaus machen mittlerweile sechs Millionen Studenten in kostenlosen, hart an der Nahezu-null-Grenzkosten-Marke operierenden Offenen Online-Massen-Seminaren (MOOC*1-Seminaren) ihre Seminar-Scheine bei einigen der renommiertesten Professoren der Welt. Trotz der Höhe der Vorlaufkosten bei diesen drei Beispielen bewegen sich diese Sektoren auf einer Kurve exponentiellen Wachstums nicht unähnlich der Exponentialkurve, die im Lauf der letzten Jahrzehnte die Grenzkosten des Computerwesens auf praktisch null gedrückt hat. Innerhalb der nächsten zwei, drei Jahrzehnte werden Prosumenten in riesigen kontinentalen und weltweiten Netzen nicht nur grüne Energie zu praktisch Null-Grenzkosten produzieren und teilen, sondern auch materielle Güter und Dienstleistungen sowie Bildung in virtuellen Klassenzimmern online – was uns wirtschaftlich ein Zeitalter praktisch kostenloser Güter und Dienstleistungen bringt.
Auch wenn die nahezu kostenlosen Güter und Dienstleistungen massiv in den Vordergrund treten, werden diese nach Ansicht vieler führender Player der Nahezu-null-Grenzkosten-Revolution eine Menge neuer Möglichkeiten zur Schaffung anderer Güter und Dienstleistungen bringen, die durch ausreichend große Profitmargen weiterhin für Wachstum sorgen und sogar dafür, dass das kapitalistische System auch weiterhin blüht. Chris Anderson, ehemals Redakteur des Magazins Wired, erinnert uns daran, dass verschenkte Produkte seit Langem schon dazu eingesetzt werden, potenzielle Kunden anzuziehen, die dann andere Güter kaufen. Als Beispiel dafür führt er Gillette an, den ersten Massenproduzenten von Einwegrasierern. Gillette hatte mit diesen verschenkten Rasierern die Verbraucher zum Kauf der Geräte für diese Klingen gebracht.3
Ähnlich erlauben heute auch Bühnenkünstler das kostenlose Sharing ihrer Musik online in der Hoffnung, sich eine treue Fangemeinde heranzuziehen, die in ihre Konzerte geht. Sowohl die New York Times als auch der britische Economist stellen online kostenlos Artikel zur Verfügung in der Hoffnung, dass ein gewisser Prozentsatz der Leser sich für detailliertere Informationen in Form eines Abonnements entscheidet.
»kostenlos« – oder »frei«, wie es heute heißt – ist als Marketingstrategie darauf ausgerichtet, eine Kundschaft heranzuziehen, die irgendwann auch bezahlt. Diese Bemühungen sind verständlich, aber kurzsichtig und womöglich sogar naiv. Je mehr Güter und Dienstleistungen, die das Wirtschaftsleben unserer Gesellschaft ausmachen, sich in Richtung Nahezu-null-Grenzkosten bewegen und fast kostenlos zu haben sind, desto mehr wird sich der kapitalistische Markt in schmale Nischen zurückziehen, in denen Unternehmen, die Profit abwerfen, nur am Rande der Wirtschaft überleben. Und sie verlassen sich auf einen schwindenden Kundenstamm für ausgesprochen spezialisierte Produkte und Dienstleistungen.
Die zögerliche Art und Weise, mit der wir uns dem Problem der Nahezu-null-Grenzkosten stellen, ist verständlich. Viele, wenn auch nicht alle aus der alten Wirtschaftsgarde können sich schlicht nicht vorstellen, wie wirtschaftliches Leben sich in einer Welt gestalten sollte, in der fast alle Güter und Dienstleistungen nahezu kostenlos sind, in der es keinen Profit mehr gibt, in der Eigentum bedeutungslos und der Markt überflüssig geworden ist. Was dann?
Der eine oder andere beginnt sich ebendiese Frage zu stellen. Er mag sich damit trösten, dass einige der großen Architekten des modernen ökonomischen Denkens das Problem schon vor langer Zeit ausgemacht haben, John Maynard Keynes zum Beispiel, Robert Heilbroner und Wassily Leontief. Sie haben sich Gedanken über den kritischen Widerspruch gemacht, der den Kapitalismus treibt. Sie haben sich überlegt, ob in ferner Zukunft neue Technologien die Produktivität derart anheben und die Preise damit derart senken könnten, dass es zu ebender Situation kommt, die uns jetzt ins Haus steht.
Oskar Lange, im frühen 20. Jahrhundert Professor an der University of Chicago, hat das Problem im Kern eines reifen Kapitalismus ausgemacht. Er verstand, dass die Suche nach technologischer Innovation zur Förderung der Produktivität und Senkung der Preise das System in Konflikt mit sich selbst bringen muss. 1936, mitten in den Wirren der Weltwirtschaftskrise, warf er die Frage auf, ob das Prinzip privater Produktionsmittel dazu angetan sei, den wirtschaftlichen Fortschritt auf ewig voranzutreiben, oder ob in einem bestimmten Stadium der technischen Entwicklung gerade der Erfolg des Systems zu einer Fessel würde, die seiner Weiterentwicklung hinderlich sei.4
Wenn ein Unternehmer, so schrieb Lange, zur Senkung der Preise für seine Waren und Dienstleistungen technische Innovationen einführt, verschafft er sich einen vorübergehenden Vorteil über Konkurrenten, die noch den Klotz veralteter Produktionsmethoden am Bein haben, was zu einer Entwertung der älteren Investitionen führt, an die sie gebunden sind. Die Konkurrenz sieht sich gezwungen, mit eigenen technologischen Innovationen zu reagieren, was zu einer neuen Runde von Produktivitätssteigerung und Preissenkung führt und so weiter. In reifen Industrien jedoch, in denen es eine Handvoll Unternehmen geschafft haben, einen Großteil des Marktes an sich zu reißen und ihm ein Monopol beziehungsweise ein Oligopol aufzuzwingen, hätten diese ein erhebliches Interesse daran, den wirtschaftlichen Fortschritt zu hemmen, um den Wert des Kapitals zu schützen, das noch in veraltete Technologie investiert ist. Lange bemerkt, dass in dem Augenblick, »in dem der Werterhalt investierten Kapitals zur Hauptsorge des Unternehmers wird, jeder weitere wirtschaftliche Fortschritt zum Stillstand kommen oder sich zumindest beträchtlich verlangsamen muss … Verschärft werden diese Folgen noch, wenn ein Teil der Industrien von Monopolen bestimmt ist.«5
Führende Unternehmen mit entsprechender Macht unterbinden nicht selten den Marktzugang neuer Unternehmen und die Einführung von Innovationen in ihrer Branche. Aber die Einführung neuer, produktiverer Technologien zum Schutz älterer Kapitalinvestitionen zu drosseln oder gar zu stoppen sorgt für einen Kopplungseffekt, da so die Investition von Kapital in profitable neue Geschäfte verhindert wird. Und wenn Kapital nicht in neue profitable Investments migrieren kann, bringt das die Wirtschaft längerfristig zum Stehen.
Völlig ungeschminkt schilderte Lange den Kampf zwischen Kapitalisten untereinander:
»Die Stabilität des kapitalistischen Systems wird zum einen durch wechselnde Versuche er schüttert, den wirtschaftlichen Fortschritt zum Schutz alter Investitionen zu hemmen, zum anderen durch gewaltige Zusammenbrüche im Falle eines Scheiterns solcher Versuche.«6
Versuche, den wirtschaftlichen Fortschritt zu hemmen, sind unweigerlich zum Scheitern verurteilt, da am Rande des Systems ständig neue Unternehmer lauern, die Augen offen für Innovationen, die die Produktivität erhöhen und die Kosten reduzieren, was es ihnen erlaubt, mit niedrigeren Preisen als denen der Konkurrenz auf Konsumentenfang zu gehen. Der von Lange umrissene Wettlauf ist auf lange Sicht unerbittlich, da der Zuwachs an Produktivität fortwährend auf Kosten und Preise drückt, was eine unaufhaltsame Schmälerung der Gewinnspannen zur Folge hat.
Auch wenn heutige Ökonomen einer Ära nahezu kostenloser Waren und Dienstleistungen mit einem eher unguten Gefühl entgegensehen, haben einige frühere Ökonomen angesichts dieser Aussicht durchaus, wenn auch verhaltene, Begeisterung zum Ausdruck gebracht. John Maynard Keynes, einer der großen Ökonomen des 20. Jahrhunderts, dessen wirtschaftswissenschaftliche Theorien nach wie vor beträchtliches Gewicht haben, schrieb 1930 einen kleinen Essay mit dem Titel »Ökonomische Möglichkeiten für unsere Enkel«, der zu einer Zeit erschien, in der Millionen von Amerikanern sich des Gefühls nicht erwehren konnten, mit dem plötzlichen wirtschaftlichen Abschwung von 1929 könnte ein langer Sturz ins Bodenlose begonnen haben.
Neue Technologien, so Keynes, beförderten die Produktivität und senkten so die Kosten für Güter und Dienstleistungen in einem nie gekannten Maß. Außerdem reduzierten sie dramatisch die Zahl menschlicher Arbeitskräfte, die zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen nötig seien. Keynes führte sogar einen neuen Begriff ein, den seine Leser, wie er schrieb, »in kommenden Jahren oft hören werden – nämlich technologische Arbeitslosigkeit. Das ist Arbeitslosigkeit, die dadurch entsteht, dass wir schneller Mittel und Wege zur Einsparung von Arbeitskräften entdecken als neue Einsatzbereiche für Arbeitskräfte.« Keynes beeilte sich, hinzuzufügen, dass diese technologische Arbeitslosigkeit, so beunruhigend sie auch auf kurze Sicht sein möge, auf lange Sicht ein großer Segen sei, weil sie nichts anderes bedeute, als »dass die Menschheit ihr ökonomisches Problem löst«.7
Keynes glaubte, dass »bald ein Punkt erreicht ist, viel früher vielleicht, als irgendeinem von uns bewusst ist, an dem diese Bedürfnisse in dem Sinne befriedigt sind, dass wir unsere Energien fürderhin lieber anderen als wirtschaftlichen Zielen widmen«.8 Er blickte erwartungsvoll einer Zukunft entgegen, in der Maschinen einen Überfluss an nahezu kostenlosen Gütern und Dienstleistungen produzieren, sodass der Mensch, von Plackerei und Härten befreit, sein Geist von der Konzentration auf rein pekuniäre Interessen erlöst, sich mehr auf die »Künste des Lebens« und die Suche nach Transzendenz konzentrieren kann.
Sowohl Lange als auch Keynes haben bereits in den 1930ern die Schizophrenie im Kern des kapitalistischen Systems erkannt: die wettbewerbsorientierten Märkten inhärente unternehmerische Dynamik, die die Produktivität nach oben und die Grenzkosten nach unten treibt. Ökonomen verstehen seit Langem, dass die effizienteste Wirtschaft die ist, in der die Verbraucher nur für die Grenzkosten der Waren bezahlen, die sie erstehen. Aber wenn Verbraucher nur für die Grenzkosten bezahlen und diese in rasendem Tempo gegen null gehen, könnten die Unternehmen weder die Renditen für ihre Investitionen garantieren noch ausreichende Profite, um ihre Aktionäre zufriedenzustellen. Das würde dazu führen, dass Marktführer den Markt zu dominieren versuchen, um sich ein Monopol zu sichern, das es ihnen ermöglicht, dem Markt höhere Preise abzutrotzen als lediglich die Grenzkosten der Produkte, die sie verkaufen. Einzig das würde verhindern, dass die unsichtbare Hand den Markt in Richtung der effizientesten Wirtschaft treibt, einer Wirtschaft mit nahezu null Grenzkosten und der Aussicht auf nahezu kostenlose Güter und Dienstleistungen. Und genau das ist der unlösbare Widerspruch im Herzen aller kapitalistischen Theorie und Praxis.
Achtzig Jahre nach den Beobachtungen von Lange und Keynes beschäftigen sich zeitgenössische Ökonomen einmal mehr mit diesem Widerspruch in der Funktionsweise des kapitalistischen Systems, und keiner von ihnen weiß, wie die Marktwirtschaft funktionieren soll, ohne im Gefolge neuer Technologien, die uns in eine Nahezu-null-Grenzkosten-Ära treiben, zu implodieren.
Lawrence Summers, ehemals Präsident der Harvard University und Finanzminister unter Bill Clinton, und J. Bradford DeLong, Professor für Volkswirtschaft an der University of California in Berkeley, widmeten sich im August 2001 dem kapitalistischen Dilemma in einem gemeinsamen Referat vor einem Symposium der amerikanischen Notenbank in Kansas City mit dem Thema »Wirtschaftspolitik für die Informationsökonomie«. Diesmal stand weit mehr auf dem Spiel, da die neuen Informationstechnologien und die einsetzende Revolution bei der Internetkommunikation drohten, das kapitalistische System in einigen Jahrzehnten in eine Nahezu-null-Grenzkosten-Realität zu treiben.
Summers’ und DeLongs Sorgen konzentrierten sich auf die eben aufkommenden Technologien im Bereich der EDV und der Kommunikation. Diese »kataklystischen Innovationen«, so schrieben sie, erzwängen ein grundlegendes Umdenken im Wirtschaftsleben mit potenziellen Auswirkungen, deren Tragweite denen der Einführung der Elektrizität gleichzustellen seien. Summers’ und DeLongs Ansicht, dass die technologischen Veränderungen, die da in Gang gesetzt waren, die Grenzkosten dramatisch senken dürften, wurde zum Ausgangspunkt ihrer Diskussion. »Die fundamentalste Bedingung für wirtschaftliche Effizienz« besteht ihrer Ansicht nach darin, »dass der Preis gleich den Grenzkosten« sei.9 Darüber hinaus seien, so räumten sie ein, »die sozialen und die Grenzkosten bei Waren im Kommunikationsbereich nahezu null«.10 Und jetzt kommt das Paradox:
»Wenn Informationsgüter zu ihren Grenzkosten – die bei null liegen – vertrieben werden sollen, können sie nicht von Unternehmen geschaffen und produziert werden, die ihre [fixen Rüst-]Kosten über Einkünfte aus dem Verkauf an Konsumenten decken. Wenn Informationsgüter [von Unternehmen] geschaffen und produziert werden sollen, müssen [diese] damit rechnen können, ihre Produkte mit Profit zu verkaufen.« 11
Summers und DeLong sprachen sich gegen staatliche Subventionen zur Deckung der Vorlaufkosten aus, da die Unzulänglichkeiten von »administrativer Bürokratie«, »Gruppendenken« und »Amtsschimmel … die unternehmerische Energie des Marktes zerstören«.12
Statt staatlicher Intervention legten die beiden renommierten Ökonomen widerwillig nahe, die beste Methode, die innovativen Kräfte einer Wirtschaft zu schützen, die »Güter unter der Bedingung erheblich zunehmender Skalenerträge produziert«, bestehe darin, kurzfristig natürlichen Monopolen den Vorzug zu geben.13 »Vorübergehende Monopolmacht und Profite«, so argumentieren Summers und DeLong, »sind die Belohnungen, die es braucht, um das private Unternehmertum zu solchen Innovationen anzuspornen.«14 Beide erkennen sie die Zwickmühle, in die sie das private Unternehmertum mit dem Eingeständnis bringen, dass »das natürliche Monopol nicht der fundamentalsten Bedingung wirtschaftlicher Effizienz – Preis gleich Grenzkosten – entspricht.«15 Es gehört nun einmal, wie jeder Ökonom weiß, zum Modus operandi des Monopols, potenziellen Konkurrenten die Einführung jeder Innovation zu verleiden, die die Produktivität steigert, die Grenzkosten reduziert und den Preis für die Kundschaft senkt. Nichtsdestoweniger kommen Summers und DeLong zu dem Schluss, dies sei in der »New Economy« womöglich der einzige Schritt nach vorn. Die beiden räumten erstaunlicherweise ein, »die richtige Betrachtungsweise dieses komplexen Problembereichs ist unklar, klar ist jedoch, dass das Wettbewerbsparadigma nicht ganz und gar angemessen sein kann … nur wissen wir noch nicht, wie das richtige Ersatzparadigma auszusehen hat.«16
Summers und DeLong sahen sich hoffnungslos in der Falle. Obwohl es weder Ökonomen noch Unternehmer auf die Selbstzerstörung des kapitalistischen Systems abgesehen haben (man hat erwartet, es würde ewig regieren), zeigt ein sorgfältiger Blick auf die Logik seiner Funktionsweise die Unvermeidlichkeit einer Nahezu-null-Grenzkosten-Zukunft. Eine Nahezu-null-Grenzkosten-Gesellschaft ist der Zustand optimaler Effizienz, was die Beförderung des Allgemeinwohls angeht, und damit der Triumph des Kapitalismus schlechthin. Sein Augenblick des Triumphs freilich markiert auch sein unausweichliches Verschwinden von der Weltbühne. Auch wenn der Kapitalismus noch weit davon entfernt ist, sich selbst abzuschaffen, so ist doch eines deutlich abzusehen: Je näher er uns einer Nahezu-null-Grenzkosten-Gesellschaft bringt, desto geringer wird seine einst unangefochtene Leistungsfähigkeit und weicht in einer Zeit, die sich eher durch Überfluss auszeichnet als durch Knappheit, einer ganz und gar neuartigen Organisationsform des Wirtschaftslebens.
Die Ablösung des ökonomischen Paradigmas
Die interessanteste Passage in Summers’ und DeLongs Referat über die Widersprüche und Herausforderungen kapitalistischer Theorie und Praxis im sich entfaltenden Informationszeitalter ist die Bemerkung, sie wüssten noch nicht, wie das richtige Ersatzparadigma auszusehen habe. Allein die Tatsache, dass sie auf die Wahrscheinlichkeit eines neuen Paradigmas als Ersatz für das alte anspielen, deutet auf die sich abzeichnenden Anomalien und den finsteren Schatten, den sie auf die langfristige Lebensfähigkeit der derzeitigen Wirtschaftsordnung werfen.
Wir befinden uns allem Anschein nach in der Anfangsphase einer alles verändernden Ablösung des ökonomischen Paradigmas. In der Abenddämmerung der kapitalistischen Ära zeichnet sich ein neues Wirtschaftsmodell ab, das sich besser zur Organisation einer Gesellschaft eignet, in der mehr und mehr Güter und Dienstleistungen nahezu kostenlos sind.
Der Begriff des Paradigmenwechsels wurde in den vergangenen Jahren derart strapaziert, dass er schier synonym zu »Veränderung« schlechthin geworden ist; es dürfte hier also durchaus hilfreich sein, noch einmal bei Thomas Kuhn nachzulesen, dessen Buch Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen für die Übernahme des Begriffs Paradigma in den allgemeinen Diskurs verantwortlich ist. Kuhn definierte ein Paradigma als System von Überzeugungen und Annahmen, die zusammenwirkend eine integrierte und geschlossene Weltsicht ergeben, die so überzeugend und unwiderstehlich ist, dass wir sie als die Realität selbst ansehen. Er benutzte den Begriff für herkömmliche und nahezu universell akzeptierte Wissenschaftsmodelle wie etwa die Newtonʼsche Physik und Darwins Evolutionstheorie.17
Die Kraft des Paradigmas als Narrativ beruht in seiner allumfassenden Beschreibung der Realität. Einmal akzeptiert, wird es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, seine zentralen Annahmen infrage zu stellen, schließlich scheinen sie die natürliche Ordnung der Dinge zu reflektieren. Alternative Erklärungen der Welt werden selten auch nur in Betracht gezogen, da sie in krassem Widerspruch zu dem stehen, was man als unzweideutige Wahrheit akzeptiert. Aber dieses kritiklose Akzeptieren und die Weigerung, sich alternative Erklärungen auch nur vorzustellen, führt zu schwärenden Widersprüchen, die sich anhäufen bis zu einem Punkt, an dem das existierende Paradigma zerschlagen und durch ein neues Erklärungsparadigma ersetzt wird, das die Anomalien, Einsichten und neuen Entwicklungen effektiver in einem umfassenden neuen Narrativ zu arrangieren vermag.
Das kapitalistische Paradigma, lange Zeit als der beste Mechanismus zur Förderung einer effizienten Organisation ökonomischen Handelns akzeptiert, wird jetzt von zwei Seiten angegriffen.
An der ersten Front steht eine neue Generation interdisziplinärer Wissenschaftler, die ganz unterschiedliche, vormals voneinander unabhängige Disziplinen miteinander verbunden haben: Chemie, Biologie, Ökowissenschaften, Ingenieurswesen, Architektur, Stadtplanung und Informationstechnologie. Diese Wissenschaftler stellen die herkömmliche – mit Metaphern aus Newtons Physik verbundene – Wirtschaftstheorie mit einer neuen theoretischen Ökonomie infrage, die auf die Gesetze der Thermodynamik gegründet ist. Über die unauflösliche Beziehung zwischen ökonomischer Aktivität und den durch die Energiegesetze diktierten ökologischen Zwängen schweigt sich die klassische kapitalistische Theorie im Grunde genommen aus. Der klassischen wie der neoklassischen Wirtschaftstheorie stehen die Kräfte, die die Biosphäre der Erde regieren, außerhalb der Sphäre wirtschaftlichen Handelns – kleine korrigierbare Faktoren von geringer Bedeutung für die Funktionsweise des kapitalistischen Systems an sich. Konventionelle Ökonomen übersehen ganz einfach, dass die Gesetze der Thermodynamik jede wirtschaftliche Aktivität regieren. Die ersten beiden Gesetze der Thermodynamik besagen, dass »der gesamte Energiegehalt des Universums konstant ist und die gesamte Entropie fortwährend zunimmt«.18 Dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik oder Energieerhaltungssatz zufolge kann Energie weder geschaffen noch vernichtet werden – anders gesagt, die Energiemenge im Universum bleibt vom Anbeginn bis zum Ende aller Zeit gleich. Während die Menge an Energie konstant bleibt, ändert sich fortwährend ihre Erscheinungsform, allerdings immer nur in eine Richtung, von verfügbar zu nicht verfügbar. Und hier kommt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik ins Spiel. Laut diesem ändert Energie sich stets von warm nach kalt, von einer konzentrierten Form in eine verstreute, von einer geordneten in eine ungeordnete Form. Verbrennen wir zum Beispiel ein Stück Kohle, bleibt die Gesamtmenge der Energie konstant, sie wird jedoch in Form von Kohlendioxid, Schwefeldioxid und anderen Gasen über die Atmosphäre verteilt. Auch wenn Energie nie verloren gehen kann, diese verstreute Energie ist nicht mehr in der Lage, sinnvolle Arbeit zu verrichten. Physiker bezeichnen diesen Verlust an nutzbarer Energie als Entropie.
Jedwede ökonomische Aktivität basiert darauf, sich in der Natur – in Form von Feststoffen, Flüssigkeiten oder Gasen – verfügbare Energie nutzbar zu machen und sie in Produkte und Dienstleistungen zu verwandeln. In jeder Phase von Produktion, Lagerung und Vertrieb verwandelt man mithilfe von Energie natürliche Ressourcen in fertige Güter und Dienstleistungen. Was immer an Energie in Produkt und Dienstleistung steckt, es wurde Energie darauf verwendet, die ökonomische Aktivität die Wertschöpfungskette entlangzubewegen, und diese Energie ging dabei – so präsentiert sich uns die entropische Rechnung – für immer verloren. Und schließlich werden die Güter, die wir produzieren, verbraucht, weggeworfen, gehen zurück in die Natur, womit wiederum ein Zuwachs an Entropie einhergeht. Ingenieure und Chemiker weisen darauf hin, dass es bei ökonomischen Aktivitäten nie einen Nettoenergiegewinn geben kann; die Umwandlung von natürlichen Ressourcen in ökonomische Werte führt immer zu einem Verlust an verfügbarer Energie. Die Frage ist nur, zu welchem Zeitpunkt man uns die Rechnung dafür präsentiert.
Nun, die entropische Rechnung für das Industriezeitalter liegt vor. Die durch das Verbrennen ungeheurer Mengen fossiler Brennstoffe in der Atmosphäre akkumulierten Kohlendioxidemissionen haben einen Klimawechsel sowie die Zerstörung der gesamten Biosphäre in Gang gesetzt, was so manche Frage an unser herkömmliches ökonomisches Modell aufwerfen muss. Die Ökonomie hat sich im Großen und Ganzen noch der Tatsache zu stellen, dass ökonomische Aktivitäten von den Gesetzen der Thermodynamik bestimmt sind. Gerade das eklatante Unverständnis der ganzen Disziplin gegenüber seinem eigenen Gegenstand zwingt zum Umdenken des Paradigmas durch Akademiker anderer Disziplinen über das ganze Spektrum der Natur- und Gesellschaftswissenschaften hinweg. Ich habe mich damit eingehender in meinem vorhergehenden Buch Die dritte industrielle Revolution befasst, speziell in dem Kapitel »Aufs Altenteil mit Adam Smith«.
An der zweiten Front entwickelt sich aus den Eingeweiden der Zweiten Industriellen Revolution eine gewaltige neue technologische Plattform, die den Widerspruch im Kern der kapitalistischen Ideologie auf besagtes Endspiel zutreibt. Das Verschmelzen des Kommunikationsinternets mit einem eben in der Entwicklung begriffenen Energie- und Logistikinternet zu einer nahtlosen intelligenten Infrastruktur des 21. Jahrhunderts – dem Internet der Dinge (Internet of Things) – hat eine Dritte Industrielle Revolution eingeleitet. Dieses Internet der Dinge fördert jetzt schon die Produktivität in einem Maße, dass die Grenzkosten vieler Güter und Dienstleistungen nahezu null sind, was sie praktisch kostenlos macht. Die Folge davon ist, dass die Profite wirtschaftlicher Unternehmen auszutrocknen beginnen, Eigentumsrechte ausgehöhlt werden und eine auf Knappheit gegründete Ökonomie langsam einer Ökonomie des Überflusses Platz macht.
Das Internet der Dinge
Das Internet der Dinge (IdD) wird eines Tages alles und jeden verbinden, und das in einem integrierten, weltumspannenden Netz. Natürliche Ressourcen, Produktionsstraßen, Stromübertragungs- und logistische Netze, Recyclingströme, Wohnräume, Büros, Geschäfte, Fahrzeuge, ja selbst Menschen werden mit Sensoren versehen, und die so gewonnenen Informationen werden als Big Data in ein globales neurales IdD-Netz eingespeist. Prosumenten können sich in dieses Netz einklinken und erreichen mithilfe von Big Data, Analysesoftware und Algorithmen eine dramatische Steigerung von Effizienz und Produktivität. Damit gehen die Marginalkosten, wie wir das schon bei Informationsgütern gesehen haben, auch bei Produktion und gemeinsamer Nutzung einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen gegen nahezu null.
Der Internet of Things Research Cluster, ein von der Europäischen Kommission ins Leben gerufener Forschungsverbund zur Förderung des Übergangs in die neue Ära des »ubiquitären Computings«, hat eine Unzahl von Beispielen für die Art und Weise vorgelegt, in der man das Internet der Dinge bereits jetzt zur globalen dezentralen Vernetzung des Planeten einsetzt.
Die Implementierung des IdD über alle Sektoren von Industrie und Handel hinweg hat längst begonnen. Über den gesamten Weg von Produktion, Vertrieb, Verbrauch und Wiederverwertung installiert man Sensoren, die den Fluss von Gütern und Dienstleistungen überwachen und registrieren. So setzt zum Beispiel UPS Big Data zur Echtzeitüberwachung seiner 60000 Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten ein. Der Logistikriese baut Sensoren in seine Fahrzeuge ein, um Einzelteile auf eventuelle Verschleißerscheinungen zu kontrollieren, sodass man sie ersetzen kann, bevor das Fahrzeug kostspielig liegen bleibt.19
Sensoren führen Buch über die Verfügbarkeit von Rohstoffen und informieren die Zentralen darüber ebenso wie über den jeweiligen Lagerbestand; sie gehen Fehlleistungen entlang der Produktionsstraßen auf den Grund und berichten in Echtzeit über den Stromverbrauch von Elektrogeräten in Geschäften und Haushalten und dessen Wirkung auf den Strompreis im Übertragungsnetz. Stromverbraucher können durch Programmieren ihrer Geräte ihren Verbrauch reduzieren oder sie zu Stoßzeiten im Netz völlig abschalten, um allzu große Ausschläge im Stromverbrauch, wenn nicht gar einen Brown-out über das ganze Netz, zu vermeiden. Und sie können dafür sogar noch eine Gutschrift auf ihrer monatlichen Rechnung kassieren.
Sensoren im Ladengeschäft berichten den Verkaufs- und Marketingabteilungen, welche Waren in Augenschein genommen, angefasst, wieder in die Regale gelegt oder gekauft werden, was Aufschluss über das Konsumverhalten zulässt. Weitere Sensoren verfolgen den Weg des Produkts vom Hersteller über den Händler zum Konsumenten und messen den Anteil an Abfallprodukten, der dem Recycling zugeführt wird. Diese Big Data werden rund um die Uhr analysiert, um das Inventar von Zulieferern, Herstellern und Distributoren zu rekalibrieren; darüber hinaus initiieren sie neue Geschäftspraktiken zur Verbesserung der thermodynamischen Effizienz und Produktivität über die ganze Wertschöpfungskette.
Auch beginnt man das IdD zur Schaffung intelligenter Städte (»Smart Cities«) einzusetzen. Sensoren, die Vibrationen und Materialzustand von Gebäuden, Brücken, Straßen und anderer Infrastruktur messen, erlauben Hochrechnungen auf deren strukturelle Integrität und anstehende Reparaturen. Andere Sensoren verfolgen die Lärmbelastung in den Vierteln, überwachen Verkehrsstaus auf den Fahrbahnen und die Dichte der Fußgänger auf den Gehsteigen, um Routen zu optimieren. Sensoren die Randsteine entlang sollen die Autofahrer über die Verfügbarkeit von Parkplätzen informieren.
Intelligente Straßen und intelligente Autobahnen halten die Fahrer über Unfälle und Verkehrsbehinderungen auf dem Laufenden. Versicherungen beginnen mit dem Einbau von Sensoren in Fahrzeuge zu experimentieren, die Daten über die Zeit liefern, in denen ein Fahrzeug benutzt wird, wo es sich befindet und welche Entfernungen es über einen bestimmten Zeitraum zurücklegt; anhand der dadurch ermöglichten Hochrechnungen auf Risiken werden dann die Versicherungsprämien festgelegt.20 Sensoren in der Straßenbeleuchtung erlauben dieser, ihre Leuchtkraft den natürlichen Lichtverhältnissen ihrer unmittelbaren Umgebung anzupassen. Selbst Mülltonnen werden mit Sensoren versehen, um über den Füllzustand die Abfallsammlung zu optimieren.
In der unbebauten Umwelt findet das Internet der Dinge zunehmend Einsatz bei der Betreuung von Ökosystemen. Sensoren in Wäldern benachrichtigen die Feuerwehr über potenzielle Brandherde. Sensoren in Städten, Vorstädten und ländlichen Gemeinden messen im Auftrag der Wissenschaft die Luftverschmutzung und warnen die Bürger vor toxischen Bedingungen, sodass der, der sich diesen nicht aussetzen möchte, daheim bleiben kann. 2013 lieferten Sensoren auf dem Dach der amerikanischen Botschaft in Beijing stündlich Berichte über den CO2-Ausstoß der chinesischen Hauptstadt. Die sofort im Internet veröffentlichten Daten warnten die Einwohner vor gefährlichen Verschmutzungsniveaus. Diese Informationen veranlassten den Staat um der öffentlichen Gesundheit willen zur Einführung drastischer Maßnahmen zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen in nahe gelegenen Kohlekraftwerken; außerdem schränkte man sowohl den Autoverkehr als auch die Produktion energieintensiver Fabriken in der ganzen Region ein.
Zur Schaffung eines Frühwarnsystems für Lawinen, Erdfälle, Vulkanausbrüche und Erdbeben bringt man Sensoren in den Boden ein, um selbst geringfügige Änderungen von Vibrationen und Erddichte messen zu können. IBM installiert Sensoren in Rio de Janeiro, um schwere Regenfälle und Erdrutsche bis zu zwei Tage im Voraus vorhersagen zu können, was den Behörden die Evakuierung der betroffenen Bevölkerung erlaubt.21
Forscher pflanzen Wildtieren Sensoren ein und stationieren andere entlang der Migrationswege, um Daten über Umwelt- und Verhaltensänderungen zu sammeln, die sich auf das Wohl der Tiere auswirken könnten; so lassen sich Präventivmaßnahmen zur Wiederherstellung der Dynamik bestimmter Ökosysteme einleiten. Darüber hinaus installiert man Sensoren in Flüssen, Seen und Ozeanen, um Veränderungen in der Wasserqualität und deren Auswirkungen auf Flora und Fauna in den betreffenden Ökosystemen festzustellen; so lassen sich die Veränderungen möglicherweise noch korrigieren. Im Rahmen eines Pilotprogramms in Dubuque, Iowa, hat man digitale Wasserzähler nebst Software zur Überwachung bestimmter Muster im Wasserverbrauch von Privathaushalten installiert. Nicht nur informieren diese den Hausbesitzer über mögliche Lecks, sie helfen auch bei der Drosselung des Verbrauchs.22
Auch auf unsere Nahrungsmittelproduktion und -auslieferung wirkt sich das Internet der Dinge aus. So überwachen Bauern mithilfe von Sensoren Wetterbedingungen, Veränderungen der Bodenfeuchtigkeit, Pollenflug und andere Faktoren mit potenziellen Auswirkungen auf den Ertrag; die Installation automatisierter Reaktionsmechanismen soll günstige Wuchsbedingungen garantieren. Sensoren an ausgelieferten Obst- und Gemüsekisten informieren nicht nur über deren Verbleib, sie »schnuppern« sogar an den landwirtschaftlichen Produkten und warnen vor unmittelbar bevorstehender Fäulnis, sodass man sie zu näher gelegenen Wiederverkäufern umleiten kann.23
Selbst am menschlichen Körper werden Sensoren an- oder gar eingebracht, die bestimmte Funktionen wie Herzschlag, Puls, Temperatur oder Hautfärbung überwachen; sie können den Arzt auf wesentliche Veränderungen hinweisen, die womöglich seiner Aufmerksamkeit bedürfen. General Electrics arbeitet mit optischer Software, die »Gesichtszüge auf Anzeichen von starken Schmerzen, einsetzendem Delirium oder Hinweise auf andere Probleme analysieren« und das Pflegepersonal alarmieren kann.24 Zur Unterstützung von medizinischem Rettungspersonal und einer beschleunigten Behandlung werden schon in naher Zukunft Körpersensoren mit der Krankenakte einer Person verbunden sein, was dem IdD eine blitzschnelle Wahrscheinlichkeitsrechnung hinsichtlich ihres Gesundheitszustands erlaubt.
Nirgendwo ist die Wirkung des IdD deutlicher zu spüren als bei der Installation von Sicherheitssystemen. Eigenheime, Büros, Fabriken, Geschäfte, selbst öffentliche Räume sind mit Kameras ausgestattet, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Das IdD erlaubt nicht nur das schnelle Eingreifen von Sicherheitsdiensten und Polizei, es speichert auch gleich die zur Ergreifung der Täter nötigen Daten.
Das Internet der Dinge bettet bebaute und natürliche Umwelt in ein integriertes Netzwerk ein, erlaubt jedem Menschen und jedem »Ding«, miteinander auf der Suche nach Synergien zu kommunizieren, und ermöglicht wechselseitige Verbindungen auf eine Art und Weise, die die thermodynamische Effizienz der Gesellschaft optimiert, während sie gleichzeitig das Wohlergehen des Planeten als Ganzes garantiert. Haben die technologischen Plattformen der Ersten und Zweiten Industriellen Revolution dazu beigetragen, die zahllosen ökologischen Wechselwirkungen unserer Erde um der Marktgerechtigkeit und des persönlichen Gewinns willen zu entkoppeln und einzuhegen, kehrt die IdD-Plattform der Dritten Industriellen Revolution diesen Prozess wieder um. Was das IdD hinsichtlich der Organisation unseres Wirtschaftslebens zu einer einschneidenden Technologie macht, ist der Umstand, dass es der Menschheit bei der Reintegration in die komplexe Choreographie der Biosphäre behilflich ist und dabei zwar dramatisch die Produktivität erhöht, aber ohne die ökologischen Beziehungen zu kompromittieren, die den Planeten regieren. Ein sparsamerer und vor allem effizienterer und produktiverer Umgang mit unseren Ressourcen in einer zirkulären Wirtschaft und der Übergang von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien sind die maßgeblichen Merkmale des aufkommenden ökonomischen Paradigmas. In der neuen Ära werden wir zu Knoten im Nervensystem der Biosphäre.
Aber das Internet der Dinge bietet uns nicht nur die Aussicht auf umfassende Umwälzungen in der Art, in der die Menschheit ihren Planeten bewohnt, und stellt damit die Weichen in eine nachhaltigere Zukunft im Überfluss, es wirft auch beunruhigende Fragen hinsichtlich Datensicherheit und Privatsphäre auf, die wir ausführlicher in Kapitel 5 und an anderen Stellen ansprechen wollen.
Einige in der Informationstechnologie führende Unternehmen der Welt sind bereits mit dem Ausbau des Internets der Dinge befasst. General Electrics »Industrial Internet«, Ciscos »Internet of Everything«, IBMs »Smarter Planet« sowie Siemens’ »Nachhaltige Stadtentwicklung« sind nur einige der vielen Initiativen, die gegenwärtig im Gange sind, um eine intelligente Infrastruktur für die Dritte Industrielle Revolution in die Wege zu leiten, die Stadtviertel, Städte, Regionen und Kontinente zu einem, wie Branchenkenner es nennen, globalen neuronalen Netzwerk zu verbinden vermag. Konzipiert ist dieses Netz als offen, dezentral und kollaborativ; es gibt jedem an jedem Ort und zu jeder Zeit die Möglichkeit, sich einzuklinken und mithilfe bereitstehender Big Data neue Applikationen zu schaffen, mit denen sich sein Alltagsleben im Nahezu-null-Grenzkosten-Bereich führen lässt. Anfangs waren sich die Weltkonzerne, die sich für das IdD stark machten, selbst nicht ganz sicher, was genau den grundlegenden Betriebsmechanismus der Plattform konstituieren sollte. 2012 lud mich Cisco nach Berlin ein, um mit einer Reihe von IT-Vorständen seiner Firmenkundschaft die Dritte Industrielle Revolution zu diskutieren. Im Jahr darauf lud mich Siemens ein, mich mit ihrem damaligen CEO Peter Löscher zu treffen, dem Global Board und zwanzig der Chefs seiner weltweiten Divisionen. In den Chefetagen beider Konzerne war das Interesse am Internet der Dinge sehr groß.
Meinen Vortrag bei Cisco begann ich mit der Frage, was allen Infrastruktursystemen der Geschichte gemeinsam sei. Infrastruktur erfordert drei Elemente, die jeweils mit den anderen interagieren, damit das System als Ganzes funktioniert: ein Kommunikationsmedium, eine Energiequelle und einen logistischen Mechanismus. In diesem Sinne lässt sich Infrastruktur als eine prothetische Erweiterung sehen, als eine Möglichkeit zum Ausbau des sozialen Organismus. Nimmt man ihr die Möglichkeit zu kommunizieren, die Energiequelle und ihre Form der Mobilität, hört die Gesellschaft auf zu funktionieren.
Wie bereits erwähnt, setzt sich das IdD aus einem Kommunikationsinternet, einem Energieinternet und einem Logistikinternet zusammen, die gemeinsam als Betriebssystem funktionieren. Ziel ist die unablässige Suche nach Möglichkeiten zur Erhöhung thermodynamischer Effizienz und der Produktivität bei der Organisation von Ressourcen, der Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen sowie dem Recycling von Abfallstoffen. Jedes dieser Internets ermöglicht die Arbeit der anderen. Ohne Kommunikation lässt sich wirtschaftliche Aktivität nicht verwalten. Ohne Energie lassen sich weder Informationen schaffen, noch lässt sich etwas transportieren. Ohne Logistik bewegen wir wirtschaftliche Aktivität nicht über die Wertschöpfungskette. Zusammen bilden diese drei Betriebssysteme die Physiologie des neuen ökonomischen Organismus.
Diese drei ineinandergreifenden Komponenten des IdD bedürfen der funktionellen Anpassung an die Gegebenheiten eines jeden Konzerns. Gerade in Bezug auf Cisco brachte ich meine Zweifel am Sinn eines Chief Information Officers in einer sich ausweitenden IdD-Wirtschaft zum Ausdruck und schlug vor, Informationstechnologie, Energiedienste und Logistik künftig zu einer einzigen Funktion unter der Leitung eines Chief Productivity Officers zusammenzulegen. In seiner Person würden IT-, Energie-, und Logistik-Know-how vereint; seine Aufgabe wäre der Einsatz des IdD zur Optimierung sowohl der thermodynamischen Effizienz als auch der Produktivität des Konzerns.
Während Cisco in der Hauptsache ein IT-Unternehmen ist, gestaltet sich Siemens mit seinen Energie-, Logistik- und Infrastruktur-Divisionen, um nur einige zu nennen, weit weniger homogen. Bei meinem Treffen mit den führenden Leuten von Siemens war klar, dass diese Divisionen immer noch allesamt mehr oder weniger unabhängig voneinander operieren, dass mit anderen Worten jede ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen verkauft. Die Neudefinition des Konzerns als Lieferant von Lösungen zur Schaffung intelligenter und nachhaltiger Städte zwingt diese traditionell isolierten Einheiten zu einem Dialog darüber, wie man einander bei der Umsetzung der neuen Vision eines IdD potenzieren könnte. Das Konzept, die drei Arten von Internet in einem einzigen IdD-System operieren zu lassen, um sowohl thermodynamische Effizienz als auch die Produktivität von Städten, Regionen und Ländern zu erhöhen, begann Sinn zu ergeben. Der Teufel steckt freilich im Detail – wie man ein neues Geschäftsmodell schafft, das Siemens’ mächtige Einzeldivisionen zu einem allumfassenden Lieferanten von Lösungen vereint, der wiederum den jeweils zuständigen Verwaltungen beim Ausbau einer IdD-Technologie-Plattform und dem Bürger beim Umstieg auf eine »intelligente« und »nachhaltige« Gesellschaft zur Seite steht.
Mit der steilen Entwicklung der IdD-Plattform gewinnt die Frage des Überdenkens unserer Geschäftspraktiken eine zentrale Bedeutung. Mein eigenes Social Enterprise, die TIR Consulting Group, setzt sich aus einer ganzen Reihe weltweit führender Architekturbüros und anderer Unternehmen aus den Sektoren Energie, Bau, Versorgung, IT und Logistik zusammen. Seit 2009 arbeiten wir mit Städten, Regionen und Staaten an Gesamtkonzepten – oder Third Industrial Revolution Master Plans, wie wir das nennen – zur Einführung einer IdD-Infrastruktur. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir uns hier auf Neuland bewegen und in rasendem Tempo dazuzulernen haben, wollen wir dahinterkommen, wie sich diese neue intelligente Gesellschaft am besten aufbauen lässt. Aber immerhin wissen wir so viel: Der Kern des IdD-Betriebssystems besteht in der Fusion von Kommunikations-, Energie- und Logistikinternet zu einer integrierten Betriebsplattform. Bleiben diese drei Netze voneinander isoliert, ist der Aufbau des IdD nicht möglich, und die Vision einer intelligenten Gesellschaft in einer nachhaltigen Welt kann sich nicht erfüllen. (Wir kommen auf diese drei Arten von Internet als treibende Kräfte des IdD im Verlauf des Buches noch des Öfteren zurück.)
Der Aufstieg der kollaborativen Commons
Bei all der Begeisterung über die Aussichten des Internets der Dinge geht völlig unter, dass die Fusion von allen und allem zu einem weltweiten und vom Motor »extremer Produktivität« getriebenen Netzwerk uns schneller denn je einer Ära nahezu kostenloser Güter und Dienstleistungen entgegenbringt. Das wiederum wird im nächsten halben Jahrhundert zum Schwinden des Kapitalismus und zum Aufstieg der kollaborativen Commons als dominantem Modell zur Organisation wirtschaftlichen Lebens führen.
Wir sind so daran gewöhnt, den kapitalistischen Markt nebst der dazugehörigen Regierungsform als die einzig möglichen Organisationsformen wirtschaftlichen Lebens zu sehen, dass wir dabei ganz das andere Organisationsmodell in unserer Mitte vergessen, auf das wir tagtäglich hinsichtlich einer ganzen Reihe von Gütern und Dienstleistungen angewiesen sind, die weder Markt noch Staat stellen. Die Commons – Gemeingüter oder Allmende – sind älter als sowohl der kapitalistische Markt als auch die repräsentative Regierung; sie sind die älteste institutionalisierte Form demokratischer selbstverwalteter Aktivität.
Die heutigen Commons sind der Ort, wo Milliarden von Menschen miteinander den bedeutungsvollen sozialen Aspekten des Lebens nachgehen. Sie setzen sich zusammen aus buchstäblich Millionen von selbstverwalteten, größtenteils demokratisch verwalteten Organisationen: karitative Einrichtungen, Religionsgemeinschaften, künstlerische und kulturelle Gruppen, Stiftungen im Bildungsbereich, Amateursportvereine, Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften, Kreditgenossenschaften, Organisationen im Gesundheitswesen, Interessenverbände, Hauseigentümergemeinschaften. Die Liste formeller und informeller Einrichtungen ist schier endlos – gemein ist ihnen, dass unsere Gesellschaft in ihr Sozialkapital generiert.
Die traditionellen demokratisch verwalteten Commons finden sich heute noch verstreut auf allen Kontinenten. Ländliche Gemeinschaften legen ihre Ressourcen – Land, Wasser, Wald, Weiden, Wild, Fisch etc. – zusammen und nutzen sie im Kollektiv. Entscheidungen über Kollektivierung, Anbau, Verteilung und Recycling von Ressourcen werden demokratisch von den Mitgliedern der Commons gefällt. Man legt Sanktionen und Strafen für Verstöße gegen Regeln und Protokolle in Satzungen fest, was die Commons zum selbstverwalteten wirtschaftlichen Unternehmen macht. Die Commons haben sich als relativ erfolgreiches Verwaltungsmodell in von der Subsistenzwirtschaft geprägten Gemeinschaften erwiesen, die in erster Linie für den Eigenverbrauch produzieren und nicht für den Tausch. Sie sind die frühen Archetypen unserer heutigen Kreislaufwirtschaft.
Der Erfolg der Commons ist umso beeindruckender, wirft man einen Blick auf die politischen Umstände, die sie hervorgebracht haben. Größtenteils tauchte diese Verwaltungsform in Feudalgesellschaften auf, deren unumschränkte Herrscher ihre Untertanen durch Abgaben ausbluteten, sei es durch Frondienst auf ihren Gütern oder durch eine Steuer in Form eines Teils ihrer Produktion. Die Organisation in einer gemeinnützigen Ökonomie war der einzig gangbare Weg, die optimale Nutzung des bisschen Reichtums, den man ihnen gelassen hatte, zu gewährleisten. Was sich daraus lernen lässt? Eine demokratische Form von Selbstverwaltung, die Commons-Ressourcen zum Nutzen aller zusammenzulegte, erwies sich als robustes ökonomisches Modell für das Überleben in einem despotischen Feudalsystem, das seine Untertanen in Knechtschaft hielt.
Die großen Einhegungsbewegungen überall in Europa, die letztlich den Untergang der Feudalgesellschaften, den Aufstieg der modernen Marktwirtschaft und damit das kapitalistische System herbeiführten, machten den ländlichen Commons ein Ende, nicht aber dem gemeinschaftlichen Geist, der sie beseelte. Die Bauern nahmen die daraus gelernten Lektionen mit in die neue städtische Umgebung, wo sie sich – in Gestalt des Fabrikherren der Industriellen Revolution – einem nicht weniger imposanten Feind gegenübersahen. Städtische Arbeiter und eine sich herausbildende Mittelschicht legten, wie einst ihre in Leibeigenschaft lebenden Vorfahren, ihre Ressourcen zusammen – diesmal in Form von Löhnen und Fertigkeiten – und schufen neue Arten von selbstverwalteten Commons. Karitative Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Gewerkschaften, Kooperativen und populärkulturelle Einrichtungen aller Art begannen Wurzeln zu fassen und zu florieren. Sie schufen die Grundlage für das, was man im 19. Jahrhundert als Zivil- beziehungsweise Bürgergesellschaft bezeichnen sollte. Das Schmiermittel dieser neuen Commons-Einrichtungen war Sozialkapital, ihr Motor war der demokratische Geist. Sie sollten eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Lebensbedingungen von Millionen von Städtern spielen.
Im 20. Jahrhundert wurde diese Zivil- beziehungsweise Bürgergesellschaft durch von der Steuer befreite Einrichtungen institutionalisiert und teils zum Non-Profit-Sektor umfirmiert. Heute benutzen wir die Begriffe Zivilgesellschaft und Non-Profit-Sektor mehr oder weniger synonym, je nachdem, ob wir ihre soziale Funktion oder ihre institutionelle Klassifikation hervorheben wollen. Neuerdings beginnt sich eine neue Generation von diesen älteren Unterscheidungen wegzuentwickeln; sie bevorzugt den Ausdruck »soziale Commons«.
In der langen Entwicklung von den feudalen zu den sozialen Commons perfektionierte Generation auf Generation die Prinzipien demokratischer Selbstverwaltung zur hohen Kunst. Gegenwärtig wachsen in vielen Ländern aller Kontinente die sozialen Commons schneller als die Marktwirtschaft. Dennoch ist das Produkt dieser sozialen Commons größtenteils nicht von pekuniärem, sondern von sozialem Wert; entsprechend lässt der Volkswirtschaftler sie auch gern außen vor. Nichtsdestoweniger ist diese soziale Ökonomie eine beeindruckende Kraft. Laut einer 40 Länder umfassenden Studie des Center for Civil Society Studies der John Hopkins University belaufen sich die Betriebsaufwendungen der Non-Profit-Commons auf 2,2 Billionen Dollar. In acht der betreffenden Länder – USA, Kanada, Japan, Frankreich, Belgien, Australien, Tschechien und Neuseeland – macht der Non-Profit-Sektor im Durchschnitt 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.25 Sein Anteil am BIP in diesen Ländern übersteigt den Anteil aller Versorgungsunternehmen zusammengenommen, ist gleich dem des Bausektors und fast so groß wie der Anteil von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern.26
In den sozialen Commons generieren wir den Goodwill, der eine Gesellschaft als kulturelles Gebilde zusammenhält. Märkte und Regierungen sind eine Erweiterung der sozialen Identität eines Volks; ohne den ständigen Nachschub an sozialem Kapital herrschte nicht genügend Vertrauen, um sie funktionieren zu lassen, und dennoch tun wir die sozialen Commons als »dritten Sektor« ab – als wäre er weniger wichtig als Märkte und Staat.
Würden wir jedoch eines Tages aufwachen und feststellen, dass all die Organisationen der Zivilgesellschaft über Nacht verschwunden sind, die Gesellschaft würde rasch verdorren und eingehen. Ohne Gotteshäuser, Schulen, Kliniken, Selbsthilfegruppen, Interessenvertretungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, von Kunst und Kultur ganz zu schweigen, würden wir unsere Identität ebenso verlieren wie die Bande, die uns als menschliche Großfamilie zusammenhalten. Unser Leben verlöre den Sinn.
Während der vom materiellen Gewinn getriebene kapitalistische Markt auf Eigennutz basiert, charakterisiert die sozialen Commons das Interesse an der Zusammenarbeit, hinter dem ein aufrichtiges Verlangen nach Kontakt mit anderen und Teilhabe steht. Während Ersterer Eigentumsrecht, Vorsicht und das Streben nach Autonomie propagiert, bevorzugt letzterer quelloffene Innovation, Transparenz und die Suche nach Gemeinschaft.
Was die Commons heute relevanter denn je macht, ist der Umstand, dass wir zurzeit an einer globalen Hightech-Plattform arbeiten, deren konstituierende Eigenschaften potenziell genau die Werte und Prinzipien optimieren, die diese uralte Institution beseelen.
Das Internet der Dinge ist der technologische »Seelenverwandte« der sozialen Commons – ein im Entstehen begriffenes kollaboratives Common. Konfiguration und Wesen der neuen Infrastruktur des Internets der Dinge ist die quelloffene Architektur. Das System ist von Natur aus dezentral und soll sowohl die Zusammenarbeit ermöglichen als auch die Suche nach Synergien, was es zum idealen technologischen Rahmen für die Förderung der Sozialwirtschaft macht. Die Grundgedanken hinter dem IdD sind die Optimierung der lateralen Peer-Produktion, universeller Zugang sowie Offenheit für alle. Das World Wide Web ist, wie jeder weiß, der schon einmal dort unterwegs war, dem wesensverwandt, und diese Werte sind kritisch für Erzeugung und Hege von Sozialkapital in der Bürgergesellschaft. Der eigentliche Sinn der neuen Technologie besteht in der Förderung einer Teil- und Tauschkultur. Kurzum, es deckt sich mit all dem, worum es bei den Commons geht. Es sind eben diese Besonderheiten im Design des IdD, die die sozialen Commons aus ihrem Schattendasein holen und ihnen eine Hightech-Plattform geben, die sie zum dominanten ökonomischen Paradigma des 21. Jahrhunderts machen wird.
Das Internet der Dinge ermöglicht Milliarden von Menschen die Teilnahme an sozialen Peer-to-Peer-Netzwerken, in denen sie gemeinsam mit anderen die zahlreichen neuen ökonomischen Möglichkeiten und Praktiken der kollaborativen Commons schaffen. Die Plattform verwandelt jeden in einen Prosumenten und macht jede Aktivität zur Zusammenarbeit. Das IdD verbindet potenziell jeden Menschen mit jedem anderen in einer weltumspannenden Gemeinschaft und sorgt so für eine Blüte des sozialen Kapitals von nie gekannten Ausmaßen, was wiederum eine Teil- und Tauschwirtschaft oder Sharing Economy möglich macht. Ohne die IdD-Plattform wären die kollaborativen Commons weder funktionsfähig noch realisierbar.
Das Adjektiv collaborative ist erst Ende der 1920er-Jahre belegt; der Oxford English Dictionary führt einen Erstnachweis von 1927 an. (Im Deutschen beginnt sich kollaborativ eben erst im Sinne der gemeinsamen Arbeit in den Commons als Lehnübersetzung einzubürgern.) Eine Suche mit Googles Ngram Viewer zeigt uns, dass hier große Veränderungen im Gange sind. Der Ngram Viewer erlaubt dem Forscher, einen Korpus von fünf Millionen zwischen 1500 und 2008 erschienenen und mittlerweile digitalisierten Büchern zu durchsuchen und so festzustellen, wann ein bestimmtes Wort zum ersten Mal benutzt wurde und ob seine Verwendung über bestimmte Zeiträume zu- oder abnimmt. In den 40er- und 50er-Jahren beginnt man collaborative häufiger einzusetzen, ab den 60er-Jahren hebt eine steile Karriere des Adjektivs an, die sich letztlich mit dem Auftauchen von Computern und Internettechnologie als interaktives Peer-to-Peer-Kommunikationsmittel deckt.27
Die kollaborativen Commons haben bereits jetzt eine tief greifende Wirkung auf das Wirtschaftsleben. Märkte beginnen Netzwerken zu weichen, Eigentum wird zunehmend weniger wichtig als Zugang zu dem, was benötigt wird. Eigennutz wird gemildert durch kollaborative Interessen, und der traditionelle Traum, es vom armen Schlucker zum Millionär zu bringen, wird ersetzt durch den neuen Traum von einer nachhaltigen Lebensqualität.
Da sich in der kommenden Ära eine neue Generation zunehmend mit diesem »Kollaboratismus« identifizieren wird, werden sowohl der Kapitalismus als auch der Sozialismus ihren einst beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft verlieren Die jungen Kollaboratisten borgen sich die Kardinaltugenden von Kapitalisten und Sozialisten und eliminieren dabei das auf Zentralisation ausgerichtete Wesen sowohl des freien Marktes als auch des bürokratischen Staats.
Das dezentrale, vernetzte Wesen des Internet of Things vertieft das individuelle unternehmerische Engagement direkt proportional zu Vielfalt und Intensität der Beziehungen des Einzelnen innerhalb der Gemeinwirtschaft. Was wiederum daher kommt, dass die Demokratisierung von Kommunikation, Energie und Logistik Milliarden von Menschen »ermächtigen« wird. Erreicht wird dies jedoch nur durch die Teilnahme an Peer-to-Peer-Netzwerken, die von Sozialkapital getragen sind.
Eben erreicht eine neue Generation die Mündigkeit, die mithilfe eines höheren Maßes an sozialer Einbettung ein höheres Maß an unternehmerischer Selbstbestimmung gewonnen hat. Es kommt keineswegs überraschend, dass die Besten und Gescheitesten der Millenniumsgeneration sich als »gemeinwirtschaftliche Unternehmer« (Social Entrepreneurs) sehen. Für sie sind »unternehmerisch« und »sozial« kein Widerspruch mehr, sondern eine Tautologie. Hunderte von Millionen übertragen bereits Teile ihres Wirtschaftslebens von den kapitalistischen Märkten auf die globalen kollaborativen Commons. Prosumenten nutzen gemeinsam selbst produzierte Informationen, Unterhaltung, grüne Energie, 3-D-Druck-Erzeugnisse und Open-Online-Seminare in den kollaborativen Commons bei Grenzwertkosten von nahezu null. Und nicht nur das. Sie teilen auch Autos, Wohnungen, ja, selbst Kleidung mit anderen mittels Miete, Tauschringen und Kooperativen zu niedrigen oder Nahezu-null-Grenzwertkosten. Eine wachsende Zahl von Menschen arbeitet in »patientengesteuerten« Gesundheitsnetzwerken an der Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten auf der Suche nach neuen Behandlungsmethoden für Krankheiten; auch sie arbeiten mit Nahezu-null-Grenzkosten. Und junge Social Entrepreneurs (»Sozialunternehmer«) gründen ökologisch verantwortungsbewusste Geschäfte, finanzieren per Crowdfunding neue Unternehmen, ja, sie schaffen sogar alternative soziale Währungen in der neuen Ökonomie. Folge von alledem ist, dass der »Tauschwert« des Marktplatzes zunehmend durch einen »mit anderen teilbaren« Wert in den kollaborativen Commons ersetzt wird. Wenn Prosumenten ihre Güter und Dienstleistungen in diesen Commons teilen, verliert das die Marktwirtschaft regierende Regelwerk für das gesellschaftliche Leben an Relevanz.
Die gegenwärtige Debatte unter Volkswirten, Wirtschaftsführern und Vertretern des Staats über eine, wie es aussieht, neue Form von langfristiger wirtschaftlicher Stagnation, die sich rund um den Globus abzeichnet, ist ein Indikator für die Umwälzungen, die sich im Zuge des Umstiegs der Wirtschaft vom Tauschwert auf dem Marktplatz zum Teil- und Tauschwert in den kollaborativen Commons vollziehen.
Das globale BIP zeigt im Gefolge der Großen Rezession rückläufige Zuwachsraten. Ökonomen verweisen unter anderem auf hohe Energiekosten, Wandlungen in der Bevölkerungsstruktur, das langsamere Anwachsen der Arbeiterschaft, auf Schulden von Privathaushalten und Staat sowie darauf, dass ein wachsender Anteil des globalen Einkommens in die Taschen der Reichen fließt und der gebeutelte Verbraucher kein Risiko beim Konsum mehr einzugehen bereit ist. Es gibt da jedoch womöglich einen noch weitreichenderen, wenn auch noch im Werden begriffenen Faktor, mit dem die rückläufigen Zuwachsraten beim BIP wenigstens zum Teil zu erklären wären. Der Rückgang der Grenzkosten bei der Produktion von Gütern und Dienstleistungen in einem Sektor auf den anderen lässt die Profite schwinden, wodurch auch das BIP sinkt. Und je mehr Güter und Dienstleistungen so gut wie umsonst zu haben sind, desto weniger wird auf dem Marktplatz gekauft – auch das mit negativen Auswirkungen auf das BIP. Und selbst von den Dingen, die man auf dem Marktplatz ersteht, werden immer weniger neu gekauft, da immer mehr Menschen einmal Gekauftes einer zweiten Verwendung in der Tausch- und Teilwirtschaft oder dem Recycling zuführen, was ihren Lebenszyklus verlängert – mit dämpfender Wirkung auf das BIP. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern gibt darüber hinaus dem Zugang den Vorzug über den Besitz, d. h., man bezahlt lieber für die begrenzte Zeit, in der man einen Wagen, ein Rad oder was auch immer auch tatsächlich verwendet. Weiterhin senkt der Umstand, dass Automatisierung, Roboter und künstliche Intelligenz zig Millionen Arbeiter ersetzen, die Kaufkraft der Konsumenten auf dem Marktplatz. Und schließlich migriert mit der steigenden Zahl von Prosumenten immer mehr wirtschaftliche Aktivität von der Tauschwirtschaft des Marktplatzes in die Teil- und Tauschwirtschaft der kollaborativen Commons, ebenfalls mit negativen Auswirkungen auf das BIP.
Worauf es ankommt, ist Folgendes: Die wirtschaftliche Stagnation mag noch zahlreiche andere Ursachen haben oder auch nicht, Tatsache ist, dass eben erst eine weit entscheidendere Veränderung ihre Wirkung zu entfalten beginnt, die für diese Trägheit mitverantwortlich sein könnte: der langsame Niedergang des kapitalistischen Systems und der Aufstieg der kollaborativen Commons, in denen man das ökonomische Wohl weniger durch Anhäufung von Markt- als durch das Sammeln von Sozialkapital misst. Wir können den Grund für den allmählichen Rückgang des BIP in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zunehmend im Umstieg auf ein pulsierendes neues ökonomisches Paradigma sehen, das ökonomischen Wert nicht mehr misst wie bisher.
Nirgendwo ist die Veränderung augenscheinlicher als in der globalen Debatte darüber, wie denn wirtschaftlicher Erfolg am besten zu beurteilen sei. Konventionelle Messinstrumente zur Beurteilung ökonomischer Leistung wie das Bruttoinlandsprodukt konzentrieren sich ausschließlich auf die Auflistung aller Güter und Dienstleistungen, die ein Land im Jahr produziert – zwischen negativem und positivem Wirtschaftswachstum unterscheiden sie nicht. Eine Zunahme der Ausgaben für die Beseitigung von Giftmülldeponien, für Polizeischutz und den Ausbau von Gefängniskapazitäten, militärischen Inbesitznahmen und dergleichen mehr – all das zählen wir zum Bruttoinlandsprodukt.