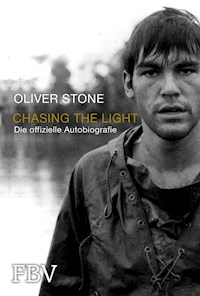4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kopp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was der russische Präsident Wladimir Putin wirklich sagt!
Unzensiert, ungekürzt und nicht aus dem Zusammenhang gerissen.
Die Putin-Interviews sind das Ergebnis von mehr als einem Dutzend Gesprächen, die der Oscar-prämierte Regisseur Oliver Stone über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Noch nie zuvor hat der russische Präsident einem westlichen Gesprächspartner ein so langes und dermaßen ausführliches Interview gegeben. Kein Thema bleibt ausgespart. Das erste Interview fand statt, als Stone in Moskau den NSA-Whistleblower Edward Snowden aufsuchte, das letzte nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.
Als Reaktion auf Stones Fragen spricht Putin über die russisch-amerikanischen Beziehungen, über den Vorwurf, der Kreml habe sich in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen eingemischt, über Russlands Beteiligung an Konflikten in Syrien, der Ukraine und andernorts. Putin spricht über seinen Aufstieg zur Macht und über sein Verhältnis zu den US-Präsidenten Clinton, George W. Bush, Obama und Trump. Es sind persönliche, provokante und manchmal auch surreal wirkende Gespräche.
Durch Querverweise und Quellenangaben ermöglicht das Buch dem Leser ein tieferes Verständnis der in den Gesprächen behandelten Themen und steigert auf diese Weise das Lesevergnügen.
»Für alle, an denen die jahrelange Verteufelung Putins durch die Massenmedien nicht spurlos vorbeigegangen ist, werden Oliver Stones beispiellose Interviews mit Wladimir Putin ein wahrer Augenöffner sein. Die Gespräche behandeln das Private genauso wie das Politische, es geht um Russland, um Amerika, um wenig bekannte Episoden und um die aktuellen Nachrichten.«
Stephen F. Cohen, Professor für Russistik, New York University und Princeton University
»Eine historische Interviewreihe von immenser Bedeutung (...) Diese Gespräche sind ein Schlüsseltext zum Verständnis unserer gefährlichen Zeit.«
Robert Scheer, Journalist und Bestsellerautor
»Oliver Stones Putin-Interviews sind ein dringend benötigtes Gegengift zur Russland-Hysterie, die die USA gepackt hat. Wer mithilfe der Interviews Zeit mit Wladimir Putin verbringt, muss einfach seine Menschlichkeit, seine Intelligenz und seinen völligen Mangel an Antipathie gegenüber den USA erkennen.«
Dan Kovalik, Anwalt für Menschenrechte
»Stone gelingt es mit seiner Arbeit, unsere Perspektive neu auszurichten.«
New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
1. Auflage September 2018 2. Auflage März 2022 3. Auflage August 2024 als Sonderausgabe
Copyright © 2017 by Oliver Stone Copyright des Vorworts © 2017 by Robert Scheer
Copyright © 2018, 2022, 2024 für die deutschsprachige Ausgabe Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg
Titel der amerikanischen Originalausgabe:The Putin Interviews
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Peter Hiess Lektorat: Renate Öttinger Satz und Layout: Martina Kimmerle Covergestaltung: Laura Hönes
ISBN E-Book 978-3-86445-618-3 eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis Kopp Verlag Bertha-Benz-Straße 10 D-72108 Rottenburg E-Mail: [email protected] Tel.: (07472) 98 06-10 Fax: (07472) 98 06-11Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:www.kopp-verlag.de
Zitat
»Wenn Wladimir Putin wirklich der große Feind der USA ist, dann sollten wir zumindest versuchen, ihn zu verstehen.«
Oliver Stone
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Abschrift einer Reihe von Interviews, die Oliver Stone mit Wladimir Putin führte. Die Gespräche fanden im Rahmen von vier Russland-Reisen an insgesamt 9 Tagen zwischen dem 2. Juli 2015 und dem 10. Februar 2017 statt. Bei der Übersetzung von Putins Worten aus dem Russischen haben wir uns erlaubt, grammatikalische Irrtümer, unklare Formulierungen und diverse Widersprüche zu korrigieren. Da sich die Interviews über 2 Jahre erstreckten, haben wir auch einige Wiederholungen gekürzt. In jedem Fall aber haben wir darauf geachtet, dass Intention und Sinn des Gesagten im vorliegenden Transkript richtig wiedergegeben werden.
Vorwort
Vor 30 Jahren war ich als Korrespondent für die Los Angeles Times tätig. Damals führte mich ein Auftrag ins Allerheiligste des Politbüros, in das geheimnisvolle und allmächtige Zentrum der Sowjetunion. Staatsoberhaupt Michail Gorbatschow leitete zu dieser Zeit gerade sein ehrgeiziges politisches Projekt für mehr Offenheit und Veränderung in die Wege. Seine Perestroika, die Umgestaltung der sowjetischen Regierung, würde später unweigerlich – wenn auch unbeabsichtigt – das Ende des brutalen kommunistischen Experiments herbeiführen. Danach folgte eine schöne neue Welt aus unterschiedlichen Ethnien, Kulturen und Religionen, die sich über ein Sechstel der Landfläche unseres Planeten erstreckt.
Ich interviewte an diesem Tag Alexander Jakowlew, das liberalste Mitglied des Politbüros und enger Vertrauter Gorbatschows. Ein anderes Mal klopfte ich im selben Flur auch an die Tür von Jegor Ligatschow, der als zweiter Mann nach Michail Gorbatschow und stärkster Gegner der Perestroika galt. Boris Jelzin, dessen Rolle zu dieser Zeit noch eher unklar war, begegnete ich leider nicht – er wurde 4 Jahre später, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der erste russische Präsident. Es war Jelzin, der den ehemaligen KGB-Oberstleutnant Wladimir Putin als Angehörigen des Reformflügels in seine Regierung holte. Als Jelzin am 31. Dezember 1999 sein Amt niederlegte, übernahm Putin die Amtsgeschäfte des Präsidenten. Ein paar Monate danach gewann Putin dann mit einem klaren Sieg über den Kandidaten der Kommunistischen Partei die Präsidentschaftswahlen des Landes.
Der Regisseur Oliver Stone führte für den US-Fernsehsender Showtime mehrere Interviews mit dem russischen Staatschef. Diese historisch bedeutenden und immens wichtigen Gespräche wurden zur Grundlage einer vierteiligen Doku-Fernsehserie und sind im vorliegenden Buch vollständig abgedruckt. Putin sagt darin unter anderem, dass er nach dem Ende der Sowjetunion glaubte, der Kalte Krieg und mit ihm die Bedrohung in Gestalt eines bewaffneten Konflikts seien nun endlich vorbei. Doch es kam völlig anders.
Putin verwarf zwar den Kommunismus als Staatsreligion und griff stattdessen die Traditionen der russisch-orthodoxen Kirche wieder auf, ist aber bis heute leidenschaftlicher Nationalist. Er ist fest entschlossen, Russland den Respekt zu verschaffen, den es seiner Ansicht nach verdient. Für ihn bedeutet das eine Rücksichtnahme auf die historischen Anliegen des russischen Volkes bezüglich seiner Landesgrenzen und der Behandlung russischsprachiger Menschen, die nach dem Kollaps der Sowjetunion plötzlich Bürger eines anderen Landes wie beispielsweise der Ukraine waren.
Bei seinen Gesprächen mit Stone hält Putin seinem Amtsvorgänger Gorbatschow zugute, dass er einerseits die Notwendigkeit eines tief greifenden Wandels im scheiternden sowjetischen System richtig erkannt habe. Andererseits sei der Perestroika-Lenker äußerst naiv gewesen, was die gewaltigen Hindernisse für diesen Wandel im eigenen Land und vor allem in den Vereinigten Staaten anging. Er sei überzeugt gewesen, dass die Vernunft siegen werde, da doch die Hauptgegner im Kalten Krieg – die beide die Fähigkeit besaßen, alles Leben auf der Erde auszulöschen – nichts als den Frieden wollten.
Die zentrale Fragestellung in den Stone-Putin-Interviews befasst sich damit, wie es zum derzeitigen politischen Spannungsverhältnis kommen konnte. Damit sind diese Gespräche ein Schlüsseltext zum Verständnis unserer gefährlichen Zeit. Die zwischen dem 2. Juli 2015 und dem 10. Februar 2017 geführten Interviews entstanden in einem Zeitraum, als sich die Beziehungen zwischen den zwei größten Militärmächten der Welt erheblich verschlechterten. Heute herrschen zwischen Russland und den USA so viel Misstrauen und Feindseligkeit, wie wir sie seit dem Ende des Kalten Kriegs vor einem Vierteljahrhundert nicht mehr gesehen haben. Stone merkt in den Gesprächen auch einige Male pointiert an, dass Macht oft die Eigenschaft hat, die Herrscher eines Landes im Namen eines fehlgeleiteten Patriotismus zu korrumpieren. Und dies, so Stone, sei ein Problem, das jeden Staat und definitiv auch Russland betreffen könne.
Das Gespräch wurde respektvoll geführt und gab Putin die Möglichkeit, »seine Version der Geschichte darzustellen«, wie Stone gegen Ende sagte. Das hindert den Regisseur und Journalisten Stone jedoch nicht daran, diese Version immer wieder aktiv infrage zu stellen. Seine Bemerkungen drehen sich vor allem um die anhaltende Diskussion über Russlands Rolle in der Weltpolitik, angefangen von der Unterstützung des syrischen Assad-Regimes bis hin zur Anschuldigung, die US-Präsidentschaftswahlen des Jahres 2016 beeinflusst zu haben.
Stone weiß aus eigener Erfahrung viel über aussichtslose Kriege und die Lügen, die darüber erzählt werden. Er war 2 Jahre im Kampfeinsatz in Vietnam und verarbeitete die dort gemachten Erfahrungen in seinem mit vier Oscars ausgezeichneten Film Platoon und den beiden anderen Werken seiner bravourösen Vietnam-Trilogie, Geboren am 4. Juli und Zwischen Himmel und Hölle. Auch in seiner 2012 vom Sender Showtime ausgestrahlten, zehnteiligen revisionistischen Geschichtsaufarbeitung Oliver Stone – Die Geschichte Amerikas und dem Begleitbuch dazu geht er ausführlich auf das Thema Krieg ein. Zudem stellt er darin die offizielle amerikanische Darstellung des Kalten Kriegs infrage, die gerade vor dem Hintergrund des vorliegenden Werks eine grundlegende Rolle spielt.
Aber auch Putin ist mit dem Thema Krieg mehr als vertraut. Schließlich kam er im Trümmerhaufen der Sowjetunion an die Macht, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Invasion und 50 Millionen Toten nichts Besseres zu tun hatte, als in Afghanistan einzumarschieren. Dieser sinnlose Konflikt war es im Endeffekt auch, der das Ende des kommunistischen Regimes einläutete. Heute lenkt Wladimir Putin einen Staat, der zwar nach wie vor eine riesige militärische Macht darstellt, aber weit weniger erfolgreich ist, was seine friedlichen wirtschaftlichen Errungenschaften angeht.
Gemeinsam ist Putin und Stone die Überzeugung, dass militaristische Selbstüberschätzung fatale Folgen haben kann. Auch jenen Ideologien in ihren jeweiligen Gesellschaften, die heute ebenso wie früher imperialistisch gesinnt sind, stehen sie durchaus misstrauisch gegenüber. Dennoch unterhalten sich hier nicht zwei Gleichgesinnte. Stone ist auf den folgenden Seiten vielmehr der kritische Künstler, der sich auf Widersprüche und merkwürdiges Gedankengut stürzt. Putin wiederum stellt von vornherein ausdrücklich klar, dass er sich bei aller Zurückhaltung seiner Rolle als Oberbefehlshaber der zweitstärksten Militärmacht der Welt stets bewusst ist und dass alle seine Aussagen Folgen haben können, die weit über spannendes Fernsehen hinausgehen. Dennoch hegen die beiden Männer einen vorsichtigen Respekt füreinander und gewähren dem Leser interessante Einblicke in den Verstand der Mächtigen – seien es nun Politiker oder Künstler.
Für Oliver Stone ist das Filmemachen eine perfekte Möglichkeit, seiner Verachtung für die Dogmen der außenpolitischen Führung seines Landes Ausdruck zu verleihen. Putin steht vor einer wesentlich schwierigeren Aufgabe: Er ist der politische Führer eines Landes, das immer noch mitten im grundlegenden Wandel von der sowjetkommunistischen zu einer neuen russischen Nationalidentität steht. Ihr muss es gelingen, die Brücke zwischen »1000 Jahren« russischer Geschichte, von den Zaren bis zu den mächtigen Oligarchen – der russischen Version der Günstlingskapitalisten – zu schlagen.
Putin tritt hier als Prophet eines verwundeten russischen Nationalismus auf, der zwar durchaus eine erhebliche Bedrohung darstellen könnte, aber so gar nichts mit der kommunistischen Ideologie zu tun hat, die seinem Aufstieg zur Macht voranging und die ihm sichtlich zuwider ist. Dieses Spannungsverhältnis spielt – wie wir sehen werden – eine zentrale Rolle in Putins Denken, aber auch in der Frage, wo Russland in der heutigen, stark veränderten Welt steht. Das Interview beginnt zu einer Zeit, als kaum jemand damit rechnete, dass ein populistischer, rechter Kandidat bei den amerikanischen Vorwahlen sämtliche Gegner aus dem republikanischen Establishment schlagen, die demokratische Kandidatin problemlos überholen und US-Präsident werden würde. Am Ende der Abschrift, nicht einmal einen Monat nach Donald Trumps Amtseinführung, beenden Oliver Stone und Wladimir Putin ihr Gespräch auf zugleich aufschlussreiche wie deprimierende Art und Weise.
In der letzten Interviewsitzung versucht Stone seinen Gesprächspartner nachdrücklich zu Aussagen zu bewegen, die für den intellektuell angriffslustigen Dokumentarfilmer ein paar offene Fragen beantworten sollen. Dazu gehören auch umstrittene Aspekte der 18 Jahre, die Putin nun schon das flächenmäßig größte Land der Erde regiert. Ist Putin süchtig nach Macht? Sieht er sich selbst als jemanden, der eine unerlässliche Rolle in der russischen Geschichte spielt? Hat die großteils unangefochtene Macht, die er ausübt, seine Sicht der Dinge ins Unrealistische verändert? Obwohl diese Themen in den vorliegenden Interviews nicht das erste Mal zur Sprache kommen, geht Putin gegen Schluss nicht mehr so bereitwillig auf Stones Nachbohren ein. Vielmehr hat sich eine gewisse Verdrossenheit eingestellt, die – wie Wladimir Putin klarstellt – weniger darauf zurückzuführen ist, dass er seine Ideen nicht für ein westliches Publikum geeignet hielte, sondern vielmehr darauf, dass sie ohnehin nicht gehört werden.
Putin hat es mittlerweile bereits mit seinem vierten US-Präsidenten zu tun, und ironischerweise ist Trump ausgerechnet der Präsident, dem er zur Wahl verholfen haben soll (was er allerdings leugnet). Der russische Staatschef wirkt im Gespräch so, als hätten ihn seine erfolglosen Versuche, endlich zur amerikanischen Führung durchzudringen, ein wenig zermürbt. Er behauptet, dass die Politiker oder vielmehr die hinter ihnen stehende Bürokratie Russland einfach nicht als Partner ansehen wollen – ein Wort, das er selbst häufig in Bezug auf die Vereinigten Staaten benutzt, wenn auch nicht ohne eine Spur Sarkasmus. Stattdessen behandle man sein Land in den USA stets nur als bequemen Sündenbock für das eigene Versagen.
Am Ende des dritten Interviews stellt Putin Stone die Frage, ob er nie geschlagen worden sei. »Oh doch, oft«, versichert ihm Stone darauf. Und Putin antwortet ihm, wobei er sich auf die geplante Ausstrahlung der Dokumentation bezieht: »Dann wird das für Sie ja nichts Neues sein – weil Sie für das, was Sie vorhaben, garantiert einiges einstecken werden müssen.«
Diese Vorhersage ist schmerzlich, aber angesichts des derzeitigen Klimas der weitverbreiteten öffentlichen Verurteilung für den bisher unbewiesenen Vorwurf, Russland habe sich in die US-Wahlen eingemischt, durchaus korrekt. Und Stone sagt darauf: »Ich weiß, aber das ist es wert … schon wegen des Versuchs, der Welt etwas mehr Frieden und Bewusstheit zu bringen.«
Robert Scheer
Erstes Interview
Erste Reise • Erster Tag • 2. Juli 2015
Erste Reise
Erster Tag 2. Juli 2015
Putins Vorgeschichte
OS:Ich glaube, die meisten Menschen im Westen wissen nicht viel über Sie, abgesehen von dem, was in den Nachrichten gebracht wird. Wir würden gern etwas über Ihren Hintergrund erfahren und verstehen, woher Sie kommen. Ich weiß, dass Sie im Oktober 1952 geboren wurden, nach dem Krieg, und dass Ihre Mutter Fabrikarbeiterin war und Ihr Vater im Krieg gekämpft hat. Aber was er nach dem Krieg gemacht hat, weiß ich nicht. Bekannt ist auch, dass Sie als Heranwachsender mit anderen Familien in einer Gemeinschaftswohnung lebten.
WP: Meine Mutter hat nicht in einer Fabrik gearbeitet. Sie war zwar Arbeiterin, aber in verschiedenen Berufen tätig. Ich war ein Einzelkind, meine Eltern hatten vor mir zwei Kinder verloren – eines im Krieg, während der Leningrader Blockade 1 . Da sie mich nicht in ein Waisenhaus stecken wollten, arbeitete meine Mutter als Hausmeisterin.
OS:Weil sie Sie nicht weggeben wollte?
WP: Richtig. Und mein Vater arbeitete in einem Werk – einer Fabrik.
OS:Was machte er dort genau?
WP: Er war Ingenieur. Er hatte einen Hochschulabschluss, eine Berufsausbildung und arbeitete in einer Fabrik.
OS:War es eine feste Arbeit oder eine Reihe von Gelegenheitsjobs? War er fest angestellt?
WP: Ja, er war fest angestellt, würde ich meinen. Er war schon sehr lange berufstätig. Auch nach seiner Pensionierung arbeitete er noch weiter, bis er etwa 70 war.
OS:Aber er ist im Krieg verwundet worden, oder?
WP: Das stimmt, ja. Bei Kriegsbeginn diente er in einer Spezialeinheit. Das waren kleine Partisanengruppen, die Einsätze hinter den feindlichen Linien durchführten. Zwanzig Mann gehörten seiner Gruppe an, und nur vier kehrten aus dem Einsatz zurück.
Er hat mir davon erzählt. Später, als ich dann Präsident war, bekam ich Zugriff auf die Archive und konnte so seine Kriegsgeschichten bestätigen. Sehr seltsam, wie sich alles fügt … Später kämpfte er als Rotarmist in einem der gefährlichsten Leningrader Frontgebiete. Das war der »Newski pjatatschok« – der Brückenkopf. Bei den Kampfhandlungen am Newa-Ufer war es der sowjetischen Armee gelungen, einen kleinen Brückenkopf von 2 mal 4 Kilometern Größe zu halten.
OS:Ihr älterer Bruder starb wenige Tage – glaube ich – oder wenige Monate nach Ihrer Geburt …
WP: Nein, er verstarb während der Leningrader Blockade. Er war keine 3 Jahre alt. Damals wollte man Kinder retten, indem man sie ihren Familien abnahm und anderswo versorgte, damit sie überleben konnten. Doch mein Bruder wurde krank und starb. Man informierte meine Eltern nicht einmal darüber, wo er begraben lag. Durch einen seltsamen Zufall gelang es ein paar interessierten Personen vor Kurzem, etwas darüber in den Archiven zu finden. Sie arbeiteten mit dem Nachnamen des Kindes, dem Namen seines Vaters und der Adresse, von der man das Kind abgeholt hatte. So konnten sie einige Dokumente über den Tod meines Bruders, sein Grab und das Waisenhaus entdecken, in das man ihn gebracht hatte. Vergangenes Jahr habe ich seine Grabstätte in Sankt Petersburg zum ersten Mal besucht.
OS:Ihr Vater und Ihre Mutter müssen es trotz der vielen Todesopfer im Zweiten Weltkrieg geschafft haben, nicht an diesen Tragödien zu zerbrechen. Der dritte Sohn stellte wahrscheinlich eine neue Hoffnung für sie dar.
WP: Sie sind nicht daran zerbrochen, das ist wahr. Aber der Krieg war 1945 zu Ende, und ich kam erst 1952 zur Welt. Das war eine sehr schwierige Zeit für einfache Menschen, die an die Sowjetunion glaubten. Und sie entschieden sich trotzdem dafür, noch ein Kind in die Welt zu setzen.
OS:Wie man hört, hatten Sie ein kleines Problem mit Jugendkriminalität. Sie sollen ein ziemlich wildes Kind gewesen sein, bis sie dann mit 12 Jahren anfingen, Judo-Unterricht zu nehmen.
WP: Auch das ist richtig. Meine Eltern bemühten sich zwar um meine Erziehung, so gut sie konnten, aber trotzdem … Ich war viel im Freien, dauernd im Hof und auf den Straßen unterwegs. Und ich war mit Sicherheit nicht immer so diszipliniert, wie manche mich gern gesehen hätten. Erst die Tatsache, dass ich systematisch Sport auszuüben begann und Judo lernte, veränderte mein Leben entschieden zum Besseren.
OS:Man hat mir auch gesagt, dass Ihr Großvater väterlicherseits für Lenin und Stalin gekocht hat.
WP: Ebenfalls eine Tatsache … die Welt ist halt klein. Vor der Russischen Revolution im Jahr 1917 war er in einem Restaurant in Petrograd tätig, also in Leningrad. Er war Küchenchef, ein Koch. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass er für jemanden von Lenins Format kochte. Später arbeitete er tatsächlich auf dem Land und kochte auch für Stalin, der dort wohnte. Er war ein sehr einfacher Mann, ein Koch eben.
OS:Hat er Ihnen Geschichten über diese Zeit erzählt?
WP: Nein. Er hat mir nie etwas erzählt. Aber um ehrlich zu sein: Ich verbrachte einen Teil meiner Kindheit in der Oblast Moskau. Wir wohnten in Sankt Petersburg, das damals noch Leningrad hieß. Im Sommer besuchten wir aber immer für ein paar Wochen meinen Großvater, der längst im Ruhestand war, aber immer noch an seinem ehemaligen Arbeitsplatz wohnte, in einer staatlichen Datscha. Und mein Vater erzählte mir, wie er früher seinen Vater besuchte und dieser ihm Stalin von Weitem gezeigt hat. Mehr weiß ich auch nicht.
OS:Da haben wir ja etwas gemeinsam! Mein Großvater mütterlicherseits war im Ersten Weltkrieg ein französischer Soldat. Er arbeitete auch als Koch, allerdings in den Schützengräben. Und er erzählte mir viele Geschichten über den Ersten Weltkrieg und wie hart die Zeit damals war.
WP: Ja, meine Mutter erzählte mir auch weiter, was ihr Vater über den Ersten Weltkrieg berichtet hat. Er hat ebenfalls in diesem Krieg gekämpft und dabei unter anderem menschlich sehr interessante Dinge erlebt. Mein Großvater war in den Schützengräben und erzählte nach dem Krieg eine Geschichte. Er sah, dass ein österreichischer Soldat – das war an der Südfront, glaube ich – mit der Waffe auf ihn zielte. Aber mein Großvater war schneller und schoss zuerst. Der Österreicher war getroffen und stürzte zu Boden. Mein Großvater sah, dass er noch am Leben war. Es war kein Mensch außer ihm in der Nähe, und der Österreicher verblutete. Er war dem Tod geweiht. Mein Großvater kroch zu ihm hinüber, nahm seine Feldapotheke heraus und verband die Wunden des Feindes. Eine seltsame Geschichte. Seinen Verwandten erzählte er nur: »Ich hätte nicht zuerst geschossen, wenn ich nicht gesehen hätte, dass er schon auf mich zielte.« Aus welchem Land man auch stammt – wir sind alle gleich, wir sind alle menschliche Wesen. Diese Leute sind auch ganz normale Menschen, Arbeiter wie wir.
OS:Der Erste Weltkrieg war für Frankreich wohl genauso grausam und blutig wie für Russland. In diesem Krieg wurden 50 Prozent aller jungen Männer zwischen 17 und 35 Jahren getötet oder verletzt.2
WP: Das ist wahr.
OS:Sie schlossen die Oberschule ab und begannen dann sofort, Jura zu studieren. Das funktioniert im russischen Bildungssystem so, nehme ich an.
WP: Genau. Ich machte Abitur am Gymnasium in Leningrad und belegte dann gleich Jura an der Universität Leningrad.
OS:Und Sie hatten Ihren Uni-Abschluss bereits 1975 in der Tasche? Ganz schön schnell! Dann waren Sie Anwalt und lernten Ihre erste Frau kennen … ich meine, Ihre letzte Frau … also Ihre einzige Frau.
WP: Das kam erst später. Genauer gesagt, 7 Jahre später.
OS:Und ebenfalls im Jahr 1975 traten Sie in den KGB ein, auch in Leningrad.
WP: Ja. In Wirklichkeit war es so, dass es in sowjetischen Hochschuleinrichtungen eine Zuteilung von Arbeitsplätzen gab. Wenn man fertig studiert hatte, wurde von einem erwartet, dass man sich beim zugewiesenen Arbeitgeber meldete.
OS:Aha – Sie hatten also gar keine Wahl?
WP: Ich werde es Ihnen genauer erklären. Ich war durch die Arbeitsplatzzuteilung verpflichtet, dorthin zu gehen, und wurde auch auf Anhieb aufgenommen. Aber ich wollte auch zum KGB. Ich hatte eigentlich nur Jura studiert, weil ich später einmal für den KGB arbeiten wollte. Als ich noch ein Schüler war, bin ich sogar einmal ganz alleine zum KGB-Büro in Leningrad gegangen und habe mich erkundigt, was ich tun müsse, um für den Dienst arbeiten zu können. Der dortige Mitarbeiter hat mir gesagt, ich bräuchte dazu ein Hochschulstudium und eine juristische Ausbildung. Deswegen habe ich mich dann für das Jurastudium entschieden.
OS:Ich verstehe.
WP: Aber natürlich erinnerte sich nach Abschluss meines Studiums beim KGB kein Mensch mehr an mich, weil ich zwischendurch keinerlei Kontakt mehr dorthin gehabt hatte. Als uns die Arbeitsplätze zugeteilt wurden, rechnete ich wirklich nicht damit, dass der KGB mich entdeckte und mir eine Beschäftigung anbot.
OS:Und Sie schwärmten für die sowjetischen Filme über den KGB und die Geheimdienstarbeit.
WP: Genau das.
OS:Filme mit Tichonow und Georgi … so hießen die Schauspieler, glaube ich.
WP: Es gab viele Bücher und Filme mit solchen Geschichten. Für die schwärmte ich wirklich, das haben Sie treffend formuliert.
OS:Von 1985 bis 1990 waren Sie in Dresden stationiert, aber die ersten 10 Jahre zum Großteil in Leningrad – ist das richtig?
WP: Ja, genau. In Leningrad und auch in Moskau, in speziellen Ausbildungsstätten.
OS:Und Sie schlugen sich gut und machten schnell Karriere.
WP: Im Großen und Ganzen, ja.
OS:Aber Ostdeutschland muss zwischen 1985 und 1990 ziemlich trostlos gewesen sein …
WP: Trostlos nicht unbedingt. In dieser Zeit spielten sich in der Sowjetunion Ereignisse ab, die mit der Perestroika zu tun hatten. 3 Ich glaube, darauf müssen wir nicht näher eingehen. Es gab alle möglichen Probleme im Zusammenhang mit der Perestroika – aber zugleich eine besondere Stimmung, den Geist der Neuerung. Und als ich nach Ostdeutschland, also in die Deutsche Demokratische Republik kam, war von dieser Neuerung nichts zu spüren.
OS:Genau das habe ich gemeint.
WP: Man hatte den Eindruck, dass das System dort in den 1950er-Jahren stecken geblieben war.
OS:Kommen wir zurück zu Gorbatschow, mit dem Sie ja persönlich nicht viel zu tun hatten. Es gab ein deutliches Reformstreben, aber Sie waren nicht in Moskau und bekamen das daher nicht direkt mit. Das muss eine seltsame Zeit für Sie gewesen sein. Sind Sie nach Moskau zurückgegangen? Haben Sie die Perestroika selbst erlebt?
WP: Gorbatschow und seine Gefolgschaft begriffen durchaus, dass das Land dringend Veränderungen nötig hatte. Heute kann ich aber mit großer Sicherheit sagen, dass sie nicht begriffen haben, welche Veränderungen anstanden und wie man sie hätte durchsetzen sollen.
OS:Okay.
WP: Und darum haben sie viele Dinge getan, die dem Land großen Schaden zugefügt haben, auch wenn sie gut gemeint waren und der Wandel wirklich notwendig war.
OS:Ich habe Gorbatschow einige Male getroffen, als er in den USA war, aber auch hier in Russland. Er hat etwas mit Ihnen gemeinsam, weil auch er im kommunistischen System hochgekommen ist. Er hat sehr bescheiden angefangen, als Landwirtschaftsexperte. Er sah sich die verfügbaren Unterlagen an, arbeitete sehr konzentriert und scheint recht früh erkannt zu haben, wie er in seinen Memoiren schreibt, dass die Wirtschaft wegen diverser Probleme nicht funktionieren konnte. Das System funktionierte nicht.
WP: Wir alle haben etwas gemeinsam, weil wir Menschen sind.
OS:Ja, aber worauf ich hinaus will: Er war ebenfalls ein Arbeiter. Er war sehr genau und stellte konkrete Fragen, zum Beispiel: Wie lässt sich das System reparieren?
WP: Ich war kein Arbeiter. Aber ich glaube, dass eben diese Genauigkeit und Konkretheit einem Großteil der früheren sowjetischen Führung – einschließlich Gorbatschow – fehlten. Sie wussten nicht, was sie wollten oder was für die notwendigen Reformen erforderlich war.
OS: Okay. Aber im August 1991 kam es zu einem Staatsstreich der Kommunisten4, und Sie traten am zweiten Tag dieses Staatsstreichs von Ihrem Posten zurück.
WP: Es war ein Putschversuch. Und ich trat tatsächlich zurück, am zweiten oder dritten Tag, das weiß ich nicht mehr genau. Als ich aus Deutschland zurückgekehrt war, arbeitete ich eine Zeit lang an der Universität. Ich war aber nach wie vor KGB-Offizier im Außengeheimdienst. Danach bot mir Anatoli Sobtschak, der frühere Bürgermeister von Sankt Petersburg, eine Stelle an. 5 Das Gespräch war ziemlich seltsam, weil Sobtschak während des Studiums einer meiner Professoren war und mich jetzt in sein Kabinett einlud.
OS:Das war nach dem Putsch. Aber warum sind Sie währenddessen zurückgetreten? Es ging doch um Ihre Karriere.
WP: Ich werde Ihnen alles genau erzählen. Als Sobtschak mir den Posten anbot, antwortete ich ihm, dass ich sehr an einer Zusammenarbeit mit ihm interessiert sei. Aber ich hielt die Idee trotzdem für undurchführbar und auch nicht für richtig. Schließlich war ich nach wie vor ein Offizier des KGB-Außengeheimdiensts. Und Sobtschak war ein prominenter Anführer der demokratischen Bewegung – ein Politiker der neuen Welle. Ich sagte ihm sehr direkt, dass es schädlich für seinen Ruf wäre, wenn jemand erführe, dass ich als ehemaliger KGB-Offizier an seiner Seite arbeite. In Russland gab es ja damals heftige politische Unruhen. Umso mehr überraschte mich Sobtschaks Reaktion, weil er einfach sagte: »Das ist mir egal.« Ich war also für sehr kurze Zeit als sein Berater tätig. Und dann, als der Putschversuch kam, befand ich mich plötzlich in einer sehr zwiespältigen Lage.
OS:Im August ’91?
WP: Ja, bei diesem gewalttätigen Staatsstreich. Da konnte ich einfach nicht mehr KGB-Offizier und gleichzeitig enger Berater des demokratisch gewählten Bürgermeisters von Sankt Petersburg sein. Deswegen bin ich von meinem Posten zurückgetreten. Sobtschak rief den Leiter des KGB für die gesamte UdSSR an und ersuchte ihn, mich gehen zu lassen. Ein paar Tage später kam die Zustimmung für den offiziellen Beschluss zu meinem Austritt aus dem KGB.
OS:Glaubten Sie zu dieser Zeit noch an den Kommunismus und das sowjetische System?
WP: Mit Sicherheit nicht. Aber am Anfang glaubte ich schon daran. Ich hielt die Idee für gut und wollte sie umsetzen.
OS:Und wann hat sich das geändert?
WP: Bedauerlicherweise ändern sich meine Ansichten nicht dann, wenn ich mit neuen Ideen konfrontiert werde, sondern nur, wenn ich mich neuen Umständen gegenübersehe. Es wurde immer deutlicher, dass das System nicht effizient und in einer Sackgasse angelangt war. Es gab kein Wirtschaftswachstum mehr. Das politische System stagnierte, war erstarrt und nicht mehr zur Weiterentwicklung fähig. Wenn eine politische Kraft, eine einzige Partei, in einem Land ein Monopol hat, ist das schädlich und gefährlich.
OS:Aber das sind Gorbatschows Ideen. Waren Sie also doch von Gorbatschow beeinflusst?
WP: Das sind keineswegs Gorbatschows Ideen, sondern vielmehr Ideen des französischen utopischen Sozialismus 6 , mit denen Gorbatschow nicht das Geringste zu tun hatte. Ich wiederhole – sein Verdienst ist es, dass er die Notwendigkeit von Veränderungen erkannt hat. Er versuchte, das System zu verändern. Oder vielmehr nicht zu verändern, sondern es zu sanieren und zu revidieren. Das Problem dabei war, dass dieses System aber von Grund auf ineffizient war. Und wie kann man ein System radikal verändern und dabei den Staat aufrechterhalten? Das wusste damals niemand, auch Gorbatschow nicht. Deshalb führten er und seine Leute das Land auch an den Rand des Zusammenbruchs. 7
OS:Ja, das muss eine traumatische Erfahrung gewesen sein. Die Sowjetunion brach zusammen, und Jelzin gründete die Russische Föderation. Ich war Anfang 1992 in Sankt Petersburg und lernte dort Sobtschak kennen. Vielleicht haben wir uns auch damals schon kennengelernt, wenn Sie zu dieser Zeit sein Assistent waren.
WP: Daran kann ich mich nicht erinnern. Aber ich kann Ihnen sagen, dass Sobtschak ein absolut loyaler und ehrlicher Mensch war. Vom ideologischen Standpunkt her war er ein Demokrat, doch er wandte sich kategorisch gegen die Auflösung der Sowjetunion.
OS:Er war gegen die Auflösung, das stimmt. Und es war eine wilde, aufregende Zeit. Man hatte das Gefühl, dass hier etwas Neues entstand, von dem niemand wusste, wohin es sich entwickeln würde. Es gab Gangster, es gab … die Menschen waren anders, trugen neue Kleider. Als ich 1983 während der Breschnew-Ära die Sowjetunion besuchte, fand ich sie äußerst deprimierend. Mein nächster Besuch 7 oder 8 Jahre später war unglaublich für mich. Sobtschak lud uns in ein Luxusrestaurant ein, wo wir einen wunderbaren Abend verbrachten.
WP: Aber zur selben Zeit, als die schicken Restaurants aufmachten, wurde das russische Sozialversicherungssystem komplett zerstört. Ganze Wirtschaftszweige hörten zu funktionieren auf. Die öffentliche Gesundheitsversorgung lag in Trümmern. Die russischen Streitkräfte waren in einem bedauernswerten Zustand, und Millionen Menschen lebten unterhalb der Armutsgrenze. Das darf man auch nicht vergessen.
OS:Ja, das war die andere Seite. Sie übersiedelten dann 1996 nach Moskau und waren dort für 13 Monate Direktor des Inlandsgeheimdienstes.
WP: Nein, nicht sofort. Ich zog nach Moskau und sollte anfangs eigentlich für die Regierung Jelzin arbeiten. Also war ich erst für rechtliche Angelegenheiten zuständig und wurde danach in die Verwaltung übernommen. Ich war Vizechef der Präsidialverwaltung und beaufsichtigte die Regierung sowie die Regionalverwaltungen. Erst danach wurde ich zum Direktor des Inlandsgeheimdiensts FSB (Federalnaja Sluschba Besopasnosti) ernannt.
OS:In dieser Rolle mussten Sie dann ja direkt gesehen haben, welches Chaos im Staat herrschte. Es war wahrscheinlich ein einziger Albtraum.
WP: Ja, das war es. Ich höre oft, dass Kritik an mir geäußert wird. Gewisse Leute behaupten, ich würde den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauern. Dazu muss man sagen, dass sich nach Auflösung der Sowjetunion 25 Millionen Russen im Handumdrehen im Ausland befanden, in einem anderen Land.
Das ist eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Es geht um Menschen, die in einem Land lebten, die dort Verwandte, eine Arbeit, Wohnungen und gleiche Rechte hatten. Und plötzlich fanden sie sich im Ausland wieder. Dort gab es von Anfang an bestimmte Anzeichen für das, was bevorstand – und dann kam es zu ausgewachsenen Bürgerkriegen. Das alles habe ich persönlich gesehen, vor allem in meiner Rolle als Direktor des FSB.
OS:1999 machten Sie dann einen weiteren Karrieresprung – zum Ministerpräsidenten. Jelzin legte am 31. Dezember 1999 sein Amt nieder. Wenn man sich Pressekonferenzen und andere Filmaufnahmen von ihm ansieht, ist ganz offensichtlich, dass er alkoholkrank war. Das muss sich auf sein Gehirn ausgewirkt haben. So wie er sich bewegte und in die Kamera starrte, wirkte er katatonisch.
WP: Ich glaube nicht, dass ich das Recht habe, Urteile abzugeben – weder über Gorbatschow noch über Jelzin. Ich habe schon gesagt, dass Gorbatschow nicht wusste, was zu tun ist, was die Zielsetzungen waren und wie man sie erreichen konnte. Trotzdem unternahm er als Erster einen Schritt, um dem Land seine Freiheit zu schenken, und das war ein historischer Durchbruch. Dies ist eine ganz offensichtliche Tatsache – und für Jelzin gilt dasselbe. Er hatte seine Probleme, so wie jeder von uns, aber er hatte auch seine guten Seiten. Eine davon war, dass er sich niemals vor der Verantwortung drücken wollte; er hat nie versucht, sich seiner persönlichen Verantwortung zu entziehen. Er wusste, wie man Verantwortung übernimmt, auch wenn er mit Sicherheit seine Dämonen hatte. Aber es stimmt, was Sie gesagt haben. Das ist kein Geheimnis, sondern die Realität.
OS:Nur aus Neugier, weil ich die Geschichte kenne, wie Chruschtschow mit Stalin trinken musste … haben Sie abends auch manchmal mit Herrn Jelzin einen getrunken?
WP: Nein, nie. Ich stand ihm nicht so nahe, wie man vielleicht annehmen könnte. Ich war nie einer der engsten Berater von Gorbatschow oder Jelzin. Es kam absolut überraschend für mich, als er mich zum Direktor des FSB ernannte. Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass ich nie Alkohol missbraucht habe. Ich habe Jelzin immer nur im beruflichen Umfeld getroffen. Und ich habe ihn bei der Arbeit nie betrunken erlebt.
OS:Verkatert vielleicht?
WP: Das habe ich nie überprüft. Ich habe nicht einmal versucht, eine Alkoholfahne an ihm zu riechen. Das ist mein Ernst. Ich war nie mit ihm jagen, wir verbrachten nie privat Zeit miteinander. Wir kamen nur in seinem Büro zusammen, das war alles. Ich habe nie auch nur ein Glas Wodka mit ihm getrunken.
OS:Wahnsinn. Die Ministerpräsidenten kamen und gingen … und plötzlich waren Sie Ministerpräsident. Nicht schlecht.
WP: Ja, das war schon eine seltsame Geschichte. Wie Sie richtig sagten, bin ich 1996 aus Leningrad nach Moskau gekommen. Und im Großen und Ganzen hatte ich in Moskau keine starke Unterstützung, keine Kontakte. Trotzdem war ich keine 4 Jahre später, am 1. Januar 2000, amtierender Präsident. Eine unglaubliche Geschichte.
OS:Ja, wirklich.
WP: Trotzdem muss ich darauf bestehen, dass ich keine besondere Beziehung zu Jelzin oder jemandem aus seinem Team hatte.
OS:Vielleicht wurde gerade ein anderer Ministerpräsident gefeuert, und Jelzin sagte: »Okay, dann übernimmst du diesen Job.«
WP: Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich versuchte er jemand Geeigneten zu finden, weil er schon beschlossen hatte, sein Amt niederzulegen. Tatsächlich waren mehrere Ministerpräsidenten ernannt worden und dann wieder zurückgetreten. Ich weiß nicht, warum er sich ausgerechnet für mich entschieden hat. Es hat vor mir sehr begabte Ministerpräsidenten gegeben – einer von ihnen ist vor Kurzem verstorben. Als Jelzin mir den Posten zum ersten Mal anbot, habe ich abgelehnt.
OS:Sie haben abgelehnt? Warum?
WP: Ja. Es war im benachbarten Büro. Er hatte mich zu sich gebeten und mir gesagt, dass er mich zum Ministerpräsidenten ernennen wollte. Danach sollte ich mich für das Amt des Präsidenten bewerben. Ich antwortete, dass das eine sehr große Verantwortung sei und ich dafür mein ganzes Leben ändern müsse. Und ich war mir nicht sicher, ob ich das auch wirklich wollte. Er sagte nur: »Darüber sprechen wir noch.«
OS:In welcher Hinsicht mussten Sie dafür Ihr Leben ändern? Sie waren doch schon längere Zeit Regierungsbeamter.
WP: Das ist trotzdem etwas ganz anderes. Als Beamter, sogar als hoher Beamter, kann man ein beinahe normales Leben führen. Man kann Freunde treffen, ins Kino oder ins Theater gehen, ganz offen mit Freunden sprechen. Und man muss nicht die Verantwortung für das Schicksal von Millionen Menschen und alles, was in einem Land passiert, übernehmen. Und es war damals eine sehr große Herausforderung, die Verantwortung für Russland zu übernehmen. Dazu kommt, dass Boris Jelzin meine Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten im August 1999 vorschlug und das Parlament zustimmte. Im selben Monat – August – begann der Zweite Tschetschenien-Krieg 8 und stellte das Land auf eine harte Probe. Offen gesagt wusste ich damals nicht, welche Pläne Präsident Jelzin für mich hatte. Aber ich stand eben vor dieser Situation und musste die Verantwortung dafür übernehmen. Und ich wusste nicht, wie lange ich auf diesem Posten durchhalten würde. Schließlich hätte Präsident Jelzin auch jeden Augenblick zu mir sagen können: »Sie sind entlassen.« Es gab nur eines, woran ich damals denken konnte: Wo soll ich meine Kinder verstecken?
OS:Wirklich? Und was würden Sie in einer solchen Situation tun?
WP: Was glauben Sie? Die Situation war äußerst angespannt – stellen Sie sich vor, man hätte mich entlassen. Ich hatte keine Leibwächter, also was hätte ich tun sollen? Wie hätte ich für die Sicherheit meiner Familie sorgen sollen? Zu diesem Zeitpunkt beschloss ich: Wenn dies mein Schicksal ist, dann muss ich es bis zum Ende durchziehen. Ich wusste damals noch nicht, dass ich bald Präsident sein würde. Dafür gab es keine Garantie.
OS:Darf ich fragen, ob Sie je bei Treffen mit Jelzin und irgendwelchen Oligarchen dabei waren?
WP: Ja, sicher war ich das.
OS:Also haben Sie gesehen, wie er mit diesen Leuten umgegangen ist?
WP: Natürlich. Es war alles sehr amtlich und pragmatisch. Jelzin hat sie nicht als Oligarchen getroffen, sondern als Vertreter großer Unternehmen – als Menschen, von deren Tätigkeit das Schicksal von Millionen Menschen abhing und die sehr viele Arbeitskräfte beschäftigten.
OS:Hatten Sie das Gefühl, dass die Oligarchen mit Jelzin tun konnten, was sie wollten?
WP: Ja, aber das hat er selbst nicht begriffen. Boris Jelzin war ein höchst dis-tanzierter Mensch. Wenn ihm in Hinblick auf dieses oligarchische Regierungssystem etwas vorzuwerfen ist, dann nur seine Vertrauensseligkeit. Ansonsten hatte er keinerlei Beziehungen zu Oligarchen, und er verschaffte sich durch sie auch keine persönlichen Vorteile.
OS:Hatten Sie mit Leuten wie Beresowski auch persönlich zu tun?9
WP: Ja, sicher. Ich kannte Beresowski schon, bevor ich nach Moskau ging.
OS:In welchem Verhältnis standen Sie zu ihm? Waren Sie befreundet?
WP: Nein, wir hatten keine freundschaftlichen Beziehungen zueinander. Ich habe ihn kennengelernt, weil ich damals in Sankt Petersburg tätig war und wir aus Moskau aufgefordert wurden, jemanden vom US-Senat – wenn ich mich richtig erinnere – zu empfangen. Der Senator kam mit einer Maschine aus Tiflis und wollte sich mit Sobtschak treffen. Da ich Beauftragter der Stadt für auswärtige Beziehungen war, sollte ich das Treffen organisieren. Ich erstattete Sobtschak Bericht, und er stimmte zu. Also trafen wir uns offiziell mit diesem Senator, der in Begleitung Beresowskis aus Tiflis angereist war. So lernten wir uns kennen. Ich weiß noch, dass Beresowski während der Zusammenkunft eingeschlafen ist.
OS:Beresowski war ein intelligenter Mensch. Wahrscheinlich hat er Sie abgeschätzt, genauer betrachtet und sich überlegt, wie er mit Ihnen umgehen soll oder Geschäfte machen könnte. Menschenkenntnis kann ja in beide Richtungen funktionieren.
WP: Das glaube ich nicht. Ich war ja damals nur Sobtschaks Assistent. Wenn Beresowski über etwas nachdachte, dann höchstens darüber, wie er seine Beziehung zu Sobtschak pflegen könnte – aber sicher nicht über mich.
OS:Na gut, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2000. Es ist eine düstere Zeit. Sie sind jetzt Präsident und haben die Wahl mit 53 Prozent der Stimmen gewonnen. Niemand rechnet ernsthaft damit, dass Sie lange in dieser Position durchhalten werden. Sie regieren ein Land, das gerade viel durchmacht. Der Tschetschenien-Krieg tobt, und es sieht nicht gut aus für Russland. Alles wird privatisiert, die Oligarchen werden immer mächtiger. Aber Sie stellen sich gegen diese Dinge. Ich habe mir Dokumentationen angesehen, die Ihren Kampf genau zeigen. Das muss ein wirklich hartes Ringen für Sie gewesen sein – eine der schwärzesten Zeiten Ihres Lebens.
WP: Ja, das … stimmt genau. Doch diese schwierige Zeit begann nicht im Jahr 2000, sondern viel früher. Meiner Ansicht nach ging es schon Anfang der 1990er-Jahre los, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, und lief bis 2000 so. 1998 erlebte das Land eine Krise, eine sehr schwere Wirtschaftskrise. 1999 begann der Zweite Tschetschenien-Krieg, ich wurde Ministerpräsident, und das Land steckte in einer sehr schwierigen Lage. So sah es damals aus.
OS:Sind Sie deshalb um 4 Uhr früh schweißgebadet erwacht? Konnten Sie überhaupt schlafen? Wie haben Sie sich gefühlt, wenn Sie nachts wach lagen?
WP: Ich bin nie um 4 Uhr früh aufgewacht. Ich ging um Mitternacht schlafen und wachte um sieben oder so auf. Ich schlief immer 6 bis 7 Stunden.
OS:Sehr diszipliniert. Und keine Albträume?
WP: Nein.
OS:Wirklich? Stammt diese Disziplin aus Ihrer Militärzeit, aus der Zeit beim KGB?
WP: Ich glaube, ich habe sie dem Sport und auch dem Militärdienst zu verdanken.
OS:Sie sind sehr diszipliniert.
WP: Wenn man das nicht ist, erschwert es die Arbeit ungemein. Ohne Disziplin hat man keine Kraft, sich um aktuelle Problemstellungen zu kümmern, geschweige denn um strategische Fragen. Man muss sich immer fit halten.
OS:Ja, aber haben Sie in dieser Zeit Ihre Kinder überhaupt gesehen? Und Ihre Frau?
WP: Ja, sicher. Aber immer nur für kurze Zeit.
OS:Regelmäßig? Haben Sie gemeinsam mit ihnen gegessen? Und sie jeden Abend gesehen?
WP: Ich kam sehr spät nach Hause und ging sehr früh zur Arbeit. Natürlich habe ich sie gesehen, aber eben nur sehr kurz.
OS:Und wann sind Ihre Eltern gestorben? Auch in dieser Zeit?
WP: Meine Mutter starb 1998, mein Vater 1999.
OS:Das muss sehr schwierig für Sie gewesen sein – zusätzlich zu all den anderen Problemen.
WP: Meine Eltern waren die letzten 2 Jahre ihres Lebens in einem Krankenhaus. Ich flog jeden Freitag von Moskau nach Sankt Petersburg, um sie dort zu besuchen. Jede Woche.
OS:Übers Wochenende, und Sonntagabend wieder zurück? Oder wie?
WP: Nein, nur für einen Tag. Ich besuchte sie und flog dann wieder zurück nach Moskau.
OS:Waren Ihre Eltern stolz auf Sie?
WP: Ja.
OS:Ihre Mutter und Ihr Vater konnten es gar nicht glauben, stimmt’s?
WP: Das war wirklich der Fall. Mein Vater ist, 2 Monate bevor ich Ministerpräsident wurde, gestorben. Aber trotzdem hat er jedes Mal, wenn ich zu Besuch kam, zu den Schwestern gesagt: »Schaut, da kommt mein Präsident.«
OS:Das ist nett. Sehr nett. Es wird allgemein anerkannt, dass Sie in Ihrer ersten Amtszeit sehr viel Gutes getan haben. Sie setzten der Privatisierung ein Ende. Sie bauten Industrie- und Wirtschaftszweige aus – Elektronik, Maschinenbau, Petrochemie, Landwirtschaft und viele andere. Sie waren ein echter Sohn Russlands, darauf sollten Sie stolz sein. Sie sorgten für ein Anwachsen des Bruttoinlandsprodukts, erhöhten die Einkommen, reformierten das Militär und beendeten den Tschetschenien-Krieg.10
WP: Ganz so stimmt das nicht. Ich habe der Privatisierung kein Ende gesetzt, ich wollte sie nur gerechter und ausgewogener gestalten. Ich setzte mich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür ein, dass Staatseigentum nicht gratis verschleudert wird. Wir bereiteten einigen Machenschaften – manipulativen Machenschaften, die zum Machtzuwachs der Oligarchen führten – ein Ende. Es waren diese Machenschaften, durch die gewisse Leute im Handumdrehen zu Milliardären werden konnten. Und das sage ich mit allem gebotenen Respekt für Wassily Leontief, den Amerikaner russischer Herkunft, der den Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat. Als er noch am Leben war, habe ich ihn kennengelernt, seine Vorlesungen besucht und ihn sprechen gehört. Er sagte, dass Eigentum uneingeschränkt für einen Rubel verkauft werden darf. Dabei ging es ihm aber darum, dass dieses Eigentum in die Hände jener Leute gelangt, die es verdient haben – so dachte er darüber. Unter unseren Umständen, also den damaligen russischen Verhältnissen, führte diese Umverteilung des Eigentums aber nur dazu, dass sich eine bestimmte Kategorie von Leuten auf gesetzlich zulässige Art bereichern konnte. Und das bedeutete auch, dass die Regierung die Kontrolle über strategisch wichtige Industriezweige verlor oder diese Industriezweige einfach zerstört wurden. Mein Ziel war es also nicht, die Privatisierung zu beenden, sondern sie systematischer und fairer zu machen.
OS:Ich habe Filmaufnahmen aus den Jahren 2003 und 2004 von Ihnen und den Oligarchen gesehen. Muss eine ganz schön interessante Sitzung gewesen sein … Sie hatten aber auch heftige Zusammenstöße mit Beresowski und Leuten wie Chodorkowski.
WP: Keine Zusammenstöße. Ich sagte ihnen nur, dass sie alle äquidistant zur Regierung sein müssten – dieser Ausdruck war damals in Mode. Und ich sagte ihnen, dass sie ihren Besitz nur im Rahmen des geltenden Rechts zu erwerben bräuchten, dann würden wir auch nicht versuchen, ihnen diesen Besitz wegzunehmen. Aber Gesetze ändern sich, und auch sie müssten sich an die neuen Gesetze halten. Ich brachte zum Ausdruck, dass jeder Versuch, rückwirkend etwas am Ergebnis der Privatisierung zu ändern, der Wirtschaft des Landes mehr Schaden zufügen würde als die Privatisierung selbst. Aus diesem Grund würden wir auch damit weitermachen, wenn auch auf einer faireren Grundlage. Und wir würden alles in unserer Macht Stehende tun, diese Besitztümer und Eigentumsrechte zu sichern. Aber die Oligarchen mussten begreifen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Punkt. Dem hat seinerzeit auch niemand widersprochen.
OS:Sie haben die Armutsrate um zwei Drittel gesenkt?
WP: Das ist richtig.
OS:Respekt für alte Menschen. Erhöhung der Renten und Pensionen.
WP: Um ein Vielfaches.
OS:Im Jahr 2000 betrug das Durchschnittseinkommen 2700 Rubel. 2012 waren es bereits 29 000 Rubel.
WP: Auch das ist richtig.
OS:2004 waren Sie äußerst beliebt und wurden mit 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt.11
WP: Es waren sogar etwas mehr.
OS: Und 2008 wurden Sie – weil nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten als Präsident erlaubt sind – wieder Ministerpräsident, sozusagen der heimliche Herrscher. 2012 kandidieren Sie dann wieder für das Präsidentenamt und gewinnen die Wahl. Diesmal mit 63 Prozent der Wählerstimmen, glaube ich.
WP: Ja, das ist richtig.
OS:Drei Amtszeiten als Präsident also. Manche Leute würden sagen, dass Sie mit einer vierten Amtszeit sogar Franklin Delano Roosevelt in den Schatten stellen könnten …
WP: Er war viermal Präsident? 12
OS:Ja. Er konnte seine vierte Amtszeit zwar nicht mehr beenden, aber er war zweifellos ungeheuer beliebt. Und Sie werden ganz offensichtlich für vieles kritisiert. Man kritisiert Sie unter anderem dafür, dass Sie hart gegen die Presse vorgehen – aber darüber möchte ich heute Abend nicht mit Ihnen sprechen, sondern später einmal. Mir wird erst jetzt klar, dass Sie seit fast 15 Jahren Präsident sind. Das ist unglaublich.
WP: Nein, die ersten zwei Amtszeiten waren 2 mal 4, also 8 Jahre. Und jetzt wieder seit 2012 – das sind 10 Jahre.
OS:Na gut. Aber Sie haben auch als Ministerpräsident schwer gearbeitet.
WP: Ja, ich habe schwer und im Großen und Ganzen auch recht erfolgreich gearbeitet. Aber in diesem Zeitraum war jemand anders russischer Präsident, auch wenn man das im Ausland etwas anders sieht. Ich kann Ihnen versichern, dass Präsident Medwedew alle seine Aufgaben völlig unabhängig durchführte. Die russische Verfassung sieht hier eine Aufgabenteilung vor. Ich mischte mich nie in seinen Verantwortungsbereich ein. 13 Es gab bestimmte Themen, bei denen er es für notwendig erachtete, mich zurate zu ziehen, aber das kam sehr selten vor. Ansonsten erledigte er alles nach seinem eigenen Ermessen. Dazu kann ich Ihnen eine kuriose Geschichte erzählen: Bei der Amtseinführung von Präsident Medwedew 14 kamen wir – eine Handvoll Leute, die Medwedew nahestanden – hier zusammen, und einer der russischen Würdenträger hatte ein paar freundliche Worte für mich übrig. »Wir wissen alle, was los ist – dass Sie nach wie vor unser Präsident sind«, sagte er. Woraufhin ich mich an die Anwesenden wandte und entgegnete: »Danke für die schmeichelhaften Worte, aber bitte senden Sie keine falschen Signale an die Gesellschaft. Nur einer kann Präsident unseres Landes sein – die Person, die vom Volk gewählt wurde.«
OS:Schön und gut. Wie ich höre, haben Sie auch fünf Attentatsversuche überlebt. Nicht so viele wie Castro, den ich ebenfalls interviewt habe und bei dem es wahrscheinlich eher fünfzig waren, aber seriösen Meldungen zufolge waren es fünf.15
WP: Ja, auch ich habe mit Castro darüber geredet, und er fragte mich: »Wissen Sie eigentlich, wieso ich noch am Leben bin?« Ich sagte: »Nein, warum?« »Weil ich mich immer persönlich um meine Sicherheit gekümmert habe.« Im Gegensatz zu Castro mache ich meine Arbeit und lasse die Sicherheitskräfte die ihre tun – und die tun sie bislang ziemlich erfolgreich. Ich war in meiner Funktion recht erfolgreich und sie in ihrer.
OS:Sie haben sich also nicht an das Castro-Modell gehalten?
WP: Dafür sehe ich keine Notwendigkeit.
OS:Also vertrauen Sie Ihren Sicherheitsleuten und finden, dass sie gut arbeiten.
WP: Ja.
OS:Aber Sie wissen, dass die beliebteste Attentatsmethode – auch, als die USA Castro zu beseitigen versuchten – jene ist, einen Killer in die Sicherheitsmannschaft des Opfers einzuschleusen.
WP: Ja, das weiß ich. Aber wissen Sie, was man in Russland sagt? »Wer dafür bestimmt ist, gehängt zu werden, der wird nicht ertrinken.«
OS:Wie sieht Ihre Bestimmung aus? Wissen Sie das auch?
WP: Das weiß nur Gott. Nur Gott kennt unser Schicksal – Ihres und meines.
OS:Friedlich im Bett sterben vielleicht?
WP: Eines Tages ist es für jeden von uns so weit. Die Frage ist nur, was wir bis dahin in dieser vergänglichen Welt geleistet und ob wir unser Leben genossen haben.
OS:Ich habe noch für etwa 10 Minuten Fragen auf Lager, dann können wir für heute Abend Schluss machen.
In einer russischen Dokumentation über Sie war von der Eisbergtheorie die Rede. Die besagt, dass die meisten Menschen in Sachen Außenpolitik nur das oberste Siebentel des Eisbergs zu sehen bekommen – und nie die anderen sechs Siebentel unter Wasser. Und dass außenpolitische Angelegenheiten immer tückisch und in Wahrheit ganz anders sind, als sie scheinen.
WP: Es ist sehr kompliziert.
OS:Ich würde mich morgen und übermorgen gern mit Ihnen darüber unterhalten. Meiner Ansicht nach muss man unter die Oberfläche schauen, wenn man wissen möchte, was auf der Welt los ist.
WP: Ich glaube, man muss nur aufmerksam verfolgen, was auf der Welt passiert – dann wird man auch die Logik hinter den Ereignissen verstehen. Warum sind normale Menschen oft nicht auf dem Laufenden, was aktuelle Ereignisse betrifft? Warum halten sie all diese Dinge für kompliziert? Warum glauben sie, dass sich manches im Verborgenen abspielt? Das liegt einfach nur daran, dass normale Menschen genug damit zu tun haben, ihr Leben zu leben. Sie gehen jeden Tag zur Arbeit, verdienen sich ihren Lebensunterhalt und kümmern sich nicht um internationale Angelegenheiten. Und das ist genau der Grund, warum man normale Menschen so leicht manipulieren und in die Irre führen kann. Würden sie das verfolgen, was sich Tag für Tag auf der Welt abspielt, dann könnten sie auch das politische Geschehen leichter verstehen und die Logik hinter weltweiten Entwicklungen durchschauen, auch wenn ein Teil der Diplomatie sich immer hinter verschlossenen Türen abspielen wird. Man kann auch ohne Zugang zu Geheimdokumenten ein Verständnis internationaler Affären erlangen.
OS:Ich habe viel über Ihre erstaunlichen Arbeitsgewohnheiten gelesen. Sie lesen und lernen die ganze Zeit. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die ich vor Kurzem über John F. Kennedy gelesen habe. Er war ein aufregender und glanzvoller Präsident, aber er arbeitete auch sehr, sehr hart. Sein Bruder Robert Kennedy schrieb ein Buch mit dem Titel Dreizehn Tage, in dem es um die Kuba-Krise zwischen Chruschtschow und Kennedy geht. Das Erstaunliche an diesem Werk ist Kennedys Beschreibung der Arbeitsmoral seines Bruders, der jedes Dokument und jede Rede eines ausländischen Regierungschefs las, die er in die Hände bekam. Er kannte die Rede dann genau, nicht nur eine Zusammenfassung von der CIA, weil er diesem Geheimdienst ohnehin nicht traute. Nur so war es möglich, dass er seine eigenen Schlussfolgerungen über Chruschtschow ziehen und die Krise bereinigen konnte.
WP: Ich lese auch keine Zusammenfassungen. Ich lese immer nur die Originaldokumente. Ich arbeite auch nicht mit den Analysen, die mir die Geheimdienste zur Verfügung stellen, sondern nur mit einzelnen Dokumenten.
OS:Sehr interessant, das habe ich vermutet. Man sagt, dass sich Ihre Lebensphilosophie in den Grundbegriffen des Judo zusammenfassen lässt …
WP: Ja, mehr oder weniger. Meine Grundidee – der flexible Weg, sozusagen – ist auch die grundlegende Idee des Judo. Man muss flexibel sein. Manchmal kann man anderen auch nachgeben, wenn das der Weg ist, der schlussendlich zum Sieg führt.
OS:Andererseits gibt es da auch diese Rattengeschichte, von der Sie Mike Wallace erzählt haben: Sie sind, wahrscheinlich als kleiner Junge, mit einem Stock einer Ratte hinterhergejagt, und plötzlich hat die Ratte sich gegen Sie gestellt.
WP: Sie hat mich nicht gebissen, aber sie hat versucht, mich anzuspringen. Und plötzlich lief ich vor der Ratte davon. Immer eine Treppe, dann einen Treppenabsatz, immer weiter hinunter. Ich war zwar noch sehr klein, aber ich war immer noch schneller als die Ratte und konnte die Treppe hinunterrennen, auf dem Absatz scharf abbiegen und die nächste Treppe runterflitzen. Und wissen Sie, was die Ratte gemacht hat? Sie sprang von einer Treppe einfach auf die andere hinunter.
OS:Sie haben die Ratte mit Ihrem Stock verärgert, stimmt’s?
WP: Ja, ich glaube, das war der Fall.
OS:Ihrer und der Judo-Philosophie zufolge wäre es also ratsam, nicht zu stark zu attackieren – der Gegner mag zwar schwach aussehen, kann sich aber plötzlich gegen einen wenden.
WP: Damals besuchte ich noch keinen Judokurs. Und die Schlussfolgerung wäre in diesem Fall eine andere, glaube ich. Es gibt doch diesen berühmten Spruch: Treib eine Ratte nie in die Enge. Genau diesen Fehler habe ich gemacht. Man sollte nie jemanden in die Enge treiben. Niemand sollte in eine Situation gedrängt werden, die eine Sackgasse für ihn ist.
OS:Die Oligarchen haben Sie unterschätzt. Sie nahmen an, dass Sie nicht lange Präsident bleiben würden.
WP: Man sollte immer daran denken, dass nicht alle Oligarchen gleich sind. Manche von ihnen waren bereit, sich an die vorgeschlagenen Richtlinien über ihre Beziehung zur Regierung zu halten. Man versicherte ihnen, dass ihnen niemand ihr Eigentum wegnehmen wollte. Man sagte ihnen, dass die Regierung ihr Eigentum sogar schützen würde, und das, obwohl die früheren Gesetze ungerecht gewesen waren. Aber Gesetz ist Gesetz – und zwar immer. Auch das ist eine Regel, an die man sich halten muss.
OS:Gesetz ist Gesetz, bis sich das Gesetz ändert. Manchmal protestieren die Menschen dagegen. In Amerika entstanden aus den Protesten der Bürgerrechtsbewegung neue Gesetze zur Gleichstellung. Aus Protesten und zivilem Ungehorsam können auch gute Dinge entstehen.
WP: Das stimmt ebenfalls, aber unsere Situation war eine ganz andere. Ich bin der Meinung, dass die Privatisierungsgesetze Anfang der 1990er-Jahre ungerecht waren. Hätte ich aber jetzt wieder eine Entprivatisierung in die Wege geleitet, dann wäre das – wie gesagt – für die Wirtschaft und das Leben der einfachen Menschen noch schädlicher gewesen. Und genau das habe ich den Leitern der Großunternehmen in einer ehrlichen Aussprache auch gesagt. Ich teilte ihnen mit, dass wir die bisher bestehenden Programme auslaufen lassen würden und dass die Gesetze fairer und gerechter werden müssten. Ich sagte ihnen auch, dass die Wirtschaft mehr soziale Verantwortung übernehmen sollte. Und viele dieser Geschäftsmänner, die überwiegende Mehrheit, richteten sich nach den neuen Gesetzen. Wissen Sie, wer über die neuen Gesetze unglücklich war? Die Leute, die keine echten Geschäftsmänner waren, die ihre Millionen oder Milliarden nicht ihrer unternehmerischen Gabe verdankten, sondern einzig und allein ihrer Fähigkeit, gute Beziehungen zu den Behörden herzustellen. Diese Leute waren unzufrieden und lehnten die neuen Gesetze ab. Aber das waren nur wenige, im Großen und Ganzen hatten wir eine gute Beziehung zu den Wirtschaftstreibenden.
OS:Beenden wir diesen Abend mit einer kurzen Anmerkung zu Stalin. Sie haben sich negativ über Stalin geäußert, und er wird ja auch weltweit weithin verurteilt. Gleichzeitig weiß man aber, dass er im Krieg ein großartiger Staatslenker war. Er führte Russland zum Sieg über Deutschland und den Faschismus. Wie gehen Sie persönlich mit diesem Zwiespalt um?
WP: Sie sind ein durchtriebener Charakter!
OS:Warum? Wir können auch morgen darüber reden, wenn Sie wollen.
WP: Nein, ich kann das durchaus gleich beantworten. Es gab früher ja auch einen anderen prominenten Politiker: Winston Churchill. Der war entschieden gegen das Sowjetsystem, doch nach Beginn des Zweiten Weltkriegs setzte er sich stark für eine Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ein und nannte Stalin einen großen Kriegsherrn und Revolutionär. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann bekanntlich eben dieser Churchill, der den Kalten Krieg eröffnete. Als die Sowjetunion dann ihren ersten Atomtest durchführte, war es kein anderer als Winston Churchill, der plötzlich über die Notwendigkeit einer friedlichen Koexistenz zwischen zwei Systemen sprach. Er war ein äußerst flexibler Mensch. Ich glaube aber dennoch, dass er in seinem tiefsten Inneren die Einstellung gegenüber Stalin nie auch nur um ein Jota geändert hat.
Stalin war ein Produkt seiner Zeit. Man kann ihn einerseits verteufeln, so viel man will. Andererseits reden wir ja auch über seine glorreichen Verdienste im Kampf gegen den Faschismus. Und was die Verteufelung angeht – wir kennen auch eine historische Figur namens Oliver Cromwell. Der war ein sehr blutrünstiger Mann, der im Zuge einer Revolution an die Macht kam und sich zu einem Diktator und Tyrannen entwickelte. Trotzdem findet man heute noch in ganz Großbritannien Denkmäler zu seinen Ehren. Auch Napoleon wird nach wie vor vergöttert. Aber was hat er getan? Er bediente sich einer Welle revolutionärer Begeisterung, um an die Macht zu kommen. Dann führte er nicht nur die Monarchie wieder ein, sondern ernannte sich auch noch selbst zum Kaiser. Und er führte Frankreich in eine nationale Katastrophe, in die völlige Niederlage. Es gibt viele solche Situationen und Persönlichkeiten, mehr als genug in der gesamten Weltgeschichte. Ich glaube, dass die übermäßige Verteufelung Stalins nur eine der Methoden ist, die Sowjetunion und Russland anzugreifen. Man versucht damit, dem heutigen Russland einen Ursprung im Stalinismus unterzuschieben. Natürlich hat auch unser Land in Bezug auf seine Vergangenheit keine weiße Weste, aber damit müssen wir leben.
Was ich damit sagen will: Russland hat sich radikal verändert. Irgendetwas aus dieser Zeit hat sich sicher in unserer Mentalität festgesetzt, aber eine Rückkehr zum Stalinismus wird es nicht geben, weil sich die Mentalität des Volkes geändert hat. Als Stalin an die Macht kam, hatte er noch wunderbare Ideen, die er realisieren wollte. Er sprach von Gleichheit, Brüderlichkeit und Frieden … und dann wurde er zum Diktator. Ich glaube nicht, dass in dieser Lage etwas anderes möglich gewesen wäre. Damit meine ich die Weltlage. War es in Spanien, Italien oder Deutschland etwa besser? Es gab viele Staaten, deren Regierungen eine Gewaltherrschaft einsetzten.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Stalin nicht imstande gewesen wäre, das Volk der Sowjetunion zu vereinen. Er schaffte es, den Widerstand gegen den Faschismus zu organisieren. Und er verhielt sich dabei nicht wie Hitler, sondern hörte auf seine Generäle und ließ sich sogar einige Male von ihnen eines Besseren belehren. Das alles heißt natürlich nicht, dass wir die Gräueltaten des Stalinismus vergessen dürften – den Mord an Millionen unserer Landsleute, die Vernichtungslager. Die Erinnerung daran muss erhalten bleiben. Stalin ist eine zwiespältige Figur. Ich glaube, dass er gegen Ende seines Lebens in einer psychisch sehr schwierigen Lage war. Aber um dies mit Sicherheit sagen zu können, wäre eine unparteiische Studie nötig.
OS:Ihre Eltern haben Stalin bewundert, ist das richtig?
WP: Ja, sicher. Ich glaube, dass die überwiegende Mehrheit der damaligen Sowjetbürger ihn bewunderte. So wie die überwiegende Mehrheit der Franzosen einst Napoleon bewunderte – und viele das heute noch tun.
OS:Ich würde unser heutiges Gespräch gern mit einer persönlichen Note beenden. Ich habe Filmaufnahmen von Ihnen gesehen, auf denen Sie – es ist wirklich unglaublich! – etwas gelernt haben, mit dem Sie in Ihrer Jugend ganz sicher nichts zu tun hatten: Klavier spielen.
WP: Sicherlich. Ein Freund hat mir vor nicht allzu langer Zeit beigebracht, mit zwei Fingern ein paar sehr beliebte Melodien zu spielen.
OS:Ich finde es großartig, dass Sie in Ihrem Alter noch Lust haben, etwas Neues zu lernen. Ich habe Sie auch Ski fahren gesehen – wieder etwas, das Sie früher nie getan haben.
WP: Nein, ich war schon als Student Ski fahren. Aber das Eislaufen habe ich erst vor Kurzem erlernt.
OS:Ja, das habe ich gesehen – in Verbindung mit Eishockey.
WP: Als ich mit dem Eislaufen begann, vor ungefähr 2 Jahren, war mein erster Gedanke, dass ich diesen Sport nie beherrschen würde. Anfangs dachte ich nur: Wie bleibt man da stehen, wie hält man an?!
OS:Das verstehe ich. Haben Sie Angst, sich den Knöchel zu brechen? Oder machen Sie sich keine Sorgen um Verletzungen?