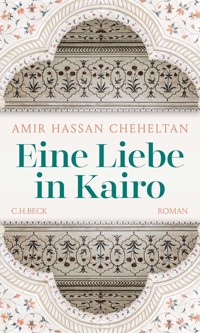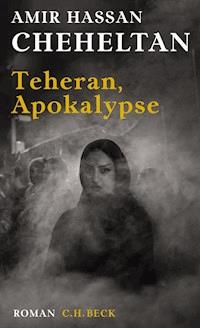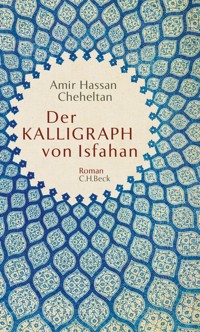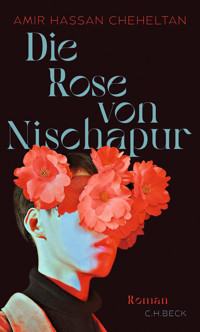
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Als sich David 2015 endlich seinen langjährigen Traum erfüllt und Iran bereist, ahnt er noch nicht, dass sein Leben bei der Rückkehr nach England ein anderes sein wird. In Teheran trifft er den Schriftsteller Nader und dessen Freundin Nastaran. Schnell entwickelt sich durch ihre leidenschaftlichen Gespräche eine innige Freundschaft, die schon bald gefährlich zu kippen droht. "Die Rose von Nischapur" ist ein bewegender Teheran-Roman über Begehren, Misstrauen und die Sehnsucht nach einer Freiheit, die unerreichbar scheint. Seit Jahren hat der junge Engländer David einen Traum: Er möchte Iran bereisen, die Heimat seines Lieblingsdichters Omar Khayyam. Doch das Land ist nach dem Arabischen Frühling noch immer schwer erschüttert – für Reisende aus dem Westen ist höchste Vorsicht geboten. Durch eine Zufallsbekanntschaft mit dem iranischen Schriftsteller Nader, der ihn zu sich nach Teheran einlädt, wird sein Traum endlich Wirklichkeit. Gemeinsam mit Nader und dessen Freundin Nastaran erkundet David die geheimnisvollen Ecken dieser aufregenden und zugleich gebeutelten Stadt. Alle drei verehren sie den persischen Klassiker Khayyam und finden in ihren leidenschaftlichen Gesprächen über ihn und seine Lebensphilosophie schnell zu einer tiefen Verbundenheit. Doch was passiert mit einer Freundschaft, wenn sie zu intim wird? "Die Rose von Nischapur" ist ein mutiger Roman über die Vielfalt menschlicher Beziehungen vor dem Hintergrund eines autoriäten Regimes. Er zeigt, welche beeindruckende Macht die Literatur hat, wenn unser Leben uns zur Flucht zwingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
AMIR HASSAN CHEHELTAN
Die Rose von Nischapur
Roman
Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich
C.H.BECK
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Hinweis:
1
– 2015 – Teheran
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
– 2022 – London
Zum Buch
Vita
Impressum
Hinweis:
Das Manuskript des Romans, den Sie auf den folgenden Seiten lesen werden, erreichte mich auf dem Postweg. Beigefügt war ihm eine ausführliche Anmerkung, die zwar das Wie und Warum der Geschichte erläuterte, mir den Namen ihres Verfassers aber vorenthielt. Es ist äußerst ermüdend, den Inhalt dieser zerknitterten Notiz wiederzugeben, doch die dringende Bitte, die sie enthielt, konnte ich, nach monatelangem Zaudern, nicht ablehnen. Wer sie verfasst hat, muss gewusst haben, dass ich mit Buchdruck und Verlagswesen vertraut bin, und hat mich deshalb gebeten, sein Manuskript umgehend in Druck zu geben. Der Text beschreibt die Entwicklung einer geheim gehaltenen Dreiecksbeziehung, weiter nichts.
Während die Liebe eines jungen Engländers zu einem bereits vor Jahrhunderten verstorbenen iranischen Dichter uns erneut die unvergleichliche Macht der Literatur vor Augen führte, gab mir, das muss ich gestehen, ein weiterer Aspekt zu denken und brachte mich zu einer grundsätzlichen Frage: Welchen Anteil hatten gegen den Strom schwimmende persischsprachige Dichter und Denker am Aufbau der iranischen Zivilisation? Wie wirkte sich dieser Beitrag auf das Verständnis dessen aus, was unsere Vorfahren dachten, und wie weit hatte er Einfluss auf die Zukunft?
Rasche Themenwechsel verrieten: Die Notiz war in aller Eile verfasst worden. Der Urheber selbst hatte erwähnt, sie auf der Post hastig hingekritzelt und dem Manuskript im Briefumschlag beigefügt zu haben. Die Handschrift ließ seine Anspannung erkennen, er war offenbar aufgewühlt. Auch hatte er dargelegt, dass er sich, nach Hause zurückgekehrt, das Leben nehmen werde, auf eher unübliche Art und Weise. Er wollte eine beträchtliche Menge Opium in Whisky auflösen und das Gemisch schluckweise zu sich nehmen. So würde er im Tiefschlaf scheiden, Qualen vermeiden, den unerbittlichen Todesstoß nicht spüren. Auch ließ er mich wissen, dass er die Träume, die er kurz vor seinem Tod haben würde, niemandem werde schildern können, weshalb er Träume aus seiner Vergangenheit skizziert hatte. Unter ihnen ein ständig wiederkehrender Traum von einem hübschen Mädchen, das in einem stillen, ins rote Licht eines Sonnenuntergangs getauchten See ertrinkt. Er hatte angemerkt, dass es immer sein Wunsch gewesen sei, auf diese Weise zu sterben, an einem ruhigen Abend, in einem entlegenen See, allein. Von einem ruhmreichen Tod war in der Anmerkung ebenfalls zu lesen, vom Sterben im Bett, nicht im Kampf an der Front, nein, in weichen Kissen, Hand in Hand mit einem einzigen Freund, in einer Mondnacht.
Der Verfasser hatte die Bedeutung des Manuskripts unterstrichen: Die hier geschilderten Ereignisse sind wahrscheinlich das, was, im Höchstmaß verdichtet, während meiner letzten Sekunden vor meinen Augen vorüberziehen wird, denn sie beschreiben mein Leben, das ich zu Papier gebracht habe, um es zu verewigen. Und weiter hieß es: Mein Leben fühlt sich leer an, ziel- und nutzlos. So voller Langeweile, Trübsinn, dass es sich nicht mehr lohnt, es fortzusetzen, obwohl es einst sinn- und bedeutungsvoll war. Es ist der Moment gekommen, das Fest des Lebens zu verlassen, weil dieses Fest für mich zu Ende ist … Manche Menschen mögen meinen Schritt für eine kluge Entscheidung, sogar für glorreich, poetisch, romantisch halten, doch in Wahrheit ist er nichts von alledem. Ich muss einfach gehen. Und es ist, als wüsste ich um den genauen Zeitpunkt meines Todes … Ich glaube nicht an Gott, habe nie an ihn geglaubt und zähle nicht zu den Menschen, die den Tod als die Fortsetzung des Lebens betrachten. Dennoch sehe ich ihm in Demut entgegen, wissend, dass er mein endgültiges Ende bedeutet … Selbstmord möchte ich mir nicht als etwas Erfreuliches vorstellen. Doch wir alle wissen, Selbstmord ist ein Privileg des Menschen, Tieren ist er nicht vergönnt. Ich glaube an die Schönheit des Menschen, meine Obsession, Verschmutzung, Verunreinigung zu vermeiden, ist zu einer unheilbaren Krankheit geworden. Ich bin nicht unglücklich, denn ich verstehe mich aufs Sterben … auch als nicht gläubiger Mensch. Schon in jungen Jahren war das Leben für mich nicht mehr als ein Tag in einem Rasthof. Weshalb ich heute mühelos Abschied nehmen kann. Ich bedaure die Menschen, die ihr Erdendasein unter Qualen ertragen, nur weil sie den Tod fürchten. Von alledem abgesehen, ist Selbstmord schön, und weshalb soll ich, dem es in seinem ganzen Leben nicht vergönnt war, Schönes zu schaffen, nun darauf verzichten? … Bitte veröffentlichen Sie dieses Manuskript. Wobei mein Name nichts zur Sache tut. Weder Sie noch eine potenzielle Leserschaft muss ihn kennen. Es zählt die Geschichte, nicht ihr Erzähler. Und vermutlich habe ich sie genau deshalb in der dritten Person erzählt.
Offenbar hat er sich aus moralischen oder aus intellektuellen Beweggründen das Leben genommen. Wären materielle Motive im Spiel gewesen, hätte er sie gewiss zur Sprache gebracht. Es wird zwar deutlich, dass ihm das Leben nicht zuwider ist, doch aus seinen Worten spricht eine Erschöpfung, die seinen Selbstmord zu einem jener seltenen, edlen Phänomene macht, in denen man gemeinhin eine Auflehnung gegen den Lauf der Zeit sieht. Nichts als schöne Worte, all das. Er hat sich umgebracht, um sein eigener Herr zu bleiben, im Wunsch nach Selbstbestimmung. Und es gab ein weiteres Motiv: Er hat sich das Leben genommen, um unsterblich zu sein!
In seiner Notiz hatte er mich gefragt: Wissen Sie, dass Schwäne vor ihrem Tod, der Sage nach, mit wunderschöner Stimme ihr letztes Lied anstimmen? Ein Schwan, der so singt, möchte sterben und feiert seinen Tod. Das beigefügte Buch ist mein Schwanengesang.
Die Anmerkung enthielt ein weiteres Geständnis. Er habe, so bekannte er, kaum die Hälfte seines Buches geschrieben und dann zu schreiben aufgehört, weil sein Kopf plötzlich gedankenleer geworden sei. Zwei Jahre später habe ein Heiliger ihm die zweite Hälfte seines Werks offenbart. Einer Legende nach gab es in der Antike ein Buch über Bücher, die eines Tages für immer verschwunden sein würden, in Feuersbrünsten etwa, die mitunter ganze Bibliotheken verschlingen, oder auch durch Vernichtungsaktionen ungebildeter Menschen, die Bücher für nutzlos hielten. Der Urheber dieses Werks hatte zwar nicht vorausgesagt, wie die Bücher jeweils zerstört würden, hatte aber jedes betroffene Werk namentlich aufgeführt. Steht das Manuskript, das ich heute in Händen halte, etwa auch auf diesem Index? Bat dessen Verfasser mich darum, es in Druck zu geben, weil er seinem Werk das bittere Schicksal der Vernichtung ersparen wollte? Er behauptet, sein Werk sei aufgrund falscher Zeugenaussagen auf diesem antiken Index gelandet. Weshalb aber hatte er selbst nichts unternommen, um sein Buch drucken zu lassen?
Fand er, mit dem Abfassen des Werks sei seine Hauptpflicht getan, er müsse keine weitere Verantwortung übernehmen und könne sich stattdessen dem Projekt seines glorreichen Todes widmen? Ich vermag es nicht zu sagen, möchte die geneigte Leserschaft jedoch auf einen anderen Aspekt hinweisen, der hier nicht fehlen darf.
Die insbesondere in der zweiten Hälfte des Manuskripts festgehaltenen Abenteuer kommen mir sehr bekannt vor. So vertraut scheinen sie mir, dass ich das Gefühl habe, ich selbst sei deren Verfasser. Einer meiner wiederkehrenden schweren Träume handelt von einem Romanmanuskript, das ich vor Jahren verfasst habe, zwischen vielen Stapeln Papier in meiner Schreibtischschublade aber nicht wiederfinde. Wie von Sinnen durchwühle ich alles, stelle die Schublade auf den Kopf und vergieße dabei Tränen. Ein verlorener Roman. Nach zwei, drei Jahren Mühsal und Qual! Die Schriftsteller unter Ihnen werden wissen, von welchem Albtraum ich hier rede. In vielen düsteren Nächten hat er mich heimgesucht.
Heißt die Tatsache, dass mich dieses Manuskript nun per Post erreicht hat, mein schwerer Traum ist wahr geworden? Bin tatsächlich ich der Urheber dieses Werks, und der es mir entwendet hat, hat sich mit dessen Rücksendung an mich einen derben Scherz erlaubt? Dass Autoren bisweilen davon absehen, ein Werk in Druck zu geben, kann unterschiedliche Gründe haben. Etwa den, dass der Autor in seinem Werk ein sehr intimes, lange gehütetes Geheimnis offenbart und dessen Enthüllung im Grunde fürchtet. Dabei tun wir Schriftsteller, meiner Ansicht nach, nichts anderes, als unsere Wünsche, Ideen, Geheimnisse den jeweiligen Charakteren zuzuschreiben, die wir erschaffen, was selbst den Wunsch einschließt, kriminelle Handlungen zu begehen! Dieses Manuskript beweist, ein Autor kann durchaus die Distanz zwischen Fakt, seinem Alltag, und Fiktion, dem literarischen Geschehen, deutlich reduzieren oder sie sogar ganz aufheben. Mir scheint es auch ein perfektes Beispiel, ein handfester Beweis dafür zu sein, dass, wie manche sagen, in fiktiven Schriften die verborgenen Wünsche ihrer Urheber Ausdruck finden.
Allmählich scheine ich der Tatsache ins Auge sehen zu müssen, dass ich der Urheber des Manuskripts bin. Anlass zu diesem sich zunehmend erhärtenden Verdacht gibt mir der Tatbestand, dass alle meine bisher unternommenen Versuche, den wahren Autor des Werks zu finden, fruchtlos geblieben sind. Ich wandte mich sogar an einen Gerichtsmediziner, um anhand des Poststempels herauszufinden, wer, außer dem Verfasser, noch um die fragliche Zeit Suizid begangen hat. Doch meine Hoffnung, einige Fragen auf diesem Weg zu klären, wurde enttäuscht. Auch Todesanzeigen in Tageszeitungen, die ich heranzog, lieferten keine weiteren Anhaltspunkte.
Ebenso gut könnte es sein, dass ich mich irre. Dass der Verfasser, seiner Ankündigung gemäß, nun im Reich der Toten weilte und es nun mir oblag, seinem Wunsch zu entsprechen, denn andernfalls würde ich keine Ruhe finden. Ich stand in der Schuld eines Toten. Sollte es tatsächlich ein Leben, eine Welt nach dem Tod geben, in der er mich beschuldigen würde, seiner Bitte nicht nachgekommen zu sein, was könnte ich zu meiner Verteidigung vorbringen?
Und zuallerletzt: Das Manuskript behandelt ein so heikles Thema, dass es, angesichts der strengen Zensurbedingungen, hierzulande gar keine Druckerlaubnis bekäme. Weshalb ich es, notgedrungen, einem ausländischen Verleger anzuvertrauen gedenke. Zuvor werde ich einige Sachverhalte detaillierter darstellen und dem Original Erläuterungen hinzufügen, die einer ausländischen Leserschaft das Verständnis bestimmter Textstellen erleichtern sollen.
1
2015 – Teheran
Eine Frau mittleren Alters, relativ groß, trug Davids Namen in das voluminöse Gästebuch ein, das vor ihr lag, hob dann den Blick, lächelte und nickte Nader bekräftigend zu. Dann setzte sie ihre Brille ab, öffnete eine Schublade, entnahm ihr einen großen Ring, an dem viele Schlüssel hingen, trennte einen Schlüssel ab und legte den Bund zurück in die Lade.
Die Pension befand sich zwar im Norden der Stadt, war vom Stadtzentrum aber nicht allzu weit entfernt. Sie stand am Ende einer Nebenstraße, die in eine erst kürzlich angelegte schöne Parkanlage mündete. Noch wuchsen hier zwar keine großen Bäume, aber mit Rasenflächen, Wasserbecken und Fontänen versehen, war sie ansprechend gestaltet, wenngleich zu dieser Jahreszeit nur spärlich besucht. In direkter Nachbarschaft der Pension lag zur einen Seite ein Wohnheim für Studierende, zur anderen ein gruseliges altes Gefängnis, dessen Gelände man nach der Revolution im Jahr 1979 zu einem Park gemacht hatte und das heute auch einen Obst- und Gemüsemarkt beherbergt. Beide, Park und Markt, tragen den Namen der Haftanstalt.
Anders als man es vermuten mochte, besaß nicht Banu, die stämmige Mittfünfzigerin, die Pension, sondern ihr betagter Vater, der vormittags hier vorbeikam und Rezeptionsdienst versah. Dort aß er auch kurz zu Mittag, rückte seinen Stuhl dann an die Wand hinter sich, lehnte den Kopf zurück und hielt ein Schläfchen und begab sich, sobald es Abend wurde, ohne großes Aufhebens nach Hause. An manchen Tagen allerdings blieb er zwei, drei Stunden länger vor Ort und spielte mit seinem Freund, dem Konditor von gegenüber, Backgammon. Dann hallte das Foyer der Pension jedes Mal wider von ihren lebhaften Ausrufen und Kommentaren, die ihre Spielzüge begleiteten. Banus Vater nahm keinen Einfluss mehr auf die Geschäftsführung, die er vollständig in die Hände seiner Tochter gelegt hatte, weil ihm inzwischen die Kräfte dazu fehlten. Banu wohnte in der Pension und war rund um die Uhr vor Ort.
Nach ihren kurzen Hinweisen reichte sie David den Schlüssel zu seinem Zimmer und hieß ihn in gebrochenem Englisch willkommen. David lobte daraufhin in recht fließendem Persisch die angenehm entspannte Atmosphäre des Hauses. Was Nader erleichterte. Er entnahm dem kurzen Wortwechsel, dass David mit seiner, Naders, Wahl der Unterkunft zufrieden war. David gedachte, mindestens zwei Monate in der Pension zu bleiben.
Banu wies auf eine weitere Gepflogenheit des Hauses hin: «Ihr Zimmer wird einmal wöchentlich gereinigt, Sie können den Tag wählen. Frische Handtücher und Bettwäsche sind selbstverständlich jederzeit verfügbar.»
Sie wartete auf Davids Fragen zu ihren Hinweisen. Doch David lächelte nur.
«Darf ich Ihnen jetzt das Haus zeigen?»
David und Nader nickten zustimmend. Banu schob eine krause Haarsträhne unter ihr Kopftuch, zog den Knoten unterm Kinn fester und übernahm die Führung des Zuges. Der durchquerte das Foyer und betrat das Speisezimmer. In einer Ecke des Raums, auf einem hochbeinigen viereckigen Tisch, brodelte ein neusilberner Samowar vor sich hin, daneben ein Tablett mit Teegläsern und anderem Teezubehör. Ein elektrisch betriebener Kaffeeautomat stand ebenfalls dort.
Banu erläuterte: «Tee, Kaffee und warmes Wasser sind den ganzen Tag über verfügbar.»
Durch eine Flügeltür ging es weiter ins Esszimmer. Hier stand, außer zwei kleineren Vierertischen, am Fenster ein großer Tisch für acht Personen. Durch das Fenster schaute man hinaus in den Hof der Pension.
«Frühstück servieren wir morgens von sieben bis zehn Uhr, Gäste, die über Mittag in der Pension bleiben, versorgen sich selbst. Abends kommt eine Dame ins Haus, die für alle Gäste kocht und das Essen auch serviert. Um acht Uhr. Die Gäste nehmen das Abendessen meist gemeinsam ein, und nach vorheriger Vereinbarung bewirten wir gern auch jeweils zwei Freunde oder Bekannte unserer Gäste. Außer Ihnen sind das zurzeit vier weitere. Damit sind alle fünf Zimmer der Pension belegt, wir sind ausgebucht.»
Die Führung fortsetzend, ging Banu voraus, durchquerte den Raum und blieb jenseits, an der Schwelle zur Küche, stehen. «Hier ist unsere Küche, in der Sie natürlich nicht aktiv werden müssen.»
Eine schwarze Katze ging mit gerecktem Schwanz an Banu vorbei ins Esszimmer. «Ohne unsere Katze könnten wir die Mäuseplage in der Küche nicht bewältigen», erklärte Banu und führte Nader und David zurück ins Foyer, zu Davids Koffern. Es gab keinen Pagen, der das Gepäck der Gäste in die Zimmer bringen würde. Banu hob den kleineren der beiden Koffer mit der einen Hand hoch, schob mit der anderen erneut eine Haarlocke unter ihr Kopftuch und sagte: «Bitte folgen Sie mir.»
Bevor sie den Fuß auf die erste Treppenstufe setzte, erklärte sie: «Mein Zimmer ist auf der Seite», und deutete in die der Treppe gegenüberliegende Richtung. Dann stiegen die drei einige Stufen hinauf und betraten einen breiten Flur, in den durch ein gekipptes Fenster der gedämpfte Lärm der Straße drang. Banu stellte Davids Koffer vor dessen Zimmertür ab und erläuterte: «Alle Gästezimmer befinden sich auf dieser Etage. Dusche und WC sind am Ende des Gangs.»
Dann streckte sie die Hand aus, bat David um den Zimmerschlüssel und schloss die Tür auf. Sie trug Davids Koffer in die Zimmermitte und stellte ihn dort ab. Dann trat sie ans Fenster, zog den Vorhang auf und schaute nach draußen:
«Heute Morgen habe ich das Fenster ein, zwei Stunden offen gelassen, zum Lüften.»
Und an David gewandt, wollte sie wissen: «Gefällt Ihnen Ihr Zimmer?»
David nickte und ließ den Blick schweifen. Mitten im Zimmer, mit einem purpurfarbenen Überwurf bedeckt und etwa die Hälfte des Raums einnehmend, stand ein großes Bett. Daneben, auf einem Holztisch, eine Lampe mit farblich zum Überwurf passendem Schirm. An der Wand gegenüber hing ein großer Spiegel über einer Kommode mit drei Schubladen, und neben einem Sessel in einer Ecke war ein Schreibtisch platziert, davor stand ein einfacher Stuhl. Die gesamte Breite einer Seitenwand nahm ein großer Schrank ein, dessen Türen halb offen standen.
«Es ist alles bestens», sagte David.
Kurz ließ er den Blick auf dem farbigen Ölporträt einer jungen Dame ruhen, das neben dem Spiegel hing, ging dann ans Fenster und schaute in den kleinen Wintergarten der Pension: eine gemütliche Oase.
Banu trat neben David, als könne sie sein Urteil erst bestätigen, nachdem sie selbst in den Blick genommen hatte, was er sah: «Wie geschaffen für Menschen auf der Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit.»
Wer aufmerksam hinhörte, nahm den Lärm der Stadt gedämpft wahr. Und so relativierte Banu ihre positive Bewertung: «Das große Wohnheim für Studierende der Uni Teheran ist nicht weit von hier.»
Der Himmel hing voller marmorweißer Quellwolken. Dazwischen leuchtete er strahlend blau.
«Meine Studienzeit liegt noch nicht lange zurück.»
«Man sieht Ihnen an, dass Sie sehr jung sind.»
Beide entfernten sich vom Fenster. Banu sah David und Nader erwartungsvoll an: «Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?»
David verneinte dankend: «Sie sagten, es gibt jederzeit Tee und Kaffee?»
Und ohne Banus Antwort abzuwarten, wandte er sich an Nader: «Wie wär’s mit einem Schluck Tee?»
«Ich habe gerade frischen Tee gemacht», sagte Banu.
«Ich warte unten auf dich», sagte Nader.
«Ich brauche nur ein paar Minuten», sagte David.
«Du kannst ruhig auch duschen. Ich hab’s nicht eilig.»
David deutete auf die Zeitung unter Naders Arm: «Ich weiß, dir wird nie langweilig.» Er schaute auf seine Uhr.
«Mach dir um mich keine Gedanken.»
Bevor Banu das Zimmer verließ, sagte sie: «Ich habe übrigens einen weiteren Gast aus Übersee. Eine junge Deutsche. Sie sind also nicht allein!»
Schalkhaft zwinkerte sie David zu. Der nickte lachend. Nader fand das verschwörerische Getue unangebracht.
Er hatte David vor rund drei Stunden vom internationalen Flughafen, dreißig Kilometer südlich von Teheran, abgeholt. Während der Fahrt hatte er eine erste Frage an David gerichtet.
«Hast du dich endlich auf das gefährliche Abenteuer Orientreise eingelassen?»
Und erläuternd hatte er hinzugesetzt: «Im 18. Jahrhundert hatte der dänische König eine sechsköpfige Delegation in den Nahen Osten entsandt, und nur einer der Sechs hat die Reise überlebt.»
David fand Naders Beobachtung irrelevant.
«Wir sind aber mittlerweile im 21. Jahrhundert.»
Nader ließ nicht locker: «Und in diesem 21. Jahrhundert wimmelt es im gesamten Nahen Osten von muslimischen Extremisten.»
Nach einer halben Stunde Fahrt über eine durch trockene Einöde führende Autobahn und einer Unterhaltung, die mit Teherans Wetter begann und mit Roger Coopers Aufzeichnungen über seine Zeit in iranischer Haft endete, erreichten sie zunächst die Vororte und kurz darauf einen für den Privatverkehr gesperrten Stadtteil Teherans. An dessen Rand parkten sie Naders Wagen und stiegen in einen Schnellbus um, für den eine eigene Spur angelegt war. Nader fuhr gern Bus. Schon als Kind hatte er seine Großmutter mit Vergnügen zum Einkaufen begleitet. In doppelstöckigen Bussen ging die Fahrt damals von Schemirans Stadtrand aus in ihr Zentrum.
Im Bus sagte David: «Ich fühle mich hier wie zu Hause.»
Nader wandte ein: «Aber zwischen Teheran und London besteht ein Riesenunterschied.»
«Ich wollte sagen, dass ich mich hier sehr sicher fühle. Das lebhafte Gedränge stört mich gar nicht. In meinem Leben geht auch manches drunter und drüber.»
«Die Stadt als Spiegel des Lebens», murmelte Nader.
Mit seinem Leben hatte sie nichts gemein.
Am Tupkhaneh-Platz, einem der bedeutenden alten Plätze im Süden der Stadt, stiegen sie aus, schlenderten vorbei am Haupteingang des Volksparks, Bagh-e Melli, am Außenministerium, am ehemaligen Königsschloss Kakh-e Marmar, dem Marmorpalast, unweit vom Amtssitz des Präsidenten der Republik, und erreichten schließlich den großen Basar und das älteste Königsschloss der Hauptstadt, den Golestan-Palast. David, erstmals in einem Land des Ostens unterwegs, war beeindruckt. Nach einem etwa einstündigen Rundgang durch dieses Viertel bestiegen sie ein Taxi, um den belebtesten Teil der Stadt, über den Baharestan-Platz und am Parlament vorbei, nicht zu Fuß durchqueren zu müssen. Über die Eslambol-Kreuzung und die Naderi-Straße führte der Weg nun in den Teil der Stadt, der die diplomatischen Vertretungen wichtiger europäischer Staaten beherbergte. Die kurze Rundfahrt, auf Naders Vorschlag hin unternommen und von David begrüßt, hatte ihn nicht ins Herz Teherans, sondern ins Innere des Landes Iran geführt.
Nader und David waren einander erstmals vor vierzehn Monaten in London begegnet. Naders britischer Verleger hatte, anlässlich der Veröffentlichung von Naders jüngstem Roman, eine Lesereise organisiert, mit London als letzter Station. Die Veranstaltung fand in einem eigens dafür vorgesehenen Areal einer Buchhandlung vor knapp fünfzig interessierten Gästen statt. Am Ende der kurzen Schlange derer, die sich nach der Lesung ein Exemplar von Naders Werk signieren ließen, hatte ein gut aussehender junger Mann gewartet, der sich als David vorstellte, das von Nader signierte Buch entgegennahm und mit charmantem Akzent auf Persisch sagte:
«Die Geschichte, die Sie gelesen haben, hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte nach Iran reisen, wissen Sie. Ich habe mich nämlich in die Verse Omar Khayyams verliebt.»
Dass einem seiner Zähne im Oberkiefer ein kleines Stück fehlte, wurde offenbar, wenn David lachte. Nader ließ ein wenig Zeit verstreichen, bevor er zustimmend nickte und David aufmunternd ansah, damit er seine Pläne erläuterte.
«Ich habe mich in die Kultur verliebt, die einen solchen Dichter hervorgebracht hat.»
Nader wandte leise ein: «Von dieser Kultur ist vermutlich nicht mehr allzu viel übrig. Nicht, dass Sie enttäuscht werden.»
David erwiderte voller Überzeugung: «Nichts geht verloren, zumindest nicht vollständig.»
Er glaubte an seine Worte. Nader schüttelte mehrmals den Kopf und lächelte kaum merklich. Der attraktive junge Mann beharrte auf seiner Ansicht: «Dessen bin ich mir sicher.»
In den zwanzig Jahren, in denen Nader nun als Romancier tätig war, waren ihm an vielen Orten der Welt viele freundliche Menschen begegnet, doch noch nie hatte jemand ihn gleich bei der ersten Begegnung so in seinen Bann geschlagen wie David. Kein Wunder, bei Davids attraktivem Äußeren und seinen schön geschwungenen Augen, aus denen Klugheit, Aufrichtigkeit und die Liebe zu Gleichgesinnten sprachen. Er zählte zu den Menschen, die, von Natur aus freundlich und liebenswürdig, in ihrem Gegenüber sofort Vertrauen erwecken. Er war nicht sehr groß gewachsen, offenbar bewusst lässig, aber durchaus hochwertig gekleidet. Der rote Schal um den Hals, das blaue Hemd und selbst die unter den Arm geklemmte Lederjacke waren brandneu und von hoher Qualität. Später erkannte Nader, David war nicht nur auf sein Äußeres bedacht, sondern auch ein Schöngeist. Sein reizender englischer Akzent, mit dem er Persisch sprach, oder seine leuchtenden Augen, was es auch sein mochte, Nader malte sich aus, dass eine Begegnung mit David angenehm verlaufen dürfte. Sein Rückflug nach Iran war zwar für den Mittag des nächsten Tages geplant, doch er lud den jungen Mann in sein Hotel ein, zum Frühstück vor seiner Rückreise. Seine Mutter pflegte zu sagen: «Die Augen sind der Spiegel der Seele», und der aufrichtige Blick dieses jungen Briten ließ auf ein reines, offenes Herz schließen. Am nächsten Morgen fiel Nader sofort auf, Davids Augen waren bei Tageslicht sogar noch klarer, noch ansprechender. Der Autor und sein interessierter Leser verbrachten eine gute Stunde zusammen. Genug Zeit, um das Gefühl entstehen zu lassen, sie würden sich bereits seit Jahren kennen und seien sogar seelenverwandt. Wobei David seinem Gegenüber großen Respekt erwies, was Nader, immerhin fünfzehn Jahre älter als er, sehr genoss.
Schönes Sonnenlicht fiel durch die großen Fenster in den Speiseraum und brachte Helligkeit und Wärme. In dieser angenehmen Atmosphäre nahmen der Autor und sein Gast das Frühstück ein, unterhielten sich dabei in kurzen, mitunter unvollständigen Sätzen über dies und das, hier und dort, das schlechte Wetter in London, den Smog in Teheran. Anfangs beantwortete der junge Brite nur Naders Fragen. Dann hielt er inne, trank mehrere Schlucke Tee, und es bot sich die Gelegenheit zu einem tiefsinnigeren Gespräch.
«Was findest du denn so außergewöhnlich an Khayyam?»
«Kein anderer Dichter konnte die Welt alles Heiligen so unverhohlen entweihen wie er. Zugleich hat er eine so wahnsinnig große Freude am Leben, die mir bei keinem anderen Dichter, keinem anderen Künstler begegnet ist. Khayyam hat die Welt vereinfacht, sie entzaubert und von der Träumerei befreit.»
«Aber manche Zeitgenossen warfen ihm vor, er stifte insbesondere Männer dazu an, all ihre Zeit dem Wein und den Frauen zu widmen.»
«Ja, für ihn lag der Sinn des Lebens im Streben nach Vergnügen und Genuss. Ohne sie, so seine Sicht, war die Welt bedeutungslos. Dass er sein gesamtes Leben deshalb in Ausschweifung und großer Sünde verbracht hat, stimmt einfach nicht. Ich weiß, weshalb er so starken Gegenwind bekam. Er hat Geheimnisse gelüftet, als deren alleinige Hüterin sich die Religion sah, die mit aller Kraft an ihnen festhält. Khayyam aber fordert die Menschen auf, gemeinsam dem Hedonismus zu frönen. Er wollte den Glauben an Gott durch den Glauben an die Freuden des Lebens ersetzen.»
Nader nickte zustimmend und ergänzte:
«Körperlichen Bedürfnissen sollte man nachgeben, davon war er zutiefst überzeugt.»
«Khayyam hat die Menschen an ihren Ursprung zurückgeführt, dorthin, wo keinerlei Erinnerung ist, kein Glaube, keine Ideologie, keine Philosophie. Dort lässt er den starren Blick schweifen und erkennt klar und kompromisslos: Indem er die zur Sinn- und Bedeutungssuche in der Welt befindlichen Werkzeuge und Mechanismen als sinnlos und als absoluten Unfug abtut und sie missachtet, offenbart er deren Hohlheit, die Leere, die er ihnen attestiert. Der Tod ist für ihn ein Bruch zwischen dem Leben und dem Nichts, zwischen Ein- und Ausatmen.»
Was tun, um der Vergeblichkeit der Welt zu entkommen? Es gibt nur einen Weg: Man muss die Freude suchen, nach Genuss streben. Die Freude entzieht den Menschen der Herrschaft der Zeit. Khayyam erkennt weder die Sünde noch deren Bestrafung an.
Ein Blick ins Europa des 11. Jahrhunderts, in die Epoche, in der Khayyam in Iran diese Phänomene bereits thematisierte, zeigt, dort war von solch ketzerischem Gedankengut noch gar keine Rede. Viel später erst, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wird Khayyams Einfluss so groß, dass man mit seinem Namen sogar Theaterstücke, Ballettaufführungen, Seifen, Tabak und Kaffee bewirbt. Manche sahen Europa damals im Khayyam-Fieber.
Das Khayyam-Fieber! Es hielt sich, ansteckend und unheilbar, mindestens bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts. David und Nader setzten ihren Gedankenaustausch fort, über Khayyams neue Art des Umgangs mit Tod und Leben und über die Ähnlichkeit seiner Vierzeiler mit denen des Lukrez.
Nach dem einstündigen Treffen fühlte Nader sich, als habe man ihm das Tor zu einem üppigen Blumengarten aufgestoßen. War das ein Zufall, ein flüchtiges Ereignis?
Davids Liebe für Khayyam entstand zwar dank eines Zufalls, eine vorübergehende Laune aber war sie nicht. Sie dauerte bereits mehrere Jahre, denn ein Freund hatte ihm zum fünfundzwanzigsten Geburtstag einen Band mit Gedichten von Omar Khayyam geschenkt. David hatte damals weder des Dichters Namen noch den seines englischen Übersetzers je gehört. Nachdem sich, spätabends, alle Festgäste verabschiedet hatten und seine Wohnung wieder halbwegs aufgeräumt war, trat er, vor dem Zubettgehen, ans Fenster, weil er es schließen wollte, hielt aber inne, weil in dieser Sommernacht aus der tiefen Dunkelheit und der Stille der Straße ein lauer Wind zu ihm ins Zimmer wehte. Er schloss das Fenster nicht, nahm das Buchgeschenk und ging zu Bett. «Kaum hatte ich die ersten Verse gelesen, war ich so überwältigt, dass ich meine damalige Ergriffenheit bis heute spüre. Ich dachte, Omar Khayyam steht leibhaftig vor mir und spricht zu mir, nur zu mir. Ich allein schien seine Botschaft in ihrer ganzen Tiefe zu ermessen und hatte die Pflicht, sie anderen Menschen zu vermitteln. Wir haben nur eine Welt, so seine Worte. Wer von einem Jenseits spricht, der fabuliert.»
Khayyams offene Worte übermittelten Gedanken, die so einfach waren wie «Guten Morgen!» und so tiefgründig, wie der Himmel hoch war. David schloss das Buch und schaute zu, wie der Wind am Fenster mit der Gardine spielte. Er fühlte sich seiner Umgebung entrückt und war erstaunt, wie vertraut ihm dieses Gefühl vorkam. Weckte auch die Lektüre anderer morgenländischer Texte, wie etwa Tausendundeine Nacht, diese Empfindungen in ihm? Nein, Khayyams Lyrik wirkte intensiver, wie eine starke Droge, die ihm plötzlich die Tore zu seinen Gefühlen und zu seinem Verstand öffnete und ihn sogar zum Weinen brachte. Zugleich war ihm bewusst, hier brachte etwas Großes Distanz zwischen ihn und seine Vergangenheit. Damit war sein bisheriges Leben zu Ende. Er fiel in einen Traum, den er mit offenen Augen verfolgte. Naneh Khatun, die stolze, in der Kunst der Verführung der Menschheit bewanderte Jungfrau, reichte ihm einen kristallenen Kelch und ermunterte ihn, zu vergessen, sich von irdischen Fesseln und Zwängen zu lösen. War das der Weg zur Vereinfachung der Welt? Die Mythen über die Zeit nach dem Tod aus seinem Leben zu streichen? Zugleich sah er das Innere eines Basars vor sich, das Labyrinth der Gänge und Ladengeschäfte, das schräg durch Luken in den Kuppeldächern einfallende Licht, und er roch die unterschiedlichsten Gewürze, in weißen Plastiksäcken vor Geschäften feilgeboten. Er ging im Geist weiter, zur Töpferwerkstatt, wo frisch geformte Tonkrüge, auf einem großflächigen Podest aufgereiht, in der warmen Sonne des Orients trockneten.
David träumte bis in die frühen Morgenstunden. Als er schließlich wach wurde, setzte er sich, noch vor dem Duschen und bevor er Kaffee aufsetzte, und trotz seiner leichten, dem Alkoholkonsum vom Vorabend geschuldeten Kopfschmerzen, an seinen Schreibtisch, schaltete seinen Laptop ein und erhielt nach kurzer Suche schon etliche Hinweise auf den persischsprachigen Dichter aus dem 11. Jahrhundert. Gern hätte er sie alle gelesen, konnte sie der schieren Menge wegen jedoch nur überfliegen. Ihm schien von einem unsichtbaren Ort her, aus der Tiefe eines endlos langen Korridors vielleicht, ein Windhauch zu wehen und ihm Kraft zu spenden. Vor allem aber brachte er die mit Neuentdeckungen einhergehende Freude und Faszination. Zwei Stunden später stand er, den Kopf voller Namen und Orte, vom Schreibtisch auf, streckte sich wieder auf seinem Bett aus und kam nicht zur Ruhe, weil die Namen unbekannter Orte und fremder Menschen ihm in schwindelerregender Schnelligkeit durch den Sinn gingen, rätselhaft, spannend, berauschend.
In den folgenden Tagen dachte David über die Verkettung von Zufällen nach, die in der Stadt Nischapur, im Orient des 11. Jahrhunderts, ihren Anfang genommen, dann über ein Pastorenhaus und einen Korb mit preisreduzierten Büchern in einer Londoner Buchhandlung im 19. Jahrhundert gelandet war und schließlich in Form des einfachen Geburtstagsgeschenks seines Freunds in seinen Händen geendet hatte. Versprach diese seltsame Folge von Ereignissen ein in naher Zukunft zu lüftendes Geheimnis?
Wäre Edward Bayles Cowell als junger Neunzehnjähriger – der bereits im Alter von sechzehn Jahren als Autodidakt aus dem Persischen übersetzte Verse des großen iranischen Dichters Hafis in einer asiatischen Zeitschrift veröffentlicht hatte und der bald auch als Edward FitzGeralds Konkurrent um die Liebe einer Frau auf den Plan trat – ihm nicht im Hause eines Pastors begegnet, hätte FitzGerald, als Cowells Schüler, vielleicht nie erwogen, das Persische zu erlernen. Wobei der Spracherwerb allein nicht dazu führte, dass man auf Omar Khayyams Lyrik aufmerksam wurde. Auch andere Menschen aus der westlichen Welt lernten Persisch, interessierten sich für Khayyams Werke aber nicht im Geringsten. Sieben Jahre nach ihrer ersten Begegnung reiste FitzGerald im Jahr 1852 nach Oxford und besuchte Cowell und dessen Gattin. Über diese Begegnung schreibt Cowell: «An diesem regnerischen Sonntag schlug ich ihm vor, das Persische zu erlernen, und stellte ihm in Aussicht, ihn dessen Grammatik binnen eines Tages zu lehren.» Die Grammatik, verfasst von Sir William Jones, enthielt fast ausnahmslos den Werken des Hafis entnommene Beispiele. Auch mit Irans berühmten Dichtern Firdausi, Sa’adi und Dschami war Jones vertraut, übertrug sogar Dschamis Verserzählung Salaman und Absal, ein Werk über den mystischen Tod, ins Englische. Bald nach dieser Begegnung sollte sich etwas Großes ereignen. Kurz vor Beginn des Jahres 1856 bereiteten Cowell und seine Frau sich auf ihre Reise nach Indien vor, wo Cowell im damaligen Kalkutta von 1856 bis 1867 am Presidency College britische Geschichte lehrte. In jenen Tagen stieß er in der Bibliothek des Magdalen College in Oxford, wo er studierte und persische Manuskripte katalogisierte, auf eines in persischer Schönschrift, mit Purpurtinte auf Papyrus geschrieben und goldverziert.
Cowell sandte FitzGerald eine Teilabschrift dieses Manuskripts mit dem Titel ‹Die Vierzeiler des Omar Khayyam›. FitzGerald verbrachte die ersten beiden Juliwochen des Jahres 1856 bei Cowell und seiner Frau, deren Seereise nach Indien unmittelbar bevorstand. Er schrieb an einen Freund: «In diesen zwei Wochen habe ich die sehr ketzerischen, kurzweiligen Verse eines epikureischen Dichters aus dem 11. Jahrhundert gelesen, der dem Gedanken der Vorsehung sehr ablehnend gegenübersteht.» Damals wusste FitzGerald noch nicht, dass seine englische Übersetzung dieser Verse ihm eines Tages Weltruhm verschaffen würde.
Khayyams Blasphemie und sein Hedonismus beeindruckten FitzGerald. Er fand es beachtlich, dass Khayyam dem Konzept der Vorsehung nichts abgewann, der herrschenden Auffassung widersprach, dass göttlicher Wille über den Alltag hinaus bis in alle Ewigkeit zu gelten habe und dass er der Vergänglichkeit Bedeutung beimaß. Khayyam erkannte göttlichen Willen nicht an und sah auch in Leid und Schmerz nicht den Weg zur Erlösung.
FitzGerald, der bereits mit Werken von Hafis vertraut war, erkannte, dass aus dessen unbedingter Hingabe an den gnädigen Gott bei Khayyam Auflehnung gegen den Gedanken der Schöpfung sowie, zwingend, Pessimismus getreten waren. Hafis sah sich im Einklang mit Gottes traurigem Plan, gegen den er nie aufzubegehren suchte.
Im Juni 1857 wurde FitzGeralds kostbarer Schatz vollständig. Cowell ließ ihm eine weitere Teilabschrift des Manuskripts von Khayyams Versen zukommen, die damals in der 1784 vom britischen Philologen Sir William Jones gegründeten Bibliothek der Asiatic Society of Bengal aufbewahrt wurde. Ihr Zweck bestand vielleicht allein darin, Khayyam, durch FitzGeralds Vermittlung, in der Welt bekannt zu machen. Dieser Zweck erfüllte sich im Juni 1857. Danach verschwand die Abschrift.
Vierzehn Monate lang kommunizierten Nader und David, telefonisch, via Skype oder per E-Mail miteinander und erörterten Themen wie persische Lyrik, iranisches Alltagsleben, Orientromantik, offene oder verborgene Erotik im iranischen Denken, wobei Khayyam in ihrem Austausch den größten Raum einnahm. Die Bedeutung, die er Gegebenheiten wie Sexualität und Tod oder einem Seele und Körper gleichermaßen zerstörenden Materialismus einräumte, weckte in David große Fragen, die zu endlosen, tiefgreifenden Gesprächen führten. Wie konnte jemand bereits vor Jahrhunderten zu einer Geisteshaltung gelangen, die vom damaligen Zeitgeist nicht nur abwich, sondern ihm komplett zuwiderlief? Wählen Menschen ihre Art zu denken frei und selbstbestimmt, oder prägen die Bedingungen, unter denen sie leben, ihre Weltsicht und geben ihnen Denkräume vor?
Nader freute sich seinerseits über die Freude, mit der der junge Europäer Irans jahrhundertealte Zivilisation bis in jeden Winkel hinein zu ergründen suchte. Enthielten Khayyams Gedanken Elemente, die sich von der iranischen Kultur unterschieden oder ihr zuwiderliefen? Kristallisierte sich in seinen Ideen zuvor unterdrücktes Gedankengut, dem er endlich Ausdruck verlieh?
Jedenfalls gönnte man Omar Khayyam, als er 1131 starb, kein Begräbnis auf dem Friedhof für Muslime. Dem Leichnam des großen Dichters Firdausi war 1020 übrigens das gleiche Schicksal beschieden. So bestrafte eine Kultur diejenigen ihrer Kinder, die sich unverschämt über eng gesteckte Grenzen hinauswagten. Kurz kamen David und Nader auf aktuelle Tagesthemen zu sprechen – die Verfechter von Heuchelei und Falschheit ließen noch immer nicht ab vom iranischen Volk und setzten selbst im 21. Jahrhundert ihr Leben und Treiben fort wie eh und je –, um kurz darauf wieder bei Khayyam zu landen. Über die Stellung des Menschen auf Erden und die Position der Erde im Universum gab er sich keiner Täuschung hin. Das bewies, wie einzigartig er war. Ihm kam es nur darauf an, die ‹Jetzt-Zeit› zu erkennen, die Zeit, die über das Vergessen hinausgeht, Zukunft wird, und die einzige ‹Zeit› ist, über die wir verfügen dürfen, und deshalb versuchen müssen, sie zu verewigen. Laut und vernehmlich verkündete er: ‹Es gibt kein Zurück! Paradies und Hölle sind nichts als Hirngespinste.› Wenn er gewusst hätte, dass man eintausend Jahre später junge Männer locken, ihnen das Paradies versprechen und sie in Selbstmordkommandos in den Tod schicken würde …
Nach dem Frühstück hatte David sich in der Lobby des alten Hotels mit den Worten «In einem Monat in Teheran!» von Nader verabschiedet.