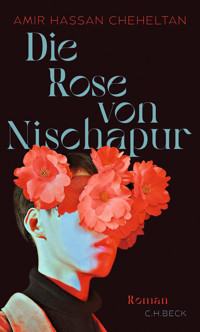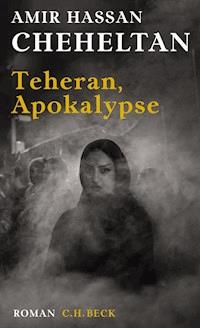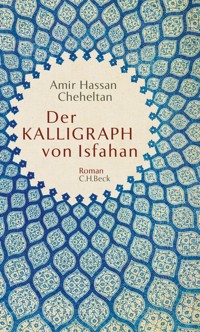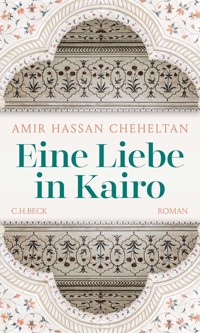
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Als der iranische Botschafter in Ägypten 1947 seinen Dienst antritt, muss er zwei Aufgaben lösen: Er soll Fausia, die Schwester des ägyptischen Königs, zur Rückkehr in den Iran bewegen, wo sie seit 1939 mit Schah Mohammed Reza Pahlevi verheiratet ist. Sie ist aus der unglücklichen Ehe zurück in ihre Heimat geflohen. Und er soll dafür sorgen, dass der Leichnam des in Südafrika verstorbenen Vaters Schah Rezas in den Iran überführt wird. Während sich der Botschafter in Kairo an die Erfüllung seiner Aufträge macht, verliebt er sich in Sakineh, die Frau eines indischen Philosophieprofessors in der ägyptischen Metropole. Kairos Atmosphäre und Stimmung, zwischen Rückständigkeit und Moderne, Bedrohung und Aufbruch in diesen Jahren fängt der neue Roman von Amir Hassan Cheheltan wunderbar ein. Und während wir über eine Liebe lesen, deren Schicksal eng verknüpft ist mit Erfolg oder Misserfolg des Botschafters, wird uns ebenso, subtil und komplex, historisch sorgfältig grundiert und in einer detailreichen Sprache das Bild einer Epoche und Region vermittelt, die bis heute unter den gleichen Spannungen steht und leidet, etwa dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Außerdem liefert der Roman dabei die Porträts einiger starker, unverhofft mächtiger Frauen. Sinnlich und klug, komisch und raffiniert – der neue, große Zeitroman des Balzac Irans (Berliner Zeitung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
AMIR HASSAN CHEHELTAN
Eine Liebe in Kairo
Roman
Aus dem Persischen von Jutta Himmelreich
C.H.BECK
ZUM BUCH
Als der iranische Botschafter in Ägypten 1947 seinen Dienst antritt, muss er zwei Aufgaben lösen: Er soll Fausia, die Schwester des ägyptischen Königs, zur Rückkehr in den Iran bewegen, wo sie seit 1939 mit Schah Reza Pahlevi verheiratet ist. Sie ist aus der unglücklichen Ehe zurück in ihre Heimat geflohen. Und er soll dafür sorgen, dass der Leichnam des in Südafrika verstorbenen Vaters Schah Rezas in den Iran überführt wird.
Während sich der Botschafter in Kairo an die Erfüllung seiner Aufträge macht, verliebt er sich in Sakineh, die Frau eines indischen Philosophieprofessors in der ägyptischen Metropole. Kairos Atmosphäre und Stimmung, zwischen Rückständigkeit und Moderne, Bedrohung und Aufbruch in diesen Jahren, fängt der neue Roman von Amir Hassan Cheheltan wunderbar ein. Und während wir über eine Liebe lesen, deren Schicksal eng mit Erfolg oder Misserfolg des Botschafters verknüpft ist, wird uns zugleich, subtil, historisch sorgfältig grundiert und in einer detailreichen Sprache, das Bild einer Epoche und Region geliefert, die bis heute unter den gleichen Spannungen leidet. Zugleich werden die Porträts einiger starker, unverhofft mächtiger Frauen gezeichnet. Sinnlich und klug, komisch und raffiniert – der neue große Zeitroman des «Balzac Irans» (Berliner Zeitung).
ÜBER DEN AUTOR
Amir Hassan Cheheltan, geboren 1956 in Teheran, studierte in England Elektrotechnik, nahm am Irakkrieg teil und veröffentlichte in Teheran Romane und Erzählungsbände. Sein Roman «Teheran, Revolutionsstraße» erschien 2009 als Welt-Erstveröffentlichung auf Deutsch, es folgten «Teheran, Apokalypse» und «Teheran, Stadt ohne Himmel». Zuletzt erschienen bei C. H.Beck seine Romane «Der Kalligraph von Isfahan» (2015) und «Der Zirkel der Literaturliebhaber» (2020), für den der Autor und die Übersetzerin 2020 den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt erhielten.
ÜBER DIE ÜBERSETZERIN
Jutta Himmelreich studierte Romanistik, Amerikanistik und Ethnologie in Frankfurt, Tucson, Arizona und Paris. Sie ist seit 1985 als Übersetzerin und Dolmetscherin in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Farsi tätig.
INHALT
KAPITEL 1
Mitte Oktober 1947 – Kairo
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 1
Mitte Oktober 1947 – Kairo
Mehrmals ließ der Botschafter den Blick durch die halbdunkle, fast menschenleere Ankunftshalle schweifen. Wartete vielleicht jemand auf ihn? Es war niemand zu sehen. Der Botschafter wusste nicht einmal, wohin es die Fluggäste verschlagen hatte, die mit ihm in Kairo gelandet waren. In einiger Entfernung sah er lediglich zwei Männer, die sich hinter dem verglasten Schalter einer ihm unbekannten Fluggesellschaft miteinander unterhielten. Merkwürdig, fast mysteriös, diese Stille am Flughafen der bedeutendsten arabischen Hauptstadt, zu dieser Tageszeit. Kaum aber hatte er seinen leichten Koffer abgestellt, um kurz Atem zu schöpfen, stand ein schlanker, dunkelhäutiger Mann vor ihm, lächelte ihn freundlich an und setzte so seiner Ungewissheit ein Ende. Er trug zwar einen hohen Fez, war aber ganz offenbar kein Ägypter. Er begrüßte den Botschafter wortkarg, verbeugte sich kurz, ließ ihm jedoch keine Zeit, die Begrüßung zu erwidern. Er nahm den Koffer an sich und bat den Botschafter, ihm zu folgen.
Das alles geschah so rasch, dass der Diplomat sich nicht einmal fragte, warum und wohin er ihm folgen sollte.
Um nicht hinter dem Mann zurückzufallen, tat er, wie ihm geheißen, und trat hinaus ins Freie, wo mehrere Autos standen. Der Dunkelhäutige ging auf einen der Wagen zu, öffnete den Kofferraum und verstaute des Botschafters Gepäck darin. Noch über den Kofferraum gebeugt, wandte er sich dem Botschafter zu, deutete auf den Wagen und öffnete ihm schon im nächsten Moment dessen Fond. Der Botschafter wusste kaum, wie ihm geschah. Da er die Lage, in die er so rasch geraten war, noch nicht vollständig erfasst hatte, sah er erst beim Einsteigen, dass sein Stellvertreter, vor Schmerz ächzend und stöhnend, dem Wagen mühevoll entstieg, und er hörte ihn, nach einer sehr kurzen Begrüßung, lang und breit erläutern, dass ihm, tags zuvor infolge einer kleinen Unachtsamkeit gestürzt, das Gehen zurzeit schwerer falle als ein Kopfsprung in den Sand. Er bat um Entschuldigung dafür, dass er seinen Vorgesetzten nicht schon in der Ankunftshalle empfangen hatte.
Der Botschafter kannte seinen Vize bereits und wusste um dessen Redseligkeit. Er fiel ihm ins Wort: «Sie hätten sich gar nicht herbemühen müssen.»
Er stieg in den Wagen. Der Fahrer, seinen Beifahrer aus dem Augenwinkel beobachtend, grinste, schloss die hintere Wagentür, setzte sich ans Steuer und brachte den Botschafter zum Staunen, weil er mitsamt seinem hohen Fez unter dem niedrigen Autodach Platz gefunden hatte.
Indes wuchtete sich sein Stellvertreter mit ebenso viel Aufhebens, wie er ihm entstiegen war, zurück ins Fahrzeug, wandte sich seinem Dienstherrn sofort zu und klagte, das letzte Wort betonend, über die drückende Schwüle in der Stadt: «Mittags das Haus zu verlassen, ist selbst zu dieser Jahreszeit eine Qual!» Der Botschafter nickte, kurbelte, während der Wagen sich in Bewegung setzte, die Fensterscheibe herunter und sah hinaus, um seinem Assistenten zu bedeuten, dass er die Unterhaltung nicht fortsetzen mochte. Dabei hatte der nicht unrecht. Vor drei Wochen schon hatte der Herbst eingesetzt, und dennoch war es in Kairo vor allem um die Mittagszeit noch so ungemein heiß, dass alles, was man in den Blick nahm, in einer zähen Flüssigkeit zu schweben schien. Sobald der Wagen das Flughafengelände verlassen hatte, schloss der Botschafter das Fenster wieder, zum Schutz gegen den heißen Wind, der ins Auto geweht war. Während er sich unterwegs mit seinem Assistenten über dies und das unterhielt, stellte er beim nächsten Blick aus dem Fenster fest, dass sie Kairos Stadtkern erreicht hatten. Von jetzt an würden sie, in den belebtesten Straßen einer der ältesten Städte der Erde, nur noch Schritt fahren können. ‹Daran werde ich mich gewöhnen müssen›, dachte der Botschafter. Gewöhnen an das Leben in einer Stadt, in der er heute seinen Dienst antrat.
Acht Jahre zuvor war er schon einmal kurz in Kairo gewesen, wenn auch mit anderem Auftrag. Damals hatten hochrangige Staatsmänner ihn begleitet, unter ihnen der iranische Kronprinz, der in Kairo Prinzessin Fausia, die Schwester des ägyptischen Königs Faruk, zu ehelichen gedachte, um sie anschließend mit nach Teheran zu nehmen, wo alles für ein gebührendes Hochzeitsfest vorbereitet war.
Der Fahrer bremste unsanft. Entschuldigte sich dafür sofort bei seinen Fahrgästen. Dieses ungewöhnliche Gedränge! Karren, Menschen, Lasttiere nahmen die gesamte Straße in Beschlag, die nicht klar vom Bürgersteig abgegrenzt war. Mit den Lebensbedingungen im arabischen Raum war der Botschafter wohl vertraut. Einem solchen Durcheinander aber schien er sich erstmals gegenüberzusehen. Er rückte nach vorn, auf die Sitzkante, um durch die Windschutzscheibe bessere Sicht auf das dichte Gewimmel zu haben. Da er recht gut Arabisch verstand, brachten ihn die Rufe, mit denen die Lastenträger sich ihre Wege durch die Menge bahnten, zum Lachen. Er hatte als junger Erwachsener Jahre in Beirut verbracht. Dem Fahrer entging die Verwunderung seines hochrangigen Fahrgasts nicht: «In letzter Zeit haben die Menschen große Angst.»
Natürlich konnte auch Angst der Auslöser für ein solches Wirrwarr sein. Neugierig beugte der Botschafter sich zum Fahrer vor, wollte Details zu diesem Sachverhalt erfahren. Doch sein Stellvertreter schüttelte bedauernd den Kopf, kam dem Fahrer zuvor und antwortete statt seiner: «Die Stadt hat keine Angst. Sie trauert.»
In den Gesichtern der geschäftigen Passanten konnte der Botschafter keine Anzeichen von Trauer erkennen. Umso neugieriger war er auf den Grund dafür. Der Fahrer lieferte ihn umgehend: «Sie trauern um die Opfer der Cholera. Täglich sterben in Kairo fünfhundert Menschen an der Krankheit.»
Des Botschafters Stellvertreter bekräftigte: «So steht es in den Zeitungen.» Argwöhnisch schob er nach: «Die tatsächlichen Zahlen liegen sicher höher.» Indem er beide Hände hob, verlieh er seinen Worten Nachdruck. Zwar hatte der Botschafter noch in Teheran vom Ausbruch der Cholera in Ägypten gehört. Der Ernst der Lage aber war ihm nicht klar gewesen. ‹Cholera auf der einen Seite, Unruhen in Palästina auf der anderen›, dachte er. Wie sollte er in diesem Ereignisgewirr seine Mission erfüllen? Würde er in Kairo mit seinen Anliegen überhaupt Gehör finden?
Oft hatte er in letzter Zeit über seinen komplizierten diplomatischen Auftrag nachgedacht. Er bestand darin, sowohl Mohammed-Reza Schahs geflohene Braut als auch Reza Schahs Leichnam in den Iran zurückzubringen. Der Vater des Bräutigams hatte die Wirren des Ersten Weltkriegs fern von Haus und Hof einsam im Ausland verbracht, dort auch sein Leben gelassen, und nun ruhte der Leichnam bis zu seiner Überführung nach Teheran in Kairos ar-Rifa’i-Moschee. Ein weiterer Auftrag bestand darin, Saudi-Arabien dazu zu bewegen, seine diplomatische Vertretung in Teheran wieder zu öffnen. Seit vier Jahren lagen die Beziehungen zwischen beiden Ländern, aufgrund der Enthauptung eines iranischen Pilgers in Mekka, auf Eis.
Unwirsch machte der Botschafter eine Handbewegung, wie um eine lästige Fliege zu verscheuchen, und schnaubte dabei. Als könne er sich mit einem kräftigen Schwung seines Arms der Last entledigen, die seine Mission ihm aufbürdete. «In welchem Teil Kairos sind wir jetzt?», fragte er, um auf andere Gedanken zu kommen, und schaute starr aus dem Fenster. Ohne eine Antwort abzuwarten, sagte er: «So viele Menschen!» Als erlebe er solch ein Szenario zum ersten Mal. Sein Assistent erläuterte: «Ganz gleich, in welchem Teil der Stadt wir sind, so ist es überall, jeden Tag. Straßen und Menschen in ständigem Ringen um Raum!»
Der Botschafter wusste allerdings, dass Kairo auch ein Nachtleben hatte. Das Resultat eines Jahrhunderts englischer Herrschaft über die Stadt. Und zum Glanz der Nächte trug die Neigung der Araber zu Frivolität und Ausschweifung bei!
Dessen war der Botschafter sich sicher. Mit einem entschlossenen Nicken bekräftigte er seine Überzeugung. Als der Wagen an einer Kreuzung kurz zum Stehen kam, hörte er zwei junge Zeitungsverkäufer, den einen auf der linken Straßenseite, auf der rechten den anderen, die jüngsten Schlagzeilen vom Blutvergießen in Palästina laut hinausschreien. Sie rissen ihn aus seinen Gedanken und setzten alles daran, auch andere Passanten auf sich aufmerksam zu machen. Vergeblich. Käufer ließen sich nicht begeistern, und auch des Botschafters Interesse war nur theoretischer Natur. Unterdessen sagte sein Stellvertreter: «Während die Juden täglich weiter vorrücken, sitzen die arabischen Staatsführer nur da und legen die Hände in den Schoß.»
Er seufzte laut, bedauernd, und fuhr fort: «Jetzt machen sich all die Waffen und die Munition, die die Juden den Engländern im gesamten Nahen Osten während des Zweiten Weltkriegs entwendet haben, bezahlt! Kürzlich kam heraus, dass sie sie in großen unterirdischen Lagern in von Juden bewohnten palästinensischen Dörfern gehortet haben.»
Nachrichten über Palästina verfolgte der Botschafter aufmerksam. Vor einigen Tagen war er im Libanon gewesen, als die Arabische Liga dort zusammenkam. Der irakische General Ismail Safwat hatte die arabischen Führer gebeten, schnellstmöglich Truppen an Palästinas Grenzen zu entsenden, die palästinensischen Kämpfer mit Waffen und Munition zu versorgen und ihnen weiterhin finanzielle Unterstützung zuzusichern. Er fand, hier sei höchste Eile geboten. Zur Untermauerung seiner Forderung zeichnete er ein in der Tat besorgniserregendes Bild der Lage der Palästinenser. Keine Soldaten, keine Waffen, keine Munition. Nur eine Million Pfund Sterling Finanzhilfe wurde bewilligt, ohne dabei festzulegen, wie das Geld bereitgestellt werden solle. Man traf auch eine weitere Vereinbarung, der zufolge in Kairo ein Militärkomitee zu bilden sei, zur Koordinierung der Unterstützung für die Palästinenser. Allerdings war von Anfang an klar, dass diese Entscheidung folgenlos bleiben und über das Papier, auf dem man sie festgehalten hatte, nicht hinausgehen würde. Während der Botschafter diese Ereignisse Revue passieren ließ, schauderte es ihn vor Abneigung: «Das Volk ist zu bedauern, es wird von einem Haufen ehrloser Gierhälse regiert!»
«Auch die Engländer, die dort für Ordnung sorgen sollen, schauen meist tatenlos zu. Schreiten nur ein, wenn die Araber die Oberhand haben. Sie treten zwar in Aktion, um die Juden vor Notlagen zu bewahren. Vor deren Gewalt sind sie trotzdem nicht sicher.» Hier übernahm der Fahrer das Gespräch und schilderte, wie Juden zwei hochrangige englische Offiziere ermordet hatten. Zwei jüdische Soldaten entführten die beiden Offiziere eines Abends aus einem Teehaus in Tel Aviv und knüpften sie in einem Waldstück auf. Tags darauf wollte ein englischer Offizier die Toten bergen. Als er die Seile durchtrennt hatte und die leblosen Gestalten zu Boden fielen, wurden sie durch eine Explosion zerfetzt, und der Offizier wurde erheblich im Gesicht verletzt. Man hatte die Leichen vermint.
Aus der Zeitung hatte der Botschafter von den durch diese Tat ausgelösten Protesten in London erfahren. Dort waren, nach Bekanntwerden der Nachricht, Häuser und Geschäfte jüdischer Bürger in Flammen aufgegangen.
An einer Nische des großen Markts angelangt, wo, bunt durcheinander, Fuhrwerke parkten, Lasttiere getränkt wurden, fliegende Händler, von möglicher Käuferschaft umringt, Waren feilboten, bemühte der Fahrer sich, seine Vorgesetzten auf andere Gedanken zu bringen: «Abends sieht man hier keine Menschenseele, nur Straßenköter. Menschen versammeln sich in der Stadt an den unterschiedlichsten Stellen, und überall anders. Hotels, Nachtklubs, Kasinos, bis die Sonne aufgeht.» Mittlerweile hatten sie das Botschaftsviertel erreicht.
Der Botschafter beließ es bei einer kurzen Begrüßung des Personals, das ihn, Schlange stehend, in der diplomatischen Vertretung erwartete, und verschob kurze Einzelgespräche auf später. Nach seiner ermüdenden Anreise wies man ihm den Weg in sein Schlafzimmer, das erstaunliche Ähnlichkeit mit seinem Schlafzimmer in Teheran hatte, wenngleich die Einrichtung wenig Stilgespür erkennen ließ. Übergroße, dunkelbraune Möbel. Helle Vorhänge mit purpurroten Fransen im Kontrast dazu, die trotz ihrer vielen Falten Licht ins Zimmer ließen. Dennoch öffnete der Botschafter sie, weil er den Raum bei Tageslicht betrachten wollte. Er hatte seinen Reiz. War etwa so groß wie sein Zimmer zu Hause, hatte zwei große Fenster, durch die man die mächtigen Wedel einer Palme auf der einen, auf der anderen eine Eiche sah, von der man noch einzelne Nüsse hätte pflücken können, wenn man die Hand ausgestreckt hätte. Ein deutlicher Unterschied zu seinem Zimmer in Teheran bestand allerdings darin, dass er sich hier seltsam fremd fühlte, in ungewohnter Atmosphäre, die woher rühren mochte? Von Kairo vielleicht? Wie sein Zimmer zu Hause hatte das Zimmer hier auch eine schmale Balkontür. Der Botschafter öffnete sie und spürte am frischen Luftzug von draußen, wie stickig es hier drinnen war. Auf dem Balkon standen zwei Korbstühle, zwischen beiden ein runder Tisch, darauf ein metallener Aschenbecher. Das Ganze umfriedet von einem schmiedeeisernen Gitter aus Weinlaub und Trauben.
Der Botschafter schloss die Tür, kippte die beiden Fenster zwecks Frischluftzufuhr und zog die Vorhänge wieder zu, um das Licht zu dämpfen. Dann ließ er sich aufs Bett fallen und sank in tiefen Schlaf. Der Grund für seine Erschöpfung lag weniger in seiner anstrengenden, mehrstündigen Flugreise, sondern vielmehr im Schlafentzug während der Woche, die er zuvor in Beirut verbracht hatte. Dort waren die Tage mit großen und kleinen Unterredungen vergangen, die Nächte mit Besuchen im Casino Schahin, bei Tänzerinnen und arabischer Musik. Und jetzt schlief er im zweiten Stock der diplomatischen Vertretung Irans, in einem klapprigen Bett, dessen Sprungfedern bei jeder seiner Regungen erbärmlich quietschten, während sein wirrer Traum ihn in die Berge führte. Dort stapfte er, Seite an Seite mit Linda Soursoq, jünger und schöner als er sie von den Farbbildern in arabischen Zeitschriften aus seiner Jugend in Erinnerung hatte, auf einem schmalen Pfad bergan, während der aus ihrem Dekolleté aufsteigende Duft ihm den Kopf verdrehte. Er war Madame Soursoq erstmals auf seiner letzten Libanonreise begegnet. Einer nun Sechzigjährigen, der man trotz ihrer Falten die seltene Schönheit ansah, mit der sie als junge Frau wohl gesegnet gewesen war. Wenn er sich nicht irrte, verdankte sie ihre Bekanntheit erstens dieser Schönheit und zweitens ihrer Affäre mit Ahmet Dschemal Pascha. Dass sie eines Abends im Laufe einer Zusammenkunft mehrmals in Erscheinung trat, gab dem Botschafter Anlass, sich zu fragen, über welche Qualitäten eine Frau verfügen musste, um die Aufmerksamkeit eines so blutrünstigen Mannes wie Dschemal Pascha zu erregen, der bis heute als ‹Aufseher des Völkermords› an Armeniern, Assyrern und Aramäern im Ersten Weltkrieg gilt. In Konstantinopel ansässig, fungierte er, im Triumvirat mit zwei weiteren hochrangigen Staatsbeamten, Talaat Bey und Enver Pascha, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs als Generalgouverneur des Osmanischen Reichs. In jenen Krisenjahren hatte der Botschafter sein Medizinstudium in Beirut begonnen.
Bei der erwähnten Zusammenkunft war auch die Tochter des vorherigen libanesischen Regierungschefs zugegen, die sich, wie viele andere Beiruter auch, ihrer Muttersprache schämte, folglich nur Französisch parlierte und sich sehr schnell als außerordentlich flatterhaft entpuppte. Ein Mitarbeiter der Botschaft, gut aussehend, stattlich gebaut, trug sie nach dem Abendessen, vor den Augen der versammelten Gesellschaft, plötzlich von der Tafel weg, offenbar, um sie für den Rest des Abends zu entführen. Schon kurz darauf aber ließ er wieder von ihr ab, als er sah, wie sie von jemandem Kokain kaufte. So zumindest schilderte er die Begebenheit seinem Dienstherrn am nächsten Tag in aller Ausführlichkeit. Bei anderen Treffen war es ähnlich zugegangen. Unentwegt hatten die Libanesen von der französischen Triade de Musset, Lamartine und Hugo geredet, ohne jemals die Namen großer arabischer Dichter und Philosophen wie Abu l-’Ala’ al-Ma’arri oder Matnabi auch nur gehört zu haben, was den Botschafter zutiefst erzürnte. Wo auch immer im Orient die Franzosen aufgetaucht waren, hatten sie die Menschen vor Ort seelisch vergiftet und sie von sich selbst entfremdet.
Des Botschafters wirrer Traum ging damit weiter, dass Dschemal Pascha zu Pferd erschien und die junge Madame Soursoq hinter sich in den Sattel hob. Er endete mit dem Ritt der beiden in die Ferne. Während seiner Studienzeit in Beirut hatte der Botschafter Madame Soursoq auf den Titelbildern libanesischer Zeitschriften gesehen, ihre strahlende Jugend und Schönheit im Wettstreit mit den vielen Juwelen, die sie jeweils trug. Damals hätte er es sich nicht träumen lassen, dass er ihr eines Tages persönlich begegnen und ihr schon bei der ersten Begegnung so nahekommen würde, dass sie ihm, eine leichte Unpässlichkeit am nächsten Tag vorgebend, einen Korb Blumen ins Hotel schicken ließ. Was hätte er dagegen tun sollen? Schon seit seiner Jugend hatte er auf Frauen faszinierend gewirkt.
Im Halbschlaf versuchte er, sich Madame Soursoq so vorzustellen, wie er sie durch ihre Jugendporträts in Erinnerung hatte. Zu schade, dass er die Schönheit erst jetzt, als Sechzigjährige, kennenlernte. Dass er so dachte, erstaunte ihn, erfreulich fand er es nicht. Junge Frauen gern. Ältere? Nein. Tatsächlich war es ihm zeit seines Lebens zuwider, dass solche Frauen Gefallen an ihm fanden, erst recht, wenn sie, in die Jahre gekommen, verflossene Geliebte eines blutrünstigen Paschas waren. Dieses Gefühl der Abneigung weckte ihn. Er schlug die Augen auf, blieb eine Weile reglos liegen, um sich zurechtzufinden. In Nordamerika war er gewiss nicht. Dort sah alles ganz anders aus als hier. Das etwas heruntergekommene Zimmer kam ihm, aus unerfindlichem Grund, plötzlich uralt vor.
Gedämpfter Straßenlärm holte ihn in die Gegenwart zurück. Nach Kairo. Er setzte sich auf die Bettkante, spürte sofort die Last seines schweren, umfangreichen Auftrags wieder, und wieder packte ihn die Angst. Wachsende Angst. Er musste möglichst umgehend die ersten Schritte zur Erfüllung seiner Mission unternehmen.
An diesem Nachmittag standen zwei wichtige offizielle Amtshandlungen an. Die erste bestand darin, im Abdeen-Palast vorstellig zu werden und sich in die Gästebücher des Königs Faruk, das seiner Frau und seiner Mutter und auch in das Ihrer Hoheit Königin Fausia einzutragen. Die zweite würde ihn zu einer Kranzniederlegung an die Ruhestätte König Fouads I. in der ar-Rifa’i-Moschee führen, wo auch Reza Schah ruhte. So rasch wie möglich musste er Gespräche mit zwei Personen aufnehmen: zum einen mit Sulfikar Pascha, König Faruks Schwiegervater, mit dem ihn eine lange Freundschaft verband und der ihm vermutlich wie kein Zweiter die durch Fausias Scheidungsantrag bedingten Verwicklungen am ägyptischen Hof würde erläutern können. Zum andern mit US-Botschafter Tuck, dem er ein Schreiben seines Amtskollegen George Allan in Teheran zu überbringen hatte. Auf beide Lageberichte war er sehr gespannt.
*
Während der nächsten Tage verließ der Botschafter seine Dienststelle nicht. Er suchte die verschiedenen Abteilungen auf, gab hier Anweisungen zu Renovierungen und Innenarbeiten, dort zu Reparaturen am Gebäude. Weil die Vertretung zeitweise ohne Leitung geblieben war, hatte sich Post angesammelt, die nun auf des Botschafters Schreibtisch ihrer Bearbeitung harrte. So manches Ersuchen hatte sich durchs längere Liegen erledigt, andere konnte sein Stellvertreter weisungsgemäß bearbeiten, die übrigen wanderten ins Archiv. Der Botschafter machte sich ans Werk, las rund um die Uhr Antrag um Antrag, konnte die Stapel an Dokumenten binnen Kurzem reduzieren und fand sogar noch Zeit, sich mit seinem neuen Mitarbeiterstab vertrauter zu machen. Er verfasste Schreiben nach Teheran, Beirut und San Francisco, die er erst spätabends, nachdem das übliche Arbeitspensum erledigt war, Gelegenheit hatte, in Telegrammform zu bringen, um Mohammad Reza Schahs Privatsekretariat über seine Ankunft in Kairo in Kenntnis zu setzen und zusätzliche Themen zu benennen, die er im Laufe seiner Konsultationen mit Entscheidungsträgern am ägyptischen Hof anzusprechen gedachte.
Zu Mittag aß er während dieser Zeit allein und in aller Eile, um den vielen nachmittags vorstellig werdenden Menschen aus Kairos iranischer Gemeinde im großen Empfangsraum der Botschaft zu Diensten sein zu können. Mit manchen tat er sich schwer, weil ihre Ansinnen eines Diplomaten Möglichkeiten überstiegen. Dennoch musste er möglichst günstige Prognosen machen, obwohl ihm die Hände gebunden waren. Auch Geschäftsleute wurden vorstellig, meist seit mehreren Generationen bereits in Ägypten tätig, und ein Konditor, der dem Botschafter eine Auswahl iranischer Süßspeisen und Gebäck zum Geschenk machte. Ein, zwei Mullahs, Studenten an der Al-Azhar-Universität, zählten ebenfalls zur iranischen Gemeinde, und auch junge ägyptische Doktoranden suchten ihn mit der Bitte um Unterstützung bei ihren Recherchen zur Promotion über klassische iranische Literatur auf. Sogar eine Sängerin trat mit einem Anliegen an ihn heran. Eine Frau mittleren Alters, keine Augenweide, das unschön gefärbte Haar zu beiden Seiten am Kopf so geflochten, dass es aussah, als habe sie sich zwei große Tomaten über die Stirn gepflanzt. Sie trug den seltsamen Namen Parandehpur, Vogelsohn, und hatte eine noch seltsamere Bitte: Der Botschafter möge seinen Einfluss geltend machen und ihr in Kairos angesehenen Casinos Auftritte verschaffen. In Etablissements, in denen Diplomaten und Politiker hohen Rangs verkehrten. Sie erwähnte einen Herrn Karim Sabet, der Iraner sei, die namhaftesten Casinos der Stadt betreibe und König Faruk nahestand. Sie versprach sich von diesem Schritt einen Karriereschub und war – vielmehr noch – überzeugt, ihre Berühmtheit könne dabei helfen, der ägyptischen Bevölkerung die hohe Kunst der iranischen Musik nahezubringen. Der Botschafter schüttelte den Kopf über diesen Plan, gab der Künstlerin lächelnd zu verstehen, dass er ihr diese Bitte zwar nicht von vornherein abschlagen, ihr aber auch keine falschen Versprechungen machen wolle. Nicht selten war er nach solchen Gesprächen sehr angespannt, frustriert, zudem sicher, dass er es hier mit Menschen zu tun hatte, die Unmögliches von ihm fordern würden, wenn er nachgiebig wäre. An solchen Tagen ging er abends früh schlafen. Zumal seine von den USA aus nach Ägypten verschiffte Kiste mit Büchern in Kairo noch nicht eingetroffen war.
Eines Abends, nach einem weiteren sehr arbeitsreichen Tag, brachte seine Sekretärin ihm ein Einschreiben, adressiert an Irans diplomatische Vertretung in Kairo, versandt vom Philosophen Walikhan Hindi. Der Botschafter ließ den Blick eine Weile auf dem Namen Walikhan ruhen. War er’s wirklich? Unter den Tausenden Namen Tausender Menschen verschiedenster Nationalitäten, die einem Diplomaten durch den Kopf schwirren, trat dieser allmählich hervor, denn er war an eine besondere Erinnerung geknüpft. Eine Erinnerung, die, nach vielen Jahren tief in seinem Gedächtnis vergraben, noch erstaunlich lebendig war. Je länger er an sie zurückdachte, desto lebhafter wurde sie und hob des Botschafters Stimmung. Wie weggeblasen war seine schlechte Laune, durch all die Iranerinnen, Iraner verursacht, die ihn heute, und an so vielen anderen Nachmittagen, wie aufdringliche Fliegen umschwärmt und ihn hartnäckig gedrängt hatten, ihre unsinnigen Anträge zu bewilligen.
Die Erinnerung war mit dem indischen Philosophen, vor allem aber mit der jungen Frau in seiner Begleitung verbunden, der der Botschafter vor Jahren begegnet war. Eine Amerikanerin, rank, schlank, höchst attraktiv. Wobei er sich damals gefragt hatte, was die hübsche Frau an diesem indischen Philosophen und an seinen Thesen und Absichten anziehend fand? Ein Primat in Paarungsstimmung, der auf die außergewöhnliche Schönheit einen Alleinanspruch erhob.
Die Begebenheit reichte rund fünfzehn Jahre zurück. Eines Sommers war der Botschafter nach Frankreich gereist, um in Paris, gemeinsam mit einem Freund, die dortige Moschee zu besuchen.
Das kleine Café der Moschee in einem Winkel des ausgedehnten, beschaulichen Gartens war strohgedeckt, zum Schutz vor direkter Sonne. Das nützliche Strohdach, sanfter Wind von der Seine her, arabische Musik, durch die offenen Fenster des Cafés auch draußen im Freien hörbar, hatten das Gartenlokal zu einem gemütlichen Fleckchen Erde gemacht, an dem ein Glas Tee umso wohler tat. Da der Botschafter und sein iranischer Freund sich auf Persisch unterhielten, als sie das Café betraten, wurde an einem der Tische ein Inder, in Begleitung einer hübschen jungen Dame, auf sie aufmerksam. Wo auch immer, wie auch immer übten junge Frauen eine magnetische Anziehungskraft auf den Botschafter aus. Noch bevor er den Inder bemerkte, war ihm die junge Dame aufgefallen, mit ihrem rätselhaft widersprüchlichen Blick, den der Diplomat sofort erfasste, weil er ihm vertraut schien. Der Inder lud die beiden Männer auf Persisch ein, sich zu ihnen an den Tisch zu setzen, und stellte sich, während sie Platz nahmen, als Philosoph Walikhan vor. Behaglich war dem Botschafter dabei nicht zumute. «Ich unterrichte islamische Philosophie», erläuterte er und gab sich, trotz seiner offensichtlich indischen Herkunft, unverhohlen stolz als Iraner aus, schwächte das Postulat jedoch ab, als er des Botschafters Verwunderung bemerkte: «Ich habe iranische Vorfahren.»
Er rief den Kellner und bestellte zwei Gläser Tee, ohne seine Gäste nach ihren Wünschen gefragt zu haben. Seine hervortretenden Augen und das große, fleischige Muttermal auf einem Nasenflügel machten sein Gesicht unansehnlich. Wenn der Philosoph den Botschafter ansah, schien er den Blick auf dessen linke Schulter zu richten.
«Ich gebe eine philosophische Zeitschrift heraus, wissen Sie. Der Westen ist auf einem Irrweg, eine elende, armselige Region.»
Bedauernd seufzte er und schüttelte zugleich ratlos den Kopf. Er schien eine überirdische Mission erfüllen zu müssen, den Westen zu retten. Das sprach zumindest aus seinem Blick. Die hübsche junge Dame nickte indes bekräftigend und fischte des Inders Worte förmlich aus der Luft. In der leicht angespannten Atmosphäre sprach unbeschreibliche Hingabe aus ihrem Blick, eine Art Anbetung, wie Jünger sie einem Heiligen entgegenbringen. Als sie sich dem Botschafter erneut zuwandte, blitzte wieder diese unbändige Kraft in ihren Augen auf. Jedenfalls zeigte die junge Frau, dass sie sich ihrer Schönheit keinesfalls bewusst war.
Woher aber rührte sein Gefühl, diesen Blick, dieses Gesicht bereits zu kennen? Das hätte er sie gern gefragt, doch der Retter des Westens übernahm das Gespräch, hob beide Hände und sagte in höchstem Eifer: «Meine wichtigste Aufgabe besteht darin, ihnen vor Augen zu führen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Anschließend heißt’s, sie zivilisieren.»
Er würde gewiss gleich mit der Faust auf den Tisch schlagen, so des Botschafters Vermutung nach diesem kurzen Ausbruch. Doch der Philosoph begnügte sich damit, seinen erhobenen Zeigefinger zu schwingen, mit großer Entschlossenheit. Und er hatte noch mehr zu sagen: «Seitdem ich mir das vorgenommen habe, bin ich in Europa mancherorts nicht gern gesehen.» Dann seufzte er gedehnt und schloss mit der Feststellung: «Der Europäer ist ein Wilder, ein Dieb, der sich aufführt, als sei er die Krone der Schöpfung, das Beste, was das Universum zu bieten hat.»
‹Moment, was gibt der Mann da von sich?›, dachte der Botschafter. Er wandte sich von der jungen Frau ab und nahm den Inder in den Blick, das ungepflegte Äußere, das dunkle Gesicht, die Glubschaugen, den ungekämmten Schnurrbart, den Mund voller schwarzer Zähne. Erträglich wurde dieser unschöne Moment durch die Anmut der bedauerlicherweise an den Lippen dieses Mannes hängenden jungen Frau. Wenn er nur wüsste, wo er sie schon einmal gesehen hatte!
Bald stellte sich jedoch heraus, dass der seltene Schatz, den die Gesellschaft der jungen Schönen an diesem Sommernachmittag darstellte, des Philosophen entsetzliches Gefasel nicht wettmachen konnte, weshalb die beiden Männer sich alsbald verabschiedeten.
Die zweite Begegnung, Tage später, ergab sich ebenfalls zufällig, im Café Coupole, am Montparnasse. Wieder war der Philosoph in Begleitung der schönen Frau, wieder bat er den Botschafter zu sich an den Tisch und stellte ihm die Schöne diesmal vor: «Meine Sekretärin, die bald zum Islam konvertieren wird. Sie studiert in Paris Sanskrit und jüdische Geschichte.»
‹Das Absurdeste, was eine schöne, junge Frau studieren kann›, dachte der Botschafter. Ohne sich seine Geringschätzung anmerken zu lassen, verbeugte er sich, drückte der Akademikerin lächelnd sein Lob aus, streckte ihr seine Hand entgegen und wartete darauf, dass sie sie ergriff. Wieder sah er ihr in die Augen, als er ihre zarte Hand drückte, und wieder erkannte er die widerstreitenden Kräfte in ihrem Blick.
Nach dieser kurzen Begrüßung hatte der Botschafter kaum am Tisch der beiden Platz genommen, als der mit starkem Akzent philosophierende Inder, der nur ein einziges Gesprächsthema zu haben schien, kein gutes Haar an Europa, den Europäern, deren Wissenschaft und Gesellschaft mehr ließ. Er wischte sich mit Daumen und Zeigefinger kurz über die Mundwinkel, wollte seine Tirade fortsetzen, beschloss stattdessen unverhofft, seine Glubschaugen auf den Botschafter, genauer gesagt, auf dessen linke Schulter zu richten und zu schweigen.
Derart beäugt, fühlte der Botschafter sich sichtlich unwohl. Unbegreiflich war ihm, wie jemand so grob daherreden konnte, noch dazu in Gesellschaft einer reizenden, jungen Dame. Er konnte nicht anders, als dem Westen, zumindest bedingt, beizuspringen: «Schauen Sie, man kann die westliche Zivilisation nicht in Bausch und Bogen verdammen oder gar als Anomalie abtun. Sie hat, genauer betrachtet, trotz all ihrer Fehler, auch Vorzüge.»
Schneller, so dachte er, könne man ihm nicht widersprechen. In diesem Moment öffnete die junge, engelhafte Gestalt, die mit ihnen am Tisch saß, ihre Lippen und richtete das Wort an den Botschafter: «Verzeihen Sie, mein Herr, da muss ich Ihnen kurz, aber ganz offen entgegenhalten, dass die westliche Zivilisation nichts Bemerkenswertes zu bieten hat. Wo man auch hinschaut, sieht man entweder Gewalt, Kriminalität, peinliche Dinge oder anderes Schändliche.»
Der Eifer, mit dem sie bei der Sache war, offenbarte die widerstreitenden Kräfte in ihren Augen noch stärker. Der Botschafter ließ sie gern reden. Was sie sagte, war ihm einerlei. Er genoss den Klang ihrer schönen Stimme und verlor sein Herz im Nu an die sanften Kopfbewegungen, die sie zwischen zwei Sätzen machte. Ihre offenen Worte aber trafen ihn unvorbereitet.
Den beiden gegenüber saß der indische Philosoph, in seinen Stuhl gesunken, hatte sich die Reste des kürzlich verzehrten Essens noch immer nicht vollständig aus den Mundwinkeln gewischt und nickte der jungen Frau aufmunternd zu. Widerwärtig anzusehen!
Was des Diplomaten Abscheu noch verstärkte, war seine Vorstellung, dass dieser hässliche Inder diese junge Frau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Nacht für Nacht vögelte. Insgeheim musste er allerdings zugeben, dass er nicht wissen konnte, was sich zwischen den beiden hinter verschlossenen Türen tat. Vielleicht verfügte der Philosoph über verborgene Qualitäten, an denen es anderen Männern fehlte. Ob er, ausdauernd, inbrünstig, allabendlich eine oder zwei Stunden mit der Schaffung der Voraussetzungen zur geistigen Erbauung dieses Engels auf Erden verbrachte? Was sonst könnte dieses Wunder der Schöpfung in den Fängen dieses jämmerlichen alten Mannes halten? Wer, außer Gott, mochte das wissen?
Um seinen Abscheu zu lindern, schaute der Botschafter die schöne Meisterin der wohl gewählten Worte noch einmal an und hatte plötzlich das Gefühl, sein Schweigen zu ihres Herrn und Meisters Weisungen würde ihn wie einen Vollidioten dastehen lassen. Also machte er sich, sehr gefasst, ein weiteres Mal zum Fürsprecher des Westens: «Verehrteste, wie kann man eine Zivilisation, eine Gesellschaft, ein Volk zu einhundert Prozent und ausnahmslos als verderbt verurteilen? Wenn Sie sagen würden, es liegen nur wenige positive Aspekte vor, könnte ich Ihnen beipflichten. Wenn Sie sagen würden, im Westen hat der Materialismus die Menschlichkeit verdrängt, hätten Sie meine Zustimmung. Aber rundweg alles als schlecht abzutun, kann ich nicht gutheißen.» Statt klein beizugeben, schüttelte die Fee energisch den Kopf: «Bei allem Respekt, aber Sie verstehen den Westen nicht.» Und um einen Schlusspunkt zu setzen, wandte sie sich von ihm ab, sah in die Ferne. Kurz darauf besann sie sich anders und brachte einen Zusatzpunkt an: «Die wahre Zivilisation liegt im Osten. Dort geht die Sonne auf. Der Osten ist die Wiege der Zivilisation. Dort liegt der Anfang allen Seins und aller Dinge, und dort entwickelt sich alles beständig weiter. Alles Östliche ist gut und genehm.»
Eine junge Frau aus dem Okzident verliebt in den Orient! Ein eher zweifelhaftes Phänomen, vor allem, wenn einem sofort eine andere abenteuerlustige, im Osten sehr einflussreiche Frau aus der westlichen Welt in den Sinn kam.
«Kennen Sie die Engländerin Gertrude Bell?»
«Nein», sagte die junge Frau und zuckte dabei gleichgültig mit den Schultern.
«Sie war Archäologin, reiselustig, begeisterte Alpinistin. Bis sie im Jahr 1892, nach ihrem Studium in Oxford, ihren in Teheran als Diplomat tätigen Onkel besuchte. Dort begann ihr neues Leben. Sie verfiel der legendären Anziehungskraft des Orients, genau wie Sie, Madame!», erläuterte der Botschafter, hielt kurz inne, deutete dann auf sie. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, schüttelte bedauernd den Kopf und führte weiter aus: «Ihr Interesse hat den Menschen im Nahen Osten Jahre später das Leben sehr schwer gemacht.» Nun wurde nicht nur die hübsche Sekretärin hellhörig, sondern auch ihr Chef, Philosoph Walikhan. Erwartungsvoll sahen sie beide den Botschafter an. «Ja, Gertrude Bell veröffentlichte ihre Reisenotizen bald als Buch, Persian Pictures, Persische Reisebilder, und lernte so gut Persisch, dass sie Lyrik des großen Hafis ins Englische übertragen konnte. Dann interessierte sie sich fürs Arabische. Auch das lernte sie gut. Und einige Jahre später bereiste sie den gesamten Nahen Osten, ein ganzes Jahrzehnt lang. Ihre Reisen führten sie über die gesamte Arabische Halbinsel sowie nach Damaskus, Bagdad, Beirut, Kairo, Jerusalem. Sie bahnte Freundschaften mit den führenden Köpfen der arabischen Völker an und wurde bald in deren engste Kreise aufgenommen. Ein Privileg, in dessen Genuss nur eine Frau gelangen konnte. Bald kannte sie den Nahen Osten so gut wie ihre eigenen Handflächen. ‹Warum meinen Wissens- und Erfahrungsschatz ungenutzt lassen?›, dachte sie sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs und sprach beim Kairoer Büro des englischen Geheimdiensts vor. Deren Kommandeure erteilten ihr den Auftrag, in ganz Nordafrika Frontsoldaten für England zu rekrutieren. Bis zu ihrem Tod war sie die einzige Frau, die Macht und großen Einfluss auf die Ausgestaltung der englischen Kolonialpolitik im Nahen Osten hatte.
Manche bezeichnen sie abschätzig als Spionin, werden ihrer Persönlichkeit damit aber nicht gerecht.
Sie war auch Zeugin des Genozids an den Armeniern im Jahr 1915, hatte mit eigenen Augen gesehen, wie türkische Männer Armenierinnen auf Märkten in Damaskus meistbietend versteigerten. Zum Zeichen der Besiegelung einer solchen Transaktion war es üblich, der verkauften Ware mit dem Auktionshammer einen leichten Hieb auf den Kopf zu versetzen. Bells Memoiren ist zu entnehmen, dass ein übereifriger Auktionator einer Armenierin so heftig auf den Kopf schlug, dass sie in Ohnmacht fiel und der Käufer von seinem Kauf zurücktrat.»
Staunend, vor Schreck auch, stieß das junge Engelskind einen Schrei aus und hielt sich rasch den Mund zu. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, weil sie es wohl angebracht fand, Distanz zu halten von dem Mann und dem, was er da sagte.
Er setzte seine Schilderung unbeirrt fort.
«Als sich bei Kriegsende der Zerfall des Osmanischen Reichs abzeichnete, erhielt Gertrude Bell von den Engländern den Auftrag, die Lage in Mesopotamien zu sondieren. Als starke Befürworterin eines unabhängigen Staates in der Region kam sie mit den dort ansässigen Kurden, Schiiten und Sunniten dahingehend überein, ihre Selbstbestimmung unter sich zu regeln. Weshalb man sie bald auch die Mutter des Iraks nannte. Ihre Beliebtheit unter den Führern in der arabischen Welt brachte ihr auch das Vertrauen hochrangiger englischer Politiker ein. Dieser Rückhalt verschaffte ihr Macht und Anerkennung, die ihresgleichen suchten. Die Araber nannten sie Al Khatun, die Königin der Wüste. Nicht wenige Menschen sehen die jetzige Lage im Irak, erwartbar, als Folge der durch Bells Wirken gezogenen geografischen Grenzen.»
Gewiss eindrucksvoll, das Vermächtnis dieser Gertrude Bell. Um sich aber von ihr zu distanzieren, sagte des Botschafters hübsches Gegenüber: «Ich bin das genaue Gegenteil von ihr. Sie hat ihr Wissen und ihre Erfahrung in den Dienst des Teufels gestellt, um den Orient an die Kandare zu legen. Ich hingegen bin fest überzeugt: Die Menschen im Osten müssen sich nicht nur vom Joch des Kolonialismus befreien. Sie müssen den Westen regieren. Das ist meine These, kurz, prägnant.»
Lebhaft und in allem Ernst vorgebracht, begleitet von einem stechenden Blick, der dem Gesprächspartner bis ins Mark drang, klangen ihre Worte durchs ganze Café und ernteten auch diesmal die uneingeschränkte, wenngleich schweigend vermittelte Zustimmung des Philosophen. Wie ein von seiner talentiertesten Studentin in den Schatten gestellter Professor lächelte er triumphierend und wackelte dabei zufrieden mit dem Kopf.
Der Botschafter wollte aufbrausen – hielt jedoch an sich: «Gnädige Frau, ich bin im Orient geboren und müsste mich glücklich schätzen, Sie diese Ansicht vertreten zu hören. Trotzdem muss ich sagen, es steht nicht alles zum Besten bei uns. Wir haben Schwächen, wir haben unsere schlechten Seiten. Was Entwicklung betrifft, sind wir im Rückstand.»
Das himmlische Wesen beugte sich in seinem Stuhl vor und streckte dem Botschafter beide Hände entgegen: «Die westliche Zivilisation ist krank, werter Herr Botschafter. Unter einem Mikroskop betrachtet, wäre es für alle Welt offensichtlich: Der Orient hat die Pflicht und Aufgabe, den Okzident zu heilen.»
«Vorausgesetzt, Ihre Diagnose stimmt, dann müsste man nach Medizin für den Westen auch im Westen suchen.»
«Der Westen braucht den Osten. Ohne ihn ist er nichts!»
«Sie machen aus dem Westen ‹das Andere›. Genau das haben Orientalisten mit dem Osten getan und sich dafür die Bezeichnung ‹auf den Kopf gestellte, umgekehrte› Orientalisten eingehandelt!»
«Nennen Sie sie, wie Sie wollen.»
Was sollte das nun wieder heißen? Der Botschafter schwieg und sann eine Weile darüber nach, was wohl hinter diesen Worten stecken mochte. Die laute Musik im Café lenkte ihn zwar ab, doch schließlich fragte er sein hübsches Gegenüber: «Welchen Orient meinen Sie denn? Bitte bedenken Sie: Die Kulturen im Okzident haben sehr vieles miteinander gemeinsam. Im Orient ist das nicht so. Hier haben wir es mit einer Vielzahl einander nicht sonderlich ähnlicher Kulturen zu tun.»
«Sie sind alle gut, alle!»
«Konzepte wie Osten und Westen bedeuten doch heute kaum noch etwas. Von Orient und Okzident konnte man zu Zeiten der alten Perser und der alten Griechen noch sprechen, deren Imperien, Kulturen, Gesellschaften, Denkweisen im Streben nach Weltherrschaft in Konkurrenz zueinander standen. Anders als heute.»
«Doch, das kann man, bis heute. Der Orient steht für Spiritualität, Geist, Verstand. Davon findet man im Okzident keine Spur», sagte die junge Frau mit Nachdruck und sah den Botschafter dabei herausfordernd an. Der wandte sich ab, schaute verunsichert, fast verstört in den Raum. Unter den Augen dieser Frau schien alles, was er hier sah, seltsam unnachgiebig geworden zu sein, unvereinbar miteinander. Er gewann seine Fassung zurück und sagte dann: «Gestatten Sie, dass ich auf einen noch größeren Unterschied hinweise. Der Westen hat Kopernikus, Galileo, Newton. Die Basis für den Buchdruck wurde im Westen gelegt, im Westen erfand man das Schießpulver und die Wirkung der Dampfkraft.»
«Doch von den geistigen, spirituellen Ebenen, die der Osten längst erreicht hat, ist der Westen noch Jahrhunderte entfernt.»
In ihrer Hartnäckigkeit hätte die junge Frau, keinem erdenklichen Argument des Menschenverstands auch nur annähernd zugänglich, den Botschafter um ein Haar zum Gotteslästerer gemacht. Einlenkend legte er nun beide Handflächen auf die Knie, beugte sich vor, ohne sich jedoch zu erheben. Es wäre unhöflich gewesen, mitten im Gespräch zu gehen. Unverschämt auch, angesichts der Schönheit seines Gegenübers. Der Botschafter atmete tief durch und sagte, ungewöhnlich empathisch: «Ich weiß, weshalb Sie Ihre Schlüsse ziehen. Gewiss hat Ihnen jemand irgendwann gesagt, der Orient ist dieses fremde, rätselhafte, verblüffende, eigensinnige, irrationale, sexuell abnorme Andere weiblichen Charakters, in einem Wort: ein Orient wie aus Tausendundeiner Nacht. Im Zuge dessen sind Sie an Informationen und Ideen geraten, die dieses Klischee auf den Kopf gestellt haben. Antoine Galland würde sich im Grabe umdrehen. Er hat Anfang des achtzehnten Jahrhunderts Tausendundeine Nacht übersetzt.» Das schöne Gegenüber lächelte verständnisvoll, während der Botschafter in aller Ruhe hinzusetzte: «Ich weiß, Sie mögen dieses Klischee nicht. Aber Sie irren, wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen, indem Sie die westliche Zivilisation und Kultur komplett ignorieren.» Einzulenken war die Schöne keineswegs bereit. «Der Westen ist hohl und inhaltsleer», sagte sie, «und Sie haben sich, warum auch immer, von seinem Äußeren täuschen lassen. Als jemand, der Sanskrit studiert hat, sage ich Ihnen: In Indien liegt der Ursprung aller Sprachen, aus Indien kommen alle Ideen. Osten heißt schlicht und einfach alles!»
In ernstem Ton fragte der Botschafter: «Meinen Sie nicht, dass solche Überhöhungen Napoleon auf den Orient aufmerksam gemacht, mithin das wachsende Interesse anderer Europäer geweckt haben? Französische Historiker nannten Ägypten die Perle des Orients. Ein Dutzend Orientalisten begleitete Napoleon auf seinem Ägypten-Feldzug.»
Die nun eintretende Stille stimmte die Schöne nicht milder. Was wohl mit darin begründet lag, dass der europäische Kolonialismus den Menschen im Orient nicht nur während der letzten ein, zwei Jahrhunderte Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch die Zukunft zerstört hatte. Vermutlich wusste die schöne Sanskritstudentin nicht, dass den Europäern der Gestank ihrer Ignoranz und ihres engstirnigen Mangels an Weltgewandtheit schon vor ihrer tatsächlichen Einmischung vorausgeeilt war. Dank ihrer makellosen Erscheinung widersprach der Botschafter seiner Gesprächspartnerin nicht offen.
In versöhnlichem Ton sagte er: «Ich weiß sehr wohl, dass der Westen sich dem Osten gegenüber mehr als einmal ungerecht verhalten hat. Europäische Gelehrte behaupteten jahrhundertelang, die Lehren des Koran seien lediglich Nacherzählungen der Thora und der Bibel. Sie wollten den Islam mit allen Mitteln diskreditieren und seine Anhängerschaft demütigen, bezeichneten den Islam, im Gegensatz zu ihrer eigenen Religion, als von Natur aus gewaltbereit. Indem sie Muslime als Verfechter von Homosexualität, Prostitution und Ehebruch darstellten, bereiteten sie den Boden für ihre eigene Mission: Die Erleuchtung des Christentums dorthin zu bringen, wo die Menschen, ihrer Lesart nach, in Dunkelheit dahinvegetierten.»
Die junge Frau nickte lächelnd, im Gefühl, einen Sieg errungen zu haben. Und da der Botschafter schwieg, ermunterte sie ihn spöttisch: «Bitte reden Sie weiter. Sie sind ja sogar besser im Bilde als ich.»
«Es ist kein Geheimnis, dass der Westen den Osten für nicht entwicklungsfähig hielt, für unfähig, sich selbst zu erkennen und sich selbst zu bestimmen. Zugleich sah er in ihm einen unendlichen Quell von Mysterien, Geheimnissen, Rätseln, unliebsamen Überraschungen und Schrecken.»
Um diese Einhelligkeit zu feiern, reichte die junge Frau dem Botschafter entzückt die Hand. Der drückte sie, mit größtem Vergnügen. Und statt sich damit zu begnügen, verneigte er sich und küsste ihre Hand.
Schweigen, zufriedenes Lächeln auf beiden Seiten. War es wichtig, was die Frau sagte, wenn ihr Antlitz, ihr schlanker Hals, ihr Dekolleté einen so bezaubernden Anblick boten? «Wenn Sie gestatten, darf ich fragen: Haben Sie den Orient schon bereist? Kennen Sie irgendein Land der Region aus eigener Anschauung?» Der Botschafter bemühte sich nach Kräften, den Moment des Abschiednehmens hinauszuzögern.
«Nein, woher rührt Ihre Wissbegier?»
«Das will ich Ihnen gleich sagen … Ich selbst komme aus dem Orient und weiß sehr wohl um seine schädlichen und schlechten Seiten. Perfektion ist der Menschheit noch nicht beschieden. Will sagen, der Osten hat Schwächen und Stärken, Laster und Tugenden. Genau wie der Westen. Wenn die Welt eines Tages gut wird, wird sie die Tugenden von Orient und Okzident miteinander verbinden, die Laster beider Seiten überwinden.»
Trotz dieser versöhnlichen Töne wählte die junge Frau abermals den Weg des Widerspruchs, indem sie einige Buchtitel aufzählte, die – wen wunderte es? – die Ansichten ihres Herrn und Meisters bekräftigten. Ihre Frage, ob der Botschafter die Werke gelesen habe, verneinte der.
«Lesen Sie sie.»
Kaum geschlossen, war der Frieden schon wieder dahin. Denn die junge Frau hatte erneut kalt und kämpferisch gekontert. Der neu entfachte Kampfgeist wirkte sich auf ihre Schönheit aus. Er tat ihr keinen Abbruch, nein, er veränderte sie nur, betonte ihre Weiblichkeit. Wieder spürte der Botschafter, dass er sich und seine Weltsicht gegen die Gewitterfronten, die Überraschungsangriffe dieser wilden Verfechterin schützen musste. Doch wie hätte er gegen Bücher argumentieren können, die er nicht gelesen hatte? Davon abgesehen, war die Frau bereit, mit Leib und Seele für ihre Überzeugungen einzustehen und im Bemühen, andere für sich zu gewinnen, sogar ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Kampf bis in den Tod!
Eine beängstigende Erkenntnis. Diese starke Liebe zum Orient ließ den Diplomaten an Gertrude Bell denken. Und plötzlich fiel ihm ein, dass auch ihr schon bei der ersten Begegnung unverkennbarer Kampfgeist, ihr Starrsinn, ihre Unerbittlichkeit ihn an jemanden erinnerten: an Dihya, die schöne Gazelle, geheimnisumwobene Berberkönigin, führende Kämpferin und Geistliche, Kahina, die im Widerstand der nordafrikanischen Ureinwohner gegen die Eroberung Nordafrikas durch muslimische Araber ihr Leben ließ. So zu lesen in einem der Werke Ibn Khalduns, in dem der Botschafter kürzlich geblättert hatte. Die Frau, die ihm heute gegenübersaß, glich dem Bild, das er sich von Ibn Khalduns Heldin gemacht hatte, aufs Haar.
Ein Moment der Stille verstrich. Die temperamentvolle Amerikanerin schaute, dessen Zustimmung suchend, den Philosophen an. Der tat ihr den Gefallen, nickte beipflichtend, verzog den schiefen Mund zu einem Lächeln, während seine Glubschaugen Lob und Anerkennung spendeten. Zum Spaß malte der Botschafter sich aus, dass der Inder, halb Mensch, halb Tier wie das Fabelwesen Dowalpa, nachts zu der jungen Elfe ins Bett kletterte und sie mit seinen starken schwarzen Greifarmen eng umschlang. Wie abstoßend!
Dass das Abendessen weitgehend schweigend verlief, gab dem Botschafter Gelegenheit, die Worte der schönen Sanskritstudentin zu überdenken. Der westliche Ungeist des Materialismus schien sie sehr zu beschäftigen. Und ihre Blauäugigkeit gegenüber dem Orient wurzelte vermutlich in ihrem Freiheitsdrang. Vielleicht sehnte sie sich nach einem imaginären Anderswo, möglichst weit weg von ihrem Ursprungsort. Gab es dafür einen persönlichen Grund? War ihr Wunsch, der eigenen Welt zu entkommen, unter Umständen familiär bedingt?
Obwohl er die Gesellschaft der schönen Gazelle gern länger genossen hätte, bat der Botschafter schon kurz nach dem Abendessen um die Rechnung, weil er sich den weiteren Anblick des Inders ersparen wollte, der ihn auf Persisch belehrte:
«Weder Sie noch ich werden die Rechnung begleichen. Das übernimmt die junge Dame.»
Worauf der Botschafter reagierte: «Bei allem Respekt, sofern Männer zugegen sind, ist es nicht üblich, einer Frau die Zahlung einer so hohen Rechnung für Speisen und alkoholische Getränke zu überlassen.»
«Möchten Sie sich schon wieder nach den schlechten europäischen Sitten richten?», fragte der Philosoph den Botschafter, der sich einer weiteren Erwiderung enthielt. Um sich aber erkenntlich zu zeigen, lud er das Paar zu einem Spaziergang mit anschließendem Mittagessen auf Schloss Malmaison ein, den Wohnsitz und Rückzugsort Kaiser Napoleons und seiner Gemahlin Joséphine. Warum er zur Bewirtung seiner Gäste ausgerechnet diesen Ort wählte, wusste er nicht zu sagen. In einem Anflug der Verliebtheit in das reizende Geschöpf an des Inders Seite vielleicht?
Kurz bevor es Abschied nehmen hieß, wandte der Botschafter sich noch einmal an die junge Frau: «Schon als ich Sie das erste Mal sah, kamen Sie mir bekannt vor. Erst jetzt, in dieser Sekunde, ist mir eingefallen, an wen Sie mich damals erinnert haben. An Dihya, die geheimnisvolle Berber-Priesterin.»
«Viel weiß ich nicht über sie», sagte die junge Sanskritstudentin. «Aber nicht wenige Forscher finden, ihre Persönlichkeit ist der der Debora nachempfunden.»
Und mit der schönsten Stimme, die der Botschafter je gehört hatte, sang sie: «Den Herrn will ich lobpreisen», eine Zeile aus einem Vers der jüdischen Dichterin, Richterin und Prophetin Debora. Und damit nahm man Abschied voneinander.
In der folgenden Woche aßen die drei auf Schloss Malmaison zu Mittag, verbrachten den Nachmittag mit Spaziergängen und kehrten abends nach Paris zurück. Der Botschafter behielt die junge Frau und ihren alten Meisterphilosophen pausenlos im Auge, weil er sehen wollte, wie sie mit ihm umging. Sie bemutterte den Mann nach allen Regeln der Kunst und huldigte ihm zugleich wie einem Gott. Was an diesem kläglich ungebildeten Philosophen, der offenbar alle Register zog, um die charmante, junge Frau an sich zu binden, machte sie ihm schier hörig? Weshalb hing dieses Geschöpf so inbrünstig an den Lippen eines Mannes, dessen hässlicher Mund nur Unfug ausspuckte? Der Botschafter fühlte sich an Teherans Freudenhaus erinnert, in dem Zuhälter und Halsabschneider armen Huren wahre Liebe vorspielten, die ihnen allabendlich ihre gesamten Tageseinnahmen übereigneten. Die junge Frau war wirklich ausnehmend schön.
Im Monat darauf war der Botschafter nach Teheran zurückgekehrt, der Kontakt zu dem Paar war abgebrochen. Und heute entnahm er der kurzen, mit der Inlandspost eingetroffenen Notiz, dass der Philosoph sich, fünfzehn Jahre nach Paris, gern mit ihm treffen würde.
Der Diplomat starrte des Philosophen kindliche Handschrift an. Ob die Schöne ihm noch zu Diensten war? Das ließ sich leicht herausfinden. Er griff nach einem Stift, antwortete dem Philosophen ebenso knapp, wie der ihm geschrieben hatte, und lud ihn für den Donnerstag der kommenden Woche um siebzehn Uhr zum Nachmittagstee in die deutsche Botschaft ein. Früher hätte er das Treffen angesichts seines vollen Terminkalenders nicht anberaumen können. Die amerikanische Frau ließ er in seiner Einladung unerwähnt, weil er sich sicher war, dass der Philosoph gemeinsam mit ihr erscheinen würde, sofern er sie noch in den Fängen hätte. Leise Vorfreude stellte sich ein, nachdem er die Antwort verfasst und seiner Sekretärin zwecks Postversand überreicht hatte. Die kannte Kairo in- und auswendig, weil sie seit mehreren Jahren dort lebte. Nach einem flüchtigen Blick auf die Anschrift sagte sie: «Das ist gar nicht weit von hier.»
«Will heißen?»
«Höchstens fünfzehn, zwanzig Minuten zu Fuß.»
Die beiden wohnten also ganz in der Nähe. Ein erneuter Blick auf die Anschrift steigerte des Botschafters Vorfreude. Er bemühte sich, das baldige Wiedersehen so einzuordnen wie alle nicht seinem diplomatischen Auftrag geschuldeten Termine mit neugierigen Naseweisen aller Art. Insgeheim aber wusste er, dass dieser sich von den anderen unterschied. In den Folgetagen rügte er sich bisweilen dafür, dass er sich auf das Treffen mit dem unterbelichteten Inder freute. Im nächsten Moment fiel ihm ein: Nein, nicht der Inder war der Grund für seine Erwartungsfreude, sondern die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit der Amerikanerin.
Die Begegnungen vor fünfzehn Jahren hatten etwas in ihm ausgelöst, etwas, das lange schlummern und sich unverhofft wieder bemerkbar machen konnte. Das war ihm erst nach dem Abschied damals bewusst geworden.
KAPITEL 2
Dass der Botschafter, erst drei Wochen zuvor in Kairo eingetroffen, schon heute, und damit früher als erwartet, seinen Antrittsbesuch beim ägyptischen Premierminister Mahmud an-Nukraschi Pascha machen konnte, stimmte ihn zuversichtlich. Heute Morgen war ihm beim Aufstehen durch den Kopf gegangen, dass große Männer in der Menschheitsgeschichte schwierige Aufgaben gemeistert hatten und dass nun er unter Beweis stellen musste, ob er seinen Herausforderungen gewachsen war.
Der Premierminister begrüßte ihn herzlich, und nach einer kurzen, stehend eingeholten Erkundigung nach des Gastgebers Befinden nahm der Botschafter dem Premierminister gegenüber auf einem Ledersessel Platz, öffnete seine Aktentasche, entnahm ihr die Abschriften zweier Schreiben des iranischen Staatsoberhaupts an König Faruk – das eine zur Akkreditierung des neuen Botschafters am ägyptischen Hof, das andere bezüglich der Abberufung seines Vorgängers –, überreichte sie seinem Gegenüber und bat um Auskunft darüber, wie man dem König die Originalschriftstücke zukommen lassen könne.
Der Premierminister nickte, presste, zum Zeichen seiner Konzentration auf die in Angriff zu nehmende Sache, die Kiefer zusammen und klemmte sich sein Monokel vors Auge. Doch plötzlich wandte er sich von den Schriftstücken ab und gab stattdessen seiner Zufriedenheit über das Wiedersehen nach acht Jahren und seiner besonderen Freude darüber Ausdruck, mit dem Gesandten des großen iranischen Herrschers nun näher Bekanntschaft zu machen.
Er legte die Abschriften auf den Tisch vor sich und lenkte das Gespräch auf andere Themen, wie etwa die Plage der Cholera oder die gefährliche Komplikation der Lage der Juden in Palästina. Gespräche, die bei Konsultationen in diesen Zeiten wohl an der Tagesordnung waren.
Als der Premierminister andeutete, das Unglück Palästinas habe an dem Tag seinen Lauf genommen, an dem die Region den Engländern als Mandatsgebiet zugesprochen wurde und die Engländer fortan deren Geschicke lenkten, schien dem Botschafter die Erörterung des Themas mit diesem kurzen Fazit ihr Ende gefunden zu haben und die Gelegenheit gekommen zu sein, die Unstimmigkeiten zwischen Mohammed-Reza Schah und seiner Gattin Fausia anzusprechen. Doch der Premierminister beeilte sich, sein Fazit um einige Details zu ergänzen: «Jetzt, wo gemunkelt wird, dass sie ihre Truppen nächstes Jahr im August aus Palästina abziehen, verschlimmert die Lage sich von Tag zu Tag.» Um das Gespräch behutsam vom Thema Palästina abzulenken, führte der Botschafter an: «Die Engländer werden ihre Streitkräfte schrittweise und möglichst geschickt aus den Krisengebieten in ihren Kolonien abziehen, bevor die Menschen vor Ort sie mit Gewalt vertreiben.»
Das Verhalten der Engländer behagte dem Premierminister keineswegs, weshalb er erwiderte: «Wir haben sie zwar nicht zu uns eingeladen. Aber jetzt können sie nicht einfach wieder gehen, nur weil es ihnen so passt. Haben sie auch nur einen Gedanken daran verschwendet, welche Kräfte das Vakuum füllen werden, das sie hinterlassen?»
Im Wissen um seine Kenntnis der Materie schüttelte der Botschafter den Kopf. «Mit Verlaub, Herr Premierminister, die Engländer haben sich ihr Vorgehen gut überlegt. Die Zukunft wird sich zu ihren Gunsten und nach ihrem Gutdünken entwickeln. Sie haben längst gewisse Personen mit der Erfüllung besonderer Aufgaben in unserer Region betraut. Deshalb verlassen sie sie ja auch leichten Herzens. Das werden die Ereignisse in den kommenden Monaten zeigen.»
«Schon jetzt bestätigt sich Ihre Ansicht. Alles weist darauf hin, dass die Juden die groß angelegte Besatzung Palästinas planen. Sie haben eine Wehrpflicht verfügt, für alle Frauen und Männer im Alter zwischen siebzehn und fünfundzwanzig Jahren.»
Diesbezüglich waren weitere Nachrichten im Umlauf, nicht eine erfreuliche darunter. Da der Premierminister über die bevorstehenden Ereignisse äußerst beunruhigt schien und seiner Besorgnis auch Ausdruck verlieh, beschloss der Botschafter, in seiner Ungeduld angesichts der wiederholten Verzögerungen in Bezug auf die Sache der Prinzessin Fausia, selbige jetzt ohne Umschweife anzusprechen.
«Mit Verlaub, werter Herr Premierminister, lassen Sie uns vom heiklen Thema Palästina, das uns allen hier in der Region zweifellos großen Kummer bereitet, ausnahmsweise absehen, denn ich möchte mit Ihnen gern in aller Offenheit den Auftrag erörtern, den zu erfüllen man mich in erster Linie nach Kairo entsandt hat – sofern Sie gestatten.»
Der Premierminister wurde sofort hellhörig: «Werter Herr Botschafter, ich bin ganz Ohr», beteuerte er.
«Ungeachtet dessen, was uns auf offizieller Ebene verbindet, und sehr viel bedeutender als das ist die Tatsache, dass Sie und ich Muslime sind. Allein diese Wahrheit gibt uns Grund genug zu einem offenen, ehrlichen Austausch im Geiste der Freundschaft und Brüderlichkeit. Was ich damit sagen will: Wenn wir Muslime, von Karatschi bis Casablanca, einig zusammenstehen, zwingen wir nicht nur die Juden Palästinas in die Knie, sondern die ganze Welt, wenn sie sich gegen uns stellt. Diese Einigkeit zweier großer muslimischer Nationen, Iran und Ägypten, gefestigt durch familiäre Bande zwischen den Königshäusern beider Länder, könnte anderen Nationen des Nahen Ostens, könnte allen muslimischen Ländern rund um den Erdball als Beispiel und Vorbild zur Stärkung ihrer Einheit dienen.
Wie sich leider zeigt, droht dieser Hoffnungsschimmer zu verglühen. Die muslimische Welt ist sich darin einig, dass dieser Ehebund ein wegweisendes Zeichen für ihre politische Einheit und Verständigung gesetzt hat. Und nun frage ich Sie: Soll diese Möglichkeit etwa ungenutzt bleiben? Ägyptens Hof und die Regierung haben ein solches Geheimnis aus Prinzessin Fausias Ansinnen gemacht, dass beiden Nationen daraus nur Nachteile erwachsen. Sollten die Unstimmigkeiten – möge ich stumm werden, falls sie eintritt! – die Trennung des Paars zur Folge haben, werden wir unweigerlich zum Gespött der grausamen Kolonialmächte, die uns mangelnde geistige Reife und fehlende Weitsicht attestieren wollen. Davon abgesehen, gestatten Sie mir, Herr Premierminister, Sie in aller Offenheit und aus tiefstem Herzen zu fragen: ‹Sollte die Ehe, ganz im Sinne der Feinde unserer beider Nationen, in die Brüche gehen, was wird die Welt von einer geschiedenen Prinzessin denken?›»
Die Aussicht auf eine «geschiedene Prinzessin» war dem Premierminister sichtlich unangenehm. Angespannt runzelte er die Stirn. Das grimmige Gesicht seines Gegenübers veranlasste den Botschafter, nach seiner recht wortreichen Vorrede zu schweigen und den Premierminister erwartungsvoll anzusehen. Er war sich ziemlich sicher, Eindruck auf den Staatsmann gemacht zu haben.
Der hatte dem Botschafter genau zugehört, nickte nun beifällig, beugte sich zu ihm, ergriff seine Hand und sagte in mitfühlendem Ton: «Herr Botschafter, Sie wissen nur zu gut, dass es sich hier um eine rein private Familienangelegenheit handelt.»