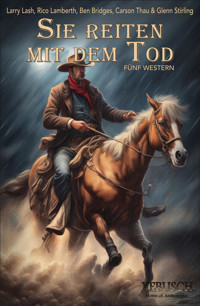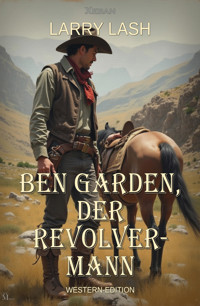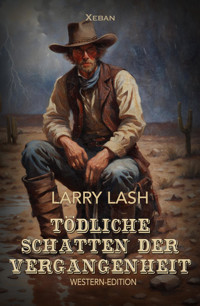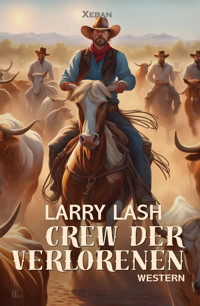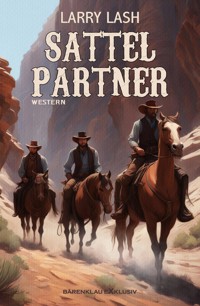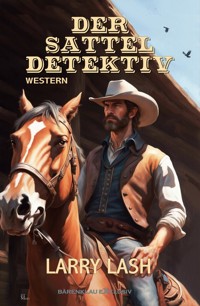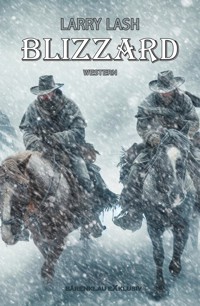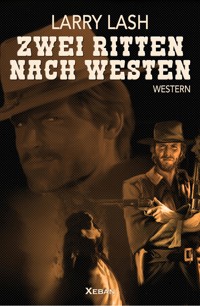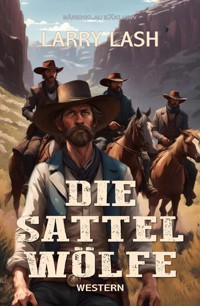
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf einem paradiesischen Stück Erde am Rande der Wüste hat Jim Matheson die kleine Stadt Dolores aufgebaut, seine Ranch und einen Damm, der das kostbare Wasser aufstaut und für Zeiten der Dürre und Trockenheit bereithält, sodass die Rancher ihre Weiden bewässern können. Dass ebendieser Staudamm der schwächste Punkt in Mathesons Paradies ist, weiß Alan Harris nur allzu gut. Er und seine Bande der Gesetzlosen, die „Sattelwölfe“, haben keine Skrupel, den Staudamm zu zerstören, damit Tod und Vernichtung aus der Wüste das Land heimsuchen und es unfruchtbar machen. Umso billiger ist es dann für ihn und den verbrecherischen Rancher Abe Clary zu haben. Doch die Sattelwölfe haben die Rechnung ohne Ken Graham gemacht, der nach 15 Jahren Leben bei den Yaquis in der Wüste zurückkommt, um sich gegen die Übermacht zu stellen – auch wenn es sein Leben kostet. Aber sein Schicksal ist mit den Clarys auf ewig verbunden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Larry Lash
Die Sattelwölfe
Western
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit Bärenklau Exklusiv, 2024
Korrektorat: Falk Nagel
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Sattelwölfe
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Auf einem paradiesischen Stück Erde am Rande der Wüste hat Jim Matheson die kleine Stadt Dolores aufgebaut, seine Ranch und einen Damm, der das kostbare Wasser aufstaut und für Zeiten der Dürre und Trockenheit bereithält, sodass die Rancher ihre Weiden bewässern können. Dass ebendieser Staudamm der schwächste Punkt in Mathesons Paradies ist, weiß Alan Harris nur allzu gut. Er und seine Bande der Gesetzlosen, die „Sattelwölfe“, haben keine Skrupel, den Staudamm zu zerstören, damit Tod und Vernichtung aus der Wüste das Land heimsuchen und es unfruchtbar machen. Umso billiger ist es dann für ihn und den verbrecherischen Rancher Abe Clary zu haben. Doch die Sattelwölfe haben die Rechnung ohne Ken Graham gemacht, der nach 15 Jahren Leben bei den Yaquis in der Wüste zurückkommt, um sich gegen die Übermacht zu stellen – auch wenn es sein Leben kostet. Aber sein Schicksal ist mit den Clarys auf ewig verbunden …
***
Die Sattelwölfe
Western von Larry Lash
1. Kapitel
Jerome Wilcox schüttelte die Schnur der Torospeitsche aus, und seine linke Hand, die die Zügel hielt, griff fester zu. Sein breitflächig geschnittenes Gesicht verdüsterte sich, als er zu dem toten Reitpferd am Wegrand hinschaute, dessen schwarzes Fell der unbarmherzig niedersengenden Sonne preisgegeben war.
Selten war Jerome ein selbst im Tode noch so prächtiges Pferd vor Augen gekommen. Als es noch gelebt hatte, musste es der Stolz seines Besitzers gewesen sein, ein Pferd von sicherlich ungewöhnlicher Schnelligkeit und Ausdauer. Es war hochgebaut, hatte schmale Fesseln und kleine Hufe. Unter dem Fell trat die Äderung hervor, wie sie nur bei Vollblutpferden in so klarer Zeichnung zu sehen war. Die Fesseln zeigten nicht den kleinsten Ansatz eines Kötenbehangs.
Die großen dunklen Augen des Pferdes waren gebrochen. Sein Körper lag im Staube des Ödlandes vor der gewaltigen Kulisse der Wüste, den blauen Vulkanrundhügeln in der Ferne und den graugrünen Kakteenfeldern.
Der Wüstenwind hatte noch nicht mit seiner Begräbnisarbeit begonnen. Oben am Firmament kreisten die Aasgeier über dem Kadaver, gefiederte Todesboten, wartend auf ihr grausiges Mahl. Von allen Seiten schwebten, wie durch geheimnisvolle Signale gerufen, immer mehr Aasgeier heran, und sicherlich waren auch bereits die Coyoten unterwegs, um sich ihren Anteil an der Beute zu sichern.
In wenigen Minuten würde die Schlacht der Todesboten untereinander um ein Stück Fleisch beginnen. Von dem einst so prächtigen Pferd würden nur bleichende Knochen übrigbleiben, die der Wind mit Staub und Wüstensand bedecken würde. Die hässlich anzusehenden Schusswunden würden dann nicht mehr zu sehen sein. Ein Pferdeschicksal hatte sich erfüllt.
»Los denn!«, rief Jerome Wilcox rau und ließ die Peitsche über die Rücken der Zugpferde tanzen, dass das Peitschenende dicht über dem Fell der Tiere zischte, »vorwärts!«
Sogleich zogen die Gespannpferde an. Ihre Hufe trommelten den Boden. Staub wirbelte unter den Rädern des Einspänners auf.
Jetzt erst, als das tote Pferd bereits hinter dem Wagen versank, schaute Jerome Wilcox seinen Begleiter an. Der Fremde hatte neben ihm auf dem Bock Platz genommen. Der Sattel, den er seinem toten Rappen abgenommen hatte, lag auf der Kastensohle. Er saß ein wenig vorgebeugt mit niederhängenden Schultern, als trüge er unsichtbare, schwere Lasten, den Blick seiner grünen, blitzenden Augen starr vorausgerichtet. Dunkelrotes, im Nacken bis auf die Schulter fallendes Haar, quoll ihm unter der Stetsonkrempe hervor. Sein grauer Stetson wies zwei Kugellöcher auf.
Dieser Fremde mochte an die dreißig Jahre alt sein. Groß und hager saß er neben Jerome Wilcox in sich versunken. Nach und nach schien er zu begreifen, dass mit dem Anrollen des Einspänners die Feinde vertrieben waren und er mit dem Leben davongekommen war.
»Nicht eine Kugel hatte ich mehr im Revolver«, sagte er aus seinem Schweigen heraus, ohne den Blick zu ändern und Jerome Wilcox anzusehen. »Vier Tage lang war das Rudel hinter mir her. Die letzten beiden hätten es beinahe geschafft. Es war ein knappes Rennen, und es ist noch nicht entschieden.«
»Stranger, du kommst aus der Wüste?«
»Dort, wo sie am einsamsten ist«, erwiderte der Gefragte ruhig, als hinge er besonderen Gedanken nach. »Fünfzehn Jahre lebte ich bei den Yaquis.«
Jerome hob überrascht den Kopf und sah den Mann neben sich verblüfft an. Alles andere hatte er erwartet, nur nicht eine solche Antwort. Wenn der Fremde behauptet hätte, er wäre Südseeinsulaner, Jerome hätte ihm eher glauben können, aber ein Weißer bei den Yaquis, das gab es doch nicht! Ein Weißer konnte doch gar nicht bei diesen menschlichen Wüstenwölfen leben, bei diesem mörderischsten, unheimlichsten aller Indianerstämme der Wüste, vor denen selbst die blutrünstigen Apachen verblassten.
Wo gab es das, dass ein Weißer mit den schnellsten Läufern der Welt Schritt halten konnte? Man sagte, dass ein Yaquikrieger den ganzen Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang laufen konnte, dass ein Yaquikrieger sogar ein Pferd im Laufen schlagen konnte. Man sagte den Yaquis nach, dass sie Nachfahren der alten Azteken wären, jenem hochstehenden Kulturvolk, das ihren Göttern Menschenopfer brachte. Man erzählte sich Gräuelgeschichten von diesem Volk, das sich in die unzugänglichsten Gebiete der Wüste zurückgezogen hatte, dorthin, wo man annehmen musste, dass kein Leben mehr möglich wäre, wo auf nacktem Vulkangestein die Sonne alles Leben getötet hatte, keinen Pflanzenwuchs mehr zuließ und keinen Tieren Nahrung bot.
Und doch, die Yaquis lebten hier mitten in der Wüste.
Auf schwer zu besteigenden Bergen hatten sie ihre Dörfer. Von dort aus kamen sie hin und wieder wie die Adler herunter, um in den Niederungen und Kulturgebieten am Wüstenrande mordend, plündernd und raubend einzufallen, wobei sie sich nicht scheuten, Frauen, Kinder und Halbwüchsige mitzunehmen.
Doch man hatte noch nie davon gehört, dass jemals einer der Geraubten, in die Gefangenschaft der Yaquis Gezwungenen, zurückkehrte.
»Sind Sie etwa den Heiden entflohen?«, ungläubig fragte es Jerome Wilcox. »Haben Sie irgendwo ein Pferd bekommen?«
»Ein Pferd mit Sattel und Zaumzeug für einen Mann, der nichts hat, meinen Sie? Nein, das glauben Sie selbst nicht, Partner«, unterbrach ihn der Fremde. »Wenn Sie sich auch vorsichtig ausdrücken, so liegt es doch klar auf der Hand, dass Sie sagen wollten, dass ich das Pferd erbeutet hätte, nicht wahr?« In den grünen Augen des Fremden wurden dunkle Schatten sichtbar. »Das Pferd gehörte mir! Ich bekam es als Fohlen geschenkt und hatte es selbst großgezogen. Dort, wo die Yaquis leben, ist nicht nur glühende, tote Wüste. Es gibt in geschützten Tälern Wasser, fruchtbare Maisfelder und Getreideäcker. Glauben Sie nicht an die Gräuelmärchen, die man sich über die Yaquis erzählt. Es sind prächtige Menschen, die besten Kameraden, die genügsamsten Freunde, ritterlich und edel. Was jeder über sie glaubt, stimmt nicht! Genau das Gegenteil davon ist wahr. Aber man sagt nicht, dass die mexikanische Regierung diesen Indianern den Lebensraum nahm. Man schweigt darüber, dass die einzelnen Regierungen die Yaquis für sich haben kämpfen lassen und die großen Stämme zum Schluss so ausgeblutet waren, dass sie sich gegen die drakonischen Maßnahmen der Regierung nicht mehr zu wehren wussten. Jede Forderung der Yaquis wurde abgeschlagen und nicht erfüllt. Regierungstruppen schossen Hunderte von ihnen nieder. Nur die Flucht in die unwegsame Wüste blieb diesen hochgewachsenen, freiheitsliebenden Menschen übrig. Ich war einer der Ihren, Partner, bis an den Tag, als der Letzte meines Stammes von Regierungstruppen niedergeschossen wurde, bis an den Tag, da meine Frau und mein Sohn sterben mussten …«
Der Fremde schwieg, und wieder waren seine Augen in die Ferne gerichtet. Er hatte nicht angeklagt, nur mit ruhiger Stimme berichtet, und doch musste ein Vulkan in diesem Fremden brennen.
Mochte er auch ein Squawman sein, wie man verächtlich an der Grenze von den Männern sprach, die sich als Lebenskameradinnen Indianerfrauen ausgesucht hatten, er, Jerome Wilcox, dachte nicht so. Auch in seiner Ahnenreihe waren Indianer, und so hatte auch er ein wenig von dem Blut der Ureinwohner des Landes, das keinen Menschen im Osten der Vereinigten Staaten stören, sondern nur adeln konnte.
Was hatte die Liebe zwischen Mann und Frau mit Rasse zu tun? Dieses unbestimmte Etwas, das man Liebe nannte, war durch keine Nationalität und keine Rassenschranke gebunden. Es blieb ein unbekanntes Gesetz, das jeden in seinen Bann ziehen konnte.
Der Verlust der Frau, des Sohnes, war immer schmerzlich, gleich, welcher Rasse die Frau angehörte, gleich, welche Hautfarbe sie trug. Die Verbundenheit der Ehepartner wurde letzten Endes weder von einem Standesamt noch einem Sheriff bestimmt, sondern von den Menschen, die sich zur Ehe gefunden hatten, selbst.
»Es tut mir leid«, sagte Wilcox aus seinen Gedanken heraus. Nach einer Weile fuhr er fort: »Was weiß ich schon von den Yaquis? Doch nur das, was erzählt wird und was man ab und zu in den Zeitungen lesen kann. Ich habe mir anscheinend ebenfalls ein falsches Bild gemacht, Stranger, doch das ist nicht meine Schuld.«
Der Fremde erwiderte nichts darauf. Warum sollte er auch dem Wildfremden aus seiner Vergangenheit berichten, von der Zeit in der Wüste, die ihm ein unverdientes Glück durch eine dunkeläugige, wunderbar schlichte und einfache Frau gebracht hatte.
Das ging nur ihn etwas an und niemanden anderen sonst. Es war, als hätte sich ein dunkler Schleier über all das gesenkt, was in der Wüste gewesen war, als wären fünfzehn Jahre seines Lebens in ein Nichts zusammengeschrumpft, aus dem nur die Erinnerung als lodernde Flamme brannte.
Das Letzte aus der Vergangenheit, der Rappe, war auf der Trailstrecke geblieben.
Und nun? Nun kehrte er zu seinen Rassegenossen zurück, und es war ihm klar, dass es eine andere Welt war als die, in der er bisher gelebt hatte. Es war ihm klar, dass die Menschen seiner Rasse meist eigensüchtig und habgierig waren, eine andere Welt, in der einer dem anderen kaum etwas gönnte, in der das gegenseitige Belauern, das hintergründige Intrigenspiel um Macht, Reichtum, Stellung und Einfluss diese Welt in Spannung und Gärung hielt, als wollte sie niemals zur Ruhe kommen.
Es war die Welt seiner Rasse. Wie anders war doch die Welt, aus der er kam! Dort gab es kein Verstecken, Verkriechen, um aus dem Hinterhalt zuzuschlagen. Große Kinder waren die Yaquis gewesen, die sich nur dann zu schrecklichen Wesen verwandelten, wenn es galt, Beute zu machen, damit die Dorfgemeinschaft nicht in einer Hungersnot unterging, dass die Kinder nicht starben und die alten Leute nicht dahinsiechten. Sie mussten Beute machen, denn die Äcker waren zur Selbsterhaltung zu klein, die Wüste zu leer, zu feindlich. Sie mussten in die Niederungen einfallen und sich holen, was sie zum Leben brauchten. Die mexikanische Regierung schenkte ihnen nichts. Sie gab ihnen aber auch nicht die Möglichkeit zur Selbsterhaltung. Im Gegenteil, sie sandte immer wieder Truppen in die Wüste hinein, um auch das letzte Yaquidorf einzuäschern, den letzten Yaqui umzubringen. Es gab auf der einen wie auf der anderen Seite kein Pardon, ein gnadenloser, erbitterter Kampf ums nackte Leben.
»Wer waren die Männer, die hinter Ihnen her sind, Stranger?«, brach Jerome Wilcox das Schweigen.
»Revolvermänner«, entgegnete der Fremde, »angeworben von der mexikanischen Regierung. Amerikaner, so wie Sie und ich. Aber eiskalte Burschen, die für hohe Sonderprämien das vollbringen sollten, was die regulären mexikanischen Truppen in all den Jahren nicht erreichten, die Aushebung der gefürchteten Yaquinester. Fünf von ihnen waren hinter mir her, damit sie durch mich Dorfgemeinschaften aufstöbern konnten. Nur darum ließen sie mich nach der entsetzlichen Zerstörung meines Dorfes am Leben. Da ich mit den Yaquis gelebt hatte, kannte ich die nächsten Dorfgemeinschaften und sollte den Burschen helfen, diese versteckten Dörfer in den Bergen zu finden. Ich musste dem schrecklichen Sterben der Angehörigen meines Dorfes zusehen, meiner Freunde, meiner Frau, meines Kindes … Erbarmungslos wurden sie gemordet, von vertierten Menschen, für Geld umgebracht! Ich weiß heute noch nicht, wie ich es ausgehalten habe, doch von diesem Augenblick an ist etwas in mir zerrissen …«
Er brach ab, seine grünen Augen waren jetzt so dunkel geworden, dass sie fast schwarz wirkten. Nur der Himmel mochte wissen, was er wirklich durchgestanden hatte. Eine furchtbare Tragödie musste sich in der Wüste abgespielt haben. Die knappe Schilderung des Fremden zeigte nur die großen Umrisse des Geschehens, doch die Einzelheiten mussten unfassbar gewesen sein.
Unwillkürlich griff der Fahrer Wilcox nach seinem Munitionspäckchen, das er in der Holztasche auf dem Fahrersitz verstaut hatte, zog es hervor und hielt es dem Fremden mit den Worten hin: »45er-Munition zum Auffüttern der Revolver. Ich denke, es ist das richtige Futter.«
»Ich danke, Mister …?«
»Wilcox.« Der Fahrer nannte seinen Namen, und der Fremde erwiderte: »Ich bin Ken Graham. Fünfzehn Jahre lang hatte ich Vor- und Nachnamen abgelegt. Jetzt hängen sie mir beide wieder an. Ich muss mich erst wieder an sie gewöhnen.«
»Es wäre gut, Ken, wenn es gleich geschehen würde«, entgegnete Wilcox, der Ältere der beiden. »Es wäre gut, wenn du auch gleich einen Freund erkennen würdest. Sollten sich die beiden Schufte sehen lassen, dann …« Er klopfte hart auf den Kolben seines 45er-Revolvers, und sein Mund schloss sich so fest, dass er zu einem dünnen Strich wurde. Eine Weile schwieg er nachdenklich, fuhr dann fort: »Wo willst du jetzt hin? Ich mache dir einen Vorschlag. Komm doch mit mir! Sicherlich stellt mein Boss einen Mann wie dich gern ein. Bei uns kannst du erst einmal zur Ruhe kommen. Es ist aber besser, du erwähnst nichts aus deiner Vergangenheit.«
»Ich weiß, man sieht Squawmänner nicht gerne«, erwiderte Ken Graham bitter. »Hier an der Grenze Mexikos, wo noch Apachenbanden und Yaquikrieger auftauchen, sieht man Männer mit scheelen Augen an, die in den Rothäuten Menschen und keine Tiere sehen.«
»Nimm es nicht tragisch, Ken!«, sagte Wilcox. »Die- Menschen wissen es nicht besser. Es wird ihnen so vorgekaut, und sie schlucken es. Es ist nicht mehr möglich, ihnen eine bessere Meinung über die sogenannten Wilden zu vermitteln. Die Kämpfe, die ausgetragen werden, lassen immer wieder neuen Hass auflodern. Die Kluft, die die Rassen trennt, ist zu groß geworden. Hinzu kommt noch, dass die Sturmflut der weißen Einwanderer nicht mehr aufgehalten werden kann. Der weiße Mann hat Besitz von dem Riesenkontinent genommen. Was bedeuten da noch die freischweifenden Indianerhorden? Gleich, ob es Apachen oder Angehörige eines anderen Stammes sind, ihre Zeit wird eines Tages zu Ende gehen, und mögen sie sich noch so sehr dagegen zur Wehr setzen. Man will ihnen keine Zeit geben, sich umzustellen, will nicht warten, bis aus Jägern und Nomaden sesshafte Bauern, Rancher, Farmer, Siedler geworden sind, die sich in den Gemeinschaften der Weißen eingliedern könnten. Die so freiheitsliebenden Bürger der USA sind gegen die Menschen der roten Hautfarbe wenig fair. Gerade ihren Freiheitskampf hätten die US-Bürger begreifen müssen.«
»Ich bin sicher, dass sie alles begreifen würden, Wilcox, wenn von Mensch zu Mensch verhandelt würde, wenn es keine politischen Hintergründe gäbe und keine Wahlkandidaten, die mit der Erschließung neuer Territorien die Wähler für sich buchen wollen. Diese Gents sitzen weitab vom Schuss, missbrauchen ihre Macht, um sich noch größere Machtpositionen zu sichern. Was gilt da noch das Leben der sogenannten Wilden?« Ein heiseres Lachen kam von Ken Grahams Lippen.
Nach einer Weile fügte er hinzu: »Das gilt jedoch nicht für alle. Es gibt unter den Mächtigen auch andere, große Männer, denen die Freiheit aller ein Begriff ist.« Bei diesen Worten lud er seinen Revolver mit der ihm gereichten Munition auf. Er tat es sehr sorgfältig wie ein Mann, der gewohnt war, seine Feuerwaffe hoch einzuschätzen, der wusste, dass von ihrem guten Zustand sein Leben abhängen konnte.
Wilcox Blick fiel auf den Sattel, der zu Ken Grahams Füßen lag. Der Sattel wies ein Messingschild auf mit der Inschrift: Jed Matheson, Sieger im Rodeo 1850, Texas.
Er stieß einen erstaunten Ausruf aus und sah Graham nachdenklich an. Bemerkte dann: »Jeder Mann in Texas kannte Jed. Er war ein lustiger, junger Bursche. Zwar leichtsinnig und oft unzuverlässig, doch man achtete ihn bis zu dem Tag, da er aus irgendwelchen Gründen zum Banditen wurde. Wie kommst du an seinen Sattel?«
»Jed Matheson schenkte ihn mir«, erwiderte Ken Graham, ohne auch nur einen Augenblick zu zögern. »Er war bei den üblen Revolvermännern, die gegen die Yaquis eingesetzt wurden. Seine Mutter kam durch Wüstenindianer ums Leben, und er hasste alle lndianer. Für ihn war es wirklich etwas, was man ausrotten musste, und doch, dieser Jed Matheson war anders als die Unmenschen, die bei ihm waren. Er nahm nicht an den Massenmorden teil, tötete nur, wenn er seinem Gegner eine Chance im Kampf geben konnte. Er war es, der mich befreite, der meinem Rappen seinen Sattel aufgelegt, sein Zaumzeug gegeben hatte, der mir einen Packen mit der nötigen Ausrüstung besorgte. Ohne ihn wäre ich meinen Häschern wohl kaum entronnen. Ich verdanke einem Banditen mein Leben …«
Wieder lachte Graham ein leises, eigenartig klingendes Lachen, dass Wilcox ein Frieren überkam. »Ich sehe es dir an, Wilcox, dass du ungläubig bist und annimmst, ich hätte diesen Jed, den großen Rodeosieger, aus dem Sattel geholt, um mich seines Eigentumes zu bemächtigen.«
»Je länger ich über dich nachdenke«, entgegnete Wilcox, »umso mehr wird mir klar, dass Pech an deinen Stiefelsohlen klebt. Mein Boss ist ein Matheson, ein leiblicher Bruder von Jed. Er würde dir unbequeme Fragen stellen, wenn er das Schild auf dem Sattel sehen würde. Der Sattel ist doch nur eine Belastung für dich. Wir sollten anhalten und ihn vergraben.«
»Wilcox, was wäre damit für mich gewonnen? Die Wahrheit kommt doch eines Tages ans Licht.«
»Man soll sein Schicksal aber nicht herausfordern, Graham. Deine Situation ist schlecht. Du brauchst unbedingt Arbeit, damit du wieder zu einem Pferd, einer Ausrüstung und allen anderen Dingen kommen kannst, was dir ein Weitertrailen erst ermöglichen kann. Zu Fuß würdest du nicht weit kommen. Außerdem würde ein laufender Weißer erst recht auffallen. – Brrr …! Halt, ihr alten Tanten!«, schrie er seinen Gespannpferden zu.
In einer gewaltigen Staubwolke kam das Gespann zum Stehen. »Eine Frage, Graham. Wissen deine Verfolger um den Sattel?«
»Ja«, erwiderte Ken. »Sie wissen es, und das ist es, was mich mutlos machen könnte. Wenn sie Jed für seinen Großmut mir gegenüber getötet haben und mir dann seinen Tod in die Schuhe schieben, wie will ich dann die Wahrheit beweisen? Was ist Jeds Bruder eigentlich für ein Mann?«
»Ich weiß es nicht recht, Graham«, erwiderte Wilcox. »Ich arbeite erst seit einem Monat für ihn. Er zahlt gut, und es gibt ein gutes Essen auf seiner Pferderanch, sowie gute Quartiere. Was die Mannschaft treibt, habe ich noch nicht beobachten können. Meine Arbeit nimmt mich sehr in Anspruch. Ich bin als Kurier eingestellt und von der Frühe bis spät in der Nacht auf dem Bock. Mir fiel nur auf, dass er eine ungewöhnlich starke Mannschaft hat, aber wir leben in Grenznähe, und das erklärt alles. Man muss mit Banditentruppen aus Mexiko und wilden, heidnischen Reitern rechnen. Jim Matheson ist ein großer Mann. Außer der Pferdezucht beschäftigt er sich mit Maisanbau und Bodenverbesserungen. Du wirst ihn bald kennenlernen. Dort vor uns, wo der grüne Streifen am Horizont sichtbar ist, beginnt sein Reich, in Wüstennähe und doch vor den sengenden Glutwinden geschützt. Ein Land, das ein Paradies sein könnte, wenn nur die Menschen friedliebender, duldsamer sein würden. Der Boden ist großartig, die Äcker fruchtbar, die Weiden saftig. Wasser gibt’s genügend, und Jahr für Jahr gelingt es, der Wüste mehr Land abzugewinnen und fruchtbar zu machen. Man sagt, dass Jim seinen einzigen Bruder sehr vermisst, dass er ihn abgöttisch liebt, dass er nie darüber hinwegkommt, dass dieser jüngere Bruder sich einer Banditengruppe angeschlossen hat.«
»Das ist letzten Endes seine Sache. Jeder hat wohl eine Menge an seinem Leben auszusetzen und möchte es anders haben. Warum eigentlich? Ja, warum bescheiden sich nur so wenige Menschen mit dem, was sie haben und was sie sind, und leben glücklicher?«
»Jim Matheson versuchte immer wieder, Männer anzuwerben, die ihm Jed zurückbringen sollten. Das erzählt man sich. Doch bisher kam niemand von den ausgesandten Männern zurück, und auch Jed nicht. Wird dir jetzt klar, weshalb der Sattel weg muss?«
Ohne auf eine Erwiderung zu warten, lud sich der Fahrer Wilcox den Sattel auf und sprang mit ihm über die Radnabe hinweg zu Boden, sah sich rasch um und ging auf ein Bisnagikakteengestrüpp zu. Mit den bloßen Händen buddelte Wilcox ein Loch in den Wüstensand, ganz dicht an den Kakteenstauden.
Graham hatte es zugelassen, dass Wilcox den Sattel an sich nahm, doch schien ihm dessen Handlung unsinnig. Er war auf dem Bock des Einspänners sitzengeblieben und beobachtete die langgestreckten Wellenkämme der Wüstendünen, die nur fern im Westen einen grünen Hauch zeigten, sonst aber von einer geradezu entnervenden Monotonie waren, in der der Wind Sandnebelschleier hineinwob.
Morgen oder übermorgen würden sie das grüne Paradies erreichen. Würden sie es schaffen? Wer konnte das voraussagen?
Noch waren zwei kaltblütige Schießer in der Nähe, zwei von den Sattelwölfen, die von dem Rudel übriggeblieben waren. Mit ihrem Erscheinen musste er rechnen und durfte keinen Augenblick die Wachsamkeit verlieren. Er musste jederzeit auf einen neuen Überfall gefasst sein. Solange es Tag war, war die Wahrscheinlichkeit wohl nicht sehr groß, denn die Dünenkämme waren weithin übersichtlich, und mit Wilcox’ Winchester, die griffbereit auf dem Peitschenhalfter hing, war jeder Angriff mit Leichtigkeit abzuschlagen. Das würden auch seine Verfolger wissen, aber Ken glaubte nicht daran, dass die beiden letzten der Raureitergruppe das große Rennen aufgeben würden.
Die große Prämie, die die mexikanische Regierung für die Vernichtung der Yaquis ausgesetzt hatte, lockte zu sehr, war diesen Kerlen Anreiz genug, um ihr grauenhaftes Handwerk auszuüben.
Nur der Teufel wusste, woher die Yaquimenschenjäger, diese eiskalten Burschen, kamen, die man zu Recht Sattelwölfe nannte. Es waren zumeist Kerle, die der Osten ausspie, die aus Zuchthäusern und Strafanstalten entwichen waren, deren Steckbriefe überall hingen, die vogelfrei waren und nur das nackte Leben zu verlieren hatten. Es waren Kerle, die bei Gefahr und bei Annäherung von Statetroopers rasch über die Grenze nach Mexiko hineinritten, wo sie bei der dortigen armen Bevölkerung, die von den Großgrundbesitzern ausgelaugt und ausgesaugt wurden Unterschlupf fanden. Vor keiner Untat schreckten diese Kerle zurück. Die Einbringung Ken Grahams würde für sie nur Geldverdienen bedeuten.
Die Kehle wurde Ken bei dem Gedanken an die Sattelwölfe eng.
»Deine Vergangenheit ist nun endgültig begraben«, meldete sich der Fahrer von den Bisnagistauden her und deutete auf die Stelle, wo er den Sattel in dem Sand verscharrt hatte.
2. Kapitel
Die Sonne sank. Die Gluthitze, die den Gespannpferden stark zugesetzt hatte, wurde durch Kälte abgelöst. Einige im Wagen befindliche Decken wurden den Tieren umgehängt, mitgeführtes Brennholz aus dem Wagen geholt und ein Feuer in Gang gebracht. Man kochte ab.
Das kleine, fast rauchlose Feuer war in einer Mulde angelegt worden, sodass der Feuerschein nicht in die Wüste wie ein Wegweiser hineinleuchten konnte. Es war nicht stark genug, um sich an ihm erwärmen zu können, nur gerade dazu da, dass man sich eine warme Mahlzeit bereiten konnte.
Langsam versank der Sonnenfeuerball, der eine purpurne Färbung angenommen hatte, in einem Bett aus goldenen Strahlenbündeln, das den Westen noch einmal hell aufleuchten ließ.
Der Nachtbeginn in der Wüste hatte immer etwas unwahrscheinlich Schönes an sich, war ein Schauspiel, dem man sich nicht entziehen konnte. Mensch und Tier waren gleichbedeutend dem Staub, den der Wüstenwind mit leisem Klingen von Düne zu Düne trieb, waren nichts weiter als Treibgut inmitten der großen Einsamkeit, die sich unter dem Nachthimmel ins Unendliche auszudehnen schien.
Zwei Männer in der Wüste.
Beide schwiegen. Sie hatten gegessen und tranken in kleinen Schlucken den selbstgebrauten, schwarzen Kaffee.
Die Nachtkälte, die aus der Wüste wie aus einem Eiskrater blies, trug aus der Ferne Wolfsgeheul mit dem Wind heran. Das Geheul brach ab, und wieder senkte sich das monotone Schweigen nieder, das nur von dem Scharren der Gespannpferde unterbrochen wurde.
Das Feuer verlosch. Die Männer nahmen ihre Decken und setzten sich unter den Wagenkasten des Einspänners. Die Pferde kauten an dem Hafer, der ihnen in den umgebundenen Futtersäcken gereicht worden war.
Über die Wachfolge hatten sich die beiden Männer bereits geeinigt. Sie wussten, dass sie Acht geben und aufpassen mussten, dass sie sich in dieser großen Einsamkeit nicht von dem Schweigen der Wüste täuschen lassen durften.