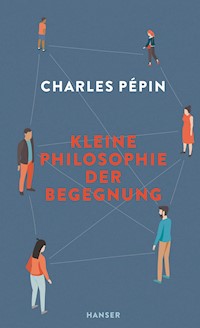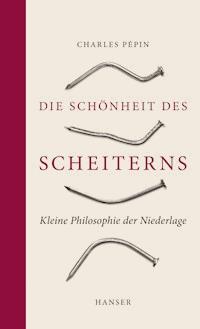
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Niederlagen haben einen schlechten Ruf. Man sieht darin Schwäche statt Erfahrungsgewinn. Und das, obwohl so gut wie keine Erfolgsgeschichte ohne den unvermeidlichen Crash auskommt, das zeigen die Lebensläufe von Steve Jobs, Joanne K. Rowling oder Charles de Gaulle. Charles Pépin betrachtet das Scheitern neu. Er begreift es im Sinne der Stoiker als privilegierte Begegnung mit der Realität und wie die Existenzialisten als Chance zur Neuerfindung. In seinem charmanten Kompendium entwirft er eine befreiende Philosophie des Scheiterns, die vor Optimismus sprüht und zeigt, was der verpasst, der nie gescheitert ist. Eine wunderbar kluge philosophische Anleitung zur gekonnten Niederlage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Pépins Buch ist genial, denn es befreit von der Angst vor dem Scheitern. Auf elegante und unterhaltsame Weise zeigt er, was uns die Philosophen über den Umgang mit der Niederlage lehren. Pépins angewandte Philosophie betrachtet das Scheitern neu und nimmt der persönlichen Katastrophe die Schärfe. Charmanter und befreiender wurde noch nie über die Niederlage geschrieben.
Hanser E-Book
Charles Pépin
DIE SCHÖNHEIT DES SCHEITERNS
Kleine Philosophie der Niederlage
Aus dem Französischen von Caroline Gutberlet
Carl Hanser Verlag
INHALT
Einleitung
1 Wer scheitert, lernt schneller
2 Nur wer irrt, kann verstehen
– Die epistemologische Sicht –
3 Die Krise als sich öffnendes Fenster
– Eine Fragestellung unserer Zeit –
4 Scheitern festigt den Charakter
– Die dialektische Sicht –
5 Scheitern lehrt Demut
– Eine christliche Sicht? –
6 Scheitern als Wirklichkeitserfahrung
– Die stoische Sicht –
7 Scheitern als Chance zur Neuerfindung des Selbst
– Die existenzialistische Sicht –
8 Scheitern als Fehlleistung oder glücklicher Unfall
– Die psychoanalytische Sicht –
9 Scheitern heißt nicht, ein Versager zu sein
– Warum Scheitern so wehtut –
10 Wagen heißt, das Wagnis des Scheiterns eingehen
11 Ist Wagemut erlernbar?
12 Die gescheiterte Schule?
13 Das Gelingen des Erfolgs
14 Die Freude der Kämpfenden
15 Der Mensch, das versagende Tier
16 Ist unsere Fähigkeit zum Neubeginn unbegrenzt?
Schluss
Anhang
Rudyard Kipling, »If–«
Die Bücher, die dieses Buch gemacht haben
EINLEITUNG
Was haben Charles de Gaulle, Steve Jobs und Serge Gainsbourg gemeinsam? Was verbindet J. K. Rowling, Charles Darwin und Roger Federer? Oder auch Winston Churchill, Barbara und Thomas Edison?
Sie alle haben spektakuläre Erfolge erzielt, nicht wahr? Schon, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Bevor sie Erfolg hatten, mussten sie Fehlschläge einstecken. Besser: Wegen der Fehlschläge hatten sie Erfolg. Ohne den Widerstand der Wirklichkeit, ohne Missgeschicke, ohne all die Gelegenheiten, die ihnen ihr Scheitern geboten hat, um nachzudenken und sich wieder aufzurichten, hätten sie sich nicht so vervollkommnen können, wie sie es getan haben.
Fast 30 Jahre lang, vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis Mitte des Zweiten Weltkriegs, musste Charles de Gaulle mit Enttäuschungen fertigwerden. Doch erst durch die Konfrontation mit ihnen hat er seinen Charakter festigen und seinen Wunsch besser fassen können, »eine bestimmte Idee von Frankreich« lebendig werden zu lassen. Als die Geschichte endlich einen anderen Lauf nahm, war er bereit: Seine Niederlagen hatten ihn zäh gemacht und auf den Kampf vorbereitet.
Bevor Thomas Edison die Erfindung der Glühbirne gelang, war er so oft gescheitert, dass ihn einer seiner Mitarbeiter eines Tages fragte, wie er diese vielen Fehlschläge überhaupt ertragen konnte. »Ich bin nicht tausendmal gescheitert. Ich habe erfolgreich tausend Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühbirne nicht zum Leuchten gebracht wird«, war seine Antwort. Thomas Edison wusste, dass ein Wissenschaftler nur aus seinen Fehlern lernen kann und dass jeder erkannte Irrtum ihn der Wahrheit ein Stück näher bringt.
Als Serge Gainsbourg die Malerei aufgab, zu der er sich berufen gefühlt hatte, war das eine Katastrophe für ihn. Mit dem bitteren Geschmack des Scheiterns im Mund wandte er sich dem Chanson, einer in seinen Augen »minderen« Kunstform, zu. Doch genau das befreite ihn von dem Druck, dem er sich als Maler selber ausgesetzt hatte. Seine Begabung als Autor und Interpret, der typische Gainsbourg-Sound, sind untrennbar mit diesem Loslassen verbunden, das zugleich ein »Kind« des Scheiterns ist.
Wenn wir Roger Federer heute Tennis spielen sehen, können wir uns kaum vorstellen, dass er als Jugendlicher Niederlagen einstecken musste und nicht selten in einem Wutanfall seinen Schläger auf den Boden schleuderte. Doch genau in diesen Jahren bildete sich derjenige heraus, der zum besten Tennisspieler aller Zeiten werden sollte. Ohne all die verlorenen Matches und die Momente der Verzagtheit wäre Roger Federer später bestimmt nicht so lange Weltranglistenerster geblieben. Sein legendäres Fairplay, die scheinbar mühelose Eleganz seines Spiels sind nicht angeboren, sondern hart erarbeitet und darum umso schöner.
Charles Darwin hat erst sein Medizinstudium und dann auch sein Theologiestudium an den Nagel gehängt. Daraufhin schiffte er sich auf die »Beagle« ein, eine Reise, die entscheidend dafür war, dass er seine Berufung als Forscher fand. Ohne seine Niederlagen als Student wäre er nie und nimmer offen für diese Reise gewesen, die sein Leben – und ganz nebenbei auch unsere Vorstellung vom Menschen – veränderte.
Am Anfang ihrer Karriere musste Barbara erleben, wie sich die Pforten der Cabarets eine nach der anderen vor ihrer Nase schlossen. Wenn sie doch einmal auftreten durfte, wurde ihr Gesang meistens mit Buhrufen quittiert. Die Lebenskraft und Empathie, die wir in manchen ihrer grandiosen Chansons spüren, die sie später komponierte, haben viel mit diesen Demütigungen der ersten Jahre zu tun. Wer sich die Niederlagen auf Barbaras Lebensweg wegdenkt, muss sich die schönsten Lieder aus ihrem Repertoire wegdenken.
Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich: Das Scheitern hat nicht nur eine, sondern mehrere Tugenden.
Es gibt Fehlschläge, die unseren Willen befeuern, und andere, die ein Loslassen ermöglichen; solche, die uns Kraft geben, den eingeschlagenen Weg bis zum Ende durchzustehen, und solche, die uns Auftrieb geben, um diesen Weg zu verlassen.
Es gibt Fehlschläge, die uns kämpferischer machen, und solche, die uns weiser machen. Und dann gibt es Fehlschläge, die uns offen machen für Neues.
Das Scheitern ist unserem Leben, unseren Ängsten, unseren Erfolgen innewohnend. Erstaunlicherweise wird dieses Thema von Philosophen kaum behandelt. Als ich mit der Arbeit an diesem Buch begann, wollte ich herausfinden, was die Altvorderen dazu gesagt haben. Ich war sehr überrascht festzustellen, wie wenig Interesse sie am Scheitern gehabt haben. All jene Denker, die so selbstverständlich über Ideal und Wirklichkeit sinniert haben, über das »gute Leben« und die Bekämpfung der Ängste, über den Unterschied zwischen Wollen und Können, sie hätten doch ganze Abhandlungen über das Scheitern schreiben müssen. Dem ist aber nicht so. Es gibt kein einziges größeres philosophisches Werk zu diesem Thema. Keinen Dialog Platons über die Weisheit des Scheiterns. Keine Abhandlung Descartes’ über die Tugend des Scheiterns. Kein Traktat Hegels über die Dialektik des Scheiterns. Das ist umso überraschender, als das Scheitern in einem besonderen Verhältnis zum Abenteuer des menschlichen Lebens zu stehen scheint.
Bei meinen Seminaren treffe ich oft auf Unternehmer und Angestellte, die durch Konkurs, Entlassung oder verpasste Gelegenheiten Verletzungen davongetragen haben. Manche haben ihre Kindheit, ihre Jugend, das Studium und die Anfänge des Berufslebens durchlebt, ohne jemals das Gefühl des Scheiterns gehabt zu haben. Mir ist aufgefallen, dass sie es am schwersten haben, wieder auf die Beine zu kommen.
Als Philosophielehrer am Gymnasium beobachte ich häufiger, dass Schüler völlig am Boden zerstört sind, wenn sie eine schlechte Note bekommen. Man hat ihnen offensichtlich nicht gesagt, dass ein Mensch scheitern kann. Dabei ist dieser Satz so einfach: Wir können scheitern. Er ist einfach, aber er hat etwas mit unserem Menschsein zu tun. Tiere können nicht scheitern, weil ihr ganzes Tun von ihrem Instinkt diktiert wird: Sie brauchen nur ihrer Natur zu folgen, um nicht zu irren. Der Vogel, der sein Nest baut, tut das jedes Mal auf vollkommene Weise. Instinktiv weiß er, was zu tun ist. Er muss keine Lehren aus seinen Fehlschlägen ziehen. Durch unser Irren und Scheitern manifestiert sich unsere menschliche Natur: Wir sind weder instinktgeleitete Tiere noch durchprogrammierte Maschinen oder gar göttliche Wesen. Wir können scheitern, weil wir Menschen sind und weil wir frei sind: frei, uns zu irren – frei, uns zu korrigieren – frei, uns weiterzuentwickeln.
Ab und zu klingt das Thema Scheitern bei den Philosophen doch an. Recht greifbar bei den Stoikern des Altertums, die uns eine Weisheit der Akzeptanz lehren und uns nahelegen, auf ein Übel nicht noch ein weiteres draufzusetzen. Als Ahnung bei Nietzsche, wenn er beispielsweise schreibt: »Mancher kann seine eignen Ketten nicht lösen, und doch ist er dem Freunde ein Erlöser.« Implizit in Sartres Aufsätzen über Existenzialismus: Wenn wir unser Leben lang werden können, nicht gefangen sind in einem Sein, sagt Sartre, dann kann Scheitern die Tugend besitzen, uns in die Zukunft zu tragen, und helfen, uns neu zu erfinden. Explizit bei Bachelard, wenn er den Wissenschaftler definiert als jemanden, der den Mut hat, eine »Psychoanalyse der anfänglichen Irrtümer« durchzuführen. Von diesen Philosophen werden wir also ausgehen. Aber das wird nicht ausreichen. Die Weisheit des Scheiterns, die die Philosophen lediglich umreißen, müssen wir woanders suchen: in Schriften von Künstlern, in Erfahrungsberichten von Psychoanalytikern, in heiligen Texten, in den Memoiren bedeutender Persönlichkeiten, in den inspirierenden Reflexionen eines Miles Davis, in den Lehren fürs Leben von Andre Agassi und nicht zuletzt in Gedichten wie »If–« von Rudyard Kipling.
1WER SCHEITERT, LERNT SCHNELLER
Wir befinden uns in Tarbes, Südwestfrankreich, mitten im Winter des Jahres 1999. Der junge Spanier ist 13 Jahre alt. Er hat soeben das Halbfinale des Tennisturniers »Les Petits As« verloren, die inoffizielle Weltmeisterschaft der 12- bis 14-Jährigen. Der Franzose, der ihn besiegt hat und das Turnier gewinnen wird, ist im gleichen Jahr geboren und genauso groß wie er. Es war ein Leichtes für ihn gewesen, ihn zu bezwingen. Der Wunderknabe heißt Richard Gasquet: Er ist »der kleine Mozart des französischen Tennis«. Die Fachleute behaupten, kein Spieler seines Alters habe jemals eine derartige Meisterschaft erreicht. Mit neun Jahren prangte er bereits auf dem Titelblatt von Tennis Magazine, das titelte: »Le champion que la France attend?« – Frankreichs zukünftiger Weltmeister? Seine vollendeten Bewegungen, die Schönheit seiner einhändigen Rückhand, die Angriffslust seines Spiels bedeuteten ebenso viele narzisstische Verletzungen für seinen Gegner. Nachdem der Junge aus Mallorca Richard Gasquet die Hand gereicht hat, lässt er sich völlig erledigt auf seinen Stuhl fallen. Sein Name ist Rafael Nadal.
Rafael Nadal hat es an jenem Tag nicht geschafft, Weltmeister seiner Altersklasse zu werden. Wenn man sich dieses Spiel heute auf YouTube anschaut, fällt besonders die aggressive Spielweise von Richard Gasquet auf: Er nimmt den Ball sehr früh und überrumpelt den Gegner. Und genau diese Art, möglichst aggressiv in den Ball zu gehen, erinnert auf seltsame Weise an das, was später Rafael Nadals Erfolg ausmachen wird, jenem Tennisspieler, der jahrelang die Weltrangliste anführen und 60 Turniere gewinnen wird, davon zwölfmal den Grand-Slam-Titel. Richard Gasquet ist ein bedeutender Spieler geworden: Er hat es bis auf Platz sieben der Weltrangliste geschafft. Doch bis heute hat er kein einziges der Grand-Slam-Turniere gewonnen. Überhaupt hat er insgesamt nur neun Titel geholt. Egal, was für Glanzleistungen er noch in Zukunft vollbringt, er wird es nie mehr so weit schaffen wie Rafael Nadal. Daher stellt sich die Frage: Was war entscheidend für diesen Unterschied?
Ein Blick auf den Werdegang von Rafael Nadal kann eine Teilantwort geben. In jungen Jahren hat er viele Fehlschläge erlebt, Spiele verloren und, weil ihm die klassische Vorhand partout nicht gelingen wollte, eine eigene Vorhand entwickeln müssen, die zu seinem Markenzeichen geworden ist: Nach dem Ballschlag schnellt sein Schläger mit einer unwahrscheinlichen Geste wie ein Lasso in die Höhe. Nach seiner Niederlage spielte Rafael Nadal noch 14-mal gegen Richard Gasquet –, und er gewann alle 14 Spiele. Was geschah nach der Niederlage? Zweifellos begann Rafael Nadal, sich mehr für Gasquets Spiel zu interessieren, und hat es mit seinem Onkel und Trainer Tony Nadal in allen Einzelheiten analysiert. Zweifellos hat er an jenem Tag in Tarbes mehr aus seiner Niederlage gelernt, als wenn er gesiegt hätte. Vielleicht hat er sogar mehr aus dieser einen Niederlage gelernt, als es bei zehn Siegen der Fall gewesen wäre. Möglich auch, dass ihm das eigene Maß an Aggressivität, zu dem er fähig ist, eben in jenem Moment klar wurde, in dem er der von Richard Gasquet unterlag. Ich bin überzeugt, dass Rafael Nadal diese Niederlage half, sein wahres Talent schneller zu entdecken. Übrigens hat er im Jahr darauf das Turnier »Les Petits As« gewonnen.
Vielleicht liegt genau hier das Problem von Richard Gasquet: Von seinen ersten Gehversuchen auf dem Tennisplatz bis zum Alter von 16 Jahren sind ihm die Siege scheinbar mühelos in den Schoß gefallen. Kann es sein, dass er während der wichtigen Lehrjahre nicht genug scheiterte? Oder dass es beim ersten Scheitern schon zu spät war? Oder dass er, weil er fast nie scheiterte, nie die Erfahrung der widerständigen Wirklichkeit gemacht hat? Jene Erfahrung, die uns zwingt, die Wirklichkeit zu hinterfragen und zu analysieren und uns über den seltsamen Stoff zu wundern, aus dem sie gemacht ist. Erfolge sind angenehm, aber sie sind oft weniger lehrreich als Misserfolge.
Bestimmte Siege sind nur zu erringen, wenn Schlachten verloren werden. Eine paradoxe Aussage, der aber, wie ich meine, etwas vom Geheimnis der menschlichen Existenz innewohnt. Beeilen wir uns also zu scheitern, denn so begegnen wir der Wirklichkeit intensiver als bei unseren Erfolgen. Weil die Wirklichkeit uns Widerstand bietet, hinterfragen wir sie und betrachten sie aus allen Blickwinkeln. Weil sie uns Widerstand bietet, finden wir in ihr den Rückhalt, den wir brauchen, um Schwung zu nehmen.
In Studien über die Aktivitäten von Start-ups im Silicon Valley würdigen amerikanische Theoretiker das Fail-Fast – scheitere schnell – und sogar das »Fail-Fast, Learn-Fast« – scheitere schnell, lerne schnell – und heben den Lerneffekt früher Fehlschläge hervor. In den Jahren der Ausbildung ist der Geist wissbegierig und vermag sofort Lehren aus den sich bietenden Widerständen zu ziehen. Wie die Fachleute aufzeigen, sind Unternehmer, die früh scheiterten und schnell Lehren aus ihren Fehlschlägen gezogen haben, erfolgreicher – und vor allem schneller erfolgreich – als solche, deren Laufbahn ohne größere Hindernisse verläuft. Erfahrungen, auch missglückte, besitzen eine große Kraft und bringen einen schneller vorwärts als die besten Theorien.
Wenn stimmt, was die Fachleute sagen, dann wird auch verständlich, was all jenen guten, seriösen, anständigen Schulabgängern fehlt, die auf den Arbeitsmarkt kommen, ohne jemals gestrauchelt zu sein. Was sie wohl gelernt haben, wenn sie nichts weiter als die Regeln befolgt und die Vorgaben erfolgreich umgesetzt haben? Fehlt ihnen da nicht ein Sinn für den Neubeginn, für das in unserer Welt des schnellen Wandels entscheidende schnelle Reaktionsvermögen?
In meinem Beruf als Philosophielehrer habe ich bei vielen Gelegenheiten den Nutzen frühzeitiger Fehlschläge beobachten können und die daraus resultierende Fähigkeit, schneller erfolgreich zu sein.
Das Fach Philosophie steht im letzten Gymnasialjahr auf dem Lehrplan, ist also neu. Wie in keinem anderen Fach werden die Schüler zu eigenständigem Nachdenken gefordert, dürfen sich nie dagewesene Freiheiten im Umgang mit ihrem Wissen herausnehmen und sich an die großen Fragen der Existenz heranwagen. Aus heutiger Sicht kann ich nach 20 Jahren Philosophieunterricht behaupten, dass es besser ist, den ersten Aufsatz zu vermasseln, statt eine Durchschnittsnote zu kassieren und sich keine weiteren Fragen zu stellen. Eine schlechte Note zum Auftakt ermöglicht dem Schüler, das geforderte radikale Umdenken zu begreifen. Es ist besser, frühzeitig zu scheitern und sich die wahren Fragen zu stellen, statt durchzukommen, aber nicht zu begreifen, warum: Danach stellen sich schneller Fortschritte ein. Wird dieses Scheitern unmittelbar danach im Unterricht thematisiert, eröffnet sich ein leichterer Zugang zur Philosophie über das Scheitern als über den Erfolg.
Jahrelang habe ich Philosophie oder »culture générale«, wie sie offiziell genannt wird, auf Sommervorbereitungskursen für die Eingangsprüfung zur Aufnahme am Sciences Po Paris gelehrt. An den Intensivkursen im Lycée Lakanal in Sceaux, inmitten eines blühenden großen Parks, nahmen junge Abiturienten teil. Da die Prüfungen Ende August/Anfang September stattfinden, begannen die Kurse Mitte Juli und dauerten fünf Wochen. Hier konnte ich das gleiche Phänomen beobachten wie in der Schule, nur geraffter. Teilnehmer, die den Kurs mit ordentlichen Noten begonnen hatten, schafften die Prüfung zur Aufnahme am Sciences Po Paris am Ende des Sommers häufig nicht. Unter den Teilnehmern hingegen, die zu Beginn des Kurses einige richtig schlechte Noten kassiert hatten, schafften fünf Wochen später die meisten mit Bravour ihre Aufnahme an die Grande École in der Rue Saint-Guillaume. Dieses Scheitern, ihre erste »Krise« zu Kursbeginn, bot sich ihnen als Chance, sich der neuen Wirklichkeit zu stellen, die sie erwartete, während die mit den Durchschnittsnoten an dieser Stelle nichts mitnahmen. Die einen weckte das Scheitern auf, während die anderen über ihre kleinen Erfolge einschliefen. Ein relativ kurzer Zeitraum – fünf Wochen – reichte also aus, um zu zeigen, dass ein akzeptierter Fehlschlag mehr bringt als gar keiner. Mit anderen Worten, ein frühzeitiger Fehlschlag, der schnell wieder eingerenkt wird, ist mehr wert als gar kein Fehlschlag.
Diese Sicht der Dinge ist einleuchtend, in Ländern wie Deutschland und Frankreich aber kaum verbreitet. Für die amerikanischen Theoretiker stellt das Fail-Fast – das frühzeitige Scheitern als Tugend – den Gegenbegriff zum Fast-Track dar, die Vorstellung, wonach es entscheidend ist, sich so früh wie möglich auf die Fährte (»track«) des Erfolgs zu bringen, schnell erfolgreich zu sein. Letzteres entspricht in vielerlei Hinsicht der Auffassung von Erfolg, wie sie heute in Frankreich vorherrscht. Tatsächlich leiden wir an dieser Fast-Track-Ideologie.
In den USA, aber auch in Großbritannien, Finnland oder Norwegen sprechen Unternehmer, Politiker oder Sportler gerne über die Fehlschläge, die sie am Anfang ihrer Karriere erleiden mussten, und führen sie so stolz vor wie ein Krieger seine Narben. Wir hingegen definieren uns selbst unser Leben lang über die Diplome, die wir gemacht haben, als wir noch bei unseren Eltern wohnten.
Bei meinen Coachings in Unternehmen habe ich oft mit Personen in leitenden Funktionen zu tun, die sich mit HEC 76, ENA 89 oder X 80 vorstellen, sprich als Absolventen der Elitehochschulen École des hautes études commerciales im Jahr 1976, der École nationale d’administration 1989 und der École polytechnique 1980. Das überrascht mich jedes Mal wieder. Die implizite Botschaft ist klar: »Das Diplom, das ich mit zwanzig erlangt habe, verleiht mir lebenslang eine Identität und einen Wert.« Das ist das Gegenteil des Fail-Fast: Es geht nicht darum, schnell zu scheitern, sondern schnell Erfolg zu haben! Ganz so, als wäre es möglich – und wünschenswert –, sich ein für alle Mal vor Risiken zu schützen, sich auf der Fährte einer vorgezeichneten Karriere einzurichten und sich ein Leben lang über einen Erfolg zu definieren, den man mit 20 errungen hat. Steckt hinter dem Diplomwahn etwa die Angst vor dem Leben, vor der Wirklichkeit, mit der wir glücklicherweise ständig konfrontiert werden, durch ein Scheitern oft sogar noch schneller? Die Lebensläufe von Richard Gasquet und Rafael Nadal scheinen jedenfalls zu bestätigen, dass es besser ist, ab und zu die Erfolgsfährte zu verlassen – und zwar möglichst früh. Im Übrigen kann man bei dieser Gelegenheit die eigene Widerstandsfähigkeit erproben. Damit kommen wir zu einer weiteren Tugend des Scheiterns: Wir müssen einmal gescheitert sein, um zu wissen, dass wir wieder aufstehen können. Je früher wir damit anfangen, desto besser.
Die schädlichen Auswirkungen der Fast-Track-Ideologie sind in einem weiteren Bereich des französischen Bildungssystems zu spüren. Der Lehrkörper ist in zwei Kategorien unterteilt. Wer auf höheres Lehramt studiert und nicht die Agrégation, sondern nur das CAPES geschafft hat, unterrichtet 18 Stunden pro Woche. Wer hingegen die Agrégation erlangt hat, unterrichtet 14 Stunden pro Woche und ist besser bezahlt. Im Laufe der Karriere werden diese Unterschiede noch größer. Vom Fail-Fast-Prinzip sind wir also noch meilenweit entfernt. Wer mit 22 Jahren seine Agrégation nicht geschafft hat, muss mit Mehrarbeit für weniger Geld bis ans Ende seiner Tage dafür bezahlen. Ein absurdes System, das den Wert von Erfahrung im Beruf negiert.
Dieser Logik entsprechend, müssen die Schüler ab der zehnten Klasse wissen, was sie später studieren wollen, und haben Beklemmungen bei dem Gedanken, dass die Entscheidung für eine Fachrichtung ihnen Türen verschließen wird. Sie sind noch keine 16 Jahre alt und werden schon vor falschen Weichenstellungen gewarnt. Stattdessen sollte man ihnen die Angst nehmen und ihnen sagen, dass man manchmal seinen Weg schneller findet, wenn man erst einmal irrt, dass es Fehlschläge gibt, die einen schneller vorwärtsbringen als Erfolge. Man sollte ihnen von dem Tag erzählen, an dem Nadal gewonnen hat, als er gegen Gasquet verlor. Oder ihnen schildern, wie die Professoren der Medizinfakultät von Boston die Bewerber auswählen. Weil es zu viele Kandidaten gibt, die Medizin studieren wollen, und auch zu viele, die auf den ersten Blick alle erforderlichen Kriterien erfüllen, ziehen die Professoren Bewerber vor, die schon mal gescheitert sind. Die besten Chancen haben Studenten, die bereits ein anderes Studium angefangen, aber dann gemerkt haben, dass es ein Fehlgriff war, und jetzt Medizin studieren wollen. In den Augen der Professoren helfen solche Fehlentscheidungen, schneller zu wachsen und sich schneller der eigenen Berufung zu nähern, kurzum, sich selbst besser kennenzulernen. Ganz praktisch vermindert sich so auch das Risiko, Studenten aufzunehmen, denen nach ein paar Monaten klar wird, dass sie doch nicht Arzt werden wollen: Sie haben bereits einen neuen Weg eingeschlagen, unwahrscheinlich also, dass sie es noch einmal tun.
Die Gymnasiasten und Studierenden sind nicht die Einzigen, die unter der Fast-Track-Ideologie zu leiden haben. Für einen Unternehmer stellt eine Pleite ein kaum zu überwindendes Hindernis dar. Damit ist er gebrandmarkt und wird es sehr schwer haben, die Finanzierung für ein neues Projekt zu finden. In den USA, einer Kultur des Fail-Fast, wird sein Scheitern – wenn er es gut vermittelt – als Erfahrung, als Beweis von Reife und als Garantie dafür gesehen, dass er eine bestimmte Art von Fehlern nicht mehr machen wird. Vielleicht bekommt er sogar leichter einen Kredit gewährt, als wenn er nicht gescheitert wäre. Hierzulande ist das genaue Gegenteil der Fall. Bis 2013 gab es in der Banque de France eine Kartei – »fichier 040« – mit den Namen sämtlicher Unternehmer, die ein Insolvenzverfahren durchlaufen hatten. Wer in dieser Kartei stand, war gebrandmarkt und konnte sicher davon ausgehen, nie mehr eine Finanzierung für ein Projekt zu bekommen. Inzwischen wurde sie per Gesetz abgeschafft, doch die Vorbehalte der Banker und Investoren sind geblieben.
Scheitern hat in Frankreich und Deutschland oft mit Schuld zu tun. In den USA bedeutet es, wagemutig zu sein. Wer hier hingegen jung scheitert, hat es nicht geschafft, sich selbst auf den richtigen Weg zu bringen. Wer in den USA scheitert, hat schon früh begonnen, den eigenen Weg zu finden.
Letztendlich macht dieses Problem eines deutlich: Wir messen dem Verstand eine viel zu große Bedeutung bei – und den Diplomen, die den Triumph des Verstandes über die Erfahrung sanktionieren. Als Kinder von Platon und Descartes sind wir zu sehr Rationalisten und nicht Empiriker genug. Es ist also kein Zufall, dass die meisten Philosophen des Empirismus aus dem angelsächsischen Raum kommen: John Locke, David Hume, Ralph Waldo Emerson … Im Kern sagte David Hume: Was wir von der Welt wissen, das wissen wir aus Erfahrung. Und der Amerikaner Emerson ein gutes Jahrhundert später: »Das Leben ist ein Experiment. Je mehr Erfahrungen man macht, desto besser.«
Die Erfahrung des Scheiterns ist die unmittelbare Erfahrung des Lebens selbst. Erfolgstaumel empfinden wir häufig als Schwebezustand. Er lässt sich zugegebenermaßen nicht »fassen«. Beim Scheitern hingegen stoßen wir auf eine Wirklichkeit, die wir vorher nicht kannten und die uns vor den Kopf stößt. Ist nicht das wahre Leben das, was uns überrascht, mit sich reißt und von keiner Theorie erklärt werden kann? Je schneller wir scheitern, desto früher hinterfragen wir das Leben.
2NUR WER IRRT, KANN VERSTEHEN
– Die epistemologische Sicht –
»Es gibt keine Wahrheit ohne korrigierte Irrtümer.«
Gaston Bachelard
Der Dichter und Denker Gaston Bachelard definierte einen Gelehrten wie folgt: Er erkennt seinen anfänglichen Irrtum und findet die Kraft, ihn zu korrigieren.
Bachelard zufolge sind die großen Wissenschaftler Menschen wie du und ich: Erst irren sie und machen sich falsche Vorstellungen von den Dingen. So glaubten sie, dass ein Schwamm »saugt« und ein Stück Holz »schwimmt«. Was sie jedoch zu Wissenschaftlern macht, ist, dass sie es nicht bei diesen ersten Überzeugungen belassen. Sie stellen Versuche an, um ihre Gültigkeit zu testen, und besitzen den außerordentlichen Mut, ihren anfänglichen, durch Berührung mit der Wirklichkeit, mit den Naturgesetzen aufgezeigten Irrtum zu korrigieren. So begriffen sie, dass ein Schwamm nicht »saugt«, sondern die Wassertropfen der Umgebung in die Hohlräume dringen. Und auch, dass ein Stück Holz nicht aktiv auf dem Wasser schwimmt, sondern dass es mit dem Verhältnis von Masse und verdrängtem Wasservolumen zu tun hat, nach dem Archimedischen Prinzip, wonach ein Körper schwimmt, wenn die Auftriebskraft größer als die Gewichtskraft ist. Daraus folgt die radikale Schlussfolgerung von Bachelard, dass es »keine Wahrheit ohne korrigierte Irrtümer« gibt.
In seinem Werk Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes