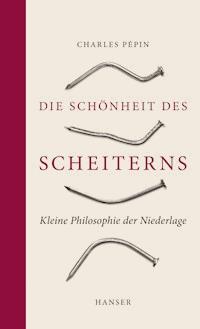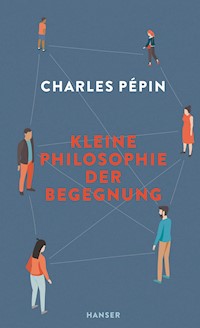Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Philosophie, die Mut macht: Wie die eigene Vergangenheit zur Kraftquelle wird.
Die Vergangenheit vergeht nicht. Sie ist immer präsent. Wie ist es möglich, eine fruchtbare Beziehung zu den eigenen Erinnerungen aufzubauen? Die Neurowissenschaften bestätigen heute, was die Philosophie schon lange weiß: Das Gedächtnis ist dynamisch und beweglich. Unsere Erinnerungen sind nicht starr, sie ähneln einer Partitur, die es zu interpretieren gilt.
Der Philosoph Charles Pépin bringt antike Weisheiten, kognitive Wissenschaften, neue Therapieformen und Klassiker der Philosophie zusammen. Das individuelle Glück hängt mit der Fähigkeit zusammen, gut mit der eigenen Vergangenheit zu leben. Sie kann zu einer Kraftquelle für die Zukunft werden – das beweist dieses vor Optimismus sprühende Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Eine Philosophie, die Mut macht: Wie die eigene Vergangenheit zur Kraftquelle wird.Die Vergangenheit vergeht nicht. Sie ist immer präsent. Wie ist es möglich, eine fruchtbare Beziehung zu den eigenen Erinnerungen aufzubauen? Die Neurowissenschaften bestätigen heute, was die Philosophie schon lange weiß: Das Gedächtnis ist dynamisch und beweglich. Unsere Erinnerungen sind nicht starr, sie ähneln einer Partitur, die es zu interpretieren gilt.Der Philosoph Charles Pépin bringt antike Weisheiten, kognitive Wissenschaften, neue Therapieformen und Klassiker der Philosophie zusammen. Das individuelle Glück hängt mit der Fähigkeit zusammen, gut mit der eigenen Vergangenheit zu leben. Sie kann zu einer Kraftquelle für die Zukunft werden — das beweist dieses vor Optimismus sprühende Buch.
Charles Pépin
Mit der eigenen Vergangenheit leben
Eine Philosophie für den Aufbruch
Aus dem Französischen von Caroline Gutberlet
Hanser
Einleitung
Mit dem Bohneneintopf oder den Rinderrouladen, die wir an Sonntagen mit so großer Freude zu kochen pflegen, mit diesen Gerüchen und Geschmäckern knüpfen wir an unsere Kindheit an, an unsere Oma, die sie so vorzüglich zuzubereiten wusste.
In unserem Verhältnis zur Arbeit, unserem zuweilen übertriebenen Perfektionismus, werden wir wieder zu dem Jugendlichen von damals, der sich vor den Vorhaltungen des Vaters oder eines autoritären Lehrers fürchtete.
In unserer Art zu lieben, um jeden Preis daran zu glauben, lassen wir den Idealismus unserer Mutter fortleben; das, was wir mit unseren Kinderaugen von der Liebe gesehen haben.
In den Werten, an die wir glauben, und in den Dingen, die uns wichtiger sind als alles andere, überdauern die Spuren unseres Herkunftsmilieus, unserer Erziehung und unserer einschneidenden Begegnungen.
Sogar wenn wir uns in Betrachtung versenken, sind wir nicht einfach nur im gegenwärtigen Augenblick: Die Landschaft, die uns mitten ins Herz trifft und wie durch Zauberhand mit der Welt versöhnt, das Licht der Sommerabende, das wir so gern wiederfinden, der Wein, der uns gleich beim ersten Schluck auf eine Reise schickt — all das zu lieben, ihre Schönheit zu genießen, ihre Kraft zu spüren, haben wir gelernt.
Alles, was wir sind, unsere guten wie unsere schlechten Seiten, unsere Vorlieben und Abneigungen, unsere Träume und Ambitionen, aber auch unsere Ängste und Sorgen, unsere Freuden und Leiden, unsere Reaktionen, unsere Weltsicht und natürlich unsere Gewohnheiten: All dies entspringt unserer Vergangenheit. Und in allem ist die Vergangenheit gegenwärtig. Wir glaubten, sie läge hinter uns, dabei macht sie sich kontinuierlich bemerkbar.
Diese Vergangenheit, die nicht vergeht, hält sich noch hartnäckiger im Kern jener Dinge, die wir bedauern oder bereuen, in der Erinnerung an unsere Fehlschläge, an jene Momente, die sich uns eingebrannt haben und sich immer dann in Erinnerung rufen, wenn uns Zweifel befallen. Aber sie hält sich auch, wiewohl eher im Hintergrund, in der Erinnerung an schöne Dinge, an unsere ersten Gefühlswallungen, unsere prägendsten Entdeckungen, unsere Erfolge.
Egal, ob wir glücklich oder unglücklich sind, unsere Vergangenheit kehrt unentwegt zurück. Sie lädt sich ungebeten in unsere Gegenwart ein: bei der Arbeit, auf der Straße, zu Hause, unerwartet, zurückgerufen durch eine flüchtige Sinnesempfindung. Ein kurzes Verweilen, und schon taucht sie aus den Tiefen unserer Geschichte auf und spült einen Schwall von Erinnerungen hoch, die uns in sanfte Nostalgie oder bittere Melancholie versetzen. Mitunter überfällt sie uns auch, gnadenlos, intensiv, blendend wie der Blitz eines alten Traumas, der uns ins Wanken bringt, allzu oft im ungünstigsten Moment. Eine unglückliche, schmerzhafte Erinnerung oder eine Verletzung, die wir am liebsten vergessen würden, kommt immer wieder hoch, als wären wir dazu verdammt, diese Szene endlos zu durchleben. Wir möchten uns von der unglücklichen Vergangenheit frei machen und die glücklichen Tage wiederkehren lassen, doch meistens scheitern wir mit dem einen wie mit dem anderen. Je mehr wir vergessen wollen, desto mehr Kraft verleihen wir den Erinnerungen, die uns zusetzen. Je mehr wir vergangene Freuden wiederaufleben lassen wollen, desto bitterer die Nostalgie. Ein seltsames Ding ist die Vergangenheit: Sie lässt sich nicht rückgängig machen und sucht doch fortwährend unsere Gegenwart heim. Wie die Antlitze unserer Verstorbenen, wenn sie uns besuchen.
Es wäre ein Fehler zu glauben, dass das Gestern allein der Vergangenheit angehört. In Wirklichkeit vergeht die Vergangenheit nicht; wir bestehen zu weitaus größeren Teilen aus Vergangenheit als aus Gegenwart. Jeder erlebte Augenblick schließt sich eilends der Vergangenheit an, die sich endlos weiter aufbläht wie ein Segel bei Rückenwind. In der Gegenwart sind wir nur Passanten: Je weiter wir im Leben voranschreiten, desto reicher an Erlebtem sind wir. Daher ist es für uns essenziell, gut mit unserer Vergangenheit zu leben und den richtigen Abstand zu ihr zu finden. Um uns selbst besser zu kennen und zu verstehen, um zu wissen, was wir geerbt haben, aber vor allem, um nicht ins Grübeln und Wiederkäuen zu verfallen wie diejenigen, die nicht mit, sondern in ihrer Vergangenheit leben und manchmal auch in Neurosen oder Ressentiments gefangen sind.
Ohne die Lichtmomente des Gestrigen sehen wir nichts vom Morgigen, und das immer größer und stärker werdende Segel treibt uns irgendwohin. Unser Leben entgleitet uns, wir werden zu blinden Passagieren.
Um zu begreifen, wie unsere Vergangenheit in der Gegenwart auf uns einwirkt, müssen wir untersuchen, wie unser Gedächtnis funktioniert. Denn hier befindet sich unsere Vergangenheit: in uns, nicht hinter uns. Lange Zeit haben wir irrigerweise das Gedächtnis auf einen simplen Erinnerungsspeicher reduziert, inzwischen wissen wir aber dank der Fortschritte der Neurowissenschaften, dass es viel mehr ist: Unser Gedächtnis ist komplex und beweglich, es ist das pochende Herz unseres Gehirns, das sich seinerseits durch Plastizität und die Fähigkeit auszeichnet, sich ständig selbst umzustrukturieren und unablässig neue Nervenverknüpfungen anzulegen. Dieses neue Verständnis des Gedächtnisses, das die heutige Kognitionswissenschaft etabliert hat, bricht mit dem Bild, das wir uns bis dato von den Erinnerungen gemacht haben: als Daten, die auf einer Festplatte gespeichert werden. Auch die Erinnerungen sind lebendig; sie werden regelmäßig abgerufen, bekräftigt, zementiert, zuweilen neu erschaffen und sogar erfunden.
Unser Gedächtnis gleicht einem neuen Kontinent, wo faszinierende Entdeckungen auf uns warten: Unsere Vergangenheit ist zugleich ein Schicksal, das umarmt, und ein Material, das bearbeitet werden will, und unsere Erinnerungen sind eher erfinderische Rekonstruktionen als objektive Daten. Die Revolution der Neurowissenschaften eröffnet uns vollkommen neue Felder: Wir haben die Möglichkeit, auf vergangenes Unglück zurückzublicken, um das Toxische daran zu neutralisieren, und die Möglichkeit, verlorenes Glück in die Gegenwart zu holen, um es wieder zu genießen. In unsere Vergangenheit eingreifen zu können, ist keine Fiktion, sondern wissenschaftlich erwiesen und stellt vor allem eine existenzielle Möglichkeit für uns alle dar. Die vielversprechende Revolution hat bereits zu neuen psychotherapeutischen Methoden der sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung geführt. Wenn wir die Funktionsweise unseres Gedächtnisses besser verstehen, können wir auf unsere Vergangenheit und damit auch auf unsere Gegenwart einwirken, auf unser Vermögen, uns vorwärts zu bewegen. Während Freud oder Lacan uns aufforderten, die Vergangenheit zu akzeptieren, da sie nicht zu ändern sei, legen uns die neuen, neurowissenschaftlich ausgebildeten Therapeuten nun nahe, unsere Vergangenheit zu verändern, um offen für die Zukunft zu sein.
Im Lichte dieser außergewöhnlichen Reise in unser Gehirn werden wir nicht nur manche antike Weisheit wiederfinden und ihre verblüffende Aktualität ermessen, sondern auch jüngere Philosophen, angefangen bei Friedrich Nietzsche über Henri Bergson bis hin zu Hannah Arendt, die die wesentliche Bedeutung des Gedächtnisses — und des Vergessens — für die Entwicklung der Persönlichkeit, den Erfolg unseres Handelns und für unser Glück erkannt haben. Wir werden uns auf sie stützen und dank ihnen lernen, wie wir mit unserer Vergangenheit besser leben können. Daneben werden wir aus Literatur und Kunst schöpfen: die Proust’schen Reminiszenzen, die schöpferische Fantasie von Hervé Le Tellier, die traumartigen Inszenierungen von David Cronenberg und David Lynch, die Schriften von Jorge Semprun und Simone Veil über die Lagererfahrung, die Schilderung der Trauer um ihren Mann von Joan Didion, die ergreifenden Melodien von Barbara bis hin zum vielseitigen Talent von Zlatan Ibrahimović. Denn diese Künstlerinnen und Künstler des Worts, des Bilds oder des Balls machen für uns nachvollziehbar, was uns die Neurowissenschaften lehren: Obwohl unsere Vergangenheit uns zu dem gemacht hat, was wir sind, sind wir nicht einfach das, was sie aus uns gemacht hat; wir haben keinen Grund, uns von unserer Vergangenheit alles gefallen zu lassen.
Wir müssen nur den richtigen Abstand zu ihr finden und unser Segel, das die Vergangenheit immer weiter aufbläht, so ausrichten, dass es den Wind gut ausnutzt, damit wir wieder in Fahrt kommen.
Kapitel 1
Henri Bergsons geniale Intuition
Es hat lange gedauert, bis das Gedächtnis ein vollwertiges Thema der Philosophie wurde. Und noch heute haben wir oft eine verzerrte Vorstellung davon. Nicht selten werden Metaphern der Informatik bemüht, um über diese Sphäre des Geistes zu sprechen. So ist von »mangelnder Bandbreite« oder vom »vollen Speicher« die Rede, ganz so, als könnten wir das Gedächtnis lokalisieren und ihm eine Festplatte aufpfropfen, um »seine Kapazitäten zu erhöhen«. Wir stellen uns das Gedächtnis häufig als ein statisches, rein volumenbezogenes, aufhäufendes Ding vor. Ein Vorurteil, das den Begriff der Erinnerung und das Phänomen der Reminiszenz verarmen lässt. Die philosophische Tradition ist in diesem Punkt über lange Zeit dem gemeinen Menschenverstand gefolgt und hat das Gedächtnis als bloßen Aufbewahrungsort der Vergangenheit betrachtet. So begründete René Descartes beispielsweise sein mangelndes Interesse am Gedächtnis damit, dass dieses verglichen mit der Vernunft oder dem Bewusstsein »von Natur aus schwach« sei.
Abgesehen von den Visionen einiger weniger Philosophen, die die Potenziale des Gedächtnisses erkannten, allen voran Augustinus, der in seinen Bekenntnissen dessen große Kraft lobte, sollte es noch bis Ende des 19. Jahrhunderts dauern, ehe ein Philosoph das Gedächtnis in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellte. Henri Bergson hatte die für seine Epoche ziemlich verrückte, doch von der heutigen Wissenschaft bestätigte Intuition, dass unser Gedächtnis nicht statisch, sondern dynamisch ist, dass unsere Erinnerungen lebendig sind, einem Auf und Ab unterliegen und kurz unser Bewusstsein streifen, bevor sie wieder verschwinden. Und vor allem: dass unser Gedächtnis konstitutiv für unser Bewusstsein und damit unsere Identität ist.
Der phänomenale Erfolg Bergsons und seiner Philosophie des Gedächtnisses ist heute kaum noch nachvollziehbar, ebenso wenig der Schock, den die neuen Überlegungen auslösten, die der einflussreichste Philosoph seiner Zeit verfocht, der am Collège de France in Paris lehrte, die »Völkerbundkommission für geistige Zusammenarbeit« leitete und sogar den Literaturnobelpreis erhielt.
Die Menschen drängten sich auf dem Boulevard Saint-Germain, um Bergson am Collège de France zu hören. Jede seiner Vorlesungen war ein Ereignis, selbstredend ein intellektuelles, aber auch ein gesellschaftliches. Wer vor der Tür des Hörsaals bleiben musste, hoffte, den Verfasser der Schöpferischen Evolution beim Verlassen des Gebäudes zu erblicken oder den Klang seiner verstärkten Stimme durch das Fenster zu hören. Um die begeisterte Zuhörerschaft empfangen zu können, wurde sogar in Erwägung gezogen, seine Vorlesung in die große Aula der Sorbonne oder in die Halle des Palais Garnier zu verlegen. Auch im Ausland mobilisierte Bergson die Massen. 1911 hielt er in London einen Vortrag, der über eigens installierte Lautsprecher bis auf die Straße übertragen wurde. 1913 in New York soll sein Auftritt auf dem Broadway den ersten großen Verkehrsstau der Stadtgeschichte verursacht haben! Bergson war, weit vor der Zeit, eine Art Popstar der Philosophie — und warum? Wegen einer entschieden modernen Philosophie des Gedächtnisses und der Erinnerungen, die auch ein Denken des Handelns und eine Einladung zur Freiheit war.
Auf seiner Suche nach der anfänglichen und letztgültigen Wahrheit stellte sich Descartes die Frage: Wie können wir uns unserer Existenz gewiss werden? Seine Antwort war das berühmte cogito ergo sum: Ich denke, also bin ich. Der Beweis unserer Existenz liege in unserem Bewusstsein. Eine Behauptung, die Hegel zufolge Descartes als »Helden« der modernen Philosophie etablierte. Bergson revolutionierte das cogito. Er übernahm die Antwort Descartes’ und setzte — in genialer Intuition — das erinnernde Subjekt an seine Stelle: Wir wissen, dass wir existieren, weil wir uns erinnern. Unsere Fähigkeit, uns unsere Handlungen und Erfahrungen in Erinnerung zu rufen und dieses Wissen unter dem Dach einer Identität, einer Persönlichkeit mit ihrer individuellen Geschichte zu vereinen, wird zum Sockel der Erkenntnis. Ich erinnere mich, also bin ich! Unsere Erinnerungen sind der Stoff, aus dem wir gemacht sind, behauptet Bergson. So schreibt er 1919 in Die seelische Energie: »Ich […] halte mich an die Beobachtung, denn es gibt nichts so unmittelbar Gegebenes, nichts evidenter Wirkliches, als das Bewußtsein, und der Geist des Menschen ist das Bewußtsein selber. Nun bedeutet aber Bewußtsein vor allem Gedächtnis. […] So glaube ich denn freilich, daß unser ganzes inneres Leben etwas ist wie dieser einzige Satz, den ich schon beim ersten Erwachen meines Bewußtseins begonnen habe, ein Satz, der wohl mit Kommata durchsät ist, doch nirgends durch Punkte zerschnitten.«1
Unser Wissen und unsere Identität und damit auch das Gedächtnis, auf dem sie gründen, sind jedoch nicht verfestigt. Bergson zufolge besteht unsere Vergangenheit in unserem Gedächtnis endlos fort, ohne starr zu sein: Sie entwickelt sich mit uns weiter und wird entsprechend unseren Lebenserfahrungen und der Art und Weise, wie wir unsere Zukunft abstecken, in der Gegenwart modelliert. Ein Jahrhundert später haben die Neurowissenschaften Bergsons Intuition bestätigt: Es gibt keine objektive Erinnerung, jede Erinnerung ist eine dynamische Rekonstruktion. Diese Kraft, die in unserem Gedächtnis wirkt, ist sogar konstitutiv für das Lebensprinzip, das uns antreibt.
In Materie und Gedächtnis zeigt Bergson auf, dass wir, um zu handeln, unentwegt die Erinnerungen danach auswählen, was für unser Handeln nützlich ist: Aus dem riesigen Ozean unserer Erinnerungen strömen spontan nur diejenigen ins Bewusstsein, die wir brauchen. Kein Philosoph vor ihm hatte so gut verstanden, was heute eine wissenschaftliche Tatsache ist: Das Gedächtnis dient weniger dazu, die Vergangenheit zu bewahren, als eher dazu, sich in die Zukunft zu projizieren. Oder genauer: Es bewahrt die Vergangenheit, um Vorhersagen treffen zu können. Wie im Übrigen bei Alzheimer-Kranken zu beobachten ist, fällt es ihnen nicht nur schwer, sich an die Vergangenheit zu erinnern, es gelingt ihnen auch nicht, sich der Zukunft zuzuwenden. Das Gedächtnis und die Sorge um das, was kommt, gehen Hand in Hand: Diese fast schon kontraintuitive Idee steht im Zentrum von Bergsons visionärem Denken.
Allerdings aktiviert unser Handeln nur einen winzigen Teil der verfügbaren Erinnerungen. Diesseits des Handelns bildet unser Gedächtnis ein großes Ganzes aus Erinnerungen, die Bergson als lebendig und in Bewegung beschreibt. Wollen wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, müssen wir in die Flut der Überbleibsel der Vergangenheit eintauchen und diesen begegnen, um unsere Komplexität, unsere Subjektivität und jene Geschichte zu erfassen, die für uns konstitutiv ist und unaufhörlich fortgeschrieben wird, die »mit Kommata durchsät ist, doch nirgends durch Punkte zerschnitten«.
Wie Bergson in Die seelische Energie schreibt: »Aber setzen Sie den Fall, daß ich in einem bestimmten Moment das Interesse an der gegenwärtigen Situation, an meinen dringendsten Geschäften, kurz an dem, was bisher alle Aktivität meines Gedächtnisses auf einen einzigen Punkt konzentrierte, verliere. Anders ausgedrückt, setzen Sie den Fall, ich schlafe ein. Dann würden diese reglosen Erinnerungen merken, daß das Hindernis weggeräumt ist, daß die Falltür geöffnet ist, die sie bis dahin im Kellergeschoß des Bewußtseins eingesperrt hielt, und nun geraten sie in Bewegung. Sie werden sich rühren, sich erheben und in der Nacht des Unbewußtseins einen ungeheuren Totentanz aufführen. Und alle miteinander werden zur Tür laufen, die sich eben halb geöffnet hat.«2
In dieser Passage erinnert Bergson an den Traumzustand: Wenn wir aufhören, zu handeln und dadurch eine Auswahl zu treffen, und unsere Erinnerungen freien Lauf haben, beginnen sie zu »tanzen«. Unsere Erinnerungen bilden den plastischen, vielgestaltigen, aktiven Stoff unserer Träume. Fast das gesamte Werk Bergsons ist eine Demonstration dieser Vitalität unserer Erinnerungen, die sich einerseits in den Träumen zeigt, andererseits und weit darüber hinaus in allen Phänomenen des Bewusstseins. Bergson lehrt uns etwas Grundlegendes für das Verständnis des menschlichen Geistes und unsere Persönlichkeitsbildung: Unsere Erinnerungen, unsere Vergangenheit »berieseln« unsere gesamte bewusste Aktivität. Unsere Vergangenheit kehrt fortlaufend in unseren Wahrnehmungen, Intuitionen, Entscheidungen wieder — in allem, was es uns ermöglicht, unsere freie Persönlichkeit auszudrücken. So erfassen wir die Welt durch den Filter unserer Erinnerungen: Sie legen sich über die Wirklichkeit, die als gleich, ähnlich oder gegensätzlich wahrgenommen wird; wir vergleichen, stellen Verbindungen her und Unterschiede fest, um zu begreifen und zu integrieren. Was wir sehen, berühren, hören, »erinnert« uns immer an etwas; das Neue wird unwiederbringlich mit dem Stempel des Erlebten versehen. Auch unsere Intuitionen sind durch eine lange Erziehung geprägt, durch Erfahrungen, die tief in unserem Innern eingeschrieben sind und zur rechten Zeit wiederkehren, um uns zu leiten. Hier ist kein Wunder am Werk, weder hellseherischer noch göttlicher Natur, sondern schlicht das fruchtbare Spiel der Erfahrung: Wir sind durchdrungen von einer Vergangenheit, die zu uns spricht und uns Orientierung gibt.
An diesem frühen Apriltag öffne ich das Fenster, atme die noch frische Morgenluft ein und verspüre große Lust, in eine leichte Jacke zu schlüpfen und meinen Kaffee draußen zu trinken. Es ist der besondere Duft des nahenden Frühlings, der Wiederkehr der schönen Tage. Noch ist es zu früh, um zu wissen, ob der Tag schön werden wird, doch da ist dieser einzigartige Wohlgeruch, der mich anspricht. Ich kenne ihn, erkenne ihn wieder, und er weckt in mir den Wunsch, den Sonnenaufgang zu genießen. So ist es auch mit jeder unserer Entscheidungen, die erst im Bewusstsein des Lebensweges, der uns bis an diesen entscheidenden Punkt geführt hat, frei sind. Wir entscheiden immer nur auf der Grundlage einer Gesamtheit von verinnerlichten Konditionierungen, die unsere Persönlichkeit geformt und die Prinzipien und Werte begründet haben, die unsere Entscheidungen bestimmen. Wir sind nur in dem Maße frei, in dem wir uns der Vergangenheit bewusst sind, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, und unserer Geschichte, die der Leitfaden für unsere Zukunft ist. Die Philosophie von Henri Bergson lädt uns ein, die lebendige Materie der Erinnerungen zu ergreifen und sie mitzunehmen in der Bewegung, die uns in die Zukunft trägt.
Wie lebendig unsere Erinnerungen sind, wie dynamisch unser Gedächtnis ist, diese Erfahrung machen wir Tag für Tag. Durch die wie aus dem Nichts auftauchende Erinnerung an einen verstorbenen geliebten Menschen — warum gerade jetzt? Durch das Gefühl des Bedauerns oder schmerzhafter Reue, das uns ergreift. Durch die Erinnerung an eine alte Liebe, die eine Duftnote, ein Lichtschimmer auf einem alltäglichen Gegenstand, ein Lied im Radio zufällig weckt. Wir hatten diesen fröhlichen Augenblick vollkommen vergessen, und nun läuft uns ein wohliger Schauer über den Rücken, so als hätte er, über all die Jahre unversehrt geblieben, rein und frisch, rücklings am Saum der Gegenwart auf die Gelegenheit gelauert, sich ins Bewusstsein zu rufen und ein Lächeln auf unsere Lippen zu zaubern. Oder wir denken an ein vergangenes, verlorenes Liebesglück zurück, das in unserem Gedächtnis aber noch so lebendig ist, dass uns die heftigsten Gefühle überwältigen und auf einer Woge bittersüßer Nostalgie forttreiben. Im Schatten einer so lebendigen, intensiven Erinnerung verblasst die Gegenwart und wird schal, auch darin liegt die ganze Kraft der Nostalgie, die Serge Gainsbourg in La Chanson de Prévert besingt: »Avec d’autres bien sûr je m’abandonne | Mais leur chanson est monotone | Et peu à peu je m’indiffère | À cela il n’est rien à faire | Car chaque fois ›Les Feuilles mortes‹ | Te rappellent à mon souvenir«.3Les Feuilles mortes, dieses Lied von Jacques Prévert, bewegt den Sänger ungewollt zum Rückblick auf eine vergangene Liebesgeschichte, die »nicht aufhört zu sterben« und in seiner Erinnerung präsent und lebendig bleibt mit einem Glanz, der seine neuen Liebschaften blass und »monoton« erscheinen lässt. Unter der Glocke einer hartnäckigen Erinnerung und andauernder Nostalgie kann die Gegenwart sich nicht entfalten. Gainsbourg wird vergessen müssen, um wieder lieben zu können, wenn seine »toten Liebschaften zu Ende gestorben sind«. Selbstverständlich wird dann die Erinnerung nicht tot sein, völliges Vergessen ist nicht möglich. Der Liebende muss lernen, mit ihr zu leben, sie in der Vergangenheit verblassen zu lassen, als abgeschlossenes Kapitel seiner Geschichte, die fortdauert. Wenn die Nostalgie süß wird und der Gegenwart Platz macht, kann er sich wieder öffnen.
Etwas weiter weg an den Rändern des Bewusstseins existieren all jene Erinnerungen, die uns entgleiten; sie sind wohl da, aber nicht greifbar. Sie liegen uns auf der Zunge, kitzeln unsere Nerven, wir fühlen sie, spüren sie, sie sind zum Greifen nah und entziehen sich doch, ausweichend und flüchtig. Irgendwann später kehren sie zurück und überraschen uns in einem denkbar unerwarteten Moment. So viel Wunderbares, Rätselhaftes verbirgt sich im Leben unseres Gedächtnisses!
Ja, unsere Vergangenheit ist lebendig, sie ist nicht nur vergangen, sondern stets gegenwärtig. Sie zwingt zur Demut: Nicht nur, dass sie partout nicht vorübergehen will, obendrein handelt sie nur nach ihrem eigenen Kopf. Die Vergangenheit taucht auf, wann sie will, nicht, wenn wir es wollen, und klopft ohne Vorwarnung an das Tor der Gegenwart. Unser Gedächtnis folgt einem eigenen Rhythmus, einer eigenen inneren Logik. Es reagiert auf Auslöser und Reize, die wir im Wesentlichen nicht verstehen. Wie gerne würden wir uns von belastenden Dingen befreien, peinliche Momente tilgen und quälendes Bedauern loswerden. Und umgekehrt unsere Sternstunden für die Ewigkeit festhalten und die Glücksmomente, als wir auf Wolke sieben schwebten, andauern lassen. Aber unsere Erinnerungen bleiben davon unbeeindruckt. Wir stecken in den Fängen der unkontrollierbaren Vergangenheit, der Erinnerung, diesem »sturen Hund«.4 Wie sollen wir in Frieden mit einer Geschichte leben, die uns ständig beißt?
Und doch müssen wir wohl oder übel einen Weg finden, um mit unserer Vergangenheit zu leben, dieses schwere Gepäck mit leichtem Herzen zu tragen, da jede Sekunde, die vergeht, unsere Zukunft verkürzt und das Erlebte anwachsen lässt. »Ja, ich glaube, unser vergangenes Leben ist immer da, aufbewahrt bis in seine geringsten Einzelheiten; wir vergessen nichts, und alles, was wir vom ersten Erwachen unseres Bewußtseins an empfunden, gedacht und gewollt haben, besteht endlos fort«, schreibt Bergson in Die seelische Energie.5 Was für eine erstaunliche, faszinierende und auch ein wenig beunruhigende Intuition — unsere Geschichte ist ganz und gar unauslöschlich …
Das erklärt, warum Menschenscharen sich drängten, um Bergson zu hören, dieser unauffälligen Erscheinung mit dem kraftvollen Denken. Die Feststellung der Demut angesichts der Vitalität unseres Gedächtnisses kommt für den Philosophen keinem Eingeständnis der Ohnmacht gleich. Im Gegenteil. Bergson lädt uns angesichts der stürmischen Wogen unserer Erinnerungen zu einer neuen Herangehensweise an die Freiheit ein. Er legt uns eine Haltung der schöpferischen Empfänglichkeit und der Offenheit für die Vergangenheit nahe, die uns konstituiert. Wenn die Persönlichkeit die persönliche Geschichte in ihrer Totalität verdichtet, dann wird der freie Akt zum Privileg derer, die »ihre Vergangenheit mitnehmen«, zur Gänze im Gepäck haben, um sich in die Zukunft zu stürzen. Wir können unsere Vergangenheit und unsere Freiheit gleichzeitig ergreifen. Bergson schlägt nichts weniger als eine Methode vor, damit uns dies gelingt.
Kapitel 2
Die Gegenwärtigkeiten der Vergangenheit
Das Gedächtnis ist keine ganzheitliche und homogene, sondern eine vielfältige Fähigkeit. Wir verfügen über mehr als ein Gedächtnis. Das hatte schon Bergson festgestellt: Wir merken uns Dinge auf verschiedene Weise, Lernprozesse können unterschiedlich verlaufen. Er unterschied zwei Formen des Gedächtnisses: das Erinnerungsgedächtnis (mémoire souvenir) und das Gewohnheitsgedächtnis (mémoire habitude). Das Erinnerungsgedächtnis bildet und erweitert sich mit den Lebenserfahrungen, ohne eigenes Zutun. Da ist die Erinnerung an unsere erste Verabredung oder an eine schmerzhafte Trennung. Im Unterschied dazu ist das Gewohnheitsgedächtnis das Ergebnis einer Anstrengung, eines Willensaktes. Da ist die Lektion, die wir lernen müssen, damit sie sich einprägt. Die Neurowissenschaftler haben Bergsons Intuition bestätigt, gehen in ihrer Analyse aber noch weiter. Nach ihren Erkenntnissen gibt es nicht zwei, sondern fünf Formen des Gedächtnisses, davon drei Haupt- und zwei Nebenformen: das episodische (oder autobiografische) Gedächtnis, das in etwa Bergsons Erinnerungsgedächtnis entspricht; das semantische Gedächtnis der Worte und Ideen; das prozedurale Gedächtnis, das mit unseren Reflexen und Gewohnheiten verbunden ist und Bergsons Gewohnheitsgedächtnis ähnelt; dazu kommt noch das Kurzzeitgedächtnis, aufgefächert in Arbeits- und sensorisches Gedächtnis. Die Existenz der drei Hauptformen des Gedächtnisses verweist aber nicht nur auf drei Modalitäten des Erinnerns, sondern bedeutet auch und vor allem, dass unsere Vergangenheit auf mindestens drei verschiedene Arten in uns wirkt und erhellend oder irreführend, Stütze oder Hindernis sein kann. Da wir wissen wollen, wie wir mit unserer Vergangenheit gut leben können, drängt sich nun ein Abstecher zu den Neurowissenschaften auf und zu deren neuesten Erkenntnissen über die Funktionsweise unseres Gedächtnisses oder, genauer: unserer Gedächtnisse.
Das episodische Gedächtnis oder die Erinnerung an Episoden unseres Lebens
Unser episodisches Gedächtnis ist das Sammelbecken der Erinnerungen an Erlebtes: Diese Episoden warten nur darauf, sich ins Bewusstsein zu rufen, um uns das Herz zu erwärmen oder einen Stich zu versetzen, uns Flügel wachsen zu lassen oder in trübsinnige Stimmung zu tauchen, oder einfach um uns einzuladen, unseren Lebensweg Revue passieren zu lassen. Das episodische Gedächtnis ist der Sitz unserer Geschichte. Ebenjene Fähigkeit zur Wiedererinnerung des eigenen Lebens als Erzählung dürfte uns wohl am meisten von den Tieren unterscheiden. Das Bewusstsein des Selbst basiert bei uns Menschentieren auf den vergangenen Episoden unserer Geschichte und den Emotionen, die wir damit verbinden. Natürlich verfügen auch Tiere über die Fähigkeit, sich zurückzuerinnern, allerdings nicht in der Fülle, die uns das episodische Gedächtnis bietet: Sie sind nicht imstande, eine innere Zeitreise zu unternehmen und sich einzelne Erlebnisse zu vergegenwärtigen. Wie immer, wenn wir versuchen zu bestimmen, was zum Wesen des Menschen gehört, stoßen wir auf Ausnahmen. So haben die Forscherinnen und Forscher Nicola Clayton, Joanna Dally und Nathan Emery festgestellt, dass einige Vögel, wie zum Beispiel die Eichelhäher, sich nicht nur daran erinnern können, wo sie ihre Nahrung versteckt haben und was es war, sondern auch, wann sie dies getan haben.1 Das episodische Gedächtnis kommt also auch im Tierreich durchaus vor. Doch diese Fähigkeit ist äußerst selten, Menschenaffen beispielsweise haben sie nicht. Die Anzeichen eines episodischen Gedächtnisses bleiben punktuell und begrenzt, sodass man bei Tieren eher von einem quasi-episodischen Gedächtnis spricht. Sprichwörtlich mögen wir vielleicht »ein Gedächtnis wie ein Elefant haben«, allerdings ist und bleibt das Erinnerungsvermögen des Dickhäuters weit weniger eindrucksvoll als das des Menschen.
Tatsächlich weist unser episodisches Gedächtnis die verblüffende Eigenschaft auf, potenziell unendlich zu sein. Heute wissen wir, insbesondere durch die Forschungsarbeit von Larry R. Squire und Eric R. Kandel,2 der mit dem Nobelpreis für Physiologie und Medizin ausgezeichnet wurde, dass die herkömmliche Vorstellung vom Gedächtnis als begrenztem Speicherort falsch ist. Unser episodisches Gedächtnis kennt keine Grenzen: Die dynamische Gesamtheit aller Episoden der Vergangenheit, die wir im Gedächtnis behalten, wird immer neue Erinnerungen aufnehmen können.
Mithin trägt jeder Mensch den weiten Ozean der Sequenzen seiner Vergangenheit in sich, wobei die bewussten Erinnerungen nur die Spitze des Eisbergs namens episodisches Gedächtnis bilden. Wir vergessen viel weniger, als wir meinen: Die scheinbar vergessenen Episoden sind in Wirklichkeit nur tiefer vergraben. Auch wenn wir traumatische Erlebnisse nach Kräften verdrängen, kehrt unter besonderen Umständen das Verdrängte mit Wucht zurück. Das bestätigt Bergsons Intuition: Nur weil wir eine Erinnerung scheinbar vergessen haben, bedeutet das nicht, dass sie endgültig verloren ist. Sie bleibt in uns gegenwärtig, wirkt auf ihre Weise in unserem Gehirn, beeinflusst unsere Art, zu denken und die Welt wahrzunehmen. Eine scheinbar vergessene Erinnerung ist kein ausgestrichenes Wort auf einem Blatt und keine verlorene oder überschriebene Datei, die auf der Festplatte eines Computers nirgends wiederzufinden ist. Vergessen ist nicht gleichbedeutend mit Verschwinden: Eine Erinnerung findet sich immer wieder, begünstigt durch einen Spaziergang, der einen Sommer in der Jugend zurückruft, oder durch den Geschmack einer in Tee getunkten Madeleine. Wir meinen zu vergessen, weil andere, unmittelbar nützlichere Erinnerungen in den Vordergrund unseres Bewusstseins treten oder weil wir ein unerträgliches Erlebnis verdrängen. Doch die scheinbar vergessenen Erinnerungen sind alle da, im Hintergrund: Auf die eine oder andere Weise »bestehen sie endlos fort«, um es mit den Worten Bergsons zu sagen.
Dafür, dass die Erinnerungen fortbestehen, gibt es im Wesentlichen zwei Gründe, die oft miteinander einhergehen: Zum einen sind sie nützlich, im Extremfall für unser Überleben, zum anderen sind Erfahrungen, die wir durchgemacht haben, emotional stark aufgeladen, wobei Emotionen das Zeichen für einen lebenswichtigen Nutzen sein können. So bleiben negative Emotionen leichter im Gedächtnis haften: Da diese häufig mit Angst und daher mit dem Überlebensinstinkt verbunden sind, lösen sie einen Reflex des Wiedererinnerns aus, den wir von der jahrtausendealten Evolution unserer Spezies geerbt haben. Das trockene Knacken eines Holzstücks schreckt uns auf, der Anblick eines Raubtiers löst einen Fluchtreflex aus, das instinktive Erkennen eines Schreckensschreis versetzt uns in Alarmbereitschaft: Wir haben gelernt, augenblicklich auf die Anzeichen einer potenziellen Gefahr zu reagieren. Primitive, unangenehme Emotionen fungieren als Warnung für das Gehirn, das gelernt hat, die damit verbundenen Informationen abzuspeichern, da dies für unseren Erhalt notwendig ist. Die Erinnerung an diese lange Zeit der menschlichen Evolution findet im Prozess selbst der Speicherung unserer Erfahrungen Eingang. Dass sich noch heute die schmerzhaften, unschönen Erinnerungen fester in uns verankern als die anderen, ist das Resultat dieser grundlegenden Funktionsweise unseres Gedächtnisses.
Eine Erinnerung ist also — entgegen der ursprünglichen Vorstellung, die sich die Menschen davon gemacht haben und die noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts bei vielen Psychologen vorherrschend war — kein in unserem Gehirn eingeschriebener Datensatz. Sie ist keine lokalisierbare Gedächtnisspur, auch kein irgendwo abgespeichertes Bild, sondern eine in einer bestimmten Weise erfolgte Affizierung und Beeinflussung unseres Gehirns durch das Erlebte.
In ihrem spannenden Buch Gedächtnis. Die Natur des Erinnerns erzählen Larry Squire und Eric Kandel die Geschichte der neuen Vorstellung vom Gedächtnis und schildern insbesondere die Experimente, mit denen bewiesen werden konnte, dass unser Gedächtnis in keinem bestimmten Bereich des Gehirns lokalisiert werden kann.3 Lange hatte man geglaubt, dass die Schläfenlappen oder der Hippocampus der Sitz des Gedächtnisses seien. Ein Experiment der führenden kanadischen Psychologin Brenda Milner zeigte jedoch, dass ein Patient, der mit dem Kürzel H. M. in die Geschichte der Psychologie eingegangen ist, sich auch nach einer Operation, bei der ein Großteil der Schläfenlappen und des Hippocampus entfernt wurde, an seine Vergangenheit erinnern konnte. Nach der Operation konnte er zwar keine neuen Erinnerungen mehr bilden, aber sich weiterhin präzise Dinge aus seiner Vergangenheit, insbesondere seiner Kindheit, ins Gedächtnis rufen.4 Damit war der Beweis erbracht, dass das Gedächtnis nicht in den Schläfenlappen und im Hippocampus verortet ist, auch wenn Letzterer eine primordiale Rolle bei der Erinnerungsbildung spielt. Es gibt also kein spezifisches Zentrum im Gehirn, so die Schlussfolgerung von Squire und Kandel, in dem unsere Erinnerungen gespeichert sind. An ihrer Repräsentation im Gehirn sind mehrere Hirnstrukturen gleichzeitig beteiligt, und um ein vergangenes Ereignis zu erhellen, tauschen verschiedene Hirnbereiche Informationen aus — wie ebenso viele einander überkreuzende Faserbündel. Jedes Bündel transportiert eine Information über einen Aspekt der Erinnerung: den Geruch, den sie verströmt, ihre Erscheinung, die menschlichen Beziehungen, die darin verwickelt sind, die Emotionen, die sich damit verbinden, die Jahreszeit und so weiter. Das Gewebe aus diesen sich vielfach kreuzenden Bündeln formt die Erinnerung und »enkodiert« sie, so der wissenschaftliche Begriff, im Gedächtnis. Ist die Erinnerung einmal abgespeichert, bleibt sie auch erhalten, egal von welchen Beeinträchtigungen die Hirnbereiche betroffen sind, die die Enkodierung vorgenommen haben. Damit bestätigen die neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaften Bergsons kühne Annahme von vor hundert Jahren, die seine spiritualistische Position festigte: Wir wissen nicht wirklich, wo sich die Erinnerungen befinden.5
Unser Gedächtnis ist dynamisch und unser Gehirn ein Organ in Bewegung, das sich kontinuierlich weiterentwickelt. Man muss sich 85 Milliarden Neuronen vorstellen, und viele Milliarden Synapsen, die deren Verschaltung sicherstellen: Eine Erinnerung gleicht einer Faltung oder einem Netzwerk. Während eines Erlebnisses reagiert unser Gehirn und stellt eine Reihe von neuronalen Verbindungen her, die, ähnlich einer Woge, unsere graue Substanz anregen und verschiedene Bereiche des Gehirns miteinander verbinden.
Die Faltung, das Netzwerk, das dabei in unserem Gehirn entsteht, modifiziert dieses und legt das Grundmuster der Erinnerung fest. So wird unser Gehirn durch das Erlebte verändert und bilden unsere Erinnerungen in gewisser Weise die Landkarte dessen, was wir werden. Diese faszinierende Entdeckung führte vor gerade einmal dreißig Jahren zu einer weiteren, grundlegenden Entdeckung: Unser Gehirn zeichnet sich durch Plastizität und die Fähigkeit aus, sich fortlaufend weiterzuentwickeln, wie ein dichtes, rhizomartiges Netzwerk, das sich permanent neu konfiguriert. Wie das Universum gleicht es sich nie, sondern befindet sich in ständiger Umformung, während Galaxien entstehen und vergehen, Sterne zu Supernovas explodieren, Sternhaufen zerfallen … Unser Gehirn wandelt sich unablässig, und wir können es immer wieder umwandeln; wir können das, was sich gebildet hat, umbilden. Mag uns eine negative, ja traumatische Erfahrung noch so sehr beeinflusst haben, keine Erinnerung, keine Vergangenheit schreibt uns ein Schicksal auf den Leib.
Wir reaktivieren Netzwerke, wenn wir uns erinnern, erwecken neuronale Pfade der Vergangenheit zu neuem Leben, allerdings nie auf dieselbe Weise, da unser Gehirn sich unablässig wandelt. Die Erinnerung wird gleichsam neu konfiguriert: durch das seitdem Erlebte, durch den aktuellen Kontext, durch unseren emotionalen Zustand. In diesem Sinne ist unser Gedächtnis lebendig und eine Erinnerung nie zweimal dieselbe.
Das neuronale Netzwerk, das eine Erinnerung durchläuft, gleicht einem Pfad, der sich durch den Wald schlängelt: Es ist immer derselbe Pfad, auf dem wir gehen, aber er ist jedes Mal anders. Die Pflanzen sind gewachsen, Regen ist gefallen, Äste sind abgebrochen, andere Wanderer haben ihn verändert, vertieft, verbreitert. Wer sich etwas vergegenwärtigt, findet zugleich immer Bekanntes wieder und entdeckt Neues.
Wenn aber jede Erinnerung neu betrachtet und ebendarum rekonstruiert werden kann, nimmt unweigerlich unsere Fantasie am Prozess teil. Die Grenze zwischen Erinnerung und Fantasie lässt sich nicht mit Genauigkeit ziehen. Die US-amerikanische Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus hat in den 1970er-Jahren das Zustandekommen falscher Erinnerungen nachgewiesen. Wir sind der festen Überzeugung, dass sich etwas in einer bestimmten Weise zugetragen hat, dabei ist es nichts anderes als ein Produkt unserer Fantasie und nicht unseres Gedächtnisses. Diese Erfahrung machen wir selbst manchmal. Da ist diese Episode aus der Familiengeschichte, die schon so oft beim Essen erzählt wurde, eine Anekdote, die jedes Mal unweigerlich zum Schmunzeln führt und Teil des gemeinsamen Erlebens ist, das die Bande zu unseren Geschwistern, Eltern und Verwandten enger knüpft. Wir waren überzeugt, dabei gewesen zu sein, bis eines Tages ein Verwandter mitten in der lebhaften Schilderung in schallendes Gelächter ausbricht: »Aber du warst doch gar nicht dabei!« Wir haben diese Episode so oft gehört, sie uns so plastisch vorgestellt, dass die Erinnerung daran lebendiger ist als an andere, sehr reale Erlebnisse. Der Nachweis dieser falschen Erinnerungen durch Elizabeth Loftus erregte in den Vereinigten Staaten so großes Aufsehen, dass sich die Rechtsprechung änderte: Es war fortan nicht mehr möglich, eine Person nur aufgrund der Aussage eines einzigen Augenzeugen zu verurteilen, denn es bestand die Gefahr, dass sie infolge einer falschen Erinnerung als ein Produkt der Fantasie oder der nachträglichen Beeinflussung identifiziert wurde.6
Dass unser episodisches Gedächtnis nicht vollkommen zuverlässig ist, bedeutet jedoch nicht, dass wir unseren Erinnerungen grundsätzlich nicht trauen können. Auch wenn sie nicht immer erwiesen sind, können wir sie als Indizien betrachten, die es zu sammeln, zu verknüpfen, zu deuten gilt. Welche Bedeutung wir diesen Gedächtnisspuren beimessen, hängt von den Vorstellungen und Werten ab, die wir damit assoziieren. Das ist die Aufgabe des semantischen Gedächtnisses.
Das semantische Gedächtnis oder das Gedächtnis der Worte und Ideen
Zu wissen, was die Farbe Gelb ist und dass die Frucht mit der dicken gelben Schale und dem saftigen sauren Fruchtfleisch »Zitrone« heißt und zur Familie der Zitrusfrüchte gehört, hat mit unserem semantischen Gedächtnis zu tun. Oder dass der Zweite Weltkrieg 1945 zu Ende ging und welche Hintergründe und Ereignisse zum Algerienkrieg führten. Dass ich mein Bedürfnis zu trinken mit dem Wort »Durst« verbinde und die Befriedigung dieses Bedürfnisses mit dem Wort »stillen« oder »löschen«, hat ebenfalls mit unserem semantischen Gedächtnis zu tun. Dasselbe gilt für unsere Fähigkeit, Liebe auf den ersten Blick oder Hassgefühle zu erkennen, eine Tatsache oder eine Enttäuschung zu identifizieren, Begriffe wie »Freiheit« und »Abhängigkeit« zu erfassen oder auch unsere Vorstellungen von den »Dingen des Lebens« zu begreifen.
Das semantische Gedächtnis enthält die Worte, die wir gleich Namenstäfelchen Gegenständen, Vorstellungen, Begriffen, »allgemeinen Wahrheiten« anheften. Unser Weltwissen schreibt sich darin ein. Anders als das episodische Gedächtnis nimmt sich das semantische Gedächtnis nicht unserer Erlebnisse an, sondern all der Dinge, die wir daraus abgeleitet haben. Es enthält die Gesamtheit unserer Kenntnisse, Ideen und Urteile, sowohl der expliziten als auch der impliziten.
Oft sind wir uns der Vorstellungen, die wir über Männer und Frauen, über Liebe, Macht, den Sinn des Lebens oder auch über uns selbst haben, nicht vollends bewusst. Dabei beeinflussen diese in der »Vorkammer« des Bewusstseins entstandenen Vorstellungen unsere Beziehung zu anderen Menschen und zur Welt, unsere Emotionen und Reaktionen. Unser semantisches Gedächtnis hat also eine starke implizite Dimension. So kann es zum Beispiel sein, dass wir uns nicht für würdig halten, geliebt zu werden, und das nicht einmal wissen. Diese Vorstellung, die in unserem impliziten semantischen Gedächtnis gespeichert ist, rührt vielleicht von der Erfahrung her, dass wir als junger Mann von unserer ersten großen Liebe betrogen oder als Kind von unserer Mutter vernachlässigt wurden. Unsere Verhaltensweisen, unsere Reaktionen ergeben sich aus dem Selbstbild, das sich damals verfestigt hat: Wir nehmen seither leichter hin, dass man achtlos oder respektlos mit uns umgeht, wir lassen Fehlverhalten uns gegenüber durchgehen, weil sich tief in unserm Innern die Vorstellung festgesetzt hat, dass wir nicht würdig sind, geliebt zu werden. Diese Selbstherabwürdigung kann dazu führen, dass wir in manchen Momenten ängstlich