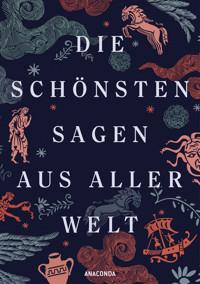
Die schönsten Sagen aus aller Welt E-Book
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Gleich ob Drachen oder Elfen, Magier oder Seejungfrauen: Der Sagenschatz ist voller Wesen, die nicht ganz von dieser Welt sind. Seit Jahrhunderten geraten Helden an üble Endgegner, mysteriöse Geistererscheinungen und unwiderstehlich liebreizende Geschöpfe. Und das nicht nur im Reich der Artusritter oder Nibelungen. Dieser Band versammelt eine reiche Auswahl von Sagen aus aller Welt, denn auch in Asien, bei den Inuit oder in der Südsee stehen fantastische Stoffe und abenteuerliche Geschichten seit jeher hoch im Kurs.
- Von Helden, Hexen und Helenen
- Heldentaten, Riesen, Nixen, Zauberer, magische Orte und mythologische Stoffe
- Der beste Einstieg in die wichtigsten Mythologien aus allen Teilen der Welt
- Mit zahlreichen historischen Schwarzweiß-Illustrationen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die schönsten Sagenaus aller Welt
Herausgegeben und mit einem Vorwortvon Erich Ackermann
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Diese Publikation enthält Links auf Webseiten Dritter,für deren Inhalt wir keine Haftung übernehmen, da wir unsdiese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Standzum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhaltedieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG aus-drücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotive: © ap PRINT / shutterstock (Hintergrundtextur),© MariLila / shutterstock (Pferd, Figuren, Schiff, Vase, Flügel),© NGalitsky / shutterstock (Wolken)
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32423-0V001
www.anacondaverlag.de
Für meine kleine Enkeltochter Elisabeth
Inhalt
Vorwort
Gilgamesch der Sumerer
Isis und Osiris
Prometheus
Orpheus und Eurydike
Dädalus und Ikaros
Perseus
Jason und die Argonauten
Hero und Leander
Romulus und Remus
Die Gründung Roms
Die Heimholung des Hammers
Thors Besuch bei Geirröd
Balders Tod
Die Kleinode der Zwerge
Helgi und Sigrun – Eine Liebe bis in den Tod
König Frodis Mühle Grotti
Skadi und Njörd
Beowulf
Grettir und die Trollriesin
Frithjof der Kühne
Der Küster von Mörkaa
Das Seehundweibchen (Kópakonan)
Wieland der Schmied
Gudrun
Die Nibelungen
Walter und Hildegunde
Dietrich von Bern
Roland, der Paladin Karls des Großen
Die Haimonskinder und ihr Ross Bayard
Robert der Teufel
Die Brautfahrt des Schmiedes Ilmarinen
Condlas Jenseitsfahrt
Fionn im Land der Riesen
Wie Fionn von der Verzauberung erlöst wurde
Nighean Righ Fo Thuinn – Die Tochter des Königs Untersee
Oisíns Jugend
Warum der rote Drache das Sinnbild von Wales ist
Wie Artus König wurde
Die Verzauberung des Zauberers Merlin
Herr Lancelot und die Gralsritter
Lohengrin
Parzival
Genoveva
Tristan und Isolde
Der Lindwurm von Lambton
Robin Hood
Doktor Faustus
Der Rattenfänger von Hameln
El Cid
Wilhelm Tell
Der Mord des Massiloniane
Der Held Gossi
Prinz Rama und die schöne Sita
Die Vogelfrau
Die Drachenprinzessin
Das Gespenst von Sakura
Jimmu Tenno, der erste Kaiser von Japan
Kohuki und seine zwei Frauen
Die Taten des Halbgotts Maui
Die sieben Schwestern Meamei
Wie die Plejaden an den Himmel kamen
Die Amazonen
Die Tochter des Königsgeiers
Der Riese Kin-äk
Kosmogonie der Navajos
Das weiße Steinkanu
Die himmlischen Geschwister
Die Sage von der schläfrigen Schlucht (Sleepy Hollow)
Quellenverzeichnis
Vorwort
Uns ist in alten maeren wunders viel geseit (»uns wird in alten Erzählungen [Sagen] viel Wunderbares berichtet«): schon in dieser ersten Zeile des mittelhochdeutschen Nibelungenlieds wird das Wort maer, woraus später etwas abwertend das Diminutiv Märchen wird, mit der Sage geradezu gleichgesetzt; und in der Tat überschneiden sich in vielen Bereichen die Erzählformen Sage, Märchen und Mythos, welcher allem zugrunde liegt; in allen dreien tritt das Dämonische und Übernatürliche in unterschiedlicher Stärke zutage. Die Brüder Grimm waren die Ersten, die Märchen von Sage geschieden hatten. In ihrem Deutschen Wörterbuch nennen sie die Sage »eine Kunde von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung entbehrt.« Daraus ergibt sich, dass neben dem mythischen Wesenskern der Sage historische Begebenheiten und Persönlichkeiten, die aber nicht gesichert sind, den Verlauf der Erzählung prägen.
Der Realitätsanspruch der Sagen steht allerdings deutlich höher als der der Mythen und Märchen; der Sage haftet etwas Bewusstes, etwas Greifbares an. Sie hat einen wahren Kern und spielt sich ab an einem bestimmten geografischen Ort, der manchmal präzise benannt wird, und die agierenden Helden tragen oft historisch gesicherte Namen. Aber doch gibt es zwischen Sage, Märchen und Mythos so enge Verbindungen, dass die Unterschiede oft verschwimmen oder ineinander übergehen. In anderen Sprachen gibt es daher auch kein eigenes Wort für Sage, und was den Gattungsbegriff der isländischen Saga angeht, so ist dieser grundverschieden von unserer Sage und meint eine eigenständige Literaturgattung, die von Autoren geschaffen wurde und Ereignisse der ersten Besiedlung der Insel aufgreift und romanhaft wiedergibt.
Der Mythos ist der elementare Hintergrund jedes frühzeitlichen Denkens; er ist das exemplarische Geschehen, das alles aus dem Irdischen hervorhebt und als Modell gilt, und erklärt alles Werden und Geschehen. So wird die mythische Deutung der Welt und des Menschen auch zu einer Grundlage der Sagen, und viele von ihnen können auch als solche gelten, wenn sie wie bei zahlreichen griechischen Mythen, etwa der Ilias und der Odyssee, narrativ groß ausgestaltet werden. Dadurch wird auch eine scheinbar reine Mythenerzählung wie das tragische Geschehen um Isis und Osiris, bei deren Hauptpersonen es sich um Götter handelt, zu einer Sage. Nicht ohne Grund hat also Gustav Schwab seinen Klassiker Die schönsten Sagen des klassischen Altertums (1838 – 1840) genannt.
Neben diesen mythologischen Sagen gibt es noch die Volkssage und die historische Sage, die oft als Heldensage in Erscheinung tritt.
Volkssagen sind meist lokal angesiedelt, spiegeln die Alltagswelt wider, und die übernatürlichen Kräfte, die in ihnen sichtbar werden, sind kleinere Naturgeister und dämonische Mächte der beseelten Natur wie Drachen, Zwerge, Nymphen; selten werden sie vom Walten der Götter beeinflusst. Auch sind solche Sagen oft ätiologischer Art und wollen Bräuche, Namen und Erscheinungen erklären; oder es geht darin um den Versuch einer Erklärung von Naturphänomenen wie Irrlichter oder besondere Formen von Bergen und Seen, bisweilen auch um genealogische Besonderheiten. Die historische Volkssage greift unerklärliche und im Nebel der Geschichte verloren gegangene Ereignisse auf und führt diese auf den Eingriff des Dämonischen zurück. So wird etwa das historisch nachweisbare plötzliche Verschwinden von vielen Kindern in Hameln durch die Sage vom Rattenfänger in den Bereich des Dämonischen verlegt und somit mythisiert. Auch diese eigentlich rein lokale Volkssage enthält einen Erklärungs- und Wahrheitsanspruch, wobei das Numinose, die Schauer einflößende Macht des Übernatürlichen, in ihr so groß ist, dass die lokale Geschichte von diesem Rattenfänger auch heute noch in der ganzen Welt bekannt ist.
Die historische Heldensage, die um ihrer Bekanntheit und Beliebtheit willen den größten Teil der Sagen dieses Buches ausmacht, hat ein bestimmtes historisches Ereignis oder eine Person zum Gegenstand, die einer Mythisierung unterzogen sind, wobei das mythische oder magische Bewusstsein, das sich im Volksglauben der Menschen niedergeschlagen hat, ein Weltbild bewirkt, das solche Sagen geradezu hervorgebracht hat. In den Heldensagen, die wie alle Sagen von Generation zu Generation mündlich tradiert wurden, zeigen sich Mythos und Geschichte eng verwoben. Neben wirklich belegten berühmten historischen Persönlichkeiten wie Theoderich der Große oder Attila leben in dieser Sagenwelt der Helden aber auch mythische Gestalten, denen wie im Beispiel von Siegfried sogar historische Orte wie Xanten und Worms zugewiesen werden; aber auch teils frei erfundene Abenteuer vermischen, wie bei der Runde um König Artus und seine Ritter, historisches mit mythischem und gar mystischem Geschehen. Heldensagen sind meist eine in die Erhöhung gehende Gestaltung aus der Frühzeit der nationalen Geschichte eines Volkes und überliefern somit Geschichte im Sinne der führenden Adelsschicht. Der Held steht als Idealtypus des adligen Kriegers und als führender Repräsentant seiner Gesellschaftsschicht im Mittelpunkt, wobei die real existierende Historie mythisiert und nach den Mustern von Mythos und Märchen umgestaltet wird. Oft allerdings will die Sage nicht die Welt, sondern den Menschen als Glied in der Gesellschaft erklären, und dann weist sie kein kosmologisches, sondern ein psychologisches Moment auf; Eigenschaften wie Mut, Feigheit, Liebe, Hass und Ehre werden hinterfragt und an ihnen wird der Wert des Helden gemessen und in eine moralische Kategorie gestellt.
Ein besonders hoch stilisierter Held in den europäischen Heldensagen ist der idealisierte Ritter. Er verkörpert die eigentlichen Tugenden, die jeder Ritter haben sollte. Treue, Ehre, Tapferkeit und auch die christlich geprägte Barmherzigkeit zeichnen ihn aus. Dieser ideale Held muss sich stets in einem dramatischen Kampf gegen all die Mächte bewähren, die das Gegenteil seiner Tugenden darstellen, gegen Feigheit, Unehre und Verrat. Oft sind die historischen Ereignisse, in die das Geschehen gebettet ist, nur noch in Umrissen oder gar nicht mehr greifbar. Diese Sage endet dann auch häufig tragisch mit dem Tod des Helden, auch dies anders als im Märchen, dessen optimistische Weltsicht das Geschehen immer gut ausgehen lässt und da abbricht, wo die Probleme vielleicht beginnen könnten.
In vielen Hochkulturen der Welt sind die Heldensagen mit dem Ursprung ihrer Geschichte verbunden und so identitätsstiftend geworden, dass sie zum Nationalepos aufgestiegen sind und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkten, während sich in den Sagen vieler indigener Völker eher noch das mythische Element erhalten hat und der geschichtliche Hintergrund keine maßgebliche Rolle spielt. Dort tritt dann die dämonische Weltsicht in den Vordergrund und deutet unerklärliche natürliche Phänomene mit dem Erscheinen und Eingreifen übernatürlicher Wesen, die dann als Geister personifiziert werden, sei es als Mensch oder Tier, als Mischwesen oder gar als erdachtes Fabelwesen, das strafen, aber auch helfen kann. Somit spiegeln sich in diesen Volkssagen auch die volkstümlichen Glaubensvorstellungen, die eine magische Weltsicht aufweisen.
Doch Sagen wollen nicht nur Unerklärliches dadurch erklären, dass sie die Natur beseelen und so den Menschen näherbringen, sie wollen nicht nur ihre Zuhörer mit ihrer Vergangenheit verbinden, die sie dann überhöht und oft gewaltig übertrieben darstellen und mit Helden mit all ihren Stärken und Schwächen bevölkern, sie wollen wie die Märchen auch unterhalten und den Menschen damit ein Stück dem Alltag entrücken. Diese Unterhaltungsfunktion ist das Hauptanliegen der folgenden Zusammenstellung der schönsten Sagen aus aller Welt.
Erich Ackermann
Gilgamesch der Sumerer
Das Gilgamesch-Epos kann als älteste Sage der Welt gelten. Es ist das erste Großepos der Weltliteratur und wurde um 2000 v. Chr. von einem anonymen babylonischen Dichter auf Tontafeln gemeißelt. Das Epos erzählt den Erkenntnisweg des gottgleichen Gilgamesch, König der sumerischen Stadt Uruk, der sich gemeinsam mit seinem tierähnlichen Freund Enkidu auf die Suche nach der Unsterblichkeit macht, am Ende jedoch erkennen muss, dass auch für ihn, der zu einem Drittel Mensch und zu zwei Dritteln Gott ist, das Leben endlich ist. Dabei werden geradezu existentialistische Grundthemen wie Liebe, Macht, Tod und die Frage nach dem Sinn des Lebens sichtbar. Im Übrigen sind Parallelen zwischen dem Gilgamesch-Epos und dem Alten Testament erkennbar: Die biblische Sintflutgeschichte stimmt selbst in einigen Details, wie dem Aussenden der Vögel nach dem Stranden der Arche, mit der babylonischen Version überein.
Es sind schon nahezu 5000 Jahre her, da lebte im Vorderen Orient in Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, das Volk der Sumerer. Dies war das Ursprungsland aller menschlichen Kultur, vor allem auch, weil dort als Erstes eine Schrift entwickelt wurde, die Keilschrift, die eine Urform vieler Schriften ist, die man heute auf der ganzen Welt kennt. Auch für ihre Baukunst und die künstliche Bewässerung ihrer Äcker und Gärten wurden die Sumerer allenthalben bewundert. Ihre Hauptstadt Uruk war mit prächtigen Gebäuden und Anlagen geschmückt, hochgetürmte Tempel, die Zikkurate, ragten in den Himmel, und eine hohe Mauer umgab die Stadt, um sie vor den Angriffen der Feinde zu schützen.
Über die Sumerer herrschte der junge Gilgamesch, der zu zwei Dritteln göttlich, zu einem Drittel allerdings ein Mensch war. Doch er war ein grausamer König, der sein Volk unterdrückte und seine Untertanen wie Sklaven für sich und sein eigenes Wohl arbeiten ließ, und er scheute sich auch nicht, sich an den Frauen der eigenen Bevölkerung zu vergehen; so verlangte er sogar, wenn ein Paar heiratete, die erste Nacht mit der Braut zu verbringen. Seine Untertanen litten so sehr unter seiner Unterdrückung, dass sie keinen anderen Ausweg mehr kannten, als sich bei den Göttern über ihn zu beschweren, denn ihre Not wurde zu groß und die Ernten verdorrten auf ihren Feldern.
Und die Götter hatten Erbarmen mit dem Leid des Volkes und entschieden, ihm zu helfen. Sie schufen ein Geschöpf, das genauso stark war wie Gilgamesch selbst. Dazu nahmen sie einen Klumpen Lehm, kneteten und formten ihn und warfen ihn ins Hochland der Steppe. So wurde dort der Wildmensch Enkidu geboren, der zu zwei Teilen Mensch und zu einem Teil ein Tier war, mit denen er auch als ihresgleichen zusammenlebte. Ein Jäger entdeckte unter den anderen Tieren dieses ganz mit Haaren bedeckte Geschöpf und erzählte Gilgamesch davon, der ihn dann unbedingt zu sehen wünschte, denn der König sehnte sich so sehr danach, einen ebenbürtigen Freund zu haben. Und damit dieses Geschöpf ganz zum Menschen werden konnte, bedurfte es der Liebe einer Frau. So schickte denn der Jäger eine Tempeldienerin zu ihm, und Enkidu und sie blieben sechs Tage und sieben Nächte in Liebe zusammen, und dann erst wurde er ein wahrer Mensch, und beide machten sich auf den Weg nach Uruk. Von nun an mieden auch die Tiere seine Gesellschaft.
Unterwegs schon hörte Enkidu von einem Reisenden, der seine Tochter verheiraten wollte, dass die erste Nacht seiner Tochter nicht dem Bräutigam gehören sollte, sondern nach alter Sitte dem König von Uruk, Gilgamesch. Da geriet Enkidu in einen gewaltigen Zorn und brach sofort nach Uruk auf, um sich dem König im Kampf zu stellen. Dort angekommen versperrte er ihm den Weg in das Haus der Braut und ging wutentbrannt auf ihn los, um ihm seine Grenzen zu weisen. Der erbitterte Kampf zwischen den beiden starken Männern dauerte die ganze Nacht hindurch, bis beide ermattet am Boden lagen: Es gab keinen Sieger, doch Gilgamesch hatte endlich einen Menschen gefunden, der ihm gewachsen war und ihm seine Grenzen aufgezeigt hatte. Aus der Wut des Königs wurde Bewunderung, und er wollte von nun an Enkidu immer an seiner Seite haben. So wurden die beiden Freunde, und die Stadt blühte wieder auf, und das Volk vergaß seinen Zorn auf den ehemals so grausamen Herrscher und jubelte ihm wieder zu.
Um die Stadt weiter mit prächtigen Bauwerken zu verschönern, brauchten die beiden nun Zedernholz, das es in Uruk allerdings nicht gab. So machten sie sich denn in die fernen Berge des Libanon auf, wo reichlich davon wuchs. Doch der Zedernwald wurde von dem schrecklichen Ungeheuer Humamba bewacht, das aus seinem Rachen Feuer spie und dessen Atem tödlich war. Die Reise der beiden Freunde dauerte viele Wochen lang, während sie den ganzen Tag hindurch liefen und nachts unter dem Sternenzelt schliefen. Und groß war auch die Furcht von Gilgamesch vor dem gefährlichen Dämon; doch seine Mutter hatte vor der gefährlichen Reise den Sonnengott Schamasch um Segen für beide gebeten. Als die Freunde endlich in den riesigen Zedernwäldern angekommen waren, lockten sie das Ungeheuer sogleich in die bewaldeten Schluchten und bekamen Hilfe von oben vom Herrn der Sonne, der zu dem fürchterlichen Kampf mit dem Untier Stürme sendete, die Humambas Gesicht verdunkelten. Blitzschnell ergriff da Gilgamesch seine Axt und schlug zu, sodass Humamba endlich tödlich getroffen am Boden lag. Nun konnten die beiden Sieger so viele Zedernbäume fällen, wie sie für ihre Bauwerke brauchten, und sie in die Heimat schaffen lassen.
Als Enkidu und Gilgamesch aus dem Zedernwald zurückkehrten, war die Freude in ganz Uruk riesengroß, und es wurde ein großes Fest veranstaltet. Schön und strahlend sahen die beiden Helden aus, sodass selbst die Götter von ihnen beeindruckt waren, besonders Ischtar, die Göttin der Liebe und des Begehrens. Sobald sie Gilgamesch erblickt hatte, verliebte sie sich in ihn und wünschte voller Verlangen, ihn zu besitzen, stieg vom Himmel herab und begehrte ihn zum Bräutigam. Doch der alte Stolz und die Überheblichkeit waren noch nicht ganz vom König gewichen, und er lehnte unwirsch das Verlangen Ischtars ab. Dabei warf er ihr das Unglück vor, in das sie viele ihrer Geliebten gestürzt hatte, und auch ihre stetige Untreue. Diese Abweisung aber war ein unerhörter Aufschrei gegen die Götter. Zornig bat nun die Göttin Ischtar ihren Vater Anu, den Gott des Himmels, den mächtigen Himmelsstier zur Erde zu schicken. Schnaubend näherte sich das gewaltige Tier der Stadt und brachte Tod und Verwüstung über das ganze Land. Jedes Mal, wenn der Himmelsstier schnaubte, tat sich die Erde auf und verschluckte Hunderte der Einwohner von Uruk. Die beiden Helden Gilgamesch und Enkidu aber erwarteten das feurige Tier bereits an den Toren der Stadt und stellten sich ihm zum Kampf: Enkidu packte es am Schwanz, und Gilgamesch stürzte sich ihm von vorne entgegen und rammte ihm dann den Dolch ins Genick, sodass der Stier laut losbrüllte und dann tot zu Boden stürzte. Das Volk von Uruk, das dem Kampf zugesehen hatte, jubelte den Siegern zu; doch auch Ischtar hatte die ihr angetane Schmach mit angesehen; sie fluchte und wurde dabei noch von Enkidu verspottet und verhöhnt, indem dieser dem toten Stier eine Keule ausriss und sie nach der Göttin warf. Doch diese Untat sollte nicht ungesühnt bleiben.
Die Götter fassten sogleich in einer Versammlung den Entschluss, dass er sterben sollte; und so geschah es denn auch. Der stolze Held, der sein Leben einstmals als nahezu wildes Tier begonnen hatte, wurde krank und immer schwächer; es überfiel ihn ein Fieber und er hauchte bald sein Leben aus. Unsäglich war nun die Trauer seines Freundes Gilgamesch. Um die Götter wieder gnädig zu stimmen, opferte er ihnen Ochsen und Schafe; sie sollten den Freund gnädig in ihrer Unterwelt aufnehmen. Und auch seine früheren Taten und Werke in Uruk waren dem König plötzlich gleichgültig und nichts mehr wert; er begann über den Tod nachzudenken und über die Unsterblichkeit; diese suchte er, denn er wollte nicht sterben. Da fiel ihm ein, dass es einen Menschen gab, dem die Götter Unsterblichkeit verliehen hatten, nämlich seinem Vorfahren Uta-napischtim; der lebte im weiten Meer auf der Insel der Seligen. Und Gilgamesch beschloss, zu ihm zu gehen, um ihn nach der Unsterblichkeit zu fragen. So legte er denn seine königlichen Gewänder ab, hüllte sich in Tierfelle und machte sich auf die lange und beschwerliche Reise ans Ende der Welt zu seinem Urahnen, dem die Götter nach einer alles vernichtenden Sintflut ein ewiges Leben gewährt hatten; ihn wollte er fragen, wie er dem Tod aus dem Weg gehen könne.
Zuerst führte ihn seine Reise zu dem Berg Maschu mit seinen zwei Gipfeln, wo die Sonne nachts auf der einen Seite untergeht und morgens auf der anderen Seite wieder auf. Da Gilgamesch zu Utanapischtim wollte, musste er den Berg überwinden, aber zwei riesige Skorpione bewachten den Durchgang durch den Berg und ließen ihn nicht vorbei; erst nach langem Reden erreichte es dann der Held, diese zu überreden, ihn durchzulassen. Danach ging es weiter zwölf Meilen lang durch völlige Finsternis, in der Gilgamesch schier verzweifelte, dann durch endlose Steppen und trostlose Wüsten, bis er endlich in einen wunderschönen Garten am Meeresufer anlangte. An der Küste traf er endlich auf ein menschliches Wesen; es war die Schankwirtin Siduri, und ihr vertraute er den eigentlichen Grund seiner langen Reise an: die Suche nach der Unsterblichkeit. Doch Siduri riet ihm von dieser Suche ab. »Nur der Gott Schamasch hat jemals dieses Meer überquert«, warnte sie ihn, »vergeblich ist die Suche nach der Unsterblichkeit. Die Götter haben dem Menschen den Tod beschieden, und damit musst du dich abfinden.« Doch sie konnte Gilgamesch nicht von seiner Absicht abbringen, und so wies sie ihm den Weg zu dem Fährmann Urschanabi, bei dem Gilgamesch auch wiederum viel Ungemach erfuhr. Weil er dessen Gefährten ins Wasser geworfen hatte, musste er zuerst 300 Bäume fällen, um daraus ein Boot zur Überfahrt zu bauen, was nach vielen weiteren Fährnissen auch gelang, bis er endlich nach der Fahrt durch das Meer des Todes das andere Ufer erreichte, das Land der Seligen, in dem Utanapischtim weilte.
Sogleich eilte er zu seinem Urahn und erzählte ihm den Grund seiner beschwerlichen und gefährlichen Reise hierhin ans Ende der Welt. Dieser hörte ihm gut zu, lehnte es aber ab, ihm zu helfen, unsterblich zu werden, denn das Leben der Menschen liege in der Hand der Götter »So höre denn nun, warum ich die Unsterblichkeit erlangt habe«, begann der weise Urahn dann zu sprechen. »Vor vielen Jahren hatten die Götter beschlossen, eine große Sintflut über die Erde zu senden, um alles Leben dort zu tilgen. Nur der Gott Ea wollte nicht, dass das Leben von der Erde verschwindet, und so sagte er zu mir: ›Baue dir ein Schiff, das groß genug ist, deine Familie, Handwerker aller Bereiche und von jedem Tier ein Paar, dazu Nahrung für alle für eine lange Zeit aufzunehmen. Darauf kannst du dich mit deinen Begleitern vor der vernichtenden Sintflut retten, die die Götter über die Erde schicken werden, um die Menschheit zu vernichten.‹ Das waren seine Worte, und ich tat, wie er mir geraten hatte. Und siehe! Kurz darauf brach das fürchterliche Unwetter los, und die Sintflut vernichtete die übrig gebliebene Menschheit. Als dann die Wasser endlich zurückgingen, und sie sahen, dass ich mit den Meinen überlebt hatte, wurden sie zunächst zornig, doch der gütige Ea besänftigte sie und riet ihnen, die Überlebenden zu schonen und ihnen zu helfen. Und sie waren dann versöhnt und verliehen mir und meiner Frau die Unsterblichkeit und machten uns zu ihresgleichen, und dies auch mit der Zustimmung des Götterkönigs Enlil, der der eigentliche Anstifter der Sintflut gewesen war. Aber wir mussten dafür am Ende der Welt leben, damit niemand dieses Geheimnis je erfahren sollte. Die Menschen werden alle dereinst sterben, aber die Menschheit selbst wird weiterbestehen. Doch sei nicht so verzweifelt, Gilgamesch! Es gibt da noch einen Weg zum ewigen Leben. Wenn du denkst, du könntest für alle Ewigkeit leben, dann kannst du sicher mal nur sechs Tage und sieben Nächte lang wach bleiben. Das soll deine Probe sein!« – »Wenn das alles ist!«, meinte da Gilgamesch lachend, weiter kam er aber nicht, denn da war er schon auf der Stelle eingeschlafen und erwachte erst sechs Tage und sieben Nächte später. So hatte er die Probe nicht bestanden. »Wasche dich, ziehe wieder deine königlichen Gewänder an und kehre zu den Deinen nach Uruk zurück, denn dort gehörst du hin«, sprach darauf der Urahn, doch auf Anraten seiner Frau verriet ihm Uta-napischtim noch das Geheimnis einer stachligen Pflanze, die einem die Jugend wiederbringt und damit mit der Hoffnung auf ein längeres Leben zumindest ein wenig über den Verlust der Unsterblichkeit hinwegtröstet; hinter dem Meer des Todes soll sie wachsen. So dankte dann Gilgamesch dem weisen Uta-napischtim und dessen Gattin und machte sich mit dem Fährmann Urschanabi auf den Rückweg über das Meer des Todes. Inmitten des Meeres band er sich Steine an seine Füße und tauchte hinab in das tiefe Wasser, wo er dann auch bald die Pflanze, die einem die Verjüngung bringt, fand und mit sich auf das Boot nahm, um sie zu Hause in Uruk an einem Greis auszuprobieren.
Der Rückweg vom Ufer des Meeres ins heimische Uruk war lang und entbehrungsreich, und Gilgamesch war froh, als er unterwegs auf eine klare und erfrischende Quelle stieß, die ihn geradezu zum Bad einlud. Als er nach dem Bad eingeschlafen an der Quelle lag, kam aber eine Schlange angekrochen und fraß die kostbare Pflanze mir nichts dir nichts auf, woraufhin sie sich häutete, also doch ein anderes neues Leben begann. Da brach Gilgamesch in Tränen aus und wähnte alles für verloren. Sollte seine unendlich lange, beschwerliche und gefährliche Reise doch vergebens gewesen sein? Er würde dann ein für alle Mal ein sterblicher Mensch bleiben.
Als er mit Urschanabi nach Uruk zurückkehrte und die festen Mauern erblickte, die die Stadt umgaben und die er gebaut hatte, erfasste ihn aber ein großer Stolz. Er war zwar unverrichteter Dinge nach Hause zurückgekehrt, aber hatte doch zu sich selbst gefunden und erkannt, dass der beste Weg zur Unsterblichkeit, den ein Mensch erreichen kann, große Taten und bedeutende Leistungen sind, die den ewigen Ruhm zur Folge haben. So war seine Reise doch nicht vergeblich gewesen, sondern ein Weg hin zur Erkenntnis, zu der ihn der weise Uta-napischtim gebracht hatte: Statt seine Kräfte für sich allein und die falschen Dinge zu verschwenden, sollte er sie aufbringen für das Wohl seiner Untertanen, für seine Mitmenschen also. Er lebte fortan in Einklang mit sich selbst, nahm die Sterblichkeit als Schicksal der Menschen an und wurde ein guter und weiser König.
Sage aus dem alten Mesopotamien
Isis und Osiris
Osiris war der älteste Sohn des Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin Nut, seine Schwester und Gemahlin hieß Isis, die andere Schwester Nephthys; die Geschwister hatten auch einen Bruder, Seth, doch dieser war anders als sie; er war arglistig und vom Neid getrieben. Als Geb sah, wie geschickt und begabt Osiris war, übergab er ihm die Regierung beider Länder: Ober- und Unterägypten. Seth hingegen, sein Bruder, der Nephthys zur Gemahlin hatte, erhielt die Herrschaft über das Wüstenland. Osiris war es, der den ehemals wilden Ägyptern die Kultur brachte und ihr Leben durch viele Errungenschaften, die er ihnen brachte, erleichterte. Er galt als ein gerechter König, denn er verhalf seinem Volk zu Wohlstand und sittlichem Handeln, regierte beide Länder mit Weisheit und läutete damit ein neues Zeitalter für die Ägypter ein. Er machte gute und bindende Gesetze, legte gerechte Verordnungen fest, urteilte mit Klugheit über die Menschen und ließ endlich Frieden über das ganze Land Ägypten herrschen.
Isis, die Gemahlin von Osiris, war ebenso eine Frau von großer Weisheit. Als sie die Not der Menschen erkannte, sammelte sie Gersten- und Weizenähren, die sie wild wachsen sah, und gab sie dem König. Und Osiris lehrte die Menschen, das Land, das überschwemmt worden war, aufzubrechen, den Samen zu säen und zur rechten Zeit die Ernte einzufahren. Er lehrte sie auch, wie man Korn mahlt und Mehl knetet, damit sie reichlich Nahrung hätten. Von dem weisen Herrscher wurde der Weinstock auf Pfählen gezogen, und er kultivierte Obstbäume und ließ die Früchte ernten. Wie ein Vater war er für sein Volk, und er lehrte sie, die Götter anzubeten und Tempel zu errichten. Die Hand des Menschen erhob sich nicht mehr gegen den eigenen Bruder. Es gab Wohlstand im Land Ägypten in den Tagen von Osiris dem Guten.
Als der König erkannte, welche Wohltat die Werke waren, die er in Ägypten vollbracht hatte, zog er in die ganze Welt, um alle Menschen Weisheit zu lehren und ihnen Wohlstand und Frieden zu bringen. Seine Triumphe errang er nicht durch Eroberungen in der Schlacht, sondern durch sanfte und überzeugende Rede. Isis herrschte bis zu seiner Rückkehr über das Land Ägypten. Sie war stärker als Seth, der mit eifersüchtigen Augen auf die guten Werke seines Bruders blickte, denn sein Herz war voller Bosheit, und er liebte den Krieg mehr als den Frieden und wollte einen Aufstand im Königreich anzetteln, doch die Königin vereitelte seine bösen Pläne. Nachdem er nun vergeblich versucht hatte, sich im Kampf gegen sie durchzusetzen, plante er, Osiris durch eine List zu besiegen; die Gefolgsleute seiner arglistigen Pläne waren zweiundsiebzig Männer, die Untertanen der Königin von Äthiopien waren.
Als Osiris von seiner Mission zurückkehrte, herrschte große Freude im Land. Es wurde ein königliches Fest abgehalten, und auch der arglistige Seth war gekommen, um sich zu vergnügen, und mit ihm waren seine Mitverschwörer da. Heimlich hatte er sich jedoch vorher die genauen Körpermaße von Osiris genommen und brachte nun als Geschenk einen reich geschmückten Sarkophag mit, den er nach den Maßen des Königs hatte anfertigen lassen. Alle Menschen priesen dies Kunstwerk auf dem Fest und bewunderten seine Schönheit, und viele wünschten sehr, es zu besitzen. Als die Herzen durch das Biertrinken erfreut waren, verkündete Seth, dass er den Sarkophag demjenigen schenken würde, dessen Körper genau in diesen Sarg hineinpasse und ihn vollends ausfüllen könne. Alle Gäste waren begierig darauf, den Versuch zu machen, wie Seth es gewünscht hatte. So geschah es, dass sich in jener verhängnisvollen Nacht einer nach dem anderen in den Sarkophag legte, bis es schien, als könne sich kein Mann finden, der den Preis für sich gewinnen könnte. Dann trat Osiris hervor. Er legte sich hinein und füllte den Sarkophag bis in alle Teile. Aber sein Triumph war teuer errungen in jener dunklen Stunde, denn er ahnte nicht die List, mit der ihm Seth nach dem Leben trachtete.
Kaum nämlich hatte er sich hineingelegt, da sprangen die bösen Gefährten Seths plötzlich vor und schlossen den Deckel, nagelten ihn fest zu und versiegelten alles dicht mit Blei. So wurde das reich geschmückte Geschenk zum tödlichen Sarg des guten Königs Osiris, von dem bald der Atem des Lebens wich. Sogleich wurde das Fest aufgelöst und die Fröhlichkeit endete in Trauer. Seth befahl seinen Gefolgsleuten, den Sarkophag wegzutragen und heimlich zu entsorgen. Wie er es ihnen befohlen hatte, taten sie es auch. Sie eilten durch die Nacht und warfen ihn in den Nil. Die Strömung trug ihn in der Dunkelheit fort, und als der Morgen kam, erreichte er über das Delta das große Meer und wurde hin und her getrieben, zwischen den Wellen hin und her wälzend. So endeten die Tage des Osiris und die Jahre seiner weisen und wohlhabenden Herrschaft im Lande Ägypten.
Als Isis die traurige Nachricht überbracht wurde, wurde sie von großem Kummer ergriffen, und niemand vermochte es, sie zu trösten. Sie weinte bitterlich, schnitt eine Locke ihres glänzenden Haares ab und zog die Trauerkleider an. Danach wanderte die Königin im Land auf der Suche nach dem Leichnam des Osiris auf und ab und wollte nicht ruhen, als bis sie gefunden hatte, wonach sie suchte. Endlich erfuhr sie von Kindern am Ufer, sie hätten die Kiste den Nil hinabtreiben und an der Mündung des Deltas, die ihren Namen von der Stadt Tanis hat, ins Meer gleiten sehen.
In der Zwischenzeit hatte Seth den Thron des Osiris an sich gerissen und herrschte über das Land Ägypten. Den Menschen wurde Unrecht getan und sie wurden ihres Besitzes beraubt. Es herrschten Tyrannei und große Unruhen, und die Anhänger des Osiris litten unter Verfolgung. Königin Isis wurde zur Flüchtigen im Königreich und suchte in den Sümpfen und im tiefen Dschungel des Deltas Schutz vor ihren Feinden. Sieben Skorpione folgten ihr, und das waren ihre Beschützer. Ra, der vom Himmel herabblickte, fühlte Mitleid mit ihr und sandte ihr Hilfe: Anubis, der Totengott mit dem Hundekopf, wurde ihr Begleiter.
Eines Tages suchte Isis Zuflucht bei einer armen Frau, die beim Anblick der furchterregenden Skorpione von so großer Angst ergriffen wurde, dass sie die Tür vor der wandernden Königin schloss. Aber ein Skorpion verschaffte sich Zutritt und biss ihr Kind, sodass es starb. Und das Herz der Isis wurde von Mitleid gerührt, als sie die Mutter wehklagen hörte, und sie sprach magische Worte, die das Kind wieder lebendig werden ließen, und die Frau diente der Königin mit Dankbarkeit, so lange sie im Haus blieb.
Bald geschah es auch, dass Isis ihren Sohn Horus gebar1; aber Seth erfuhr, wo die Mutter und das Kind verborgen waren, und machte sie zu Gefangenen im Haus. Es war sein Wunsch, Horus zu töten, damit dieser nicht sein Feind und der Anwärter auf den Thron des Osiris werden sollte. Der weise Thoth aber kam aus dem Himmel und warnte Isis, und diese floh mit ihrem Kind in die Nacht. Sie flüchtete sich in die Gegend von Buto, wo sie Horus in die Obhut von Uazit gab, der jungfräulichen Göttin der Stadt, die eine Schlange war, damit er Schutz habe vor dem eifersüchtigen Zorn Seths, seines arglistigen Onkels. Die Mutter Isis aber zog weiter, um den Leichnam des Osiris zu suchen.
1 In einer Version der Sage gelang es Isis durch Zauberkräfte, von ihrem toten Gatten ein Kind zu empfangen, indem sie in Gestalt eines Milans trauernd über seinem Leichnam saß.
Eines Tages aber, als Uazit das Kind betrachtete, fand sie es tot liegen. Ein Skorpion hatte es gebissen, und es lag auch nicht in ihrer Macht, es wieder zum Leben zu erwecken. In ihrer bitteren Trauer rief sie den großen Gott Ra an. Ihre Stimme erhob sich zum Himmel, und das Sonnenboot blieb in seinem Kurs. Da kam der weise Thoth herab, um Hilfe zu leisten. Er bewirkte einen mächtigen Zauber, indem er magische Worte über das Kind Horus sprach, das sofort wieder zum Leben erweckt wurde, denn es war der Wille der Götter, dass er zu einem starken Mann heranwachsen und dann den Mörder seines Vaters besiegen sollte.
Der Sarg des Osiris aber war inzwischen von den Wellen nach Byblos in Phönizien getrieben und dort am Ufer an den Fuß einer Tamariske gespült worden. Dieser Baum war dann um ihn herum gewachsen, und der Leichnam des toten Herrschers war in seinem großen Stamm eingeschlossen. Als der König von Byblos davon erfahren hatte, ließ er ihn fällen und in seinem Palast als Säule aufstellen. Aber niemand erfuhr von dem Geheimnis, das er enthielt. Isis jedoch wurde dies durch eine Offenbarung enthüllt und sie machte sich mit einem Schiff auf den Weg nach Byblos.
Als sie die phönizische Küste erreichte, ging sie in gewöhnliche Kleider gehüllt an Land und saß an einem Brunnen und weinte bitterlich. Die Frauen kamen, um Wasser zu schöpfen, und versuchten, ihr Trost zuzusprechen, aber Isis antwortete nicht und hörte nicht auf zu trauern, bis die Mägde sich der Königin näherten. Sie grüßte sie freundlich. Als diese freundlich zu ihr gesprochen hatten, flocht sie ihnen das Haar, und in jede Locke hauchte sie süßen und verführerischen Duft. So geschah es, dass die Königin Astarte, als die Mädchen in das Haus des Königs zurückkehrten, den Duft roch und befahl, die fremde Frau vor sie zu führen. Dann fand Isis Gnade in den Augen der Königin, die sie zur Pflegemutter des königlichen Kindes erwählte.
Aber Isis weigerte sich, das Kind zu säugen, und um sein Schreien nach Milch zum Schweigen zu bringen, steckte sie ihm den Finger in den Mund. Als die Nacht hereinbrach, ließ sie sein Fleisch durch eine heilige Flamme versengen, um die Sterblichkeit des Kindes aus dem Körper herauszubrennen; dann nahm sie die Gestalt einer Schwalbe an und flog mit Schmerzensschreien um die heilige Säule herum, die den Leichnam des Osiris enthielt. Es traf sich, dass die Königin herankam und ihr Kind in den Flammen erblickte. Sie riss es sogleich hervor; doch obwohl sie seinen Leichnam rettete, sorgte sie mit dieser Tat dafür, dass ihm keine Unsterblichkeit mehr zuteilwurde.
Da nahm Isis wieder ihre gewohnte Gestalt an und enthüllte der Königin ihre wahre Natur. Sie gestand auch dem König ihr wirkliches Anliegen und bat ihn, ihr die heilige Säule zu geben. Diese Gnade wurde ihr auch gewährt, und sie schnitt tief in den Stamm und holte den Sarkophag hervor, der darin verborgen war. Sie umarmte ihn zärtlich und stieß Wehklagen aus; dann weihte sie die heilige Säule, die sie in Leinen wickelte und mit Myrrhe salbte, und diese wurde hernach in einen Tempel gestellt, den der König für Isis errichten ließ, und lange Jahrhunderte lang wurde sie dort von den Bewohnern von Byblos verehrt.
Der Sarg des Osiris wurde darauf zu dem Schiff getragen, mit dem die trauernde Königin nach Phönizien gesegelt war. Sie ging an Bord und das Schiff stach sogleich in See. Sobald nun das Land aus dem Blickfeld entschwunden war, sehnte sich Isis danach, das Antlitz ihres toten Gatten noch einmal zu sehen; sie öffnete also den Sarkophag und küsste leidenschaftlich die kalten Lippen ihres toten Gemahls, während Tränen aus ihren Augen strömten. Als Isis dann ihr Land Ägypten erreichte, verbarg sie den Leichnam des toten Königs an einem geheimen Ort und eilte in die Stadt Buto, um ihren Sohn Horus zu umarmen. Doch ihr Triumph war nur von kurzer Dauer. Der Zufall wollte es, dass Seth bei Vollmond im Dschungel des Deltas auf Jagd nach Wildschweinen gegangen war und den Sarkophag entdeckte; er ließ ihn öffnen, und der Leichnam des Osiris wurde herausgeholt und in vierzehn Stücke zerrissen, die Seth voller Hass in den Nil warf, damit die Krokodile sie verschlingen könnten. Doch aus Furcht vor Isis taten sie das nicht. Und so blieben sie verstreut an den Ufern des Flusses liegen. Ein Fisch aber, der Oxyrhynchus, verschluckte den Phallus, wofür er später überall im Land verflucht wurde.
Isis’ Herz war erneut von Trauer erfüllt, als sie erfuhr, was Seth getan hatte. Sie hatte sich ein Boot aus der Papyrusstaude gebaut und fuhr im Delta auf und ab, um die Bruchstücke des Leichnams ihres Mannes zu suchen, und endlich fand sie sie alle, bis auf den Phallus, der von dem Fisch verschluckt worden war. Sie begrub die Körperteile dort, wo sie gefunden wurden, und schuf für jedes Körperglied ein Grabmal. In späteren Tagen wurden über den Gräbern Tempel errichtet, in denen Osiris viele Jahrhunderte lang vom Volk verehrt wurde.
Seth herrschte indes weiterhin über Ägypten und verfolgte die Anhänger von Osiris und Isis in den Sümpfen des Deltas und entlang der Meeresküste im Norden. Aber Horus, der der rechtmäßige König war, war zu einem starken jungen Mann herangewachsen. Er bereitete sich auf den kommenden Kampf vor und wurde ein tapferer Krieger. Eines Nachts nun erschien dem Horus in einem Traum das Gesicht seines Vaters Osiris, und dessen Geist bat ihn inständig, Seth, von dem er so heimtückisch getötet worden war, zu stürzen. Horus gelobte, seinen Onkel und alle seine Anhänger aus dem Land Ägypten zu vertreiben. Da sammelte er sein Heer und zog in die Schlacht. Seth stürmte auf die Stadt Edfu los und tötete viele von Horus’ Gefolgsleuten. Aber Horus sicherte sich die Hilfe der Stämme, die Osiris und Isis treu geblieben waren, und Seth wurde abermals angegriffen und an die Ostgrenze getrieben. In Zaru fand die letzte Schlacht statt. Sie dauerte viele Tage, und Horus verlor ein Auge. Aber Seth wurde noch schwerer verwundet und endlich mit seinem Heer aus dem Reich vertrieben.
Es wird erzählt, dass der Gott Thoth, der Ibis-köpfige Gott des Mondes, aus dem Himmel herabstieg und die Wunden von Horus und Seth heilte. Da erschien Seth vor dem göttlichen Rat und beanspruchte den Thron. Aber die Götter urteilten, dass Horus der rechtmäßige König sei, und er begründete seine Macht im Lande Ägypten und wurde ein weiser und starker Herrscher wie sein Vater Osiris.
Eine weitere Sage erzählt, dass Isis und Nephthys, die ihren Gemahl Seth nie geliebt hatte, die Körperteile von Osiris aufgesammelt und dann bitterlich geweint hätten. Der Gott Ra aber hörte die Klagen und sandte vom Himmel den Gott Anubis herab, der mit der Hilfe von Thot und Horus die einzelnen Teile wieder zum ganzen Körper des Osiris zusammensetzte und in Leinentücher einhüllte, was der Ursprung der Mumifizierung in Ägypten gewesen sei. Die geflügelte Isis aber sei über dem Körper des geliebten Gemahls geschwebt, und der Luftstrom, den ihre Flügel erzeugt hätten, sei durch die Nase in den Körper des Osiris eingedrungen, sodass dieser mit neuem Leben erfüllt worden sei. Später dann wurde Osiris Richter und König in der Welt der Toten.
Mythensage aus dem alten Ägypten
Prometheus
Himmel und Erde waren geschaffen: Das Meer wogte in seinen Ufern und die Fische spielten darin; in den Lüften sangen beflügelt die Vögel; der Erdboden wimmelte von Tieren. Aber noch fehlte es an dem Geschöpf, dessen Leib so beschaffen war, dass der Geist in ihm Wohnung machen und von ihm aus die Erdenwelt beherrschen konnte. Da betrat Prometheus die Erde, ein Sprössling des alten Göttergeschlechts, das Zeus entthront hatte, ein Sohn des erdgeborenen Uranossohns Iapetos, kluger Erfindung voll. Dieser wusste wohl, dass im Erdboden der Same des Himmels schlummerte; darum nahm er ein Stück von Ton, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und formte daraus ein Gebilde, nach dem Ebenbild der Götter, der Herren der Welt. Diesen seinen Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften und schloss sie in die Brust des Menschen ein. Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin, Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohns und blies dem halbbeseelten Bild den Geist, den göttlichen Atem ein.
So entstanden die ersten Menschen und füllten bald vervielfältigt die Erde. Lange aber wussten diese nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend sahen sie umsonst, hörten hörend nicht; wie Traumgestalten liefen sie umher und wussten sich der Schöpfung nicht zu bedienen. Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu bebauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem gefällten Holz des Waldes zu zimmern, und mit allem diesem sich Häuser zu erbauen. Unter der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen wie von beweglichen Ameisen; nicht den Winter, nicht den blütevollen Frühling, nicht den früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren Zeichen; planlos war alles, was sie verrichteten.
Da nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an; er lehrte sie den Auf- und Niedergang der Gestirne zu beobachten, erfand ihnen die Kunst zu zählen, die Buchstabenschrift; lehrte sie Tiere ans Joch zu spannen und zu Gefährten ihrer Arbeit zu brauchen, gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen; erfand Boote und Segel für die Schifffahrt. Auch fürs übrige Leben sorgte er den Menschen. Früher, wenn einer krank wurde, wusste er kein Mittel, nicht was von Speise und Trank ihm zuträglich sei, kannte kein Salböl zur Linderung seiner Schäden; sondern aus Mangel an Arzneien starben sie elendiglich dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu vertreiben. Dann lehrte er sie die Wahrsagekunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug und Opferschau. Ferner führte er ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das Silber und das Gold entdecken; kurz, in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens leitete er sie ein.
Im Himmel herrschte mit seinen Kindern seit Kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront und das alte Göttergeschlecht, von welchem auch Prometheus abstammte, gestürzt hatte.
Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten Verehrung von ihm für den Schutz, welchen sie demselben angedeihen zu lassen bereit waren. Zu Mekone in Griechenland ward eine Beratung gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen, und Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, dass die Götter für die übernommenen Schutzämter den Sterblichen nicht allzu lästige Gebühren auferlegen möchten. Da verführte den Prometheus seine Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier, davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich davon verlangten. Er hatte aber nach Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht; auf die eine Seite legte er das Fleisch, die Eingeweide und den Speck, in die Haut des Stieres zusammengefasst, auf die andere die kahlen Knochen, geschickt in das Eingeweidefett des Schlachtopfers eingehüllt. Und dieser Haufen war der größere. Zeus, der Göttervater, der Allwissende, durchschaute seinen Betrug und sprach: »Sohn des Iapetos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du die Teile geteilt!« Prometheus glaubte jetzt erst recht, dass er ihn betrogen hatte, lächelte bei sich selbst und sprach: »Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz anrät zu wählen.« Zeus erzürnte im Herzen, aber geflissentlich fasste er mit beiden Händen das weiße Eingeweidefett. Als er es nun auseinander gedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich an, als entdeckte er jetzt eben erst den Betrug und zornig sprach er: »Ich sehe wohl, dass du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!«
Zeus beschloss, sich an Prometheus für dessen Betrug zu rächen, und versagte den Sterblichen die letzte Gabe, der sie zur vollkommenen Lebensführung bedurften, das Feuer. Doch auch dafür wusste der schlaue Sohn des Iapetos Rat. Er nahm den langen Stängel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem vorüberfahrenden Sonnenwagen, und setzte so den Stängel in glühenden Brand. Mit diesem Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde, und bald loderte der erste Holzstoß gen Himmel. In innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhin leuchtenden Glanz des Feuers unter den Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, zum Ersatz für des Feuers Gebrauch, das den Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott Hephaistos musste ihm das Scheinbild einer schönen jungen Frau fertigen; Athene selbst, die, auf Prometheus eifersüchtig, ihm feindlich gesonnen geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde, die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zuliebe kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten herrlich verziert hatte. Hermes, der Götterbote, musste dem holden Gebilde Sprache verleihen, und Aphrodite allen Liebreiz. Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Gutes ein blendendes Übel geschaffen und nannte sie Pandora, das heißt die Allbeschenkte, denn jeder der Unsterblichen hatte dem Mädchen irgendein Unheil bringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben. Darauf führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern umherwandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimetheus, dem arglosen Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen. Vergebens hatte diesen der Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Zeus anzunehmen, damit dem Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden. Epimetheus aber vergaß die warnenden Worte seines Bruders, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei von Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit. Das Mädchen aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei Epimetheus angekommen, schlug sie den Deckel zurück, und alsbald entflog dem Gefäß eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit Blitzeseile über die Erde. Nur ein einziges Gut war zuunterst in dem Fass verborgen, die Hoffnung; aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe diese Hoffnung herausflattern konnte, und verschloss sie für immer in dem Gefäß. Das Elend füllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben; eine Schar von Fiebern hielt die Erde belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt.
Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem Hephaistos und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia, was wörtlich Zwang und Gewalt bedeutet. Diese mussten ihn in die skythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine Felswand des Berges Kaukasus mit unauflöslichen Ketten schmieden. Ungern vollzog Hephaistos den Auftrag seines Vaters, er liebte in dem Titanensohn den verwandten Abkömmling seines Urgroßvaters Uranos, den ebenbürtigen Göttersprössling. Unter mitleidsvollen Worten und von den roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen. So musste nun Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie zu beugen. »Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden«, sagte Hephaistos zu ihm, »denn des Zeus Sinn ist unerbittlich und alle, die erst seit Kurzem die Herrschergewalt an sich gerissen,2 sind hartherzig.« Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder doch dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und Meereswellen, die Allmutter Erde und den allanschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes. »Was das Schicksal beschlossen hat«, sprach er, »muss derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat.« Auch ließ er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, dass dem Götterherrscher durch einen neuen Ehebund, nämlich mit Thetis, Verderben und Untergang bevorstehe, näher auszudeuten. Zeus hielt Wort: Er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner Leber zehren durfte, die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Diese Qual sollte nicht eher aufhören, bis ein Ersatzmann erscheinen würde, der sich anbieten würde, durch freiwillige Übernahme des Todes gewissermaßen sein Stellvertreter zu werden.
2 Zeus hatte seinen Vater Kronos und mit ihm die alte Götterdynastie gestürzt und sich des Olymps mit Gewalt bemächtigt. lapetos und Kronos waren Brüder, Prometheus und Zeus Geschwisterkinder.
Jener Zeitpunkt erschien früher, als der Verurteilte nach des Zeus Spruch erwarten durfte. Als er dreißig Jahre an dem Felsen gehangen, kam Herakles des Weges, der auf der Fahrt nach den Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen war. Wie er den Götterenkel am Kaukasus hängen sah und sich seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, denn er sah zu, wie der Adler, auf den Knien des Prometheus sitzend, an der Leber des Unglückseligen fraß. Da legte er Keule und Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den Pfeil und schoss den grausamen Vogel von der Leber des Gequälten weg. Hierauf löste er seine Fesseln und führte den Befreiten mit sich davon. Damit aber die Bedingung des Zeus erfüllt würde, stellte er ihm als Ersatzmann den Kentauren Chiron, der sich anbot, für den armen Prometheus zu sterben; denn vorher war er unsterblich. Auf dass jedoch das Urteil des Zeus, der den Prometheus auf weit längere Zeit an den Felsen verurteilt hatte, auch so nicht unvollzogen bliebe, so musste Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasusfelsen befand. So konnte sich Zeus rühmen, dass sein Feind noch immer an den Kaukasus angeschmiedet lebte.
Griechische Sage
Orpheus und Eurydike
Der unvergleichliche Sänger Orpheus war ein Sohn des thrakischen Königs und Flussgottes Oiagros und der Muse Kalliope. Apollon selbst, der melodische Gott, schenkte ihm ein Saitenspiel, und wenn Orpheus dasselbe rührte und dazu seinen herrlichen Gesang, den seine Mutter ihn gelehrt hatte, ertönen ließ, so kamen die Vögel in der Luft, die Fische im Wasser, die Tiere des Waldes, ja die Bäume und Felsen herbei, um den wundervollen Klängen zu lauschen.
Seine Gattin war die wunderschöne Nymphe Eurydike, und sie liebten sich beide auf das Zärtlichste. Aber ach, nur allzu kurz war ihr Glück; denn kaum waren die fröhlichen Lieder der Hochzeit verstummt, da raffte ein früher Tod die blühende Gattin dahin. Auf grüner Aue wandelte die schöne Eurydike mit ihren Gespielinnen, den Nymphen; da biss sie eine giftige Natter, die im Gras versteckt lag, in die zarte Ferse, und sterbend sank die Liebliche ihren erschreckten Freundinnen in die Arme. Unaufhörlich hallten nun die Berge und Täler vom Schluchzen und Klagen der Nymphen wider, und unter ihnen jammerte und sang Orpheus seinen Schmerz in wehmütigen Liedern; da trauerten die Vögel und die klugen Hirsche und Rehe mit dem verlassenen Gatten. Aber sein Flehen und Weinen brachte die Verlorene nicht zurück. Da fasste er einen unerhörten Entschluss: Hinunter in das grausige Reich der Schatten wollte er steigen, um das finstere Königspaar zur Rückgabe Eurydikes zu bewegen. Durch die Pforte der Unterwelt bei Tainaron ging er hinab; schaurig umschwebten die Schatten der Toten den Lebenden, er aber schritt mitten durch die Schrecknisse des Orkus, bis er vor den Thron des bleichen Hades und seiner strengen Gemahlin trat. Dort fasste er seine Leier und sang zum süßen Klang der Saiten: »Oh ihr Herrscher des unterirdischen Reiches, gönnt mir, Wahres zu reden, und höret gnädig meine Bitten an! Nicht kam ich herab, von Neugier getrieben, den Tartaros zu schauen, nicht um den dreiköpfigen Hund zu fesseln; ach nein, um der Gattin willen nah ich mich euch. Vom Biss der tückischen Natter vergiftet, sank die Liebste in der Jugend Blüte dahin, nur wenige Tage war sie meines Hauses Stolz und Freude. Seht, ich wollte es tragen, das unermessliche Leid; als Mann habe ich lange gerungen. Aber die Liebe zerbricht mir das Herz, ich kann nicht ohne Eurydike sein. Darum fleh ich zu euch, furchtbare, heilige Götter des Todes! bei diesen grauenvollen Orten, bei der schweigenden Öde eurer Gefilde: Gebt sie mir wieder, die traute Gattin; lasst sie frei, und schenkt ihr das allzu früh verblühte Leben von Neuem! Aber kann es nicht sein, so nehmt dann auch mich unter die Toten auf, nimmer kehr ich ohne sie zurück.«
Also sang er und rührte mit den Fingern die Saiten. Siehe, da horchten die blutlosen Schatten und weinten. Der unselige Tantalos haschte nicht mehr nach den entschlüpfenden Wassern, die sich ihm immer wieder entzogen, Ixions sausendes Rad stand still, die Töchter des Danaos ließen ab vom vergeblichen Mühen und lehnten horchend an der Urne, Sisyphos selbst vergaß seine Qual und setzte sich auf den tückischen Felsblock, den sanften Klagetönen zu lauschen. Damals, so sagt man, rannen selbst von den Wangen der furchtbaren Eumeniden Tränen hernieder, und das düstere Herrscherpaar fühlte sich zum ersten Mal von Mitleid bewegt. Persephone rief den Schatten Eurydikes, der unsicheren Schritts herankam. »Nimm sie mit dir«, sprach die Totenkönigin, »aber wisse: nur wenn du keinen Blick auf sie wirfst, wenn sie dir beim Heraufsteigen in die Oberwelt folgt, ehe du das Tor der Unterwelt durchschritten, nur dann gehört sie dir; doch schaust du dich zu früh nach ihr um, so wird dir die Gnade entzogen.«
Schweigend und schnellen Schritts stiegen nun die beiden den finsteren Weg empor, vom Grauen der Nacht umgeben. Da ward Orpheus von unsäglicher Sehnsucht ergriffen, er lauschte, ob er nicht den Atemzug der Geliebten oder das Rauschen ihres Gewandes hörte – aber still, totenstill war alles um ihn her. Von Angst und Liebe überwältigt, seiner selbst kaum mächtig, wagte er es, einen schnellen Blick rückwärts nach der Ersehnten zu werfen. Oh Jammer! Da schwebt sie, das Auge traurig und voll Zärtlichkeit auf ihn heftend, zurück in die schaurige Tiefe. Verzweiflungsvoll streckt er die Arme nach der Entschwindenden. Ach, umsonst! Zum zweiten Mal erleidet sie den Tod, doch ohne Klage – hätte sie klagen können, so innig geliebt zu sein? Schon ist sie fast seinen Blicken entschwunden: »Leb wohl, leb wohl!«, so tönt es leise verhallend aus der Ferne. Starr vor Gram und Entsetzen stand Orpheus zuerst, dann stürzte er zurück in die finsteren Klüfte; aber jetzt wehrte ihm Charon und weigerte sich, ihn über den schwarzen Styx zu fahren. Sieben Tage und Nächte saß nun der Arme am Ufer, ohne Speise und Trank; zahllose Tränen vergießend, um Gnade fleht er die unterirdischen Götter; aber diese sind unerbittlich, zum zweiten Mal lassen sie sich nicht erweichen. So kehrt er denn gramvoll auf die Oberwelt zurück in die einsamen Bergwälder Thrakiens. Drei Jahre lang lebte er so dahin, allein, die Gesellschaft der Menschen fliehend. Verhasst ist ihm der Anblick der Frauen, denn ihn umschwebt das liebliche Bild seiner Eurydike: Ihr gelten alle seine Seufzer und Lieder, ihrem Andenken die süßen klagenden Töne, die er der Leier entlockt.
So saß der göttliche Sänger einst auf einem grünen, schattenlosen Hügel und begann sein Lied. Alsbald bewegte sich der Wald, näher und näher rückten die mächtigen Bäume, bis sie den Sitzenden mit ihren Zweigen überschatteten; und auch die Tiere des Waldes und die munteren Vögel kamen heran und lauschten im Kreis den wundervollen Tönen. Da durchstürmten thrakische Weiber schwärmend die Berge, das ausschweifende Fest des Dionysos feiernd. Sie hassten den Sänger, der seit dem Tod der Gattin alle Frauen verschmähte. Jetzt erblickten sie den Verächter. »Dort seht ihn, der uns verhöhnt!«, so rief die erste der rasenden Mänaden, und im Nu stürzten sie tobend auf ihn ein, indem sie Steine und Thyrsosstäbe schleuderten. Noch lange schützten die treuen Tiere den geliebten Sänger; wie aber der Klang seiner Weisen allmählich in dem Wutgeheul der wahnsinnigen Weiber verhallte, flohen sie erschreckt ins Dickicht des Waldes. Da traf ein geschleuderter Stein die Schläfe des Unglücklichen; blutend sank er in den grünen Rasen; ach, durch den liederreichen Mund, der Felsen und Bergwild gerührt hatte, entfloh die Seele.
Kaum war die mörderische Schar entwichen, da kamen die Vögel schluchzend herbeigeflattert, traurig nahten die Felsen und alles Getier; auch die Nymphen der Quellen und Bäume eilten zusammen, in schwarze Gewänder gehüllt. Um Orpheus klagten sie alle und begruben seine verstümmelten Glieder. Das Haupt aber und die Leier nahm die schwellende Flut des Flusses Hebros auf und trug sie mitten im Strom dahin. Noch immer klang es wie süßer Klagelaut von den Saiten und von der entseelten Zunge, leise antworteten die Ufer mit wehmütigem Widerhall. So trug der Strom das Haupt und die Leier hinaus in die Meeresfluten bis an das Gestade der Insel Lesbos, wo die frommen Einwohner beides auffingen. Das Haupt bestatteten sie, und die Leier hängten sie in einem Tempel auf. Daher kommt es, dass jene Insel so herrliche Dichter und Sänger erzeugt hat; ja selbst die Nachtigallen sangen dort lieblicher als anderswo, um das Grab des göttlichen Orpheus zu ehren. Seine Seele aber schwebte hinab ins Schattenreich. Dort fand Orpheus die Geliebte wieder, und nun weilten sie, ungetrennt und selig umschlungen, in den Gefilden Elysiums, auf ewig miteinander vereinigt.
Griechische Sage
Dädalus und Ikaros
Dädalus aus Athen war der kunstreichste Mann seiner Zeit, Baumeister, Bildhauer und Steinmetz. In den verschiedensten Gegenden der Welt wurden Werke seiner Kunst bewundert, und von seinen Bildsäulen sagte man, sie leben, gehen und sehen und seien für kein Bild, sondern für ein beseeltes Geschöpf zu halten. Denn während an den Bildsäulen der früheren Meister die Augen geschlossen waren und die Hände, von den Seiten des Körpers nicht getrennt, schlaff herunterhingen, war er der Erste, der seinen Bildern offene Augen gab, sie die Hände ausstrecken und auf schreitenden Füßen stehen ließ. Aber so kunstreich Dädalus auch war, so eitel und eifersüchtig war er auch auf seine Kunst, und diese Untugend verführte ihn zum Verbrechen und trieb ihn ins Elend.
Er hatte einen Neffen namens Talos, den er in seinen eigenen Künsten unterrichtete und der noch herrlichere Anlagen zeigte als sein Onkel und Meister. Schon als Knabe hatte Talos die Töpferscheibe erfunden; den Kinnbacken einer Schlange, auf den er irgendwo gestoßen war, gebrauchte er als Säge und durchschnitt mit den gezackten Zähnen ein kleines Brettchen; dann ahmte er dieses Werkzeug in Eisen nach, in dessen Schärfe er eine Reihe fortlaufender Zähne einschnitt, und wurde so der gepriesene Erfinder der Säge. Ebenso erfand er das Drechseleisen, indem er zuerst zwei eiserne Arme verband, von welchen der eine stillstand, während der andere sich drehte. Auch andere künstliche Werkzeuge ersann er, alles ohne die Hilfe seines Lehrers, und erwarb sich damit hohen Ruhm.
Dädalus fing an zu befürchten, der Name des Schülers könnte größer werden als der des Meisters; der Neid übermannte ihn, und er brachte den Knaben hinterlistig um, indem er ihn von Athenes Burg herabstürzte. Während Dädalus mit seinem Begräbnis beschäftigt war, wurde er überrascht; er gab vor, eine Schlange zu verscharren. Dennoch wurde er vor dem Gericht des Areopag wegen eines Mordes angeklagt und für schuldig befunden. Er ergriff nun die Flucht und irrte anfangs flüchtig in Attika umher, bis er weiter nach der Insel Kreta floh. Hier fand er bei dem König Minos eine Zuflucht, ward dessen Freund und als berühmter Künstler hoch angesehen. Er wurde von ihm auserwählt, um dem Minotauros, einem Ungeheuer von abscheulicher Abkunft, der ein Doppelwesen war, das vom Kopf bis an die Schultern die Gestalt eines Stieres hatte, im Übrigen aber einem Menschen glich, einen Aufenthalt zu schaffen, wo das Ungetüm den Augen der Menschen ganz entzogen würde. Der erfinderische Geist des Dädalus erbaute zu diesem Zweck das Labyrinth, ein Gebäude voll gewundener Krümmungen, welche Augen und Füße des Betretenden verwirrten. Die unzähligen Gänge schlangen sich ineinander wie der verworrene Lauf des geschlängelten phrygischen Flusses Mäander, der in verzweifelndem Lauf bald vorwärts-, bald zurückfließt und oft seinen eigenen Wellen entgegenkommt. Als der Bau vollendet war und Dädalus ihn durchmusterte, fand sich der Erfinder selbst mit Mühe zur Schwelle zurück, solch einen trügerischen Irrgarten hatte er geschaffen. Im Innersten dieses Labyrinths wurde der Minotauros gehalten, und seine Speisen waren sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen, die, vermöge alter Zinsbarkeit, alle neun Jahre von Athen dem König Kretas zugesandt werden mussten.
Indessen wurde dem Dädalus die lange Verbannung aus der geliebten Heimat doch allmählich zur Last, und es quälte ihn, bei dem tyrannischen und selbst gegen seinen Freund misstrauischen König sein ganzes Leben auf einem vom Meer rings umschlossenen Eiland zubringen zu sollen. Sein erfinderischer Geist sann auf Rettung. Nachdem er lange nachgedacht hatte, rief er endlich ganz freudig aus: »Die Rettung ist gefunden; mag mich Minos immerhin von Land und Wasser aussperren, die Luft bleibt mir doch offen; so viel Minos auch besitzt, über sie hat er keine Herrschergewalt. Durch die Luft will ich entfliehen!« Gesagt, getan. Dädalus ahmte mit seinem Erfindungsgeist die Natur nach. Er fing an, Vogelfedern von verschiedener Größe so in Ordnung zu legen, dass er mit der kleinsten begann und zu der kürzeren Feder stets eine längere fügte, sodass man glauben konnte, sie seien von selbst von unten nach oben ansteigend gewachsen. Diese Federn verknüpfte er in der Mitte mit Leinfäden, unten mit Wachs. Die so vereinigten beugte er mit kaum merklicher Krümmung, sodass sie ganz das Ansehen von Flügeln bekamen.





























