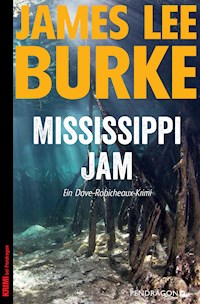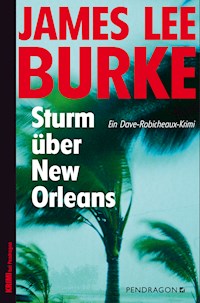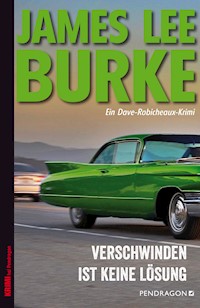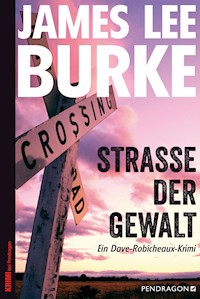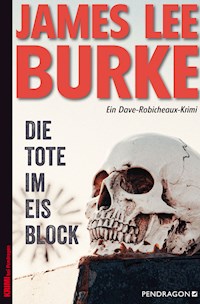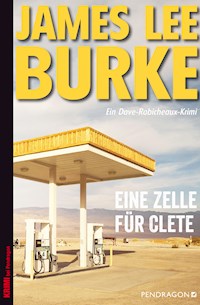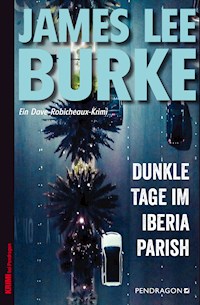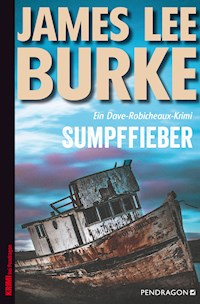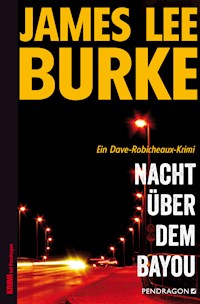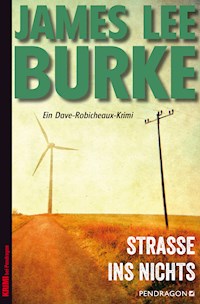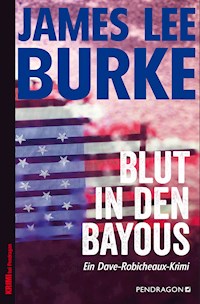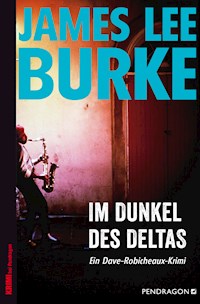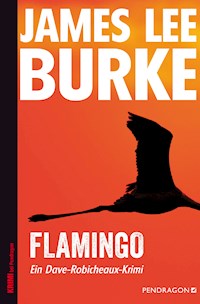Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
Vergewaltigt und mit einer Schrotflinte erschossen: Der Mord an einer 16-jährigen Schülerin schreckt die Menschen in New Iberia auf. Fingerabdrücke am Tatort weisen auf den jungen schwarzen Cajun-Musiker Tee Bobby Hulin hin. Doch Dave Robicheaux ist skeptisch und gräbt tiefer. Seine Ermittlungen führen ihn weit in die Vergangenheit - zu Tee Bobby Hulins Großmutter und einem zwielichtigen ehemaligen Plantagenaufseher. Dann geschieht ein zweiter Mord. Diesmal ist die Tochter eines berüchtigten Mafioso aus New Orleans das Opfer. Als der Mafioso die Sache selbst in die Hand nehmen will, läuft Robicheaux die Zeit davon ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Lee Burke • Die Schuld der Väter
Für Rick und Carole DeMarinis
sowie Paul und Elizabeth Zarzyski
JAMES LEE BURKE
Die Schuld der Väter
Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 12
Aus dem Amerikanischen von Georg Schmidt
1
Als ich in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts in New Iberia unten an der Golfküste aufwuchs, gab es für mich keinerlei Zweifel daran, wie es auf der Welt zuging. In der Morgendämmerung ragten entlang der East Main Street die alten, noch aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg stammenden Häuser mit ihren taunassen Säulenportalen, den Gartenwegen und den Balkonen aus dem Dunst auf, zeichneten sich die Kamine und Schieferdächer weich unter dem Laubdach der immergrünen Eichen ab, das die ganze Straße überspannte. Mit umgekippten Schornsteinen lagen die versenkten Schiffe der US-Navy im Hafenbecken von Pearl Harbor, und überall in New Iberia hingen die Militärsterne in den Fenstern. Aber an der East Main Street war die Luft im ersten Morgengrauen schwer vom Duft der nachts blühenden Blumen, roch es nach Flechten auf feuchtem Gestein und dem faulig-fruchtbaren Moderdunst des Bayou Teche. Auch wenn im Fenster eines Herrenhauses ein goldener Stern hängen mochte, der den Soldatentod eines Familienangehörigen anzeigte, hätte man meinen können, man befände sich eher im Jahr 1861 als im Sommer 1942.
Selbst wenn sich die Sonne über den Horizont schob, wenn die Eis- und Milchwagen auf ihren mit Eisenreifen beschlagenen Rädern die Straße entlangrollten und sich die Schwarzen nach und nach an den Hintertüren ihrer Dienstherren zur Arbeit meldeten, war das Licht niemals grell, wurde es nie zu heiß oder roch nach Straßenteer und Staub, so wie in anderen Gegenden. Stattdessen sickerte es durch das Louisianamoos, durch Bambus und Philodendron, an denen murmelgroße Tautropfen hingen, sodass für diejenigen, die hier lebten, je der neue Morgen mit einer blauen Samtigkeit anbrach, die ihnen tagtäglich deutlich machte, wie großartig die Erde war, erschaffen nach einem Plan, der uns vom Himmel gewährt worden war und nie in Frage gestellt werden sollte.
Unten an der Straße stand das alte Frederic Hotel, ein zauberhafter rosafarbener Bau mit Topfpalmen und Marmorsäulen im Innern, einem Ballsaal, einem Fahrstuhl, der aussah wie ein Vogelkäfig aus Messing, einem hohen Schuhputzstuhl aus verschnörkeltem Schmiedeeisen und einer langen, von Hand geschnitzten Mahagonibar. Inmitten der Palmwedel und der blauen und grauen Farbkringel an den Marmorsäulen standen die Glücksspiel- und Rennpferd-Automaten mit ihren blinkenden, kreisenden Lichtern und den wie mattes Zinn schimmernden Münzschalen, die ein stummes Versprechen für jene abgaben, die frohen Mutes waren.
Weiter unten zweigten die Hopkins und die Railroad Avenue von der Main Street ab, wie zwei Zubringerstraßen in einen Teil der Geschichte und Geographie der Stadt, über den die Leute in der Öffentlichkeit nicht redeten. Wenn ich samstagnachmittags mit meinem Vater zum Eishaus ging, schaute ich immer verstohlen die Railroad Avenue hinab, auf die ungestrichenen Hütten, die sich zu beiden Seiten der Bahngleise aneinanderreihten, und die ungepflegten Frauen, die auf den Stufen saßen, verkatert, breitbeinig, die Knie unter den weiten Kattunkleidern angewinkelt, und sich vielleicht gerade einen Schluck Bier aus einem Eimer schöpften, den zwei schwarze Jungen an einem Besenstiel aus Hattie Fontenots Bar anschleppten.
Ich lernte frühzeitig, dass es kein Laster oder Geschäft mit der Unzucht ohne das Einverständnis der Allgemeinheit gab. Ich dachte, ich hätte das Wesen des Bösen begriffen. Mit zwölf Jahren erfuhr ich, dass dem nicht so war.
Mein Halbbruder, der 15 Monate jünger war als ich, hieß Jimmie Robicheaux. Seine Mutter war eine Prostituierte aus Abbeville, aber er und ich wurden gemeinsam aufgezogen, größtenteils von unserem Vater, bekannt als Big Aldous, der Trapper, gewerbsmäßiger Fischer und Bohrarbeiter auf den Öltürmen vor der Küste war. Als Kinder waren Jimmie und ich unzertrennlich. An schönen Sommerabenden gingen wir immer zu den Ballspielen, die unter Flutlicht im City Park stattfanden, und stahlen uns in die Menschenschlangen, die an den Grills und Krabbenküchen bei den Freiluftpavillons anstanden. Unser Vergehen war eher harmlos, nehme ich an, und wir waren ziemlich stolz auf uns, wenn wir meinten, wir hätten die Erwachsenen wieder einmal ausgetrickst.
An einem heißen Augustabend, an dem Blitze zwischen den Gewitterwolken über dem Golf von Mexiko zuckten, gingen Jimmie und ich unter den Eichen am Rande des Parks entlang, als wir einen alten Ford sahen, in dem zwei Pärchen saßen, eins auf dem Vordersitz, eins hinten. Wir hörten eine Frau aufstöhnen, dann wurde ihre Stimme lauter und durchdringender. Mit offenem Mund starrten wir hin, als wir den nach hinten gewölbten Oberkörper einer Frau sahen, ihre nackten Brüste, die im Lichtschein eines Picknickpavillons schimmerten, den vor Lust aufgerissenen Mund.
Wir wollten in die andere Richtung gehen, aber die Frau lachte jetzt und schaute mit schweißnassem, glänzendem Gesicht aus dem Fenster. „Hey, Junge, weißt du, was wir grade gemacht ham? Das tut meiner Muschi so gut. Hey, komm her, du. Wir ham gefickt, mein Junge“, sagte sie.
Damit hätte es vorbei sein sollen – eine unangenehme Begegnung mit weißem Abschaum, Leuten, die vermutlich betrunken waren und sich beim Schäferstündchen im Grünen hatten erwischen lassen. Doch die eigentliche Auseinandersetzung fing damit erst an. Der Mann am Lenkrad zündete sich eine Zigarette an, sodass sein Gesicht im Flammenschein wie Teig aufleuchtete, dann trat er heraus auf den Kies. Er hatte Tätowierungen an den Unterarmen, die wie dunkelblaue Schlieren wirkten. Mit zwei Fingern klappte er die Klinge eines Taschenmessers auf.
„Ihr schaut wohl gern bei andern Leuten durchs Fenster?“, fragte er.
„Nein, Sir“, sagte ich.
„Das sind doch noch Jungs, Legion“, sagte die Frau auf dem Rücksitz, während sie ihre Bluse anzog.
„Vielleicht bleiben sie das auch für immer“, sagte der Mann.
Ich dachte zunächst, er wollte uns damit bloß erschrecken. Aber dann sah ich ihn deutlich vor mir, die pechschwarzen, nach hinten gekämmten Haare, das schmale Gesicht mit den steilen Falten, die Augen, mit denen er ein Kind anschaute, als wäre es die Ursache all seines Zorns auf Gott und die Welt.
Dann rannten Jimmie und ich in die Dunkelheit, mit klopfenden Herzen, für immer verändert durch das Wissen, dass es auf der Welt dunkle Abgründe gab, in denen das Böse hauste.
Da mein Vater nicht in der Stadt war, rannten wir bis zu dem Eishaus an der Railroad Avenue, hinter dem das hell erleuchtete und gepflegte Haus von Ciro Shanahan stand, dem einzigen Menschen, von dem mein Vater voller Bewunderung und Zutrauen sprach.
Später sollte ich erfahren, warum mein Vater so viel Hochachtung vor seinem Freund hatte. Ciro Shanahan war einer jener seltenen Menschen, die ihr Leid stillschweigend erduldeten und sich schweres Unrecht zufügen ließen, um diejenigen zu schützen, die sie liebten.
Es war in einer Frühlingsnacht im Jahr 1931, als Ciro und mein Vater südlich von Point Au Fer die Motoren ihres Bootes abstellten und auf die schwarz-grünen Umrisse der Küste von Louisiana starrten, die sich im Mondlicht abzeichneten. Die Wellen trugen Schaumkronen, und ein scharfer Wind bauschte die knatternde Plane auf, die über die Kisten voller mexikanischem Whiskey und kubanischem Rum gespannt war, die mein Vater und Ciro 16 Kilometer weiter draußen von einem Trawler übernommen hatten. Mein Vater schaute durch seinen Feldstecher und betrachtete die Suchscheinwerfer, die im Süden über die Wellenkämme huschten. Dann stützte er das Glas auf das Dach des kleinen, aus rohem Kiefernholz gebauten Ruderhauses am Heck des Bootes, wischte sich die salzige Gischt vom Gesicht und musterte den Küstenstreifen. Zwischen ihnen und dem rettenden Ufer tanzten die Positionslichter von drei Booten in der Dünung.
„Der Mond scheint. Ich hab dir doch gesagt, das is ’ne schlechte Nacht für so was“, sagte er.
„Wir haben es früher auch schon gemacht. Wir sind immer noch da, nicht wahr?“, erwiderte Ciro.
„Die Boote vor uns, das sind die Männer vom Staat, Ciro“, sagte mein Vater.
„Das wissen wir nicht“, sagte Ciro.
„Wir können uns nach Osten halten. Die Ladung bei Grand Chenier verstecken und später zurückkommen. Hör mal zu, du. Im Knast is noch keiner auf seine Kosten gekommen“, sagte mein Vater.
Ciro war klein, gebaut wie ein Hafenarbeiter, hatte rote Haare, grüne Augen und einen schmalen, nach unten gezogenen irischen Mund. Er trug einen Segeltuchmantel und einen Fedora-Filzhut, der mit einem Schal am Kopf festgebunden war. Es war ungewöhnlich kalt für die Jahreszeit, und sein Gesicht war vom Wind gerötet, wirkte verkniffen und nachdenklich.
„Der Mann hat seine Laster da oben stehen, Aldous. Ich hab ihm versprochen, dass wir heut Nacht kommen. Man lässt die Leute nicht warten“, sagte er.
„Niemand kommt nach Angola, weil er in ’nem leeren Laster sitzt“, sagte mein Vater.
Ciro wandte den Blick von meinem Vater ab und schaute zum Horizont im Süden.
„Is jetzt eh wurscht. Da kommt die Küstenwache. Halt dich fest“, sagte er.
Das Boot, das Ciro und meinem Vater gemeinsam gehörte, war lang und schmal, wie ein Torpedoboot aus dem Ersten Weltkrieg, und für die Versorgung der Bohrtürme vor der Küste gebaut worden, ohne jeden Firlefanz an Bord. Das Ruderhaus saß wie eine Streichholzschachtel am Heck, und selbst wenn sich die Bohrrohre hoch auf dem Deck stapelten, konnten es die schweren Chrysler-Motoren noch problemlos durch dreieinhalb Meter hohen Seegang treiben. Als Ciro den Gashebel nach vorn schob, pflügten die Schrauben eine Furche durch die Dünung, und der Bug stieg aus dem Wasser und schnitt durch eine Welle, dass die Gischt im Mondschein wie ein Pferdeschwanz hochspritzte.
Doch die Suchscheinwerfer auf dem Kutter der Küstenwache waren unerbittlich. Sie zerschnitten das Boot meines Vaters, brannten ihm rote Ringe in die Augen, färbten die Wellen sandig grün und nahmen ihnen alles Geheimnisvolle, erfassten die Köderfische und die Stachelrochen, die aus den Kämmen schossen. Der Bootsrumpf donnerte über das Wasser, dass die Schnapsflaschen unter der Plane heftig durchgerüttelt wurden, während die Suchscheinwerfer durch die Fenster des Ruderhauses hindurch weit hinaus in die Dunkelheit stachen. Die ganze Zeit über lagen die Boote, die zwischen meinem Vater und der rettenden Küste vertäut waren, abwartend da, hatten jetzt die Kabinenfenster erleuchtet, doch die Motoren schwiegen.
Mein Vater beugte sich dicht an Ciros Ohr. „Du hältst genau auf die Agenten zu“, sagte er.
„Um die Leute hat sich Mr. Julian gekümmert“, sagte Ciro.
„Mr. Julian hat sich um Mr. Julian gekümmert“, erwiderte mein Vater.
„Das will ich nicht gehört haben, Aldous.“
Plötzlich setzten sich die Boote der staatlichen Alkoholfahnder in Bewegung, jagten über die Wellen und richteten ihre Suchscheinwerfer auf Ciro und meinen Vater. Ciro riss das Ruder hart nach Steuerbord, kurvte um eine Sandbank herum, fuhr durch seichtes Wasser und steuerte mit bockendem Bug gegen den ablaufenden Ebbstrom.
Vor ihnen war die Mündung des Atchafalaya. Mein Vater sah, wie die Küste näher kam, sah das wehende Moos an den Stämmen der abgestorbenen Zypressen, die überfluteten Weiden, Tupelobäume und das Riedgras, das im Wind wogte und wankte. Die Plane über den Whiskey- und Rumkisten riss sich los, klatschte an das Ruderhaus und verdeckte ihnen die Sicht nach vorn. Mein Vater zerschnitt die anderen Seile, mit denen die Plane befestigt war, zerrte sie von den übereinander gestapelten Schnapskisten und wälzte sie über die Bordwand. Als er wieder zur Küste schaute, sah er eine Reihe von Sandbänken in der Bucht aufragen, wie die Buckel verirrter Wale.
„Ach Ciro, was hast du uns da bloß eingebrockt?“, fragte er.
Das Boot schoss gerade zwischen zwei Sandbänken hindurch, als jemand auf dem Staatsboot ein paar kurze Feuerstöße mit einer Schnellfeuerwaffe abgab. Whiskey, Rum und Glassplitter spritzten durch die Luft, dann landete ein Leuchtspurgeschoss auf dem Deck, das wie Phosphor aufglühte, worauf eine riesige Flammenwand emporloderte und das ganze Ruderhaus umfing.
Aber Ciro nahm das Gas nicht zurück, dachte nicht daran aufzugeben. Die Glasscheiben wurden schwarz und zersprangen; blaues, gelbes und rotes Feuer tropfte vom Deck ins Wasser.
„Halt auf das Laub zu!“, brüllte mein Vater und zeigte auf eine schmale Bucht, auf der eine dicke Schicht abgefallener Blätter trieb.
Der Bug des Bootes brach durch die Bäume und setzte das Laub in Flammen. Dann sprangen mein Vater und Ciro über Bord und stapften durch den aufspritzenden Sumpf, während das Feuer ihnen Muster auf die Körper zeichnete.
Drei Kilometer weit rannten, wateten und torkelten sie durch brusttiefes Wasser, durch Morast, Luftranken und sumpfige Sandlöcher, die schwarz vor Insekten waren, die sich an den darin erstickten oder verhungerten Kühen und Wildtieren gütlich taten. Drei Stunden später saßen sie beide auf einem trockenen Uferdamm und sahen zu, wie der Himmel dunkler wurde und der Mond zu einer fahlen weißen Scheibe verblasste. Ciros linker Knöchel war dick wie eine Honigmelone.
„Ich hol mein Auto“, sagte mein Vater. „Und danach lassen wir die Finger von Alkoholschmuggel.“
„Wir haben eh kein Boot mehr dazu“, sagte Ciro.
„Danke für den Hinweis. Wenn ich das nächste Mal für Mr. Julian LaSalle arbeite, kaufst du dir ’ne Knarre und erschießt mich.“
„Er hat die Krankenhausrechnungen von meiner Tochter bezahlt. Du bist zu hart zu den Leuten, Aldous“, sagte Ciro.
„Bezahlt er uns auch unser Boot?“
Mein Vater lief acht Kilometer weit, bis zu der Gruppe von Sumpfahornbäumen, bei der er sein Auto geparkt hatte. Der Himmel war bereits blau, als er zurückkehrte, um Ciro abzuholen, die wilden Blumen entlang des Damms blühten, und die Luft glitzerte vom Salz. Er kam um ein Weidengehölz und starrte durch die Windschutzscheibe auf das Geschehen, in das er unverhofft geraten war.
Drei Männer mit Fedora-Hüten und schlechtsitzenden Anzügen, zwei davon mit Browning-Schnellfeuergewehren bewaffnet, geleiteten Ciro in Handschellen zur Rückseite eines Gefängniswagens, dessen Boden mit Eisenplatten belegt war. Der Wagen hing an einem Laster des Staates, und zwei Schwarze, die für Julian LaSalle arbeiteten, saßen bereits darin.
Mein Vater legte den Rückwärtsgang ein und setzte den ganzen Damm entlang zurück, bis er auf eine Plankenstraße stieß, die durch den Sumpf führte. Während er durch die überfluteten Senken in der Straße raste und der Matsch über die Windschutzscheibe spritzte, versuchte er nicht an Ciro zu denken, der in Fesseln zum Gefängniswagen gehumpelt war. Er erfasste ein Stück Rotwild, eine Hirschkuh, und sah, wie sie mit zerschmettertem Leib vom Kotflügel abprallte und gegen einen Baum geschleudert wurde. Doch mein Vater ging nicht vom Gas, bis er in Morgan City war, wo er durch die Hintertür in ein Café für Schwarze trat und sich ein Glas Whiskey bestellte, das er beim Trinken mit beiden Händen hielt.
Dann legte er den schweren Kopf auf die Arme, schlief ein und träumte von Vögeln, die im Blattwerk brennender Bäume gefangen waren.
2
Cops, Polizeireporter und hart gesottene Sozialarbeiter halten sich für gewöhnlich unter ihresgleichen auf und schließen kaum engere Freundschaft mit Leuten außerhalb ihres Berufes. Sie sind nicht etwa verschlossen, elitär oder überheblich. Sie wollen einfach ihre Erfahrungen nicht mit Außenstehenden teilen. Wenn sie es täten, würde man sie wahrscheinlich meiden.
In einem der Faliciana Parishs kannte ich einen Schwarzen, der Sergeant in Lieutenant William Calleys Zug in My Lai ge wesen war. Er hatte oben am Graben gestanden und mit dem Maschinengewehr Frauen, Kinder und alte Männer niedergeschossen, die um ihr Leben flehten. Etliche Jahre später starb der Sohn des Sergeants in dessen Vorgarten an einer Überdosis. Der Sergeant glaubte, dass der Tod seines Sohnes die Strafe für die Geschehnisse im Graben von My Lai war. Er klebte die Wände seines Hauses voller Bilder und Zeitungsartikel, die in allen Einzelheiten die Gräueltat beschrieben, an der er teilgenommen hatte, und durchlebte seine Taten in My Lai stets aufs Neue, 24 Stunden am Tag.
Aber die Politiker, die meinen Freund, den Sergeant, in dieses Dorf in der Dritten Welt geschickt hatten, mussten nicht seine Bürde tragen, und sie wurden auch nie von einer zivilen oder militärischen Behörde zur Rechenschaft gezogen.
So ist das eben im Leben. Die Richtigen erwischt es selten. Gerechtigkeit ist etwas, das den Opfern von Gewaltverbrechen nur selten zuteil wird. Wenn man Cop ist, kann man von Glück reden, wenn es einen aufgrund der Sachen, die man zu sehen bekommt, nicht zu später Stunde noch in Kneipen treibt.
An einem Frühlingsnachmittag im letzten Jahr nahm ich am Telefon auf meinem Schreibtisch in der Sheriff- Dienststelle des Iberia Parish einen Anruf entgegen und wusste sofort, dass ich gerade einen Fall erwischt hatte, zu dem es keine befriedigende Lösung geben würde, einen Fall, der eine völlig unschuldige, anständige Familie betraf, deren Wunden nie verheilen würden.
Der Vater war Zuckerrohrfarmer, die Mutter Krankenschwester im Iberia General. Ihre sechzehnjährige Tochter war eine Einserschülerin an der hiesigen katholischen Highschool. An diesem Morgen hatte sie mit ihrem Freund in einem offenen Geländewagen eine Spritztour über ein brachliegendes Zuckerrohrfeld unternommen. Ein Schwarzer, der auf der hinteren Veranda seines nahe gelegenen Hauses gesessen hatte, sagte, der Geländewagen hätte eine Wolke aus braunem Staub auf dem Feld aufgewühlt und wäre in einem Wäldchen aus Tupelobäumen verschwunden, dann über eine Holzbrücke zu einem anderen Feld gerumpelt, das voll mit jungem Zuckerrohr stand. Ein grauer Spritschlucker mit abgeflachtem Dach, in dem drei Leute saßen, hätte am Bachlauf geparkt. Der Schwarze sagte, der Fahrer hätte eine Bierdose aus dem Fenster geworfen, den Motor angelassen und wäre in die gleiche Richtung gefahren wie der Geländewagen.
Helen Soileau war meine Partnerin. Sie hatte ihre Laufbahn als Politesse beim NOPD begonnen, danach als Streifenpolizistin im Garden District gearbeitet, bevor sie in ihre Heimatstadt zurückkehrte und wieder von vorn anfing. Sie hatte die Statur eines Mannes, war streitlustig und aufbrausend, aber von Clete Purcel, meinem alten Partner bei der Mordkommission in New Orleans, einmal abgesehen, war sie der beste Polizist, den ich je kennengelernt habe.
Helen fuhr mit dem Streifenwagen an dem Tupelowäldchen vorbei, überquerte die Brücke über den Bachlauf und folgte einem Feldweg durch das Zuckerrohr, das von der Frühjahrsdürre hellgrün war und trocken im Wind wisperte. Vor uns befand sich ein weiteres Tupelowäldchen, das mit gelbem Absperrband umgeben war.
„Kennst du die Familie?“, fragte Helen.
„Ein bisschen“, erwiderte ich.
„Haben sie noch andere Kinder?“
„Nein“, sagte ich.
„Ein Jammer. Wissen sie schon Bescheid?“
„Sie sind heute in Lafayette. Der Sheriff konnte sie noch nicht erreichen“, sagte ich.
Helen drehte sich um und schaute mich an. Sie hatte ein kantiges Gesicht und dichte, schulterlange blonde Haare. Sie kaute auf ihrem Kaugummi herum und warf mir einen fragenden Blick zu.
„Müssen wir sie verständigen?“, fragte sie.
„Sieht so aus“, erwiderte ich.
„Bei so einem Fall hätte ich am liebsten den Täter dabei, damit ihm die Angehörigen eine aufs Ohr geben können.“
„Schlechte Gedanken, Helen“, sagte ich.
„Ich bin so schuldbewusst, wie ich nur kann“, sagte sie.
Zwei Deputies, der Schwarze, der die Schüsse gemeldet hatte, und der Teenager, der den Geländewagen gefahren hatte, erwarteten uns außerhalb des Absperrbandes, das um das Tupelogehölz gewunden war. Der Junge hockte im Schneidersitz am Boden und starrte niedergeschlagen ins Leere. Durch das Rückfenster des Streifenwagens sah ich einen Krankenwagen, der die Brücke am Bachlauf überquerte.
Helen stellte den Streifenwagen ab, worauf wir in den Schatten der Bäume gingen. Die Sonne, rosa vom Staub, der über den Himmel zog, stand tief im Westen. Ein scharfer Gestank stieg mir in die Nase, wie von einem toten Tier, das im Bachbett verweste.
„Wo ist sie?“, fragte ich einen Deputy.
Er nahm die Zigarette aus dem Mund und trat sie aus. „Auf der anderen Seite von dem Brombeergebüsch“, sagte er.
„Heben Sie bitte die Kippe auf und zünden Sie sich keine weitere mehr an“, sagte ich.
Helen und ich duckten uns unter dem Absperrband hindurch und gingen mitten in das Wäldchen. Eine graue Wolke aus Insekten schwärmte über der Stelle, an der das Gras plattgedrückt war. Helen blickte auf die Leiche hinab und stieß den Atem aus.
„Zwei Wunden. Eine in der Brust, die andere an der Seite. Vermutlich eine Flinte“, sagte sie. Unwillkürlich suchte sie den Boden nach einer ausgeworfenen Patronenhülse ab.
Ich kauerte mich neben die Leiche. Die Hände des Mädchens waren über den Kopf gezogen und mit einem Springseil um den Fuß eines Baumstamms gebunden. Ihre Haut war durch den starken Blutverlust grau verfärbt. Die Augen standen noch immer offen und schienen auf eine etwa einen Meter entfernte wilde Blume gerichtet zu sein. Ihr Höschen hing um den einen Knöchel. Ich stand auf und spürte, wie meine Knie knackten. Einen kurzen Moment verschwammen die Bäume auf der Lichtung vor meinen Augen.
„Fehlt dir was?“, fragte Helen.
„Die haben ihr eine ihrer Socken in den Mund gestopft“, sagte ich.
Helen ließ den Blick über mein Gesicht schweifen. „Reden wir mit dem Jungen“, sagte sie.
Seine Haut war mit Staub bedeckt, und Schweißbäche wa ren ihm aus den Haaren gelaufen und im Gesicht getrocknet. Das T-Shirt war mit Dreck verschmiert und sah aus, als wäre es zusammengeknotet worden, bevor er es angezogen hatte. Als er aufsah, brannte Feindseeligkeit in seinem Blick.
„Es waren also zwei Schwarze?“, fragte ich.
„ Ja. Ich meine, ja, Sir“, erwiderte er.
„Nur zwei?“
„Mehr hab ich nicht gesehen.“
„Du hast gesagt, sie hatten Sturmhauben auf ? Und einer von ihnen trug Handschuhe?“
„Das hab ich gesagt“, erwiderte er.
Selbst im Schatten war es heiß. Ich tupfte mir mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn.
„Sie haben dich also gefesselt?“, fragte ich.
„ Ja“, erwiderte er.
„Mit deinem T-Shirt?“, fragte ich.
„ Ja, Sir.“
Ich kauerte mich neben ihn und warf den Deputies einen eindringlichen Blick zu. Sie gingen mit dem Schwarzen zu ihrem Streifenwagen, stiegen ein und ließen die Türen offen, damit der Wind durchziehen konnte.
„Mal sehen, ob ich das verstanden habe“, sagte ich zu dem Jungen. „Sie haben dich mit deinem T-Shirt und dem Gürtel gefesselt, haben dich beim Bachbett zurückgelassen und sind mit Amanda in den Wald gegangen? Typen in Sturmhauben, die man übers Gesicht ziehen kann?“
„Genauso war es“, erwiderte er.
„Konntest du dich nicht befreien?“
„Nein. Es war echt fest.“
„Ich tu mich schwer mit dem, was du mir da erzählst. Das klingt nicht schlüssig, Partner“, sagte ich.
„Schlüssig?“
„T-Shirts sind keine Handschellen“, sagte ich.
Seine Augen wurden feucht. Er fuhr sich mit den Fingern in die Haare.
„Du hast ziemlich Schiss gehabt, was?“, fragte ich.
„Ich glaube schon. Ja, Sir“, erwiderte er.
„Ich hätte auch Schiss gehabt. Das ist nicht weiter schlimm“, sagte ich. Ich tätschelte seine Schulter und stand auf.
„Wollen Sie sich die verdammten Nigger schnappen oder nicht?“, fragte er.
Ich ging zu unserem Streifenwagen. Die Sonne, die jetzt tief am Horizont stand, hing blutrot über den Bäumen in der Ferne. Helen hatte gerade einen Funkspruch entgegengenommen.
„Was hältst du von dem Jungen?“, fragte sie.
„Schwer zu sagen. Er ist nicht der Allerglaubwürdigste.“
„Die Eltern des Mädchens sind gerade aus Lafayette zurückgekommen. Das ist vielleicht ein Haufen Scheiße, Bwana“, sagte sie.
Das Haus der Familie war ein eingeschossiger weißer Holzbau, der zwischen der Staatsstraße und dem dahinterliegenden Zuckerrohrfeld stand. Eine Mooreiche, die im Winter kein Laub trug, spendete in den heißen Monaten auf der einen Seite Schatten. Nur durch dem nummerierten Briefkasten unten an der Straße und den überdachten Autostellplatz, der aussah, als wäre er erst nachträglich angebaut worden, unterschied es sich von den anderen Häusern an der Straße.
Die Jalousien waren heruntergelassen. Weihwassergefäße aus Plastik waren an die Türen genagelt, im Wohnzimmer hing ein Kirchenkalender an der Wand und daneben eine von Hand bestickte Decke mit dem Vaterunser. Quentin Boudreau war der Vater, ein von der Sonne verbrannter, rotblonder Mann, der eine Nickelbrille, einen schlichten blauen Schlips und ein gestärktes weißes Hemd trug, in dem er sich vorkommen musste wie in einem Eisenpanzer. Sein Blick wirkte teilnahmslos, abwesend, so als ob ihm Gedanken durch den Kopf gingen, die er sich noch nicht zugestehen wollte.
Er drückte die Hand seiner Frau an sein Knie. Sie war eine kleine, dunkelhaarige Cajun, die mit niedergeschmetterter Miene dasaß. Weder sie noch ihr Mann sprachen oder versuchten, eine Frage zu stellen, während Helen und ich ihnen so schonend wie möglich erklärten, was mit ihrer Tochter geschehen war. Ich wollte, dass sie wütend wurden, uns beschimpften, rassistische Sprüche von sich gaben, irgendetwas machten, das mich von den Gefühlen erlöste, die ich hatte, als ich ihnen ins Gesicht schaute.
Doch das taten sie nicht. Sie waren demütig und anspruchslos und momentan vermutlich gar nicht in der Lage, all das zu verstehen, was man ihnen sagte.
Ich legte meine Visitenkarte auf den Kaffeetisch und stand auf. „Unser herzliches Beileid für Sie und Ihre Familie“, sagte ich.
Die Frau hatte ihre Hände jetzt im Schoß gefaltet. Sie schaute darauf, blickte dann zu mir auf.
„Wurde Amanda vergewaltigt?“, fragte sie.
„Das muss der Gerichtsmediziner erst noch feststellen. Aber ja, ich glaube schon“, sagte ich.
„Haben sie Kondome benutzt?“, fragte sie.
„Wir haben keine gefunden“, erwiderte ich.
„Dann haben Sie die DNS von denen“, sagte sie. Ihre Augen waren jetzt schwarz und hart und auf mich fixiert.
Helen und ich gingen hinaus und überquerten den Hof. Der Wind wehte uns den Staub entgegen, aber nach dem langen heißen Tag wirkte er kühl und roch nach dem Salz vom Golf. Dann hörte ich Mr. Boudreau hinter mir. Mit schwerfälligen Schritten kam er auf uns zu, als hätte er ein gichtiges Bein. Die eine Ecke seines Hemdkragens stand hoch, wie eine Speerspitze, die ihm an die Kehle gedrückt wurde.
„Was für eine Waffe haben sie benutzt?“, fragte er.
„Eine Flinte“, sagte ich.
Er kniff die Augen zusammen, schob seine Brille hoch. „Haben sie meiner Kleinen ins Gesicht geschossen?“, fragte er.
„Nein, Sir“, erwiderte ich.
„Ihrem Gesicht sollten diese Hurensöhne nämlich lieber nichts angetan haben“, sagte er und fing im Vorgarten an zu weinen.
Am nächsten Morgen stießen wir durch die Fingerabdrücke, die an der am Tatort aus dem Autofenster geworfenen Bierdose gesichert worden waren, auf einen Namen – Tee Bobby Hulin, ein 25 Jahre alter schwarzer Straßengauner und unverbesserlicher Klugscheißer, dessen schmächtige Statur ihn so manches Mal davor bewahrt hatte, dass er in seine sämtlichen Einzelteile zerlegt wurde. Seine Akte war gut zehn Zentimeter dick und enthielt etliche Strafbefehle, unter anderem, weil er mit neun Jahren erstmals wegen Ladendiebstahls festgenommen worden war, mit 13 ein Auto geklaut, in den Fluren seiner Highschool mit Gras gedealt und sich hinter dem hiesigen Wal-Mart einen Laster voller Toilettenpapier geschnappt hatte und damit weggefahren war.
Seit Jahren schon war Tee Bobby immer knapp davongekommen, indem er den Leuten einen vormachte, sich mit Charme und Scharwenzeln durchmogelte und alle davon überzeugte, dass er eher ein Schwindler als ein Verbrecher war. Außerdem besaß er noch eine andere, eine größere Gabe, auch wenn er sie allem Anschein nach überhaupt nicht verdient hatte – als ob Gott eines Tages aufs Geratewohl mit dem Finger auf ihn gezeigt und ihm eine Musikalität geschenkt hätte, die seit Guitar Slims schwermütig-schönen Plattenaufnahmen niemandem mehr zuteil geworden war.
Als Helen und ich an diesem Abend bei einem Drive-in-Restaurant unweit des City Parks auf Tee Bobbys Spritschlucker zugingen, stand sein Akkordeon auf dem Rücksitz, glänzend wie Elfenbein und gesprenkelt wie das Innere eines Granatapfels.
„Hey, Dave, was gibt’s?“, fragte er.
„Reden Sie Respektspersonen nicht mit dem Vornamen an“, sagte Helen.
„Schon kapiert, Miss Helen. Ich hab doch nix angestellt, was?“, fragte er und zog die Augenbrauen hoch.
„Das müssen Sie uns verraten“, sagte ich.
Er tat, als dächte er ernsthaft nach. „Nee. Keinen Schimmer. Wollt ihr ein Stück von meinem Krabbenburger?“, fragte er.
Seine Haut schimmerte mattgolden wie abgewetztes Sattelleder, die Augen waren blaugrün, die Haare leicht eingeölt, lockig, kurz geschnitten und im Nacken hoch ausrasiert. Nach wie vor schaute er uns mit einem dämlichen Grinsen an.
„Legen Sie Ihre Autoschlüssel unter den Sitz und steigen Sie in den Streifenwagen“, sagte Helen.
„Das klingt nicht gut. Ich glaub, ich ruf lieber meinen Anwalt an“, sagte er.
„Ich habe nicht gesagt, dass Sie festgenommen sind. Wir hätten bloß gern ein paar Auskünfte von Ihnen. Haben Sie was dagegen?“, fragte Helen.
„Ich hab’s schon wieder kapiert. Die Weißen bitten bloß um Hilfe. Da müssen sie niemand seine Rechte vorlesen. Klar doch will ich der Polizei helfen“, sagte er.
„Sie sind ja eine wandelnde Benimmfibel, Tee Bobby“, sagte Helen. 20 Minuten später saß Tee Bobby allein in einem Vernehmungszimmer in der Sheriff-Dienststelle des Iberia Parish, während Helen und ich in meinem Büro miteinander redeten. Der Himmel draußen war mit braunen Wolkenstreifen gerippt, die Bahnschranken am Schienenstrang waren geschlossen, und ein Güterzug zockelte zwischen Baumgruppen und Hütten, in denen Menschen lebten, die Gleise entlang.
„Was für ein Gefühl hast du dabei?“, fragte ich.
„Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dieser Clown je mand mit einer Flinte ermordet hat“, sagte sie.
„Er war am Tatort.“
„Dieser Fall stinkt, Streak. Mit Amandas Freund stimmt einfach irgendwas nicht.“
„Mit Tee Bobby auch nicht. Er tut zu unbeteiligt.“
„Lass mir einen Moment Zeit, bevor du reinkommst“, sagte sie.
Sie ging in den Vernehmungsraum und ließ die Tür einen Spalt offen, damit ich ihr Gespräch mit Tee Bobby mithören konnte. Sie stützte sich auf den Tisch, sodass sie ihn mit einem ihrer muskulösen Arme leicht berührte, und beugte sich an sein Ohr. Eine zusammengerollte Illustrierte ragte aus der hinteren Tasche ihrer Jeans.
„Wir haben Hinweise darauf, dass Sie am Tatort waren. Das lässt sich nicht aus der Welt schaffen. Ich würde damit direkt reinen Tisch machen“, sagte sie.
„Gut. Bringen Sie mir ’nen Anwalt. Dann setz ich mich damit auseinander.“
„Möchten Sie, dass wir Ihre Großmutter herholen?“
„ Jetzt will Miss Helen, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege. Weil Sie ja eine dicke Freundin von meiner Familie sind. Weil meine Großmama früher immer die Sachen von Ihrem Daddy gewaschen hat, wenn er nicht gerade versucht hat, ihr unters Kleid zu fassen.“
Helen zog die zusammengerollte Zeitung aus ihrer Gesäßtasche. „Was halten Sie davon, wenn ich Sie einfach windelweich schlage?“, fragte sie.
„Das würde mir gefallen.“
Sie schaute ihn einen Moment lang nachdenklich an, dann tippte sie ihm mit der Spitze der Illustrierten leicht an die Stirn.
Spöttisch ließ er seine Augenlider flattern wie Schmetter linge.
Helen kam aus der Tür und ging an mir vorbei. „Hoffentlich verknackt der Staatsanwalt den kleinen Sack“, sagte sie.
Ich ging in den Vernehmungsraum und schloss die Tür.
„Derzeit wird Ihr Auto auseinandergenommen, und zwei Detectives sind mit einem Durchsuchungsbefehl zu Ihrem Haus unterwegs“, sagte ich. „Wenn sie irgendetwas finden, eine Sturmhaube, eine Flinte, die in den letzten zwei Tagen abgefeuert wurde, irgendeine Spur von dem Mädchen an Ihrer Kleidung, auch wenn es nur ein Haar ist, kriegen Sie die Spritze. So wie ich die Sache sehe, haben Sie etwa zehn Minuten lang die Gelegenheit, die Sache aus Ihrer Sicht darzustellen.“
Tee Bobby zog einen Kamm aus seiner Gesäßtasche, strich sich damit durch die Haare an seinem Arm und schaute ins Leere. Dann legte er den Kopf auf die verschränkten Arme und schlug mit dem Fuß einen Takt an, als wollte er den Rhythmus zu einer Melodie halten, die ihm durch den Kopf ging.
„Sie wollen sich also zum Narren machen?“, fragte ich.
„Ich hab niemand vergewaltigt. Lassen Sie mich in Frieden.“
Ich setzte mich ihm gegenüber hin und betrachtete ihn, während er mit unschuldigem Blick die Wand musterte, sich in meinem Beisein sichtlich langweilte, grinsend den Mund verzog, als er mich anschaute und meine zusehends wütender werdende Miene bemerkte.
„Was is denn los?“, fragte er.
„Sie war 16. Sie hatte zwei Löcher in der Brust und in der Seite, durch die man die Faust stecken konnte. Schauen Sie mich nicht so scheißdämlich an“, sagte ich.
„Ich kann schaun, wie ich will. Entweder Sie holen mir einen Anwalt, oder Sie lassen mich laufen. Sie haben keine Beweise, sonst hätten Sie mir längst die Fingerabdrücke genommen und mich eingebuchtet.“
„Ich knalle Ihnen gleich eine, dass Sie quer durchs Zimmer fliegen, Tee Bobby.“
„ Ja, Sir. Weiß ich doch. Dem Nigger zittern schon die Knochen, Chef “, erwiderte er.
Ich schloss ihn im Vernehmungsraum ein und ging in mein Büro. Eine halbe Stunde später ging ein Anruf von den Detectives ein, die zu Tee Bobbys Haus auf Poinciana Island geschickt worden waren.
„Bislang nichts“, teilte mir einer von ihnen mit.
„Was meinen Sie mit ‚bislang‘?“, fragte ich.
„Es wird Nacht. Wir fangen morgen früh noch mal von vorne an. Sie dürfen uns gern Gesellschaft leisten. Ich hab grade eine Mülltonne voller Krabbenschalen durchwühlt, die mindestens eine Woche alt waren“, erwiderte er.
In der Morgendämmerung fuhren Helen und ich über die Holzbrücke, die die Süßwasserbucht auf der Nordseite von Poinciana Island überspannte. Die aufgehende Sonne hing rot am Horizont und verhieß einen weiteren sengend heißen Tag, doch das Wasser in der Bucht war schwarz und roch nach lai chenden Fischen, und die Elefantenohren und in voller Blüte stehenden Bäume am Ufer raschelten im kühlen Wind, der vom Golf von Mexiko her wehte.
Ich zeigte dem Wachmann in der hölzernen Hütte auf der Brücke meine Dienstmarke, worauf wir im Schatten der Bäume durch eine Siedlung aus Holzhäusern fuhren, in denen die Angestellten der Familie LaSalle wohnten, und dann einem asphaltierten Fahrweg folgten, der sich zwischen Hügelkuppen, immergrünen Eichen, Kiefern, Tupelobäumen und rotem Ackerland wand, auf dem Schwarze Furchen ausharkten, die sich wie Marschkolonnen über das Feld zogen.
Die aus Holz und Ziegelsteinen gebauten Sklavenhütten der alten LaSalle-Plantage standen noch, waren allerdings von Perry LaSalle renoviert und modernisiert worden und wurden jetzt entweder von den Gästen der Familie oder den Bediensteten genutzt, für die die LaSalles bis zu ihrem Tod sorgten.
Ladice Hulin, Tee Bobbys Großmutter, deren dichte graue Haare über die Schulter herabhingen, saß in einem Korbsessel auf ihrer Veranda und hatte die Hände auf dem Griff eines Gehstocks verschränkt.
Ich stieg aus dem Streifenwagen und ging auf den Hof. Drei Deputies in Uniform und ein Zivilfahnder waren hinter dem Haus und rechten Abfälle aus einer alten Müllgrube. In jungen Jahren war Ladice eine absolute Schönheit gewesen, und auch jetzt, da sie vom Alter gebeugt war, strahlte sie nach wie vor einen unvermindert weiblichen Liebreiz aus, und ihre Haut war noch immer so glatt und glänzend wie Schokolade. Sie bat mich nicht auf die Veranda.
„Nehmen die Ihr Haus auseinander, Miss Ladice?“, fragte ich.
Sie schaute mich nach wie vor wortlos an. Ihre Augen waren klar und tiefgründig, der Blick starr und unverwandt, wie bei einem Reh.
„Ist Ihr Enkel drinnen?“, fragte ich.
„Der is nicht heimgekommen, nachdem Sie ihn freigelassen haben. Sie haben ihm eine Heidenangst eingejagt, falls sie das jetzt glücklich macht“, erwiderte sie.
„Wir haben versucht, ihm zu helfen. Er wollte nicht auf uns eingehen. Außerdem hat er keinerlei Betroffenheit darüber gezeigt, dass ein unschuldiges junges Mädchen vergewaltigt und ermordet wurde“, sagte ich.
Sie trug ein weißes Kattunkleid und eine goldene Halskette mit einem christlichen Medaillon. Ein durchbohrter, vergoldeter Dime hing an einem weiteren Kettchen um ihren Knöchel.
„Keine Betroffenheit, was?“ Dann wischte sie mit der Hand durch die Luft und sagte: „Nur zu, nur zu, kümmern Sie sich um Ihre Arbeit und bringen Sie’s hinter sich. Das Grab wartet schon auf mich. Ich wünschte bloß, ich müsste mich nicht mit so vielen Dummköpfen abgeben, eh ich dort hinkomme.“
„Ich habe Sie immer geachtet, Miss Ladice“, sagte ich.
Sie legte eine Hand auf die Armlehne ihres Sessels und stemmte sich hoch.
„Er wird vor Ihnen davonlaufen. Er wird Ihnen frech kommen. Weil er nämlich insgeheim ein ängstlicher kleiner Junge is. Tun Sie ihm nix zuleide, bloß weil er ängstlich is“, sagte sie.
Ich wollte etwas sagen, aber Helen tippte mir an den Arm. Der Zivilfahnder winkte uns von hinten zu. Eine schwarze Sturmhaube hing an einem Stock in seiner rechten Hand.
3
Eine Woche später kam Barbara Shanahan, die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, manchmal auch Dampframmen-Shanahan genannt, in mein Büro, ohne vorher anzuklopfen. Sie war eine stattliche, gutaussehende Frau, über eins achtzig groß, mit weißer Haut, roten Haaren und grünen Augen. Sie trug eine Hornbrille, weiße Strümpfe, ein hellorangefarbenes Kostüm und eine weiße Bluse, und es kam nur selten vor, dass sich die Männer nicht nach ihr umdrehten, wenn sie an ihnen vorbeiging. Aber sie war kratzbürstig wie Stacheldraht und wirkte ohne jeden Anlass ständig wütend und aufgebracht. Die Hingabe, mit der sie Kriminelle und Strafverteidiger in der Luft zerriss, war legendär. Über den Grund für diesen leidenschaftlichen Eifer konnte man allerdings nur Vermutungen anstellen.
Ich blickte von der Zeitung auf, die ich auf meinem Schreibtisch ausgebreitet hatte.
„Entschuldigen Sie, dass ich nicht aufstehe. Aber ich habe Sie nicht anklopfen hören“, sagte ich.
„Ich brauche alles, was Sie zu den Ermittlungen im Mord fall Amanda Boudreau vorliegen haben“, sagte sie.
„Das ist noch nicht vollständig.“
„Dann geben Sie mir das, was Sie haben, und halten mich täglich auf dem Laufenden.“
„Haben Sie den Fall abbekommen?“, fragte ich.
Sie setzte sich gegenüber von mir hin. Sie blickte auf die kleine goldene Armbanduhr an ihrem Handgelenk, dann wandte sie sich wieder mir zu. „Muss ich Ihnen denn immer alles zweimal sagen?“, fragte sie.
„Der Laborbericht über die Untersuchung der Sturmhaube die wir bei Tee Bobbys Haus gefunden haben, ist gerade eingegangen. Das Rouge und die Hautcreme stammen von Amanda Boudreau“, sagte ich.
„Gut, dann besorgen wir uns einen Haftbefehl.“ Als sie aufstand, ließ sie den Blick kurz auf mir ruhen. „Stimmt irgendwas nicht?“
„Das passt einfach nicht zusammen.“
„An der Kleidung des Verdächtigen befinden sich Spuren des Opfers. Seine Fingerabdrücke sind auf einer Bierdose am Tatort. Aber Sie haben nach wie vor Zweifel?“
„Die Samenspuren, die man bei dem Mädchen gefunden hat, stammen nicht von Tee Bobby. Der Mann, der die Schüsse gemeldet hat, sagte, in dem Auto hätten drei Leute gesessen. Aber Amandas Freund sagt, er wäre nur von zwei Männern angepöbelt worden. Wo war der andere? Der Freund sagt, er wäre mit einem T-Shirt gefesselt worden. Warum hat er nicht versucht abzuhauen?“
„Ich habe keine Ahnung. Warum finden Sie das nicht raus?“, sagte sie.
Ich zögerte, bevor ich wieder das Wort ergriff. „Mir macht noch etwas anderes zu schaffen. Ich kann mir Tee Bobby nicht als Killer vorstellen.“
„Vielleicht kommt das daher, weil Sie es auf beide Arten wollen“, sagte sie.
„Wie bitte?“
„Manche Menschen müssen sich immer gut vorkommen, für gewöhnlich auf Kosten anderer. In diesem Fall auf Kosten eines Mädchens, dem man eine Socke in den Rachen gestopft hat, während es vergewaltigt wurde.“
Ich klappte meine Zeitung zusammen und warf sie in den Papierkorb.
„Perry LaSalle vertritt Tee Bobby“, sagte ich.
„Na und?“
Ich stand auf und zog die Jalousien an den Fenstern zum Flur zu.
„Sie hassen die LaSalles, Barbara. Ich glaube, Sie haben um diesen Fall gebeten“, sagte ich.
„Ich habe in keiner Weise irgendwelche Vorbehalte, was die Familie LaSalle angeht.“
„Ihr Großvater ist wegen des alten Julian ins Gefängnis gekommen. Deswegen hat er den Job als Wachmann auf der Brücke zum Anwesen der LaSalles gekriegt.“
„Schaffen Sie den Papierkram bis Dienstschluss in mein Büro. Und merken Sie sich unterdessen eins: Wenn Sie meine Motive als Staatsanwältin noch einmal in Zweifel ziehen, zerre ich Sie wegen Verleumdung vor eine Zivilkammer und mache Ihnen die Hölle heiß.“
Sie stieß die Tür auf und marschierte den Korridor entlang, auf das Büro des Sheriffs zu. Ein Cop in Uniform, der am Wasserspender stand, betrachtete sie von der Seite und glotzte dann wie gebannt auf ihren Hintern. Er grinste verlegen, als er sah, dass ich ihn anschaute.
Es war Freitagnachmittag, und ich wollte nicht mehr über Barbara Shanahan oder ein junges Mädchen nachdenken, das vermutlich hilflos in den Lauf einer Flinte hatte starren müssen, während ihr Henker überlegte, ob er abdrücken sollte oder nicht.
Ich fuhr nach Süden, raus aus der Stadt, über eine staubige Straße und an einem von Bäumen gesäumten Wasserlauf entlang, bis ich zu dem Haus kam, das mein Vater während der Weltwirtschaftskrise gebaut hatte. Im Licht der Sonnenstrahlen, die wie gelber Rauch durch das Blätterdach der immergrünen Eichen fielen, sah ich den Bootsverleih und den Köderladen, die ich nebenbei betrieb, außerdem ein lavendelfarbenes Cadillac-Cabriolet, das neben meiner Bootsrampe stand, was bedeutete, dass mein alter Partner bei der Mordkommission in New Orleans, der Schrecken des NOPD, der gutmütige, völlig verantwortungslose, aber stets zuverlässige Clete Purcel, wieder in New Iberia war.
Er hatte seine Kühlbox auf einem Ködertisch am Ende des Bootsstegs abgestellt und nahm gerade mit einem langen, scharfen Messer, das kein Heft hatte, eine Reihe glitzernder, mit Eissplittern übersäter Sac-a-laits, Brassen und Breitmaul barsche aus. Er trug lediglich weite Shorts, Badelatschen und eine Dienstmütze der Marineinfanterie. Sein von der Sonne verbrannter Oberkörper war so dick eingeölt, dass die Haare an seinen mächtigen Armen und Schultern in goldenen Kringeln an der Haut klebten.
Ich parkte meinen Pick-up auf der Auffahrt zum Haus, überquerte die Straße und ging zum Bootsanleger, wo Clete jetzt seine Fische mit einem Esslöffel abschuppte, unter einem Wasserhahn wusch und sie auf eine frische Eisschicht in seiner Kühlbox legte.
„Sieht so aus, als hattest du einen recht guten Tag.“, sagte ich.
„Wenn ich mich bei dir duschen darf, nehm ich dich, Bootsie und Alafair mit nach Bon Creole.“ Er nahm eine mit Salz verkrustete Bierdose vom Geländer des Anlegestegs und betrachtete mich über den Rand hinweg, während er trank. Seine Haare waren von der Sonne gebleicht, die grünen Augen funkelten fröhlich, und quer durch die eine Braue zog sich eine Narbe bis über den Nasenrücken.
„Bist du bloß zum Angeln hier?“, fragte ich.
„Ich muss einen ganzen Haufen Kautionsflüchtlinge für Nig und Willie aufgreifen. Außerdem hat Nig womöglich die Kaution für einen Serienmörder gestellt.“
Ich war müde und hatte keine Lust, mir Cletes dauerndes Leid anzuhören, das er als Kopfgeldjäger für Nig Rosewater und Wee Willie Bimstine erdulden musste. Ich versuchte so aufmerksam wie möglich zu wirken, aber ich blickte immer wieder zum Haus, zu den Körben voller Springkraut, die unter dem Vordach über der Veranda im Wind schaukelten, zu Bootsie, meiner Frau, die die im Schatten liegenden Hortensienbeete jätete.
„Hörst du überhaupt zu?“, fragte Clete.
„Klar“, erwiderte ich.
„Dass wir die Sache mit diesem Serienkiller, beziehungsweise Sexgangster oder was immer er auch sein mag, überhaupt erfahren haben, war so. No Duh Dolowitz wird dabei erwischt, wie er in Sammy Figorellis Schönheitssalon einsteigen will, aber diesmal sagt Nig, er hat genug von No Duh und seinen schwachsinnigen Streichen, wie zum Beispiel, als er bei einem Kongress der Teamster die Sandwiches mit Hundefutter belegt hat oder sich als Chauffeur ausgegeben hat und mit der Fami lienlimousine der Caluccis weggefahren ist.
No Duh ruft also aus dem Zentralgefängnis an und sagt, Nig und Wee Willie wären Scheinheilige, weil sie die Kaution für ’nen Typ gestellt haben, der in Seattle und Portland zwei Nutten umgebracht hat.
Nig fragt No Duh, woher er das weiß, worauf No Duh sagt: ‚Weil ich vor ’nem Jahr in ’ner Zelle neben diesem perversen Sack gesessen hab, der sich lang und breit drüber ausgelassen hat, wie er die Bräute an Flussufern an der Westküste liegen gelassen hat. Außerdem hat sich dieser Perverse über zwei dumme Juden aus New Orleans ausgelassen, die ihm seinen falschen Namen abgekauft und Kaution für ihn gestellt haben, ohne seine Akte zu überprüfen.‘
Aber Nig hat Skrupel gekriegt und mag gar nicht dran denken, dass er womöglich einen Sexualstraftäter rausgeholt hat. Also lässt er mich sämtliche Drecksäcke durchgehen, für die er in den letzten zwei Jahren Kaution gestellt hat. Bislang hab ich 120, 130 Namen überprüft, aber ich bin noch auf keinen gestoßen, auf den die Beschreibung passt.“
„Wer glaubt denn irgendwas, was Dolowitz sagt? Einer der Giacanos hat ihm vor Jahren mit einem Rundhammer Dellen in den Schädel geschlagen“, sagte ich.
„Das isses ja. Mit seinem Hirn stimmt irgendwas nicht. No Duh ist ein Dieb, der niemals lügt. Deswegen sitzt er ja ständig.“
„Du willst uns nach Bon Creole mitnehmen?“, fragte ich.
„Hab ich doch gesagt, oder?“
„Ich hätte große Lust dazu“, sagte ich.
Doch ich sollte mich an diesem Abend nicht von dem Mord an Amanda Boudreau losreißen können. Ich hatte mich gerade geduscht und umgezogen und wartete auf der Veranda auf Clete, Bootsie und Alafair, als Perry LaSalles cremefarbene Gazelle, der Nachbau eines 1929er Mercedes, von der Straße in unsere Auffahrt einbog.
Bevor er aus dem Auto steigen konnte, ging ich ihm zwischen den Bäumen hindurch entgegen. Das Dach seines Wagens war heruntergeklappt, und seine von der Sonne gebräunte Haut wirkte im Schatten dunkel; die bräunlichen Haare waren vom Wind zerzaust, die Augen funkelten hellblau, und die Wangen waren gerötet.
Er hatte mit 21 das Studium an einer Jesuitenakademie abgebrochen, ohne dass er je einen Grund dafür angeben wollte. Er hatte unter Stadtstreichern an der Bowery gelebt und war durch den Westen gezogen, hatte auf Salat- und Rübenfeldern gearbeitet, war mit Obdachlosen und wandernden Obstpflückern in Güterwaggons gefahren, dann wie der verlorene Sohn zu seiner Familie zurückgekehrt und hatte an der Tulane University Jura studiert.
Ich mochte Perry, seine vornehme Art und die stets großmütige, offenherzige Haltung, mit der er auftrat. Er war ein stattlicher Mann, mindestens eins achtundachtzig, aber er war nie großspurig oder anmaßend, sondern immer freundlich zu denen, die weniger vom Glück begünstigt waren als er. Aber wie viele von uns hatte ich das Gefühl, dass Perrys Lebensgeschichte komplizierter war, als man aufgrund seiner Gutmütigkeit hätte meinen mögen.
„Auf Spritztour?“, fragte ich, wusste aber Bescheid.
„Ich habe gehört, dass Dampframmen-Shanahan meint, Sie wären zu lasch, was die Ermittlungen im Mordfall Amanda Boudreau angeht. Ich habe gehört, dass sie Ihnen Feuer unter den Cojones machen will“, sagte er.
„Ist mir neu“, erwiderte ich.
„Ihre Beweise taugen nichts, und das weiß sie.“
„Haben Sie in letzter Zeit einen guten Film gesehen?“, fragte ich.
„Tee Bobby ist unschuldig. Er war nicht mal am Tatort.“
„Seine Bierdose aber schon.“
„Umweltverschmutzung ist kein Schwerverbrechen.“
„War schön, Sie zu sehen, Perry.“
„Kommen Sie mal raus auf die Insel und probieren Sie meinen Fischteich aus. Bringen Sie Bootsie und Alafair mit. Wir essen alle zusammen.“
„Wird gemacht. Nach dem Prozess“, sagte ich.
Er zwinkerte mir zu, und fuhr die Straße runter und inmitten der Sonnenstrahlen davon, die durch die Bäume fielen und wie Goldmünzen auf dem frisch gewachsten Lack seines Autos tanzten.
Ich hörte, wie Clete hinter mir durch das dürre Laub auf mich zukam. Seine Haare waren nass und frisch gekämmt, die oberen Knöpfe seines Hemdes standen bis zur Brust offen.
„Ist das nicht der Typ, der das Buch über den Todestrakt in Angola geschrieben hat? Das, auf dem der Film basiert“, sagte er.
„Genau das ist er“, erwiderte ich.
Clete musterte meine Miene. „Hat dir das Buch etwa nicht gefallen?“, fragte er.
„Zwei Kids wurden bei einer beliebten Knutschecke oben an der Loreauville Road umgebracht. Perry hat die Staatsanwaltschaft in ein schlechtes Licht gerückt.“
„Warum?“
„Ich nehme an, manche Menschen müssen mit sich selbst zufrieden sein“, antwortete ich.
Am nächsten Morgen hing Nebel zwischen den Bäumen, als Alafair und ich die Böschung hinabliefen, den Köderladen öffneten, den Bootssteg abspritzten und den Grill anschürten, auf dem wir Würste, Hühnerteile und manchmal auch Schweinskoteletts für unsere Mittagsgäste brieten. Ich ging in den Lagerraum, schlitzte etliche Kartons voller Bier- und Sodadosen auf und verstaute sie in den Kühlboxen, während Alafair Kaffee kochte und den Tresen abwischte. Ich hörte, wie die kleine Glocke an der Fliegengittertür schellte und jemand in den Laden kam.
Es war ein junger Mann, der einen Strohhut trug, dessen Krempe zu beiden Seiten hochgerollt war, dazu ein hellblaues Sportsakko, einen breiten pflaumenblauen Schlips, eine graue Hose und auf Hochglanz gewienerte graubraune Cowboystiefel. Sein Haar war aschblond, kurzgeschnitten und im Nacken ausrasiert, die Haut tief gebräunt. Er trug einen Koffer, der so schwer war, dass ihm der Schweiß übers Gesicht rann und die Adern an seinen Handgelenken hervortraten.
„Wie geht’s, wie steht’s“, sagte er und setzte sich mit dem Rücken zu mir auf einen Barhocker am Tresen. „Könnte ich bitte ein Glas Wasser kriegen?“
Alafair ging jetzt in die Oberstufe der Highschool, sah aber älter aus, als sie tatsächlich war. Ihre Shorts spannten sich um Hintern und Schenkel, als sie sich auf die Zehenspitzen stellte und ein Glas vom Regal nahm. Doch der junge Mann wandte sich ab und blickte durch das Fliegengitter auf die Bäume auf der anderen Seite des Bayou.
„Wollen Sie Eis ins Glas?“, fragte sie.
„Nein, Ma’am. Ich wollte Ihnen keine Umstände machen. Ein Schluck aus der Leitung reicht“, erwiderte der junge Mann.
Sie füllte das Glas und stellte es vor ihn hin. Ihr Blick fiel auf den Koffer am Boden, der sich zu beiden Seiten ausbeulte und mit einem Ledergurt umschlungen war.
„Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?“, fragte sie.
Er zog eine Papierserviette aus dem Spender, faltete sie zusammen und tupfte sich den Schweiß von der Stirn. Er grinste sie an.
„Es gibt Tage, an denen glaube ich nicht, dass jemand wie ich Kuchen im Hades verkaufen sollte. Is in dem Haus da oben jemand daheim?“, fragte er.
„Was verkaufen Sie?“, fragte sie.
„Lexika, Bibeln, Illustrierte für die ganze Familie. Aber Bibeln verkauf ich am liebsten. Ich möchte Geistlicher oder Polizist werden. Ich hab drüben auf der Universität Kurse in Strafrecht belegt. Könnte ich vielleicht eine Pastete kriegen?“
Wieder reckte sie sich zum Regal hoch, und diesmal wanderte sein Blick über ihren Körper und verweilte auf ihren Oberschenkeln. Als ich aus dem Lagerraum trat, fuhr er herum und kniff die Augen zusammen.
„Möchten Sie ein Boot mieten?“, fragte ich.
„Nein, Sir. Ich wollte bloß eine kleine Pause machen. Ich heiße Marvin Oates. Genau genommen komm ich hier aus der Gegend“, sagte er.
„Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin Detective bei der Sheriff-Dienststelle des Iberia Parish.“
„Tja, ich nehm an, damit hat sich’s dann“, sagte er.
Ich konnte mich nur dunkel an ihn erinnern. Eine Festnahme vor vier, fünf Jahren wegen eines geplatzten Schecks, eine Empfehlung des Bewährungshelfers, dass man milde mit ihm umspringen sollte, worauf Barbara Shanahan die Gnade walten ließ, zu der sie gelegentlich fähig war, und ihn aufgrund der bereits verbüßten Strafe auf freien Fuß setzte.
„Auf Wiedersehen“, sagte ich.
„ Ja, Sir, ganz recht“, erwiderte er und legte den Kopf schief.
Er tippte sich vor Alafair an den Hut, packte seinen Koffer und ging schwerfällig, als schleppte er eine Ladung Ziegelsteine, aus der Tür.
„Wieso musst du nur so hart sein, Dave?“, fragte Alafair.
Ich wollte etwas erwidern, überlegte es mir dann anders, ging hinaus und legte die halben Hähnchen auf den Grill.
Marvin Oates blieb am Ende des Bootsstegs stehen, stellte den Koffer ab und kam auf mich zu. Nachdenklich blickte er auf einen Außenborder, der eine gelbe Schaumspur durch den Bayou zog.
„Is das Ihre Tochter, Sir?“, fragte er.
„ Jawohl.“
Er nickte. „Sie haben gesehen, dass ich mir ihre Figur angeschaut habe, als sie mir den Rücken zugekehrt hat. Aber sie sieht gut aus, und das Fleisch is schwach, jedenfalls isses bei mir so. Sie sind ihr Vater, und ich habe Sie beleidigt. Ich möchte mich dafür entschuldigen.“
Er wartete darauf, dass ich etwas sagte. Als ich ihn nach wie vor nur anschaute, legte er wieder den Kopf schief, ging zu sei nem Koffer, wuchtete ihn hoch, überquerte den Fahrweg und wollte die Auffahrt hinauflaufen.
„Falsches Haus, Partner“, rief ich.
Er lupfte den Hut zum Gruß, änderte die Richtung und machte sich auf den Weg zu meinem Nachbarn.
Am Montagmorgen rief ich an, bevor ich hinaus zur Insel der LaSalles fuhr, um Tee Bobbys Großmutter aufzusuchen. Als sie mich einließ, trug sie ein beiges Kleid und weiße, erst vor Kurzem polierte Schuhe und ihre Haare waren frisch gebürstet und hinten mit einem Kamm zusammengesteckt. Auf dem Boden ihres Wohnzimmers lagen kleine Teppiche, unter der Decke drehte sich ein Ventilator mit Holzblättern, und die Schonbezüge über den Polstermöbeln waren mit Blumenmustern bedruckt. Der Wind wehte von der Bucht und drückte die roten Blüten der Mimosen und Flamboyantbäume an die Fliegengitterfenster. Ladices Brust hob und senkte sich, während sie mich mit wachsamer Miene von der Couch aus anschaute und wartete.
„Tee Bobby hat kein Alibi. Zumindest keines, das er mir gegenüber angeben wollte“, sagte ich.
„Was is, wenn ich sage, dass er hier war, als das Mädchen umgekommen is?“, fragte sie.
„Ihre Nachbarn sagen, er war nicht da.“
„Weshalb behelligen Sie mich dann, Mr. Dave?“
„Die Leute hier in der Gegend sind wegen des Todes dieses Mädchens ziemlich aufgebracht. Tee Bobby ist die ideale Zielscheibe für ihren Zorn.“
„All das hat weit vor seiner Geburt angefangen. Der Junge kann überhaupt nix dafür.“
„Das müssen Sie mir erklären.“
Ich hörte, wie die Hintertür geöffnet wurde, und sah eine junge Frau durch die Küche gehen. Sie trug rosa Tennisschuhe und ein viel zu großes blaues Kleid, das wie ein Sack an ihr hing. Sie holte eine bereits offene Flasche Limonade, in deren Hals ein Papierstrohhalm steckte, aus dem Kühlschrank. Sie blieb in der Tür stehen und sog am Strohhalm, war Tee Bobby wie aus dem Gesicht geschnitten, aber ihre Miene war ausdruckslos, der Blick verwirrt, als ob ihr Gedanken durch den Kopf gingen, die vermutlich niemand je erraten konnte.
„Wir gehen gleich zum Doktor, Rosebud. Wart hinten auf der Veranda und komm nicht wieder rein, bis ich’s dir sage“, sagte Ladice. Die junge Frau schaute mir einen Moment lang in die Augen, zog dann den Strohhalm aus dem Mund, drehte sich um, ging aus der Hintertür und ließ sie zufallen.
„Sie sehn aus, als ob Sie irgendwas sagen wollen“, sagte Ladice.
„Was ist aus Tee Bobbys und Rosebuds Mutter geworden?“
„Is mit ’nem Weißen durchgebrannt, als sie 16 war. Hat die zwei ohne was zu essen in ihrem Bettchen liegen lassen.“
„Haben Sie das gemeint, als Sie sagten, Tee Bobby könnte nichts dafür.“
„Nein. Das hab ich überhaupt nicht gemeint.“
„Aha.“ Ich stand auf und wollte gehen. „Manche Leute sagen, der alte Julian wäre der Vater Ihrer Tochter gewesen.“
„Gehn Sie auch ins Haus einer weißen Frau und stellen ihr so eine Frage? Als würden Sie mit einem Stück Vieh reden?“, sagte sie.
„Ihr Enkel landet möglicherweise in der Todeszelle, Ladice. Perry LaSalle ist anscheinend der einzige Freund, den er hat. Vielleicht ist das gut. Vielleicht aber auch nicht. Danke, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben.“
Ich ging hinaus auf den Hof, in den Blumenduft und die von der Sonne aufgeheizte Luft, deren salziger Geruch auf einen Regenguss in Richtung des Golfs hindeutete. Auf der anderen Straßenseite, auf dem Rasen vor dem rußgeschwärzten Gemäuer, das einst Julian LaSalles Haus gewesen war, sah ich Pfauen. Ich hörte, wie Ladice hinter mir die Fliegengittertür öffnete.
„Was wollen Sie damit sagen, dass es nicht gut is, wenn Perry LaSalle der einzige Freund is, den Tee Bobby hat?“, fragte sie.
„Ein Mann, der von Schuldgefühlen getrieben wird, wendet sich irgendwann gegen die, wegen denen er sich schuldig fühlt. Aber das ist bloß eine persönliche Feststellung“, sagte ich.
Der Wind blies ihr eine Haarsträhne in die Stirn. Sie strich sie zurück und starrte mich lange an, ging dann wieder ins Haus und hakte die Fliegengittertür hinter sich ein.
Bei Sonnenuntergang half mir ein alter Schwarzer namens Batist dabei, den Laden zu schließen und unsere Mietboote an den Pfählen unter dem Bootssteg anzuketten. Blitze zuckten über dem Golf und in der Ferne hörte ich den Donner grollen, aber die Luft war trocken, die Bäume entlang der Straße waren mit Staub überzogen, und der beißende Qualm, der von ei nem abbrennenden Müllhaufen in der Nachbarschaft aufstieg, legte sich wie grauer Dunst über den Bayou.
Die schlimmste Dürre in der Geschichte von Louisiana ging nun schon ins dritte Jahr.
Ich spritzte das angetrocknete Fischblut und die Schuppen von den Planken, klappte dann die Cinzano-Schirme zusammen, die in den Kabelrollentischen auf dem Bootsanleger steckten, und ging in den Laden.
Vor ein paar Jahren hatte mir ein Freund den Nachbau einer klassischen Wurlitzer-Jukebox geschenkt, einen Musikautomaten mit einer Glaskuppel, um die rundum Lichter waberten, wie flüssige Bonbonmasse, die noch nicht in Form gegossen worden ist. Er hatte sie mit lauter 45er-Platten aus den fünfziger Jahren bestückt, und ich hatte sie seither nicht ausgetauscht. Ich warf einen mit rotem Nagellack bemalten Quarter ein und ließ Guitar Slims The Things That I Used to Do laufen.
Ich hatte noch nie einen Sänger gehört, in dessen Stimme so viel Traurigkeit lag. Ohne jedes Selbstmitleid sang er diesen Song, fand sich nur damit ab, dass ihm seine Frau, die er über alles auf der Welt liebt, untreu wird und nicht nur seine Liebesbezeugungen zurückweist, sondern sich überdies einem bösen Mann hingibt.
Guitar Slim war 32, als er am Alkohol starb.
„Das is ein alter Blues, nicht wahr?“, fragte Batist.
Batist war jetzt weit über 70, so unbeugsam und eigensinnig wie eh und je, die Haare rauchgrau, die Hände mit rosa Narben gesprenkelt, die er sich auf den Fischerbooten, auf denen er Zeit seines Lebens gearbeitet hatte, und beim Austernaufbrechen in einer der Konservenfabriken der LaSalles zugezogen hatte. Aber er war nach wie vor ein kräftiger, hoch gewachsener Mann, der fest auf sich vertraute, selbstbewusst war, was sein Können als Bootsführer und Fischer anging, und stolz darauf, dass seine sämtlichen Kinder die Highschool abgeschlossen hatten.
Er war zu einer Zeit groß geworden, als Farbige nicht mehr gezüchtigt und misshandelt, sondern eher als billige Arbeitskräfte benutzt wurden, die man wie selbstverständlich hinnahm, aber zugleich darauf achtete, dass sie ungebildet und arm blieben. Noch größeres Unrecht tat ihnen der weiße Mann vermutlich mit seiner Verlogenheit an, wenn sie ihre Ansprüche geltend machten. In diesem Fall behandelte man sie für gewöhnlich wie Kinder, gab ihnen allerlei Versprechen und Zusicherungen, die nie gehalten wurden, schickte sie fort und vermittelte ihnen das Gefühl, dass sie all ihre Schwierigkeiten nur sich selber zuzuschreiben hatten.
Aber ich hatte nie erlebt, dass sich Batist verbittert oder wütend über seine Jugendjahre äußerte. Allein aus diesem Grund hielt ich ihn für den vielleicht bemerkenswertesten Menschen, den ich je kennengelernt hatte.
Der Text und das glockengleiche Echo von Guitar Slims rollenden Akkorden ging mir unter die Haut. Ohne dass er auch nur mit einem Wort erwähnte, an welchem Ort und zu welcher Zeit er gelebt hatte, ließ er in seinem Song das Louisiana auferstehen, in dem ich aufgewachsen war – die endlosen Zuckerrohrfelder, die unter einem dunkel werdenden Himmel im Wind wogten, die unbefestigten gelben Fahrwege und die Reklameschilder für Hadacol und Jax-Bier, die an die Wände der Gemischtwarenläden genagelt waren, die von Pferden gezogenen Buggys, die während der Sonntagsmesse unter den Tupelobäumen standen, die aus Brettern zusammengezimmerten Tanzschuppen, in denen Gatemouth Brown, Smiley Lewis und Lloyd Price spielten, und die Bordellbezirke, die von Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung florierten und mit dem ersten Tageslicht irgendwie unsichtbar wurden.
„Denkst du über Tee Bobby Hulin nach?“, fragte Batist.
„Eigentlich nicht“, sagte ich.
„Der Junge hat eine üble Saat in sich, Dave.“
„ Julian LaSalles?“
„Ich sag, man soll das Böse auf dem Friedhof lassen.“
Eine halbe Stunde später schaltete ich draußen die Strahler und die über den Bootssteg gespannten Lichterketten aus. Ich schloss gerade die Ladentür ab, als ich drinnen das Telefon klingeln hörte. Ich wollte es bereits dabei bewenden lassen, ging aber doch wieder hinein, griff über den Tresen und nahm den Hörer ab.
„Dave?“, hörte ich die Stimme des Sheriffs.
„ Ja.“
„Sie sollten lieber rüber ins Gefängnis gehen. Tee Bobby hat sich grade aufgehängt.“
4
Als der Wärter an Tee Bobbys Zelle vorbeigegangen war und die Silhouette gesehen hatte, die in der Luft hing, hatte er die Zellentür aufgerissen, war mit einem Stuhl hineingestürmt, hatte einen Arm um Tee Bobbys Taille geschlungen und ihn hochgehoben, während er den Gürtel durchsäbelte, der um eine Rohrleitung an der Decke geschlungen war.
Nachdem er Tee Bobby wie einen Sack Mehl auf seiner Pritsche abgelegt hatte, brüllte er den Flur entlang: „Sucht den Hundesohn, der diesem Mann den Gürtel gelassen hat, als er ihn in eine Zelle gesteckt hat!“
Als ich Tee Bobby am nächsten Morgen im Iberia General aufsuchte, war er mit einer Hand an das Bettgeländer gekettet. Die Äderchen in seinen Augen waren geplatzt, und seine Zunge sah aus wie ein Stück Pappkarton. Er legte sich ein Kissen über den Kopf und zog die Knie bis zur Brust, wie ein Embryo. Ich nahm ihm das Kissen aus der Hand und warf es aufs Fußende des Bettes.
„Sie hätten sich genauso gut schuldig erklären können“, sagte ich.
„Was meinen Sie damit?“, fragte er.
„Versuchter Selbstmord in der Haft läuft aufs Gleiche raus wie ein Geständnis. Sie haben sich selber aufs Kreuz gelegt.“
„Das nächste Mal bring ich’s zu Ende.“
„Ihre Großmutter ist draußen. Ihre Schwester ebenfalls.“
„Was haben Sie vor, Robicheaux?“
„Nicht viel. Von Perry LaSalle einmal abgesehen, bin ich vermutlich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der Sie vor der Todesspritze retten möchte.“
„Meine Schwester hat nix damit zu tun. Lassen Sie sie in Ruhe. Sie verträgt keine Aufregung.“
„Ich überlasse Sie jetzt sich selber, Tee Bobby. Hoffentlich kann Perry ein paar mildernde Umstände für Sie geltend machen. Ich glaube nämlich, dass Barbara Shanahan Ihnen den Arsch aufreißen wird.“