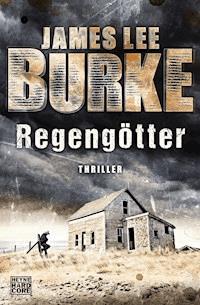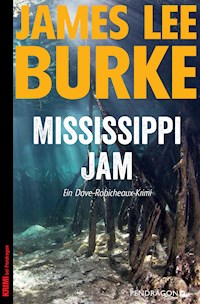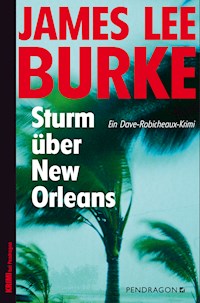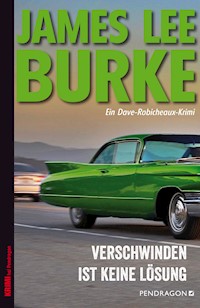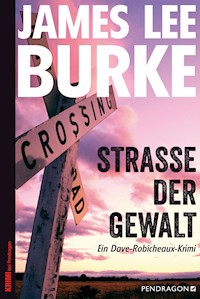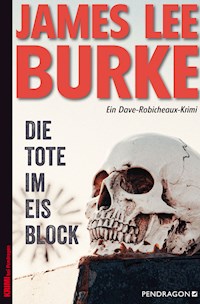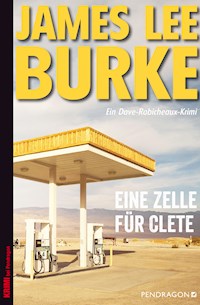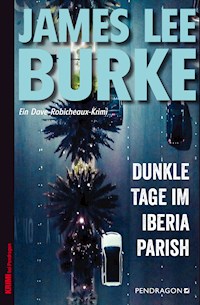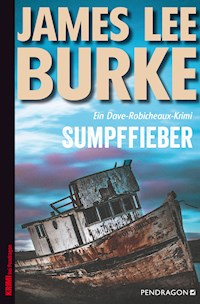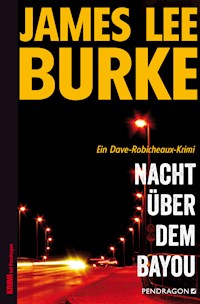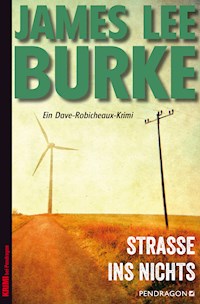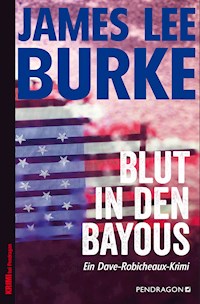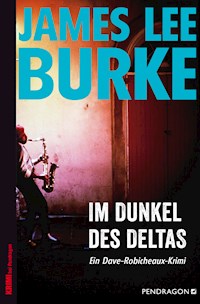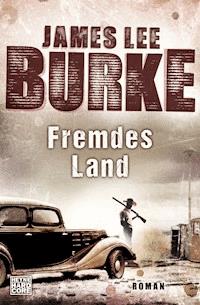
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Eine Ode an den großen amerikanischen Traum
Texas im Jahr 1934: Weldon Holland fristet in der ländlichen Ödnis ein perspektivloses Dasein. Einzig das Gangsterpärchen Bonnie und Clyde, das nach einem Bankraub auf dem Grundstück campiert, durchbricht die Monotonie. Zehn Jahre später überlebt Weldon als Leutnant nur knapp die Ardennenoffensive und rettet die jüdische Kriegsgefangene Rosita Lowenstein vor dem Tod. Zurück in Texas steigt er ins boomende Ölgeschäft ein, wo er bald in ein gefährliches Spiel aus Intrigen, Korruption und Machtstreben verwickelt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Ähnliche
Zum Buch
Texas, im Jahr 1934: Weldon Avery Holland fristet in der Ödnis von Texas ein perspektivenloses Dasein. Einzig das Gangsterpärchen Bonnie Parker und Clyde Barrow, das nach einem Bankraub auf dem Grundstück campiert, durchbricht die Monotonie.
Zehn Jahre später überlebt Lieutenant Weldon Holland nur knapp die Ardennenoffensive, in dessen Verlauf er nicht nur seinem Sergeant Hershel Pine das Leben rettet, sondern auch auf die jüdische Kriegsgefangene Rosita Lowenstein trifft, die er vor dem Tod bewahrt.
Nach Kriegsende kehren die drei gemeinsam nach Texas zurück, wo Weldon und Hershel sich mit einer technischen Erfindung im aufkommenden Ölgeschäft einen Namen machen. Doch ihre Glückssträhne hält nicht ewig, bald kommt es zu ersten Konfrontationen mit den Mächtigen der Industrie, darunter kaltblütige Männer, die alles tun, um ihren Willen durchzusetzen.
Zum Autor
James Lee Burke, 1936 in Louisiana geboren, wurde bereits Ende der Sechzigerjahre von der Literaturkritik als neue Stimme aus dem Süden gefeiert. Nach drei erfolgreichen Romanen wandte er sich Mitte der Achtzigerjahre dem Kriminalroman zu, in dem er die unvergleichliche Atmosphäre von New Orleans mit packenden Storys verband. Burke, der als einer der wenigen Autoren sogar zweimal mit dem Edgar-Allan-Poe-Preis für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet wurde, lebt abwechselnd in Missoula, Montana, und New Orleans.
Lieferbare Titel
Regengötter
Glut und Asche
James Lee Burke
Fremdes Land
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Ulrich Thiele
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel WAYFARING STRANGER bei Simon & Schuster, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Unter www.heyne-hardcore.de
finden Sie das komplette Hardcore-Programm,
den monatlichen Newsletter
sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter
www.facebook.com/heyne.hardcore
Copyright © 2015 by James Lee Burke
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-16290-0V001
www.heyne-hardcore.de
Im Gedenken an meinen geliebten Cousin
Weldon Benbow »Buddy« Mallette,
für immer am Sternenhimmel
Kapitel 1
Es war das Jahr, in dem sich keine Jahreszeit an ihre eigenen Regeln hielt. In der Wärme der Tage ließ sich die Luft ohne Taschentuch kaum atmen. In den kühlen, feuchten Nächten wurde das nasse Sackleinen, das wir vor die Fenster nagelten, steif von dem Sand, den der Wind in Wolken aus dem Westen herüber trieb, ein Brausen wie von scharrenden Eisenbahnrädern in der Prärie. Der Mond war orangefarben, manchmal auch braun, und groß wie ein Planet, wie man es zur Erntezeit gewohnt ist. Die Sonne war nie mehr als ein Schmutzfleck, gleich einer Glühbirne, die in der Fassung flackert, oder einem Streichholz, das inmitten seines eigenen Rauchs verbrennt. In besseren Zeiten hätte unsere Familie gemeinsam auf der Veranda gesessen, auf Korbstühlen oder im Schaukelstuhl, mit Gläsern voller Limonade und Schalen voller Pfirsicheis.
Mein Vater war auf Arbeitssuche bei einer Pipeline in Osttexas. Vielleicht würde er eines Tages zurückkehren, vielleicht nicht. Damals besaßen die Leute die Angewohnheit, eine Teerstraße hinunter zu wandern, eine flimmernde Hitzepfütze zu durchqueren und auf ewig zu verschwinden. Die Symptome des mentalen Verfalls, die meine Mutter zeigte, schrieb ich der Abwesenheit und den Alkoholproblemen meines Vaters zu. Mutter wetzte ihren Schlafzimmerteppich ab, indem sie unablässig im Kreis lief, während sie ihre Fingernägel in die Handballen grub und vor sich hin brabbelte, die Augen wässrig von Zuständen der Angst und Verwirrung, die niemand zerstreuen konnte. Kein normaler Mensch besuchte uns noch.
Als Gesetzeshüter hatte sich mein Großvater mit Kerlen wie Bill Dalton und John Wesley Hardin angelegt. Im Jahr 1916 hatte er mit einem Trupp auf eigene Faust handelnder Texas Ranger einem vollbesetzten Zug mit Pancho Villas Soldaten aufgelauert. Womit ich sagen will, dass Großvater sich nicht mit dem Studium komplexer psychischer Erkrankungen befasste. Das soll aber nicht heißen, er wäre ein bösartiger oder durch und durch liebloser Mann gewesen – bloß ein Mann, in dessen Denken eine Lücke zu klaffen schien. Seinen Kindern war er kein guter Vater gewesen. Aus Egoismus oder Unfähigkeit hatte er sie häufig ihrem Schicksal überlassen, selbst wenn sie dabei ins Straucheln geraten waren. Ich habe dieses offenkundige charakterliche Defizit meines Großvaters nie begriffen. Hin und wieder fragte ich mich, ob er wegen des Blutes, das er vergossen hatte, nicht mehr lieben konnte.
Er verbarg sich hinter Frivolität und Zynismus. Seiner Einschätzung nach waren sämtliche Politiker »irgendwo zwischen mittelmäßig und hundsmiserabel«. Seine erste Frau hatte »ein Gesicht, bei dem jeder Güterzug auf die Schotterstraße abgebogen wäre«. WPA stand nicht für Works Progress Administration, sondern für »Wir pfuschen alle«. Wäre er kein guter Christ gewesen, hätte er die Hilfsarbeiter gefeuert (inzwischen hatten wir keine mehr) und »stattdessen Faultiere angeheuert«. Der hiesige Bankier hatte eine dermaßen große Nase, weil die Luft gratis zu haben war. Doch wer war mein Großvater wirklich? Ich hatte keine Ahnung.
Die Sonne ging gerade unter, als ich durch das Fliegengitter der Hintertür blickte und beobachtete, wie ein schwarzes, staubverschmiertes, schuhkartonförmiges Automobil von der Straße in den Wald hinter unserem Haus abbog. Ein Mann mit Fedora und weißem Hemd ohne Krawatte stieg aus und urinierte vor die Frontscheinwerfer. Ich glaubte, Gelächter aus dem Inneren des Wagens zu hören. Während sich der Mann erleichterte, nahm er den Hut ab und kämmte sich das Haar. Gewelltes, kräftiges braunes Haar, schimmernd wie poliertes Walnussholz. Sein enggezurrter Hosenbund grub sich tief in die Rippen, seine Wangen sahen aus wie mit Ruß eingerieben – ein Anblick, der durchaus typisch war für Männer, die es während der ersten Amtszeit von Präsident Roosevelt hierhin und dorthin durch den amerikanischen Westen trieb.
»Sieht aus, als wären ein paar Leute vom Highway auf unsere Straße geraten«, sagte ich. »Jetzt pinkelt der Fahrer vor seine Scheinwerfer, und seine Mitfahrer scheinen ihre Freude daran zu haben.«
Großvater saß am Küchentisch vor einer aufgeschlagenen Enzyklopädie, die Lesebrille auf der Nase. »Er stellt sich absichtlich vor die Scheinwerfer, um Wasser zu lassen? Damit die anderen zuschauen können?«
»Zu seinen Denkvorgängen kann ich mich nicht mit Gewissheit äußern. Ich kann ihm nicht in den Kopf gucken.« Ich nahm das deutsche Fernglas, das mein Onkel aus den Schützengräben mitgebracht hatte, und stellte es auf den Wagen scharf. »Auf dem Beifahrersitz ist eine Frau. Ein zweiter Mann und eine weitere Frau hinten. Sie lassen eine Flasche kreisen.«
»Illegale?«, fragte Großvater.
Ich ließ das Fernglas sinken. »Ja, falls die Wets neuerdings mit viertürigen Wagen unterwegs sind.«
»Dein Humor erinnert mich an meine erste Frau. Ich hab sie nur ein einziges Mal lachen gehört – als ihr klar geworden ist, dass ich Gürtelrose kriege.«
Wieder richtete ich das Fernglas auf den Fahrer. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Währenddessen hörte ich, wie Großvater sich schwerfällig aus dem Stuhl hochstemmte. Er war knapp zwei Meter groß, und seine vom Bluthochdruck geschwollenen Knöchel ließen ihn schwanken, als stünde er an Bord eines Schiffes. Manchmal benutzte er einen Gehstock, manchmal nicht. An einigen Tagen schien er am Abgrund des Todes zu wanken, am nächsten Tag konnte ihn nichts davon abhalten, seinen alten Gewohnheiten drüben im Saloon nachzugehen. Seine Wangen waren gerötet vom Gin, seine Haut zart wie die eines Babys, und in seinen schmalen Augen glänzte das hellste Blau, das ich je gesehen hatte. Manchmal wollten seine Augen nicht zu seinem Gesicht oder seiner Stimme passen; manch einer konnte ihrem intensiven Leuchten nicht standhalten. »Gehen wir ’ne Runde, Ranzenarsch.«
»Kannst du dir bitte einen anderen Spitznamen für mich ausdenken?«
»Du hast nun mal einen Hintern wie ein Waschbottich.«
»Im Rückfenster des Wagens ist ein Einschussloch«, sagte ich, während ich einen weiteren Blick durch das Fernglas warf. »Und mein Hintern hat keine Ähnlichkeit mit einem Waschbottich. Könntest du gefälligst ein bisschen auf deinen Tonfall achten, Großvater?«
»Dicke Hintern und breite Hüften, das liegt bei den Hollands in der Familie. Solltest du dir merken, wirst schließlich auch mal älter. Das ist keine Beleidigung, das ist Vererbung. Oder würdest du eine Frau heiraten, die aussieht wie ein Sack irischer Kartoffeln?«
Großvater öffnete eine Küchenschublade und nahm einen Revolver im Halfter heraus. Der Pistolengürtel war um die Waffe gewickelt, in seinen Schlaufen steckten Messingprojektile. Das Metall des Revolvers sah stumpf und grau aus, wie ein altes Buffalo-Fünfcentstück. Er war vor langer Zeit auf Patronen umgerüstet worden, doch der Ladestock für das Schwarzpulver war noch vorhanden und mit einem funktionstüchtigen Scharnier unter dem Lauf angebracht. Oben an den Rändern war das Leder des Halfters gelblich glatt geschmirgelt, in die Unterkante des Revolvergriffs waren sechs winzige Kerben geritzt. Großvater schlang den Gürtel um die Schulter und setzte sich seinen Stetson auf. Die Hutkrempe war zerknittert, die Krone am Saum dunkelgrau gefleckt vom Schweiß. Großvater stieß die Fliegengittertür auf und trat hinaus ins schwindende Licht der Dämmerung.
Das Windrad arbeitete fieberhaft, seine Stützpfeiler vibrierten vor Energie, und aus der Tülle floss ein dünnes Rinnsal. Am Rand des Wassertanks klebte eine Kruste aus Dreck, toten Insekten und Tierhaaren. »Der Mond sieht aus wie in eine Teetasse getunkt«, sagte Großvater. »Nicht zu fassen, dass wir den Regen früher als gottgegeben hingenommen haben. Die Gegend muss verflucht sein.«
Die Luft roch nach Asche und Staub und Kreosotbüschen, nach Pferde- und Kuhdung, der in der Hand zu fedrigem Staub zerfallen würde. Trockenblitze zuckten durch den Himmel und erstarben, als würde man eine Öllampe aus dem Fenster eines abgedunkelten Hauses nehmen. Unter meinen Schuhen bebte es wie ein Donnergrollen in der Erde. »Spürst du das auch?«, fragte ich. Ein Versuch, Großvaters Stimmung und damit auch meine eigene zu heben.
»Mach dir keine Hoffnungen. Drüben rattert die Katy über die Schienen, das ist alles«, sagte er. »Tut mir leid, dass ich mich über deinen Hintern lustig gemacht habe, Ranz. Soll nicht wieder vorkommen. Bleib hinter mir, bis wir wissen, wer in dem Wagen sitzt.«
Als wir uns dem Waldrand näherten, verließ der Fahrer des Autos den Scheinwerferkegel und verharrte kurz als dunkle Silhouette vor dem grellen Licht, bevor er wieder einstieg, den Motor startete und scheppernd den Gang einlegte. Wann immer der Wind durch die staubtrockenen Bäume fuhr, raschelte das Blätterdach wie Papier.
»Einen Moment«, rief Großvater.
Ich dachte, der Mann würde einfach Gas geben, aber nein. Er schob den Ellbogen aus dem Seitenfenster und blickte uns direkt ins Gesicht, seine Miene eher neugierig als beunruhigt. »Reden Sie mit uns?«, fragte er.
»Sie befinden sich auf meinem Grundstück«, sagte Großvater.
»Ich dachte, das hier wäre ein öffentlicher Wald. Ist hier irgendwo ein Schild, auf dem was anderes steht? Ich hab keins gesehen.«
Neben ihm saß eine hübsche Frau mit rotblondem Haar und einer Baskenmütze, die schief über einem Auge hing. Sie sah aus wie ein fröhliches Mädchen vom Land, als arbeite sie im Kramladen oder in einem Café, wo die Fernfahrer auf einen harmlosen Schwatz vorbeikommen. Sie beugte sich vor und grinste Großvater von unten herauf an, während ihre Lippen stumme Worte formten: »Tut uns leid.«
»Sie haben Schlamm auf dem Nummernschild. Wussten Sie das?«, fragte Großvater den Fahrer.
»Da werde ich mich gleich drum kümmern«, antwortete dieser.
»Und in Ihrer Heckscheibe scheint mir ein Einschussloch zu sein.«
Der Fahrer griff in den Aschenbecher am Armaturenbrett und hielt eine Murmel ins Licht. »Hab ich auf der Rückbank gefunden. Wahrscheinlich ein Kind mit einer Steinschleuder. Oben auf der Eisenbahnbrücke hab ich einen Jungen gesehen, der hatte so ein Ding. Sind Sie hier der Sheriff?«
»Ich bin Rancher. Mein Name ist Hackberry Holland. Und Ihr Name wäre?«
»Smith«, sagte der Fahrer.
»Wohin geht die Reise, Mr. Smith? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.«
»Nach Lubbock. Oder irgendwo sonst, wo’s Arbeit gibt. Ich schraube an Autos rum, also hauptsächlich. Was ist das für eine Waffe? Eine Antiquität?«
»Ein .44er-Army-Colt. Muss meistens als Briefbeschwerer herhalten. Sie kennen sich also mit Autos aus?«
»Ja, Sir, kann man so sagen. Autos sind die Zukunft des Landes, wenn Sie mich fragen. Oder wenn Sie Henry Ford fragen.«
»An der Asphaltstraße müssen Sie links abbiegen, dann immer geradeaus nach Westen«, sagte Großvater. »Wenn Sie den Pazifik sehen, sind Sie schon vorbei an Lubbock.«
Der Mann auf der Rückbank kurbelte die Fensterscheibe herunter. Er war ein kurz gewachsener Kerl, der sicher keine sechzig Kilo auf die Waage brachte, mit Anzug und Krawatte und einem schmalkrempigen Hut, den er wie ein Dandy schräg in die Stirn gezogen trug. Er hatte ein längliches Gesicht – wie ein Pferd, das sein Maul aus der Box hängt – und das schiefe Grinsen eines dummen Menschen, der sich für außerordentlich intelligent hält. Sein Atem stank wie ein Fass verdorbenes Obst. »Ich heiße Raymond«, sagte er. »Das ist Miss Mary, meine Freundin. Ist uns eine Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen.«
Neben ihm saß eine Frau mit gespaltenem Kinn, breiter Stirn und einem kleinen, gemeinen irischen Mund; in der Mitte war ihr Gesicht eingesunken wie weiches Wachs. Sie zog an einer Zigarette und starrte in die Rauchschwaden.
»Bei meinem Viehgitter ist eine Stange hinüber«, sagte Großvater. »Nur damit Ihnen kein Reifen platzt, wenn Sie drüberfahren. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Whiskeyflasche da nicht zwischen meine Bäume werfen.«
»Ordnung ist das halbe Leben«, sagte Raymond.
Großvaters Hand legte sich auf die Unterkante des Seitenfensters. Ehe er etwas entgegnete, ließ er die Augen über Raymonds Gesicht wandern. »Der Mann, der einen tötet, reißt einem die Kehle raus, bevor man auch nur begreift, was Sache ist. Ich spreche nicht von mir selbst. Sondern von jemandem, dem Sie ein Stück die Straße runter begegnen könnten. Es gibt Kerle, die stellen sich später gerne als schlimmste Fehleinschätzung Ihres Lebens heraus.«
»Wir bitten um Entschuldigung, Sir«, sagte die Frau auf dem Beifahrersitz und lehnte sich quer über den Fahrer, um Großvater einen besseren Blick auf ihr Gesicht zu gewähren. Als ich ihr Lächeln sah, musste ich an eine Spieldose denken, die sich öffnet. »Wir wollten nicht stören. Ein wundervolles Fleckchen haben Sie hier, Sir. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sehr freundlich von Ihnen.«
»Ist ja nichts passiert«, meinte Großvater.
Ich wünschte, die Frau hätte auch ein paar Worte an mich gerichtet, doch ihr Blick ruhte nur auf Großvater.
Langsam gab der Fahrer Gas. Eine schimmernde Wolke braunen Staubes löste sich von der gewachsten Karosserie, und im Scheinwerferlicht zeichneten sich die Umrisse unserer Besucher ab. Am linken Kotflügel befand sich ein langer, silberheller Kratzer. Als der Wagen verschwunden war, spürte ich Großvaters Blick – als wollte er eine Fragestunde einlegen, um herauszufinden, wie dämlich ich in diesem Moment genau war. »Was sinnierst du da, Ranz?«
»Sie behandeln den Wagen nicht, wie es sich bei so einem Wagen gehört. Glaubst du, das sind Bankräuber?«
»Auf der Bank ist nichts mehr zu holen. Hast du das nicht mitgekriegt? Im Kramladen übrigens auch nicht, oder im Kaugummiautomaten an der Tankstelle. Bei allem, was heilig ist – wo lebst du eigentlich, Junge?«
Ich hob einen Stein auf, schleuderte ihn im hohen Bogen davon und hörte, wie er durch die Bäume rasselte. »Warum ziehst du immer alles ins Lächerliche, was ich sage?«
»Weil du die Welt zu ernst nimmst. Komm, lass uns schauen, was deine Mutter treibt. Ich hab heute Nachmittag Pfirsicheis gekauft. Das ist doch ihre Lieblingssorte.«
»Ich habe gehört, wie du mit dem Doktor telefoniert hast«, sagte ich. Plötzlich waren die Grillen in der Dunkelheit zu hören und das Pfeifen der Katy hinter dem Horizont. Staub verstopfte mir die Nasenlöcher und die Kehle. »Du willst sie zur Elektroschockbehandlung schicken. Stimmt doch, oder?«
»Das hat der Doktor ins Gespräch gebracht, ja.«
»Elektroschocks machen sie nur, wenn sie sonst keine Ideen mehr haben. Ich halte den Doktor für einen Ignoranten. Außerdem ist er dumm und verwechselt Bosheit mit Intelligenz.«
»Elektroschocks sind die modernste Behandlungsmethode für das Leiden deiner Mutter. Das hat der Doktor gesagt. Sie muss dafür ins Krankenhaus, und dort wird man sich ausgezeichnet um sie kümmern. Es könnte viel schlimmer sein. Anderen Leuten schieben sie eine Stahlsonde ins Gehirn.«
»Apropos kümmern. Ich frage mich, wieso sich kein Mensch um sie gekümmert hat, als sie klein war und sich ganz allein durchschlagen musste.«
»Dein Charakter entwickelt einen harten Zug, Weldon. Das liegt dir nicht. Wenn es so weitergeht, frisst er deine Jugend auf und raubt dir die Weisheit, die du mit dem Mannesalter erlangen solltest.«
Ich hasse dich, dachte ich.
»Ich hätte da mal eine Frage«, sagte Großvater.
»Was?«
»Hast du schon mal über die Vergebung der Sünden nachgedacht?«
»Du meinst, über die Vergebung deiner Sünden? Nein. Als hättest du jemals um Vergebung für irgendetwas gebeten. Ich kann mich an keine einzige Gelegenheit erinnern.«
»Ich meine, über Vergebung für uns alle.«
»Willst du wegen den Leuten im Wagen den Sheriff alarmieren?«
»Diese Leute gehen uns nichts an. Außer sie kommen zurück – dann sähe es anders aus.«
»Die Frau auf dem Beifahrersitz ist dir aufgefallen, was?«, sagte ich.
»So geht’s mir mit allen Frauen. So ist das Leben nun mal. Deswegen wettern die Prediger immer gegen den Sex. Aber der wird nicht so schnell von der Erde verschwinden.«
Großvaters kluge Reden waren mir zuwider. »Eine Fremde mit einem hübschen Lächeln ist dir das Licht der Welt, aber um die eigene Tochter scherst du dich einen feuchten Dreck.«
Augenblicklich bedauerte ich meine harten Worte. Großvater machte kehrt und ging voraus. Unter seiner Achsel schwang das Revolverhalfter vor und zurück, die Flügel des Windrads klapperten im Wind. Als wir ins Haus kamen, aß meine Mutter die Eiscreme, die Großvater gekauft hatte, aus der Packung und säuberte den Löffel mit ihrem Haar.
Einige Zeit zuvor, als die Episoden meiner Mutter anfingen, hatte sie uns von Träumen berichtet, an die sie sich zwar nicht erinnern konnte, die aber mit Sicherheit Informationen von immenser Wichtigkeit enthielten. Hinter ihren Augen sah man, wie sie ihre Gedanken durchharkte, als stünde sie kurz davor, die Quelle ihres großen Unglücks zu entdecken. In den Vormittagsstunden wirkte sie weder fröhlich noch traurig; der Vormittag, sagte sie, sei ein gelber Raum, in dem ab und zu ein sonniges Fenster leuchte. Doch ab drei Uhr nachmittags sank die Sonne unwiederbringlich gen Horizont, und in ihrem Kopf schien sich eine chemische Umwandlung zu vollziehen. Ein gequälter Ausdruck schlich sich in ihre Augen ein, die ständig zu der Pappelreihe am Rand der seitlichen Wiese zuckten wie zu einem Gespenst, das sie in den Schatten der Bäume locken wollte.
»Was ist mit dir, Emma Jean?«, hatte mein Vater gefragt, als es zum ersten Mal geschehen war.
»Hörst du sie nicht?«, hatte sie geantwortet.
»Wen soll ich hören?«
»Die Flüsterer. Sie sind drüben an der Gartenmauer.«
»Schau mich an. Ich bin’s, dein Mann. Der Mann, der dich liebt. Und im Garten ist niemand außer dir und mir und Weldon.«
Meine Mutter war verstummt, als glaubte sie nun erst recht, dass wir ihre Feinde wären. Sie begriff nicht, woher der giftige Dunst kam, der sie Nachmittag für Nachmittag empfing, wenn die Sonne zu einer roten Oblate in den aufsteigenden Staubwolken im Westen verblasste.
Nachdem Großvater und ich ins Haus zurückgekehrt waren, wusch ich Mutter oben im Bad das Haar und trocknete es mit dem elektrischen Ventilator, während ich die Strähnen von ihrem Nacken und ihren Augen hob. Als ich fertig war, stand Mutter von ihrem Stuhl auf, ließ den Bademantel vor dem Schrankspiegel zu Boden gleiten und starrte auf die abgeflachten Hüften hinter ihrer Unterhose. Sie fing an, sich eine Schnur um die Taille zu binden – wie schwarze Frauen, wenn sie verhindern wollten, dass ihre Unterhose unter den Kleidersaum rutschte.
»Mutter«, sagte ich, »ich bin hier.«
Meine Worte schienen nicht zu ihr durchzudringen. »Ich habe so stark abgenommen«, meinte sie. »Sieht das nicht eigenartig aus? Was denkst du? Waren die Leute im Auto wegen deinem Vater hier?«
»Was sollten sie wegen Vater wollen?«
»Vielleicht hat er Arbeit gefunden, und sie sollten uns Bescheid sagen.«
»Ich glaube, sie waren betrunken und haben sich verfahren.«
Ich ging ins Erdgeschoss, holte den einklappbaren Bridgetisch hinter dem Sofa hervor und baute unser Damebrett auf. Meine Mutter spielte liebend gern Dame – während der Partien lächelte sie, als könnte sie sich einen kurzen Urlaub von dem emotionalen Tief gönnen, das ihr Leben verschlang. In jüngeren Jahren hatte sie dunkelblondes Haar gehabt; jetzt war es braun mit grauen Strähnen. Sie nahm noch immer ihr tägliches Bad, doch sie schminkte sich nicht mehr, schnitt sich nicht mehr die Fingernägel. Ich war überzeugt, dass ich meine Mutter fortbringen musste, fort von diesem Haus und von den Ärzten, die vorhatten, Tausende ihrer Gehirnzellen abzutöten. Sonst würde sie eines Tages wie ein Gemüse in der staatlichen Irrenanstalt von Wichita Falls vor sich hin vegetieren.
»Mutter«, sagte ich. »Wie wäre es, wenn wir beide hier weggehen würden? Wenn wir zu zweit losziehen würden?«
»Aber wohin sollen wir?« Sie blickte auf die roten und schwarzen Quadrate des Damebretts.
»Wir könnten nach Galveston oder Brownsville gehen. Da ist die Luft frisch und voller Salz von den Wellen, die sich am Strand brechen. Da gibt es keinen Staub. Ich könnte mir eine Arbeit suchen.«
»Bald kommt jemand und bringt mich hier weg, oder?«
Durch die Küchentür sah ich Großvater in seiner Enzyklopädie lesen. Er las jeden Tag darin, einen Band nach dem anderen. Hinter ihm, draußen im Dunkeln, blitzten die Glühwürmchen zwischen den Bäumen wie Funken, die von einem Schwedenfeuer aufsteigen. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. »Wir müssen uns wehren, Mutter«, sagte ich. »Die Ärzte sind nicht unsere Freunde. Man sollte ihnen selber Gummiknebel in den Mund stecken und ihre eigenen Apparaturen gegen sie aufhetzen.«
Mutter starrte auf ihre Hände, die Handballen gesprenkelt von den Halbmonden frischer Nagelabdrücke. »Ich weiß nicht, warum ich mir immer so wehtue oder woher diese ganzen Gedanken kommen. Ich fühle mich unrein vor den Augen meines Schöpfers. Irgendetwas wird geschehen, schon bald. Es hat mit den Leuten im Auto zu tun. Die waren schon mal hier. Ich hab sie vom oberen Fenster aus gesehen. Sie haben sich drüben zwischen den Bäumen entkleidet.«
Zu dieser Zeit wusste ich bereits, dass Mutter ganz und gar verrückt war. Doch als sie unsere Besucher erwähnte, musste ich erneut an den Fahrer denken – an sein raues, attraktives Gesicht, sein kräftiges, walnussbraunes Haar und an die abgebrühte Lässigkeit, mit der er Großvater begegnete. Das war kein einfacher Automechaniker, so sehr er es uns auch glauben machen wollte. »Bin gleich wieder da«, sagte ich zu Mutter.
Ich durchforstete den Stapel alter Magazine, der in dem Holzgestell am Ende des Sofas steckte, und blätterte in einem True Detective-Heftaus dem Jahr 1933, bis ich auf das Foto eines gut aussehenden Mannes mit Fedora stieß, der unnachgiebig wie ein Stück Kesselblech in die Kamera blickte.
Mit dem Magazin in der Hand ging ich zu Großvater. »Kommt dir der Kerl bekannt vor?«
»Nein«, antwortete Großvater.
»Du hast nicht mal hingesehen. Das ist der Mann, mit dem du vorhin deine kleine Auseinandersetzung hattest.«
»Ich soll mit Pretty Boy Floyd geplaudert haben? Das hätte ich mitgekriegt.«
»Die gleichen Augen, das gleiche Kinn, der gleiche Mund, der gleiche Blick«, erwiderte ich. »Ein richtig schwerer Junge.«
»Da wäre nur ein Problem – Floyd wurde letztes Jahr auf einer Farm in Ohio getötet. Bevor die Bundespolizei ihm den Garaus gemacht hat, soll er gesagt haben: ›Nur zu, Jungs. Ist wohl nicht mein Tag heute.‹«
Wieder war Großvater mir einen Schritt voraus gewesen. Er schloss die Enzyklopädie und nahm die Brille ab. »Ich hab euch zwei im Wohnzimmer reden gehört. In der Obhut der Behörden ist deine Mutter besser aufgehoben. Also setz ihr keinen Floh ins Ohr. Damit tust du ihr keinen Gefallen.«
»Dich sollten sie in die Anstalt bringen, nicht sie«, entgegnete ich.
In diesem Ton hatte ich noch nie mit Großvater gesprochen. Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer brannte mein Nacken wie Feuer, und meine Augen wurden feucht, sodass ich Mutter nur noch verschwommen wahrnahm, wie ein Knäuel aus Haut und Haaren in einem Gefäß voller Chemikalien. In meiner Abwesenheit hatte sie zwei ihrer Steine unerlaubterweise zur Dame befördert. Ein Spielzug, der ihr offenbar große Befriedigung verschaffte.
Unverhofft schlug das Wetter um – es wurde heiß. Nachts fiel der Strom aus, was unsere beiden Ventilatoren zum Stillstand brachte, und nur eine Stunde später knirschte das Haus vor Hitze. Um sechs Uhr morgens stieg eine zornesrote, staubverschleierte Sonne auf. Allein die Vorstellung, in dem überheizten Holzrahmenhaus am Holzofen zu stehen und das Frühstück zuzubereiten, hätte jedem den Appetit verdorben, und noch ärgerlicher war, dass ich es für meinen griesgrämigen Großvater zubereiten musste. Doch Pflicht geht schließlich vor Laune, und so stocherte ich Anmachholz und Zeitungspapier durch das Kochfeld in die Brennkammer, entzündete es und stellte die Kaffeekanne auf die Platte. Dann ging ich vor die Tür, in der verzweifelten Hoffnung, am Himmel eine Wolke zu entdecken, die nicht halb Westtexas, sondern etwas Wasser mitbrachte.
Ich folgte den gewundenen Spuren des viertürigen Automobils durch die Bäume, über eine Anhöhe hinweg und durch eine Rinne, in der sich das Laub zu Buckeln häufte. Ich fühlte mich, als würde ich der Fährte eines Mastodons oder einer Kreatur aus uralten Sagenwelten nachspüren. Dass die Leute im Wagen höchstwahrscheinlich kriminell waren, kümmerte mich nicht. Für mich verkörperten der Fahrer und die Frau mit dem Spieldosenlächeln nicht nur die weite Welt, sondern auch eine Auflehnung gegen die Konvention. Diese Menschen nahmen ihr Schicksal nicht einfach hin. Sie hatten sich entschlossen, es zu ändern. Früher hatte ich das zweigeschossige Giebelhaus, in dem ich zur Welt gekommen war, als Symbol der verarmten Oberschicht empfunden; nun erschien es mir als Institutionalisierung eines rückwärtsgewandten Denkens, der Grausamkeit im Mantel der Liebe. Als ein Ort, wo man sich der erbarmungslosen Sonne und den Silobesitzern ergab, die den Leuten bei Zwangsversteigerungen ihr Land stahlen, für fünfzig Cent je Morgen, weil all das schlicht zur Lebensart gehörte.
Großvater meinte, die berüchtigten Banditen unserer Tage seien lediglich entrechtete Farmersleute, kaum mehr als windige Diebe, die J. Edgar Hoover zu Staatsfeinden stilisierte, um sein neu gegründetes Bureau voranzubringen. Ich fragte mich, ob Großvater auch Baby Face Nelson als glorifizierten Farmersburschen bezeichnet hätte.
Da sah ich die Whiskeyflasche, aus der Raymond getrunken hatte. Sie lag zertrümmert neben einem Stein. Großvater hatte ihn gebeten, die Flasche nicht aus dem Fenster zu werfen. Doch wenn man einen Mann wie Raymond aufforderte, nicht am Eiswürfelbehälter zu lecken oder sich beim Auftanken seines Wagens lieber keine Zigarette anzustecken, konnte man mit Sicherheit davon ausgehen, dass er schon bald unter einem Sprachfehler leiden oder mit versengtem Haar und dem Teint eines angebrannten Würstchens herumlaufen würde.
Und ich entdeckte nicht nur die Whiskeyflasche. Jenseits der Anhöhe, unten beim Flussbett, befand sich ein voll ausgestattetes Nachtlager: ein Unterstand, eine Feuerstelle mit Steinumrandung, ein paar angespitzte Stöcke, an denen Fleisch gegrillt worden war. Reifenspuren führten in die Bäume und wieder heraus. Offenbar hatten unsere Besucher hier nicht nur längere Zeit verbracht – wahrscheinlich hatten sie auch ihre Ausscheidungen in unserer Erde verscharrt, im Unterstand Geschlechtsverkehr gehabt, sich mit Wasser aus der Feldflasche rasiert und die Zähne geputzt und das Wasser auf den Boden gespuckt. Sie hatten ihr Leben mit dem unseren verschmolzen, ohne uns um Erlaubnis zu fragen.
Was waren das für Menschen? Und vor allem: Wer war die Frau auf dem Beifahrersitz? Ich hockte mich auf die Anhöhe und starrte durch die Bäume auf unser Haus. An der westlichen Wand hatte der Wind den Staub beinahe bis zur Höhe des Esszimmerfensters getürmt. Oben im Norden von Texas, im Panhandle, schichtete sich der Staub schon zu Bergen auf, die bis an die Flügel eines Windrades reichten. Stand uns das gleiche Schicksal bevor? Würden sie meine Mutter abholen, um sie später wieder bei uns abzuliefern, dann mit dem leblosen Gesichtsausdruck einer Stoffpuppe?
Ich ertrug meine eigenen Gedanken nicht.
Am Flussufer, mitten im Lager unserer Besucher, legte ich mich auf den Boden und schloss die Augen. Ich glaube, ich nickte ein und träumte von der rotblonden Frau mit der schief sitzenden Baskenmütze. Im Traum lächelte sie mich an, ihr Mund war zart und feucht wie eine Rosenblüte, die sich bei Sonnenaufgang öffnet. Ich hätte schwören können, ein klingelndes Windspiel in den Bäumen zu hören. Wie hieß die Frau? Wie wäre es, mit ihr davonzulaufen? Aber in erster Linie fragte ich mich, wie es wäre, meine Lippen auf ihre Lippen zu setzen. Einen Moment lang spürte ich, wie eine kühle Brise durch die Welt strich – alles war wieder grün und jung. In meiner Vorstellung hingen die Zweige der Weiden voller Blätter, die sich hoben und senkten wie Frauenhaar, und in der Luft schwebte der Duft fernen Regens und frisch aufgeschnittener Wassermelone.
Sechs Tage später hielt ein weißer Krankenwagen vor unserem Haus, ein Arzt und eine Krankenschwester mit der finsteren Miene einer Gefängniswärterin stiegen aus. Ohne große Worte kamen sie herein, verabreichten meiner Mutter ein Betäubungsmittel und brachten sie in die Psychiatrie des Jeff Davis Hospital in Houston. Der nächste Halt, so mein Verdacht, sollte Wichita Falls sein, wo man meiner Mutter endgültig die Lichter ausblasen würde.
Ich sprach kein Wort mehr mit Großvater, außer die Situation brachte es unweigerlich mit sich. Ich besuchte die Schule, erledigte meine Hausaufgaben und meine häuslichen Pflichten. Aber ich vermied es, ihm körperlich nahe zu sein. Ich ertrug es nicht, ihm ins Gesicht zu blicken, so groß war meine Verbitterung, und so sehr schämte ich mich für das, was er getan hatte. Doch unglücklicherweise war es ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, ihm abzunehmen, was er nicht mehr selbst erledigen konnte. Seine Knöchel und die Oberseiten seiner Füße waren rötlich-violett angelaufen, und seine Haut war straff gespannt, als wollte sie jeden Moment zerreißen. Ich hegte den Verdacht, dass er unter Diabetes litt und beschlossen hatte, der Krankheit ihren Lauf zu lassen, auch wenn er dadurch erblinden, die Beine verlieren oder im Grab landen würde. Dieselbe selbstzerstörerische Unvernunft hatte einen Großteil seiner Zeit auf Erden geprägt.
Für meine Begriffe war Großvater zum Verräter geworden oder hatte sich zumindest als derjenige entpuppt, der er schon immer gewesen war: als ein selbstsüchtiger, gefühlloser, brutaler Mann, der sich seine Dienstmarke zunutze gemacht hatte, um seinen zahlreichen niederen Gelüsten nachzugeben. Es kursierten legendäre Geschichten über Großvaters Eskapaden als Frauenheld, Trinker und Spieler, und ebenso legendär waren die Männer, die durch seine Revolver gestorben waren. Der Hebron Baptist Church war er erst beigetreten, als die Kohlen seiner Gier zu Asche zerfallen waren.
Zehn Tage waren vergangen, seit der Krankenwagen meine Mutter fortgeschafft hatte. »Der Doktor hat gesagt, ohne Behandlung hätte sie sich wahrscheinlich umgebracht«, meinte Großvater, während er am Küchentisch sitzend zusah, wie ich das Geschirr abräumte. »Deswegen habe ich irgendwann eingewilligt. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, Ranz.«
»Nenn mich nicht so. Nie wieder.«
»In Ordnung, Weldon.«
»Der Doktor ist ein beschissener Lügner.«
»Du verfällst in eine Persönlichkeit, die dir nicht entspricht«, sagte Großvater. »Vielleicht ist das verständlich, wenn man bedenkt, was in deiner Familie passiert ist, aber es wird dir noch verdammt viel Kummer bereiten. Sei der Mann, der du nun mal bist. Selbst wenn nicht viel dabei herumkommt.«
Es war wirklich erstaunlich, wie viele Beleidigungen Großvater in so wenigen Worten unterbringen konnte. Ich drehte am Eisenhebel des Wasserhahns, aber mehr als ein rostig-braunes, nach Schlamm stinkendes Tröpfeln kam nicht heraus. Auf dem Hof wirbelte das Laub im Kreis und klickerte über die Wände und Fliegengitter wie vertrocknete Heuschrecken. Ich konnte beinahe spüren, wie das Barometer absackte. Als müssten wir uns auf einen weiteren gewaltigen Sturm gefasst machen, der vielleicht endlich Regen und Donner in sich trug und Blitze, die den Himmel in Stücke schneiden würden. »Ich glaube, ich gehe hier weg«, sagte ich.
Schweigen.
»Ich hab gehört, die Leute, die zur Obsternte nach Kalifornien gegangen sind, sind schon wieder heimgekehrt«, meinte Großvater dann. »Vielleicht ist es besser, bei den eigenen Leuten zu verhungern als in einem von Hoovers Armenvierteln. Wir haben ein schönes Haus. Viele andere haben gar keins.«
Ich wandte mich von der Spüle ab. Großvaters blassblaue Augen fixierten mich, und in seinem Blick sah ich keine Schuldzuweisungen, keine Absicht, mich zu kontrollieren oder herabzusetzen. Es war ein ungewöhnlicher Moment, der mich bezweifeln ließ, ob ich ihn zuletzt fair behandelt hatte.
»Ich glaube, ich gehöre nicht mehr hierhin«, sagte ich.
»Was war dein Nachname, als du heute früh aufgewacht bist? Holland, oder? Man muss nur zusammenhalten, dann kommt man immer durch.«
»Es ist nicht mehr wie früher, Großvater.«
Seine Augen drifteten ab. »Heute Nachmittag habe ich dreißig Morgen Land verkauft. Ich dachte, du hast ein Recht, es zu erfahren. Es gehört schließlich zu deinem Erbe.«
»An wen hast du verkauft?«
»An einen Mann aus Dallas. Er wollte es für fünf Dollar pro Morgen. Ich habe ihn auf sechs fünfzig hochgehandelt.«
Die Mathematik des Raubkaufs von Ländereien war mir bereits vertraut, und ich wusste, dass Großvaters mangelndes Geschick im Umgang mit Geld und sein fehlendes Gespür fürs Feilschen weithin bekannt waren. Deshalb wusste ich auch, dass er mir nur die halbe Wahrheit gesagt hatte. »Du hast ihm die Förderrechte abgetreten, oder?«
»Da unten ist doch nur derselbe Dreck wie hier oben.«
»Und was will dann ein Mann aus Dallas damit?«
»Vielleicht will er hier einen Golfplatz bauen? Woher soll ich das wissen? Hilf mir mal hoch.«
Ich zog ihn am Arm nach oben und schloss seine rechte Hand um den Griff seines Gehstocks. Aus seinem Hemd schlug mir der Geruch saurer Milch entgegen. Großvater hatte an diesem Tag nicht gebadet. »Ich bringe dich rauf«, sagte ich.
»Geh meinen Revolver holen.«
»Was willst du damit?«
»Heute gab’s einen versuchten Überfall auf die Bank in San Angelo. Im Fluchtfahrzeug saß mindestens eine Frau. Könnte sein, dass unsere Besucher doch nicht auf dem Weg nach Lubbock sind.«
»Vielleicht war’s Ma Barker.«
»Ich hab das Gefühl, das Mädchen mit der Baskenmütze hat deine Männlichkeit wachgeküsst«, meinte Großvater. »Ich kann’s dir nicht verdenken. Es gibt kein größeres Geschenk als eine schöne Frau am Morgen. Oder wenn doch, hat’s mir kein Schwein verraten.«
In dieser Nacht hörte ich ein Auto im Wald. Ich ging die Treppe hinunter, entriegelte die Hintertür und trat auf die Veranda. Kühle Luft, ein Stückchen heller Mond hinter dem Rand einer Wolke, keinerlei Staub am Himmel. Durch die Baumstämme sah ich ein weißes Leuchten, das gleich wieder verschwand wie der Schein einer ausgeblasenen Kerze. Bei Tagesanbruch entfachte ich zuerst das Feuer im Holzofen und setzte Wasser auf; dann ging ich zum Schrank, griff mir Großvaters doppelläufige Schrotflinte und lief damit durch den Wald zum Flussufer. Das Flussbett war so gut wie ausgetrocknet, die Böschung fiel knapp zwei Meter tief senkrecht ab, und der sandige Grund war gepunktet von den Spuren kleiner Tiere und durchwirkt von Rinnsalen, die in der aufgehenden Sonne rötlich glitzerten. Ich hatte schon mindestens eine halbe Meile zurückgelegt, als ich unter einer Virginia-Eiche einen viertürigen Chevrolet entdeckte. Es war ein Confederate, ein Modell aus dem Jahr 1932 mit Drahtspeichenrädern und Weißwandreifen, weinrot lackiert mit schwarzem Dach, schwarzen Kotflügeln und gepolsterten Sitzbänken aus rotem Leder. Über dem Trittbrett war ein Ersatzreifen befestigt. Es war der eleganteste Wagen, den ich je gesehen hatte.
Die Rückbank war herausgerissen worden und stand nun am Baumstamm. Ein Mann mit Armschlinge lehnte dagegen, ein anderer werkelte unter dem Auto. Nur seine Beine ragten ins Laub, während er auf irgendetwas Metallisches einhämmerte.
Die Frau mit dem rotblonden Haar kümmerte sich um den Verletzten; diesmal trug sie keine Baskenmütze. Die zweite Frau aß ein Sandwich mit Wiener Würstchen. »Raymond«, sagte sie. »Da ist ein Bengel mit einer Schrotflinte.«
Der Mann mit dem verwundeten Arm – der, den ich für Pretty Boy Floyd gehalten hatte – zwinkerte mir zu. »Geht schon in Ordnung«, erwiderte er. Dabei blickte er mich an, sprach aber offensichtlich mit Raymond, der jetzt unter dem Wagen hervorgekrochen kam. »Der passt nur auf sein Grundstück auf. Wo steckt dein Großvater, Junge?«
»Wie kommen Sie darauf, dass er mein Großvater ist?«
»Du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten.« Er deutete auf den eingebrochenen Drahtzaun hinter meinem Rücken. »Das ist eure Grundstücksgrenze, was?«
»War es mal. Wir haben gerade ein paar Morgen verkauft. Die Waffe, die da neben Ihnen liegt – ist das eine Browning Automatic Rifle?«
»So heißt das Ding also? Ich hab’s in einem verlassenen Haus aufgestöbert«, antwortete er. »Übrigens, habt ihr Leute eigentlich ein Telefon?«
»Nein, Sir.«
»Wir hatten nämlich einen Unfall, ich brauche vielleicht einen Arzt. Und ich dachte, ich hätte eine Leitung gesehen, die zu eurem Haus führt. Das ist doch euer Haus? Das Giebelhaus?«
»Wir konnten uns die Telefonrechnung nicht mehr leisten.«
Raymond, der nun neben dem Wagen stand, klopfte sich mit einer Hand die Kleidung ab. In der anderen Hand hielt er einen Ingenieurhammer. »Ich hab die Lenkstange ins Lot gebracht, aber sie wird noch ein bisschen schlenkern. Was willst du mit der Schrotflinte, Junge? Was wird das hier?«
»Ich wollte Stinktiere schießen. Die kommen dauernd zum Haus«, sagte ich. »Da bin ich sehr gut drin.«
»Weißt du, wer wir sind?«, fragte der Verletzte.
»Ein paar Leute, die in vornehmen Autos unterwegs sind, aber lieber im Wald schlafen als im Motel?«
Raymond grinste und trat näher an mich heran. Das Laub knirschte unter seinen Schuhen. Sein Hemd hatte er ausgezogen und über den Seitenspiegel gelegt. Er trug nur noch ein Unterhemd mit dünnen Trägern, dessen Saum über seine Hose hing. Er hatte weiße, knochige, von Pickeln getüpfelte Schultern. Ich roch die Pomade in seinem Haar. »Du hast sicher schon mal davon gehört, dass sich irgendwer aus dem Knast rausgeballert hat, oder?«
»Ja, Sir.«
»Aber hast du schon mal davon gehört, dass sich wer in den Knast reingeballert hat?«
»Das wäre mir neu.«
»Aber ansonsten kennst du dich hervorragend aus, wie?«
»Sie haben mich gefragt.«
»Du hast keine Ahnung, wen du hier vor dir hast.« Raymond reckte das Kinn empor, ein Funkeln im Auge. »Wir haben Geschichte geschrieben!«
»Raymond ist ein Spaßvogel«, sagte der Verletzte. »Wir sind ganz normale, hart arbeitende Leute. Den Wagen da habe ich für einen Kunden repariert. Hast du Lust, eine Runde zu drehen? Aber natürlich hast du Lust!«
»Sie sind also in ein Gefängnis eingebrochen?«, fragte ich.
»Hab dich nur auf den Arm genommen«, erwiderte Raymond.
»Ich hab’s in der Zeitung gelesen«, sagte ich. »Der Überfall auf das Gefängnis von Eastham. Da wurde ein Wachmann getötet.«
»Vielleicht solltest du dich lieber um deinen eigenen Kram kümmern«, meinte die Frau, die das Sandwich aß.
Bis auf den Wind in den Bäumen war es vollkommen still. Ich fühlte mich, als stünde ich in einer Schwarz-Weiß-Fotografie, deren Motiv sich binnen Sekunden zum Schlechten hin verändern konnte. Aber das war mir egal. »Könnten Sie dann auch in eine Irrenanstalt einbrechen?«
»Warum sollten wir?«, fragte Raymond.
»Um jemanden rauszuholen. Jemanden, der da nicht reingehört.«
Die Frau mit dem rotblonden Haar nahm eine Bürste aus der Handtasche und strich sich damit über den Hinterkopf. »Jemanden aus deiner Familie?«
»Meine Mutter.«
»Deine Mutter wurde eingewiesen?«
»Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber sie haben sie abgeholt.«
Die Frau legte den Kopf schief und bürstete sich das Haar. »Wenn man etwas sowieso nicht ändern kann, sollte man sich deswegen auch nicht das Hirn zermartern. Vielleicht kommt deine Ma schon bald wieder putzmunter nach Hause. Und man sollte auch keine Waffe mit sich rumtragen, wenn man nicht bereit ist, den Abzug zu drücken.«
»Um meine Mutter zu befreien, würde ich den Abzug drücken. Jederzeit.«
Der Verletzte lachte. »Mach nur so weiter, dann darfst du später für den Staat Baumwolle pflücken. Denkst du, du könntest vielleicht einfach wieder vergessen, was du hier gesehen hast? Wenn ich ganz lieb Bitte sage?«
»Die wollen ihr Stromstöße verpassen. Vielleicht haben sie schon damit angefangen«, sagte ich. »Finden Sie das gerecht? Sie hat niemandem was getan, und jetzt wird sie schlechter behandelt als jeder Verbrecher, der das Schlimmste verdient hätte.«
Laub fiel von der Eiche und flatterte kreiselnd zu Boden wie Insektenflügel ohne Körper. Die Blätter waren gelb, vom Pilzbefall gefleckt, und ihr Anblick erinnerte mich an Käfer, die in dunklem Wasser versinken.
Die Frau mit dem Sandwich kehrte mir den Rücken zu und sagte etwas zu dem Verletzten. Es dauerte einige Sekunden, bis ich ihre Worte erfasst hatte, aber dann gab es keinen Zweifel mehr: Er darf uns nicht entwischen.
»Mary, könntest du mir eine kleine Erfrischung aus der Kühlbox bringen?«, sagte die Frau mit dem rotblonden Haar. »Ich will mich kurz mit unserem jungen Freund unterhalten.«
»Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, Bonnie«, entgegnete Mary. »Es ist immer dasselbe. Du bist lieb und nett, und wir anderen müssen es ausbaden.«
»Ganz unten müsste noch eine eiskalte Coca-Cola liegen«, meinte Bonnie. »Ich bin durstig wie noch nie. Also wenn du die Freundlichkeit hättest, wäre ich dir wirklich sehr verbunden.«
Bonnie fasste mich am Arm und führte mich am Flussufer entlang Richtung Haus, ohne noch einen Blick über die Schulter zu werfen oder auch nur Marys Antwort abzuwarten, als wäre die Diskussion beendet. Sie trug ein weißes Baumwollkleid mit rosa-grauem Blumendruck und einer Spitzenborte am Saum, die bei jedem Schritt über ihre Waden wischte. »Du hörst mir jetzt ganz genau zu«, sprach sie dicht an meinem Ohr. »Du tust so, als wären wir mit dem Staub gekommen und mit dem Wind gegangen. Wenn du morgen früh aufstehst, bist du immer noch du, und wir sind immer noch wir, und wir sind uns nie begegnet. Deine Ma wird bestimmt wieder gesund. Das weiß ich, weil sie einen guten Sohn großgezogen hat.«
»Wer hat den Wachmann getötet, Miss Bonnie? Doch nicht Sie, oder?«
»Geh nach Hause, Junge«, erwiderte sie. »Und komm bloß nicht wieder hierher.«
Ich kehrte zum Haus zurück und verstaute Großvaters Schrotflinte im Küchenschrank. Ein paar Minuten später kam er auf seinen Stock gestützt die Treppe herunter. Ich kochte Haferbrei, röstete vier Brotscheiben in der Bratpfanne und brachte ein Glas Eingemachtes zum Tisch. Dann füllte ich den Haferbrei in Großvaters Schale, stellte sie an seinen Platz und legte sein Brot daneben. Währenddessen spürte ich, wie er mich ununterbrochen beobachtete. »Wo warst du?«, fragte er.
»Bin am Fluss spazieren gegangen.«
»Klappschildkröten zählen, oder wie?«
»Gibt schlechtere Gesellschaft.«
»Ich schätze, es spricht für deinen Charakter – aber du bist der erbärmlichste Lügner, der mir je untergekommen ist. Letzte Nacht hab ich einen Wagen draußen im Wald gehört. Ist die Bande von neulich zurück? Obwohl ich es ihnen verboten hatte?«
»Sie sind nicht auf unserem Grundstück. Der Fahrer ist verletzt, und der andere, Raymond, musste eine Spurstange reparieren.«
»Der Fahrer hat eine Schussverletzung?«
»Nein. Sie hatten einen Unfall.«
Großvater hatte sich die Serviette um den Hals gebunden wie ein Lätzchen. Nun wischte er sich damit über den Mund und legte seinen Haferbreilöffel beiseite. »Haben sie dir gedroht?«
»Die Lady mit dem rotblonden Haar meinte, Mutter wird wieder gesund und kommt zurück nach Hause. Ich glaube, sie ist ein guter Mensch. Vielleicht sind sie schon wieder gefahren. Sie wollen uns sicher keinen Ärger machen.«
Großvater stand auf und ging zum Wandtelefon, einem Apparat mit Holzgehäuse und einer Handkurbel an der Seite. Er hielt sich die Hörmuschel ans Ohr und drehte die Kurbel. Und drehte sie noch einmal. »Tot.«
»Vielleicht ist ein Baum auf die Leitung gekippt.«
»Ich glaube eher, du verschweigst mir was.«
»Der Fahrer hat gefragt, ob wir ein Telefon haben. Haben wir nicht, hab ich gesagt. Er meinte, er hätte eine Leitung zu unserem Haus gesehen. Ich hab gesagt, dass wir uns die Rechnung nicht mehr leisten konnten.«
»Du wusstest also Bescheid.«
»Was soll ich gewusst haben?«
»Wie gefährlich diese Leute sind. Aber du wolltest es nicht wahrhaben.«
Mein Gesicht glühte vor Scham. »Und wie willst du jetzt vorgehen?«
»Erst mal müssen wir etwas klären. Wie kommst du dazu, mit einer Bande von Banditen über deine Mutter zu reden?«
»Ich dachte, sie könnten mir vielleicht helfen, Mutter aus der Irrenanstalt zu holen.«
Als ich Großvater anblickte, beobachtete ich ein eigentümliches Phänomen: Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das Licht des Mitleids und der Liebe in seinen Augen. »Gestern hab ich den Doktor angerufen, Ranz«, sagte er. »Ich hab ihm gesagt, er soll die Elektroschocks bleiben lassen. Ich hab ihm gesagt, ich hätte einen Fehler gemacht, und dass ich runter nach Houston fahre, um deine Mutter abzuholen.«
Entgeistert starrte ich ihn an. »Warum hast du mir das nicht gesagt?«
»Ich wollte noch seinen Rückruf abwarten. Um sicherzustellen, dass auch alles glattgeht.«
Ich stand auf, ging zur Spüle und schaute hinaus in die Bäume. Ich fühlte mich wie ein Judas, auch wenn ich mir unsicher war, wen ich eigentlich verraten hatte – Großvater oder unsere Gäste am Fluss. »Die Frau heißt Bonnie. Der Fahrer hatte eine Browning dabei. Gut möglich, dass es Clyde Barrow ist.«
»Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme?«, erwiderte Großvater.
Großvater beauftragte mich, mit unserem Model A zum Laden an der Kreuzung zu fahren und Sheriff Benbow zu alarmieren.
»Komm doch mit«, sagte ich.
»Während die unser Haus plündern?«
»Wir haben doch nichts, was die wollen.«
»Irgendein Landstreicher muss deine Mutter geschwängert haben. Das ist die einzige Erklärung«, meinte Großvater. »Oder hast du dich hinter einer Wolke versteckt, als Gott das Hirnschmalz verteilt hat?«
Also brach ich auf und ließ Großvater vor der Veranda stehen, in seiner Khakihose, deren Beine er in hohe Schaftstiefel gestopft hatte, und mit seinem Stetson, dessen zerknitterte Krempe sein Gesicht überschattete, sodass seine Gedanken nicht zu erahnen waren. Ich bog auf die unbefestigte Straße ein, die an dem Waldstück mit dem Camp unserer Besucher vorbeiführte. Unsere Telefonleitung hing senkrecht vom Mast. Kein Ast oder Baumstamm auf dem Boden. Ein Staubteufel wirbelte vom Feld herüber, zerschellte am Kühlergrill des Model A und puderte die Windschutzscheibe mit Sand. War das ein schlechtes Omen? Bis zum Laden an der Kreuzung waren es noch zwei Meilen. Ich wendete den Wagen auf der Straße und machte mich auf den Heimweg.
Großvater besaß zwei Pferde. Das eine hieß Shorty, ein Shetlandpony, das auf einem Auge blind war. Wenn Großvater auf Shorty durch hohes Gras ritt, sah man nur seine Schultern und seinen Kopf, als hätte man ihn mittendurch gesägt und seinen Oberkörper auf einen Karren montiert. Das andere Pferd war ein vierjähriger weißer Wallach namens Blue, der einige Araber zu seinen Vorfahren zählte und stets bis in die Haarspitzen unter Strom stand. Auf Blue musste man sich nur im Sattel vorbeugen, und schon war man auf halbem Weg nach El Paso. Auf einem solchen Pferd hatte ein Mann im Alter meines Großvaters nichts verloren. Aber das hätten Sie mal meinem Großvater sagen sollen.
Ich parkte vor der Scheune. Shorty stand in der Koppel, Blue war nirgends zu sehen. Ich warf einen Blick in den Küchenschrank, wo ich Großvaters doppelläufige Schrotflinte deponiert hatte. Sie war verschwunden.
Ich nahm den Revolver samt Halfter aus der Schublade, ging in den Wald und folgte Blues Hufspuren am Flussufer entlang bis zur Grenze unseres Grundstücks. Durch die Bäume konnte ich den Chevrolet und daneben vier Personen erkennen. Alle vier blickten zu meinem Großvater hinauf, der auf Blue saß wie eine hölzerne Wäscheklammer. Und alle vier grinsten sie ihn auf wenig respektvolle Weise an. Niemand sah in meine Richtung, auch Bonnie nicht.
Großvater hatte Blue aufgezäumt, doch auf den Sattel hatte er verzichtet. Blue war über eins sechzig groß und besaß das Exterieur eines Arabers, kräftige Hufe und breiter Brustkorb. Bei jedem Schritt kräuselte sich sein Fell vor kaum gezähmter Kraft, und landete eine Schmeißfliege auf seinem Rumpf, zuckte seine Haut vom Widerrist bis zur Kruppe. »Es sind schlechte Zeiten«, hörte ich Großvater sagen. »Aber das gibt Ihnen kein Recht, sich auf meinem Grundstück zu verkriechen oder einen schlechten Einfluss auf meinen Enkelsohn auszuüben. Ich kenne Sie. Ich weiß, wer Sie sind. Und ich kann mir denken, wer unsere Telefonleitung gekappt hat.«
»Wir sind stinknormale Leute vom Land. Gibt keinen Unterschied zwischen Ihnen und uns«, erwiderte Raymond. »Und außerdem befinden wir uns nicht auf Ihrem verdammten Grundstück.«
»An dir ist gar nichts normal, Junge. Du denkst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen – und dafür gibt’s leider kein Heilmittel«, sagte Großvater. »Du wirst eines Tages mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig liegen oder vom elektrischen Stuhl gebraten werden, und im Grunde genommen würde ich sagen, das geschieht dir nur recht. Aber wahrscheinlich hast du irgendwo eine Mutter, die sich um dich sorgt. Also warum versuchst du nicht, dein Leben in den Griff zu kriegen, solange du noch eine Chance hast?«
»Wir verschwinden hier«, antwortete Bonnie. »Aber sparen Sie sich die herablassende Art, verstanden? Ihr Enkelsohn hat uns erzählt, was mit Ihrer Tochter passiert ist. Sie haben das zugelassen.«
»Es reicht«, sagte der Verletzte. »Wir fahren.«
»Sie sind Clyde Barrow, oder?«, fragte Großvater.
»Wie gesagt, ich heiße Smith.«
»Sie wurden in Telico geboren. Haben als Kind Tiere gequält. Ihretwegen ist Ihr Bruder oben in Missouri draufgegangen. Sie sind ein amtlicher Versager, Junge.«
»Klar. Und Sie sind ein bösartiger alter Mann. Niemand wird Ihr Grab besuchen außer ein paar Steppenläufern«, sagte der Mann, der sich Smith nannte.
Alle vier stiegen in den Chevrolet und schlugen die Türen zu – und dadurch schoss Blue senkrecht in die Luft, riss die Vorderhufe höher als das Dach des Wagens. Großvater krachte auf die Erde, die Schrotflinte flog ihm aus den Händen. Sein Gesicht war weiß vor Schreck, sein Atem drang keuchend aus der Kehle. Ich dachte, ich hätte in seinem Rücken Knochen brechen gehört.
Bonnie und ihre Freunde fuhren los, mit Raymond am Steuer. Einer von ihnen spuckte Großvater noch an. Im Schatten der Bäume war nicht zu erkennen, wer es war, doch der Speichel flog aus dem Fenster wie ein Stück feuchter Bindfaden und blieb an Großvaters Hemd kleben. Sekunden später rollte der Chevrolet die staubige Steigung zwischen den Stämmen hinauf. Die Sonne brach sich in den Fenstern.
Ich ließ Halfter und Gürtel vom Revolver gleiten, spannte den Hahn und zielte beidhändig auf das Heck des Autos.
»Nicht, Weldon«, sagte Großvater.
Ich zielte nicht auf den Tank oder einen Reifen oder den Kofferraum. Ich zielte fünfundzwanzig Zentimeter unter das Dach, drückte den Abzug durch und spürte, wie sich das schwere Gehäuse in meinen Händen aufbäumte. Ich hörte, wie die .44er-Patrone ihr Ziel fand, von Metall abprallte und Glas zertrümmerte, vielleicht ins Armaturenbrett oder in die Dachverkleidung einschlug. Im Nachhall des Schusses meinte ich, einen Schrei zu hören.
Das Auto schwankte, blieb aber nicht stehen und war kurz darauf verschwunden. Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder und fragte mich, was ich da getan hatte, noch immer das Donnern der Waffe in den Ohren.
»Warum hast du nicht auf mich gehört?«, sagte Großvater.
Mein rechtes Ohr schmerzte, als hätte mir jemand die flache Hand gegen den Schädel geklatscht. Ich öffnete und schloss den Mund, um mein Hörvermögen wiederherzustellen. »Ich hab nicht nachgedacht. Wer hat da geschrien? War das eine Frau?«
»Nein, keine Frau. Das war eine Eule. Hast du das verstanden?«
»Aber ich hab eine Frau schreien gehört.«
»In solchen Situationen darf man seinen Sinnen nicht trauen. Das war eine Kreischeule. Die sehen tagsüber nichts, deshalb sind sie so schreckhaft. Hilf mir auf.«
»Ja, Sir.«
»Sag mir, was du gehört hast.«
»Eine Eule. Ich hab eine Eule schreien gehört.«
»Du wirst nie wieder an diesen Moment zurückdenken. Der heutige Tag ist nicht der Rede wert, verstanden? Und hör bloß nie auf, so ein feiner junger Mann zu sein.«
In der folgenden Woche kamen drei alte Freunde meines Großvaters zu Besuch – behäbige, massige Herren im Anzug, mit Stetsons, gewichsten Stiefeln und breiten, schwieligen Händen. Einer drehte sich seine Zigaretten selbst. Ein anderer war ein ehemaliger Texas Ranger, der angeblich fünfzig Mann getötet hatte. Sie saßen in der Küche und tranken Kaffee, während Großvater ihnen alles erzählte, was er über unsere Besucher wusste. Mich erwähnte er dabei mit keinem Wort. Ich hockte im Wohnzimmer und hörte den ehemaligen Texas Ranger sagen: »Die Kugel hätte eine Frau erwischen können. So was macht man doch nicht, Hack.« Aber währenddessen lächelte er.
Großvater blickte auf und sah, wie ich durch den Türrahmen spähte. In diesem Moment geschah etwas, das ich nie vergessen werde: Großvaters Augen füllten sich einmal mehr mit einer Wärme, wie man sie kaum von dem Mann erwartet hätte, der John Wesley Hardin hinter Gitter gebracht hatte. Die Gesetzeshüter an seinem Tisch waren Killer. Großvater war keiner. »Geh hoch und schau nach deiner Mutter«, sagte er. »Machst du das, Weldon?«
Später las ich von dem Hinterhalt in Louisiana. Bonnie Parker und Clyde Barrow wurden vom Kugelhagel der Schnellfeuerwaffen in Stücke gerissen. Ihr Freund Raymond sollte später einen tapferen, würdevollen Tod auf dem elektrischen Stuhl in Huntsville sterben; seine Freundin Mary sollte im Gefängnis landen. Keiner von ihnen war von dem Projektil getroffen worden, das ich auf ihr Auto abgefeuert hatte.
Im Sommer regnete es, und ich angelte einen Wels von derselben rötlich-braunen Farbe wie der Fluss, aus dem ich ihn geholt hatte. Ich zog den Haken aus seinem Maul, legte den Fisch wieder in die Strömung und sah zu, wie er versank, bis er nicht mehr zu erkennen war. Eine Begebenheit, die für kaum jemanden von Bedeutung gewesen sein dürfte außer für den Katzenfisch und mich.
Kapitel 2
Im Frühling 1944, als frischgebackener Second Lieutenant der United States Army kurz vor dem Aufbruch nach England, erwarb ich in einem Schreibwarengeschäft unweit des Geländes der Columbia University ein ledergebundenes Notizbuch. Ich dachte wohl, ich könnte in die Rolle eines modernen Ismael schlüpfen, und die übrige Bevölkerung würde später einmal durch mein Notizbuch wie durch ein Schlüsselloch am bedeutsamsten Ereignis der Menschheitsgeschichte teilhaben.
Ich war fraglos eitel, und wie so vielen jungen Männern dieses Zeitalters, besonders jenen aus dem Herzland der Vereinigten Staaten, fiel es mir schwer, meine Eitelkeit und Ungeduld mit meiner Schüchternheit im Umgang mit Mädchen und meiner Unsicherheit unter Absolventen östlicher Universitäten in Einklang zu bringen. Ich dachte, das Notizbuch würde mir vielleicht zu einem besseren Verständnis meiner selbst verhelfen, als ich die Tür des Schreibwarengeschäfts öffnete und auf die weiten Plätze, grünen Wiesen und aristokratisch anmutenden Gebäude der Universität blickte, deren Graduiertenfakultät ich eines Tages zu besuchen hoffte. Ja, sagte ich mir, indem ich über Dinge schrieb, von denen die meisten Menschen keine Vorstellung hatten, könnte ich mich vielleicht zum Kapitän meiner Seele aufschwingen. Ich sah mich schon im Schützengraben kauern, den Rücken an eine Erdwand gepresst, und in mein Notizbuch kritzeln, während das Artilleriefeuer aus dem Himmel herabpfiff und draußen im Niemandsland detonierte. Dazu noch eine Aufnahme von »Little Bessie«, die im Hintergrund klimperte, und mein Fantasiegebilde wäre vollendet gewesen.
Wie alle jungen Männer, die bald in den Krieg ziehen würden, wollte ich nichts von einer »großen Illusion« hören. Wenn der Krieg gar so schlimm war, wieso erweckten die, die bereits im Kampf gedient hatten, dann nie den Eindruck, ihren Einsatz zu bereuen? Man denke nur an die Bilder, die im Geist entstehen, wenn vom Klang der Hörner vor Roncesvalles die Rede ist. Was lässt das menschliche Herz schneller schlagen – das Rolandslied oder ein Rückzug in Trägheit und Langeweile, während anderswo die Welt in Flammen aufgeht?
Meine Generation war eitel, aber nicht arrogant. Letzteres möchte ich auf keinen Fall andeuten. Unsere Eitelkeit gründete nicht nur in unserer Jugend, sondern auch in unserer kollektiven Unschuld. Unserer Vorstellung nach hatten wir die Weltwirtschaftskrise heil überstanden, weil wir der Jefferson’schen Demokratie die Treue gehalten hatten, statt uns den Kommunisten oder der amerikanischen Entsprechung des Faschismus hinzugeben. Eine realistische Einschätzung unserer selbst hätte etwas bescheidener ausfallen müssen: Wir waren Kinder eines Zeitalters des Übergangs – die letzten Amerikaner, die sich noch an eine Nation erinnern würden, in der die Landwirtschaft die Industrie überwogen hatte, in der man mehr Schotterstraßen gefunden hatte als asphaltierte Highways. Und wir sollten die letzte Generation sein, die noch auf die moralische Glaubwürdigkeit der Republik gewettet hätte.