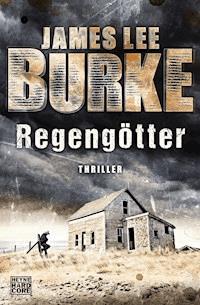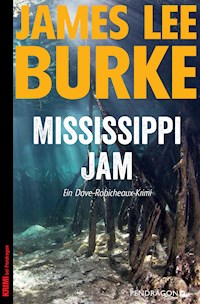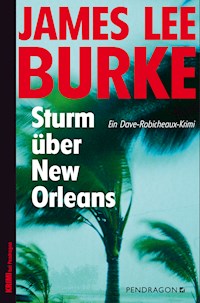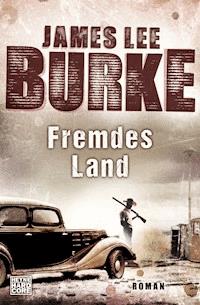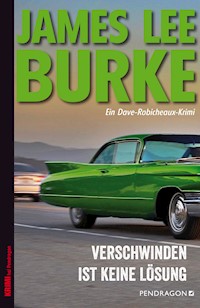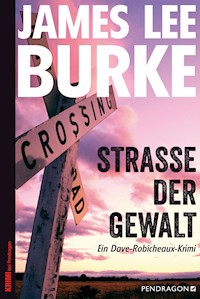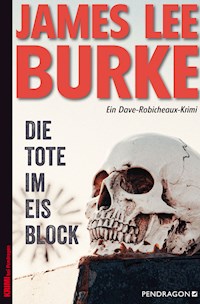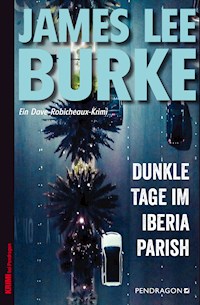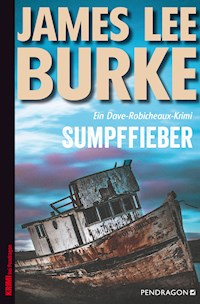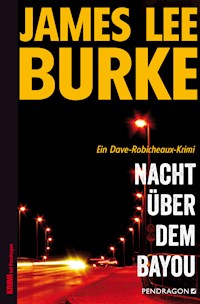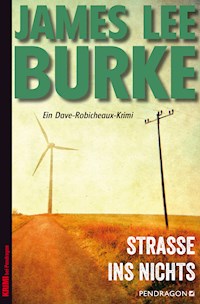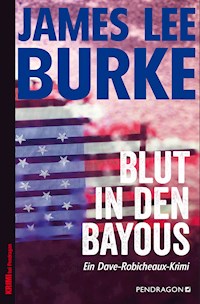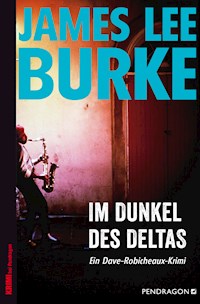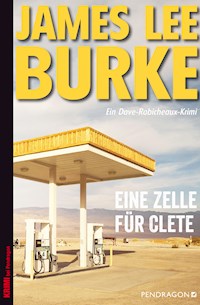
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Ein tiefer Einblick in die amerikanische Seele: Atmosphärisch, düster, brillant. Der skrupellose Mord an sieben jungen Frauen veranlasst Detective Dave Robicheaux, zusammen mit seinem besten Freund Clete Purcel Ermittlungen anzustellen. Dabei geraten sie immer wieder an den berüchtigten Zuhälter Herman Stanga. Als der tot aufgefunden wird, kurz nachdem Clete ihn zusammengeschlagen hat, wird es heikel für Clete. Zudem muss Robicheaux auch noch um seine Tochter Alafair fürchten - sie hat sich mit dem erfolgreichen Autor Kermit Abelard eingelassen und Dave ist überzeugt davon, dass er in zwielichtige Geschäfte verwickelt ist, die auch Alafair bedrohen könnten. Dieser Fall wird ihm alles abverlangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine CousinenAlafair Kane, Charlotte Elrod,Karen McRae und Mary Murdy
JAMES LEE BURKE
Eine Zellefür Clete
Ein Dave-Robicheaux-KrimiBand 18
Aus dem Amerikanischenvon Norbert Jakober
PENDRAGON
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1
Das Zimmer, das ich in der Altstadt von Natchez gemietet hatte, erinnerte mehr an New Orleans als an irgendeine Kleinstadt am Mississippi. Die sturmsicheren Fensterläden leuchteten in einem zartrosa Licht, wie man es auch im Garden District in New Orleans sehen konnte, wenn im Frühling die Sonne aufging. Über den Gärten lag ein feiner Nebel, der vom Fluss heraufgezogen war. Die pastellfarbenen Hauswände waren von Flechten überzogen. Auf den gepflasterten Wegen roch es nach feuchtem Stein und wilder Minze, die in grünen Büscheln zwischen den Steinfliesen wuchs. Ich sah, wie die Schatten der Bananenstauden auf den Fliegengittern der Fenster spielten, das Kondenswasser auf den Blättern wie Adern in Körpergewebe. Irgendwo auf dem Fluss stieß ein Schiffshorn sein langgezogenes, vom Nebel gedämpftes Tuten aus. Ein hölzerner Ventilator rotierte träge über meinem Bett, die daran befestigten Lampen wie kleine gläserne Blumen. Der Holzboden, die knallbunte Tapete und die feuchten Flecken an der Decke erinnerten an eine andere Zeit, die noch nicht vom Kommerz beherrscht war. Diesen Eindruck unterstrich eine aufziehbare runde Wanduhr ohne Zeiger.
Hier im tiefen Süden kann es dir auch heute noch passieren, dass du eines Morgens aufwachst und dich fragst, ob du ins Jahr 1862 zurückversetzt wurdest. Vielleicht wirst du dir dann sogar mit einem Anflug von schlechtem Gewissen eingestehen, dass dir eine solche Reise in die Vergangenheit gar nicht einmal unangenehm wäre.
An diesem Vormittag fand ich in einer kieferbestandenen Senke unweit des Mississippi den Mann, den ich suchte. Er hieß Jimmy Darl Thigpin. Die in den Südstaaten recht häufige Verkleinerungsform des Namens, die denjenigen jungenhaft wirken ließ, war in seinem Fall absolut irreführend. Er war seit Jahrzehnten als bewaffneter Aufseher im Strafvollzug von Mississippi tätig, ein Kerl von der harten Sorte, dem man tunlichst aus dem Weg ging und dessen Charakter man nicht hinterfragte. In gewisser Weise war Jimmy Darl Thigpin für uns alle, die wir das Gesetz vertraten, ein abschreckendes Beispiel. Man fürchtete, vielleicht auch einmal so zu werden wie er.
Er saß aufrecht auf einem stattlichen Pferd, eine abgesägte, doppelläufige Schrotflinte auf dem Oberschenkel. Der Sattel knirschte unter seinem Gewicht. Er trug ein langärmeliges Baumwollhemd, um seine Arme vor den Moskitos zu schützen, und einen alten Cowboyhut, um zu verhindern, dass ihn der Hautkrebs erneut heimsuchte, der auf einer Gesichtshälfte seine Spuren hinterlassen hatte. Soweit ich wusste, hatte er in seiner vierzehnjährigen Laufbahn fünf Männer umgebracht – manche im Strafvollzug, manche auch draußen, einen im Streit um eine Frau in einer Bar.
Die Häftlinge, die er bewachte, waren durchweg Schwarze in grünweiß gestreiften Sträflingspullis und ausgebeulten Hosen, manche mit Fußfesseln gesichert. Sie fällten Bäume, hackten die Äste ab, um sie zu verbrennen, und luden die Stämme auf einen Pritschenwagen. Das Feuer strahlte eine enorme Hitze ab, entwickelte aber kaum Rauch.
Als Thigpin mich an der Straße parken sah, saß er ab, öffnete den Verschluss seiner Schrotflinte und hielt sie über dem linken Unterarm, sodass man die zwei Patronen in den Kammern sehen konnte. Obwohl er seine Waffe gesichert hatte, als wäre er auf meine Sicherheit bedacht, blieb sein Gesichtsausdruck finster, als er mir die Hand schüttelte, ohne die Häftlinge aus den Augen zu lassen.
„Wir wissen es zu schätzen, dass Sie uns angerufen haben, Cap“, sagte ich. „Man sieht, dass Sie den Laden im Griff haben.“
Im nächsten Moment wurde mir bewusst, was ich gesagt hatte. Manchmal ist es im Privatleben wie im Beruf notwendig, sich bei Leuten einzuschmeicheln, die einem nicht koscher sind. Das Schlimmste daran ist nicht, dass es nicht ganz ehrlich gemeint ist, sondern dass der Betreffende einen als Gleichgesinnten und Freund betrachten könnte. Dann beschleicht einen die Angst, dass man diesen Leuten ähnlicher ist, als man sich eingestehen will. Ich redete mir ein, dass ich das irgendwann nicht mehr nötig haben würde. Hoffte ich wenigstens.
Meine Befürchtungen waren unbegründet. Thigpin schien sich nur zu fragen, warum ich eigentlich nach Mississippi gekommen war, obwohl er selbst mich kontaktiert hatte. „Geht es um diese Nutten, die drüben bei Ihnen umgebracht wurden?“
„So würde ich sie nicht unbedingt nennen.“
„Sie haben recht, man soll nicht schlecht von den Toten reden. Der Junge, von dem ich Ihnen erzählt hab, ist dort drüben. Der mit den Goldzähnen.“
„Danke für Ihre Hilfe, Cap.“
Vielleicht war er im Grunde gar kein so schlechter Kerl, sagte ich mir. Aber kaum denkt man mit einer gewissen Erleichterung, dass wir doch alle einen guten Kern haben, folgt schon die nächste Enttäuschung.
„Passen Sie auf Ihre Sachen auf“, sagte Thigpin. „Der Typ ist schon als Langfinger auf die Welt gekommen.“
„Was?“
„Nicht dass Sie noch Mitleid mit ihm kriegen. Der stiehlt Ihnen die Klobrille unterm Hintern weg, ohne dass Sie’s merken. Wenn er Ihnen nicht erzählt, was er weiß, sagen Sie Bescheid, dann helfe ich seinem Gedächtnis mit ein paar Ohrfeigen auf die Sprünge.“
Jimmy Darl Thigpin öffnete einen Beutel Kautabak und schob sich einen Priem in die Backe. Während er langsam kaute, verklärten sich seine Augen vor Wohlbehagen. Als ihm bewusst wurde, dass ich ihm zusah, schlich sich ein verschwörerisches Lächeln in seinen Mundwinkel, als wolle er andeuten, dass wir zum selben Club gehörten.
Der Häftling hieß Elmore Latiolais. Er stammte aus einem ländlichen Slum knapp 100 Kilometer nordöstlich von New Iberia, wo ich als Detective im Iberia Parish Sheriff’s Department tätig war. Er hatte zwar die Gesichtszüge eines Schwarzen, doch seine Haut hatte einen hellen Braunton und war mit großen Muttermalen bedeckt. Seine drahtigen Haare waren goldblond gefärbt. Er war einer von diesen Rückfalltätern, deren Lebensgeschichten uns das Scheitern unserer Institutionen vor Augen führen und uns zu der resignierenden Erkenntnis kommen lassen, dass es für manche Menschen und Situationen keine Lösung gibt.
Wir setzten uns auf einen Baumstamm im Schatten, etwa 30 Meter von den anderen entfernt. Die Luft war stickig und heiß in der Waldlichtung, in deren Mitte das Feuer brannte. Die frisch geschnittenen Äste, die in die Flammen geworfen wurden, fingen augenblicklich Feuer. Elmore Latiolais war schweißgebadet und dünstete einen Geruch nach Moder und altem Seifenwasser aus.
„Warum müssen wir eigentlich hier reden, Mann?“, beschwerte er sich.
„Sorry, dass ich kein klimatisiertes Büro mitgebracht habe“, sagte ich.
„Für die bin ich ’n Spitzel, wenn ich mit Ihnen rede.“
„Ich bin weit gefahren, um mit Ihnen zu sprechen, Partner. Soll ich wieder heimfahren?“
Sein Blick schweifte in die Ferne, als ließe sich in der hitzeflimmernden Luft eine Antwort auf alle ungelösten Probleme seines Lebens finden.
„Meine Schwester Bernadette war eines der sieben Mädchen, die umgebracht wurden. Obwohl das kein Schwein juckt.“
„Das hat mir Captain Thigpin schon gesagt.“
„Meine Großmutter hat mir den Zeitungsartikel geschickt. Der war vom letzten November. Sie sagt, seither haben sie nix mehr darüber berichtet. In dem Artikel steht, dass meine Schwester und die anderen Prostituierte waren.“
„Nicht direkt. Aber es stimmt – sie haben so was angedeutet. Worauf wollen Sie hinaus?“
„Es is so verdammt unfair.“
„Was ist unfair?“
„Dass sie meine Schwester ’ne Prostituierte nennen. Die Wahrheit interessiert doch eh keinen. Wie Müllsäcke haben sie diese Mädchen weggeworfen.“ Er wischte sich mit dem Handballen über die Nase.
„Haben Sie eine Ahnung, wer für ihren Tod verantwortlich sein könnte?“
„Herman Stanga.“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Stanga wollte mich im Knast abstechen lassen.“
„Herman Stanga ist ein Zuhälter.“
„Genau.“
„Sie sagen, ein Zuhälter ist in den Tod Ihrer Schwester verwickelt, aber Ihre Schwester war keine Prostituierte. Wie passt das zusammen?“
Er schaute mich abschätzig an. „Muss ich Ihnen das wirklich erklären, Mann?“
Ich stützte die Hände auf die Knie, spannte die Arme an und wartete, bis der Zorn verflog, der in mir hochkam. „Sie haben Captain Thigpin gesagt, er soll mich anrufen. Warum gerade mich und nicht jemand anderen?“
„Mein Cousin hat mir gesagt, dass Sie herumfragen, ob jemand was über die Mädchen weiß. Nur hab ich das Gefühl, dass Sie mit dem Kopf zu tief im Sand stecken, um irgendwas zu kapieren.“
„Sorry, aber ich glaube nicht, dass unser Gespräch irgendwohin führt.“
„Mann, mit Nutten lässt sich heute nix mehr verdienen. Herman Stanga macht sein Geld jetzt mit Meth. Müssen Sie echt nach Mississippi kommen und jemand aus ’nem Arbeitstrupp fragen, um da draufzukommen?“
Ich stand auf, den Blick ins Leere gerichtet. „Ich habe ein paar Fotos hier, die ich Ihnen zeigen will. Sagen Sie mir, ob Sie eine der Frauen kennen.“
Es waren sieben Fotografien, die ich in der Hemdtasche bei mir trug, doch ich nahm nur sechs heraus. Latiolais blieb auf dem Baumstamm sitzen und besah sich die Bilder eins nach dem anderen. Es waren keine Polizeifotos. Sie waren von Freunden oder Verwandten mit einer billigen Kamera geknipst und bei einem Fotoschnelldienst entwickelt worden. Der Hintergrund zeigte heruntergekommene Gegenden, in denen die Leute ihren Müll in die Regengräben warfen, wo er im Sommer von Unkraut überwuchert wurde und im Winter wieder zum Vorschein kam.
Zwei Opfer waren weiß, vier dunkelhäutig. Hübsche junge Mädchen, die keinen unglücklichen Eindruck machten. Keine schien sich vorstellen zu können, welches Schicksal sie erwartete.
„Sie haben alle südlich der Bahnlinie gelebt, oder?“, fragte er.
„Ja. Kennen Sie sie?“
„Nein, keine von ihnen. Sie haben mir das Foto meiner Schwester nicht gezeigt.“
Ich zog das siebte Foto aus der Hemdtasche und reichte es ihm. Die junge Frau auf dem Bild war 17 Jahre alt gewesen, als sie starb. Zum letzten Mal war sie gesehen worden, als sie um vier Uhr nachmittags einen Ramschladen verlassen hatte. Sie hatte ein hübsches rundes Gesicht und lächelte in die Kamera.
Elmore Latiolais betrachtete das Foto lange, dann schirmte er die Augen mit einer Hand ab, wie um sich vor der grellen Sonne zu schützen. „Kann ich es behalten?“
„Tut mir leid“, sagte ich.
Er nickte und gab mir das Bild zurück, seine Augen feucht, die blondierten Haare schweißnass.
„Sie sagen, Sie haben die anderen Opfer noch nie gesehen. Woher wissen Sie dann, dass sie südlich der Bahnlinie gewohnt haben?“, hakte ich nach.
„Sehen Sie, das hab ich damit gemeint, dass Sie nix kapieren. Hätten die nördlich der Eisenbahn gelebt, würdet ihr alle zusammen den ganzen Bundesstaat Louisiana auf den Kopf stellen, bis ihr den Mann findet, der sie umgebracht hat.“
Elmore Latiolais war kein netter Mensch. Wahrscheinlich hatte er Verbrechen begangen, die um einiges schlimmer waren als diejenigen, für die er verurteilt worden war. Doch die Tatsache, dass er Herman Stanga für einen gewissenlosen Drecksack hielt, sagte mir, dass er doch irgendwie aus dem gleichen Holz geschnitzt war wie wir anderen. Herman Stanga war ein anderes Kaliber. Stanga war ein Mann, den ich hasste, vielleicht weniger als Person als für das, was er verkörperte. Wie auch immer, ich hasste den Kerl dermaßen, dass ich Angst davor hatte, was ich täte, wenn ich irgendwo bewaffnet mit ihm allein wäre.
Ich verabschiedete mich von Elmore Latiolais.
„Sie werden auch nich’ mehr tun als die anderen, oder?“
„Sie haben mir nichts gesagt, was mir ermittlungstechnisch weiterhilft.“
„Ermittlungstechnisch? Cooles Wort, muss ich mir merken. Wissen Sie, Herman hat vor zehn Jahren eine Cousine von mir umgebracht. Er hat ihr eine Überdosis verpasst und sie einfach krepieren lassen. Als ihm klar wurde, dass ich Bescheid wusste, hat er einen Typ angeheuert, der mich kaltmachen sollte. Euch hat das damals schon nicht interessiert – ihr werdet auch jetzt keinen Finger krumm machen.“
„Es tut mir leid, was mit Ihrer Schwester passiert ist“, sagte ich.
„Ja“, antwortete er.
Herman war eines dieser Individuen, für die es kaum die richtigen Worte gibt. Er machte die jungen Leute, die als Dealer für ihn arbeiteten, zu Drogenabhängigen, machte sie „mit einer Prise Heroin fit fürs Geschäft“. Von seinen Prostituierten verlangte er, dass sie sich Speck anfutterten, um den Kunden zu signalisieren, dass sie kein Aids hatten. Seine weißen Mädchen bot er schwarzen Freiern an, während die schwarzen dem weißen Publikum vorbehalten waren. Wenn ein Kunde es gern auf die harte Tour haben wollte und jemand dabei zu Schaden kam, war das eben so. „Harry Truman hat die Gleichbehandlung in der United States Army durchgesetzt. Ich geh mit der Chancengleichheit noch einen Schritt weiter“, sagte er manchmal.
Nach seiner Selbsteinschätzung war er jemand, der nach seiner eigenen Pfeife tanzte. „Ich bin, wie ich bin, ohne Schnickschnack und Firlefanz.“ Er hatte ein Koboldgesicht mit einem Schnurrbart, der wie feine schwarze Flügel von der Oberlippe abstand. Mit dem harmlosen, schelmischen Funkeln in seinen Augen wirkte er wie ein pfiffiger Typ, der es zwar faustdick hinter den Ohren hatte, aber im Grunde harmlos war. Sein Körper war schlank und drahtig, mit der Anspannung eines Methabhängigen, obwohl er nur gelegentlich zu Drogen griff. Am liebsten lag er in weißen Seidenshorts auf einer Luftmatratze in seinem Pool und badete in der Sonne, eine Ray-Ban Sonnenbrille im Gesicht, einen Frozen Daiquiri auf dem Bauch balancierend, sein Schwanz wie die Galionsfigur am Bug eines Segelschiffs. Den Nachbarn war er ein Dorn im Auge, sie fürchteten den schlechten Einfluss auf ihre Kinder. Herman kümmerte es wenig – er zeigte ihnen den Stinkefinger, wenn er sie vom Fenster herunterschauen sah. Herman Stanga scherte sich nicht um Regeln und Konventionen und war damit steinreich geworden, während das Vermögen seiner Nachbarn in der Rezession von 2009 zusammengeschrumpft war.
Er hatte sich ein stattliches Haus im Antebellum-Stil am Bayou Teche gekauft. Der frühere Besitzer, ein schwarzer Arzt, hatte es ihm für einen Spottpreis überlassen und mit Frau und Kindern fluchtartig die Stadt verlassen. Das schmucke Haus verfiel zusehends, sobald Herman einzog. Die Holzsäulen waren von Termiten zerfressen. Die grünen Fensterläden hingen schief in den Angeln, die Regenrinnen waren verrostet und mit Kiefernnadeln verstopft. Der einst makellos gepflegte Rasen war von Unkraut überwuchert und mit Ameisenhügeln übersät. Hermans Dobermänner gruben Löcher in die Blumenbeete und hinterließen ihre Haufen auf jedem freien Fleckchen, das sie finden konnten. Hermans Eigenheim war ein Musterbeispiel für den zunehmenden Verfall der Vorstädte.
Auf mein Klingeln reagierte niemand. Ich ging hinters Haus und sah ihn am Pool, wo er mit einem langen Kescher Blätter aus dem Wasser fischte. Aus seiner knapp geschnittenen Badehose lugten Schambehaarung und die Arschspalte hervor. Seine Haut hatte den eigenartigsten Farbton, den ich je an einem Menschen gesehen hatte – wie schwarzes Elfenbein mit einem goldenen Schimmer. Die Nachmittagssonne war bereits hinter den Eichen am Bayou verschwunden. Seine nassen Haare und die ölige Haut hatten einen feurigen Glanz. Neben einem Tisch mit integriertem Sonnenschirm drehte sich über glühenden Kohlen ein Hühnchen auf einem Grillspieß. Im Schatten des Schirms stand eine Kühlbox mit zerstoßenem Eis und mehreren Flaschen mexikanischem und deutschem Bier.
„Wenn das nicht unser RoboCop ist!“, rief er aus. „Setzen Sie sich, Bruder, und nehmen Sie sich ein Bier.“
Über einem Segeltuchstuhl hing ein gestreifter Bademantel. Ich nahm ihn und warf ihm den Mantel zu. „Ziehen Sie sich was an.“
„Wozu?“
„Die Kinder Ihrer Nachbarn schauen herüber.“
„Sie haben recht – es wird kühler.“ Er zog den Bademantel über und band den Gürtel zu, das Kinn in den milden Wind gereckt. Die Spätnachmittagssonne zauberte ein Leuchten auf den Bayou, als hätte jemand unter der Wasseroberfläche ein Streichholz entzündet. „Wollen Sie eine Runde schwimmen? Ich hab sicher eine Badehose da, die Ihnen passt.“
„Ich will Ihnen nur ein paar Fotos zeigen, Herman.“
„Von den Mädchen, die drüben im Jeff Davis Parish gestorben sind?“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Weil ihr immer wieder versucht, mir was anzuhängen. Weil ihr keinen anderen findet.“
„Hat noch niemand deswegen mit Ihnen gesprochen?“
„Seit vier Monaten haben sie nix mehr über diese Mädchen berichtet. Was sagt Ihnen das?“
„Sagen Sie’s mir. Ich bin nicht so schlau.“
„Geben Sie mir die Fotos“, erwiderte Stanga, ohne auf meine Bemerkung einzugehen, und streckte die Hand aus.
Nun ignorierte ich seine Geste und legte die Fotos nebeneinander auf den Glastisch. Er wartete geduldig, ein amüsiertes Funkeln in den Augen.
„Sie wollen wissen, ob ich sie kenne? Nein. Ob ich sie schon mal gesehen habe? Nein. Und mal ehrlich, sie wären auch nich’ interessant für mich gewesen. Warum?, werden Sie fragen. Ganz einfach: Weil sie potthässliche Landpomeranzen sin’. Jetzt schauen Sie mich nich’ so an.“
„Was glauben Sie, wer die Mädchen umgebracht haben könnte?“
„Sicher kein Zuhälter. Man schlachtet keine Pferde aus dem eigenen Stall. Fragen Sie doch mal in den Familien nach. Da hat’s wahrscheinlich Zoff gegeben.“ Er schaute auf seine goldene Armbanduhr mit schwarzem Zifferblatt und eingelegten roten Edelsteinen. „Ich krieg heute noch Besuch. Sind wir fertig?“
Die Unterwasserbeleuchtung seines Swimmingpools schaltete sich ein und erzeugte ein so kristallklares Blau, dass ich ein Zehncentstück auf dem Grund des tiefen Endes liegen sah. Bananenstauden und ein prächtiger Magnolienbaum überragten den spitzenbewehrten Zaun, der den Pool umgab. Die Gartenstühle waren von blühenden Topfpflanzen beschattet, deren Duft intensiver als jedes Parfüm war.
„Ihr Zuhause ist ein einziger Widerspruch. Der Garten ist mit Hundekacke zugepflastert, das Haus von Termiten zerfressen, aber der Platz hier am Pool ist wie aus dem Lifestyle-Magazin. Das kapier ich nicht.“
„Der Nigger, der das Haus gebaut hat, wollte ’ne Villa wie in Vom Winde verweht. Bloß wollen die Weißen hier am Bayou keine Schwarzen, die sich wie Weiße benehmen. Jetzt haben sie ’nen richtigen Nigger, damit sie mal Grund zum Jammern haben. Mir gehören drei Mietshäuser, ein Apartment in Lake Charles und ein Strandhaus in Panama City, aber dieses Haus benutze ich als Luxusklo. Jeden Tag, den ich hier bin, sinken die Häuser meiner Nachbarn im Wert. Dreimal dürfen Sie raten, wem sie ihre Häuser am Ende verkaufen werden. Das heißt, falls ich noch mehr Häuser kaufen will.
Wissen Sie, warum seit vier Monaten nicht mehr über diese Mädchen berichtet wird? Weil’s keinen juckt. Wir sin’ hier in Louisiana, Robo man. Schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Wenn du Geld hast, kriechen dir die Leute in den Arsch. Wenn du keins hast, treten sie dir in denselben.“
„Bemühen Sie sich nicht, ich finde allein raus.“
„Sie mich auch, Mann.“
„Wie war das?“
„Was ich Ihnen gesagt hab, is die Wahrheit. Damit kommen Sie nich’ klar. Aber das is Ihr Problem, Scheißkerl. Nicht meins.“
Ich lebte mit meiner Frau Molly, einer ehemaligen Nonne, in einem bescheidenen Haus an der East Main Street, umgeben von Pecannussbäumen, Kiefern und immergrünen Eichen, nur einen halben Block entfernt von einem berühmten Antebellum-Haus aus dem Jahr 1831, das den Namen Shadows trug. Der Rost auf dem Blechdach und an den Regenrinnen leuchtete orange in der Spätnachmittagssonne. Hinter dem Haus reichte unser Grundstück bis zum Bayou Teche hinunter. Entlang des Bayou hatte es nie größere Eingriffe in die Geländeform gegeben. Aus diesem Grund wurden die Häuser in unserer Siedlung trotz der Nähe zum Wasser nie überflutet, auch nicht im schlimmsten Hurrikan. Genauso wichtig bei unseren teilweise tropischen Temperaturen war die Tatsache, dass unser Haus fast den ganzen Tag beschattet war. Auf der sonnigen Seite des Grundstücks blühten fast das ganze Jahr über Kamelien und Hibiskus, während im Frühling die Azaleen mit ihren Blütenblättern den Rasen wie mit pinkfarbenem Konfetti übersäten.
Es war ein Haus, in dem es sich gut leben ließ – kühl im Sommer und warm im Winter. Die deckenhohen Fenster waren mit sturmsicheren Fensterläden versehen, und unsere neue Veranda war ein wunderbares Plätzchen, um auf den hölzernen Schaukelstühlen zu sitzen, umgeben von Topfpflanzen und unseren vierbeinigen Mitbewohnern.
Unsere Adoptivtochter Alafair hatte ihr Psychologiestudium am Reed College in Portland abgeschlossen und sich nun ein Semester Auszeit von ihrem Jurastudium an der Stanford University genommen, um einen Roman zu überarbeiten, an dem sie drei Jahre geschrieben hatte. Sie war mit einem Notendurchschnitt von 3,9 GPA nicht nur eine ambitionierte Studentin, sondern hatte außerdem eine echte schriftstellerische Begabung. Ich zweifelte nicht im Geringsten daran, dass sie beruflich erfolgreich sein würde, welchen Weg sie auch einschlug. Umso mehr Sorgen machte mir ihr Privatleben. Das Problem hatte einen Namen: Kermit Abelard, der erste Mann, mit dem es Alafair richtig ernst zu sein schien.
„Er kommt vorbei? Jetzt?“, fragte ich.
Ich war gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte meinen Pick-up unter dem Carport geparkt. Sie saß im Schaukelstuhl auf der Veranda, in einem geblümten Sommerkleid und weißen Schuhen, ihre Haut sonnengebräunt, die Spitzen ihres pechschwarzen Haars, das sie ihren indigenen Vorfahren verdankte, von der Sonne gebleicht. „Was hast du eigentlich gegen ihn, Dave?“
„Er ist zu alt für dich.“
„Er ist 33. Er nennt es das Jahr seiner Kreuzigung.“
„Wenigstens ist er bodenständig und bescheiden.“
„Jetzt sei mal nicht so sarkastisch, ja?“
„Kommt sein Freund aus dem Knast auch mit?“
Alafair verzog angewidert das Gesicht. Kermit Abelards Familie hatte einmal das halbe St. Mary Parish besessen – doch man konnte ihm nicht vorwerfen, dass er bloß von seiner Herkunft lebte. Er hatte in New York die Schauspielschule besucht und drei Romane veröffentlicht, von denen einer sogar verfilmt worden war. Eine Zeit lang hatte er auf einer Ölbohrinsel gearbeitet, obwohl er sich die Zeit mit Tennisspielen oder Angeln hätte vertreiben können. Leider lebte er seine egalitären Ansichten auf Kosten anderer aus – zum Beispiel, als er die gesamte Crew der Bohrinsel überredete, der Gewerkschaft beizutreten, worauf sie alle gefeuert wurden. Vor zwei Jahren war es ihm gelungen, für einen Autor, der im Staatsgefängnis in Huntsville einsaß, eine Freilassung auf Bewährung zu erwirken – einen Mann, der sein halbes Leben hinter Gittern verbracht hatte.
„Hast du Der grüne Käfig gelesen?“, fragte Alafair.
„Ja. Ich hab’s mir aus der Bücherei besorgt, nicht gekauft.“
„Findest du nicht, dass es ein brillantes Buch ist?“
„Ja, aber aus anderen Gründen, als der Autor und seine Fans glauben.“
Sie ließ sich nicht provozieren, also redete ich weiter: „Es ist ein gelungener Einblick in die Denkweise eines narzisstischen Psychopathen, der es meisterhaft versteht, andere zu manipulieren. Du brauchst nur nachzuzählen, wie oft die Wörter ‚ich‘, ‚mir‘, ‚mich‘ und ‚mein‘ in jedem Absatz vorkommen.“
„Ein paar Leuten muss es gefallen haben. Robbie stand mit dem Buch auf der Shortlist für den National Book Award.“
„Robbie?“
„Such dir jemand anderen zum Streiten, Dave.“
Ich schaute auf den abendlichen Verkehr hinaus, auf die Vögel, die sich vor dem Hintergrund des lilafarbenen Sonnenuntergangs in den Bäumen versammelten. „Wollen wir eine Runde joggen?“, fragte ich.
„Ich geh mit Kermit in den Park. Er liest gerade das letzte Kapitel meines Romans, das ich noch mal überarbeitet habe.“
Ich ging ins Haus. Molly hatte mir auf dem Küchentisch eine Nachricht hinterlassen – sie sei nach Lafayette gefahren und würde etwas fürs Abendessen besorgen. Ich schlüpfte in Shorts, T-Shirt und Laufschuhe, ging hinaus in den Garten und machte 50 Liegestütze, mit den Füßen auf der Bank und unter den interessierten Blicken unseres Kampfkaters Snuggs und unseres alten dreibeinigen Waschbären Tripod. Danach fünf Curls mit der 60-Pfund-Hantel, dreimal Schulterdrücken und 100 Bauchpressen. Es war zugleich kühl und warm im Schatten der Bäume, der Wind wehte durch den Bambus, der unser Grundstück von dem unserer Nachbarin trennte. Neben ihrer Garage stand der Blauregen in voller Blüte. Ich hatte beinahe meine Sorgen vergessen, die ich mir um Alafair machte, weil sie nach meinem Gefühl den falschen Leuten vertraute, als ich plötzlich Kermit Abelards schwarzes Saab-Cabrio in der Auffahrt hörte. Eine Autotür wurde geöffnet und zugeschlagen. Das Geräusch wiederholte sich nicht – daraus schloss ich, dass Kermit Abelard nicht ausgestiegen und zur Veranda gekommen war, um Alafair zum Wagen zu geleiten. Man konnte dem Mann wirklich nicht vorwerfen, dass er allzu großen Wert darauf legte, sich wie ein Gentleman zu benehmen.
Ich ging zum Rand des Gartens hinterm Haus und schaute durch den Carport nach vorne. Kermit setzte den Wagen zur Straße zurück, das Verdeck des Cabrios geöffnet. Gesprenkelte Schatten flirrten über die blank polierte Oberfläche des Wagens, als wäre das abnehmende Licht der untergehenden Sonne eigens für ihn arrangiert worden. Alafair saß neben ihm auf dem ledernen Beifahrersitz. Auf der Rückbank saß ein Mann, dessen Gesicht ich nur von der Umschlagklappe eines Buchs kannte.
Ich joggte die East Main hinunter, im Schatten der immergrünen Eichen, die die gesamte Straße säumten, vorbei am Shadows und der Frühstückspension, in der einst der Aufseher der Plantage gehaust hatte, an dem massiven Ziegelbau des alten Postamts und dem Evangeline Theater, über die Zugbrücke an der Burke Street und weiter in den City Park, wo die Leute grillten und Highschool-Schüler in ein Softballspiel vertieft waren.
Ich drehte zwei Runden durch den Park, insgesamt sechs Kilometer. Nach der zweiten Runde sprintete ich nach Hause. Mein Blut war mit Sauerstoff angereichert, mein Atem regelmäßig, mein Herz schlug kräftig. Der Schweißglanz auf meiner Haut sagte mir, dass es uns hin und wieder vergönnt ist, uns zu fühlen wie einst in jungen Jahren. Dann sah ich Kermit Abelards Saab beim Pavillon parken. Auf einem mit kariertem Tuch bedeckten Tisch lagen Zeitungen ausgebreitet, darauf ein großer Teller mit gekochten Flusskrebsen, Artischocken und Maiskolben.
Ich wollte nicht stehen bleiben, doch Alafair und ihre Freunde, Kermit Abelard und der gefängniserfahrene Schriftsteller namens Robert Weingart, hatten mich bereits gesehen. Alafair winkte mir zu, ihr Gesicht voller Freude und Stolz. Ich tat zuerst so, als würde ich sie nicht sehen, als wäre ich ganz ins Laufen vertieft. Aber durfte ich so weit gehen, die eigene Tochter vor ihren Freunden zu ignorieren? War es in Ordnung, die Abneigung gegenüber diesen Typen an ihr auszulassen? Vielleicht brauchte sie mich ja gerade jetzt aus Gründen, die ihr selbst nicht bewusst waren oder sie sich nicht eingestehen konnte.
Ich verlangsamte meinen Lauf und wischte mir das Gesicht mit dem Handtuch ab, das ich bei mir hatte.
Kermit war ein stämmiger, mittelgroßer Mann mit kurzen, von dicken Adern durchzogenen Armen und einem Grübchen im Kinn. Vom Körperbau her erinnerte er mehr an einen Hafenarbeiter als an einen Spross der alten Südstaatenaristokratie. Das Hemd hatte er oben aufgeknöpft, sodass man seine sonnengebräunte, glatte Brust sehen konnte. Auch die breiten Hände mit den kurzen, stumpfen Fingern waren die eines Arbeiters. Was nicht ganz dazu passte, war der rote Stein im Ring der Kappa-Sigma-Studentenverbindung, der an einem Finger funkelte.
„Darf ich Ihnen Robert vorstellen, Mr. Robicheaux“, sagte er.
„Ich bin ziemlich verschwitzt, Leute“, sagte ich. „Ich glaube, ich geh besser duschen.“
Robert Weingart saß auf dem Holztisch, die Stiefel auf der Bank, und lächelte gutmütig. Er hatte feine Wangenknochen, einen kleinen Mund und ordentlich nach hinten gekämmte schwarze Haare mit einem grauen Streifen. Seine Augen waren haselnussbraun und langgezogen, die Wangen eingefallen. Seine Hände ruhten auf den Knien, die Finger bandagiert wie die eines Pianisten. Er vermittelte den offenen Eindruck eines Mannes, der nichts zu verbergen und ein lupenreines Gewissen hatte. Ein Mann, der mit sich und der Welt im Reinen war.
Es waren kleine Details, die mich irritierten. Er blinzelte nicht, so wie Filmschauspieler nie blinzelten, das Lächeln kam ihm allzu leicht über die Lippen und seine Kiefer wirkten zu fein für die Größe des Schädels. Sein Blick war unverwandt auf mich gerichtet. Ich wartete darauf, dass er endlich blinzelte. Vergeblich.
„Sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt“, meinte er.
„Geht so.“
„Doch, Sie hatten ein ordentliches Tempo drauf.“
„Kann es sein, dass ich Sie schon mal in einem Film gesehen habe?“
„Das glaube ich nicht.“
„Sie erinnern mich an einen Schauspieler. Sein Name fällt mir grad nicht ein.“
„Nein, ich bin bloß ein Schreiberling.“ Er stand von dem Tisch auf und hielt mir die Hand hin. „Rob Weingart. Freut mich, Sie kennenzulernen.“
„Nennt man Sie nicht Robbie?“
„Nennen Sie mich einfach Rob, wenn Sie wollen.“
Sein Händedruck war schlaff, kühl und trocken und kein bisschen bedrohlich. Seine Zähne hatten einen weißen Glanz. Er nahm sich einen Krebs, schob ihn in den Mund und kaute langsam, ohne den Blick von mir abzuwenden. Mit einer Papierserviette tupfte er sich die Lippen ab, sein Gesichtsausdruck so mild wie das Wetter, mit einem pfiffigen Lächeln, als wäre ihm gerade etwas Lustiges eingefallen. „Sie sehen so nachdenklich aus. Haben Sie eine Frage?“
„Jetzt hab ich’s. Es war kein Schauspieler. Sie erinnern mich an Chet Baker“, sagte ich.
„Den Musiker?“
„Ja. Ziemlich tragische Persönlichkeit. Seine Sucht hat ihn aufgefressen. Mögen Sie Jazz, Mr. Weingart? Sind Sie mal irgendwo aufgetreten? Ich bin mir sicher, ich hab Sie schon mal in der Öffentlichkeit gesehen.“
„Möchten Sie eine Kleinigkeit essen, Mr. Robicheaux?“, bot Kermit an.
„Nein, ich bin nirgends aufgetreten“, sagte Robert Weingart. „Wie kommen Sie darauf?“
„Ich bewundere Menschen, die sich antrainieren können, nie zu blinzeln. Wenn jemand nicht blinzelt, kann man nicht einschätzen, was er denkt. Man sieht nur ein Gesicht, in dem sich absolut nicht lesen lässt. Es ist, als würde man elektrisierte Seide anschauen.“
„Das nenn ich ein Sprachbild“, sagte Robert zu Kermit. „Einer von uns sollte es übernehmen und Mr. Robicheaux in einer Fußnote erwähnen.“
„Sie können es gern verwenden. Kostet nichts“, sagte ich.
Kermit Abelard berührte meinen Unterarm mit einem gut gefüllten Pappteller.
„Nein, danke“, sagte ich. „Ich lauf mal lieber weiter.“
„Sie sind Polizist“, sagte Robert Weingart.
„Hat Alafair Ihnen das erzählt?“
„Meistens sehe ich es jemandem an, dass er bei der Polizei ist. Das gehört irgendwie zu meinem Lebenslauf. Aber in diesem Fall hat Ihre Tochter es mir gesagt. Glaube ich wenigstens.“
„Glauben Sie? Sie sind sich nicht sicher?“
Alafairs Gesicht glühte.
„Ist mein Teller fertig?“, fragte Robert. „Ich könnte einen Wal verdrücken.“ Er schaute sich um und unterdrückte seine Belustigung über die groteske Szene.
„Ich glaub’s einfach nicht“, polterte Alafair, nachdem sie nach Hause gekommen war. „Warum hast du ihm nicht gleich eine gescheuert?“
„Sicher, das wäre eine Möglichkeit gewesen.“
„Was hat er dir bloß getan? Er hat nur dagesessen und geplaudert.“
„Der Kerl ist ein Wiederholungstäter, wie er im Buch steht, Alf. Lass dich nicht blenden.“
„Und sprich mich nicht mit diesem blöden Namen an. Wie kannst du über jemanden urteilen, den du gerade mal fünf Sekunden kennst?“
„Wer ein bisschen Erfahrung mit solchen Leuten hat, riecht so was drei Meilen gegen den Wind.“
„Das eigentliche Problem ist, dass du jeden, der dir begegnet, kontrollieren willst. Du suchst nur eine Bestätigung für deine Vorurteile – und Kermits Freund muss es büßen.“
„Du hast recht, ich kenne ihn nicht.“
„Warum nimmst du Kermit etwas übel, was seine Familie vielleicht getan hat? Das ist unfair, Dave. Nicht nur ihm gegenüber, sondern auch mir.“
„Was seine Familie vielleicht getan hat, sagst du? Da gibt es kein Vielleicht. Die Abelards haben sich aufgeführt wie Diktatoren. Wenn es nach ihnen ginge, würden wir heute noch für einen Hungerlohn für sie schuften.“
„Na und? Das heißt noch lange nicht, dass Kermit auch so ist. John und Robert Kennedy waren auch nicht wie ihr Vater.“
„Was ist mit euch? Man hört euch die ganze Auffahrt hinunter“, sagte Molly, die durch die Hintertür hereinkam, mit vollen Einkaufstüten bepackt.
„Frag Dave“, sagte Alafair. „Falls du ihn überreden kannst, mal für eine Sekunde den Kopf aus dem Sand zu ziehen.“
„Das hat heute schon mal jemand zu mir gesagt. Ein Häftling in einem Arbeitstrupp in Mississippi.“
Molly wollte mit den Einkaufstüten zur Arbeitsplatte gehen, doch sie kam nicht weit. Nach zwei Schritten zerriss eine Tüte und verstreute unser Abendessen auf dem Linoleumboden.
In diesem Moment klopfte Clete Purcel an die Fliegengittertür. „Stör ich?“
2
Clete Purcel hatte mich dazu gebracht, ins Jefferson Davis Parish zu fahren und mich nach den sieben Mädchen und jungen Frauen zu erkundigen, deren Leichen in den letzten Jahren in Gräben und Sumpfgebieten gefunden worden waren. Vor zwei Wochen war der Leichnam einer Frau, hinter der Clete wegen Kautionsflucht her gewesen war, auf dem Grund eines erst kürzlich entwässerten Kanals entdeckt worden. Ihr halb verwestes Gesicht war von Algen überzogen, als hätte man sie in schmutzige Plastikfolie gehüllt. Der Rechtsmediziner meinte, sie sei an schweren Verletzungen gestorben. Vielleicht war sie von einem Auto angefahren worden und in den Kanal gestürzt. Es konnte aber auch ganz anders gewesen sein.
Clete war als Privatdetektiv tätig und hatte ein Büro an der Main Street hier in New Iberia und eines an der St. Ann Street im French Quarter in New Orleans. Seine Routinearbeit spulte er mit einer Mischung aus Langeweile und Verachtung für die Leute ab, die er aufspürte und an zwei Kautionsagenten in New Orleans auslieferte, Nig Rosewater und Wee Willie Bimstine, die nach Hurrikan Katrina in Konkurs gegangen waren, als FEMA, die nationale Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe, ihre Klienten in alle möglichen, teilweise weit entfernten Städte der Vereinigten Staaten verfrachtete. Davor war Clete der beste Cop gewesen, der mir je begegnet war, sowohl als Streifenpolizist als auch als Ermittler beim NOPD. Leider waren ihm Alkohol, Drogen und eine Vorliebe für verkorkste Frauen zum Verhängnis geworden. Einmal hatte er sich sogar vor einer möglichen Mordanklage nach El Salvador und Guatemala geflüchtet. Dort hatte er als Söldner miterlebt, wie mehr Zivilisten ermordet wurden als einst in Vietnam.
Er war von seinem Naturell her ganz einfach unfähig, maßzuhalten. Hatte er wieder mal zu viel getrunken, bekämpfte er seinen Kater mit Aufputschmitteln und einer bewährten Mischung aus Wodka und Tomatensaft mit einer Selleriestange. Er war der festen Überzeugung, dass vier Fingerbreit Scotch in einem Glas Milch seiner Leber nicht schaden konnten. Seinen übermäßigen Konsum von frittierten Krebsen, Poorboy-Sandwiches und tonnenweise Gumbo kompensierte er mit täglichem Gewichtheben. Sein Mut, seine Heimatliebe, sein Ehrgefühl und seine Treue gegenüber seinen Freunden waren beispiellos. Nie war mir ein besserer und aufrechterer Mensch als er begegnet. Trotz seiner vielen Vorzüge wurde er die Überzeugung nicht los, dass er die Liebe einer guten Frau nicht verdiente und dass sein verstorbener Vater, der Milchmann, der ihn als Jungen misshandelt hatte, ihm über die Schulter guckte und seinen Lebenswandel missbilligte.
Clete war ein Schelm und ein Clown, er war der Schrecken der Mafiosi und ein unerbittlicher Gegner all jener, die Frauen und Kinder nicht mit Respekt behandelten. Er war ein schrulliges Original, ein durchgeknallter Typ, der sich mit dem Geist einer toten Mamasan unterhielt, aber er kannte keine Gnade gegenüber Leuten, die andere ausnutzten oder in irgendeiner Weise ihre Macht missbrauchten. Einmal war er mit einem Bulldozer zur Villa eines Angehörigen des Giacano-Clans gefahren und hatte das ganze Haus niedergerissen. Das war die Seite, die die Welt von ihm zu sehen bekam. In Wahrheit war Clete ein tragischer Held. Feinde hatte er viele: Gangster, korrupte Cops, aber auch Versicherungsgesellschaften, denen er ein Dorn im Auge war. Mehr als einmal hatten Ku-Klux-Klan und Neonazis versucht, ihn umzubringen. Einmal hatte er etwas mit einer Stripperin angefangen und sich dabei Tripper geholt. Seinen unermüdlichen Einsatz hatte er mit zahlreichen Schuss-, Stich- und anderen Wunden bezahlt. Ein Kongressabgeordneter hatte versucht, ihn ins Gefängnis zu bringen. Doch bis heute hatte ihm keiner seiner Gegner etwas anhaben können. Seinen unerbittlichsten Feind trug er in der eigenen Brust.
Ich ging zu ihm in die kühle Abendluft hinaus. Der Wind wehte durch den Bambus entlang der Auffahrt. Seine Haut war von einem frischen Sonnenbrand gerötet. Er trug sein gewohntes Hawaiihemd und eine Sonnenbrille, in der sich Bäume und Wolken und sein rostbrauner Cadillac mit dem weißen Verdeck spiegelten. Er griff durchs Fahrerfenster und nahm sich eine offene Bierdose vom Armaturenbrett, dann steckte er sich eine Zigarette in den Mundwinkel und zog sein Zippo hervor. Ich nahm ihm die Zigarette aus dem Mund und schob sie in seine Hemdtasche.
„Muss das sein?“, protestierte er.
„Ja.“
„Was war bei euch in der Küche los?“
„Ich hatte zuvor einen kleinen Wortwechsel mit einem schreibenden Knastbruder, der mit Alafairs neuem Freund abhängt.“
„Meinst du diesen Weingart?“
„Du kennst ihn?“
„Nicht persönlich. Er hat ein schwarzes Mädchen verprügelt, das im Ruby Tuesday serviert.“
„Woher weißt du das?“
„Sie hat’s mir erzählt. Der Typ ist berühmt. Sie war halt beeindruckt – du weißt ja, wie das ist. Diese Mädchen haben noch nichts von der Welt gesehen, waren noch nie weiter weg als Lake Charles – da braucht es nicht viel, damit sie einen Kerl ranlassen.“ Clete nahm einen Schluck Bier. Die eisgekühlte Dose war feucht vom Kondenswasser, seine Lippen hinterließen einen hellen Fleck auf der metallischen Oberfläche. „Ich hab ein Dr Pepper in der Kühlbox“, fügte er hinzu.
„Hab grad eins getrunken. Warum bist du gekommen?“
Seine Augen waren hinter der Sonnenbrille verborgen, doch als er sich mir zuwandte, wusste ich, dass ihm die Schärfe in meiner Stimme nicht entgangen war. „Die Feds ermitteln wegen dieser Morde im Jeff Davis Parish. Sagen sie zumindest. Sie reden von einem Serienkiller, aber das scheint mir nicht sehr plausibel.“
„Lass die Finger davon, Clete.“
„Die Kautionsflüchtige, hinter der ich her war, war 21. Mit 13 kam sie zum ersten Mal mit harten Drogen in Berührung. Sie hätte etwas anderes vom Leben verdient gehabt, als so jung mit gebrochenen Knochen in einem Regengraben zu enden.“
Ich schwieg. Er nahm die Sonnenbrille ab und fixierte mich. Die Haut um seine Augen wirkte unnatürlich weiß. „Na los, sag’s schon.“
„Ich hab nichts zu sagen.“
„Versoffene Privatschnüffler sollen sich nicht in offizielle Ermittlungen einmischen – geht es darum?“
„Ich war in Mississippi und hab mit dem Bruder eines Opfers gesprochen. Danach auch noch mit Herman Stanga.“
„Und?“
„Ich hab nichts erfahren, was mir irgendwie weiterhelfen würde.“
„Heißt das, du verfolgst es nicht weiter?“
„Ich bin nicht zuständig.“
„Und das gilt dann automatisch auch für mich?“
„Das hab ich nicht gesagt.“
„Aber gedacht.“
„Es lässt sich nur von drei der sieben toten Mädchen mit Sicherheit sagen, dass sie ermordet wurden, Clete. Wie die anderen gestorben sind, weiß kein Mensch. Überdosis, Unfall mit Fahrerflucht, Selbstmord – es kann alles Mögliche gewesen sein.“
„Nur drei?“
„Du weißt, wie ich es gemeint habe.“
„Klar.“ Er setzte die Sonnenbrille auf, stieg in seinen Caddy und drehte den Zündschlüssel zornig um.
„Geh nicht so weg.“
„Geh rein und streite weiter mit deiner Familie, Streak. Manchmal machst du mich echt fertig.“
Er setzte den Wagen zurück und zündete sich seine Zigarette an. Ein vorbeikommendes Auto wich ihm mit lautem Hupen aus.
Clete begann mit seiner Suche nach Herman Stanga im alten Rotlichtviertel von New Iberia an der Railroad Avenue, wo einst die weißen Mädchen für fünf Dollar zu haben waren, während die schwarzen Mädchen an der Hopkins Street drei Dollar nahmen. Er kam an den kleinen Zimmern, den sogenannten Cribs vorbei, deren Fenster mit Sperrholz vernagelt waren, an einem Daiquiri-Ausschank und an leerstehenden Häusern, vor denen sich prallvolle Müllsäcke, alte Möbel und zerrissene Matratzen stapelten. Er sah einen von einem Brand geschwärzten Bungalow, der heute als Absteige für Heroinsüchtige diente. Es war die eigentümliche Mischung aus Drogensucht, Prostitution und normalem Arbeitsleben, die heute in vielen amerikanischen Städten Normalität war. Clete fuhr die Ann Street hinunter, wo in regelmäßigen Abständen junge schwarze Drogenverkäufer postiert waren. Mit leeren Gesichtern standen sie an der Straße aufgereiht wie Wäscheklammern an der Leine. Ihre Kunden signalisierten mit kurzem Blinken, dass sie Interesse hatten.
Der Himmel war von Regenwolken bedeckt, zwischen denen im Westen die Sonne als kleiner roter Funke hervorguckte. In den Bäumen zwitscherten Vögel.
Clete parkte an einer Straßenecke vor einem schmalen Shotgun-Haus mit abgeblätterter Farbe und wartete. Er saß mit offenem Verdeck im Wagen, den Porkpie-Hut in die Stirn geschoben, die Finger vor der Brust verschränkt, die Augen geschlossen, als würde er schlafen. Drei Minuten vergingen, dann spürte er jemanden dicht neben seinem Gesicht. Er öffnete ein Auge und schaute in das Gesicht eines Jungen, der nicht älter als zwölf sein konnte, eine Baseballkappe auf den Ohren.
„Was wollen Sie, Mann?“, fragte der Junge.
„Ist das jetzt Herman Stangas Beitrag gegen Diskriminierung, dass er Liliputaner einstellt?“
„Ich bin kein Liliputaner. Sie parken vor dem Haus meines Freundes, drum frag ich Sie, was Sie wollen. Falls Sie die Weight Watchers suchen, da sin’ Sie hier falsch.“
„Wenn du so weitermachst, stopf ich dich in den Auspuff.“
„Ändert auch nix. Dann sin’ Sie immer noch ein Dickwanst, der Leute beschimpft.“
„Ich suche Herman Stanga. Ich schulde ihm Geld.“
Der Junge zeigte keine Regung. Es war nicht zu erkennen, ob er die Lüge durchschaute. Er trat einen Schritt zurück, nickte anerkennend und strich mit den Fingerspitzen über das Chrom des Außenspiegels. Sein Kopf war zu klein für den Körper, und der Körper zu klein für die ausgebeulte Hose und das orangeweiße Polyester-T-Shirt.
„Sie fahren in der Gegend herum und bringen den Leuten Geld? Okay, ich nehm’s und geb’s weiter.“
„Wie heißt du?“
„Buford.“
„Sag deinen Eltern, sie sollen was Besseres zum Verhüten nehmen, Buford.“
Das Gesicht des Jungen zeigte eine markante Veränderung, eine tiefe Kränkung, die sich nicht verbergen ließ. Clete legte den Gang ein, um weiterzufahren, hielt dann noch einmal inne. „Wie heißt du mit Nachnamen?“
„Ich hab keinen. Nein, stimmt nicht. Mein Nachname is Leck-mich-Dicker.“
„Steig ein, Leck-mich.“
Der Junge wandte sich zum Gehen. Vier oder fünf Typen beobachteten ihn aus einiger Entfernung.
„Wenn nicht, landest du im Knast“, fügte Clete hinzu und zückte seine Detektivmarke. „Die haben dort eine neue Abteilung für Kleinwüchsige. Du kannst probeweise einsitzen – vielleicht gefällt’s dir und du willst eine Weile bleiben. Deine Partner hier kannst du vergessen. Wenn du im Knast warst, schaut dich keiner mehr an.“
Der Junge zögerte, dann stieg er in den Wagen und verschwand regelrecht in dem großen Ledersitz. Er fuhr mit den Fingern über das blank polierte Holz des Armaturenbretts und betrachtete die grün leuchtenden Anzeigen. „Wo fahren wir hin?“
„Burger King. Ich esse fünfmal täglich. Mein Tank ist gerade leer. Schaffst du einen Hamburger?“
„Hab nix dagegen.“
„Wenn ich dich noch mal dabei erwische, dass du Gras vertickst, bringe ich dich persönlich in den Jugendknast.“
„Wenn Sie ’n Cop wären, wüssten Sie, wo mein Cousin Herman is.“
„Herman Stanga ist dein Cousin?“
„Ich hab Sie bei Ihrem Büro in der Stadt gesehen. Sie sin’ Detektiv.“
„Du bist ganz schön schlau für einen Winzling. Wo ist dein Cousin, Leck-mich?“
„Dort, wo er jeden Abend is, in dem Club in St. Martinville. Sin’ Sie ’n Kinderschänder?“
„Soll ich anhalten und dich in den Boden rammen?“
„Ich frag ja nur. Sie sehen irgendwie krass aus. Fehlt nur noch ein Elefantenrüssel, dann wär’s perfekt.“ Der Junge schob ein Pfefferminzbonbon in den Mund und lutschte hörbar daran herum. Dann schaute er zu den Jungs zurück, die in der Abenddämmerung verschwanden.
„Wie heißt der Club, wo dein Cousin hingeht?“, fragte Clete.
„Ihr Bauch und Ihr Arsch müssen allein schon 300 Pfund wiegen. Wie können Sie mit Ihrem Gewicht Leute verfolgen? Wenn Sie aussteigen, machen Sie Risse in den Asphalt. Das is, wie wenn ein T-Rex daherspaziert. Jurassic Park in New Iberia.“
„Wie heißt der Club?“
„Gate Mouth.“
„Kriegst du den Stoff von den Jungs dort?“
„Ich weiß nich’, was Sie meinen.“
„Die nutzen dich nur aus, Leck-mich. Dein Cousin genauso. Du klingst wie ein aufgeweckter Junge. Warum benimmst du dich nicht so?“
Sie hielten an einer roten Ampel. Der Himmel hatte sich violett verfärbt. Auf der von Geschäften, Discountern und Fastfood-Restaurants gesäumten Querstraße strömten die Autos vorbei. Der Junge namens Buford öffnete die Beifahrertür, stieg aus und schlug die Tür zu. „Danke fürs Mitnehmen, Mr. Dickwanst.“
Dann war er fort.
Der Club lag an einer langen zweispurigen Straße, die am Bayou Teche entlang ins schwarze Viertel von St. Martinville führte, bis zu einem Stadtplatz, der eine schöne Aussicht auf die Eichen, die blühenden Blumen und Elefantenohren am Ufer des Bayou bot. An dem Platz stand eine alte Kirche inmitten von Häusern aus dem 19. Jahrhundert, deren schleichender Verfall den Reiz des Platzes sogar noch erhöhte. Das schwarze Viertel war jedoch eine ganz andere Welt, die sich nicht für Postkartenansichten eignete. Die Rinnsteine waren mit leeren Bierdosen, Weinflaschen und Papierabfällen zugepflastert, aus den Kneipen plärrte laute Jukebox-Musik. Die Lokale spiegelten eine Lebensweise, die von Sozialhilfe und Kautionsbüros geprägt war, und von einem Gefängnissystem, in dem die Missetäter ein- und ausgingen wie durch das Drehkreuz einer U-Bahn-Station, ohne den geringsten sozialen Nutzen.
Im Gate Mouth Club fühlte man sich, als würde einem die Decke auf den Kopf fallen. Die roten Wände leuchteten wie glühende Kohlen. Die Vinylsitze waren zerschlissen, die Tische mit Brandflecken von Zigaretten übersät. Man fühlte sich wie in einer großen, düsteren Schachtel mit aufgemalten Türen und Fenstern. Als Clete eintrat, fühlte er sich sofort wie eingeschlossen, als hätte man ihm die Luft aus den Lungen gesaugt.
Er stellte sich an die Theke und ließ den Hut auf. Seine blaue Sportjacke verdeckte die Handschellen, die er hinten im Gürtel trug, und den blauschwarzen .38er Revolver im Schulterholster. Er war der einzige Weiße in der Bar – trotzdem schaute ihn niemand direkt an. Schließlich kam der Barkeeper herüber, ein feuchtes Geschirrtuch in der Hand, den Blick abgewendet. Sein kahl geschorener Schädel schimmerte im künstlichen Licht. Er wartete schweigend.
„Zwei Fingerbreit Jack und ein Bier zum Nachspülen“, sagte Clete.
Die Frau auf dem Hocker neben ihm stand auf und ging zur Toilette. Der Barkeeper schob seinen Zahnstocher mit der Zunge auf die andere Seite des Mundes, goss den Whiskey ein und zapfte ein Bier. Beides stellte er vor Clete auf Papierservietten ab. Clete nahm einen 20-Dollar-Schein aus der Brieftasche und legte ihn auf die Theke.
„Sonst noch was?“, fragte der Barmann.
„Ich mag die lustige, heimelige Stimmung hier. Bestimmt habt ihr jeden Tag Mardi Gras.“
Der Barkeeper stützte die Arme auf den Tresen, sah ihn mit seinen tief liegenden Augen an und hatte sichtlich Mühe, seine Ungeduld zu bezähmen. „Hat Ihnen irgendwer was getan?“
„Ist die Kneipe nach Gatemouth Brown benannt, dem Musiker?“, fragte Clete.
„Was wollen Sie, Mann?“
„Mein Wechselgeld, wenn’s keine Umstände macht.“
„Geht aufs Haus.“
„Ich bin kein Cop.“
„Dann haben Sie hier erst recht nichts verloren.“
„Okay, der Rest ist für Sie. Ich muss mit Herman Stanga reden.“
Die muskulösen Unterarme des Barkeepers waren mit einfarbigen Tattoos bedeckt.
„Ich arbeite in New Orleans und New Iberia“, erklärte Clete. „Ich verfolge Kautionsflüchtlinge und andere Saftsäcke. Aber deswegen bin ich nicht hier. Wie wär’s, wenn wir den Rassenscheiß mal vergessen?“
Der Barkeeper nahm den Zahnstocher aus dem Mund und schaute zur Hintertür. „Manchmal grillen wir Koteletts – die sind nich’ schlecht. Aber machen Sie mir keinen Stunk da draußen.“
„Ich denk nicht dran.“
Clete goss den Jack Daniel’s ins Bier und leerte den Krug. Durch einen Gang, in dem Kisten gestapelt waren, gelangte er zur Hintertür. Draußen erwartete ihn ein ländliches Idyll, das in krassem Gegensatz zu der düsteren Kneipe stand. Zwischen immergrünen Eichen und Pecannussbäumen, deren Äste mit weißen Lichterketten behangen waren, stand ein aus einem alten Ölfass gebastelter Grill. Der Rauch stieg zu den Baumkronen auf und wehte über den Bayou Teche hinweg. Die Gäste saßen an Picknicktischen und tranken aus roten Plastikbechern. Einige Tische waren mit Kerzen in blauen oder roten Gefäßen beleuchtet, die aussahen wie aus einer Kirche.
Clete hatte Herman Stanga noch nie gesehen, erkannte ihn jedoch anhand der Beschreibungen, die er gehört hatte. Stanga saß mit einer Frau im Schatten einer unbeleuchteten Eiche. Auf beiden Tischenden brannten Kerzen. Die Frau war in den Dreißigern, hatte runde Schultern und Arme. Ihr Aussehen und ihr Kleid erinnerten mehr an eine Frau vom Land als an eine regelmäßige Kneipenbesucherin.
Stanga tippte sich etwas weißes Pulver auf die Haut zwischen Daumen und Zeigefinger und hielt es der Frau unter die Nase. Sie beugte sich vor, hielt sich ein Nasenloch zu und sog das Pulver ein. Ihr Gesicht hellte sich augenblicklich auf.
Clete ging näher heran, bis nur noch ein Baum zwischen ihm und Stangas Tisch war. Ein Windstoß fuhr in die Baumkrone, ließ das Louisiana-Moos rascheln und Blätter auf den Tisch herabfallen. Clete hörte Stanga in dem hypnotischen Stakkato sprechen, das an einen Scat-Sänger aus den 1940ern erinnerte.
„Weißt du, Baby, du bist keine Putzfrau aus den Quarters in Loreauville. Du bist ’ne reife Frau, du weißt, wie die Welt tickt. Es gibt niemanden, auch keinen Mann, der dich zwingen kann, irgendwas zu tun, was du nich’ willst. Genau das brauch ich. Eine starke Frau, die mit Leuten umgehen kann, die das Geschäft am Laufen hält, verstehst du? Mittleres Management, draußen bei den Leuten. Du sorgst dafür, dass die Mädels spuren. Du wärst quasi Superwoman. Musst nich’ mehr diese Scheißkarre fahren. Du kriegst die feinsten Klamotten und ein eigenes Spesenkonto. Und ich sag dir noch was. Ich find dich verdammt attraktiv – aber das Geschäft geht vor. Ich respektiere die Grenzen einer Frau, kannste jeden fragen. Ich bin dein Freund und Geschäftspartner, aber die Basis unserer Beziehung is Respekt. Noch ’ne Prise, Baby?“
Die Augen der Frau, die Stanga während seines Monologs schläfrig und amüsiert betrachtet hatten, hoben sich von seinem Gesicht zu dem Fremden, der plötzlich hinter ihm stand. Stanga drehte den Kopf, das Kerzenlicht flackerte auf seinem Gesicht, und er lachte laut auf. „Die Amerikanische Legion is ein Stück weiter die Straße runter“, sagte er.
„Ein paar von Ihren Mädels haben Nig Rosewater und Wee Willie Bimstine um die Kaution geprellt“, sagte Clete. „Das wär jetzt ’ne Gelegenheit für eine gute Tat. Sie können mir sagen, wo ich die Mädchen finde.“
„Erstens hab ich keine ‚Mädchen‘. Zweitens bin ich nich’ Google. Und drittens …“
„Okay, ich hab’s kapiert.“ Clete zog sein Mobiltelefon aus der Hosentasche, tippte mit dem Daumen etwas ein und schaute auf das Display. „Ein Freund vom Drogendezernat sitzt draußen in meinem Caddy. Er ist zwar nicht im Dienst, aber für Sie macht er vielleicht eine Ausnahme. Wollen Sie mit mir runter zum Bayou gehen oder noch länger hier rumlabern?“
„Hören Sie, ich will keinen Ärger. Ich sitz hier gemütlich mit meiner Freundin und …“
Clete drückte die Sendetaste seines Handys.
„Okay, okay, Mann, ich bin nich’ auf der Welt, um mich zu streiten. Ich bin gleich wieder da, Baby. Bestell uns schon mal was Gutes“, sagte Stanga.
Clete stapfte zwei Schritte vor Stanga die Böschung hinunter, schaute scheinbar sorglos zu den Sternen hinauf und zu den beleuchteten Häusern am anderen Ufer des Bayou. Ein Stück flussaufwärts beförderte ein Schlepper mit eingeschalteten Decklichtern einen Kahn durch die offene Zugbrücke. Clete schaute zum flachen Wasser in Ufernähe, wo die Brassen zwischen den Seerosen nach Futter suchten. Ein Hornhecht umkreiste den Brassenschwarm, der sich unter den Seerosen versammelt hatte. Clete betrachtete das Geschehen in der Natur wie ein Mann, der das Interesse an der Welt verloren hatte und für niemanden eine Bedrohung darstellte.
„Also, wie war das jetzt mit den zwei Juden in New Orleans, die ihren Laden nich’ im Griff haben und die Sie mir auf den Hals hetzen?“, fragte Stanga hinter Cletes Rücken.
Clete rückte schweigend seinen Porkpie zurecht, betrachtete die dunkelgrünen Rückenflossen der Brassen und den wogenden Seerosenteppich.
„Hey, sin’ Sie jetzt taubstumm, oder was? Ich bin immer freundlich, aber was ich gar nich’ abkann, sin’ arrogante weiße Schnösel, die glauben, sie können Leute wie Dreck behandeln. Sie machen mir keine Angst, Mann. Sagen Sie, was Sie zu sagen ham, oder rufen Sie Ihren Freund vom Drogendezernat an, aber hören Sie auf, mich zu nerven.“
„Ich habe eines der toten Mädchen im Jeff Davis Parish identifiziert“, sagte Clete. „Der Kerl, der sie allegemacht hat, hat ihr alle Knochen im Leib gebrochen. War sie eine von Ihren, Herman? Wie viele Mädchen gehen drüben im Jeff Davis für Sie auf den Strich?“
Stanga schnippte mit den Fingern. „Jetzt weiß ich’s. Robo-Cop hat Sie geschickt, stimmt’s? Sie haben ein Büro an der Main Street in New Iberia. Sie sin’ die Feuerwehr für die Jobs, die RoboCop nich’ selber schafft oder die er vermasselt. Okay, dann verrate ich Ihnen mal was, Mann. Ich hab mit gewissen Geschäften nix mehr am Hut. Ich weiß nich’, was Sie vorhin mitgehört haben von dem, was ich zu der Lady gesagt hab, aber ich mach jetzt ganz andere Sachen … Hören Sie mir überhaupt zu, Mann? Ich red nich’ gern mit ’nem Buckel.“
Clete drehte sich langsam um. „Ich bin ganz Ohr.“
„Was ich vorhin gesagt hab – da ging’s um das St. Jude-Projekt. Wir kümmern uns da um Leute, die sonst niemand haben. So was mach ich heute. Mit Zuhälterei hab ich nix mehr am Hut – schon gar nicht mit ’nem Mord, falls Sie so was glauben. Is das jetzt bei Ihnen angekommen?“
„Sie reden von Judas Thaddäus, dem Schutzpatron für hoffnungslose Fälle?“
„Hey, Sie denken mit. Dann war unser kleiner Schwatz ja doch für was gut. Okay, sind wir dann fertig?“
„Nein. Sie haben die Papiere für zwei Kautionsflüchtige unterschrieben, also müssen Sie für den Schaden haften. Drehen Sie sich um und legen Sie die Hände an den Baum.“
Stanga schüttelte empört den Kopf, das Koboldhafte verschwand aus seinem Gesicht und er zeigte unverstellt, was in ihm vorging. „Sie machen sich hier zum Narren, Mann. Wenn Sie mich hoppnehmen, gewinnen Sie nix damit – kein Geld für die zwei Juden und auch sonst nix. Werden Sie erwachsen, Mann. Ich verkauf keinem irgendwas, was er nich’ will. Was glauben Sie, wie ich so lange im Geschäft geblieben bin? Sicher nich’, weil ich Sachen verhökere, die keiner braucht.“
„Umdrehen.“
„Ja, ja, Mann, wie Sie wollen. Ein großer weißer Fettkloß kann sich’s natürlich leisten, in ’nen schwarzen Club reinzuplatzen, Leute zu piesacken und ’nen Mann hoppzunehmen, der ’n bisschen Stoff zur Entspannung bei sich hat. Weil Sie die Welt ja so viel sicherer machen! Vielleicht schaffen Sie es sogar ins Fernsehen – in COPS kommt so was sicher gut an. Mann, was seid ihr alle bloß für Witzfiguren.“
„Halten Sie die Klappe.“
„Das hören Sie wohl nich’ gern, aber es is die Wahrheit. Wenn es keine Leute wie mich gäbe, würden Sie von der Sozialhilfe leben. Schauen Sie sich um, Mann. Haben die Leute hier Angst vor mir oder vor Ihnen? Wer macht ihnen das Leben schwer? Gehen Sie rein und fragen Sie sie. Es gab keine Probleme, bis Sie aufgetaucht sin’.“
Clete drehte Stanga um und stieß ihn gegen den Baum. Er zwang sich, die Wut zu unterdrücken, die in ihm hochkam. Als Stanga sich umdrehen wollte, versetzte Clete ihm einen kräftigen Stoß zwischen die Schulterblätter, trat Stangas Füße auseinander und begann, ihn zu filzen. Er versuchte, die Leute zu ignorieren, die sich oben an der Böschung versammelt hatten.
„Das ist die pure Heuchelei, Mann!“, rief Stanga über die Schulter. „Ihre Sachen riechen nach Gras, Ihre Haut nach Möse. Wahrscheinlich haben Sie gerade ’ne schwarze Frau gepimpert. Und wollen Sie bestreiten, dass Sie sich von den Itakern in New Orleans haben schmieren lassen? Sie können sich kaum die Schuhe binden, weil Ihre Wampe im Weg is, aber platzen hier rein mit ’ner Detektivmarke, die jeder im Internet kaufen kann. Ich würd Sie nich’ mal mein Klo putzen lassen. Nich’ mal die Hundescheiße auf meinem Rasen würd ich Sie wegmachen lassen.“
Cletes rechte Hand zitterte, als er die Handschellen hervorzog.
„Nehmt das mit euren Handys auf, Leute“, rief Stanga den Leuten zu, die die Szene beobachteten. „Schaut, was der Kerl mit mir macht. Ihr habt es alle gesehen. Ich hab nix getan.“
„Halt die Klappe“, knurrte Clete.
„Leck mich, Mann. Ich war mit 15 im Erwachsenenknast. Da waren Typen, gegen die sind Sie ein Waisenknabe. Sie machen mir keine Angst.“
Herman Stangas Hände waren noch ungefesselt, als er sich plötzlich umdrehte und Clete ins Gesicht spuckte.
Später hätte Clete nicht mehr genau sagen können, was er als Nächstes getan hatte. An den Speichel in seinem Gesicht konnte er sich erinnern, auch an die Finger, die Herman Stanga ihm in die Augen stoßen wollte. Er wusste noch, dass er Stanga hochgerissen und gegen den Baum geknallt hatte. Dass er ihn im Nacken gepackt und mit dem Gesicht voraus in die Baumrinde gepfeffert hatte. Das alles war noch im Rahmen. Doch was dann folgte, war selbst für Cletes Begriffe extrem.
Er spürte einen heißen Lufthauch, als hätte jemand neben seinem Kopf einen heißen Backofen aufgemacht. Sein Herz hämmerte gegen die Rippen, das Adrenalin pumpte in seinen Adern, während seine Kräfte ins Übermenschliche wuchsen. Mit einer Hand packte er Stangas Gürtel, mit der anderen seinen Hals. Dann knallte er seinen Kopf gegen den Baumstamm, wieder und wieder, während im Hintergrund Leute schrien. Stangas Körper fühlte sich so leicht wie eine Vogelscheuche in seinen Händen an, die Arme des Mannes schlenkerten schlaff herab.
Als Clete ihn auf den Boden fallen ließ, war Stanga noch bei Bewusstsein. Sein Gesicht zuckte, Blut strömte ihm aus der Nase und der klaffenden Wunde in der Stirn.
Die Bilder und Geräusche, die Clete sah und hörte, als er die Böschung hinauf stolperte, würden ihn für den Rest seines Lebens begleiten. Die Zeugen, die sich oben versammelt hatten, verwandelten sich in seiner Erinnerung in eine Gruppe von Dorfbewohnern in einem asiatischen Land, von dem heute niemand mehr redete. Sie jammerten und flehten um Gnade, die Augen weit aufgerissen vor Angst, die Hände verzweifelt gefaltet.
Ein Gestank stieg Clete in die Nase, wie von fauligem Wasser und Entenkacke, von brennendem Stroh und Tierhaar. Mit dem Ärmel wischte er sich Stangas Spucke aus dem Gesicht, drängte sich zwischen den Leuten hindurch, stolperte, taumelte weiter – ein Mann, der seinen Halt und seine innere Mitte verloren hatte. Der keine sichere Burg hatte, in die er sich flüchten konnte.
3
Der Anruf vom St. Martin Parish Sheriff’s Department kam um 23:46 Uhr. Clete war die zweispurige Straße zum Iberia Parish hinuntergebrettert, als er auf die Straßensperre traf. Statt ruhig und überlegt anzuhalten, lenkte er den Caddy auf eine Erdstraße und versuchte durch ein Zuckerrohrfeld zu entkommen. Am Ende hatte er einen geplatzten Reifen und zehn Meter Stacheldraht unter dem Auto. Die Polizistin, die mich angerufen hatte, kannte ich von den Anonymen Alkoholikern, deren Treffen ich gelegentlich besuchte. Sie hieß Emma Poche und war, so wie ich, einmal beim NOPD gewesen. So wie ich, war sie letztlich wegen ihres Alkoholproblems aus dem Police Department ausgeschieden. Obwohl sie sich bemühte, die Kurve zu kriegen, fürchtete ich, dass sie zu den besonders Gefährdeten gehörte, die immer nur einen Drink vom Abgrund entfernt waren.
Mit gedämpfter Stimme teilte sie mir mit, dass sie nachts als Gefängnisaufseherin aushalf und nicht in offizieller Sache anrief.
„Ich verstehe dich kaum. Ist Clete betrunken?“, fragte ich.
„Schwer zu sagen.“
„Wie bitte?“
„Wenn, dann sieht man es ihm nicht an.“
„Was ist das für ein Lärm im Hintergrund?“
„Vier Deputies versuchen, ihn in eine Isolationszelle zu schaffen.“
Die Küche war dunkel, der Mond stand hoch über dem Park auf der anderen Seite des Bayou. Ich war müde und wollte nicht schon wieder in Cletes Eskapaden hineingezogen werden. „Sag den Jungs, sie sollen ihn in Ruhe lassen. Er beruhigt sich von allein. Das ist so wie bei einem Elefantenbullen, wenn er seine aggressiven Tage hat.“
„Dieser Zuhälter aus New Iberia – wie heißt er noch mal?“
„Herman Stanga?“
„Purcel hat ihn in einer Kneipe auseinandergenommen, mitten im schwarzen Viertel. Und wenn ich sage ‚auseinandergenommen‘, dann mein ich es so. Der Anwalt des Kerls ist gerade hier. Er will deinen Freund wegen schwerer Körperverletzung drankriegen.“
„Stanga muss irgendwas getan haben. Clete vermöbelt niemanden, wenn man ihn nicht provoziert. Sonst würde er sich nicht an einem Drecksack wie Stanga die Finger schmutzig machen.“
„Er hat gerade einen Deputy zusammengeschlagen. Könntest du mal schnell deinen Arsch rüberschwingen, Dave?“
Ich zog mich an und fuhr die 16 Kilometer den Bayou hinauf zum Gefängnis des St. Martin Parish Sheriff’s Department, gleich neben dem Gerichtsgebäude mit seinen weißen Säulen, das in den 1850ern am Stadtplatz errichtet worden war. Emma Poche erwartete mich bereits und führte mich zu der Zelle, in die man Clete gesperrt hatte. Emma war etwa 35, hatte goldblondes Haar und war leicht übergewichtig. Mit ihren roten Wangen erinnerte sie mehr an eine Nordeuropäerin als an eine Cajun. In ihrer Gesäßtasche steckte ein Taschenbuch. Bevor wir zur Zelle kamen, schaute sie sich kurz um und berührte mich am Handgelenk. „Kann es sein, dass Purcel Flashbacks hat?“
„Ja, manchmal.“
„Lass ihn in ein Krankenhaus bringen.“
„Glaubst du, er ist psychotisch?“
„Dein Freund ist weniger das Problem. Eher meine Kollegen – die sind nämlich richtig stinkig auf ihn. Du solltest ihn nicht mit ihnen allein lassen.“
„Danke, Emma.“
„Du kannst mich jederzeit anrufen, Schätzchen.“ Sie zwinkerte, ihr Gesicht völlig ausdruckslos. Sie wartete. „Das war ein Scherz.“