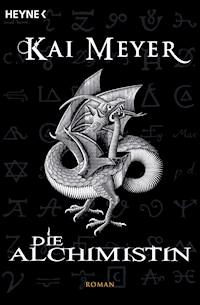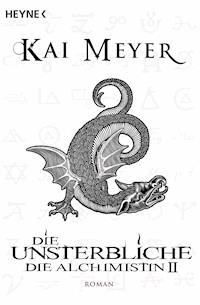9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein magischer Detektivroman im viktorianischen London von Bestseller-Autor Kai Meyer London – eine Stadt im Bann der Bücher. Mercy Amberdale ist in Buchläden und Antiquariaten aufgewachsen. Sie kennt den Zauber der Geschichten und besitzt das Talent der Bibliomantik. Für reiche Sammler besorgt sie die kostbarsten Titel, pirscht nachts durch Englands geheime Bibliotheken. Doch dann folgt sie der Spur der Bücher zum Schauplatz eines rätselhaften Mordes: Ein Buchhändler ist inmitten seines Ladens verbrannt, ohne dass ein Stück Papier zu Schaden kam. Mercy gerät in ein Netz aus magischen Intrigen und dunklen Familiengeheimnissen, bis die Suche nach der Wahrheit sie zur Wurzel aller Bibliomantik führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Kai Meyer
Die Spur der Bücher
Roman
Über dieses Buch
Mercy Amberdale ist in Buchläden und Antiquariaten aufgewachsen. Sie kennt den Zauber der Geschichten und besitzt das Talent der Bibliomantik. Für reiche Sammler besorgt sie die kostbarsten Titel, pirscht nachts durch Englands geheime Bibliotheken.
Doch dann folgt sie der Spur der Bücher zum Schauplatz eines rätselhaften Mordes: Ein Buchhändler ist inmitten seines Ladens verbrannt, ohne dass ein Stück Papier zu Schaden kam. Mercy gerät in ein Netz aus magischen Intrigen und dunklen Familiengeheimnissen, bis die Suche nach der Wahrheit sie zur Wurzel aller Bibliomantik führt.
Vom Autor der Bestseller-Trilogie DIE SEITEN DER WELT
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Erster Teil
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Zweiter Teil
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Dritter Teil
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Nachspiel
50. Kapitel
51. Kapitel
Aus: Bücher wie Sterne – Ein Libropolis-Führer
London – Libropolis 1998, 7. erweiterte Auflage
Penny Dreadful Im viktorianischen England Schmähwort für billige Hefte, in denen Fortsetzungsromane für die Unterschicht veröffentlicht wurden. Gedruckt in hohen Auflagen auf schlechtem Papier. Verwandt mit dem deutschen Groschenheft und dem amerikanischen Pulp-Magazine.
Antiquarisch zu finden in vielen Buchhandlungen überall in Libropolis. Warten Sie geduldig, bis Sie der einzige Kunde sind, und geben Sie sich als Sammler zu erkennen. Sprechen Sie leise. Besonders schockierende Titel werden unter der Theke aufbewahrt. Preise sind selten verhandelbar. Lesen Sie Penny Dreadfuls nicht in der Öffentlichkeit. Schämen Sie sich für Ihre Vorlieben.
Prolog
Das Ende der Turpin Brigade
1
Sie wünschte sich den Geruch der Geschichten zurück, die Behaglichkeit der engen Buchläden ihrer Kindheit. Das Gefühl der Einbände unter ihren Fingerspitzen, wenn sie an den Regalreihen vorüberstrich. Die Gewissheit, dass ein einziger Griff genügte, um in eine andere, eine sichere Welt zu entfliehen.
Aber Mercy Amberdale war eine Gefangene, und der einzige Buchgeruch an diesem Ort ging von ihrem Körper aus. Sie war eine Bibliomantin und ganz allein verantwortlich für ihre missliche Lage.
»Wer bist du?«, rief Madame Xu in den Schacht hinab. »Und vor allem, was bist du?«
»Keine Ahnung, was Sie meinen«, erwiderte Mercy aus der feuchtkalten Dunkelheit.
»Hast du einen Namen?«
»Clara«, sagte Mercy. »Clara Plumpton.«
»Ich kann spüren, wenn du mich belügst.«
»Deshalb sag ich ja die Wahrheit.« Der Trick war natürlich, mit jedem einzelnen Satz zu lügen, dann gab es kein verräterisches Zaudern. Mercy hatte während dieses Gesprächs noch kein einziges Mal die Wahrheit gesagt. Sie spielte auf Zeit. Zeit, die sie ihren Freunden verschaffte. Nur darauf kam es jetzt an.
Madame Xu hatte die Hände hinter ihrem Rücken verschränkt, während sie um den runden Schacht wanderte und aus pechschwarzen Augenschlitzen auf ihre Gefangene blickte. Die alte Chinesin schien die Füße nicht zu heben, während sie sich um das Loch bewegte; sie glitt im Kreis wie eine Aufziehfigur auf einer Spieldose. Dabei strich der Saum ihres goldbestickten Gewandes an der Kante entlang und funkelte im Schein einer Gaslaterne.
Mercy war siebzehn und schon seit drei Jahren Trägerin ihres Seelenbuchs. Sie stand auf dem Grund des Schachts und drehte sich auf der Stelle, um Madame Xu nicht aus den Augen zu verlieren. Immer wieder wischte sie dunkelrote Strähnen aus ihrem Gesicht, die Haare klebten auf ihrer schweißnassen Haut.
Das Loch, in das sie gestürzt war, musste an die zwei Mannslängen tief sein. Die Wände waren glatt, nur ganz oben, außerhalb ihrer Reichweite, ragte das Ende eines rostigen Eisenrohrs aus dem Gestein. Zähe Tropfen aus dunklem Schlamm hingen daran. Immer, wenn die Chinesin das Rohr passierte, löste sich einer davon und fiel zu Mercy in den Schacht.
»Wer hat dich geschickt?«
»Niemand.«
»Du magst noch jung sein, aber bist du wirklich so dumm, auf eigene Faust bei mir einzudringen?«
»Ich stecke in Ihrer Falle fest. Entscheiden Sie.«
Madame Xus trockenes Lachen klang wie das Knirschen von Sand zwischen Glasscheiben. Über ihr wölbte sich ein Ziegeldach, kupfergolden beschienen von der zuckenden Flamme der Gaslaterne. »Du bist in ein Loch gefallen, das ist richtig. Aber vorher hast du dich an vier anderen Fallen vorbeigestohlen. Für ein Mädchen wie dich ist das keine schlechte Leistung.«
»Für ein Mädchen? Sie haben es als Frau an die Spitze von Chinatown geschafft. Sie herrschen über Limehouse – und wahrscheinlich über halb London. Ich glaube nicht, dass Sie einem Mädchen weniger zutrauen als einem Mann.«
»Und das beeindruckt dich?«
»Ja, natürlich.« Mercy hatte die Worte kaum ausgesprochen, als sie begriff, dass sie soeben in die zweite Falle getappt war. Und anders als bei der ersten war es diesmal nicht absichtlich geschehen.
»So also fühlt es sich an, wenn du die Wahrheit sagst.« Madame Xu blieb stehen. Ihr kleines, faltiges Gesicht hellte sich auf. Es sah aus, als würde zerknülltes Pergament glattgezogen. »Du bist keine schlechte Lügnerin, mein Kind. Aber nun warst du zum ersten Mal aufrichtig, und das rückt alles, was du vorher gesagt hast, in ein neues Licht.«
Mercy biss sich auf die Unterlippe, bis es weh tat. Madame Xu mochte geahnt haben, dass sie bislang belogen worden war, aber jetzt wusste sie es mit absoluter Gewissheit. Mercy selbst hatte ihr den Maßstab geliefert, indem sie dieses eine Mal die Wahrheit gesagt hatte. Denn es stimmte – sie war beeindruckt von dem, was die Chinesin erreicht hatte. In ganz London gab es vermutlich nur zwei Frauen, deren Befehle ohne Zögern befolgt wurden. Die andere war Königin Victoria.
Madame Xu war die unumschränkte Regentin von Chinatown, und mit den Kräften, die man ihr nachsagte, hatte sie bereits viele Viertel der englischen Hauptstadt unterwandert. Sie war wie eine dürre, unscheinbare Pflanze, deren wahre Größe sich unter der Oberfläche verbarg, ein Netz aus Wurzelsträngen, das von Temple Park bis zu den Royal Docks, von den Hackney Marshes bis Kensington reichte.
Mercy war sicher, dass sie Madame Xu noch immer überlisten konnte, auch wenn ihr Selbstbewusstsein gerade einen kräftigen Dämpfer bekommen hatte. Xu mochte gewisse Fähigkeiten besitzen, aber Mercy war eine Bibliomantin, eine begabte noch dazu. Sobald sie den richtigen Zeitpunkt für gekommen hielt, würde sie aus diesem Loch schweben und sich mit Hilfe ihres Seelenbuchs einen Fluchtweg bahnen. Je länger Xu sie für ein dummes Ding hielt, das mit mehr Glück als Verstand in ihr Hauptquartier gestolpert war, desto besser.
Besser für Mercy und erst recht für den Rest der Turpin Brigade, der gerade durch einen anderen Winkel dieses Gemäuers schlich. Falls alles nach Plan lief, mussten Grover, Philander und Tempest jetzt kurz vor ihrem Ziel sein. Aber noch waren sie auf Mercys Ablenkungsmanöver angewiesen.
Die Chinesin beugte sich unmerklich vor, während wieder ein Schlammtropfen aus dem Eisenrohr zu Mercy in die Tiefe fiel. Plötzlich befanden sich ihre Hände nicht mehr hinter dem Rücken, sondern vor ihrer Brust. Mercy hatte die Bewegung nicht wahrgenommen. Madame Xu riss ein Streichholz an und warf es brennend in den Schacht. Mercy fing es mit Daumen und Zeigefinger an der sicheren Seite auf, sie war gut in so was.
»Schau dich um«, sagte Xu. »Zu deinen Füßen.«
Mercy zögerte kurz, dann ging sie langsam in die Hocke und schwenkte die Streichholzflamme in einem Halbkreis über den Boden des Schachts.
Im ersten Moment glaubte sie, zwei Flusskrebse wären aus dem Rohr hinunter auf die raue Oberfläche gestürzt. Große Exemplare, die mit den Beinen nach oben leblos auf ihren Rückenpanzern lagen.
Es waren Hände. Finger, die zu Krallen gekrümmt aus dem getrockneten Schlamm ragten.
Mercy hatte den Boden für Zement gehalten, aber nun begriff sie: Dieser Schacht, vielleicht ein alter Brunnen, war einmal sehr viel tiefer gewesen. Madame Xu musste nur den Zulauf öffnen lassen, dann wurde er mit Schlamm vom Grund der nahen Themse geflutet. Unter Mercys Füßen befanden sich vermutlich mehrere ausgehärtete Schichten, jede mannshoch, und in allen waren Menschen eingeschlossen wie Insekten in Bernstein.
Menschen wie Mercy. Einbrecher in Madame Xus Hauptquartier, die leichtsinnig genug gewesen waren, ihr in die Falle zu gehen.
Langsam richtete Mercy sich auf. Am Rand des Rohrs glitzerte ein neuer Tropfen, wurde zu einem zähen Faden, baumelte wie eine vollgefressene Spinne, ehe er abriss und fiel.
»Ich frage dich noch einmal.« Madame Xu setzte sich wieder in Bewegung, glitt geisterhaft um die Öffnung. »Wer hat dich zu mir geschickt? Irgendwer hat es auf etwas abgesehen, das mir gehört. Und du sollst es ihm bringen.«
Xu war keine Bibliomantin, sonst hätte Mercy ihre Aura wahrgenommen. Bibliomanten spürten einander, sobald sie sich nahe kamen. Ahnte die Chinesin trotzdem, wer da in ihrer Falle saß?
Mercy versuchte, sich ihre Verunsicherung nicht anmerken zu lassen. Ihre rechte Hand schob sich in die Tasche ihrer Jacke, und ihre Finger berührten den Einband ihres Seelenbuchs. Der Titel lautete: Mother Damnables Geschenk an das junge Frauenzimmer. Bibliomanten suchten sich ihre Seelenbücher nicht aus. Mercys war zumindest handlich.
»Keiner hat mich geschickt«, log sie, änderte dann ihre Taktik und versuchte, Madame Xu mit einem Teil der Wahrheit zu verwirren: »Ich war neugierig. Ich wollte wissen, wie es ist, als Frau so viele Männer zu befehligen. Wie lebt jemand wie Sie? Und kann man selbst so jemand werden?«
Xu war immun gegen Schmeicheleien. »Du willst etwas stehlen. Aber kein Geld, glaube ich – so eine bist du nicht.« Ihre Runde hatte sie wieder in den Lichtschein geführt, und nun sah Mercy ihr böses Lächeln. »Es ist das Kapitel, nicht wahr? Du hast es auf mein Kapitel des Flaschenpostbuchs abgesehen.«
Mercy wollte etwas antworten, aber die Chinesin ließ sie nicht mehr zu Wort kommen. »Der Auftraggeber ist ein Buchhändler oder Antiquar, möchte ich wetten. Aus der Holywell Street oder dem Cecil Court.«
Das waren die beiden alteingesessenen Straßen der Buchhändler in London. Mercy gab sich alle Mühe, durch keine Regung zu verraten, dass Madame Xu ins Schwarze getroffen hatte.
Mister Ptolemy von Quijote’s Curiosities am Cecil Court hatte ihr einen gewissen Betrag geboten. Einen Betrag, der ausreichte, um die lebensnotwendigen Medikamente für ihren Ziehvater Valentine zu kaufen. Valentine war ebenfalls Buchhändler am Cecil Court und hatte Mercy in seinem Laden großgezogen. Er ahnte nicht, dass sie diesen Handel mit seinem Konkurrenten Ptolemy eingegangen war, sonst hätte er alles getan, um sie davon abzuhalten. Selbst seinen sicheren Tod hätte Valentine in Kauf genommen, um Mercy vor Schaden zu bewahren.
»Holywell Street«, wiederholte Madame Xu in lauerndem Tonfall, »oder Cecil Court?«
»Kenn ich nicht.« Diesmal fand sie selbst, dass die Lüge kläglich misslang. Etwas ging hier gehörig schief. Nicht einmal die Berührung ihres Seelenbuchs spendete Trost.
Xu verschwand hinter der Kante, nur um im nächsten Augenblick wieder aufzutauchen. Jetzt hielt sie in der linken Hand einen Vogelkäfig, geformt wie eine Pagode, und ließ ihn über dem Abgrund baumeln, während sie mit rechts die winzige Gittertür öffnete. Etwas raschelte im Inneren.
»Sieh her.«
Sie schwenkte den Käfig kurz hin und her, dann packte sie ihn mit beiden Händen und schüttelte seinen Inhalt über Mercy aus.
Ein einzelnes Origami fiel aus der Öffnung und stürzte hinab in den Schacht. Mercy wollte herumwirbeln und es auffangen, stolperte aber über eine der totenstarren Hände und fiel auf die Knie. Das Origami landete vor ihr im Halbdunkeln, federleicht und unversehrt: eine winzige Echse, gefaltet aus blütenweißem Papier. Es hob den spitzen Kopf und schien zu ihr aufzublicken, obwohl es keine Augen besaß. Dass es sehen konnte, verdankte es der Bibliomantik, die seinen zarten Körper mit Leben erfüllte.
Sie weiß es, dachte Mercy. Xu hat die ganze Zeit über gewusst, dass ich eine Bibliomantin bin.
Wäre ihr Leben jetzt noch etwas wert gewesen, dann hätte sie es darauf verwettet, dass die Chinesin alle notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte.
»Und nun«, sagte Madame Xu genüsslich, »da wir einen leeren Käfig haben, können wir uns daranmachen, deine drei Freunde einzufangen.«
2
»Die Tür da vorne muss es sein.« Grover beschleunigte seine Schritte, während Philander und Tempest aufholten. Der kräftige, dunkelhaarige Junge lief voraus durch das Zwielicht des Korridors, ein zusammengerolltes Penny-Dreadful-Heft wie einen Schlagstock in der rechten Hand.
»Ich weiß nicht«, flüsterte Philander, als alle drei vor der Tür zum Stehen kamen. »Müssten wir es nicht irgendwie … stärker spüren?«
»Nicht unbedingt«, sagte Tempest. »Hier gibt es noch was anderes, das die Bibliomantik überlagert.« Ihr schwarzes Haar war noch immer kurzgeschoren, obwohl die letzte große Läuseplage in den Armenquartieren von St Giles drei Monate zurücklag. Philander kannte niemanden in den Krähennestern, der derart auf Sauberkeit bedacht war wie Tempest. Darum versuchte auch er, sich jeden zweiten Tag zu waschen und am Morgen den Mund auszuspülen.
»Dann ist Madame Xu also wirklich eine Hexe«, raunte Grover.
»Vielleicht keine echte Hexe«, sagte seine jüngere Schwester leise. »Aber ihr spürt es doch auch, oder?«
Die beiden Jungen sahen einander an und nickten.
Jeder der drei verstand sich auf Bibliomantik, wenngleich auf die denkbar schwächste Weise. Sie schöpften ihre Kraft nicht aus Büchern, sondern aus zerfledderten Penny Dreadfuls, Romanheften aus dünnem Zeitungspapier, was sie aus Sicht der versnobten Bibliomanten zu Dilettanten machte. Mercy war die einzige Bibliomatin, die sich mit ihnen abgab, doch Philander war nie ganz sicher, ob nicht sogar sie insgeheim ein wenig auf ihre drei Freunde herabsah.
Die Turpin Brigade war Mercys Idee gewesen, benannt nach Dick Turpin, dem kühnsten aller Romanhelden aus den Penny Dreadfuls, und obgleich Grover als Anführer der vierköpfigen Truppe galt, war es oft genug Mercy, die die Entscheidungen traf. Möglicherweise weil Grover und sie … Nun, es war ein wenig kompliziert.
Was den Einbruch ins Reich von Madame Xu anging: Philander zweifelte an Mercys Plan, und das schon seit sie ihn der Turpin Brigade zum ersten Mal unterbreitet hatte. Nur damit Tempest ihn nicht für einen Feigling hielt, hatte er sich mit Einwänden zurückgehalten.
Tempest war erst fünfzehn, die Jüngste von ihnen, und sie war zum ersten Mal bei einer Unternehmung der Turpin Brigade dabei. Die beiden Jungen glaubten aus ganz unterschiedlichen Gründen, sie beschützen zu müssen. Dabei sprach einiges dafür, dass die Bibliomantik des Mädchens die ihre bald übertreffen würde; womöglich würde Tempest eines Tages die Penny Dreadfuls hinter sich lassen und ihre Macht aus echten Büchern schöpfen.
Grover ließ seine kleine Schwester nicht aus den Augen. Mit seinen achtzehn Jahren war er der Älteste, Philander war zwei Jahre jünger. Während Grover sich als Bruder für Tempest verantwortlich fühlte, hatte Philander sie insgeheim auf andere Weise gern und hätte sie am liebsten auf der Stelle in Sicherheit gebracht. Der Gedanke, dass ihr etwas zustoßen könnte, ließ ihm keine Ruhe, seit sie Madame Xus Hauptquartier durch einen Abwasserkanal zur Themse betreten hatten.
Grover legte eine Hand auf die Tür, deren Farbe abgeblättert war, schüttelte schließlich den Kopf und gab Tempest einen Wink. »Versuch du’s mal.«
Sie schob sich zwischen Grover und Philander hindurch, das schmale Gesicht zur Tarnung mit Ruß und Kohlenstaub beschmiert. Ihre hellblauen Augen leuchteten darin wie zwei Monde. Die primitive Bemalung wäre nicht nötig gewesen, denn nach der Kletterpartie durch den Kanal sahen die drei aus wie die bedauernswerten Schornsteinfegergehilfen, die von ihren brutalen Meistern durch Londons Schlote gejagt wurden. Gegen deren Martyrium glich selbst die Arbeit als Straßenverkäufer von Zeitungen und Penny Dreadfuls, der die drei tagsüber nachgingen, einem Sonntagsspaziergang im Park. Oder was sie sich darunter vorstellten.
Tempest schloss die Augen, während sie beide Hände an die Eichentür legte, die linke gespreizt, die rechte um ihr Heft geballt. Philander warf Grover einen Blick zu, aber der ältere Junge ließ seine Schwester nicht aus den Augen. Beim ersten Anzeichen einer bibliomantischen Attacke würde er sich zwischen sie und die Tür drängen. Vorausgesetzt, Philander kam ihm nicht zuvor.
Endlich schlug Tempest die Augen wieder auf und nickte langsam. »Da sind Menschen auf der anderen Seite. Eine Menge Menschen. Aber sie fühlen sich so … beschäftigt an. Vielleicht kommen wir an ihnen vorbei, ohne dass sie uns bemerken.«
»Und das Kapitel?«, fragte Grover.
»Die Richtung stimmt. Aber im nächsten Raum ist es noch nicht, glaube ich.«
Philander fluchte leise. Der anonyme Käufer, der den Buchhändler Ptolemy beauftragt hatte, das Kapitel für ihn zu besorgen, hatte einen Lageplan zur Verfügung gestellt, eine ungenaue Skizze, angeblich von einem Spitzel in Xus Organisation. Darauf hatte es ausgesehen, als befände sich die Kammer, in der das Kapitel des Flaschenpostbuches aufbewahrt wurde, am Ende dieses Korridors.
»Gehen wir weiter?«, fragte Tempest.
»Mercy kann Xu nicht ewig ablenken«, gab Grover zu bedenken. Die Sorge um sie schien die Rußflecken um seine Augen noch dunkler zu machen. »Wir müssen entweder sofort weiter oder die ganze Sache abbrechen.«
Weder wussten sie, wie erfolgreich Mercy in ihrem Versuch war, die Aufmerksamkeit der Chinesin auf sich zu lenken, noch wie viel Zeit sie den dreien dadurch verschaffte. Sie waren Fallen und Wachtposten ausgewichen – alle zuverlässig auf der Karte markiert –, aber sie zweifelten nicht daran, dass es noch mächtigere Gegner in diesem Gemäuer gab. Von Madame Xu ganz zu schweigen.
»Alles war umsonst, wenn wir jetzt nicht weitergehen«, sagte Grover, und seine Schwester nickte.
Philander fügte sich in sein Schicksal. Wäre es nötig gewesen, hätte er Tempest bis auf den Mond begleitet.
»Dann los«, sagte Grover und drückte vorsichtig die Klinke hinunter.
Vor ihnen lag eine riesige Halle, durchzogen von Schwaden weißen Wasserdampfes und einem Gewirr von Lauten, die wie Weinen und Wehklagen klangen. Nachdem sich ihre Augen an die nebelhafte Umgebung gewöhnt hatten, erkannten sie, dass die Tür auf eine umlaufende Balustrade im oberen Teil der Halle führte. Auf langen Stuhlreihen, gut drei Mannslängen unter ihnen, saßen Dutzende Frauen, gekleidet in graue Arbeiterkluft. Man hätte meinen können, dass es sich um eine der zahlreichen Kleiderfabriken handelte, die seit einigen Jahren in ganz London aus dem Boden schossen. Doch vor den Frauen standen keine Tische mit Nähzeug. Tatsächlich gab es überhaupt keine Utensilien oder Werkzeuge. Die Frauen saßen nur da, heulend und schluchzend, und tupften sich die Tränen mit weißen Tüchern von den Wangen. Eine Aufseherin, ungemein groß und breit für eine Chinesin, wanderte durch die Reihen und verteilte Hiebe mit einer Rute, wenn eine der Frauen nicht heftig genug weinte. Sie trug das Haar zu einem schweren Zopf geflochten, nach vorn über die Schulter gelegt und geformt wie der Schwanz eines Skorpions.
Handlanger wuselten geduckt zwischen den weinenden Frauen umher, sammelten die tränengetränkten Tücher ein und verteilten trockene. Die benutzten trugen sie in jenen Teil der Halle, wo in gewaltigen Kesseln eine zähe Masse kochte. Die Tücher wurden hineingeworfen, gleichmäßig verteilt auf alle Kessel. Später würde man den Inhalt zu Papier trocknen. Denn Papierherstellung nach chinesischer Tradition war die legale Fassade, hinter der Madame Xu ihre kriminellen Geschäfte verbarg.
»Was, verdammt …«, begann Grover.
»Sie mischen dem Papier Tränen bei«, sagte Philander. »Für Liebesromane. Das verstärkt die Wirkung.« Er wedelte mit dem Penny Dreadful, das er in seiner Linken trug. Längst spürte er kaum noch etwas von der kläglichen bibliomantischen Macht, die den Seiten des Heftes innewohnte. Es mochte wohl wahr sein: Penny-Dreadful-Bibliomanten wie er waren nichts als Amateure, gerade mal gut genug, um kleine Kunststücke zu vollführen, aber weit davon entfernt, es mit jemandem wie Mercy oder gar den Agenten der Adamitischen Akademie aufnehmen zu können.
Penny Dreadfuls waren größer als Bücher, aber kleiner als Zeitungen, mit wenigen engbedruckten Seiten, auf denen nur zwei Arten von Geschichten erzählt wurden: Abenteuer voller Mord und Totschlag oder schwülstige Romanzen.
Tempest runzelte beim Anblick der weinenden Frauen die Stirn und sprach aus, was auch Philander durch den Kopf ging: »Hoffen wir mal, dass sie nur Papier für Schmonzetten produzieren. Und nicht auch Menschenblut beimischen.«
Grover deutete auf eine Tür auf der anderen Seite der Halle, ebenfalls oben auf der Balustrade. »Könnte es dort sein?«
»Merkwürdiger Ort, um etwas so Wertvolles aufzubewahren«, sagte Philander.
Tempest aber nickte. »Fühlt sich gut an. Ich glaube, da müssen wir hin.«
Hier war vermutlich ihre letzte Chance kehrtzumachen, aber keiner der drei sprach es aus. Irgendwo in diesem Gemäuer hielt Mercy gerade den Kopf für sie hin, und sie hatten ihr das Versprechen gegeben, sich nicht ohne das Kapitel aus dem Staub zu machen.
Grover zeigte auf einen Gittersteg, der oberhalb der dampfenden Kessel von einer Seite der Halle zur anderen führte und die Längsseiten der Balustrade miteinander verband. Wahrscheinlich wurden von dort Arbeiter herabgelassen, um die leeren Kessel zu reinigen. Jetzt aber boten die dichten Dampfschwaden von unten einen passablen Schutz, um ungesehen auf die andere Seite zu gelangen – falls sie unterwegs nicht bei lebendigem Leib gedünstet wurden.
Gebückt eilten sie los, erreichten unbemerkt den Steg und schlichen darüber hinweg. Der Dampf, der durch breite Öffnungen im Dach abzog, hüllte sie ein und schien sie nicht mehr loslassen zu wollen. Die Hitze war kaum zu ertragen. Innerhalb von Sekunden fühlte es sich an, als wären sie von Kopf bis Fuß in kochend heiße Tücher gewickelt. Ohne nachzudenken, nahm Philander Tempest bei der Hand, und erst als sie sicher das andere Ende des Stegs erreicht hatten, wurde ihm bewusst, dass sie seine Finger mindestens so fest umklammerte wie er die ihren.
Unter ihnen schrie die Aufseherin mit dem Skorpionzopf eine jammernde Frau an und schlug ihr unbarmherzig mit der Rute ins Gesicht. Dabei wandte sie den dreien den Rücken zu. Jetzt erst bemerkte Philander, dass an den Ausgängen hinter den Stuhlreihen Wächter postiert waren, ein halbes Dutzend Chinesen mit Knüppeln und langen Messern.
Grover erreichte die Tür als Erster und nickte zufrieden. Sie alle konnten es spüren. Die Luft war mit Bibliomantik gesättigt wie die Läden am Cecil Court mit Bücherduft.
Philander behielt die Aufseherin im Blick, während Grover die Tür vorsichtig öffnete. Alle drei schlüpften in den Raum dahinter, der Dampf blieb zurück. Tatsächlich fühlte sich die Luft hier vollkommen trocken an. Einer von Madame Xus Tricks, vermutete Philander, damit ihre Schätze keinen Schaden nahmen.
»Niemand hier«, flüsterte Tempest.
»Ganz sicher?«
»Ja, kein Mensch hier oben.«
Die Wände des Zimmers waren mit weinrotem Samt verhängt. Philander ließ die Tür in seinem Rücken angelehnt. Er hatte Vitrinen mit Kostbarkeiten erwartet oder Truhen voller Gold, womöglich Schränke mit Porzellanfiguren, Schmuck aus Jade, Elfenbein und Alabaster, unbezahlbare Kleinode aus aller Herren Länder. Stattdessen stand in der Mitte des Raumes nur eine einzelne Kiste.
»Es ist da drin«, sagte Tempest. »Ich kann’s spüren.«
Bisher hatte sie immer richtiggelegen, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass Philander misstrauisch blieb. Sie war begabt, aber sie war nicht Mercy. Womöglich lag das Kapitel des Flaschenpostbuchs tatsächlich in dieser Kiste. Die allerletzte Gewissheit würden sie erst haben, wenn sie es mit eigenen Augen sahen.
»Bisschen zu einfach, das alles«, sprach Grover aus, was auch Philander dachte. Trotzdem ging er auf die Kiste zu und legte beide Hände auf den Deckel.
Tempest blieb stehen. Sie schlug ihr Penny-Dreadful-Heft auf und brachte eine Seite dazu, sich stocksteif aufrecht zu stellen. Das Papier spaltete sich und schälte sich auseinander. Zwischen den beiden Lagen strahlte flirrender Lichtschein empor, ein unstetes, flackerndes Seitenherz. Tempest las murmelnd die geheimen Zeilen zwischen den Seiten vor. Philander vermutete, dass sie mit Hilfe der Bibliomantik den Raum nach Fallen absuchte.
Grover aber, den wohl die Sorge um Mercy unvorsichtig machte, hob bereits den Deckel.
»Nicht!«, rief Tempest.
Philander zog gerade noch sein Messer, eine kleine, ungemein scharfe Klinge, mit der er Holzspielzeug schnitzte, wenn er sich nicht gerade auf der Straße verteidigen musste.
Grover öffnete den Mund, als er ins Innere der Kiste blickte. Auch Philander konnte die bauchige Flasche aus trübem Glas sehen, die darin stand. In ihr steckte ein gerolltes Bündel Papier.
Nur war das nicht alles.
Drei Bücher lagen in einem Halbkreis um die Flasche, und als Licht auf sie fiel, wölbten sich ihre Lederdeckel nach oben. Drei Spitzen wuchsen daraus hervor.
Tempest fluchte wie ein Matrose.
Im nächsten Augenblick verfiel die Trilogie von Schnabelbüchern in kreischendes Alarmgeschrei.
3
Mercy wollte sich gerade bücken, um das verängstigte Origami vom Boden aufzuheben, als oberhalb des Schachts metallisches Klappern ertönte.
Sie blickte auf und sah die Scheren.
Madame Xu war einen Schritt zurückgetreten. Wo sie eben noch gestanden hatte, marschierte eine Kompanie blitzender, gekreuzter Klingen auf. Mercy zählte sechs Scheren, die sich auf ihren Spitzen bewegten wie auf Beinen, jede gut einen Fuß hoch. Dabei erklangen leises Quietschen und Schleifen, als würden rasierklingenscharfe Messer gewetzt.
Wie sechs silberne Soldaten standen sie dort oben in einem Halbkreis um den Schacht. Offenbar kontrollierte Madame Xu die Scheren kraft ihrer Gedanken, und so scharrten sie ungeduldig auf dem Steinboden und erwarteten ihre Order.
»Tun Sie das nicht!«, rief Mercy, doch ein schneidender Befehl der Chinesin übertönte ihre Worte.
Alle sechs Scheren machten gleichzeitig einen Schritt über die Kante und fielen senkrecht in die Tiefe. Mercy sprang mit einem Aufschrei zurück, als sich die Spitzen fingerbreit in den getrockneten Boden rammten. Ruckelnd befreiten die Scheren ihre Messer aus der Erde und formierten sich erneut zu einem Halbrund, diesmal um das verängstigte Origami. Zitternd hockte es da, drehte noch einmal das spitze Köpfchen zu Mercy empor, dann sackte es mit einem Rascheln in sich zusammen. Ehe Mercy einschreiten konnte, fielen die Scheren über das kleine Wesen her, ein klappernder Wirbel aus Klingen, beinahe zu schnell für das menschliche Auge. Papier flog in alle Richtungen, und schon im nächsten Moment war von dem Origami nichts übrig außer winzige Schnipsel.
Mercy holte mit dem Fuß aus und trat die vorderste Schere mit aller Kraft gegen die Wand. Die gekreuzten Klingen prallten dagegen und brachen auseinander. Die fünf übrigen aber rückten nun auf Mercy zu, die sogleich das Buch aus ihrer Tasche zog, um ein Seitenherz zu spalten.
Ihre Augen hatten sich längst an die Dunkelheit hier unten gewöhnt, aber das wäre nicht nötig gewesen, um zu erkennen, dass sie getäuscht worden war. Was sie da in Händen hielt, war nicht ihr Seelenbuch. Chinesische Schriftzeichen bedeckten die Seiten. Sie meinte ein hämisches Lachen zu hören, doch als sie hasserfüllt nach oben blickte, sah sie in das ernste, verschlossene Gesicht der alten Frau.
Madame Xu hielt ebenfalls ein Buch, ein kleiner, schmaler Band mit abgegriffenem Leinen. Sie schlug ihn auf und las den Titel vor: »Mother Damnables Geschenk an das junge Frauenzimmer. Gewiss eine höchst erbauliche Lektüre für eine heranwachsende Dame wie dich. So vieles, das es zu lernen gilt, nicht wahr? So viele Dummheiten, die zu vermeiden wären. So viele Fehler.«
Mercy wollte zu ihr hinaufschweben, endlich aus diesem elenden Loch verschwinden, aber ohne Seelenbuch war das so gut wie unmöglich. Zudem fehlte ihr die nötige Konzentration, der letzte Rest Bestimmtheit, den sie brauchte, um sich in die Luft zu erheben. Sie hatte es geübt, unter Valentines Aufsicht in dem winzigen Hof hinter dem Laden, aber sie konnte nur daran denken, was Madame Xu ihrem Seelenbuch antun würde, und das war, als wollte sie ihr den rechten Arm abschneiden. Ein Seelenbuch und sein Träger waren eins, sie gewaltsam voneinander zu trennen war eine Katastrophe.
Die Sohlen von Mercys groben Schnürschuhen hoben sich ein Stück weit vom Boden, dann sanken sie wieder zurück.
Madame Xu hielt das aufgeschlagene Buch mit beiden Händen, als wollte sie es hoch über Mercys Kopf zerreißen. »Weißt du, wer diese Mother Damnable war?«
»Eine Hexe.« Mercy stand Schweiß auf der Stirn, und ihre Unterlippe bebte. Nicht das Buch!, schrie es in ihren Gedanken, aber sie hatte sich gerade noch genug in der Gewalt, um die Worte nicht laut zu brüllen. »Eine Hexe hier in London, irgendwann im sechzehnten Jahrhundert. Am Ende hat sie der Teufel geholt.«
»Man hört, dass es manchen Hexen so ergeht. Glaubst du an Hexen, meine Kleine?«
Mercy sah aus dem Augenwinkel die Scheren näher kommen. »Ist das wichtig? Am Ende erinnern sich die Leute ohnehin nur an sie, weil irgendwer ein Pub nach ihnen benennt.«
Die Chinesin klappte das Buch wieder zu. Aber sie behielt es weiterhin in der Hand, die Drohung blieb unmissverständlich. »Ich sollte dich auf der Stelle töten.«
Die Scheren klapperten voller Vorfreude.
»Aber ich muss wissen, wer dich zu mir geschickt hat«, fuhr Madame Xu fort. »Wenn ich dich in Streifen schneide wie das arme Ding da unten, dann wird derjenige es wieder versuchen. Und beim nächsten Mal wird er vielleicht keine dummen Kinder schicken, sondern jemanden, der weiß, was er tut.«
Aus dem Rohr fiel ein großer Batzen Schlamm.
»Ich könnte dafür sorgen, dass dir der Morast bis zum Hals steht und dann einfach warten, bis du gesprächiger wirst. Nur erscheint mir das wie Zeitverschwendung, wenn es doch andere Mittel und Wege gibt, dich zum Sprechen zu bringen.«
Mercy hielt nicht viel von ihrem Auftraggeber Ptolemy, er war ein verknöcherter Geizkragen, und sie war sicher, dass er reden würde, sobald Xus Leute in seinem Laden auftauchten. Sie würden herausfinden, dass Mercy in Valentines Haus lebte, und dann würden sie sich auch ihn vorknöpfen. Dabei war sie doch hier, um Valentine zu retten, nicht um ihm noch größere Schwierigkeiten zu bereiten.
»Hast du gewusst, dass das Papier, das euch Bibliomanten so viel bedeutet, in China erfunden wurde?«, fragte Xu, als wäre das mit einem Mal von allergrößter Wichtigkeit.
Mercy schüttelte den Kopf, obwohl sie es selbstverständlich wusste. Sie musste unbedingt Zeit gewinnen, um zurück zu ihrer Konzentration zu finden. Xu wusste Bescheid über Grover und die anderen, und das bedeutete aller Wahrscheinlichkeit nach, dass Mercy die Einzige war, die sie alle vielleicht noch hier rausholen konnte.
Schweiß lief ihr in die Augen, während sie zu der Chinesin hinaufsah und sich Mühe gab, die fünf Scheren zu ignorieren.
»Es wird niemals einen besseren Träger für das geschriebene Wort geben als Papier«, sagte Madame Xu. »Philosophien, Religionen und wissenschaftliche Ideen sind auf Papier entwickelt und verbreitet worden. Jede Kultur, die sich in den letzten zweitausend Jahren mit einer anderen vermischt und dabei eine neue hervorgebracht hat, hat das mit Hilfe von Papier und Tinte getan. Seine Geschichte beginnt im China der Han-Dynastie, dann gelangte es nach Arabien und schließlich über Spanien nach Europa. Ohne seinen Erfinder Cai Lun gäbe es keine Bücher, keine Bibliomanten, wahrscheinlich nicht einmal dich.«
Red du nur, dachte Mercy, ehe sie begriff, dass auch dieser Gedanke sie ablenkte. Ihre Sohlen hoben sich wieder leicht, doch schon im nächsten Augenblick machte eine der Scheren einen Schritt und stach eine Spitze in Mercys Fuß. Der Schmerz raste an ihrem Bein herauf, und sie sackte zu Boden.
Madame Xu tat, als hätte sie es nicht bemerkt. »Dabei ist das Wunderbarste an einem Buch gar nicht, dass wir die Ideen und Gedanken darin studieren können – nein, wir können sie besitzen, auf dass sie für alle Zeiten uns gehören.« Sie presste Mercys Seelenbuch an ihre flache Brust. »Wir können einem Buch einen ganz besonderen Platz in unserem Leben einräumen. Wir können darin blättern, wann immer wir wollen, und bewundern, wie das Licht die Struktur des Papiers zum Vorschein bringt, mal fein und glatt, mal grob und faserig. Papier ist kostbarer als Gold, kostbarer als Menschenleben. Macht über Papier bedeutet Macht über die Welt. Aber du bist Bibliomantin. Du weißt, wie kostbar ein Buch sein kann, nicht wahr?«
»Lassen Sie es in Frieden!«, schrie Mercy den Schacht hinauf. Plötzlich hatte sie keinen Zweifel mehr, dass in den dürren Armen der Frau genug Kraft steckte, um das geschlossene Buch entzweizureißen.
Die Scheren stoben auseinander und liefen wie schwerelos an der senkrechten Wand hinauf, bis sie sich auf Höhe von Mercys Gesicht befanden. Zwei stießen sich ab und landeten mit den Spitzen auf ihren Schultern, ritzten ihre Haut unter dem einfachen Wollkleid. Mercy konnte die Kälte des Stahls an ihren Ohren spüren. Vor ihr an der Wand tänzelte eine dritte Schere auf einer Spitze, spreizte ihre eisernen Schenkel wie zum Spagat und zeigte mit der zweiten Klinge fast waagerecht auf Mercys Augen.
»Blindheit ist der größte Feind der Bibliomanten«, sagte Madame Xu. »Du musst die geheimen Worte im Seitenherz lesen können, um deine Bibliomantik zu wirken. Die Vorstellung, dein Augenlicht zu verlieren, muss dir große Angst machen.«
»Ich fürchte mich nicht vor Ihnen!« Das war keine bewusste Lüge mehr, nur noch Trotz. Wie vermessen war es gewesen zu glauben, dass sie mit ihren kaum erprobten Fähigkeiten gegen jemanden wie Madame Xu bestehen könnte.
Die Chinesin schüttelte fast mitleidsvoll den Kopf und schnippte einmal mit den Fingern. Hinter ihr erklangen hastige Schritte. »Es ist an der Zeit, dass wir beide uns endlich näher kennenlernen.«
4
Die drei Schnabelbücher schrien wie am Spieß, ein hoher, durchdringender Ton. Aus ihren Einbänden ragten dünne Schlangenhälse, an deren Enden augenlose Köpfe mit Schnäbeln saßen. Man hätte sie für alberne Handpuppen halten können. Philander wollte eines am Hals packen und aus der Kiste zerren, aber sogleich stieß einer der anderen Schnäbel vor und hackte ihm mit aller Kraft in den Finger. Fluchend zog er den Arm zurück.
»Zur Seite!«, rief Tempest. Licht fiel aus dem Seitenherz ihres Penny-Dreadful-Hefts, gleich darauf bewegte sie lautlos ihre Lippen. Dort, wo sich das Blatt gespalten hatte, war eine bläuliche Schrift erschienen. Sie war nicht so deutlich wie in einem echten Buch, die Worte nicht so machtvoll, doch Tempest gelang es, die Kraft zu bündeln und als Druckstoß gegen die Schnabelbücher zu schleudern. Die drei elastischen Hälse wurden von einer unsichtbaren Faust nach hinten geschleudert und krachten gegen die Holzkante der Kiste. Benommen sackten sie in sich zusammen, nur einer der Schnäbel wimmerte leise.
Auch die Flasche, in der das gerollte Kapitel steckte, war von dem Stoß erfasst worden, allerdings nur gegen die drei Bücher geprallt und dadurch unversehrt geblieben.
»Gut gemacht!« Grover streckte die Hand nach der Flasche aus, als Schritte über den Steg draußen in der Halle polterten. Madame Xus Schergen ließen nicht lange auf sich warten.
Philander wollte ein eigenes Seitenherz spalten, doch das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen – er war darin längst nicht so gut wie Tempest und Grover. Stattdessen ließ er sein Messer von einer Hand in die andere springen, so wie er es tat, wenn ihn draußen die Kerle von Rudelkopfs Bande in die Zange nahmen.
Als er die schiere Menge an Männern sah, die durch die schmale Tür in den Raum strömte, wusste er, dass sie verloren waren.
»Die haben gewusst, dass wir kommen!« Grover hielt sein flatterndes Heft aufgeschlagen in der linken Hand. Er schleuderte einen Druckstoß in den Pulk ihrer Gegner und schnaubte vor Genugtuung, als gleich zwei von ihnen durch die Tür gefegt wurden, gegen andere draußen auf der Balustrade prallten und sie über die Brüstung hinab in die Halle stießen.
Tempest tat es ihm gleich, während Philander sein Bestes gab, um die Männer abzuwehren, die das Mädchen packen wollten. Gleich darauf wurden die Chinesen von Tempests Attacke nach hinten geworfen, stürzten übereinander und rissen weitere mit sich zu Boden.
Trotzdem drängten immer noch mehr Männer herein, allesamt wortlos, nicht einmal Drohungen kamen über ihre Lippen. Ihre Gesichter zeigten keine Mimik, selbst die Wucht der Druckstöße nahmen sie ohne erkennbare Regung hin. Einige trugen lange Messer an ihren Gürteln, manche Revolver, doch sie schienen den Befehl zu haben, die Waffen nicht einzusetzen.
Grover sprengte mit einem weiteren Druckstoß eine Gasse durch den Wall aus Angreifern. Er packte Tempest an der Hand und rief Philander zu: »Jetzt! Komm!«
Alle drei gelangten hinaus auf den Steg. Philander sah erstaunt, dass Tempest das Flaschenpostbuch in einer Hand hielt. Es erschien ihm sonderbar, dass sie tatsächlich noch vollenden könnten, weswegen sie hergekommen waren. Zwei, drei Atemzüge lang machte ihm diese Vorstellung neuen Mut.
Tempest war die Erste, die eingefangen wurde. Ein Mann entriss ihr die Flasche, ein anderer packte sie am Hals. Philander stürzte sich mit einem Aufschrei auf ihn. Dann sah er nur noch eine Wand aus Körpern und spürte ein Trommelfeuer aus Fäusten. Er hörte Tempest schreien, eher zornig als verzweifelt – Gott, sie war so mutig –, und er meinte noch zu sehen, wie Grover sich brüllend über das Geländer schwang und in der Tiefe verschwand, aber dann kamen sie endgültig über ihn und erstickten seinen Widerstand.
5
Mercy war blind.
Sie konnte ihre Umgebung riechen – feuchte, kalte Kellerluft –, und sie nahm die Ausdünstungen der Männer wahr, die sie aus dem Schacht gezerrt und durch eine Tür in ein anderes Gewölbe gestoßen hatten. Aber sie vermochte nichts zu sehen, nur Schwärze, weil sie ihr etwas über die Augen gezogen hatten, das sich wie zwei Schalen an einem Lederband anfühlte.
Erst nach ein paar Sekunden nahm sie am unteren Rand Helligkeit wahr, konnte sogar ein Stück vom Boden erkennen. Was immer sie ihr da übergestreift hatten, es war nicht vollkommen blickdicht.
Kräftige Hände hielten ihre Arme fest.
»Zum letzten Mal«, erklang Madame Xus Stimme, jetzt viel näher und ohne Widerhall von den Schachtwänden. »Wer hat euch zu mir geschickt?«
»Was ist mit den anderen?«
»Sie haben sich tapfer geschlagen. Ich war mir sicher, dass sie in einer meiner Fallen landen würden, aber sie haben mich überrascht. Dabei bist du ihnen weit überlegen. Es war mutig von dir, dich gefangen nehmen zu lassen, um mich von ihnen abzulenken. Mutig und sehr unvernünftig.«
»Was haben Sie mit Ihnen gemacht?«
»Ich habe sie bis ans Ziel kommen lassen, weil sie mich amüsiert haben. Zumindest haben sie bis zuletzt geglaubt, dass es ihr Ziel sei. Aber das echte Kapitel haben sie nie zu Gesicht bekommen – nur eine Attrappe, gewürzt mit einer Prise Bibliomantik. Hast du wirklich geglaubt, es gäbe niemanden von deiner Sorte, der bereit wäre, für mich zu arbeiten?«
Sie hatten nie eine Chance gehabt. Madame Xu hatte gewusst, dass sie kommen würden. Wer auch immer hinter Ptolemys Auftrag steckte, würde es bei einem erneuten Versuch sehr viel schwerer haben. Xu war jetzt gewarnt, und sie würde jedes Mittel einsetzen, damit Mercy ihr einen Namen nannte.
Und wenn Mercy es nicht tat, dann eben einer der anderen. Ihr wurde siedend heiß, als sie an Grover dachte. Mercy hatte ihn und die beiden anderen in dieses Schlamassel hineingeritten, weil sie so sicher gewesen war, Xu überlisten zu können. Ihre Selbstüberschätzung war ebenso anmaßend wie arrogant gewesen.
Sie haben mich amüsiert, hatte Xu gesagt. Wie konnte sie hier bei Mercy sein und gleichzeitig wissen, was anderswo geschah? Es waren wohl genau solche Rätsel, denen Madame Xu ihren Ruf verdankte. Möglich, dass sie nur bluffte. Es spielte keine Rolle mehr.
»Ich weiß nicht, von wem der Auftrag kam«, sagte Mercy. »Und das ist die Wahrheit.«
»Dann nenn mir den Mittelsmann. Jemand hat euch vier angeheuert, ich will seinen Namen.«
Mercy schwieg. Wieder dachte sie an Valentine, der um nichts auf der Welt in diese Katastrophe hineingezogen werden durfte. Valentine hatte sie als kleines Mädchen bei sich aufgenommen, hatte ihr alles beigebracht, was er über Bücher wusste, und durch ihn hatte sie viele glückliche Jahre in den Buchläden am Cecil Court verbracht. Die Krankheit setzte ihm bereits genug zu, und viel schlimmer als jeder Schmerz, den Madame Xu ihr zufügen konnte, war die Gewissheit, dass sie ihm jetzt nicht mehr würde helfen können. Ohne Ptolemys Bezahlung würde Valentine sterben, und es war dieser Gedanke, der sie beinahe in die Knie zwang. Ihre Beine gaben nach, aber sie wurde sofort an den Armen wieder nach oben gerissen. Dabei hätte ihr einer der Kerle fast die linke Schulter ausgekugelt.
»Du willst es nicht anders«, sagte Madame Xu. Ihren Lakaien befahl sie: »Bringt jetzt die Käfer!«
Schritte entfernten sich und kehrten zurück.
»Ich werde dir erklären, was nun geschieht. Die beiden Schalen auf deinen Augen sind Muscheln, ausgesprochen schöne Exemplare. Beinahe schade, dass du sie nicht sehen kannst.«
Die Hände um Mercys Oberarme griffen noch fester zu, die Männer rückten näher. Von hinten packte jemand ihren Schädel und hielt ihn fest, so dass ihr Gesicht starr nach vorn zeigte.
Finger machten sich an der rechten Muschel zu schaffen, hoben sie kurz an und schoben etwas darunter. Noch ehe Mercy klarwurde, was es war, wiederholte sich der Vorgang an der Muschel vor ihrem linken Auge. Instinktiv kniff sie die Lider zusammen. Etwas bewegte sich, krabbelte mit dünnen Beinen über die empfindliche Haut.
»Megalorrhina Acidumi«, erklärte Madame Xu, »eine Käferart aus Borneo. Jeweils einer ist jetzt unter jeder Muschel gefangen. Es sind harmlose Tiere, sie beißen nicht und besitzen keinen Stachel. Aber wenn sie in Panik geraten – und du wirst bald wissen, was wahre Panik ist, mein Kind –, stoßen sie ein Sekret aus, dessen Geruch ihre Gegner abschrecken soll. Unglücklicherweise ist diese Flüssigkeit das pure Gift für deine Augen. Sobald du ein Brennen spürst, bleibt dir noch eine halbe Minute, um sie auszuwaschen.«
Jemand plätscherte demonstrativ in einer Wasserschüssel. Wahrscheinlich der Laufbursche, der die Tiere gebracht hatte.
»Alles ist vorbereitet«, sagte Madame Xu. »Nenn mir nur einen Namen, dann befreien wir die Käfer aus ihrer misslichen Lage und tun, was möglich ist, um deine Augen zu retten. Wir sprachen ja vorhin schon darüber: Was taugt eine Bibliomantin, die nicht mehr lesen kann?«
Mercy hörte kaum noch, was die alte Frau sagte. Das hektische Krabbeln auf ihren Augenlidern beherrschte ihre ganze Wahrnehmung. Sie spürte die Hände der Männer nicht mehr, konnte nicht mehr klar denken und hatte plötzlich Mühe, Luft zu holen. Ihr Herz pochte rasend schnell, ihre Kehle zog sich zusammen. Sie hatte das Gefühl, jedes der winzigen Glieder einzeln zu spüren, hauchzarte Bewegungen, gefolgt von einem leichten Ziehen, wenn sich die Beine mit ihren Widerhaken an ihrer Haut festklammerten. Es fühlte sich an, als rollten Kletten über ihre geschlossenen Augen, eine Berührung, die nicht schmerzhaft war, nur ganz und gar nicht dorthin gehörte.
»Noch suchen die Käfer nach einem Ausweg«, sagte Madame Xu, »aber bald werden sie erkennen, dass es keinen gibt.«
Mercy setzte sich abermals mit ihrem ganzen Körper zur Wehr, warf sich hin und her, schrie Verwünschungen und Beleidigungen, aber es half alles nichts.
»Nur einen Namen«, sagte die alte Frau.
Ptolemy!, brüllte Mercy in Gedanken, brachte die Silben aber nicht über ihre Lippen. Sie konnte den Buchhändler nicht einmal ausstehen, und nun sollte sie für ihn ihr Augenlicht verlieren? Es wäre so leicht gewesen, wenn sie die Gewissheit hätte verdrängen können, dass Ptolemy Madame Xus Leute zu Valentine führen würde. Einfach so zu tun, als ginge es gar nicht um ihn, nur für ein paar Sekunden lang. Aber Mercy liebte Valentine wie einen Vater, und lieber starb sie vor ihm, hier in Limehouse, als dass sie zuließ, dass er in den wenigen Monaten, die ihm noch blieben, in die Hände der Chinesin fiel.
Sie hatte noch nie die Last einer solchen Verantwortung gespürt, nicht nur für Valentine, sondern auch für Grover und die anderen. Sie war so dumm gewesen, so engstirnig im Stolz auf ihre Bibliomantik.
Das Krabbeln wurde schneller, immer wieder stießen die Käfer gegen die Muschelschalen, rasten kreuz und quer auf Mercys Lidern umher.
»Es ist nur ein Wort«, sagte Madame Xu fast hypnotisch. »Nur ein Name, der euch alle rettet.«
Das war eine Lüge. Mercy spürte es, noch während die Chinesin sprach. Bisher hatte Xu stets die Wahrheit gesagt, doch nun klang sie anders, beschwörend, weil sie ganz genau wusste, dass sie die vier Diebe niemals gehen lassen würde. Mercy würde das hier nicht überleben, ganz gleich, wessen Namen sie nannte, und sie würden auch Grover, Tempest und Philander töten.
Noch einmal dachte sie kurz an ihr Seelenbuch, versuchte, in Gedanken danach zu tasten, aber es gelang ihr nicht, weil zu viel auf sie einstürmte.
»Du armes Kind«, sagte Madame Xu, und da spürte Mercy, dass etwas unter den Muschelrändern hervor über ihre Wangen rann, zu zäh und klebrig für Tränen.
Im selben Augenblick begann das Brennen.
6
Philander blickte von oben in die Halle hinab, während die Männer ihn und Tempest zurück auf den Gittersteg über den kochenden Kesseln trieben.
Keine Spur von Grover. Er war entkommen, zumindest fürs Erste, und Philander spürte bei diesem Gedanken eine Mischung aus Erleichterung und Enttäuschung. Grover würde nichts unversucht lassen, um seine Schwester und Philander zu befreien. Zugleich aber hatte er die Befürchtung, dass es zu spät war und dass einzig Mercy stark genug wäre, um es mit einer solchen Übermacht aufzunehmen. Vielleicht wäre sie stark genug. Sicher war das keineswegs, zumal er keine Ahnung hatte, wo sie steckte.
»Mercy wird uns bestimmt zu Hilfe kommen«, raunte er Tempest zu, die auf dem Gittersteg hinter ihm ging. Man hatte ihnen die Hände auf den Rücken gebunden. Er spürte, dass Tempest versuchte, Bibliomantik zu wirken, aber mehr als ein Pulsieren ihrer bibliomantischen Aura brachte sie bei all der Anspannung und ohne ihr Penny Dreadful nicht zustande. Die Hefte hatten die Männer ihnen als Erstes weggenommen und vor ihren Augen in Stücke gerissen.
Philander und Tempest wurden von sechs Chinesen über den Steg gedrängt. Einer von ihnen hatte den Revolver im Anschlag, die anderen die Messer blankgezogen. Vor ihnen stand der heiße Dampf wie eine graue Wand, es stank erbärmlich nach der kochenden Papiermasse in den Kesseln. Die Frauen, die unten in der Halle saßen, weinten nicht mehr, sondern sahen mit starren Blicken zu den Gefangenen hinauf.
Die Aufseherin mit dem Skorpionzopf war verschwunden, doch schon einen Augenblick später entdeckte Philander sie auf einer Treppe, die herauf zum Steg führte. Sie betrat ihn auf halbem Weg zwischen ihnen und dem Wall aus Dampf, eine wuchtige Erscheinung, deren Lächeln keinen Zweifel daran ließ, dass sie diesen Auftritt genoss.
»Wir sind in einen der Romane geraten«, sagte Tempest hinter ihm, und die Hilflosigkeit, die er bei ihren Worten verspürte, zerriss ihm das Herz. »Das alles hier ist wie in den Heften. Wir haben immer gedacht, wir verkaufen den Leuten nur alberne Geschichten über Schurken und Liebespaare. Dabei gibt es das alles wirklich. Es ist alles wahr.«
Schurken. Und Liebespaare.
Philander drehte sich um, ignorierte das Geschrei der Wächter und suchte Tempests Blick. Ihr kurzes Haar glänzte vor Schweiß, und der Ruß war in schwarzen Bahnen über ihr Gesicht gelaufen. Doch ihre Augen leuchteten so hellblau wie immer, und er wusste im selben Moment, dass sie ihre Worte mit Bedacht gewählt hatte. Sie war erst fünfzehn, doch manchmal sagte sie Dinge, die ihn verblüfften. Er hätte sie so gern in die Arme genommen.
»Tempest, ich –«
Eine Hand riss ihn herum. Er blickte in das Gesicht der Aufseherin und stellte verblüfft fest, dass der Zopf selbst aus der Nähe noch aussah wie der Schwanz eines schwarzen Riesenskorpions, so kunstfertig war er geflochten.
Die Aufseherin sagte etwas auf Chinesisch. Sie schlug sich die Rute in die linke Hand, dann trat sie beiseite und gab den Männern einen Wink. Philander und Tempest wurden an ihr vorbei nach vorn gestoßen, weiter den Steg entlang, auf die kochenden, stinkenden Kessel zu.
»Papier für Liebesromane«, raunte die Frau ihm in akzentfreiem Englisch zu. »Ihr beiden seid die perfekte Zutat. Eine herzzerreißende Romanze, die in Tragik und Tod enden muss.«
7
Innerhalb von Sekunden wurde das Brennen unerträglich.
Mercy schüttelte sich, um die Muscheln zu lockern und den Käfern einen Fluchtweg zu bahnen, doch es war längst zu spät. Sie hatten ihr Sekret bereits abgesondert, in ihrer Panik stießen sie es mit ihren Insektenbeinen noch tiefer zwischen Mercys Augenlider. Der Schmerz wurde immer entsetzlicher, aber er war nicht das Schlimmste. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr sie sich vor Blindheit fürchtete, vor einer Welt ohne Licht, ohne Farben, ohne Bücher.
Die Käfer bewegten sich hektischer, klebten in ihren eigenen Säften fest, wehrten sich dagegen und strampelten. Mercy spürte keinen Ekel, nur noch Angst. Die Panik war so überwältigend, dass sie im ersten Moment gar nicht wahrnahm, wie ihr rechter Arm freikam. Gleich darauf der linke.
Mehrere Stimmen brüllten durcheinander, ein Schuss wurde abgefeuert, dann ertönte die Stimme von Madame Xu, die etwas auf Chinesisch rief, immer wieder und wieder, in einem Tonfall, den Mercy von ihr noch nicht kannte – maßlose Wut.
Mercy riss die Hände vors Gesicht und zerrte sich die Muscheln mit den Käfern herunter. Um sie herrschte Chaos, Körper flogen umher, Männer rannten vorwärts und wurden wieder zurückgeschleudert. Mercys Sicht war verschwommen, sie konnte vor lauter Brennen die Augen kaum offen halten. Sie suchte das Wasser, dessen Plätschern sie vorhin gehört hatte. Ihre Hoffnung, dass die Schale in all diesem Trubel nicht umgestoßen worden war, schwand mit jedem Atemzug.
»Mercy!«
»Grover?« Sie traute ihren Ohren kaum. »Grover, hier!«
Natürlich musste er sie längst sehen. Der Raum war nicht groß, das hatte sie bemerkt, ehe sie ihr die Muschelbinde übergezogen hatten. Jemand rannte an ihr vorbei, stieß sie fast um und wurde im nächsten Moment zurück in die entgegengesetzte Richtung geworfen. Erneut peitschten Schüsse, jemand schrie auf – Nicht Grover! Lass es nicht Grover sein! –, gefolgt von chinesischen Rufen, dann einem Stöhnen. Mercy konnte nichts davon zuordnen, selbst die Richtungen gerieten in ihrer Wahrnehmung durcheinander. Ein goldener Schemen huschte vorüber und verschmolz mit dem unscharfen Hintergrund, eine Tür schlug zu, ein Riegel wurde vorgeschoben. Beide Geräusche wiederholten sich. Gab es zwei Zugänge und waren jetzt beide verschlossen?
Und wo war die verdammte Schale?
Madame Xu hatte die Kammer mit ihren unverletzten Gefolgsleuten verlassen. Zugleich war es sehr viel dunkler geworden, nur durch senkrechte Schlitze in den Wänden schien schwaches Licht. Mercy ließ sich auf alle viere fallen und tastete blind über den Boden. Das Brennen tat furchtbar weh, aber sie zwang sich, die Augen aufzureißen, um wenigstens Umrisse zu erkennen, Hindernisse und Gegner. Sie berührte einen zuckenden Körper, ein Verwundeter vermutlich, und zog die Finger gleich wieder zurück. Grover rief, sie solle zu ihm kommen, dann fluchte er und geriet in ein Handgemenge.
Ihre Finger stießen auf Holz, das Bein eines Schemels, und darauf, dem Himmel sei Dank, die Wasserschüssel.
Jemand packte ihren Unterschenkel und riss sie zurück. Beinahe hätte sie dabei den Schemel umgestoßen, hörte die Schale wackeln, dann trat sie mit aller Kraft nach hinten und spürte ein Nasenbein unter ihrer Ferse brechen, ein Gefühl, als hätte sie in einen Haufen Hühnerknochen getreten. Die Hand an ihrem Bein löste sich, aber sie trat sicherheitshalber ein zweites Mal zu.
Ein Schnaufen ertönte wie von einer Dampfmaschine, gefolgt von einem Klirren, als würden schwere Ketten gestrafft. Rumpelnder Lärm setzte ein, grollte kontinuierlich aus allen Richtungen zugleich. Der Boden bebte, als wollte sich Madame Xus Hauptquartier aus seinen Fundamenten erheben.
Drei Schüsse krachten.
»Grover?«
Sie robbte wieder vorwärts, ertastete den Schemel und tauchte beide Hände ins Wasser. Ihre obere Gesichtshälfte schien in Flammen zu stehen, und im ersten Moment spürte sie keine Linderung. Erst als sie mehr Wasser gegen ihre Augen klatschte und mit den Fingern darin rieb, ließ das Brennen etwas nach. Sie konnte etwas sehen, nach wie vor verschwommen, aber sie erkannte die reglosen Körper auf dem Boden und dann auch eine hockende Gestalt, leicht vorgebeugt, mit dunklem Haar. In der linken Hand hielt Grover etwas Helles, sein Penny-Dreadful-Heft, in der anderen einen Revolver. Sie hätte nicht gedacht, dass er mit vier Männern gleichzeitig fertigwerden konnte, aber irgendwie hatte er es geschafft.
Sie taumelte auf ihn zu, rief seinen Namen, doch er reagierte nur verlangsamt, so als wären sie unter Wasser. Stockend hob er den Kopf.
»Sie haben Tempest«, keuchte er. »Philander auch.« Er verstummte, röchelte kurz und setzte dann hinzu: »Du musst ihnen … helfen …«
Noch immer auf den Knien erreichte sie ihn endlich. Sie konnte sein Gesicht kaum erkennen, erahnte es nur wie durch blindes Glas.
»Bist du verletzt?«
Er zögerte einen Herzschlag zu lang. »Geht schon.«
»Wo?«
»Schusswunde, irgendwo hier …«
Sie konnte nicht sehen, worauf er zeigte.
»Wo sind die anderen?«
»Halle … nur den Gang runter … aber die Türen …«
»Die haben uns eingesperrt.«
»Ja«, flüsterte er schwach. »Tempest … Philander kann sie nicht beschützen und –«
»Tempest ist stark genug, sie kann auf sich selbst aufpassen«, schwindelte sie, um ihn zu beruhigen. Sie wollte aufstehen und ihn auf die Beine ziehen, stemmte sich hoch – und stieß sich den Kopf.
»Was, zum Henker –«
Der Maschinenlärm. Zahnräder und Ketten. Das Beben des ganzen Raums. Jetzt ergab alles einen Sinn.
Die Decke senkte sich herab. Eine weitere von Madame Xus perfiden Fallen.
»Müssen raus …«, stöhnte Grover vornübergebeugt. Mercy war nicht einmal sicher, ob er bemerkt hatte, was da von oben näher kam.
Gebückt stolperte sie zum Eingang, nur wenige Schritte von Grover entfernt. Die Tür war aus Metall und gab keinen Fingerbreit nach, als sie die Klinke nach unten riss. Zweimal warf sie sich mit der Schulter dagegen, ehe sie einsah, dass sie nur Zeit verschwendete. So schnell sie konnte, lief sie zurück zu Grover, nahm sein Gesicht in beide Hände und half ihm, sie anzusehen.
»Liegt hier irgendwo mein Seelenbuch?«
»Deine Augen sind … rot …«
»Das Buch, Grover! Ich kann es ohne dich nicht finden.« Sie ließ seinen Kopf los, und er blickte sich tatsächlich um. Schon nach wenigen Sekunden wurde er fündig.
»Warte.« Er kroch an ihr vorbei, über eine Leiche hinweg, dann hielt er etwas hoch, nur ein dunkler Fleck in Mercys Wahrnehmung. Sie folgte ihm, war gleich darauf an seiner Seite und nahm ihr Seelenbuch entgegen. Madame Xu musste es einem ihrer Lakaien zur Aufbewahrung anvertraut haben. Vermutlich dem Mann, der jetzt leblos vor ihnen beiden am Boden lag.
Das Stampfen des Deckenmechanismus und das Reiben von Stein an Stein übertönten Grovers Worte, nicht weil der Lärm lauter wurde, sondern seine Stimme immer leiser.
»Leg dich flach hin«, sagte sie und zog ihn mit sich auf den Rücken. Dabei lehnte sie ihren Kopf und die Schultern gegen den toten Chinesen und legte ihr aufgeschlagenes Seelenbuch vor sich auf den Bauch. Wärme durchströmte sie, das Buch und sie erkannten einander, und das verlieh ihr neue Kraft.
»Kannst du … es aufhalten?«, fragte Grover, als er neben ihr lag.
»Ich versuch’s.«
Sie jagte einen Druckstoß in Richtung der verriegelten Tür und hörte das Metall im Rahmen scheppern, wenn auch nicht nachgeben.
Grover schlug mühsam sein Heft auf, sie hörte das Flattern des Papiers. »Probieren wir’s zusammen.«
Sie bezweifelte, dass er noch genügend Kraft aufbrachte, aber sie nickte ihm zu und zählte von drei rückwärts. Ein Seitenherz zu spalten war auch halbblind kein Problem, aber sie hätte die Schrift darin nicht lesen können, deshalb verschwendete sie keine Zeit mit dem Versuch. Ihr blieb nichts anderes übrig, als die wenige Bibliomantik einzusetzen, die sie auch ohne die Unterstützung des Seitenherzens einsetzen konnte.
Der zweite Stoß fiel bereits schwächer aus als ihr erster, aber mit Grovers Unterstützung wuchs er doch noch zu einer gewaltigen Druckwelle an, die einen der Körper aus dem Weg schleuderte und gegen die Tür krachte. Wieder schepperte es, diesmal kräftiger, gefolgt von einem Quietschen. Das mussten die Scharniere gewesen sein.
»Nicht … geklappt«, sagte Grover. Es versetzte ihr einen Stich, wie schwach er klang. Sie wollte nicht daran denken, dass er womöglich gerade verblutete oder an inneren Verletzungen starb. Sie musste sich konzentrieren, weil ohne ihre Hilfe auch ihre beiden Freunde getötet würden.
»Noch mal«, sagte sie verbissen, aber erst streckte sie im Liegen einen Arm nach oben aus und spürte die Decke an ihren Fingerspitzen. Nicht mehr weit über ihnen.
Grover schwieg.
»Grover?« Sie drehte sich zu ihm um und packte ihn energisch am Arm. Tränen spülten noch mehr von dem Käfersekret aus ihren Augen. »Grover, verdammt!«
»Ich … bin noch da …« Es gelang ihm, ein Lächeln in den Ton seiner brüchigen Stimme zu legen, und da endlich gestand sie sich ein, wie gern sie ihn hatte.
Er hatte das Heft auf seiner Brust liegen und tatsächlich ein Seitenherz gespalten. Das Dröhnen der Decke übertönte die Worte, die er fast lautlos vorlas. Plötzlich geriet das gleichmäßige Rattern und Schmirgeln ins Stocken, hörte kurz auf, setzte dann wieder ein. Staub rieselte an den Wänden herab.