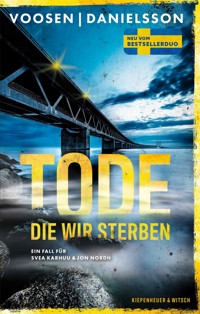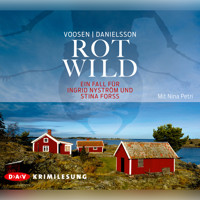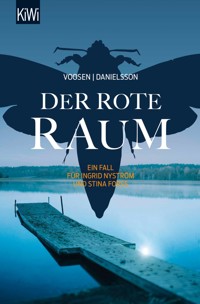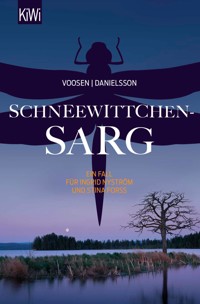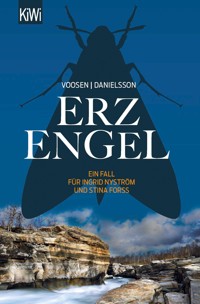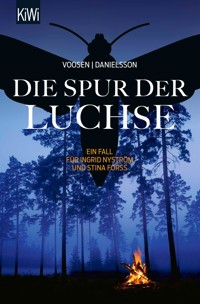
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
Vier Jugendliche, die im Wald verschwinden. Ein altes Verbrechen. Ein mystischer Runenstein auf einer Eichenlichtung und ein politisch umkämpftes Naturreservat. Indian Summerim Småland. Kurz bevor ein lang erwartetes Gerichtsurteil über die Zukunft eines riesigen Naturschutzgebiets entscheidet, erreichen die Proteste gegen eine Rodung des Walds ihren Höhepunkt. In der politisch hochaufgeladenen Situation meldet eine verzweifelte Lehrerin die jugendlichen Teilnehmer einer Schulexkursion in ebenjenem unzugänglichen Waldgebiet als vermisst. Eine großangelegte Suchaktion beginnt und als schließlich ein schwer traumatisiertes Mädchen aufgefunden wird, nehmen auch die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss die Untersuchungen auf. Während das Wetter umschlägt, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit und die beiden Ermittlerinnen geraten in einen Strudel aus brutalen Verbrechen, heftigen politischen Auseinandersetzungen und alten Geheimnissen. Vor dem Hintergrund aktuellster gesellschaftlicher Konflikte erzählen die Autoren einen atemlosen, skandinavisch-düsteren Thriller der Extraklasse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Die Spur der Luchse
Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, geboren 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen und Hamburg.
Kerstin Signe Danielsson, geboren 1983, aufgewachsen in Växjö, studierte und arbeitete in Hamburg und ihrer schwedischen Heimatstadt.
Die Autoren sind miteinander verheiratet und leben mit ihren beiden Kindern im småländischen Berg.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Indian Summer im Småland. Kurz bevor ein lang erwartetes Gerichtsurteil über die Zukunft eines riesigen Naturschutzgebiets entscheidet, erreichen die Proteste gegen eine Rodung des Walds ihren Höhepunkt. In der politisch hochaufgeladenen Situation meldet eine verzweifelte Lehrerin die jugendlichen Teilnehmer einer Schulexkursion in ebenjenem unzugänglichen Waldgebiet als vermisst. Eine großangelegte Suchaktion beginnt und als schließlich ein schwer traumatisiertes Mädchen aufgefunden wird, nehmen auch die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss die Untersuchungen auf. Während das Wetter umschlägt, beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit und die beiden Ermittlerinnen geraten in einen Strudel aus brutalen Verbrechen, heftigen politischen Auseinandersetzungen und alten Geheimnissen.
Vor dem Hintergrund aktuellster gesellschaftlicher Konflikte erzählen die Autoren einen atemlosen, skandinavisch-düsteren Thriller der Extraklasse.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © DEEPOL by plainpicture/Kent Storm; Cristian Gusa/Alamy Stock Foto
ISBN978-3-462-30436-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Tag 1
Tag 2
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Tag 3
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Tag 4
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Tag 5
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Tag 6
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Tag 7
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Tag 8
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Leseprobe »Tode, die wir sterben«
»Hochgeworfen sei der Würfel.«
Gaius Iulius Caesar, nach Plutarch: »Leben des Caesar«
»Playing for the high one, dancing with the devil
Going with the flow, it’s all a game to me
Seven or eleven, snake eyes watching you
Double up or quit, double stake or split«
»Ace of Spades«, Motörhead
Prolog
Daniel spähte aus dem Auto hinaus. Es war böig und regnete. Der Lichtschimmer der im Wind schaukelnden Weihnachtsbeleuchtung auf der anderen Seite des Gebäudes tanzte wie ein heller Schleier über den Läden der Fußgängerzone und tauchte den Parkplatz in Schatten. Ihm ging der Anfang eines Verses durch den Kopf, den er irgendwann einmal in der Schule aufgeschnappt hatte. Nicht, dass er im Unterricht jemals besonders aufmerksam gewesen oder auch nur regelmäßig in der Penne aufgetaucht wäre. Aber die Zeilen waren aus irgendeinem Grund hängen geblieben: Denn die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht … Magnus und er saßen im Dunkeln. Das war gut, denn es bedeutete, dass man sie nicht sah. Auch der Wachmann, der jeden Moment auftauchen musste, um wie jeden Abend seine erste Runde zu drehen, würde sie nicht entdecken. Danach hatten sie für eine ganze Stunde freie Bahn. »Ein Kinderspiel«, hatte Magge gesagt, »das Ganze wird so einfach wie ein Kinderspiel.« Trotzdem zitterte Daniel. Das lag zum einen an der niedrigen Temperatur im Wagen. Um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen, hatten sie den Motor abgestellt, und eine Standheizung gab es nicht. Obwohl Daniel einen gefütterten Parka und Wollsocken trug, kroch die Kälte mit jeder Minute tiefer in die Knochen. Zum anderen war er schlichtweg nervös. Das hier war sein erstes dickes Ding. Das erste Mal, dass Magnus »Magge« Andersson ihn mitnahm. Ein Schwergewicht, ein Profi, einer der wirklich harten Jungs. Das hier war Daniels Chance, richtig groß einzusteigen, und er war fest entschlossen, sie nicht zu vermasseln. Er warf Magge einen Seitenblick zu. Vor dem dunklen Hintergrund ließen sich die Konturen des kahl rasierten Schädels, der flachen Stirn, der knolligen Nase und des mächtigen Kinns gerade eben erahnen. Auch wenn Daniel ihn kaum sah, spürte er neben sich die physische Präsenz des durchtrainierten Riesen. Als wäre Magge ein Planet oder besser noch ein Fixstern, irgendetwas Großes, Mächtiges mit eigener Gravitation. Die Sorte Mann, die einem Widersacher mit einer einzigen Handbewegung das Genick brechen konnte. Was Magge auch schon getan hatte, jedenfalls wenn man wie Daniel den Gerüchten Glauben schenkte, denn Magge wirkte absolut wie einer, der keine Gefangenen machte.
Daniel fummelte das Nokia aus der Parkatasche, bestimmt schon zum zehnten Mal, seit sie hier saßen. 21.55 Uhr. Trotz der Kälte waren seine Finger feucht vor Schweiß. Als er das Handy wieder wegsteckte, wäre es ihm beinahe aus der Hand geflutscht.
»Noch fünf Minuten«, flüsterte er, »zumindest wenn der Wachmann pünktlich ist. Glaubst du, er ist pünktlich?«
Statt einer Antwort grunzte Magge.
Daniel biss sich auf die Zunge. Die Äußerung war komplett überflüssig gewesen. Ein weiteres Zeichen seiner Nervosität. Ein Zeichen von Schwäche. Und warum, zum Teufel, flüsterte er wie ein kleines Mädchen, das seiner Freundin alberne Geheimnisse ins Ohr haucht? Selbst wenn er brüllte, würde ihn außer Magge niemand hören, sie saßen in einem Auto zwischen anderen abgestellten Autos, der Himmel hatte seine Pforten geöffnet, der Wind presste die Regentropfen mit Nachdruck auf das Autodach, und die Temperatur lag knapp über dem Gefrierpunkt, ein Wetter, bei dem kein Mensch freiwillig da draußen unterwegs war.
»Da!«
Die Scheinwerfer eines auf den Parkplatz einbiegenden Wagens streiften die Rückseite des Juweliergeschäfts. Daniel erschrak über seine hohe Stimmlage. Wieder schalt er sich. Er klang ja geradezu hysterisch. Der weiße VW-Caddy hielt direkt vor dem Hintereingang des Juweliers. Trotz des Zwielichts an der Grenze zwischen Hell und Dunkel war das Emblem der Wach- und Schließgesellschaft auf der Fahrertür deutlich zu erkennen. Bei laufendem Motor stieg ein Mann in Regenjacke aus und schaltete eine helle Taschenlampe an. Ihr tastender Lichtfinger fuhr die Gebäude ab und verwandelte den unsichtbaren Regen in einen Hagel aus Silberpfeilen. Der Juwelierladen lag zwischen einem Fachhandel für Fotografie und einem Feinkostgeschäft. Der Wächter schritt die Rückseite der Ladenzeile ab, kontrollierte die Türschlösser der Hinterausgänge, leuchtete in Fenster. Anschließend beeilte er sich, wieder in den Wagen zu steigen. Niemand blieb bei dem Wetter auch nur eine Sekunde länger draußen als unbedingt nötig war, Regenkleidung hin oder her. Der Wächter schlug die Autotür zu, ließ den Motor an, wendete und fuhr davon. Das alles hatte nicht länger als zwei Minuten gedauert.
Wieder grunzte Magge, diesmal klang es zufriedener, befand Daniel.
»Wer solche Trottel beschäftigt, hat es nicht besser verdient.«
»Ganz genau«, beeilte Daniel sich zu sagen.
»Let’s rock.«
Magge öffnete die Wagentür, und Daniel tat es ihm nach. Sie holten die Ausrüstung aus dem Kofferraum. Der eisige Regen klatschte Daniel ins Gesicht und pappte seine Haare strähnig auf die Stirn. Er presste die Kiefer aufeinander, damit Magge nicht bemerkte, dass er mit den Zähnen klapperte. Sie hatten es auf ein kleines, vergittertes Fenster des Juweliergeschäfts abgesehen, den Schwachpunkt im Sicherheitssystem des Ladens. Magge stellte eine Klappleiter auf, stieg bis nach oben und setzte einen Wagenheber zwischen die beiden eingemauerten Metallstreben, die das Fenster von außen sicherten. Seine Bewegungen waren rasch und präzise. Einige Minuten später waren die Gitterstäbe so weit auseinandergespreizt, dass Daniel sich würde hindurchzwängen können. Obwohl er bereits zwanzig war, hatte er den Körperbau eines anorektischen Teenagers. Als Nächstes ließ sich Magge die Bohrmaschine auf die Leiter reichen. Nun stand der kritischste Moment der ganzen Aktion bevor: Mit einem Dreimillimeteraufsatz drillte Magge ein Loch durch den Kunststoffrahmen des Fensters. Anschließend vergrößerte er den Durchmesser, zunächst mit einem Sieben-, dann mit einem Zwölfmillimeteraufsatz. Nun war das Loch groß genug, um ein Spezialwerkzeug einzuführen, mit dem er an den feinen Draht kam, der den Sensor auf der Innenseite der Fensterscheibe mit dem Alarmsystem verband. Was genau er mit dem hochsensiblen Stromleiter anstellte, war Magges Betriebsgeheimnis. In Daniels Augen war es reine Magie, was der gelernte Elektriker mit seinem Zauberkasten anstellte. Er hielt den Atem an. Als Magge schließlich zufrieden grinste, atmete Daniel vor Erleichterung aus. Er nahm das Werkzeug entgegen und reichte Magge den Glasschneider. Kurz darauf hörte er, wie die losgelöste Scheibe auf der anderen Seite der Wand auf dem Boden zersprang. Ein lautes Klirren, das jedoch durch die Windböen und den prasselnden Regen gedämpft wurde. Magge stieg von der Leiter. Nun war Daniel an der Reihe. Er zog den durchnässten Parka aus, reichte ihn Magge, huschte die Sprossen hoch und wand sich rückwärts durch die auseinandergebogenen Gitterstäbe. Wie eine Schlange, dachte er, wie eine schwarze Mamba. Ja genau, so würde er sich in naher Zukunft nennen lassen, Black Mamba, der Schlangenmann. Der gemeinsame Bruch mit Magge würde sich herumsprechen, und niemand würde sich länger über ihn und seine schmächtige Statur lustig machen. Vielleicht würde er sich sogar eine schwarze Mamba auf den Arm tätowieren lassen oder vielleicht sogar auf beide Arme. Zwischen den Metallstäben war es eng, aber er wand sich ohne Probleme hindurch. Magge hatte Daniel mit Bedacht ausgesucht. Viele hielten ihn für einen zurückgebliebenen Riesen, aufgrund der eng stehenden Augen, der hünenhaften Gestalt und seiner legendären Einsilbigkeit, aber Daniel wusste, dass das Blödsinn war. Wer sich wie Magge so lange oben hielt, ohne jemals lange einzufahren, musste es wirklich draufhaben. Vorsichtig kam Daniel auf dem mit Scherben übersäten Teppichboden zu stehen. Er schaltete die Stirnlampe an und orientierte sich. Er befand sich am Ende eines Flurs, kaum zwei Meter vom Sicherungskasten entfernt. Er unterbrach die Stromversorgung des Alarmsystems. Magge hatte ihn detailliert instruiert. Aber natürlich hatte ein Juwelier dieses Kalibers eine zweite, batteriebetriebene Stromversorgung. Daniel sah sich um. Meistens saßen ebenjene leistungsstarken Akkus aus praktischen Gründen nämlich ganz in der Nähe des Sicherungskastens. Warum? Weil Menschen Idioten waren. Diese Weisheit hatte ihm seine Mutter eingebläut, seit er ein Kleinkind war, und die Gültigkeit dieses Grundsatzes hatte er in seinem bisherigen Leben immer wieder erfahren. Sein suchender Blick blieb an einem Bilderrahmen heften, der keinen Meter vom Sicherungskasten entfernt an der Wand hing. Das Motiv, eine verwunschene Seenlandschaft, wirkte in dem kargen Flur merkwürdig fehlplatziert. Er nahm das Bild ab. Bingo. Da war das in die Wand eingelassene Fach für die Akkus. Er trennte auch diese Stromversorgung und ging zur Hintertür, die sich neben dem Fenster befand, durch das er eingestiegen war. Sie war von innen mit zwei massiven Stahlriegeln gesichert, die er löste. Was blieb, war ein einfaches Zylinderschloss, das seinen Dietrichen keine zwei Minuten standhielt. Voilà! Er öffnete die Tür. Magge stampfte mit zwei leeren Reisetaschen herein und warf Daniel eine davon zu. Adrenalingeflasht wie er war, versuchte er sich an einem kecken Spruch.
»Dieses Jahr kommt Weihnachten wohl ein paar Tage früher.«
Magge schnaubte, was man mit etwas Wohlwollen als Lacher deuten konnte.
»Let’s rock«, brummte er zum zweiten Mal.
Sie gingen durch den Flur in den abgedunkelten Verkaufsraum, in dem nur die Schaufensterauslagen beleuchtet waren. Daniel hatte es zwei Tage vorher selbst überprüft: Von außen war alles, was hinter den illuminierten Auslagen vor sich ging, nahezu unsichtbar. Dazu kamen die Wetterverhältnisse und die fortgeschrittene Uhrzeit. Die Wahrscheinlichkeit, von Passanten beim spätabendlichen Schaufensterbummel entdeckt zu werden, tendierte gen null.
In der Tat: Es war ein Gefühl wie Weihnachten. Mit beiden Händen griff Daniel nach hochpreisigen Uhren, schweren Goldketten, fein gearbeiteten Ringen, Diamantarmbändern und schimmernden Perlenohrringen. Er schaufelte die wertvollen Klunker in die Tasche. Systematisch leerte er Schublade für Schublade, während sich Magge mit Spezialwerkzeug dem Tresor widmete, was von Erfolg gekrönt war, denn als das gedämpfte Brummen der elektrischen Geräte schließlich verstummte, schnappte die schwere Metalltür auf. Als sie den Laden samt Tresor leer geräumt hatten, war Daniels Tasche so schwer, dass er sie kaum anheben und tragen konnte, dennoch lächelte er selig, als sie die Beute samt Werkzeug zum Auto trugen und in den Kofferraum wuchteten. Daniel zog eine Rolex hervor, die er beim Einsammeln eingesteckt hatte, und betrachtete sie stolz.
»Die ziehe ich dir von deinem Anteil ab, Kleiner.« Magges stierer Blick lag auf ihm.
»Dass das klar ist.«
»Klar«, druckste Daniel, »ist doch klar.« Er schluckte und wechselte das Thema. »Wir liegen gut in der Zeit. Der Wachmann taucht frühestens in zehn Minuten wieder auf.«
»Ist das so?« Magge kraulte sein mächtiges Kinn. Daniel nahm sein Nokia aus der Hosentasche und kontrollierte die Uhrzeit. Auch wenn die Armbanduhr eine Rolex war, sicher ist sicher. Dann nickte er beflissen.
»Zehn Minuten. Frühestens.«
Die Kleidung klebte an seinem Körper, er bibberte und war bis auf die Haut durchnässt, doch er spürte es kaum. Ein Hochgefühl durchflutete ihn, er war high wie auf Ecstasy.
»Wir haben die Kasse vergessen«, sagte Magge. »Ich gehe noch einmal rein, du setzt dich ans Steuer und lässt den Motor laufen. Licht bleibt aus. Wenn der Wach-Futzi aufkreuzt, hupst du.«
Die überraschende Ansage holte Daniel in die Wirklichkeit zurück. Das war so nicht geplant gewesen. Es war riskant. Es war gefährlich. Wahrscheinlich befand sich in der Kasse doch überhaupt kein großer Geldbetrag, erst recht nicht im Vergleich zu dem, was sie alles hinten im Wagen liegen hatten. Aber Magge widersprach man nicht. Er fing den Autoschlüssel, den Magge ihm zuwarf, und stieg in den Wagen. Magge verschwand im Schatten. Daniel ließ den Motor an. Das Blut rauschte in seinen Ohren, das Herz überschlug sich. Bis jetzt war alles gut gegangen. Aber wozu sich nun verrückt machen? Es blieb genügend Zeit. Ein, zwei Augenblicke noch, dann würde Magge zurückkommen, in den Wagen steigen, und sie würden unbehelligt davonfahren und über alle Berge sein. Er zwang sich, tief durchzuatmen. Schon besser. Er streifte sich die Rolex um das schmale Handgelenk, wo sie hin und her schlackerte. Er würde das Metallarmband kürzen lassen müssen. Trotzdem war er stolz auf die Uhr. Er war stolz auf sich. Magge und er, sie hatten das Ding durchgezogen. Auch wenn sein Anteil nur bei fünf Prozent lag, würde die Beute gutes Geld bringen, sehr gutes Geld sogar. Und, was vielleicht noch wichtiger war, sein Ansehen würde steigen. Er, der Schlangenmensch, die geheimnisvolle Black Mamba. Johan, Freddie, Achmed und die anderen Vollidioten würden ihn jetzt endlich mit Respekt …
Die Scheinwerferkegel tauchten wie aus dem Nichts auf. Verdammt, dachte Daniel, verdammt noch mal! Bitte lass den Wagen weiterfahren, bitte lass ihn nicht auf den Parkplatz einbiegen. Auch wenn ihm nicht ganz klar war, wen er da eigentlich anflehte, denn den Glauben an das Christkind oder Gott oder andere höhere Mächte hatte er bereits im Alter von vier Jahren verloren, als er am Heiligabend nicht die heiß ersehnte Autorennbahn bekommen hatte, die doch sein Herzenswunsch gewesen war, sondern nur eine saftige Ohrfeige und das höhnische Lachen seiner betrunkenen Mutter. Doch es stand außer Frage, dass sein Appell wirklich und wahrhaftig von Herzen kam. Erhört wurde er jedoch nicht. Der Wagen bog auf den Parkplatz ein. Daniel drückte die Hupe. Die tastenden Finger der Autoscheinwerfer fuhren wie beim ersten Mal an der Rückseite der Läden entlang. Da! Das scheibenlose Fenster mit den aufgebogenen Metallstreben war ebenso wie die offen stehende Tür für einen Augenblick deutlich zu erkennen gewesen. Unmöglich, dass der Fahrer des Autos – ja, es war der weiße Caddy des Wachmanns! – das übersehen hatte. Verdammt, verdammt, verdammt! Wo blieb Magge? Daniel hupte erneut. Der Caddy bremste ab und blieb stehen. Die Wagentür öffnete sich, und die Silhouette des aussteigenden Mannes zeichnete sich vor der Innenbeleuchtung des Autos ab. Die Taschenlampe ging an. Sie warf weißes Licht auf die Fassade des Juwelierladens. In diesem Moment kam Magge durch die Tür. Geblendet kniff er die Augen zusammen. Alles geschah völlig lautlos, zumindest kam es Daniel so vor, obwohl es alles andere als still war, denn der Regen trommelte in einer enormen Intensität aufs Autodach, und die Windböen heulten. Wie versteinert saß er auf dem Fahrersitz, dabei wollte er doch handeln, er musste etwas tun, er musste Magge doch zu Hilfe kommen! Aber wie? Während er noch nachdachte, handelte seine Hand von ganz allein. Er schaltete die Scheinwerfer an. Es war nur eine kleine, eine intuitive Bewegung. Aber sie erwies sich als game changer. Das gleißende Licht erfasste den Wachmann, der sich überrascht dem Auto zuwandte. Die Sekunde, die dies in Anspruch nahm, die Sekunde, die Magge nun nicht mehr von der Taschenlampe geblendet war, reichte aus. Dort, wo Magge gestanden hatte, flammte etwas auf, Mündungsfeuer, gleichzeitig knallte es so heftig, dass es selbst das Trommeln des Platzregens und den rauschenden Wind übertönte. Der Wachmann brach zusammen, in der einen Hand einen Schlagstock, in der anderen die Taschenlampe, die nun wegrollte und dabei eine weißblaue Lichtraute über den Boden gleiten ließ. Eine Ewigkeit später – oder waren es nur Sekunden? – wurde die Beifahrertür aufgerissen, und Magge wuchtete den massigen Körper samt Tasche in den Wagen. Der Revolver in seiner Hand rauchte. Wie in einem Kinofilm, dachte Daniel, wie in Bonny und Clyde.
»Worauf wartest du noch?«, raunzte Magge und zog die Beifahrertür zu. »Let’s rock!«
Daniel stieg aufs Gas, bis der Motor aufjaulte, und während er mit dem Schaltknauf manisch im schwergängigen Getriebe herumstocherte, blieb sein Blick auf dem reglos am Boden liegenden Wachmann haften. Im selben Moment fiel ihm der vollständige Vers aus der Schulzeit wieder ein:
Denn die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht, und man siehet die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Endlich fand er den ersten Gang. Er ließ die Kupplung kommen, und der Wagen schnellte mit einem Ruck davon.
Schweden, heute Tag 1
Nomen est omen, dachte Hauptkommissarin Ingrid Nyström und seufzte. Eigentlich hätte man hier den Plural anwenden müssen, aber wer war in Latein schon derart bewandert? Anders, ihr Mann, da war sie sich sicher, aber der war schließlich Pastor und stand ihr gerade nicht zur Verfügung. Die Namen jedenfalls sagten alles, was man über die angespannte Lage wissen musste. Nyström brachte ihren kleinen Toyota auf einem Parkplatz für Tagesausflügler zum Stehen und stieg aus. Es war ein frischer Spätsommermorgen, und die Septembersonne ließ die Blätter der umliegenden Buchen, Eichen, Birken und Linden, der Ahornbäume und Haselnusssträucher in Nuancen von Rot-, Gelb- und Grüntönen leuchten. Es ging um diese Bäume, um genau diesen Wald, an dessen östlichem Rand sie sich nun befand. Der Kern des beinahe neuntausend Hektar umfassenden Mischwaldgebiets stand unter Naturschutz. Jahrhundertelang war es als Riesenkopfwald bekannt gewesen, benannt nach einer markanten felsigen Anhöhe an der Westseite des Areals, die eindrucksvoll die topografische Grenze des småländischen Hochlands markierte. In den vergangenen Jahren hatte sich im Volksmund jedoch zunehmend der Name Lodjurskogen durchgesetzt, der Luchswald, denn in der Tat stellte das Gelände eines der letzten südskandinavischen Habitate der seltenen Raubtiere dar. Diese Bezeichnung verwendeten die Umweltverbände, Naturschutzvereine, Aktivistengruppen und Teile der Presse, während andere Medien, die Regierung und auch Großteile der Opposition, die Regionalverwaltung, der Landkreis und der staatliche Holzkonzern, Eigner von vierundneunzig Prozent des Gebiets, zunächst von der Naturzone 427-B sprachen, was im Laufe der immer härter geführten Debatte um die Zukunft des Waldes jedoch irgendwann auf 427-B verkürzt wurde, ein nüchternes Aktenzeichen, in dem nun wirklich nichts mehr anklang, was irgendwie schützenswert gewesen wäre. Framing, dachte Nyström, beide Seiten lieferten in den Namen ihre Botschaften gleich mit. Die Fronten waren verhärtet, die Situation zugespitzt. Ursache für den Konflikt war das größte Infrastrukturvorhaben des Landes, der Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Stockholm, Göteborg und Malmö. Das Multimilliardenprojekt war eine umweltpolitische Herzensangelegenheit der Regierung und sollte perspektivisch die Zahl der Inlandsflüge drastisch senken. Nachdem jahrelang um Kostenobergrenzen, Streckenführung und einen Wust an Details gerungen worden war, zeichnete sich im Parlament schließlich ein mehrheitsfähiger Konsens ab. Eine Konsequenz dieser Kompromisslösung bestand darin, dass die Bahntrasse ebenjenes Areal 427-B beziehungsweise Lodjurskogen durchschneiden würde. Als Teil der EU-Umweltinitiative Natura 2000 war das Gebiet zwar grundsätzlich geschützt und der Erhaltung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten verpflichtet, allerdings galten hier nicht die strikten Standards eines Naturreservats – in einem gewissen Umfang und unter bestimmten Umständen war die wirtschaftliche Nutzung gesetzlich gestattet. Auf diesen Passus berief sich das Verkehrsministerium, als es die endgültigen Pläne der Trassenführung vorstellte. Aus Sicht der Naturschützer wurde damit jedoch die Büchse der Pandora geöffnet, denn war die Teilung des Gebiets durch eine Schneise in ihren Augen schon an sich eine Bedrohung des Biotops, wurde sie durch die Ankündigung des staatlichen Holzkonzerns, im Fall des Trassenbaus die gesamte nördliche Hälfte des Waldes konventionell zu bewirtschaften, sprich in weiten Teilen abzuholzen, und die Verlautbarung des ebenfalls staatlichen Grubenunternehmens, anschließend die Möglichkeiten zur Erschließung vermuteter Nickelvorkommen zu prüfen, vollends zur ökologischen Katastrophe. Nach erbittert ausgefochtenen Grabenkämpfen – die Umweltschützer forderten, das Gebiet umgehend zum Naturreservat zu erklären – war der Konflikt schließlich vor dem Verwaltungsgericht in Växjö gelandet, wo er seit Monaten verhandelt wurde. Nyström verstand das argumentative Dilemma, deshalb fiel es ihr schwer, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen. Zusammenhängende Waldgebiete waren für den Erhalt biologischer Vielfalt und den Schutz bedrohter Fauna und Flora natürlich lebenswichtig. Gleichzeitig musste sich die Gesellschaft, um die drohende Klimakatastrophe zu verhindern, innerhalb kurzer Zeit drastisch umstellen. Dazu brauchte es Projekte wie die Hochgeschwindigkeitsbahn und die wirtschaftliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, wie Holz einer war. Aber auch den inländischen Abbau von Metallen wie zum Beispiel Nickel, das zum Bau leistungsstarker Batterien benötigt wurde, jedenfalls dann, wenn man diesen eher unangenehmen Aspekt der E-Mobilität nicht vollends auf Entwicklungsländer abschieben wollte, wo der Abbau oft in nicht oder halb legalen Minen unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen und nahezu ohne Umweltauflagen erfolgte. Diese Widersprüche und Zielkonflikte würde auch das lang erwartete Gerichtsurteil nicht aus der Welt schaffen, das für den folgenden Tag angekündigt war. Eben deshalb war sie hier. Sie schloss den Wagen ab, prüfte ihr Spiegelbild in der Fensterscheibe der Fahrertür und fuhr sich mit der Hand durch die praktische Kurzhaarfrisur, die von Jahr zu Jahr mehr graue Strähnen aufwies: bloß nicht zu spießig aussehen bei dem, was sie vorhatte. Dann schulterte sie ihre lederne Umhängetasche – könnte womöglich allein schon das Taschenmaterial als Provokation aufgefasst werden? Na ja, das ließ sich nun auch nicht mehr ändern, außerdem benutzte sie das abgewetzte Ding seit mehr als dreißig Jahren, nachhaltiger ging es ja kaum – und machte sich auf den Weg in den Wald. Green Village, wie die Aktivisten ihre als Protestcamp dienende Baumhaussiedlung samt angeschlossenem Zeltlager nannten, lag etwa zwei Kilometer nördlich ihres Standpunkts. Sie war in den vergangenen Wochen bereits mehrfach in Begleitung dort gewesen und hatte sich mit Sprechern des Camps ausgetauscht. Den Sommer über war die Gruppe beständig gewachsen und umfasste mittlerweile mehr als hundert Bewohner, überwiegend junge Leute. Die Gespräche hatten teils der Vertrauensbildung und Deeskalation, teils der Klärung ganz pragmatischer Fragen gedient, wie zum Beispiel der Wasserversorgung oder der hygienischen Umstände im Camp.
Als Reaktion auf den wachsenden Protest hatte die Regionalverwaltung, in deren Zuständigkeitsbereich das Waldgebiet lag, bereits vor einem halben Jahr eine sogenannte Task Force einberufen. Dort saßen Vertreter der Region Kronoberg, des Landkreises Växjö, ein von der Regierung gesandter stellvertretender Staatsrat, der kurze Kommunikationswege in die Hauptstadt sicherstellen sollte – es war sogar von einem direkten Draht zum Ministerpräsidenten die Rede –, sowie die Polizei, vertreten durch einen hochrangigen Einsatzkoordinator aus Stockholm, und Nyström selbst. Bisher verfolgte die Kommission in Hinblick auf die Aktivisten eine großzügige Linie, was vor allem der öffentlichen Meinung geschuldet war. Rechtlich gesehen hätte das Protestlager längst geräumt werden können, aber niemandem war an Nachrichtenbildern gelegen, die Polizisten in Kampfmontur zeigten, wie sie schluchzende Teenager von Bäumen herunterzerrten oder umweltbewegte Senioren in Trekkingsandalen mit dem Wasserwerfer bearbeiteten. Möglich waren solche Szenen zwar immer noch, aber nach dem von der Kommission erhofften und auch wahrscheinlichen Urteil, das dem Regierungsvorhaben und der damit einhergehenden Rodung grünes Licht geben würde – tatsächlich fanden sich Buchmacher, die Wetten auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens anboten, wie man hörte mit einer Quote von eins zu fünf –, wäre die moralische Legitimation für eine Räumung eine andere. Ein gegensätzliches Urteil war zwar zumindest theoretisch möglich, was die Waldbesetzer zu jubelnden Gewinnern und das Camp ergo überflüssig machen würde, auch wenn die allermeisten Rechtsexperten und Prozessbeobachter nicht damit rechneten. Eine weitere, wenn auch ebenso unwahrscheinliche Alternative: Das Gericht könnte nach ausgiebiger Prüfung der Sachlage seine Nichtzuständigkeit feststellen und das Verfahren an die nächste und gleichzeitig höchste Instanz delegieren, was eine mindestens sechsmonatige Entscheidungsverzögerung zur Folge hätte. Wie viele Protestierer würden nach den ersten richtig kalten Winternächten noch in ihren Baumhütten und Zelten ausharren? Einige. Aber sicher deutlich weniger als im Moment.
So weit die strategischen Überlegungen der Kommission, die allerdings nicht unbedingt Nyströms persönliche Ansichten widerspiegelten. Überhaupt war ihr selbst nach Monaten des Mitwirkens noch schleierhaft, warum sie sich in die Sache hatte hineinziehen lassen. Als Chefin der Kriminalpolizei war sie mit gänzlich anderen Aufgaben betraut und eigentlich auch völlig ausgelastet. Die Idee war auf dem Mist ihres Vorgesetzten Erik Edman gewachsen, des Polizeichefs der Region, der in dieser Position eigentlich für die Task Force prädestiniert gewesen wäre. Doch mit der ihm eigenen Mischung aus durchsichtiger Schmeichelei, ungeschminkter Machtdemonstration, dem Einfordern von Loyalität und alten Gefallen sowie einem Appell an ihr Verantwortungsgefühl hatte Edman sie an seiner statt auf den Kommissionssitz bugsiert. Das Kalkül dahinter war klar: Sollte in polizeilicher Hinsicht irgendetwas schiefgehen, läge das in ihrer Verantwortung und nicht in seiner. Wie immer, wenn viel auf dem Spiel stand, wenn Emotionen, persönliches Engagement, ideologische Gegensätze, wenn wirtschaftliche und politische Interessen involviert waren, konnte auch viel schiefgehen: aus dem Ruder laufende Demonstrationen, Unfälle, Sachbeschädigungen, Anschläge, Angriffe auf Polizisten ebenso wie Polizeigewalt. Neben ihrer eigentlichen Arbeit war sie seit Wochen im täglichen Austausch mit dem Stockholmer Kollegen, der wiederum mit der Säpo zusammenarbeitete, die nachrichtendienstliche Bewertungen der Lage vor Ort lieferte. Offenbar gab es sogar V-Mann-Kontakte, allerdings ragten die nicht in die Szene der radikalen und militanten Umweltschützer hinein, die zwar in der absoluten Minderheit waren, von denen aber das größte Konfliktpotenzial ausging. Für die Urteilsverkündung am kommenden Tag war eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude geplant, zu der Teilnehmer aus allen Ecken des Landes und darüber hinaus erwartet wurden. Allein aus Stockholm war mehr als ein Dutzend Reisebusse angekündigt. Eine bekannte Klimaaktivistin würde eine Rede halten. Man rechnete insgesamt mit vier- bis fünftausend Menschen. In der Innenstadt würden mehrere Hundertschaften der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden. Mehr Kopfzerbrechen bereiteten Nyström jedoch jene Aktivisten, die nicht zu der zentralen Kundgebung gehen, sondern im Wald bleiben würden. Würde der Prozess wie allgemein erwartet zugunsten des Regierungsprojekts enden, waren verschiedene Aktionen zivilen Ungehorsams geplant, vor allem wollte man vom Lager aus in die vorderste Zone eindringen, in der einsatzbereite Forstmaschinen nach der Verkündung und dem Inkrafttreten des Urteils unmittelbar mit der Rodung beginnen würden, um dort durch Sitzproteste oder das Anketten an Bäume den Beginn der Abholzung zu blockieren. Dieser harte Kern bestand zum großen Teil aus den Bewohnern des Protestcamps.
Kommissarin Nyström folgte dem ausgetretenen Weg, den sie in den vergangenen Wochen bereits mehrmals entlangspaziert war. Durch das hohe Blätterdach fielen Kaskaden aus Licht und tupften helle Muster auf den Boden, Impressionisten hätten ihre Freude daran gehabt. Ein leichter Wind ließ die Blätter in den Baumkronen rascheln, und würziger Waldgeruch kitzelte in der Nase: Humus, Pilze, Moos. Es fiel ihr in der Tat schwer, sich vorzustellen, dass all dies schon in kurzer Zeit nicht mehr da sein könnte, und sie fragte sich zum wiederholten Male, warum sie in der Vergangenheit nicht öfter hierhergekommen war, lag Lodjurskogen doch keine halbe Stunde Autofahrt von ihrem Zuhause entfernt. Dabei ging sie gern und oft spazieren, dann aber meistens in den Tannen- und Fichtenwäldern, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft lagen und für Småland so typisch waren. Auf einer Lichtung, an deren Rand der Farn hüfthoch wuchs, blieb sie einen Augenblick stehen und holte tief Luft. Ja, dieser Wald war wirklich ein besonderer Ort. Die Vorstellung, dass ein Teil davon bald gerodet werden würde, war furchtbar, aller Neutralität, der sie sich verpflichtet fühlte, zum Trotz.
Um zum Green Village zu gelangen, hätte sie sich weiter in nördlicher Richtung halten müssen. Stattdessen ging sie jedoch auf den westlichen Rand der Lichtung zu und suchte nach einer Lücke im dichten Farn, die sie nach kurzer Zeit auch fand. Es war der Eingang zu einem schmalen Trampelpfad, der ihr niemals aufgefallen wäre, wenn man ihr nicht die Aufnahmen einer Kameradrohne ausgehändigt hätte. Obwohl ihr die nachrichtendienstlichen Methoden nicht ganz geheuer waren – eins musste man der Säpo lassen: Sie lieferte Ergebnisse. Ohne die Arbeit der Kollegen dort hätten sie von der Aktivistenzelle, die sich Wilde Luchse nannte, nichts erfahren. Die Wilden Luchse sonderten sich vom Rest der Protestbewegung ab. Das galt für die Radikalität ihrer Thesen und Methoden, aber auch ganz konkret räumlich. Die Gruppe, die aus acht bis zehn jungen Leuten bestand, hatte ihr eigenes kleines Lager errichtet, mehrere Kilometer vom Green Village entfernt. Es handelte sich um eine Handvoll Zelte, die im westlichen Teil des Waldes, unweit einer »Riesenkopf« genannten Anhöhe, aufgestellt worden waren. Dort zog sich wie ein Gürtel eine kilometerlange Felsstufe von Nord nach Süd, die zerklüftete Gegend war deutlich unzugänglicher, die Bäume standen dichter, das Unterholz war in Teilen undurchdringbar. Das Zeltlager der Luchse war mithilfe von Tarnnetzen beinahe unsichtbar gemacht worden, doch die Drohnen der Säpo hatten sie trotzdem entdeckt. Dass sich die Gruppe beim Verstecken so viel Mühe gab, sagte schon einiges aus. Das Gefährdungsbild flößte Nyström durchaus Respekt ein. Mehrere der Mitglieder standen im Verdacht, an einer Tierbefreiungsaktion in einer Nerzfarm beteiligt gewesen zu sein, damals unter dem Namen die Wilden Nerze, bei der ein Farmangestellter bewusstlos geschlagen worden war und bleibende Hirnschäden erlitten hatte. Die Gruppe wurde auch mit einer Brandstiftung in Verbindung gebracht, bei der die Vorratshalle eines Kosmetikherstellers in Flammen aufgegangen war. Dabei war zwar niemand verletzt worden, aber ein Sachschaden von mehreren Millionen Kronen entstanden. In einem einschlägigen Internetforum hatten die Luchse für den Fall des Rodungsbeginns verschiedene Aktionen angekündigt, ohne dabei konkret zu werden, aber eine Sabotage der Forstmaschinen galt als eins der möglichen Szenarien. Insofern war Nyströms unangekündigter Besuch nicht ohne Risiko. Es war schwer vorauszusehen, wie die Gruppe auf eine Kontaktaufnahme samt sogenannter Gefährderansprache reagieren würde. Nyström war allein, in Zivil und unbewaffnet. Das alles konnten Vorteile sein. Hier zeigte sich die Staatsmacht nicht mit grimmigem Gesicht und harter Hand, sondern mit einem Lächeln, das Gespräch suchend, vermittelnd. Trotzdem würde die Botschaft den Aktivisten sicherlich nicht schmecken: Wir haben euch auf dem Zettel und behalten euch im Auge, also baut keinen Mist. Es war durchaus vorstellbar, dass man ihr aggressiv begegnete. Frederik Hector, der Stockholmer Einsatzleiter, hatte ihr davon abgeraten, die Gruppe aufzusuchen. Dennoch war sie davon überzeugt, das Richtige zu tun. Auch wenn diese Art der Straftatenprävention in dreißig Dienstjahren nie zu ihrem Aufgabengebiet gehört hatte, war sie doch mit der ihr eigenen empathischen Grundhaltung, Offenheit und Gesprächsbereitschaft, gepaart mit einer klaren Ansprache, meistens an ihr Ziel gekommen. Sie folgte dem Pfad etwa zwei Kilometer. Die Bäume wurden niedriger, das Unterholz dichter. An einer Brombeerranke riss sie sich die Haut am Unterarm auf, an ihren Hosenbeinen sammelten sich Kletten. Der Boden wurde härter und felsiger, es ging bergauf, und sie begann zu schwitzen. Die Luchse hatten sich den Standort ihrer Zelte sorgfältig ausgesucht. Obwohl das Lager relativ nah an der westlichen Waldgrenze lag, war es doch schwer zu erreichen. Entweder musste man wie Nyström auf schmalen Pfaden von Osten, Norden oder Süden weit durch den Wald marschieren oder von Westen her eine Felsstufe hinabklettern. Erschwerend kam hinzu, dass dem westlichen Waldrand ein kilometerweiter Flickenteppich aus Weizenfeldern und Kuhweiden vorgelagert war, der sich über die Hügellandschaft legte. Dort gab es keine öffentlichen Straßen, sondern nur landwirtschaftliche Nutzwege, die so holperig waren, dass man ohne Trecker oder Geländewagen nicht mal in die Nähe des Waldes gelangte. Doch nicht nur deshalb war das Versteck gut gewählt. Das Green Village war am östlichen Waldrand errichtet worden, in unmittelbarer Nähe der angekündigten Rodungsarbeiten, entsprechend lag der Ort auch im Fokus der medialen Berichterstattung und des öffentlichen Bewusstseins. Dabei war vernachlässigt worden, dass der Trassenbau zeitgleich auch am westlichen Waldrand beginnen würde, sogar mit noch viel gravierenderen Eingriffen in die Natur, denn aufgrund der Topologie musste eine breite Bresche in die Felsaufwerfung gesprengt werden. Die Luchse mussten von ihrem Lager aus nur ein wenig klettern, um in die Nähe der dort bereitstehenden Bagger, Tieflader und Forstmaschinen zu gelangen, die alle perfekte Sabotageziele abgaben.
Die Umgebung änderte sich ein weiteres Mal. Die Vielseitigkeit Lodjurskogens war ein Argument, das Naturschützer oft anbrachten, wenn es darum ging, die ökologische Ausnahmestellung des Waldgebiets zu verdeutlichen, zu Recht, wie Nyström nicht umhinkam zu konstatieren. Das verwachsene Unterholz war einem lichten Lärchenhain gewichen. Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte zu den majestätischen Stämmen in ihrem gelb gefärbten Nadelkleid auf. Lärchen waren selten geworden, sie litten wie viele andere Baumarten unter den immer wärmer werdenden Sommern, die Schädlinge wie den Lärchenbock oder den Großen Lärchenborkenkäfer im Gepäck hatten. Auch dieses Jahr war wieder überdurchschnittlich warm und trocken gewesen, in der gesamten Region und den umliegenden Landkreisen herrschte latente Waldbrandgefahr, weshalb offenes Feuer verboten war, was sie und ihre Kollegen auch den Bewohnern des Green Village hatten eintrichtern müssen, denn nicht immer gingen Naturenthusiasmus und Sachkenntnis Hand in Hand. Mittlerweile war die Achtung des Verbots von den Wortführern des Camps konsequent durchgesetzt worden, und auch wenn der eine oder andere sicherlich die fehlende Lagerfeuerromantik vermisste, hatte man die Essenszubereitung komplett auf Feldküchen und Campingkocher umgestellt.
Nyström durchquerte den Lärchenhain. Der Pfad führte auf ein der Felsstufe vorgelagertes Plateau, das wegen seines alten Bestands aus knorrigen, verwachsenen Eichen eine besondere, beinahe verwunschene Atmosphäre hatte. Felsiger und weicher Waldboden wechselten sich ab, oft verschwand der Grund gänzlich unter einem Blätterteppich. Nun konnte es nicht mehr weit sein. Sie bemerkte, dass rechts von ihr auf einer Kuppe in der Mitte der Anhöhe die Eichen in einer auffälligen Formation standen. Deutlich erkennbar formten sie einen Kreis. Der Radius betrug etwa zwanzig Meter. In der Mitte der so entstandenen Lichtung lag ein behauener Findling, dessen Quaderform an einen Altar erinnerte. Neugierig geworden, betrat sie den Baumkreis und schaute sich den Felsen aus der Nähe an. Die Oberseite war mit eingekerbten Runen bedeckt. Nun erinnerte sie sich, vor langer Zeit vom Stein und der Eichenlichtung gelesen zu haben. Jahrhundertelang war er fast vollständig vergraben gewesen, nur eine Ecke hatte aus dem Waldboden herausgeragt. In den Achtzigerjahren war ein Pilze sammelndes Ehepaar auf diese Steinspitze mit Runeninschrift aufmerksam geworden, woraufhin Archäologen den Felsen freigelegt und sein Alter bestimmt hatten. Die damals völlig verwachsene Lichtung war wieder frei geschnitten worden, und der Runenstein wurde für einige Jahre ein beliebtes Ziel von Wanderungen, besonders frisch Verliebten hieß es, sollte er Glück bringen. Irgendwann war er dann mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Steine solcher Art gab es in Småland an die hundert. Nyström strich mit der Hand über den von der Sonne erwärmten Felsen. In der Mitte der kantigen Schriftzeichen prangte ein Kreuz, was auf die etwa achthundert Jahre zurückliegende Christianisierung Südschwedens verwies. Damals hatten die Menschen, die hier lebten, wahrscheinlich existenziellere Probleme als eine umstrittene Zugtrasse gehabt, dachte sie. Andererseits, wenn man die Kontroverse um das Waldgebiet im Kontext des Klimawandels betrachtete …
In dem Augenblick war es plötzlich da, das unbehagliche Gefühl, beobachtet zu werden. Als hätten ihre Sinne unterhalb der Bewusstseinsgrenze etwas bemerkt, eine Bewegung aus den Augenwinkeln, ein leises Geräusch … Sie drehte abrupt den Kopf. Jenseits des Eichenrings ging es steil Richtung Riesenkopf hinauf. Irgendwo dort musste das Lager der Luchse liegen. Sie legte den Kopf in den Nacken und schirmte ihre Augen mit dem Handrücken ab. Dort oben, etwa fünfzig Meter Luftlinie von ihr entfernt, stand jemand und sah auf sie hinunter. Eine junge Frau. Schwarze Hose, schwarze Windjacke, schwarze Schirmmütze. Nyström rief einen Gruß und winkte. Die Frau reagierte nicht. Trotzdem ging Nyström auf sie zu. In Dialog treten, dachte sie, Vertrauen herstellen. Unter ihren Füßen raschelten bei jedem Schritt trockene Eichenblätter, bis der Boden plötzlich unter ihr nachgab, sie ins Leere trat und fiel.
Er starrte sein Spiegelbild an. Es starrte zurück. Das war eine der zahllosen Legenden der modernen Zeit: dass es keine Monster gab. Oder dass, wenn es doch Monster gab, sie von innerer Natur waren, psychische Deformationen, kaputte Seelen, Soziopathen als nette, adrette Nachbarn von nebenan. Aber das war alles Blödsinn. Mit ihm jedenfalls hatte es nichts zu tun. Vielmehr war es umgekehrt. Innerlich war er heil, er war schön und gesund, dennoch starrte ihm aus dem unerbittlichen Spiegel eine Monstrosität entgegen. Es war paradox. Obwohl er sein Gegenüber mit aller Inbrunst hasste, konnte er sich von seinem Anblick nicht losreißen. Erst als die Tür des Gemeinschaftsbads aufging und hinter ihm jemand mit schnalzenden Flipflops in einer der Duschkabinen verschwand, beamte er sich wieder ins Hier und Jetzt zurück. Was kaum weniger erbärmlich war. Der Geruch von scharfen Reinigungsmitteln war durchdringend; sich überlagernde Deodorants und Duschgels sowie ein leichter, aber nicht zu ignorierender Hauch Scheiße. Boshaft rieb der Gestank ihm eine unumstößliche Tatsache unter die Nase: Von heute an würde er die kommenden Jahre in der erdrückenden Nähe anderer pubertierender Teenager leben, und es gab nichts, was er dagegen tun konnte, außer sich aufzuhängen, zu erschießen oder die Pulsadern zu öffnen, allesamt durchaus beunruhigend tröstende Optionen, »Letzte Ausfahrt Brooklyn«. Hinter einer der Türen knatterte ein Furz, eine Klospülung rauschte. Unter der prasselnden Dusche sang eine gut gelaunte Stimme einen dämlichen Song. Der Spiegel vor ihm beschlug allmählich, was ihm nur recht war, verblassten dadurch doch seine Konturen. Er nahm die antiseptische Seife aus dem Kulturbeutel und wusch sich die Hände. Mutter hatte sie ihm eingepackt. Denn man weiß ja nie. Eine ihrer Phrasen. Aber was wollte sie damit eigentlich sagen? Dass auf dem Internat Lepra oder die Pest grassierten? Typhus oder die Syphilis? Warum in Gottes Namen hatte sie dann zugelassen, dass Vater ihn hierher abgeschoben hatte? Nichts als Lügen. Als er beim Abtrocknen der Hände ein letztes Mal aufsah, war der Spiegel vom kondensierten Wasser völlig beschlagen. Mit der Spitze des Zeigefingers schrieb er FUCK auf die feuchte Oberfläche und fügte nach kurzem Zögern ein YOU hinzu, ohne dass er hätte sagen können, an wen das überhaupt gerichtet war. An das Monster? Seine Eltern? Die zukünftigen Mitschüler und Lehrer? An die ganze verfickte Welt? Er warf die dämliche Seife in den Mülleimer unter dem Waschbecken und verließ das Bad.
Nächste Mission: in sein Zimmer zurückfinden. Was ein doppelter Euphemismus war. Erstens war das Zimmer kein Zimmer, sondern eine Art Mönchszelle, zweitens war es nicht seine Zelle, sondern er teilte sie mit einem Fleischklops namens »André, the Giant«, unter dem Spitznamen hatte er ihn jedenfalls vorläufig abgespeichert, was keineswegs abwertend gemeint war, er war ja selbst eine Monstrosität, außerdem hatte er vor dem Namenspaten, einem bekannten Wrestler der späten Achtzigerjahre, der im wirklichen Leben André Roussinoff geheißen hatte, Hochachtung und Respekt, was er seinem Zimmernachbarn jedoch wahrscheinlich nur schwerlich vermitteln konnte, denn wer in seinem Alter interessierte sich schon für Catcher wie Hulk Hogan und Co., für die Glamourzeit des US-amerikanischen Wrestling? Er hätte ja selbst Schwierigkeiten, jemand anderem seine Faszination für lang vergangene Schaukämpfe zu erklären. Das großsprecherische Spektakel, der Schweiß, die Muskeln, die inszenierte Gewalt. In einer der vielen Nächte, in denen er vor Selbstekel und Zweifel geplagt nicht hatte einschlafen können, war er auf Youtube auf alte TV-Aufnahmen gestoßen und merkwürdigerweise hängen geblieben. Er hatte zwar eine entfernte Ahnung, woran das lag, aber er hätte sie nicht in Worte zu kleiden vermocht.
Der Flur des alten Internatsgebäudes war verwinkelt, und jede Zimmertür glich der nächsten. Warum sie nicht durchnummeriert waren, sondern schräge pseudopoetische Namen wie »Adlerhorst« oder »Magdalenas Schrecken« trugen – André und er teilten sich das »Schlaraffenland«, angesichts der kargen Einrichtung und der mickrigen Dimensionen des Zimmers ein schlechter Witz –, hatte sich ihm bisher nicht erschlossen. Machten sie hier auf Hogwarts? War es eine Art Insiderwissen, dessen einzige Funktion darin bestand, Neulingen wie ihm das Ankommen mit Absicht zu erschweren? Wenn sie die beknackten Namen auf die Türen geschrieben hätten, hätte sich wenigstens ein gewisser Sinn ergeben. Aber so? Zweimal öffnete er falsche Türen, wurde blöde angeglotzt, murmelte Entschuldigungen und stolperte weiter, bis er schließlich doch im »Schlaraffenland« landete. Links, rechts, dritte Tür links, versuchte er sich einzuprägen. Wenigstens war der Gigant nicht da, und er konnte in Ruhe seinen Koffer und Rucksack auspacken. Jeans, Sweatshirts, Sneaker, Baseballcap, ganz normale Jugendkleidung, auch wenn seine Mutter es abschätzig ein »Gangsterrapper-Outfit« nannte. Um sie zu ärgern, trug er seitdem ein billiges Goldkettenimitat, wenn ihm danach war. Er hatte bei den wenigen Mitschülern, denen er bisher begegnet war, bemerkt, dass auf dem Internat ein anderer Wind wehte als draußen, im normalen Leben. Teenager in Jackett und mit Bügelfalte in der Hose. Gleichaltrige, die herumliefen, als wären sie hier nicht irgendwo in Småland, sondern auf einem Ivy-League-College. Gescheitelte Snobs in edlen handgenähten Schuhen. Lackaffenalarm – das traf es ziemlich genau. Er sortierte seine Lieblingsbücher ein, anschließend linste er zum Regal des Fleischklopses hinüber. Die einzigen Bücher, die keine Schulbücher waren, waren Biografien von Elon Musk und Jeff Bezos. Oh, my god. Wobei: Vielleicht standen die ja ebenfalls auf dem Lehrplan, er traute diesem Laden hier im Grunde alles zu. Allein schon der Name. Sokrates. Nichts gegen griechische Philosophen. Aber an dieser Schule wurde weder Griechisch noch Philosophie unterrichtet. Er hatte sich die Mühe gemacht, die Webseite des Internats sorgfältig zu studieren und sich in die Tiefen der Unterrichtspläne hineinzulesen. Der altsprachliche Habitus und das aufgeblähte Leitbild des Internats waren wie so vieles andere nur heiße Luft. So wie er die Sache sah, war das teure Internat ein Abstellgleis für Schüler, die ihren wohlhabenden Eltern zu anstrengend geworden waren. Eine Gelddruckmaschine, von Arschlöchern für Arschlöcher, die saftige Gebühren gegen ansehnliche Abschlussnoten eintauschte und die nächste Generation von BWL-Zombies und Jura-Affen auf die Welt losließ.
Als er sich, soweit es möglich war, im »Schlaraffenland« eingerichtet hatte, schaute er auf die Uhr. Es war früher Nachmittag. Bis zum ersten Treffen mit dem Mentor, der ihm zugewiesen worden war, um ihn herumzuführen und mit den Abläufen des Internats vertraut zu machen, blieb ihm noch eine gute Stunde. Er warf sich in sein Rapper-Outfit und machte sich auf den Weg an die frische Luft. Es war ein sonniger, aber frischer Tag. Eins musste man dem Sokrates lassen: Die Lage war toll. Nach Süden und Westen erstreckten sich Wiesen und Weiden, nach Norden und Osten alter Laubbaumbestand, hinter dem das Wasser eines nahen Sees in der Sonne glitzerte. In der Ferne entdeckte er weidende Pferde. Der Anblick ließ ihn an Zuhause denken. Wehmut, Schmerz und Sehnsucht überwältigten ihn. Er ritt, seit er fünf Jahre alt war. Dass seine Eltern es übers Herz gebracht hatten, ihn von Bosse zu trennen, entsetzte ihn von allen Dingen am meisten. Sie wussten genau, was der Wallach ihm bedeutete. Bosse war immer für ihn da gewesen. Bei Bosse hatte er sich sicher und geborgen gefühlt. Bosse war seine Monstrosität egal. Pferde urteilten nicht, jedenfalls nicht nach menschlichen Maßstäben, und das rechnete er Bosse hoch an. Für Vater dagegen empfand er nichts als Verachtung. Das, was der Alte trieb, war seiner Meinung nach moralisch verwerflich, bisweilen gar verabscheuungswürdig. Trotzdem war er immer noch sein Vater gewesen. Doch die Abschiebung aufs Internat war ein Verrat, den er ihm nicht verzeihen würde. Der Anlass war lächerlich. Eingeworfene Fensterscheiben und paar Krümel Marihuana. Deswegen so ein Theater zu machen. Was war denn mit den ganzen Pillen, die er auf ärztliche Anordnung hin nehmen musste? Die Stimmungsaufheller, die verschleiern sollten, wie er sich wirklich fühlte? Die dafür sorgen sollten, dass er ein funktionierendes Zahnrad in der großen Maschine wurde? Dass er das Spiel mitspielte? Die Tabletten waren der krasse Scheiß, nicht die mikroskopisch kleine Menge Gras. Trotzdem war der Fund wie Wasser auf die Mühlen des Alten gewesen und, schlimmer noch, er hatte damit Mutter auf seine Seite gezogen. Von einer Zäsur war die Rede gewesen, von einer Luftveränderung. Von Kontakt zu Gleichaltrigen, von einer gelebten Gemeinschaft. So ein Bullshit.
Sein Spaziergang endete an einem Gatter. Zwei neugierige Fohlen kamen so nah, dass er ihre Köpfe streicheln konnte. Während seine Hand durch das weiche Fell fuhr, kam ihm ein Gedanke, der ihm sein bisheriges fünfzehn Jahre währendes Leben lang fremd gewesen war: Um das hier zu überleben, brauchte er mehr als ein Pferd, er brauchte einen echten Freund, auch wenn er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er das anstellen sollte.
Tag 2
1
Hauptkommissarin Ingrid Nyström lag in einem Krankenhausbett, Fuß- und Handgelenk bandagiert, das Pochen darin dank der starken Medikamente nur ein fernes Echo der Schmerzen, die sie nach dem Fall in das von dünnen Zweigen und Blättern getarnte Loch gespürt hatte. Trotz der Hand- und Sprunggelenksfraktur sowie einer Gehirnerschütterung hatte sie Glück im Unglück gehabt. Sie ging die Ereignisse des Vortags, so verschwommen sie waren, in Gedanken immer wieder durch. Hilflos und nahezu bewegungsunfähig hatte sie auf dem kalten Boden der ausgehobenen Grube gelegen. Sie war mit der unverletzten Hand zwar an ihr Smartphone gekommen, aber das hatte keinen Empfang gehabt, was im Funkschatten des Felsmassivs keine Überraschung war. Neben den rasenden Schmerzen in der linken Hand und im rechten Fußgelenk waren das ohnmächtige Gefühl der Verlorenheit und der Geruch der feuchten Erde ihre intensivste Erinnerung. Doch irgendwann hatte sie das Brummen eines sich nähernden Hubschraubers gehört, das zu einem ohrenbetäubenden Dröhnen angewachsen war, als der Helikopter über ihr in der Luft gestanden hatte. Ein Mann vom Rettungsdienst hatte sich mithilfe einer Winde abgeseilt, und sie war mit einer heruntergelassenen Trage aus ihrer misslichen Lage geborgen worden. Das schwerelose und schwindelnde Gefühl, über den Baumkronen zu schweben, würde sie nie vergessen. Danach beschleunigte sich die Abfolge der Bilder: der Flug zum Krankenhaus. Das Abtasten ihres Kopfes. Die Gesichter von Ärzten und Pflegern. Die mechanischen Geräusche des Röntgenapparats. Die Spritze, mit der die Operation der zertrümmerten Gelenke eingeleitet worden war. Alles um sie herum war schwarz geworden. Später dann war Anders bei ihr gewesen. Seine raue Hand in ihrer. Die Sorgen in seinem Gesicht. Der Trost seines Lächelns. Irgendwann war sie wieder weggedämmert. Schweißausbrüche und wilde Träume in der Nacht, irgendetwas mit Pferden, ein unendlich trockener Mund, alles Nebenwirkungen der morphinhaltigen Schmerzmittel. Am Morgen hatte Anders sie ein zweites Mal besucht, dieses Mal waren ihre Tochter Anna und ihr vierjähriger Enkel Albert dabei gewesen. Seine Zeichnung eines Hubschraubers mit Blaulicht lag auf ihrem Nachttisch. Alberts Helikopter erinnerte an das Yellow Submarine der Beatles. Der Besuch war schön gewesen, hatte aber auch Kraft gekostet, was vermutlich vor allem mit der Gehirnerschütterung zusammenhing. Ihr Kopf dröhnte. Immer wieder versuchte sie, das Bild von der jungen Frau auf der Anhöhe vor ihrem inneren Auge zu visualisieren: vergebens.
Die Tür des Krankenzimmers öffnete sich und riss sie aus ihren Gedanken und Träumen. Es war ihr Vorgesetzter, Polizeichef Erik Edman, in der Hand eine Pralinenschachtel, wie man sie im Krankenhauskiosk kaufen konnte. Er nahm auf dem unbelegten Bett Platz, das in einigem Abstand neben ihrem stand, und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Sie kannte ihn gut genug, um seine zuckenden Mundwinkel als Ungeduld zu dechiffrieren. Edman war nicht hier, um ihr gute Besserung zu wünschen, sondern weil er etwas von ihr wollte.
»Vielen Dank für die Blumen, aber solltest du nicht im Präsidium sein?« Ihre Stimme war rau und heiser und klang fremd in den eigenen Ohren. »Bis zur Urteilsverkündung kann es nicht mehr lange dauern, und nach meinem, nun ja, Ausfall habe ich angenommen, dass du notgedrungen stellvertretend für mich …«
»Darum geht es ja«, unterbrach er sie, »jedenfalls im weiteren Sinne.«
Sie richtete sich auf, so gut es ging. Ihr Kopf wummerte, und in den Ohren rauschte das Blut. Irgendetwas in seinem Tonfall, in der Art, wie er sie anblickte, alarmierte sie.
»Was ist los, Erik?«
So sehr er gerade noch aufs Tempo gedrückt hatte, so sehr druckste er nun herum.
»Wie soll ich sagen …? Wir … also ich im Dialog mit … also die Task Force ist einstimmig der Meinung, dass wir deinen … also, dass wir das, was dir gestern geschehen ist, als einen Anschlag auf die Ordnungsmacht, ja, als Tötungsversuch einer Polizistin im Dienst einstufen müssen.«
Sie starrte ihn fünf lange Sekunden an.
»Blödsinn.«
Er wich ihrem Blick aus.
»Ist es das wirklich?«
Er zog die Wörter unnatürlich in die Länge. Zäh und klebrig wie Kaugummi.
»Ja, das ist es, und das weißt du auch, Erik.«
»Aber was ist es denn, wenn es kein Tötungsversuch war?«
Sie zuckte mit den Schultern, was sie sofort bereute, denn ein Schmerzblitz fuhr ihr vom Oberarm bis ins frisch operierte Handgelenk.
»Irgendwelche Idioten, die ein Loch gegraben haben«, presste sie mit verzerrtem Gesicht hervor.
»Das war kein Loch, Ingrid, sondern eine heimtückische Falle.«
»Aus der ich selbst putzmunter wieder herausgeklettert wäre, wenn ich nicht so ungeschickt gefallen wäre.«
»Du hättest sterben können.«
»Blödsinn! Die Grube war gerade einmal einen Meter tief. Hätte ich mir den Kopf nicht dummerweise an dem einzigen Stein gestoßen, der da im Boden war, und wäre ich nicht so unglücklich aufgekommen, wäre überhaupt nichts passiert. Warst du dort und hast es dir angesehen?«
»Ich habe den vorläufigen Bericht der Spurensicherung gelesen«, sagte er kleinlaut.
»Den vorläufigen Bericht, Erik. Na dann.« Nach einer Pause: »Selbst wenn es diese ominösen Wilden Luchse waren: Die wollten niemanden umbringen. Dazu hätten sie ein viel tieferes Loch graben und angespitzte Äste in den Boden rammen müssen. Vor allen Dingen hätten sie wohl kaum selbst den Notruf getätigt.«
»Der Anruf war anonym, wir wissen nicht, ob er von einem Mitglied dieser militanten Gruppe kam. Es kann genauso gut eine Spaziergängerin oder ein Orientierungsläufer gewesen sein, der dir das Leben gerettet hat.«
»Militante Gruppe.« Sie wiederholte seine Worte. »Das Leben gerettet.« Und plötzlich begriff sie, was Edman im Schilde führte. Sie blickte ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Es geht hier gar nicht um mich, nicht wahr?«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Die Task Force … Du … Ihr …« Es war so durchsichtig wie niederträchtig. Ihre Lippen formten sich zu einem kalten, bösen Lächeln. »Sie wollen die Geschichte aufbauschen … Sie wollen eine Trumpfkarte in der Hinterhand. Sie wollen Munition. Mordanschlag auf Polizistin. Falls nach dem Urteil die Proteste richtig losgehen und die Situation eskaliert, wollen sie etwas, das die öffentliche Meinung gegen die Aktivisten dreht. Etwas, das ein hartes Durchgreifen legitimiert. Denn wer stellt sich schon auf die Seite von Polizistenmördern?«
Edman stritt es noch nicht einmal ab. Er rieb sein Ohrläppchen.
»Wie gesagt, es ist ein einstimmiger Beschluss.«
Glaubte er wirklich, sie würde dieses Spiel mitmachen? Das Opfer spielen? Kannte er sie nach all den Jahren so wenig?
»Erik, ich mache da nicht mit! Unter keinen Umständen! Solange ich die Abteilung für Gewaltverbrechen leite, werden wir diese dämliche Grube nicht als Todesfalle betiteln. Es war eine Kinderei, es war ausgesprochen dämlich. Aber mehr auch nicht.«
Edman strich sich einen Staubfussel von der edlen Krawatte und seufzte.
»Du verstehst es noch immer nicht. Wir hier in Kronoberg, genauer gesagt, dein Team ist gar nicht im Spiel, Ingrid. Wegen Befangenheit. Du kannst schließlich nicht einen Mordanschlag auf dich selbst untersuchen, nicht wahr?« Es verschlug ihr die Sprache. »Der Staatsschutz wird in der Sache ermitteln.«
Sie spürte Wut in sich aufwallen. Eine alte, nur zu bekannte rasende Wut. Plötzlich waren all die schrecklichen Dinge wieder da. Der Betrug. Die Verschwörung. Die vielen Toten. Ihre Schuldgefühle.
»Ich fasse es nicht, Erik.« Sie schüttelte den Kopf, eine Bewegung, die ihr der geschundene Körper ebenfalls nicht verzieh. Die Schmerzen zuckten von den Schultern über den Nacken in den Kopf. Sie biss die Zähne zusammen. »Hast du vergessen, was passiert ist? Der Staatsschutz hat uns in den vergangenen Jahren zwei Fälle aus der Hand gerissen, die Ermordung meiner Schwiegertochter und das Attentat auf Stina Forss. Beide Male wurden die Ermittlungen absichtlich gegen die Wand gefahren, beide Male wurden wir von diesen Leuten nach Strich und Faden belogen und an der Nase herumgeführt. Spuren wurden verwischt, Verbrechen vertuscht. Und nun wagst du es, diese zwielichtigen Figuren noch ein weiteres Mal ins Boot zu holen? Wegen eines Lochs im Waldboden?«
Im Gegensatz zu ihr und ihrer ehemaligen Mitarbeiterin Stina Forss kannte Edman bis heute nicht die wahren Hintergründe für die verschleppten Ermittlungen. Aber selbst er hatte begriffen, dass der Geheimdienst in Nyströms Untersuchungen eingegriffen hatte, um Dinge zu verschleiern, die nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangen sollten.
Er hob die Hände von seinen Oberschenkeln und ließ sie resigniert wieder fallen.
»Das alles ist nicht meine Idee, ich hoffe, das weißt du. Der Druck kommt von oben, von sehr weit oben.«
»Nicht der Staatsschutz, Erik.« Ihre Blicke trafen sich. »Alles und jeder, aber nicht der Staatsschutz. Nicht nach allem, was geschehen ist. Das schuldest du mir.« Sie zögerte einen Moment. »Bitte«, fügte sie schließlich hinzu, auch wenn das Wort einen galligen Nachgeschmack hinterließ.
Waidwund stöhnte er auf. Theatralik konnte er gut.
»Was soll ich denn dagegen tun, Ingrid? Der Wille, diese dumme Geschichte auszuschlachten, ist stark. Es ist politisches Kapital. Ich kann das nicht abwenden, selbst wenn ich es wollte. Ich muss dem nachgehen, sonst war es das hier für mich. Die versetzen mich in die nordschwedische Pampa, wenn sie wollen. Ich stecke mitten in einer Scheidung. Wie soll ich denn dann meine Kinder …?« Er unterbrach sich. Womöglich war er selbst über seinen jammervollen Tonfall erschrocken. Oder es war ihm bewusst geworden, dass er sich von ihr in eine Ecke hatte drängen lassen. Sie kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass ihm das missfiel. Edman war ein Mann, der die Dinge gern im Griff hatte. Er zupfte an der Manschette seines weißen Hemds. »Außerdem hat sich die Generalstaatsanwaltschaft der Sache schon angenommen. Der Stein rollt bereits und ist nicht mehr aufzuhalten.«
Er fuhr sich durchs Haar und starrte seine Schuhspitzen an. Seine demonstrative Bekümmerung wirkte beinahe echt, vielleicht war sie es sogar. Nyströms Gedanken ratterten. Ein Güterzug donnerte durch ihren Schädel. Vor Schmerzen schloss sie die Augen. Es war viel zu hell im Zimmer. Sie blinzelte. Irgendeinen Ausweg musste es geben. Sie konnte nicht zulassen, dass diese Leute, die ihr so viel genommen, die sie um ein Haar für immer gebrochen hatten, jetzt ausgerechnet sie für eine billige politische Kampagne instrumentalisierten. Sie verfluchte, dass sie Edmans Drängen nachgegeben hatte. Sie hätte sich niemals dazu bereit erklären dürfen, in der verdammten Kommission mitzuarbeiten. Aber für Reue war es Monate zu spät. Ihr vom Morphium umnebeltes Hirn arbeitete anders, als sie es gewohnt war. Sie konzentrierte sich auf ihre Atmung. Und plötzlich war da diese Idee. Stieg auf aus den Tiefen ihres Bewusstseins. Sie griff danach und fasste sie beim Schlafittchen.
Was wäre wenn …?
»Erik, der Staatsschutz darf formal erst übernehmen, wenn eine Straftat von der zuständigen Behörde als staatsgefährdend oder politisch motiviert eingestuft wird.«
»Natürlich.«
»Der Chef der zuständigen Behörde bist du.«
»Ich weiß, aber genau das …«
»Was wäre«, unterbrach sie ihn, »wenn du den Vorfall erst einmal ergebnisoffen untersuchen lassen würdest?«
»Wie soll das funktionieren, wenn unsere eigene Abteilung den Fall nicht übernehmen darf, weil die Chefin selbst in den Sachverhalt verwickelt ist?«
»Du bittest bei der Mordkommission der Nationalen Operativen Einheiten um personelle Unterstützung. Laut Protokoll und Dienstweg ein ganz normaler Vorgang. Erinnerst du dich, als im Januar auf den Kripo-Chef in Jönköping geschossen wurde? Damals ist es genauso gelaufen. Eine ähnliche Geschichte gab es im vergangenen Jahr in Jämtland.« Wieder seufzte er. Sie spürte, wie er mit sich rang. Er war der geborene Opportunist, jemand, dem die Karriere über alles ging. Der Posten eines regionalen Polizeichefs war landesweit noch nie an einen so jungen Bewerber vergeben worden. Er hätte Edmans Sprungbrett für höhere Aufgaben und schließlich ins Justizministerium sein sollen. Nur war das nie geschehen. Er, der sich so gern als mondänen Hauptstädter gesehen hätte, klebte seit mehr als zehn Jahren auf seinem Stuhl fest. Im tiefsten Småland. In einer Sackgasse. Daher die Angst, etwas falsch zu machen, die da oben zu verärgern. Deswegen hatte er Nyström in die Kommission bugsiert. Er war feige. Aber auch verbittert. Er hatte seine Ehe an die Wand gefahren. Der Karriere drohte dasselbe Schicksal. Das Leben schuldete ihm etwas. Die da oben schuldeten ihm etwas. Vielleicht konnte sie mit diesem Gefühl arbeiten. »Du bist der Chef hier, Erik. Stockholm wird dir ewig auf der Nase herumtanzen, wenn du dich nicht wehrst. Weil sie wissen, dass sie es mit dir machen können. Wieso sollten sie dich hier jemals abziehen und in die Hauptstadt holen? Etwas Besseres als eine Marionette kann ihnen doch gar nicht passieren.«
Edmans Gesichtsfarbe änderte sich um eine Nuance ins Rötliche. Kurz dachte sie, dass er sie anbrüllen, dass er seine aufgestaute Wut und Verbitterung an ihr ablassen würde. Bewusst hatte sie harte Worte gewählt. Sie pokerte hoch. All in.
»Aber was wäre denn damit gewonnen, Ingrid? Ob Geheimdienst oder Mordkommission der Operativen Einheiten, die Schlagzeilen wären dieselben. Und in beiden Fällen hätten wir hier Schnüffler am Hals, die nur Stockholm gegenüber Rechenschaft schuldig sind.«
Sie lächelte schmal.
»Möglicherweise aber auch nicht. Du solltest die Karrieren ehemaliger Mitarbeiter und vor allem ehemaliger Mitarbeiterinnen vielleicht ein bisschen intensiver verfolgen, Erik.«
Er hob den Blick.
»Denkst du etwa an …?«
Ihr rechter Mundwinkel zuckte.
»Warum denn nicht? Den Leiter der Operativen Einheiten kenne ich seit Jahren, ein feiner Kerl, wir saßen bei unzähligen Fortbildungen und Konferenzen nebeneinander und verstehen uns ziemlich gut. Vielleicht erfüllt er uns einen Wunsch, was das Personal betrifft.« Sie hob die bandagierte Hand an, was so wehtat, dass es ihr jedes Lächeln aus dem Gesicht wischte. »Wenn ich hier schon zum Opfer eines gescheiterten Mordanschlags gemacht werde«, sagte sie mit gepresster Stimme, »dann will ich meinen Fall zumindest in den richtigen Händen wissen.«
2
Kommissarin Stina Forss saß auf der Kante des Kais vor dem Grand Hotel, ließ die Füße baumeln, hielt ihr von Sommersprossen übersätes Gesicht der Septembersonne entgegen und aß ein mitgebrachtes Butterbrot. Sie mochte die Aussicht auf den glitzernden Lilla Värtan, von wo aus die Fähren und Touristenboote in den Stockholmer Schärengarten aufbrachen, und wenn es sich wie an diesem Tag einrichten ließ, verbrachte sie hier ihre Mittagspausen: Möwen fütternd, das geschäftige Treiben der Großstadt im Rücken, den Blick auf dem Wasser ruhend. Seit zwei Jahren lebte sie mittlerweile hier, ein kleines, ein unauffälliges Leben, dachte sie oft, das von Arbeit und Routinen wie täglichem Joggen oder dem Besuch des Fitnessstudios geprägt war, ohne tiefe Verwurzelung, ohne Freunde, ohne Partner, ohne feste Kollegen. Es war ihr recht so. Als Ermittlerin der Mordabteilung der Operativen Einheiten war sie in ständiger Abrufbereitschaft. Wenn irgendwo im Land ein schweres Gewaltverbrechen geschah und die Kriminalpolizei vor Ort mehr Ressourcen benötigte oder sich ein Fall hoffnungslos festgefahren hatte, kam Forss zum Einsatz. Bisher war das zehnmal passiert, in acht dieser Einsätze hatte sie die Ermittlungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen können. Das war eine sehr gute Quote. Entsprechend