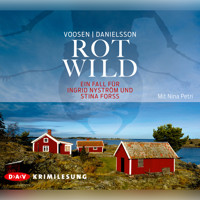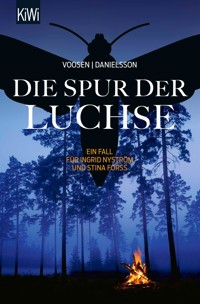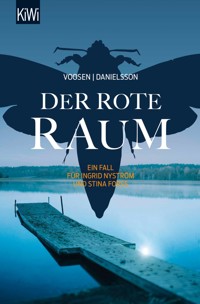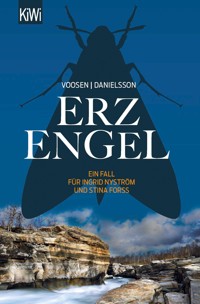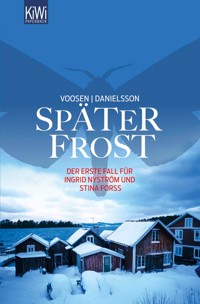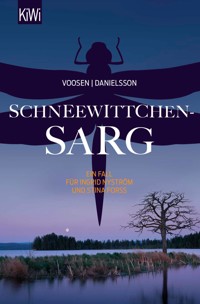
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
Ein furchtbares Verbrechen oder der Bluff des Jahrhunderts? Das versuchen die ungleichen Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss im siebten Band der beliebten Schwedenkrimiserie herauszufinden. Die Ermittlungen in ihrem bisher kompliziertesten Fall führen sie ins småländische Glasreich. Schweden 1972: Während einer Hochzeitsfeier verschwindet die junge, schöne Braut spurlos. Knapp fünfzig Jahre später taucht bei einer Ausstellungseröffnung ihr skelettierter Leichnam in einem gläsernen Sarkophag wieder auf. Nyström und Forss übernehmen die Untersuchungen und bald schon rücken drei Familienunternehmen, allesamt Glashüttenbesitzer, in den Fokus der Ermittlung. Doch je tiefer Nyström und Forss in der Vergangenheit graben, desto widersprüchlicher und rätselhafter scheinen die Dinge, die sie zu Tage fördern. Ein Fall der von Lüge und Verblendung, Eifersucht und Verrat, doch vor allem einer starken, weiblichen Künstlerpersönlichkeit und ihrem nicht zu zügelnden Lebenshunger handelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Schneewittchensarg
Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen, Hamburg und Göteborg. Kerstin Signe Danielsson, Jahrgang 1983, geboren und aufgewachsen in Växjö, studierte und arbeitete in Deutschland und Schweden. Sie leben und schreiben gemeinsam im småländischen Växjö.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Schweden 1971: An einem strahlend schönen Sommertag heiratet der junge Erbe einer Glashütte das schönste Mädchen des Dorfs. Während des rauschenden Fests findet ein Spiel statt: Die Braut wird entführt – doch sie verschwindet für immer.
Fünfzig Jahre später eröffnet ihr Ehemann eine Ausstellung mit Glaskunst aus aller Welt – und bricht zusammen. In einem gläsernen Sarkophag taucht der skelettierte Leichnam seiner Frau wieder auf – mitsamt dem schneeweißen Hochzeitskleid.
Die ungleichen Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss übernehmen die Untersuchungen, und bald schon rücken drei Familienunternehmen, allesamt Glashüttenbesitzer, in den Fokus der Ermittlung. Doch je tiefer Nyström und Forss in der Vergangenheit graben, desto widersprüchlicher und rätselhafter scheinen die Dinge, die sie zutage fördern …
Ein hoch spannender Kriminalroman über die verzehrende Gier nach Leben.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Schweden, heute, Samstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Bytorp 1968
Sonntag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Bytorp 1969
Montag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Stockholm im Herbst 1969
Dienstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Stockholm, Frühjahr 1970
Mittwoch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Stockholm, 24. April 1970
Donnerstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Stockholm, Oktober 1970
Freitag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Stockholm, 12. August 1971
Samstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
29. August 1971
Sonntag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Eine Woche danach, Sonntag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Epilog
Leseprobe »Tode, die wir sterben«
»Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will’s nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.«
Schneewittchen, nach den Brüdern Grimm
Prolog
Sommer 1971
Er stolperte den flachen Abhang hinunter auf das Seeufer zu. Einmal wäre er beinahe in einem Gestrüpp aus niedrigen Preiselbeerbüschen zu Fall gekommen, aber er konnte sich gerade noch abfangen und die Balance halten. Er wusste nicht, wie viele Bier er bereits getrunken hatte, irgendwann hatte er aufgehört, mitzuzählen, Schnaps hatte es ebenfalls reichlich gegeben, jedenfalls musste er nun dringend die Blase leeren. Als er sich weit genug von der lärmenden Festgesellschaft entfernt wähnte, blieb er vor einem Baum stehen, lehnte die Stirn an die raue Borke der Kiefer, öffnete den Reißverschluss der Anzughose und schlug das Wasser ab. Was für eine Erleichterung! Als er fertig war, bemerkte er, dass seine Schuhspitzen nass waren. Verflucht, er hatte sich auf die neuen Schuhe gepinkelt. Er sah sich um. Gab es hier irgendetwas, womit er sie wieder einigermaßen trocken wischen konnte? Auch wenn es bald dämmerte und zur fortgeschrittenen Stunde wahrscheinlich niemand mehr darauf achtete, konnte er doch unmöglich mit uringetränkten Budapestern auf die Feier zurückkehren. Einige Meter weiter unten, am Wasser, stand hohes, trockenes Gras. Besser als gar nichts, dachte er, und ärgerte sich darüber, kein Taschentuch eingesteckt zu haben. Die Scham über sein Malheur hatte ihn ein Stück weit nüchtern gemacht. Er ging auf das strohartige Gras zu, hockte sich hin und begann damit, Büschel aus der Erde zu rupfen und damit die nassen Schuhe zu bearbeiten. Der Erfolg war bescheiden. Das teure Leder hatte sich an den Spitzen dunkel verfärbt, daran konnten auch die Halme nichts ändern. Er fluchte. Gerade als er sich entschieden hatte, das sinnlose Unterfangen aufzugeben und zum Fest zurückzukehren, hörte er nicht weit von sich entfernt gedämpfte Schritte. Noch jemand, der sich erleichtern musste? Vorsichtig lugte er durch das hohe Gras. Doch die Gestalt machte keine Anstalten, sich an einen Baum zu stellen oder in die Büsche zu hocken, sondern ging geradewegs auf das Ruderboot zu, das am Steg vertäut lag. Er erkannte das Werkzeug, das sie in der Hand hielt, und traute seinen Augen kaum. Wozu sollte der Bohrer gut sein? Der Schatten, der vom Steg aus in das Boot kletterte, beantwortete seine Frage durch das, was er tat. Die charakteristischen Armbewegungen, das surrende Geräusch von Metall im Holz. Das Ganze dauerte kaum mehr als eine Minute, dann richtete sich der Schatten auf, warf den Drillbohrer in den See, kletterte auf den Steg und ging den Weg zurück, den er gekommen war.
Schweden, heute, Samstag
1
Es braute sich etwas zusammen. Das milde Sommerwetter der vergangenen Tage wurde seit den Mittagsstunden schwüler, drückend und unangenehm. Der Himmel zog sich zu, und es war nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Regentropfen fallen würden. Dennoch machte Kommissarin Stina Forss keine Anstalten, aus dem Liegestuhl im Garten aufzustehen. Sie starrte auf die unbewegte Seeoberfläche, die das Grau der Wolkendecke spiegelte. Der Schweißfilm auf ihrer Haut zog die Mücken an, doch sie war zu träge, um nach dem Insektenspray zu greifen. Sie brachte gerade einmal ein halbherziges, kraftloses Wedeln zustande, eine wenig effektive Strategie, die hartnäckigen Tierchen ließen sich auf diese Weise jedenfalls nicht vertreiben. Wobei: Träge war das falsche Wort. Ihr Körper war wie versteinert, während sich ihre Gedanken, ihre Gefühlswelt, ihr gesamtes Selbst woanders befanden, weit weg vom Hier und Jetzt, diesem kleinen, abgelegenen Haus in idyllischer Seelage an einem Julitag in Småland. Diesem waldigen Landstrich, der ihr eine neue Heimat geworden war, seit sie vor Jahren Berlin und eine Karriere bei der dortigen Mordkommission hinter sich gelassen hatte, um in Schweden, dem Land ihrer Kindheit, in der Nähe ihres schwer kranken Vaters zu sein. Stina Forss hatte die vage und schließlich auch vergebliche Hoffnung gehabt, die Dinge zwischen ihnen ins Reine zu bringen. Ihr Vater war nun seit geraumer Zeit tot, doch sie war immer noch hier, in der tiefsten Provinz. Wald, See und Abgeschiedenheit – der Gegenentwurf zu ihrem ehemaligen Leben in Berlin.
Wenn nicht sozial, so hatte sie hier doch zumindest beruflich Fuß gefasst. Aber dies war nicht der Grund dafür, dass sie an diesem Ort im Nirgendwo blieb. Gewichtiger waren die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre, die in den letzten Monaten eine so tragische Dynamik angenommen hatten, dass Forss sie längst nicht mehr begreifen konnte. Die Wucht des Geschehenen war es, die sie in den Liegestuhl drückte, und trotz Mückenstichen und heraufziehenden Gewitters mehr oder weniger bewegungsunfähig machte.
Wie und wann genau hatte das alles begonnen?
Sie grübelte seit Monaten und fand doch keine Antwort. Das, was sie von allem, das passiert war, am meisten belastete, was sie Morgen für Morgen schweißgebadet und mit verkrampften Kiefern aus dem Schlaf schrecken ließ, war die Ermordung der Schwiegertochter ihrer Chefin. Die Schüsse, die aus einem zweihundert Meter entfernten Versteck im Halbdunklen auf den fahrenden Wagen abgegeben worden waren, hatten aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der unbescholtenen jungen Mutter gegolten, sondern ihr selbst. Eine fatale Verwechslung. Sie war es gewesen, die an diesem kalten Aprilabend hätte sterben sollen. Vielleicht sollte sie das noch immer, aber sie empfand merkwürdigerweise überhaupt keine Angst, vielleicht weil sie sich dazu viel zu betäubt fühlte.
Wie viel Schuldgefühle konnte ein Mensch ertragen?
Sie nagte an ihrer Unterlippe.
Eine Mücke stach sie in den Handrücken.
Das Grollen des aufziehenden Gewitters war jetzt ganz nah.
Sie griff nach dem Glas Gin Tonic, das neben ihr auf dem Beistelltisch stand. Die Eiswürfel waren längst geschmolzen, doch das nahm sie ebenso wenig wahr wie die ersten Regentropfen. Erst das Klingeln des Handys riss sie aus der Apathie.
2
Im Gegensatz zum Gewitterregen, der sich über Stunden angebahnt hatte, bevor er sturzartig auf die Windschutzscheibe ihres Toyotas niederging, kamen die Tränen unvermittelt. Hauptkommissarin Ingrid Nyström war überrascht von der Intensität, mit der sie der Weinkrampf schüttelte, gleichzeitig gab sie sich ihm hin. Wozu dagegen ankämpfen, jetzt, wo sie allein war? Es hatte etwas Befreiendes, wenigstens für den Moment loszulassen und jede Kontrolle aufzugeben. Ihr Kleinwagen stand auf dem Parkplatz des Växjöer Flughafens, und es war keine zehn Minuten her, dass sie ihren Mann, ihre Tochter und ihren Enkel im Foyer mit innigen Umarmungen verabschiedet hatte. Anders, Anna und der kleine Albert würden über Stockholm nach London und von dort weiter nach Tansania fliegen, wo ihr Mann sich im Rahmen eines kirchlichen Entwicklungshilfeprojekts am Bau einer Schule und eines Brunnens beteiligen würde; Anna und ihr knapp einjähriger Sohn würden ihn begleiten. Vor vier Monaten war Anders bereits für einige Wochen dort gewesen, der Beginn eines Sabbatjahres seiner Pastorenstelle, doch nach Healeys unfassbarem, plötzlichem Tod war er umgehend nach Hause zurückgekehrt. Ihre Tochter brauchte ihn jetzt, sie selbst brauchte ihn jetzt. In solchen Momenten rückte man als Familie zusammen. In der Tat war ihr Mann in den chaotischen Tagen und Wochen nach Healeys Ermordung der familiäre Kraft- und Ruhepol gewesen. Annas Trauer um ihre Lebensgefährtin fand in Anders’ Nähe einen gewissen Halt, eine Stütze, die sie als Mutter ihr selbst nicht geben konnte. Warum, vermochte sie nicht zu sagen, aber es tat weh und gab ihr das Gefühl zu versagen, sie zwang sich jedoch, diese Verletzung hinunterzuschlucken, schließlich ging es hier nicht um sie, es ging um Anna und deren neun Monate alten Sohn Albert, der gerade ein Elternteil verloren hatte, es ging um Healeys Familie.
Anna und die Harringtons hatten sich darauf geeinigt, Healey in Schweden zu bestatten. Healey, auch wenn sie nicht besonders gläubig gewesen war, hatte den kleinen Dorffriedhof unter den hohen Bäumen immer als einen romantischen, besonderen Ort empfunden. Es war ein guter, ein angemessener Platz für eine letzte Ruhestätte, wenn man dies über das Grab einer Frau, die noch nicht einmal dreißig Jahre alt geworden war, überhaupt sagen konnte. Anders kümmerte sich um die gesamten Vorbereitungen der Bestattung, er brachte die Harringtons sowie den auswärtigen Freundeskreis in ihrem großen Haus beziehungsweise bei Bekannten und in Pensionen unter, leitete den zweisprachigen Trauergottesdienst und organisierte das anschließende Essen und Beisammensein im Gemeindehaus. Mit anderen Worten: Er hielt alles zusammen und bewahrte die Familie vor dem kollektiven Zusammenbruch. Sie konnte nur dankbar sein, und ihn dafür bewundern, was er war: ein fantastischer Ehemann, ein liebevoller Vater, ein fürsorglicher Großvater und nicht zuletzt ein guter Pastor.
Und sie selbst?
Natürlich trug sie ihren Teil bei. Sie versorgte die vielen Gäste. Wusch Wäsche, putzte, kochte, backte. Kümmerte sich um Albert. Versuchte Anna Trost zu spenden, auch wenn sie sich dabei viel zu oft steif und unbeholfen vorkam.
Doch natürlich reichte das nicht aus, nicht nach ihren Maßstäben. Sie wurde der Situation nicht gerecht. Weder als Mutter noch als Polizistin, und sie wusste kaum, was von beidem schwerer wog.
Tatsache war, dass der Täter nicht gefasst war, dass sich Healeys Mörder auf freiem Fuß befand, und nichts auf eine anstehende Verhaftung hindeutete. Es gab keinen Verdächtigen, die Spurenlage war dünn, ein Motiv zeichnete sich nicht einmal ab. Die Lebenspartnerin ihrer Tochter war eine unbescholtene Geschäftsfrau gewesen, die in Brighton eine Boutique betrieben hatte. Wer hatte eine solche Frau töten wollen, eine junge, hilflose Mutter? Jemand, der gleichgeschlechtliche Liebe verabscheute und Lesben hasste? Ein fanatischer Verteidiger der sogenannten Normfamilie? Kaum vorstellbar, insbesondere, wenn man die Umstände der Tat betrachtete: ein Scharfschütze aus dem Hinterhalt, der mit militärischer Präzision gearbeitet hatte. Das erinnerte an eine professionelle Hinrichtung oder an ein politisches Attentat. Es passte nichts zusammen.
Am plausibelsten, da musste sie ihrer Mitarbeiterin Stina Forss, ihrem Vorgesetzten Erik Edman sowie den Kollegen vom Staatsschutz widerwillig recht geben, war die Verwechslungstheorie. Demnach hatte es der Täter nicht auf ihre Schwiegertochter, sondern auf Stina Forss abgesehen gehabt. Auch wenn der offenbar hervorragend ausgebildete Schütze insgesamt wie ein Profi agiert hatte – zwei präzise Kopfschüsse auf ein bewegliches Ziel in großer Entfernung, das Überraschungsmoment, das sorgfältige Verwischen jeder Spur in seinem Versteck, der gut vorbereitete Fluchtweg –, war es denkbar, dass er Healey und Forss verwechselt hatte. Healey hatte in Forss’ Auto gesessen, sie hatte ähnlich wilde Locken wie die Deutschschwedin. Dazu kamen die schlechten Lichtverhältnisse in der Dämmerung und die große Entfernung.
Forss war im Gegensatz zu Healey alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Das Aufdecken einer rechtsextremen Terrorzelle und das Verhindern der Attentatspläne auf das Fußballspiel zweier Einwanderermannschaften hatte Forss unfreiwillig zu einer landesweit bekannten Polizistin gemacht, ihr Gesicht war auf den Titelseiten der großen Zeitungen gewesen, man hatte sie als Heldin von Södertälje gefeiert. Die These, dass jemand das vereitelte Bombenattentat und die beim Polizeieinsatz getöteten Kameraden rächen wolle, ergab durchaus Sinn. Darüber hinaus waren die rechtsextremen Drahtzieher und ihre Mittäter nicht die einzigen Schwerkriminellen, denen Forss während ihrer beruflichen Laufbahn das Handwerk gelegt hatte. Wenn man ihre Zeit beim Berliner Landeskriminalamt berücksichtigte, hatte sie mehr als drei Dutzend Verhaftungen zu verantworten, die zu langen Haftstrafen geführt hatten, eine eindrucksvolle Bilanz. Hinzu kam der mehrmalige Einsatz der Dienstwaffe in Notwehrsituationen, was in fünf Fällen zu schweren Verletzungen und zweimal sogar zum Tod Verdächtiger geführt hatte. Keine Frage, Stina Forss hatte sich in ihrem Berufsleben viele Feinde gemacht. Am schlüssigsten, in dem Punkt waren sich alle einig, war jedoch die Theorie einer Vergeltungsaktion für das verhinderte Bombenattentat auf das Fußballstadion von Södertälje. Das war der Grund, warum der Staatsschutz unverzüglich die Ermittlung an sich gezogen hatte. Das war der Grund, warum Nyström die Hände gebunden waren.
»Glaub mir, es ist besser so«, hatte Edman gesagt, und seine Zufriedenheit darüber, dass der verfahrene Fall unverhofft und schnell aus seinem Verantwortungsbereich delegiert worden war, kaum verhehlen können. »Außerdem bist du emotional viel zu nah an der Sache dran.«
Eine Sache.
So sah ihr Chef das also. Natürlich reagierte sie emotional, natürlich war sie voreingenommen, es ging um ihre Schwiegertochter, es ging um ihre eigene Familie verdammt noch mal! Hätte sie nicht gerade dieser Umstand zu einer besonders engagierten, sorgfältigen und ausdauernden Ermittlungschefin gemacht? Nun durfte sie dankbar sein, wenn sie über die Fortschritte des Falls auf dem Laufenden gehalten wurde. Wobei von Fortschritten kaum die Rede sein konnte. Die einzige nennenswerte Fährte war die Suche nach einem blauen Ford Galaxy älteren Baujahrs. Forss hatte in den Vernehmungen angegeben, dass ihr ein solcher Wagen in den Wochen zuvor an verschiedenen Orten aufgefallen war, sie hatte sich regelrecht beschattet gefühlt.
Forss’ Aussage hatte Nyström zunehmend stutzig werden lassen. Wenn ihre Kollegin meinte, in der Zeit vor der schrecklichen Tat tatsächlich verfolgt worden zu sein, warum hatte sie es dann um Gottes willen nicht gemeldet? Warum war sie nicht zu ihrer Chefin gegangen und hatte davon berichtet? Warum hatte sie sich Nyström nicht anvertraut?
Die Hauptkommissarin schluckte. Die Bluse war feucht vor Tränen, die Augen brannten. Sie kannte die Antwort, wenn sie ehrlich war. Weil Forss eine gestörte Persönlichkeit hatte. Weil sie ein soziales Wrack war. Weil sie niemandem traute und keinen an sich heranließ. Nyström schluckte erneut. Es schmeckte so bitter und salzig wie die Erkenntnis, die in ihrem Bewusstsein mehr und mehr Form annahm: Wäre Stina Forss weniger verkorkst, renitent und eigenbrötlerisch, wäre Healey womöglich noch am Leben.
Nyström umklammerte das Lenkrad, bis die Haut über ihren Fingerknöcheln weiß spannte.
Das Gefühl widersprach allem, woran sie glaubte und wofür sie stand, und dennoch war es da, wahr und rein: Sie wünschte, dass an diesem verfluchten Abend in der Aprildämmerung vor ihrem Haus die Richtige gestorben wäre und nicht die Falsche.
In diesem Moment meldete sich das Mobiltelefon. Sie räusperte sich und nahm das Gespräch an. Anschließend rieb sie sich die Augen trocken, wartete eine Minute, startete den Wagen und schaltete die Scheibenwischer ein.
3
Das Schwedische Glasmuseum lag gemeinsam mit dem Småländischen Museum und dem sogenannten Auswandererhaus auf einem Hügel hinter dem Bahnhof, von dem man auf den Växjösee hinabblicken konnte. Die drei Ausstellungsgebäude – postmodern, modernistisch und klassizistisch – bildeten ein uneinheitliches Ensemble in einer Grünanlage, die sich Kulturpark nannte, aber für Dealerei bekannter war als für seine Museen. Gras statt Glas. So sah es jedenfalls Stina Forss, die sich allerdings weder sonderlich für Glaskunst noch für regionale Geschichte interessierte. Der Starkregen schien jedoch wenigstens für den Moment die Kleindealer vertrieben zu haben, als sie den Kiesweg hinauf zum Glasmuseum ging. Da sie keinen Schirm dabei, und auch nicht an eine Jacke mit Kapuze gedacht hatte, war sie froh, das Foyer zu erreichen und die nassen Haare ausschütteln zu können. Keine Minute später traf Ingrid Nyström ein. Die beiden Frauen begrüßten einander knapp. Nach dem furchtbaren Vorfall mit Healey war die Atmosphäre zwischen ihnen noch kühler, als sie es ohnehin gewesen war. Forss konnte die unterschwellige Distanz ihrer Chefin nachvollziehen. Sie selbst war Lichtjahre davon entfernt, die richtigen Worte zu finden, um all das zu überwinden, was unausgesprochen zwischen ihnen stand.
Sie wandten sich an den Mann an der Kasse, der daraufhin kurz telefonierte.
Die Museumsleiterin kam in Begleitung eines uniformierten Polizisten in den Eingangsbereich gerauscht. Anders konnte man ihren Auftritt kaum bezeichnen. Die flatternden Handbewegungen der überraschend jungen Frau – Ende zwanzig, Anfang dreißig – verliehen ihr etwas Kolibrihaftes. Man sah ihr die Kulturperson an: extravagante Brille, asymmetrische Frisur, auffälliger Holzschmuck, bunter Seidenschal.
»Was für ein Drama!«, rief sie, »was für ein furchtbares Drama! Und das ausgerechnet heute!«
»Was ist denn heute?«, fragte Forss, die mit Theatralik nicht viel anfangen konnte.
»Die Vernissage!« Die ohnehin schon schrille Stimme schraubte sich im Tonfall der Entrüstung eine weitere Oktave nach oben, als könnte sie es nicht fassen, wie man über ein solch bedeutendes Ereignis nicht Bescheid wissen konnte. »250 Jahre Gustavssons – Eine Kulturgeschichte in Glas.«
»Ich habe natürlich davon gelesen, das klingt sehr spannend«, bemerkte Nyström und klang wie immer ausgleichend und um Deeskalation bemüht. »Aber vielleicht könntest du uns zunächst einmal sagen, was überhaupt geschehen ist?«
»Sicher, sicher«, nickte die junge Frau, deren Namensschild sie als Emma Herold auswies, schon einen Ton sachlicher. »Vielleicht bei einer Tasse Tee? Das japanische Restaurant hier im Haus serviert einen ausgezeichneten Gyokuro«, flötete sie. Die großen Holzperlen ihrer Halskette klackerten, die Aussicht auf ein belebendes Heißgetränk schien ihre Laune schlagartig zu beflügeln. »Oder vielleicht doch lieber einen Sencha?«
»Am liebsten würden wir sofort …«, begann Forss.
»Das klingt doch ausgezeichnet«, unterbrach Nyström sie lächelnd und an den uniformierten Kollegen gewandt: »Ich denke, ab hier übernehmen wir.«
Herold führte die Ermittlerinnen um mehrere Ecken. Im Izakaya Moshi, einem der besten Restaurants der Stadt, war zur Nachmittagsstunde wenig Betrieb. Die drei Frauen setzten sich ans Ende einer langen Tischreihe und bestellten.
»Die Vernissage also«, gab Nyström das Stichwort.
Herold nickte beflissen.
»Genau. 250 Jahre Gustavssons – …«
»… eine Kulturgeschichte im Glas«, vervollständigte Forss ungeduldig.
»In Glas«, korrigierte Herold naserümpfend, »es geht hier schließlich nicht um Alkohol, sondern um ein faszinierendes Material, ein regionales Kulturgut, um Handwerk, Formgebung, Kunst. 250 Jahre Gustavssons, das ist die Erfolgsgeschichte eines Weltkonzerns.«
Das letzte Wort klang in einem ehrfürchtigen Tremolo aus.
Forss zuckte mit den Achseln.
»Nie gehört.«
»Wir haben ein Set entsprechender Weingläser zu Hause«, schob Nyström ein. »Orchidee.«
»Das Modell ist ein Klassiker«, lobte Herold. »Wusstet ihr, dass es weltweit fünf Länder gibt, die bei offiziellen Staatsempfängen auf Gustavssons Gläser vertrauen? Darunter zwei Königshäuser! Selbstverständlich handelt es sich in solchen Fällen um Sonderanfertigungen, nichts, was es im Handel zu erwerben gäbe.«
»Selbstverständlich«, echote Forss und beäugte misstrauisch, die winzigen, hauchdünnen Schalen, die der Kellner mitsamt einer gusseisernen Kanne an den Tisch brachte. Sie wollte keinen avanciert zubereiteten Tee trinken, sondern den Tatort besichtigen. Wenn es denn einen solchen überhaupt gab. »Aber kommen wir doch zurück zur heutigen Ausstellungseröffnung.«
»Sicher, sicher«, wiederholte sich Herold, während sie sich mit fachmännischer Miene einschenkte, »wir reden hier über vierhundert Exponate, eine anderthalbjährige Vorbereitungszeit, komplizierte Versicherungsfragen, alles in allem eine unglaubliche Verantwortung, besonders für die kuratorische Leitung.« Sie sah die beiden Ermittlerinnen über die Gläser ihrer Brille hinweg an, ein Blick, der keinen Zweifel daran lassen sollte, wer mit der besagten Leitung betraut war. »Einige der Ausstellungsstücke haben einen Wert, den man kaum ermessen kann.«
»Aber wir sind ja nun wohl kaum hier, weil etwas gestohlen worden ist«, merkte Forss an.
»Nein«, erwiderte Herold, setzte die Teekanne ab und einen dramatischen Gesichtsausdruck auf. »Wir mussten die Polizei rufen, weil ein bestimmtes Exponat, nun ja, … diverse Fragen aufwirft.«
Der Regen klatschte gegen die Fenster, ganz in der Nähe grollte der Donner.
»Ich sehe noch immer nicht, wo hier das Gewaltverbrechen liegen soll«, drängte Forss.
»Warte ab, bis du gesehen hast, wovon ich spreche.« Herold sah demonstrativ auf ihre Uhr. Die Holzkugeln ihres Armbands, ein Pendant zur Halskette, klackerten. »Ich denke, er ist gleich so weit.«
»Er?«, fragte Nyström.
4
Herold führte sie im Stechschritt durch die Museumsräume. Soweit Nyström im Vorbeigehen wahrnahm, war die Ausstellung chronologisch aufgebaut. Glas aus zweieinhalb Jahrhunderten: altertümliche Kronleuchter, bauchige Flaschen, Spiegel, Karaffen. Vasen und Weinkelche. Einweck-, Wasser- und Teelichtgläser. Klares, geschliffenes, geätztes und graviertes Glas. Nach den Gebrauchsgegenständen folgten Räume mit Kunsthandwerk und Kunst, es wurde bunter. Riesige Vasen, durchzogen mit farbigen Schlieren. Menschenähnliche Figuren, beinahe lebensgroß, eng umschlungen, Liebende. Daneben amorphe Wesen wie aus Weltraumhorrorfilmen. Etwas, das wie ein überdimensioniertes Kondom aussah. Eine gigantische Wolke, die von der Decke hing, so fein und fragil gearbeitet, dass Nyström ob der Kunstfertigkeit staunen musste.
Alle Räume waren menschenleer.
»Wo sind denn die Besucher?«, fragte Forss. »Ich dachte, dies sei eine Jahrhundertausstellung?«
»Auf der Vernissage waren dreihundert geladene Gäste«, antwortete Herold schmallippig. »Nach dem, nun ja, nennen wir es Vorfall, mussten wir sie alle nach Hause schicken beziehungsweise auf die anderen Ausstellungen des Hauses verweisen. Er hat das ausdrücklich so verfügt, uns sind da die Hände gebunden. Ein einziges Fiasko! Weshalb uns natürlich sehr daran gelegen ist, den Sachverhalt so bald wie möglich aufzuklären.«
»Ein gutes Stichwort«, sagte Forss. »Sachverhalt. Vielleicht reden wir endlich einmal darüber, was eigentlich passiert ist.«
Nuschelte ihre Mitarbeiterin leicht, fragte sich Nyström, hatte Forss etwa zu dieser Tageszeit schon Alkohol getrunken?
Sie waren unterdessen vor einer geschlossenen Flügeltür angelangt.
»Ich denke, das kann er euch am besten selbst erklären«, sagte Herold, klopfte und öffnete die Tür. Sie traten in einen abgedunkelten Raum. Es gab nur eine einzige Lichtquelle. Ein illuminierter gläserner Sarkophag. Nyström machte einen weiteren Schritt. Jetzt entdeckte sie das menschliche Skelett hinter den wuchtigen Glaswänden. Es trug ein Kleid. Ihre erste Reaktion: Abwehr. Die Knochen und der Schädel sahen auf befremdliche Weise echt aus, dazu das verschlissene und verschmutzte Kleidungsstück. Tod hinter Glas. Auch wenn Nyström kaum etwas von Kunst verstand, berührte sie das Objekt emotional, es griff sie geradezu an. Einerseits bildete der Sarg – neben Schädel und Knochen ein weiteres Vergänglichkeitssymbol – eine Grenze zwischen dem Innen und dem Außen, dem Tod und dem Leben, andererseits lud seine Durchsichtigkeit zur Betrachtung, ja, einer Art verdrehtem Voyeurismus ein. Eine makabre Inszenierung. Trotzdem verstand sie nicht, wo sich hier ein Verbrechen abgespielt haben sollte. Wozu waren sie hierhergerufen worden?
»Die Installation heißt Schneewittchen«, flüsterte Herold andächtig.
Nach einigen Momenten hatten sich Nyströms Augen an das Zwielicht gewöhnt. Erst jetzt nahm sie wahr, dass sich außer ihnen noch eine weitere Person in dem Raum befand. Auf einem faltbaren Hocker, wie er für Museen typisch war, saß ein älterer Mann auf einen Gehstock gestützt, der tief in den Anblick des seltsamen Werks versunken zu sein schien. Herold räusperte sich vernehmlich.
»Wenn ich vorstellen dürfte: Gunnar Gustavsson, der Vorstandsvorsitzende der Gustavssons GlasAB. Ingrid Nyström und Stina Forss von der Kriminalpolizei.«
Der Kopf des Manns drehte sich ein wenig, gerade eben so, dass er ihnen einen kurzen Blick zuwerfen konnte, dann wandte er sich wieder der Installation zu.
»Zwei Frauen«, sagte er heiser und seine Tonlage ließ wenig Interpretationsspielraum zu, was er über diesen Umstand offenbar dachte. »Sie schicken zwei Frauen.«
Etwas in Nyström straffte sich. Wenn auch selten, so erlebte sie ähnliche Situationen doch immer wieder.
»Hauptkommissarin Ingrid Nyström«, erklärte sie kühl. »Ich bin die ranghöchste Ermittlerin für Gewaltverbrechen in der gesamten Region. Und Kommissarin Stina Forss ist meine fähigste Mitarbeiterin.« Auch wenn ihr die letzten Worte schwer über die Lippen gingen, waren sie doch wahr. »Ich schlage vor, wir sprechen nun über den vermeintlichen Sachverhalt, oder meine Kollegin und ich werden auf der Stelle wieder gehen.« Sie hatte weiß Gott Besseres zu tun, als sich an einem Samstagnachmittag von einem alten Chauvinisten vorführen zu lassen. Überhaupt war es ein Unding, dass sie noch immer nicht wussten, weshalb sie überhaupt hier waren. Erik Edman hatte sie persönlich angefordert, ein ungewöhnlicher Vorgang, kamen die Einsatzzuweisungen doch im Normalfall über den Disponenten in der telefonischen Leitstelle. Aber dass ihr karrierebesessener Vorgesetzter einem einflussreichen Firmenpatriarchen wie Gustavsson einen persönlichen Gefallen erweisen und sein bestes Personal schicken wollte, ergab natürlich Sinn, auch wenn Edman sie in dem kurzen Telefonat ärgerlicherweise nur mit nebulösen Informationshäppchen und vagen, unzusammenhängenden Anspielungen abgefertigt hatte.
»Der Sachverhalt«, sagte Gustavsson, ohne dabei aufzusehen, »ist folgender: Dies hier, die Knochen in dem Sarg«, bei diesen Worten klopfte er mit der Spitze seines Gehstocks an die gläserne Hülle, »gehören nicht irgendeinem Schneewittchen. Es sind die sterblichen Überreste meiner Frau Berit.«
Für einige Augenblicke war es still in dem Raum. Nur die Neonröhren, auf denen das Skelett in dem gläsernen Sarkophag ruhte, brummten vor sich hin.
»Wie ist das möglich?«, fragte Nyström schließlich. Da Gustavsson nicht reagierte, blickte sie Herold Hilfe suchend an.
Die Kuratorin zuckte mit den Schultern.
»Das Werk ist die Leihgabe eines amerikanischen Sammlers, geschaffen hat es Jan Hesenius, einer der ganz Großen seines Fachs. In den frühen Achtzigerjahren hat er einige aufsehenerregende Arbeiten im Auftrag von Gustavssons gefertigt. Schneewittchen stammt aus dem Jahr 1982 und ist kunstgeschichtlich ein Meilenstein, einer der Höhepunkte der Ausstellung. Wir waren begeistert, dass wir es für die Schau gewinnen konnten. Der Sammler lebt in New York, ich kannte das Objekt nur von Fotos, bevor es hier vor etwa einer Woche eingetroffen ist. Allein der logistische und finanzielle Aufwand …«
»Dies hier ist nicht Jans Werk«, fauchte Gustavsson. Langsam stand er auf und wandte sich ihnen zu. Er atmete schwer, sichtbar um Selbstbeherrschung bemüht. »Ich war dabei, als er es in unserer Glashütte geschaffen hat«, fuhr er in einem sachlicheren Ton fort. »Als es fertig war, fand ich es aus verschiedenen Gründen verstörend. Auf meine Änderungsvorschläge hat sich Jan nicht eingelassen. Künstler sind Dickschädel, und wahrscheinlich ist das auch gut so. Aber sein Schneewittchen und die ästhetische Ausrichtung unserer Firma passten einfach nicht zusammen, außerdem hat es mich zu sehr an … Damals wollte ich jedenfalls nicht, dass es in unserem Namen ausgestellt wird.« Gustavsson verzog seinen faltigen Mund. »Ich habe es ihm überlassen, er hat es behalten und später weiterverkauft. Wer hätte ahnen können, dass es einmal zu einer Ikone der Glaskunst werden würde? Sei’s drum, ich gönne Jan seinen Ruhm, und es war großzügig, dass der jetzige Besitzer es für die Jubiläumsausstellung zur Verfügung gestellt hat.« Seine hellblauen Augen glommen im kühlen Licht der Neonröhren. »Nur: Dies ist überhaupt nicht Jans Werk«, wiederholte er. »Das Original hat gläserne Knochen, die detailgetreue Arbeit daran hat Wochen gedauert. Dieses Skelett hier dagegen sieht in meinen Augen ziemlich echt aus.«
»Aber was veranlasst dich zu glauben, dass es sich dabei um deine verstorbene Frau handeln könnte?«, fragte Nyström.
Die blauen Augen fixierten sie.
»Das Kleid. Im Original ist es ein helles Etuikleid mit einem leuchtend roten Fleck in Höhe des Schritts. Jans kruder Humor. Schneewittchens Entjungferung oder Menstruation. Vielleicht sollen die Zwerge sie auch vergewaltigt haben, was weiß ich? Dies jedoch«, er wies mit ausgestrecktem Arm und zitterndem Zeigefinger auf die Installation, »ist das Brautkleid meiner Frau.«
Nyström sah genauer hin. Das Kleid war alt, teilweise zerrissen, der Stoff, der offenbar irgendwann einmal weiß gewesen sein musste, war schmutzig und vergilbt. Auf Höhe der Brust war ein markanter dunkler Fleck, womöglich geronnenes Blut. Obwohl es derart mitgenommen aussah, erkannte Nyström, die früher selbst viel genäht hatte, dass es ein Brautkleid besonderer Machart war. Ein raffinierter Schnitt, ein synthetischer Stoff, wie er in den Siebzigerjahren gern benutzt worden war, dazu wenig, aber wirkungsvoll eingesetzte Spitze, markante Knöpfe aus schimmerndem Perlmutt.
»Verwechslung ausgeschlossen?«, fragte Forss.
Gustavssons Stimme bebte.
»Berit hat es bei einem Schneider in Stockholm in Auftrag gegeben. Ein Entwurf nach ihren eigenen Vorstellungen. Verwechslung ausgeschlossen.«
»Wann ist Berit denn gestorben?«, fragte Nyström.
Gustavsson ließ seinen Arm wieder sinken. Mit einem Mal schien alle Wut und Kraft verflogen.
»Das ist es ja gerade, ich weiß es nicht«, sagte er leise. »Niemand weiß das. Am Abend des 29. August 1971 ist sie während unseres Hochzeitsfests verschwunden. Danach wurde sie nie wieder gesehen.«
Die Kommissarinnen sahen sich an.
»Das ist beinahe fünfzig Jahre her«, stellte Nyström schließlich fest.
5
Stina Forss und Emma Herold befanden sich im Büro der Museumsleiterin. Gerahmte Poster zeugten von vergangenen Ausstellungen. Wie man so viel Getue um Glas machen konnte, war Forss ein Rätsel.
»Ergeben Gustavssons Worte in deinen Augen Sinn?«, fragte sie.
»Hmm.« Herold stand vor ihrem Schreibtisch über einen großformatigen Bildband gebeugt. Forss, die sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um ihr über die Schulter zu sehen, versuchte die fotografische Abbildung von Schneewittchen mit der Erzählung des alten Manns in Einklang zu bringen. Es stimmte schon, auf der Abbildung schienen die Knochen tatsächlich aus Glas zu sein, auch wenn man das wegen der Lichtreflexionen des durchsichtigen Sargs nur erahnen konnte. »Das Kleid ist jedenfalls definitiv ein anderes, es ist in viel besserem Zustand und der auffällige Fleck ist tatsächlich an einer anderen Stelle. Verdammt, wie konnte das nur geschehen? Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Bei solch einem berühmten Werk? Bei einer Versicherungssumme von zweieinhalb Millionen Kronen?«
»Bei vierhundert Exponaten und der unglaublich großen Verantwortung«, zitierte Forss Herolds eigene Ausführungen und gab sich Mühe, dabei nicht allzu sarkastisch zu klingen, »kann das schon mal passieren.«
Das Letzte, was sie gebrauchen konnte, war eine unter Umständen wichtige Zeugin, die sich in Selbstvorwürfen erging, anstatt nachzudenken und konstruktiv zu der Ermittlung beizutragen. Dennoch nahm sie zur Kenntnis, dass die junge Museumsleiterin offenbar nicht die Fachexpertise hatte, die man von einer Frau in ihrer Position erwarten konnte.
»Außerdem stimmen die Maße nicht überein«, stellte Herold fest, die den Ausstellungsführer neben den Bildband gelegt hatte. »Ich habe das Werk für unseren Katalog eigenhändig vermessen. Im Vergleich zu den Angaben aus diesem Fachbuch ist der Sarg, der unten steht, fünf Zentimeter zu kurz, drei zu hoch und sieben zu breit. Noch ein Fauxpas von mir.« Sie wirkte aufrichtig zerknirscht. »Es sind also nicht nur die Knochen ausgetauscht worden, sondern auch die gläserne Hülle.«
»Versuchen wir es doch einmal mit schlichter Logik«, sagte Forss. »Wenn dieses Glaskunstwerk die Leihgabe eines Sammlers ist, dann sehe ich eigentlich nur drei Möglichkeiten.«
»Edmund, er heißt Joseph Edmund«, schob Herold ein. »Er ist in den USA mit einer Textilreinigungskette reich geworden und hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten auf das Sammeln von Glaskunst spezialisiert. Wir haben insgesamt vier Exponate von ihm geliehen.«
»Also, entweder hat dieser Edmund absichtlich eine Abwandlung der ursprünglichen Arbeit geschickt, womöglich um Gunnar Gustavsson zu schockieren, zu ängstigen oder zu ärgern. Falls sich die beiden Männer nicht persönlich kennen und miteinander verfeindet sind, eine eher unwahrscheinliche Möglichkeit. Die zweite Variante wäre, dass Jan Hesenius beziehungsweise die Galerie, die ihn vertrat, Edmund eine Fälschung verkauft hat. Klingt für mich ebenfalls sehr zweifelhaft. Jemand, der im großen Stil berühmte Glaskunst sammelt, kennt sich doch aus und lässt sich nicht einfach übers Ohr hauen, vor allen Dingen nicht, wenn es dabei um Summen geht, wie du sie eben erwähnt hast.« Herold verzog bei den Worten geknickt den Mund. »Die dritte und wahrscheinlichste Variante«, fuhr Forss fort, »das Original wurde auf dem Weg von New York nach Växjö, oder vielleicht sogar hier im Museum ausgetauscht, und weder Hesenius noch Edmund haben mit der Sache etwas zu tun.«
»Hier vor Ort?« Herolds Stimme schnellte erneut um eine Oktave nach oben. »Unmöglich! Ich vertraue meinem Personal zu einhundert Prozent. Außerdem: Wie sollte das praktisch überhaupt vonstattengehen? Solch ein Objekt tauscht man nicht mal eben so aus. Der Sarg wiegt mehr als dreihundert Kilo, wir haben einen Gabelstapler benötigt, um ihn an Ort und Stelle zu bugsieren.«
Forss zuckte mit den schmalen Schultern.
»Wenn nicht hier, dann muss der Tausch eben woanders geschehen sein. Oder es gibt, wie gesagt, doch eine Verwicklung des Künstlers beziehungsweise Sammlers in die Sache. Auf jeden Fall brauche ich sämtliche Kontaktdaten, die Fracht- und Versicherungspapiere, die Zollunterlagen, den gesamten Papierkram, der Schneewittchens Reise über den Atlantik dokumentiert.«
»Natürlich«, nickte Herold beflissen und machte sich daran, den entsprechenden Aktenordner aus einem Regal zu suchen. Einen Augenblick später hielt sie in der Bewegung abrupt inne. Ihre Gesichtszüge entglitten. Entsetzt blickte sie Forss an. Offenbar war sie auf einen furchtbaren Gedanken gekommen.
»Wenn da unten in der Ausstellung tatsächlich eine Fälschung steht, wo um alles in der Welt befindet sich dann das Original?«
Das, dachte Forss, ist im Moment mein geringstes Problem.
6
Ingrid Nyström war es gelungen, Gunnar Gustavsson dazu zu bewegen, den Ausstellungsraum zu verlassen und ihn in das japanische Restaurant zu dirigieren. Die Atmosphäre in dem abgedunkelten Raum und der Anblick der makabren Installation hatte sie beklommen gemacht. Sie versuchte, den Kloß in ihrem Hals zu ignorieren, auch wenn das so gut wie unmöglich war. Doch hier und jetzt ging es nicht um ihre Befindlichkeit, sondern um kriminologische Arbeit. Wenn die seltsame Geschichte des alten Manns stimmte, war die ganze Sache nicht nur äußerst rätselhaft, sondern sie hatten es womöglich mit einem schweren Verbrechen zu tun. Während sie im Izakaya Moshi auf Gustavssons doppelten Espresso und dreifachen Cognac warteten, musterte Nyström ihr Gegenüber. Der Mann mochte körperlich eingeschränkt sein, aber geistig war er auf der Höhe. Er wirkte keinesfalls wie ein Spinner. Sie rief sich in Erinnerung, dass sie es mit dem Chef eines internationalen Konzerns zu tun hatte; der Gehstock, den sie zunächst als Zeichen von Altersschwäche gedeutet hatte, schien eher einer Beinverletzung als Gebrechlichkeit geschuldet. Oder war es nur die verschrobene Geste eines konservativen Patriarchen?
Nachdem die Getränke serviert worden waren, und Gustavsson sie hinuntergestürzt hatte, ließ Nyström dem Koffein und dem Alkohol einige Momente, um zu wirken. Es dauerte nicht lange. In Gustavssons Augen regte sich etwas.
»Wir müssen über deine Frau und die Hochzeitsfeier sprechen«, sagte sie schließlich, »auch wenn die damaligen Ereignisse eine halbe Ewigkeit zurückliegen.«
Gustavsson nickte entschlossen. Wenn er immer noch ein Problem damit hatte, einer Polizistin gegenüberzusitzen, dann ließ er es sich zumindest nicht mehr anmerken, im Gegenteil, er öffnete sich ihr mit einer unvermuteten Direktheit, womöglich das Wirken des Cognacs.
»Ich bin kein Mann, der um das Wesentliche herumredet.« Er räusperte sich. »Es begann natürlich mit Berit«, hob er an, und seine heisere Stimme bekam nun beinahe etwas Versonnenes. »Alles begann mit Berit. Das erste Mädchen, in das ich mich verliebte – und das letzte. Berit wuchs im Nachbardorf auf, wir waren gleichaltrig, gingen in dieselbe Klasse, sie kam wie ich aus einer sogenannten Glashüttenfamilie. Sie war der Punkt, auf den für mich alles hinauslief. Ihre Einfühlsamkeit, die Kreativität, das lebendige Lachen. Sie war nicht nur eine Schönheit, sondern auch eine Künstlerseele, das habe ich ganz früh gespürt, ein freier Geist, das passende Gegenstück zu meiner analytischen, zugegebenermaßen bisweilen unterkühlten Art. Das hat mich fasziniert und gleichzeitig wahrscheinlich auch eingeschüchtert, anders kann ich nicht erklären, warum ich so viele Jahre gebraucht habe, um ihr meine Gefühle zu offenbaren. Was für ein Glück, was für eine Erlösung, dass sie dasselbe für mich empfand! Wir waren achtzehn, als wir endlich ein Paar wurden, neunzehn, als wir uns verlobten, dabei wusste ich schon viele, viele Jahre, dass sie die Richtige, dass sie die Einzige für mich war. Eigentlich seit ich ein kleiner Junge war.« Er hielt für einen Moment inne, als würde ihn eine schöne Erinnerung streifen. »Dann ging alles schnell. Es war die Zeit, in der viele Glashütten miteinander fusionierten. Der Betrieb von Berits Eltern, die Thurstan-Hütte in Bytorp, ging in unserer Firma auf, ein wirtschaftlich sinnvoller und nach unserer Verlobung auch emotional schlüssiger Schritt. Zwei Jahre später legten wir das Hochzeitsdatum fest. In den August, denn das war Berits Lieblingsmonat. Auf einer Wiese in einem Birkenhain am Seeufer, denn das war Berits Lieblingsort. Es sollte ein rauschendes Fest werden, so haben wir uns das gewünscht, zwei Familien, die zusammenwuchsen, zwei Glashütten und zwei Dörfer, was damals beinahe noch identisch war. Die Gustavssons und die Thurstans, Rödahult und Bytorp. Das Wetter spielte mit, es war ein wunderbarer Spätsommertag.« Der alte Mann unterbrach sich, griff nach dem leeren Cognacschwenker und gab dem Kellner ein Zeichen. Seine Erzählung forderte Nachschub. Nachdem ihm ein neues Glas gebracht worden war, und er, diesmal langsamer, getrunken hatte, fuhr er fort. »Was soll ich sagen? An dieser Stelle endete das wunderbare Märchen von Berit und Gunnar auch schon wieder, stattdessen begann ein jahrzehntelanger Albtraum.« Er sah Nyström eindringlich an. »Aber der Reihe nach: Die Feier war in vollem Gang, die Tische bogen sich unter der Last des Essens, Bier und Schnaps flossen in Strömen, eine Band spielte zum Tanz auf, du kannst es dir vorstellen. Es gab mehr als zweihundert Gäste, die Stimmung war auf dem Höhepunkt. Der Abend war fortgeschritten, ich weiß es noch wie heute, als plötzlich ein böiger Wind aufkam, die Lampions in den Birken zu schaukeln begannen, und es kühler wurde. Nach den vielen Reden und traditionellen Liedern sollte es noch eine Art Spiel geben, ein ursprünglich österreichischer Hochzeitsbrauch, auf den Herbert bestanden hatte.«
»Herbert?«
»Er war so etwas wie Berits Adoptivbruder. Seine Eltern sind wie viele Facharbeiter Mitte der Sechzigerjahre aus dem deutschsprachigen Raum emigriert, um in den småländischen Hütten zu arbeiten. Herberts Vater war ein begabter Glasschleifer, tragischerweise ist er wenige Monate nach seiner Ankunft bei einem furchtbaren Arbeitsunfall – einer der Schmelzöfen ist explodiert – ums Leben gekommen. Seine Frau starb anderthalb Jahre später an einem Hirnschlag. Zurück ließen sie einen dreizehnjährigen Jungen, Herbert. Damals haben sich die Hüttenbesitzer noch persönlich um ihre Belegschaft gekümmert, außerdem waren die Thurstans eine warmherzige, großzügige Familie, sie haben sich des Kleinen angenommen und ihn beinahe wie ihren eigenen Sohn großgezogen. Herbert war ein Jahr jünger als Berit, die beiden standen sich sehr nahe. Ich habe später viel über die Sache nachgedacht: Eigentlich muss Herbert noch zu jung gewesen sein, als er mit seiner Familie die Heimat verlassen hatte, um sich selbst an diesen merkwürdigen Brauch zu erinnern, aber es gab drei, vier ältere österreichische Landsleute in der Hütte, und ich vermute, dass sie ihm den Floh ins Ohr gesetzt haben.«
»Was für einen Floh?«
»Die Brautentführung.«
»Die Braut wurde entführt?«
»Natürlich nur spielerisch. Irgendwann während der Feier verschwinden der Trauzeuge oder ein enger Freund der Familie mit der Braut, und sie verstecken sich in einer Gastwirtschaft oder Kneipe in einem der Nachbardörfer. Der Bräutigam, manchmal auch gemeinsam mit einem Teil der Festgesellschaft, sucht die beiden und löst die Braut aus. Selbstverständlich wird dabei ordentlich gebechert. So oder so ähnlich handhabt man es in vielen Gegenden Österreichs und Teilen Süddeutschlands.«
»Für ihre Kneipendichte sind Rödahult und Bytorp nun nicht gerade bekannt.«
Ein flüchtiges Lächeln huschte über Gustavssons Gesicht.
»Wahrlich nicht. Man muss heute noch zwanzig Kilometer fahren, um abends spontan ein Bier trinken zu gehen, und damals war es noch viel trostloser. Aber auf die Trinkerei kam es Herbert auch gar nicht an. Der Spaß sollte vielmehr darin bestehen, dass er Berit auf eine der Inseln ruderte, die unweit des Ufers lagen, an dem wir feierten. Auf Österö hatten wir eine kleine Anglerhütte, in der sie warten würden, bis ich hinterhergepaddelt kam, um meine Braut symbolisch zu befreien. Wir sollten mit echtem Champagner anstoßen, damals bei uns auf dem Land eine Seltenheit, den Berits Vater von einer Geschäftsreise aus Frankreich mitgebracht hatte, ein Glas aus der Gustavsson-Produktion, eins aus der Thurstan-Hütte, um das Zusammenwachsen unserer Familien endgültig zu besiegeln. Im Grunde natürlich ein alberner Spaß, aber Herbert war derart Feuer und Flamme, dass wir uns seiner spontanen Idee nicht in den Weg stellen mochten. Ehrlich gesagt fand ich die ganze Aktion etwas übertrieben, auch ein wenig zu fremdländisch, und sie zwei Wochen vor der Hochzeit noch ins Festprogramm einzubauen, war ziemlich kurzfristig, aber ich habe gespürt, dass Berit Herbert nicht enttäuschen wollte, schließlich war er wie ein Bruder für sie, deshalb gab ich nach und willigte ein. So wurde Herberts sogenannte Brautentführung zu einem Bestandteil der Zeremonie, und ich glaube, die meisten Gäste fanden das Ganze ziemlich lustig, vor allem, weil meine Aufgabe darin bestand, in einem Kinderschlauchboot nach Österö hinauszupaddeln.«
Gustavsson leerte den Rest Cognac in einem Zug und winkte nach einem dritten Glas.
»Wie ich bereits erwähnte, hatte sich das Wetter im Laufe des Abends geändert. Ein böiger Wind war aufgekommen, die Temperatur war schlagartig gefallen. Eine Weile nachdem sich Berit und Herbert wie verabredet davongestohlen hatten, musste ich natürlich den Empörten spielen, unter dem rhythmischen Klatschen der johlenden Menge ans Ufer marschieren und in meinem feinen Anzug in dieses winzige Schlauchboot klettern. Die Leute hatten natürlich einen Riesenspaß. Der Juniorchef, der sich zum Affen machte, auch wenn mir das völlig egal war. Es war der Tag meines Lebens, ich war freudetrunken und auch sonst längst nicht mehr nüchtern. Ich war glücklich. Aber mit dem Spaß hatte es ziemlich bald ein Ende. Der See, der eine Stunde zuvor noch eine spiegelblanke Oberfläche gehabt hatte, war aufgewühlt, die Wellen schlugen in das kiellose Kinderboot, und die Strömung trug mich in die falsche Richtung. Ich musste wirklich kämpfen, um einigermaßen auf Kurs zu bleiben. Schon nach Minuten war ich schweißnass, meine Muskeln brannten. Die Leute am Ufer haben überhaupt nicht bemerkt, wie ernst die Situation war, oder sie hatten sich längst wieder zurück an die Tafel gesetzt oder weitergetanzt. Nach einer Dreiviertelstunde, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, hatte ich Österö endlich erreicht. Bei ruhigem See und mit einem richtigen Ruderboot hätte ich vielleicht fünf Minuten für die Strecke gebraucht. Völlig erschöpft, von der Gischt klitschnass und durchfroren, bin ich auf die Insel gewankt.« Er nahm das neue Glas, das der Kellner gebracht hatte, ließ den Cognac kreisen und betrachtete das Getränk. »Finnische Produktion«, sagte er schließlich.
»Der Weinbrand?«, fragte Nyström verdutzt. Hieß Cognac nicht Cognac, weil er aus der gleichnamigen französischen Region kam? Genau wie Champagner?
»Das Glas!«, antwortete Gustavsson mit Nachdruck. »Im Schwedischen Glasmuseum werden die Getränke in finnischen Gläsern serviert.« Er schüttelte abschätzig den Kopf. »Aber zurück zu meiner Geschichte. Obwohl ich die Pointe ja bereits angedeutet habe.«
»Berit und Herbert waren nicht auf der Insel«, stellte Nyström fest.
»Nein«, sagte er, »das waren sie nicht. Weder auf Österö noch zurück auf dem Fest noch zu Hause noch sonst wo. Sie waren weg, spurlos verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Siebenundvierzig Jahre habe ich nichts von Berit gehört. Keinen Hinweis, ob sie noch am Leben ist, keinen Beweis für ihren Tod. Dasselbe gilt für Herbert.«
»Was ist mit dem Ruderboot?«, fragte Nyström. Sie spürte, wie sich in ihr die Kriminalistin zu regen begann. »Ist das Boot geborgen worden?«
Gustavsson schüttelte den Kopf.
»Wie du dir denken kannst, habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um Berit zu finden. Noch in der Nacht haben wir Suchtrupps organisiert, sind mit Motorbooten den See abgefahren, haben die anderen Inseln und das Ufer abgesucht. Wir sind durch die umliegenden Dörfer gefahren und haben Anwohner und Nachbarn befragt. Nichts. Niemand hatte etwas gesehen oder gehört.«
»Was ist mit Tauchern? War es nicht das Naheliegendste, dass die beiden gekentert sind? Du hast ja selbst eindringlich von den schwierigen Verhältnissen auf dem Wasser berichtet.«
»Natürlich kamen in den nächsten Tagen auch Taucher zum Einsatz, nur gefunden haben sie nichts. Der See ist siebzehn Quadratkilometer groß, hat mehr als vierzig Kilometer teilweise schwer zugängliche Ufer. Es war unmöglich, alles systematisch abzusuchen, außerdem darfst du nicht vergessen, dass die Ausrüstung damals viel primitiver war als heute. Kein Sonar, kein GPS. Mehr als zehn Jahre später sind Angler auf das Gerippe eines versunkenen Ruderboots gestoßen, aber was hieß das schon bei einem See dieser Größe? Es war nicht mehr zu rekonstruieren, ob es sich um das fragliche Boot gehandelt hat. Der See ist außerdem sehr tief. An manchen Stellen steigt die Wassertemperatur nicht mal im Sommer über vier oder fünf Grad. Ein Gerichtsmediziner hat mir später erklärt, dass Leichname, die in so kaltem Wasser landen, nicht zwangsläufig wieder auftauchen.«
Nyström nickte. Ihre Freundin, die Pathologin Ann-Vivika Kimsel, hatte ihr in den verschiedensten Zusammenhängen bereits ausführliche Vorträge über das Verhalten von Wasserleichen gehalten. Sehr niedrige Temperaturen verlangsamten die Verwesungsprozesse derart, dass es nicht zur ausreichenden Bildung von Fäulnisgasen kam, die für den Auftrieb verantwortlich waren.
»Die Theorie vom Kentern konnte also niemals ausgeschlossen werden?«, fragte sie.
»Bis ich heute Vormittag bei der verdammten Vernissage vor diesen Glassarg getreten bin und Berits Kleid erkannt habe, war es die einzige Erklärung, an die ich geglaubt habe«, sagte Gustavsson und trank den Rest seines Cognacs aus.
7
Stina Forss und Ingrid Nyström saßen sich im Büro der Hauptkommissarin am Schreibtisch gegenüber.
»Was denkst du über die ganze Sache?«, wollte Nyström wissen.
Forss betrachtete ihre Fingernägel, auf denen sich Reste von blauem Lack befanden. Es war dringend Zeit für eine sorgfältige Maniküre, vielleicht sollte sie es mal mit goldenem Nagellack versuchen?
»Auf jeden Fall eine schräge Story«, sagte sie und rückte ihre Augenklappe zurecht. »Und mit Sicherheit morgen in aller Munde. Herold zufolge waren auf der Vernissage drei oder vier Journalisten. Der alte Gustavsson hat sie nach seiner Entdeckung alle hochkant hinausgeworfen: die Bürgermeisterin, die anderen Mitglieder der Firmenleitung, den gesamten Familienclan, die Kulturszene der Stadt. Ein echter Eklat.«
»Edman wird begeistert sein«, sagte Nyström leise.
»Wenn es überhaupt ein Fall für uns ist, und nicht nur der geschmacklose Scherz eines Glaskünstlers oder New Yorker Kunstsammlers.«
»Wir benötigen als Erstes die alte Polizeiakte. Auf mich wirkte Gustavsson durchaus glaubhaft, seine Geschichte authentisch. Dennoch kann er sich natürlich irren, was das Kleid angeht. Siebenundvierzig Jahre sind eine lange Zeit. Und manchmal sehen die Leute, was sie sehen wollen. Was uns dagegen wirklich Aufschluss geben kann, sind die menschlichen Knochen, falls sie denn tatsächlich echt sind.«
»Die DNA nutzt uns nur, wenn wir einen Vergleich haben.«
»Gustavsson hat über all die Jahre den gesamten Besitz seiner Frau aufbewahrt.«
»Hinter dem kantigen Patriarchen alter Schule verbirgt sich also ein Romantiker.«
»Du wärst überrascht gewesen, wie offen er über seine Gefühle gesprochen hat.«
»Eine Blutprobe wäre ein Volltreffer. Aber warum sollte man so etwas verwahren? Dann eher schon ein Kamm mit ausgezupften Haaren, denn ohne Wurzel geben sie keine aussagekräftigen Informationen. Eine Haarlocke in einem Amulett würde uns also nicht weiterhelfen.«
»Danke für die Nachhilfe in Forensik«, entgegnete Nyström spitz. »Dass die Chancen klein sind, ist mir natürlich klar. Lass uns trotzdem die Daumen drücken. Das Spurensicherungsteam ist jedenfalls bereits zum Familiensitz ausgerückt. Außerdem schaffen sie die Installation aus dem Museum in die Untersuchungsräume, damit sich Ann-Vivika die Knochen genauer ansehen kann.«
»Ich hoffe, sie haben einen Gabelstapler parat«, murmelte Forss.
»Alles Weitere besprechen wir morgen früh im Team. Könntest du bis dahin die alte Fallakte auftreiben und sichten? Berit Gustavsson und Herbert Moosbrugger.«
»Aye, Sir«, antwortete Forss. Das bedeutete viele Stunden Extraarbeit. Andererseits: Was sollte sie sonst mit dem Samstagabend anfangen? Außer sich wieder ihren Gin Tonics zu widmen, fiel ihr da nicht viel ein. Trotzdem wartete sie auf ein kleines »Danke«, vielleicht auch nur, weil Nyström im Allgemeinen ein höflicher Mensch war.
Aber da kam nichts.
Und Forss wusste genau, warum.
Sie lächelte schmal, stand auf und verließ ohne ein weiteres Wort das Büro.
Bytorp 1968
Meine Güte, was habe ich gestern getanzt, lange und wild, meine Füße glühen jetzt noch! Klar, die Bowle hatte es ganz schön in sich, dazu der Wodka, den Maja auf der Toilette versteckt hatte. Ich habe mich wahrscheinlich ganz schön zum Affen gemacht. Barfuß auf dem Tisch zu tanzen! Aber es hat sich so gut angefühlt, frei und unbeschwert. Das Abitur feiert man schließlich nur einmal im Leben! Und frei, das bin ich jetzt wohl tatsächlich. Nie wieder in dieses intellektuelle Gefängnis zurückzumüssen, nie wieder vor Rektor Abrahamsson zu kuschen, und vor allem: nie wieder französische Verbformen zu pauken, was sind das für formidable Aussichten! Ich glaube, die einzige Person des ganzen Lehrkörpers, die ich vermissen werde, ist Fräulein Clarin. Sie ist vielleicht selbst nicht die größte Künstlerin auf Erden, aber ohne sie wären mein Zeichenstil und meine Aquarellmalerei nicht auf dem Stand, auf dem sie heute sind. Kunstgeschichtlich hat sie sich nach meinem Geschmack immer viel zu sehr ans 19. Jahrhundert geklammert, an ihren Monet und Manet und ihren ach so geliebten Anders Zorn, als wäre alles wirklich Spannende nicht viel später passiert, aber die Moderne konnte ich zum Glück in der Bibliothek auf eigene Faust nacharbeiten, auch wenn ich da sicherlich noch etliche Lücken habe, was auf der Kunsthochschule hoffentlich nicht allzu sehr auffallen wird. Falls sie mich denn annehmen, was ja längst keine ausgemachte Sache ist. Wenn ich mir vorstelle, wie dort die ganzen perfekten Bewerbungen der Stockholmer Bohème-Jugend eintrudeln, die ihre Privatkunstlehrer haben und bedeutende Museen vor der Nase, in die sie jeden Tag hineinspazieren und die Großen im Original studieren können, wird mir ganz mau im Magen. Habe ich überhaupt eine echte Chance? Sicher, Fräulein Clarin hat mich unterstützt und immer wieder ermutigt, aber ehrlich gesagt, ist sie letzten Endes auch nur eine provinzielle Lehrerin an einem provinziellen Gymnasium, die eine provinzielle Schülerin – meine Wenigkeit – stark redet, da kann sie ihre »Pariser Jahre«, von denen ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher bin, ob es die überhaupt jemals gegeben hat, noch so sehr betonen. Nun, wir werden sehen. Was bleibt mir auch anderes übrig, als auf meine Fertigkeiten zu vertrauen, an mich zu glauben und das Beste zu hoffen?
Bis ich Bescheid erhalte, werden jedenfalls noch Wochen ins Land gehen. Ich denke, die meiste Zeit werde ich in der Glashütte verbringen, auch wenn Papa das nicht gern sieht, jedenfalls tut er immer so. Herbert hat mich vor langer Zeit schon auf eine Idee gebracht. Er macht manchmal in seinen Arbeitspausen diese Dinge aus Glas; Tiere, Pflanzen, alles Mögliche. Ich will nicht behaupten, dass es Kunst ist, auch wenn seine Figuren hübsch anzusehen sind, aber möglicherweise könnte man auf diese Weise Kunst fabrizieren. Glaskunst, sozusagen. Fräulein Clarin würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Papa würde den Kopf schütteln, und mein fleißiges Brüderlein würde mich wahrscheinlich entsetzt anstarren. Warum ist Petter nur immer so verbissen und ernst, der Kleine? Jedenfalls habe ich mir vorgenommen, mit dem Material zu experimentieren. Abstraktion in der Form, dazu viel Farbe. Kandinsky in Glas. Wie anmaßend das klingt, hi, hi. Papa wird sicherlich über die Kosten schimpfen, aber ich weiß natürlich, dass er es mir am Ende nicht abschlagen kann. Das kann er nie, der Süße. Und wer weiß, wohin es führt? Wenn sie in Stockholm in diesem Jahr meine Mappe ablehnen, weil sie die braven Stillleben und biederen Landschaftsaquarelle satt sind, versuche ich es halt erneut. Mit einer Kiste gegenstandsloser Glasgegenstände. Ein Widerspruch in sich, nicht wahr? So etwas haben sie selbst dort noch nicht gesehen, da bin ich mir sicher. Ha, vielleicht hat meine småländische Provinzialität am Ende doch etwas Gutes!
Und »gut« ist das richtige Stichwort. Das Beste, liebes Tagebuch, habe ich mir nämlich für den Schluss aufgespart. »Le meilleur vient à la fin«, wie Fräulein Clarin sagen würde, ja, ja, die Pariser Jahre. Gestern Abend hat er mich endlich geküsst! Nachdem er jahrelang dafür Anlauf genommen hatte, fürchte ich. Es war, nun ja, seltsam. Er gibt sich immer so steif. Ist das auf eine sympathisch britische Weise »gentlemanlike«, oder ist er im Grunde seines Herzens ein Spießer? Diese Anzüge, die er trägt, sind die verschroben oder einfach nur fürchterlich konservativ? Oder beides gleichzeitig? Politisch und kulturell wirkt er altbacken auf mich, aber er ist klug, denkt schnell und kann Dinge pointiert benennen. Ich mag diese Dialoge mit ihm, geistiges Pingpong, es fordert mich heraus. Nach dem Kuss war ich bereit weiterzugehen, aber das ging ihm offenbar zu schnell! Habe ich ihn damit verschreckt? Wohl kaum, er schmachtet mich seit Ewigkeiten an. Wie ein verliebter Hund, sagt Maja immer. Aber ich will ihm nicht vorschnell Unrecht tun. Warten wir ab, wie sich die Dinge entwickeln. Der Sommer ist lang, und mit Petters Moped sind es bis nach Rödahult nur gut fünfzehn Minuten, auch wenn mein Bruderherz es mir nie freiwillig leihen würde, eher würde er sich ein Bein abhacken, als das gute Stück auszuborgen. Wie gut, dass ich weiß, wo er den Schlüssel verwahrt. (In der Nachttischschublade neben den Unterwäschekatalogen, wie originell!!) Entwendete Mopeds, nächtliche Besuche, Leitern, die an Fenstern lehnen, Geflüster im Dunkeln, zwei konkurrierende Familien, doch, doch, die Vorstellung hat etwas. Romeo und Julia im Glasreich?
Sonntag
1
Ingrid Nyström sah in die Runde. Es war später Vormittag, die Sonne warf einen Lichtteppich durch das Panoramafenster des Besprechungszimmers. Ein nahezu perfekter Hochsommertag. Als hätte es das heftige Gewitter des Vortags nie gegeben. Um den großen, ovalen Tisch versammelt saßen Stina Forss, Hugo Delgado, die Pathologin Ann-Vivika Kimsel und Bo Örkenrud, der Chef der Spurensicherung. Da Wochenende war und noch völlig offen, in welche Richtung sich der Vorfall vom Vortag entwickeln würde, hatte Nyström auf die Anwesenheit der beiden anderen Teammitglieder, Lasse Knutsson und Anette Hultin, verzichtet – im Gegensatz zu Forss und Delgado hatten die beiden Kollegen ein Familienleben.
»Wer macht den Anfang?«, fragte sie.
»Mir ist bei der ersten Untersuchung einiges aufgefallen«, begann Kimsel. Nyströms gleichaltrige Freundin war wie immer elegant gekleidet, sie schien jedoch irgendetwas an ihrer Haarfarbe geändert zu haben, jedenfalls passte der ungewohnte violette Schimmer ihres gestuften Pagenschnitts perfekt zum Farbton ihrer Bluse. »Fest steht, dass es sich um ein menschliches Skelett handelt, der Anatomie zufolge um ein weibliches. Meiner vorläufigen Schätzung nach kann es durchaus dreißig, vierzig Jahre oder sogar noch älter sein. Es stammt von einer jungen Frau, anhand der Ausbildung der Beckenknochen und des Schambeins können wir davon ausgehen, dass die Pubertät zum Todeszeitpunkt abgeschlossen war, aber noch kein Kind zur Welt gebracht wurde. Ich würde auf ein Alter von zwanzig bis dreißig Jahren tippen. Zudem bin ich mir anhand der Färbung und Konsistenz der Knochen sicher, dass sie nicht von einer Wasserleiche stammen, zumindest nicht von einem Leichnam, der über einen längeren Zeitraum im Wasser war, wobei ich wohlgemerkt von Jahren oder Jahrzehnten spreche. Aber meine Untersuchungsmöglichkeiten hier sind begrenzt, Genaueres muss das kriminaltechnische Labor in Linköping feststellen.«
»Danke, Ann-Vivika«, sagte Nyström, »das sind durchweg Indizien, die zu Gustavssons Geschichte passen. Es könnte sich also tatsächlich um seine Berit handeln.«
»Dies hier«, sagte Örkenrud und hielt einen durchsichtigen Plastikbeutel hoch, »könnte uns endgültig Gewissheit verschaffen.«
»Ein Zahn?«, fragte Delgado.
»Ein Weisheitszahn«, lächelte Örkenrud, »ein richtiges Prachtexemplar, wunderbar erhalten. Der war in einer leeren Streichholzschachtel verwahrt. Auf einem klein gefalteten Zettelchen ist sogar ein passendes Gedicht notiert:
Der sogenannte Weisheitszahn,
Zwar als der letzte kommt er an,
Doch immer früh genug.
Der Name scheint mir Trug.
Der Weisheit kleine Portion,
Wozu es bringt der Erdensohn,
Sie wird mit Schmerzen erst geboren.«
»Reizend«, sagte Nyström.
»Nicht wahr? Dazu ist sogar festgehalten, wann er offenbar gezogen worden ist. Am 22. Dezember 1965.«
»Aua, ein Weihnachtsfest mit dicker Backe«, kommentierte Delgado.
»Und der gehörte mit Sicherheit Berit?«, fragte Nyström.
»Er war auf jeden Fall unter den Sachen, die der alte Gustavsson von ihr verwahrt hatte. Ein ganzer Raum voller Kisten und Schränke. Es wirkte wie eine Mischung aus Flohmarkt, Sechzigerjahre-Museum und Erinnerungsschrein, beinahe ein wenig unheimlich. Als hätte er sich emotional nie von ihr lösen können. Dabei war sie zum Zeitpunkt der Hochzeit noch nicht einmal offiziell bei ihm eingezogen. Nach ihrem Verschwinden hat er ihren gesamten Besitz zu sich schaffen lassen. Wenn Kinder sterben, dann konservieren Eltern deren Zimmer oft jahrzehntelang in dem ursprünglichen Zustand – daran hat mich dieser Raum erinnert. Nur, dass er sich eben nicht bei den Thurstans befand, sondern bei Gunnar Gustavsson. Kleidung, Schmuck, sogar eine Truhe mit Spielzeug war dort zu finden. Es hat Stunden gedauert, das alles zu sichten, dabei waren wir zu viert. Die Streichholzschachtel mit dem Zahn befand sich in einer Spieluhr. Ihr wisst schon, diese Dinger, in denen sich zu einer Melodie eine Ballerina dreht, wenn man sie öffnet. Die Handschrift, in der das Gedicht verfasst ist, passt zu der von Berits sonstigen Unterlagen. Alte Schulhefte, Aufsätze, banales Zeug. Es wirkte so, als habe Gustavsson tatsächlich alles aufgehoben, was seine junge Braut je besessen hat.«
»Bei ihrem mutmaßlichen Zahnarztbesuch war sie vierzehn Jahre alt«, rechnete Forss. »Wenn wir an ihre alten Patientenakten kommen, könnten wir anhand des Datums überprüfen, ob der Weisheitszahn wirklich von ihr stammt.«
»Ich kümmere mich darum«, sagte Delgado.
»Mit etwas Glück sind jedenfalls die Reste der Pulpa im Nervenkanal noch gut genug erhalten, um aussagekräftiges DNA-Material zu gewinnen«, fügte Örkenrud an. »Es gibt da eine Methode, die nennt sich Kaltvermahlung …«
»Weisheitszahn, da klingelt etwas«, unterbrach ihn Kimsel und blätterte in ihren Unterlagen. »In der Tat: Dem linken Unterkiefer des Totenschädels wurde der Dens serotinus entfernt. Das würde also zusammenpassen.«
»Das gesamte Material muss umgehend nach Linköping«, befand Nyström.
»Der Fleck auf dem Hochzeitskleid«, fügte Örkenrud an, »besteht übrigens wirklich aus Blut. Ob es allerdings noch verwertbare DNA-Frequenzen enthält, ist äußerst fraglich, da es über so viele Jahre allen möglichen Umwelteinflüssen ausgesetzt war. Aber einen Versuch ist es natürlich wert.«
»Auch wenn es ein paar Tage dauern kann, bis wir die Ergebnisse bekommen«, sagte Nyström, »reicht das, was wir haben, meiner Meinung nach aus, um eine belastbare Arbeitshypothese zu formulieren. Das Kleid, die Knochen, der Zahn, bisher scheint alles darauf hinzudeuten, dass Gunnar Gustavsson recht hat, und sich in dem Glassarg tatsächlich die sterblichen Überreste seiner Frau befinden.«
»Die von ihr signierten Entwurfsskizzen für das Hochzeitskleid haben wir auch sichergestellt. Sie war eine begabte Zeichnerin, soweit ich das beurteilen kann«, sagte Örkenrud.
»Eine Künstlerseele«, murmelte Nyström.
Örkenrud fuhr fort: »Das hier könnte unter Umständen auch hilfreich für uns sein.« Er legte eine Art Broschüre aus Büttenpapier auf den Tisch. »Dies ist das Festprogramm, das für die Hochzeit gedruckt wurde. Darin steht nicht nur der genaue Ablauf der Feier mit allen Liedern, Tänzen und Reden, sondern auch eine Auflistung aller Gäste samt Sitzordnung und biografischer Kurzangaben.«
Nyström nahm das Heftchen in die Hand. Auf dem Umschlag war ein Motiv des Malers Marc Chagall abgebildet.
»Solche Festprogramme für Hochzeiten waren eine Zeit lang außer Mode, aber sind seit einigen Jahren wieder im Kommen«, sagte sie.
»Das muss man sich mal vorstellen«, sagte Delgado kopfschüttelnd, »da verschwindet deine Braut spurlos während eines albernen Brauchs auf der Hochzeit, und fast fünfzig Jahre später taucht ihr Skelett in einer Ausstellung auf.«
»Womit wir uns der entscheidenden Frage nähern«, sagte Nyström. »Womit haben wir es hier zu tun? Einer Entführung? Einem Mord oder anderem Gewaltverbrechen?«