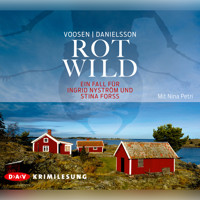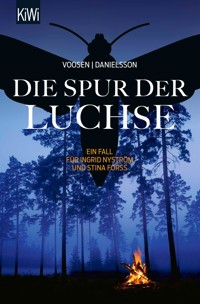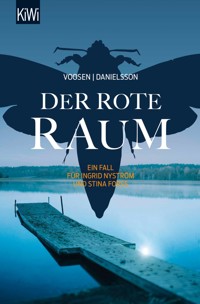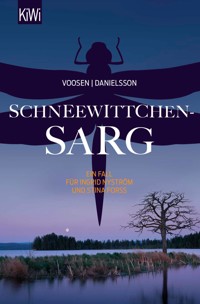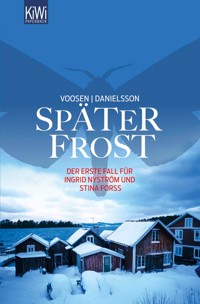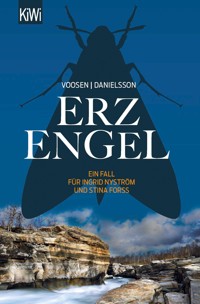
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
Ein vergessen geglaubter Fall und ein entsetzliches Verbrechen - »Erzengel«, der sechste Band der SPIEGEL-Bestsellerautoren Voosen/Danielsson, dreht sich um Glaube, Obsession und Okkultismus. Die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss stolpern über Ungereimtheiten in einem alten Fall, dem Suizid eines jungen Manns. Der vermeintliche Selbstmörder war zu Beginn der 90er-Jahre der Hauptverdächtige eines der grausamsten Verbrechen Schwedens, bei dem sechs junge Menschen, Mitglieder einer Heavy Metal-Band, ums Leben kamen. Die komplexe Ermittlung führt die beiden ungleichen Frauen in die Tiefen einer düsteren Subkultur, an die Grenze zwischen Glauben und fanatischer Religiosität, vom verschneiten Småland an die zerklüftete Westküste bis in die dunklen Schächte der Eisenerzmine im nordschwedischen Kiruna. Als rund um Växjö mittelalterliche Kirchen in Flammen stehen und ein Kollege schwer verletzt wird, müssen Nyström und Forss schmerzhaft einsehen, dass dieser Fall noch längst nicht gelöst, sondern brandaktuell und lebensgefährlich ist. »Ein Muss für Liebhaber skandinavischer Krimis.« Donaukurier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Erzengel
Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen, Växjö und Göteborg. Kerstin Signe Danielsson, Jahrgang 1983, geboren und aufgewachsen in Växjö, studierte und arbeitete in Deutschland und Schweden. Sie leben und schreiben gemeinsam im schwedischen Småland. Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch »Später Frost« (KiWi 1290), »Rotwild« (KiWi 1338), »Aus eisiger Tiefe« (1404), »In stürmischer Nacht« (1489), »Der unerbittliche Gegner« (KiWi 1515)
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss stolpern über die Ungereimtheiten in einem alten Fall, dem Suizid eines jungen Manns. Der vermeintliche Selbstmörder war zu Beginn der Neunzigerjahre der Hauptverdächtige eines der grausamsten Verbrechen Schwedens, bei dem sechs junge Menschen, Mitglieder einer Band, ums Leben kamen. Die komplexe Ermittlung führt die beiden ungleichen Frauen in die Tiefen einer düsteren Subkultur, an die Grenze zwischen Glauben und fanatischer Religiosität, vom verschneiten Småland an die zerklüftete Westküste bis in die dunklen Schächte der Eisenerzmine im nordschwedischen Kiruna. Erst als rund um Växjö mittelalterliche Kirchen in Flammen stehen und ein Kollege schwer verletzt wird, müssen Nyström und Forss schmerzhaft einsehen, dass dieser Fall noch längst nicht gelöst, sondern brandaktuell und lebensgefährlich ist.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Schweden, heute
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Montag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Einschub
Dienstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Einschub
Mittwoch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Einschub
Donnerstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Einschub
Freitag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Einschub
Samstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Einschub
Sonntag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Einschub
Montag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Einschub
Dienstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Einschub
Mittwoch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Einschub
Donnerstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Fünfeinhalb Wochen später, Samstag
Epilog
Leseprobe »Tode, die wir sterben«
Für Fabian
»Ibsen, Grieg, Munch und MAYHEM«
Jørn »Necrobutcher« Stubberud
»Cannot the kingdom of salvation take me home?«
Metallica, »To Live is to Die«
Prolog
Es war ein kalter, klarer Novembernachmittag. Der Mann registrierte mit Genugtuung, dass alles demselben Muster folgte wie an den Tagen zuvor. Derselbe Rhythmus, dieselben Routinen. Er saß in seinem Wagen und beobachtete aus sicherer Entfernung, wie der altersschwache Transporter auf den Parkplatz hinter dem Schulzentrum rollte und zum Stehen kam. Die Türen des auf dilettantische Weise mattschwarz lackierten Wagens öffneten sich und heraus stolperte eine Handvoll Jugendlicher: schulterlanges Haar, Jeansjacken, in den Händen Gitarrenkoffer, Zigaretten und Dosenbier. Sie nannten sich FLAMETHROWER, wie der Schriftzug auf dem Transporter verriet, Flammenwerfer, aber natürlich wusste dies der Mann längst, er war vorbereitet, er folgte der Band, seit sie vor fünf Tagen zu einer kurzen Tournee aufgebrochen war.
Eslöv, Nässjö, Ulricehamn, Sölvesborg und an diesem Tag Hallsberg.
Allesamt Kleinstädte, die Auftrittsorte waren Jugendzentren, Schulaulen und Turnhallen. Der Mann unterdrückte ein Gähnen. Die Musiker begannen damit, ihr Equipment in den hell erleuchteten Zweckbau zu schleppen. Gegen 19 Uhr tauchten 20 bis 30 junge Leute vor der Schule auf. Wie an den anderen Abenden auch war das Publikum äußerlich kaum von den Musikern zu unterscheiden. Teenager, überwiegend Jungen, 14 bis 18 Jahre alt. Der Mann stellte seinen Feldstecher scharf. Im gelben Licht der Außenbeleuchtung war ziemlich oft das Wort DEATH auf den Aufnähern der Jeansjacken zu lesen, Tod.
Um halb acht öffneten sich die Türen und die Konzertbesucher drängelten zum Eingang. Der Mann schaute auf seine Uhr. Anderthalb Stunden etwa, dann würde der Spuk vorbei sein. Er schaltete die Standheizung seines Wagens eine Stufe höher, lehnte sich in den Fahrersitz zurück, schenkte sich aus einer Thermoskanne Kaffee ein und aß ein Butterbrot. Er war vorbereitet, der Abend konnte lang werden.
Um kurz vor zehn verließen die letzten zerzausten Gestalten das Gebäude. Der Hausmeister schloss die Türen ab, vertrieb einige Nachzügler vom Schulhof und stellte die Außenbeleuchtung ab, dann stieg er in einen senfgelben Golf und fuhr davon. Nur in dem Transporter auf dem Parkplatz, in dem die Band übernachtete, brannte noch Licht. Auch dieses Ritual gehörte zum allabendlichen Ablauf: eine kreisende Wodkaflasche, viele Zigaretten, ein scheppernder Kassettenrekorder. Der Mann war jetzt konzentriert. Gespannt wartete er darauf, ob einer der Insassen wie an den Abenden zuvor eines der Fenster öffnete, weil die Luft in dem Wagen selbst für feierwütige Jugendliche zu verraucht geworden war. Für seinen Plan war dieses Detail nicht entscheidend, aber es würde den Ablauf leichter machen, eleganter. Und tatsächlich: Um Punkt 0.22 Uhr wurde eine der Scheiben eine Handbreit heruntergelassen. Der austretende Zigarettenqualm waberte in langen Schwaden durch die kalte Herbstluft, am Himmel stand ein bläulicher Dreiviertelmond, ein fast poetischer Moment, dachte der Mann. Auch er kurbelte das Fenster der Fahrertür ein Stück weit herunter und lauschte in die Nacht. Nach einer Weile ging die Schiebetür des provisorischen Bandbusses auf, drei der Langhaarigen sprangen heraus und pinkelten an den nächsten Baum. Jemand rülpste lautstark, es folgte ein mehrstimmiges Lachen, bevor das Trio wieder einstieg. Um kurz nach eins öffnete sich die Wagentür erneut, zwei Mädchen stiegen aus dem Transporter und verschwanden kichernd und einander untergehakt in der Nacht. Nicht lange darauf verstummte die Musik und das Licht erlosch. Geduldig wartete der Mann eine weitere Stunde. Doch in dem Wagen schien sich nichts mehr zu rühren. Vollrausch und Tiefschlaf, dachte er zufrieden und stieg bedächtig aus dem Auto. Seine weichen Sohlen machten auf dem asphaltierten Untergrund so gut wie keine Geräusche. Als er den Transporter erreichte, betrachtete er für einen Augenblick den Gegenstand in seiner Hand, der metallisch im Mondlicht schimmerte.
Wie die eiserne Miniatur einer Ananas.
Er zog den Sicherheitsstift und ließ das kleine, schwere Ding durch das offene Autofenster fallen.
Dann rannte er, so schnell er konnte, davon.
Schweden, heute
1
Hauptkommissarin Ingrid Nyström war von Anfang an dagegen gewesen. Es gab wenig, das ihr so viel Unbehagen bereitete, wie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Und dann auch noch einen ganzen Abend lang! Aber was hätte sie schon für Einwände anführen können? Jeder Protest wäre in dem lautstark orchestrierten Trubel untergegangen, den ihre drei erwachsenen Töchter seit Wochen veranstalteten, und Anders, ihr meistens sehr wunderbarer Ehemann, war in diesem Fall auch keine Hilfe gewesen, im Gegenteil, er schien in vielerlei Hinsicht sogar der eigentliche, wenn auch mehr oder weniger heimliche Dirigent dieses ihrer Meinung nach völlig überdimensionierten Werks zu sein. Die ganz große Oper statt eines romantischen Nachtlieds in pianissimo, was ihr zweifelsohne mehr behagt hätte. Doch nun stand sie hier, in einem zu tief ausgeschnittenen Kleid, das an den Hüften spannte – wie hatte sie ernsthaft den Ratschlägen der viel zu jungen Verkäuferin in der Boutique folgen können? –, blickte in siebenundfünfzig erwartungsvolle Gesichter und versuchte, sich ein Lächeln abzuringen, während die Band hinter ihr das obligatorische Hoch soll sie leben ausklingen ließ. Siebenundfünfzig geladene Gäste, die vielen umhertollenden Kinder nicht mitgerechnet, einen Gast für jedes ihrer Lebensjahre. Wie originell, dachte sie, wie sinnbildlich, besser hätte man mein biblisches Alter kaum visualisieren können. Vielen Dank auch! Eigentlich hätte dieses große Fest bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen, fünfundfünfzig war wenigstens eine Schnapszahl, etwas, auf das man im großen Stil anstoßen konnte, aber damals hatte sie gerade eine Krebserkrankung überstanden, und eine rauschende Party war das Letzte gewesen, auf das sie Lust verspürt hatte.
»Eine Rede!«, rief jemand von einem der hinteren Tische. Nyström meinte, ihren Großcousin Bertil auszumachen, aber sicher war sie sich nicht. Vielleicht brauchte sie wirklich bald eine Brille. Und in fünf Jahren dann wahrscheinlich ein neues Hüftgelenk. Und von da aus war es ja wohl kaum mehr weit bis ins Grab.
»Eine Rede, eine Rede!«, forderte nun die gesamte Menge.
Der Bandleader drückte ihr mit einem süffisanten Lächeln das Mikrofon in die Hand.
Es wurde still im Saal des Lokals, sogar die vielen Kinder hielten für einen Moment in ihrem Toben inne. Nyström stand der Schweiß auf der Stirn. Sie versuchte das unangenehme Kribbeln unter der Haut zu kontrollieren, indem sie sich wahllos auf die merkwürdige Tischdekoration konzentrierte, die schon seit Beginn des Abends unterschwellig ihre Aggression fütterte: Arrangements aus Kastanienmännchen, Rosen und neongelbem Tüll.
»Wie wunderbar, dass wir heute an diesem unglaublich schönen Ort versammelt sind!«, hob sie an.
2
Kommissarin Stina Forss steuerte ihren mehr als dreißig Jahre alten BMW durch den Schneeregen. Die Seitenfenster waren beschlagen, irgendetwas stimmte mit der Lüftung nicht, auch einer der Scheibenwischer arbeitete nicht mehr einwandfrei und zog Schlieren über die Windschutzscheibe. Die Sicht auf den Verkehr war daher alles andere als gut und der Umstand, dass sie vor etwas mehr als einem Jahr ihr linkes Auge verloren hatte, machte die Situation nicht besser. Das andere, das heile Auge war von der viereinhalbstündigen Autofahrt unter schlechten Sichtbedingungen überanstrengt, sie merkte, dass sie Kopfschmerzen bekam. Das Navigationsgerät leitete sie durch endlos erscheinende Stockholmer Vororte. Was für eine Reihenhaushölle das hier ist, dachte sie und musterte misstrauisch die winzigen Vorgärten, in denen Kindertrampoline oder auf Anhänger gebockte und mit Persenningen geschützte Segelboote unter ihren Schneehauben sichtbare Versprechen von Familienleben und Sommerurlauben darstellten. Das Glück im Kleinen, dachte sie, na dann, und gab Gas. Eine Viertelstunde später hatte sie endlich ihr Ziel erreicht.
Der erste Grund, warum sie hier war.
Sie parkte den Wagen, überprüfte im Spiegel den Lippenstift, rückte die Augenklappe zurecht, stieg aus und öffnete den Kofferraum. Zu ihrem Verdruss stellte sie fest, dass sie keinen Regenschirm dabeihatte. Dann musste es eben ohne gehen. Entschlossen klappte sie den Mantelkragen hoch und schob die Hände tief in die Taschen. Der Wind, der aus Richtung der nahen Schärenküste wehte, trieb ihr das eisige Nass nahezu waagerecht entgegen und ließ die Kiefern, die den Kiesweg säumten, in einem eigenwilligen Takt wiegen. Ihre Stämme hatten die Farbe von Bronze.
Der weitläufige Friedhof war menschenleer, außer ihr schien niemand dem unwirtlichen Wetter zu trotzen. Sie brauchte eine Weile, um sich zu orientieren. Die Position des Grabs hatte sie auf einem Notizzettel skizziert, es lag am nordöstlichen Rand des Friedhofs. Sie spürte, wie ihr Gang mit jedem Schritt unsicherer wurde. Das hatte nichts mit dem böigen Wind zu tun. Sie wusste, dass sie längst hätte hierherkommen sollen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch wie hätte das gehen sollen? Wie trauerte man um einen Mann, der sein eigenes Leben gegeben hatte, um ihres zu retten? Und das von über sechstausend anderen Menschen noch dazu? Wie trauerte man um einen Helden? Um jemanden, den man viel zu wenig gekannt hatte, um ihn zu lieben, aber dennoch oft so schmerzlich vermisste, dass es einem die Luft zum Atmen nahm?
Sie kannte auf diese Fragen keine Antwort, sie wusste noch nicht einmal, wie sie die kommenden fünfzehn Minuten überstehen sollte. Als sie endlich das Grab erreicht hatte, vor der schmucklosen Betoneinfassung stand und die schlichte Steintafel mit seinem Namen betrachtete, fand sie in sich keine Tränen. Dass ihre Wangen feucht waren, hatte sie ausschließlich dem Regen zu verdanken. Sie stand dort eine Zeit lang, fröstelnd und ratlos dem Wind lauschend.
»Danke«, flüsterte sie schließlich heiser. »Danke, Kent Vargen.«
3
Zwei Stunden und zweieinhalb Gläser Weißwein später war Ingrid Nyström um einiges milder gestimmt. Das viergängige Menü war wirklich hervorragend gewesen und die meisten Gäste waren so taktvoll und hinterlegten ihre Präsente dezent auf einem Gabentisch und ersparten ihr so einen öffentlichen Auspackmarathon voller übertriebener Ahs und Ohs. Man hatte mittlerweile die Tische mitsamt der grotesken Dekoration beiseitegestellt und der Band gelang es tatsächlich, das Gros der Gäste zum Tanzen zu animieren. Nach drei Runden Bug war Nyström verschwitzt, aber deutlich entspannter. Zum Takt des Gassenhauers Guld och gröna skogar wiegte sie Albert, den vier Monate alten Sohn ihrer jüngsten Tochter Anna, im Arm. Anschließend drehte sie eine Runde durch den Saal, um sich bei allen Anwesenden noch einmal persönlich für ihr Kommen zu bedanken. Diejenigen, die nicht tanzten, hatten sich zu kleinen Gruppen zusammengefunden, plauderten, lachten und stießen miteinander an.
»Tolle Party!«, lobte ihr langjähriger Mitarbeiter Lars »Lasse« Knutsson und klopfte ihr mit einer seiner Pranken auf die Schulter. »Das Essen war fantastisch!«
Neben dem bärtigen, bärenhaften Kollegen saßen in der kleinen Runde der Kriminalpolizei Kronoberg noch Hugo Delgado, der Computerexperte der Abteilung, und Anette Hultin, die sich seit über einem Jahr in Elternzeit befand. Aus Nyströms Team fehlte nur Stina Forss – aus irgendeinem nichtigen, wahrscheinlich vorgeschobenen Grund, was allerdings keine große Überraschung darstellte. Forss hatte mit menschlichem Miteinander so ihre Probleme, und nachdem sie vor einem Jahr während eines Einsatzes schwer verletzt worden war, war sie nicht gerade umgänglicher geworden. Im Gegenteil. Stattdessen hatte sich Nyströms Freundin Ann-Vivika Kimsel, eine alleinstehende, attraktive Frau ihres Alters, zu den Kollegen gestellt. Als Rechtsmedizinerin des Bezirks Kronoberg hatte Kimsel häufig mit Nyströms Team zu tun. Man kannte und schätzte sich.
»Schön, dass ihr gekommen seid«, sagte Nyström. »Ich hoffe, ihr langweilt euch nicht zu Tode.«
»Quatsch!«, protestierte Knutsson.
»Eine klasse Band!«, lobte Hultin.
»Und erst die Tischdekoration!«, scherzte Delgado.
Nyström verdrehte demonstrativ die Augen.
»Anders hat ein Händchen für vieles«, sagte sie. »Aber Blumengestecke?«
Die Runde lachte. Nach einigen Minuten Smalltalk nahm Kimsel Nyström zur Seite.
»Es gibt da etwas, über das wir beide uns dringend unterhalten müssten.«
»Das klingt ja vielversprechend.«
»Die Sache ist etwas … pikant.«
»Sollte ich rot werden?
»Nein, das Ganze ist eher beruflicher Natur.«
»Puh. Jetzt und hier?«
»Um Gottes willen! Ich dachte an Montagmorgen.«
»Dein Büro ist weitaus gemütlicher als meins. Sagen wir um acht?«
»Ich werde einen Tee aufsetzen. Darf ich deinen Anders nun auf einen Tanz entführen?«
»Unbedingt!«
4
Stina Forss fuhr vom Friedhof aus zu dem Motel, das sie im Vorhinein gebucht hatte, ein gesichtsloser, dreigeschossiger Bau, der eingeklemmt zwischen zwei Autobahnausfahrten lag. Auf dem Zimmer duschte sie heiß und zog sich anschließend trockene Sachen an. Nachdem sie sich die Haare geföhnt hatte, setzte sie sich auf das Bett und nahm ein altmodisches Brillenetui aus ihrer Kulturtasche, das sie vorsichtig aufklappte. Darin lagen gebettet auf einem gefalteten Stofftaschentuch zwei Gegenstände: ein großer Schlüssel mit einem komplizierten Bart sowie ein prachtvoller militärischer Orden. Es war ihr zum täglichen Ritual geworden, diese beiden Dinge anzuschauen, in die Hand zu nehmen, an sich zu drücken. Auch wenn sie nicht einmal annäherungsweise ihre Bedeutung verstand, versuchte Forss sie wortwörtlich zu begreifen. Denn es war ein Rätsel: Kent Vargen hatte ihr die beiden Gegenstände in die Manteltasche gesteckt, Sekunden bevor er sie und ein Fußballstadion voller Menschen vor dem Tod bewahrt hatte. Stattdessen hatte er sich selbst geopfert. Das Bombenattentat einer rechtsextremen Terroristenzelle auf ein Fußballspiel zweier Einwanderermannschaften in Södertälje hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. Neben Kent Vargen, dem es gelungen war, den mit einem Zeitzünder versehenen Sprengstoff im letzten Moment aus dem Stadion zu schaffen und damit die Auswirkung der Explosion drastisch einzudämmen, waren fünf Terroristen und siebzehn Unbeteiligte zu Tode gekommen, fast hundertfünfzig Menschen waren schwer verletzt worden, darunter Stina Forss. Das Justizministerium hatte eine Untersuchungskommission eingesetzt, es hatte Verhaftungen gegeben und die umfangreichen Ermittlungen der Polizei und des Staatsschutzes dauerten bis heute an. Forss, die den Terroristen auf die Spur gekommen war und die Attentatspläne aufgedeckt hatte, war von der Landespolizeiführung persönlich belobigt worden. Das Angebot, eine leitende Ermittlerstelle in Stockholm anzunehmen, hatte sie jedoch abgelehnt, ohne lange darüber nachzudenken. In den ersten Monaten nach dem Koma und den Operationen, bei denen ein Metallsplitter aus ihrem Kopf entfernt und vergeblich versucht worden war, ihr linkes Auge zu retten, hatte sie viel über ihre Situation nachgedacht. Es war einige Jahre her, seit sie aus Berlin nach Schweden, in das Land ihrer Kindheit, zurückgekehrt war. Sie hatte damals ihr deutsches Leben einschließlich einer Karriere bei der Mordkommission des Landeskriminalamts hinter sich zurückgelassen, weil ihr todkranker Vater sie hier gebraucht hatte; zumindest hatte sie sich das eingeredet, ungeachtet der Tatsache, dass ihre Beziehung kaum existent war, seit er sie und ihre Mutter in ihrer Jugend schwer misshandelt hatte. Wunden, die nie verheilt, Dinge, die nie zur Sprache gekommen waren. Der zweite, ehrlichere Grund war daher, dass sie sich endlich eine offene Aussprache erhofft hatte. Ein Gespräch, das ihr Antworten auf die Frage geben konnte, warum ihr eigenes Leben so verkorkst war, warum eine gescheiterte Liebesbeziehung auf die nächste gefolgt war, warum sie gegenüber ihren Lebensabschnittspartnern so jähzornig gewesen war, so unkontrolliert und gewalttätig. Nun war Kjell Forss seit mehr als zwei Jahren tot, das klärende Gespräch hatte es nie gegeben, doch sie war immer noch hier. Es fiel ihr selbst schwer zu verstehen, warum. Sie war in Växjö gestrandet, in der småländischen Provinz, bewohnte das ehemalige Ferienhaus ihres Vaters, das weit außerhalb der Kreisstadt im Nirgendwo lag, hatte, ausgenommen von ihren Kollegen und vielleicht noch der Familie ihrer Cousine, keine nennenswerten zwischenmenschlichen Kontakte, keine Freunde, keine Wurzeln.
Andererseits: Was zog sie zurück nach Berlin? Dort war das Leben auch ohne sie weitergegangen. Ihre ehemalige Stelle war längst wieder besetzt worden, ihr Exfreund Sebastian hatte vor Kurzem geheiratet, und nach dem, was man so hörte, waren die Wohnungspreise und Mieten in den vergangenen Jahren explodiert. Was sollte sie in Stockholm, leitende Position hin oder her? Oder gar im Sauerland, wo ihre Mutter lebte? Forss war keine Träumerin. Ein Leben, das man führte, gleich wie blass und eindimensional es von außen betrachtet wirken mochte, war immer noch besser als eins, das man herbeifantasierte. Vielleicht bin ich für Utopien auch einfach zu kaputt, dachte sie oft in letzter Zeit. Immerhin hatte sie ihren Job bei der Kripo Kronoberg. Auch wenn ihr Leben ansonsten ein Trümmerfeld sein mochte, war sie wenigstens eine gute Polizistin. Für diese Gewissheit brauchte sie nicht das Lob des Landespolizeichefs.
Forss nahm den Orden aus dem Etui. Er war kühl und schwer, ein goldenes Andreaskreuz besonderer Machart. Seine vier gezackten Enden liefen auf einen Kreis zu, der mit drei Kronen geschmückt war. Längs durch die Mitte führte ein Schwert, dessen Spitze eine große, filigran gearbeitete Krone zierte. Die Krone wiederum war an der Spitze mit einer feingliedrigen Öse an einem geklöppelten gelben Ordensband befestigt, auf das blaue Streifen und ein weiteres goldenes Schwert gestickt waren. Auf der Rückseite waren die Worte PRO PATRIA, für das Vaterland, eingeprägt, sowie das Emblem des Königshauses. Natürlich hatte sie recherchiert, was es mit diesem Orden auf sich hatte, und war nach langem Suchen schließlich in der Stadtbibliothek in einem Heraldikführer fündig geworden. Das, was sie gerade in der Hand hielt, war das Kriegskreuz ersten Grades in Gold des Königlichen Schwertordens, dem Fachbuch zufolge die bedeutendste Tapferkeitsauszeichnung, die es in Schweden gab. Merkwürdigerweise stand dort ebenfalls, dass dieser Orden noch nie verliehen worden war. Wie auch, wenn die in den Fünfzigerjahren gestiftete Auszeichnung ausschließlich zu Kriegszeiten vergeben wurde und sich das Land seit mehr als zweihundert Jahren nicht mehr im Krieg befunden hatte?
Das führte unweigerlich zu der Frage, wie eine derart exklusive Medaille in Kent Vargens Besitz gekommen war. Und warum hatte er, seinen unmittelbaren Tod vor Augen, den Orden an sie weitergereicht? Welche Bedeutung hatte der Schlüssel? Gab es womöglich einen Zusammenhang zwischen den beiden Gegenständen? Was wollte ihr Kent mit seiner letzten Geste sagen? Barg sein Erbe, wie sie die beiden Dinge nannte, eine Aufforderung? Einen Auftrag?
Die Fragen trieben sie seit den Tagen um, die sie nach dem Unglück im Krankenhaus verbracht hatte; und dafür, dass die wenigen positiven Aspekte ihres Selbstbilds im Grunde einzig und allein auf dem Umstand fußten, eine gute Ermittlerin zu sein, hatte sie im vergangenen Jahr bemerkenswert wenige Antworten gefunden, wie sie nicht ohne Bitterkeit immer wieder feststellte.
Eine Tapferkeitsmedaille, die nie vergeben worden war.
Ein Schlüssel, der sich nicht zuordnen ließ.
Beides unter den denkbar dramatischsten Umständen überreicht von ihrem … Geliebten – ihr fiel kein passenderes Wort ein –, einem Mann, den es eigentlich gar nicht gab. Sie wiederholte die Worte, sprach sie laut vor sich hin, wie um sich dadurch ihrer Wahrhaftigkeit zu versichern:
Einem Mann, den es eigentlich gar nicht gab.
Denn das war die größte und beunruhigendste Entdeckung ihrer monatelangen, heimlichen Recherche gewesen: Kent Vargen war ein Phantom. Der Mann, mit dem sie das Bett geteilt, der Kollege, der ein halbes Jahr lang ihre Abteilung verstärkt, mit dem sie täglich zusammengearbeitet hatte, schien außerhalb dieser sechsmonatigen Zeitblase nicht zu existieren. Sie fand ihn in keinem Archiv und in keinem Register. Seine Personalnummer war keiner Steuerakte zuzuordnen. Es gab keine Angehörigen und offenbar keine Freunde. Zu seiner Beerdigung, die stattgefunden hatte, während Forss noch mit einem Metallsplitter im Kopf im Koma gelegen hatte, war außer ihrer Chefin Ingrid Nyström niemand erschienen. Die Personalverwaltung in Stockholm, die Kent der Kripo in Kronoberg zugeteilt hatte, ließ ihre Anfragen unbeantwortet, angeblich fehlte der zuständige Sachbearbeiter seit Monaten krankheitsbedingt. Sicher, sie hätte ihre Chefin in die Sache einweihen und auf offiziellen Wegen mehr Druck machen können. Sie hätte sich an den Växjöer Polizeichef Edman oder gleich direkt an die Landespolizeiführung wenden können, nun, wo sie eine belobigte Toppolizistin war, der sogar der Innenminister persönlich die Hand geschüttelt hatte. Doch das Letzte, was sie wollte, war, in der Sache Staub aufzuwirbeln und unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Nicht, bevor sie wenigstens ansatzweise ahnte, was es mit Kents Nichtexistenz auf sich hatte. Das Einzige, was sie fand, waren dürftige Spuren im Internet, ein Facebook- und ein Twitteraccount, beide genau eine Woche vor dem Zeitpunkt erstellt, an dem Kent in Växjö aufgetaucht war, offenbar aus dem Nirgendwo.
Wer warst du, Kent?
Wer warst du wirklich?
Mehr als auffällig war ebenfalls, dass Kent Vargen in der Berichterstattung über das Attentat im Gegensatz zu ihr selbst überhaupt nicht auftauchte. Immer wieder war überall dasselbe fürchterliche Archivbild von ihr abgedruckt worden, sie hatte Interview- und Talkshowanfragen abwimmeln müssen, ein Verlag hatte ihr gar einen Buchvertrag angeboten. Sie war die Heldin der Stunde gewesen, das Gesicht der halbwegs vereitelten Stadiontragödie. Angesichts des Umstands, dass sie zwar den Sprengstoff entdeckt, es aber Kent gewesen war, der die Zeitbombe aus dem Stadion geschafft hatte, während sie hilflos und gefesselt am Boden gelegen hatte, waren die Zeitungsberichte schwammig. Kents Rolle blieb in der medialen Darstellung die eines Geists.
Als sie nach Wochen endlich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war seine Wohnung bereits leer geräumt worden. Wenige Tage nach seiner Beerdigung. Wer das getan oder veranlasst hatte, war vollkommen unklar. Nyström wusste von nichts. Forss’ Befragung der Nachbarn blieb bis auf die zeitliche Eingrenzung ergebnislos. Stockholm blieb stumm.
Weitergeholfen hatte ihr schließlich ein Zufallstreffer. Vor gut einem Monat war sie in der Lokalzeitung auf einen Artikel über eine Langzeitverkehrsstudie in Växjö gestoßen. Über ein Jahr hinweg war die Verkehrsdichte und Abgasbelastung an den viel befahrenen Ausfallstraßen der Stadt aufgezeichnet, gemessen und ausgewertet worden. Unter dem Vorwand, in einem wichtigen Fall von Drogenkriminalität zu ermitteln, wandte sie sich an die Forschungsgruppe der Universität, die die Studie im Auftrag der Kommune erstellt hatte. Tatsächlich war das aufgezeichnete Videomaterial noch immer gespeichert. Vollumfänglich, wie der freundliche, ältere Verkehrswissenschaftler mit Bauchansatz lächelnd betonte. Der unerwartete Damenbesuch in seinem engen Büro schien ihn überaus zu erfreuen. Geduldig setzte er sich zusammen mit ihr vor den Monitor seines Rechners, sichtete stundenlang das Material im Schnelldurchlauf und servierte dazu Unmengen kaum genießbaren Kaffees. Kent Vargen hatte auf Teleborg gewohnt, unweit der südlichen Hauptverkehrsstraße, an der eine von insgesamt fünf Kameras installiert gewesen war. Forss hatte unverschämtes Glück. Auf der Plane des Lkw, der direkt vor der roten Ampel in der Videoaufnahme zum Stehen kam, stand in großen Lettern Umzug, Entrümpelung, Einlagerung. Das Nummernschild war zu entziffern. Das Unternehmen war in Stockholm ansässig, wie ihre spätere Nachforschung ergeben hatte.
Das war der zweite Grund, warum sie an diesem regnerischen Samstagabend in der Hauptstadt war. Sie legte den Orden vorsichtig zurück in das Etui neben den Schlüssel, stand auf, zog sich den noch immer feuchten Mantel über und machte sich auf den Weg.
Die Lagerhalle des Self-Storage-Unternehmens lag eine Dreiviertelstunde Autofahrt entfernt in einem der südlichen Industriegebiete. Hinter dem Empfangstresen saß ein gelangweilt aussehender junger Mann und wischte auf einem Smartphone herum. Forss wedelte mit ihrem Dienstausweis und erklärte ihr Anliegen. Der Angestellte tippte etwas in den Computer, der vor ihm stand.
»Kent Vargen haben wir hier nicht. Überhaupt keinen Vargen.«
Damit hatte Forss durchaus gerechnet.
»Kannst du gezielt nach einem Datum suchen? Es geht um eine Lieferung aus Växjö.«
Der Mann nickte und tippte entsprechend ihren Anweisungen.
»Oh«, sagte er dann und zog eine Grimasse.
»Was, oh?«
»Es gab tatsächlich etwas, was an dem Tag aus Växjö gekommen ist.«
Sie spürte ihr Herz pochen.
»Gab?«
»Tja, es sieht so aus, als ob du zwei Wochen zu spät kommst.«
»Hat die Lieferung bereits jemand abgeholt?«
Wieder eine Grimasse, diesmal eine andere.
»Nicht direkt.«
»Was soll das heißen?«
Dem jungen Mann war nun offensichtlich unwohl zumute. Er wand sich auf seinem Schreibtischstuhl, kaute auf seiner Unterlippe herum. Forss spürte, dass er ein wenig moralische Unterstützung brauchte.
»Ich arbeite an einer landesweiten Morduntersuchung«, sagte sie. »Weißt du, welches Strafmaß für die Behinderung einer so wichtigen Ermittlung vorgesehen ist?«
Mit aufgerissenen Augen schüttelte er langsam den Kopf.
»Das glaube ich nämlich auch nicht«, sagte Forss und lächelte schmal.
Der junge Mann zögerte noch einen Augenblick, dann drehte er sich demonstrativ nach links und rechts um, als seien irgendwo versteckte Kameras montiert. Es hatte etwas Slapstickhaftes.
»Eigentlich dürfen wir gar nicht darüber sprechen«, begann er. »Aber, nun ja, wenn es um eine landesweite Mord-ermittlung geht.«
Forss nickte und setzte ihr ernstes Gesicht auf. Vielleicht schüchtert ihn auch die Augenklappe ein wenig ein, dachte sie zufrieden.
»Gegen einen gewissen Aufpreis bieten wir unter der Hand die Entsorgungsvariante K an.«
»K?«
»K steht für Krematorium.«
»Das heißt konkret?«
Wieder sah der Junge nach links und nach rechts, bevor er antwortete.
»Na, wir verbrennen den Scheiß! Nur dass wir hier gar kein Krematorium haben, natürlich auch keine Müllverbrennungsanlage, das wäre alles viel zu teuer.«
»Also?«
»Wir fackeln das Zeug in einem Container hinter der Halle ab. Ein bisschen Benzin darauf und los.«
Forss schluckte.
»Und diese Variante K, wann hat es die zuletzt gegeben?«
Der Junge griff unter den Tresen, zog einen Kalender heraus und begann, darin zu blättern.
»Das muss vor vierzehn Tagen gewesen sein. Lagernummer 34.788, die Fuhre aus Växjö.«
»Wo genau steht dieser Container?«
»Ich zeige es dir.«
Er kam hinter dem Tresen hervor und Forss folgte ihm durch ein Labyrinth aus Gängen und Türen. Sie passierten eine Unzahl an heruntergelassenen Rollgittern. Das Unternehmen warb damit, über 15.000 Quadratmeter Stellflächen zu haben. Durch eine Metalltür traten sie schließlich nach draußen. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war weiterhin feucht und kalt und Forss nahm das Aroma des nahen Meeres wahr. Vor einem etwa zwei mal sechs Meter großen, offenen Metallcontainer blieb der junge Mann stehen.
»Unser sogenanntes Krematorium.«
Forss knipste ihre Mini-Maglite an und erklomm die Sprossen der in die Containerwand eingelassenen Leiter. Sie leuchtete in das verrußte Innere. Asche, Schlacke, schwarz verfärbte Metallreste. Forss kletterte über den Rand. Auf ihren hellen Mantel konnte sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Es roch penetrant nach Lagerfeuer. Ab und an bückte sie sich. Drähte, ein rostiges Scharnier, ein Kleiderbügel. Das Gehäuse einer Fotokamera. Glassplitter. Der Schirm einer Schreibtischlampe. Die Aluminiumschale eines Laptops. Dann trat sie unvermittelt auf etwas Hartes. Mit dem Stiefel schob sie Asche beiseite, dann ging sie in die Knie und hob den Gegenstand auf. Eine kompakte Metallkassette, von der Hitze bläulich angelaufen. Sie schüttelte sie, innen klapperte etwas. Sie hatte keine Ahnung, ob der Kasten jemals Kent gehört hatte, aber sie nahm ihn mit, denn ansonsten war in diesem Container nichts zu holen.
»Bekommt mein Chef jetzt Schwierigkeiten?«, fragte der Junge, als sie wieder herauskletterte.
»Am besten erfährt niemand, dass ich überhaupt hier gewesen bin«, entgegnete Forss. »Die ganze Ermittlung ist nämlich äußerst heikel und delikat, wenn du verstehst, was ich meine.«
»Sind etwa Prominente in den Fall verwickelt?«
Forss nickte vielsagend.
»Ich wünschte, ich dürfte Namen nennen, aber leider …«
Sie hob entschuldigend die Schultern.
Seine Lippen formten ein lautloses »Wow«.
Montag
1
Der Tee, den Ann-Vivika Kimsel in ihrem geschmackvoll eingerichteten Büro zu servieren pflegte, war ausgezeichnet. Nyström musste an ihren eigenen Schreibtisch denken, der Jahrzehnte auf dem Buckel hatte, an die abgewetzten Besucherstühle und die durchhängenden Regale. Offenbar hatte die Pathologie ein anderes Budget als die Kripo Kronoberg, oder Kimsel hatte die Einrichtung aus eigener Tasche bezahlt. Der dampfende Tee hatte einen ostasiatischen Namen, den Nyström sich nicht merken konnte, und bewirkte angeblich wahre Wunder für den Stoffwechsel. Sie nahm sich jedes Mal aufs Neue vor, ihre Freundin darum zu bitten, ihr die genaue Sorte zu notieren, vergaß es aber immer wieder, und wenn sie dann beim nächsten Einkauf vor den Regalen im Delikatessenladen stand, war sie sich jedes Mal aufs Neue unsicher. Irgendetwas mit Oolong. Aber war es der Kwai Flower, der Formosa oder doch der Tin Kwan Yin?
»Wichtig ist die richtige Kombination aus Temperatur und Ziehzeit«, dozierte Kimsel. »Ich stelle den Wasserkocher exakt auf 83 Grad ein und lasse den Tee nie länger als zwei Minuten und 20 Sekunden ziehen. Den ersten Aufguss schütte ich gleich wieder weg. Am besten schmeckt mir der dritte und der vierte. Auch die Auswahl der Teekanne ist nicht zu vernachlässigen. Viele schwören ja auf emailliertes Gusseisen, zugegeben, es hat seine Vorteile, man muss allerdings auch bedenken, ob man weißen, grünen oder schwarzen Tee zubereitet …«
»Tja«, seufzte Nyström. Und dann noch einmal: »Tja.«
Ihr Wasserkocher hatte keine Temperatureinstellung. Das Einzige, was der konnte, war, Wasser zum Kochen zu bringen. Zum Aufgießen benutzte sie eine seit Ewigkeiten bewährte Thermoskanne. Handgestoppte Ziehzeiten? Mehrere Aufgüsse? Wer hatte schon so viel Zeit und Geduld? Sie jedenfalls nicht. Vielleicht war sie bei ihrem Roibuschtee doch ganz gut aufgehoben.
»Doch, du hast natürlich recht, Ingrid«, sagte Kimsel, Nyströms Gesichtsausdruck richtig deutend, »am Ende des Tages ist und bleibt es heißes Wasser mit Geschmack.«
»Eine Wissenschaft für sich«, lächelte Nyström. »Aber den Wissenschaften warst du ja immer schon zugeneigt.«
»Andernfalls wäre ich wohl auch eine miserable Pathologin.«
»Was uns zum Thema führt.«
Kimsel seufzte.
»Was uns zum Thema führt«, echote sie und legte die schmalen Hände aufeinander. Die Fingernägel waren sorgfältig in einem Rot lackiert, das perfekt auf ihre dunkle Seidenbluse und vielleicht sogar auf den gerahmten Miró-Druck an der Wand hinter ihr abgestimmt war. Nyström selbst war wahrscheinlich vierzehn oder fünfzehn Jahre alt gewesen, als sie sich das letzte Mal die Nägel lackiert hatte. Ihr lag kaum etwas an solchen Dingen, weder an Kosmetik noch an Mode – hätte sie jemand gebeten, ihren eigenen Stil zu beschreiben, wäre sie wohl nach einigem Nachsinnen am ehesten auf den Begriff pragmatisch gekommen – dennoch kam sie nicht umhin, immer wieder die Eleganz ihrer Freundin zu bewundern. »Wie ich bereits andeutete, entbehrt der Sachverhalt nicht einer gewissen Pikanterie.«
»Ich bin gespannt.«
»Du hast sicherlich mitbekommen, dass Carl Theorin im vergangenen Jahr verstorben ist?«
»Der ehemalige Professor für Rechtsmedizin.«
»Er ist stattliche 85 Jahre alt geworden. Darmkrebs, am Ende ging es sehr schnell. Er war, wie du weißt, mein Vorvorgänger hier.«
»In meinen ersten Berufsjahren bei der Kriminalpolizei bin ich ihm mehrmals begegnet. Sein Jähzorn war legendär. Angeblich hat er einmal einen menschlichen Schädel quer durch die Pathologie geschleudert, weil ihm ein junger Assistent widersprochen hat.«
Kimsel lachte.
»Das kann ich mir gut vorstellen. Die Geschichten über ihn geistern hier noch heute durch die Flure«, sagte sie. »Theorin war Mediziner vom alten Schlag. Er hatte seine Macken, aber fachlich war er eine Kapazität. Seine Habilitationsschrift über Einblutungen im Bindegewebe ist ein Standardwerk. Niemand hat wirklich verstanden, warum er das renommierte Karolinska-Institut verlassen hat, um hierher in die Provinz zu kommen. Mir gegenüber hat er einmal erwähnt, ihm bekomme unsere småländische Waldluft so gut.«
»Womöglich war das der Grund, warum er immer bis in den Winter hinein mit seinem italienischen Cabrio und offenem Verdeck herumgefahren ist.«
Kimsel lächelte.
»Ich glaube, das hatte eher andere Gründe. Theorin war ein Aufreißer vor dem Herrn, aber wenigstens einer der charmanteren Sorte. Einige Monate nach seinem Ableben hat sich die verwitwete Ehefrau an mich gewandt, es muss seine vierte gewesen sein, wenn ich richtig gezählt habe. Auch wenn das eigentlich nichts zur Sache tut. Die gute Frau hatte den Kofferraum voller alter Obduktionsakten, auf die sie beim Aufräumen und Aussortieren in Theorins Arbeitszimmer gestoßen war. Fallakten, die er offenbar im Laufe der Jahre mit nach Hause genommen, aber nie wieder zurückgebracht hatte. Er hat es wohl mit der Trennung von Beruflichem und Privatem nicht so genau genommen. Und anscheinend ist damals niemandem das Fehlen der Unterlagen aufgefallen oder es hat sich schlicht und ergreifend keiner getraut, sich über die Marotten des Chefs zu beschweren.«
»Wann ist Theorin in Pension gegangen?«
»1996. Dementsprechend stammen die meisten dieser Unterlagen aus den Neunzigerjahren, einige sind sogar noch aus den Achtzigern.«
»Richtig altes Zeug also.«
»Das im Grunde niemanden mehr interessiert.«
»Ich höre da ein Aber heraus.«
Kimsel warf ihr einen intensiven Blick zu.
»Denk doch mal nach, Ingrid. Natürlich verschwindet das meiste davon in irgendwelchen verstaubten Archiven. Normalerweise. Aber es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass die Originalberichte gebraucht werden. Alte Gerichtsfälle, die neu aufgerollt werden. Rechtsurteile, die nach Jahren zur Revision stehen. Außerdem geht es hier ums Prinzip. Die Akten gehören an ihren Platz. Punkt!«
»Aber wo ist das Problem? Wieso kannst du die Berichte nicht einfach diskret einsortieren?«
»Weil es nicht so simpel ist, wie es sich anhört. Die meisten der von Theorin verschlampten Akten sind noch nicht einmal digitalisiert. Die systematische Umstellung auf EDV begann erst Mitte der Neunzigerjahre. Das muss also als Erstes nachgeholt werden. Das ist zwar zeitaufwendig, doch unkompliziert. Der wahre Spaß geht dann jedoch erst los. Die Originale kommen ja schließlich nicht in ein zentrales Archiv, sondern sind in den meisten Fällen irgendwelchen polizeilichen Ermittlungen zugeordnet. Die Toten, die auf Theorins Obduktionstisch gelandet sind, kamen zwar meistens aus der Region Kronoberg, aber halt nicht immer, das heißt, einige der Akten müssen quer durchs Land geschickt werden: Jönköping, Kalmar, Malmö, sogar Hudiksvall ist dabei, weil irgendein durchgeknallter Norrländer 1989 auf einer Familienfeier in Älmhult volltrunken seinen Cousin erschlagen hat.«
»Klingt nach viel Arbeit«, sagte Nyström und machte ein mitfühlendes Gesicht. »Aber ich sehe noch immer nicht das Heikle daran. Theorin hat geschludert und es mit den Vorschriften nicht so genau genommen, ja. Aber das Ganze ist mehr als zwanzig Jahre her, und es ist vor allem nicht deine Schuld, auch wenn du nun Ordnung in seine Sachen bringen musst, unangenehmerweise.«
»Sicher. Aber ich erzähle dir das alles nicht, weil ich um Mitleid buhle, Ingrid, ich will auf etwas anderes hinaus.« Sie seufzte erneut. »Wie du vielleicht schon herausgehört hast, habe ich mich ein wenig in die Akten eingelesen. Es waren insgesamt siebzehn Obduktionsberichte. Du kennst meine Sorgfalt. Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Bevor ich sie also digitalisiere, zuordne, einsortiere und quer durch die Weltgeschichte schicke, wollte ich mir ein Bild machen. Das meiste waren Routineangelegenheiten: der bereits erwähnte Todschlag in Älmhult, ein Waldarbeiter mit Sepsis, eine Ertrunkene. Allerweltsfälle. Dasselbe dachte ich zunächst auch bei diesem Bericht hier.«
Kimsel schob einen altmodischen, beigefarbenen Pappordner über den Tisch. Nyström griff danach und schlug ihn auf. Als Erstes fielen ihr die drastischen Fotos ins Auge. Natürlich war sie allerhand gewohnt, aber die Bilder berührten sie unmittelbar.
»Fredrik Sidenvall hieß der junge Mann, ich weiß, ein sehr hässlicher Suizid«, erläuterte Kimsel. »Eine fatale Schussverletzung mit einer Schrottflinte im Unterbauch. Von den Organen ist buchstäblich nichts übrig geblieben.«
»Was für ein furchtbarer Tod«, flüsterte Nyström.
»Vor allem durchaus unkonventionell. Die meisten Selbstmörder, die sich mit einer Schusswaffe das Leben nehmen, schießen sich in den Kopf. Auch die Wahl der Waffe überrascht, etwas Unhandlicheres als eine lange Bockflinte mit Kipplaufverschluss lässt sich kaum finden, wenn man sich selbst das Licht ausknipsen will.« Nyström warf ihr einen Blick zu. »Entschuldige bitte den Ausdruck. Jedenfalls beides Details, die mich ein wenig irritiert haben. Daraufhin habe ich mir die Sache genauer angesehen. Ich habe Theorins damalige Untersuchungen akribisch nachvollzogen, seine Berechnungen, die Rekonstruktion der Tat. Dabei bin ich zunächst zu demselben Schluss gekommen wie er. Es war dem Mann durchaus möglich, sich in der Sitzposition, in der er am Tatort aufgefunden wurde, mit der Antonio-Zoli-Doppelbockbüchse in den Unterbauch zu schießen. Der Lauf dieser Waffe ist 65 Zentimeter lang, man muss sich sehr strecken und verrenken, den Abzug mit dem Daumen der rechten Hand statt wie üblich mit dem Zeigefinger durchziehen, aber dennoch war das Selbstmordopfer aufgrund seiner Körpergröße und der daraus folgenden Länge seiner Gliedmaßen dazu theoretisch in der Lage. Der Einschusskanal, der Winkel, in der die Flinte von der rechten Hand gehalten worden ist, all das stimmte. Es gab nichts, was gegen einen Suizid spräche.«
Nyström spürte, wie aufkommende Neugier und ein diffuses Unbehagen miteinander rangen.
»Aber?«
»Nun ja, du kennst mich. Nenn es manisch, nenn es Pedanterie: Ich konnte es dennoch nicht darauf beruhen lassen. Vielleicht war auch der Umstand nicht ganz unschuldig, dass Theorin mir vor dreißig Jahren bei einer Dienstbesprechung mal eine Spur zu vertraut die Hand auf den Oberschenkel gelegt hat, vielleicht wollte ich es dem alten Chauvi post mortem einmal so richtig zeigen. Ich war gewillt, einen Schritt weiter zu gehen als er. Ich wollte sorgfältiger sein als er. Ich gebe es zu: Ich wollte besser sein als er.« Kimsel schmunzelte. »Über eine ehemalige Studienkollegin, die mittlerweile in der Regionalverwaltung arbeitet, bin ich an die alten Krankenakten von Fredrik Sidenvall gelangt.«
»Du hättest doch den offiziellen Weg …«
»Wie denn das? Eine 56-jährige Ärztin, die aus verletztem Stolz ihrem ehemaligen Vorgesetzten einen fachlichen Fehler nachweisen will?«
»Trotzdem …«
»Mit Vorbildern und Mentoren ist es so eine Sache, Ingrid.«
»Wie meinst du das?«
»Wart’s ab«, sagte Kimsel mit einem kryptischen Unterton. »Jedenfalls: Ich hatte Glück, beziehungsweise: Ich hatte recht. Möglicherweise. Schau mal auf Seite vier des Anhangs von Sidenvalls Patientenakte, dort sind Kopien seiner gesammelten medizinischen Berichte. Den Umstand, dass er trotz seines jungen Alters bereits an Rheuma litt, kannst du ignorieren, der spielt für das, worauf ich hinauswill, keine Rolle. Lies das Ende, sein letzter Arztbesuch.«
Nyström blätterte. Die Diagnose war mit Textmarker hervorgehoben. Fredrik Sidenvall war mit einer gebrochenen rechten Hand in einer Praxis in Lessebo vorstellig geworden. Arbeitsunfall stand da. Tastbefund.
»Das war fünf Tage, bevor er sich erschossen hat«, sagte Kimsel.
»Du willst damit sagen …«
»Wenn seine Hand tatsächlich auf die Art und Weise gebrochen war, wie es hier steht, kann er damit unmöglich den Abzug der Flinte betätigt haben. Multiple Frakturen der Finger- und Mittelhandknochen.«
»Und wenn er die linke Hand …?«
Kimsel schüttelte den Kopf.
»Das passt nicht zur Körperhaltung, in der der Leichnam entdeckt wurde.«
Nyström dachte angestrengt nach.
»Und wenn er mit dem Fuß …?«
»Unmöglich. Außerdem trug er Schuhe, als er aufgefunden wurde. Es gibt haufenweise wissenschaftliche Abhandlungen zu dem Thema Selbsterschießungen. Außerdem hat Theorin den Toten akribisch vermessen. Streck mal probeweise deinen rechten Arm aus. Wenn die Mündung des Gewehrs auf dich zeigt, muss der Abzug logischerweise in die andere Richtung, also von dir weg, durchgezogen werden. Natürlich kann man mit dem Zeige- oder Mittelfinger eine Bewegung in die Richtung machen, aber es gelingt kaum, genügend Kraft auf den Durchzug auszuüben. Es geht eigentlich nur mit dem Daumen. Und auf keinen Fall, wenn Hand, Daumen und Finger mehrere Frakturen aufweisen. Es ist rein mechanisch unmöglich, abgesehen davon, dass die Schmerzen nicht zu überwinden wären.«
»In dem Arztbericht aus Lessebo steht etwas von einem Tastbefund.«
»Das ist das Problem«, gab Kimsel zu. »Der Schwachpunkt meiner Theorie.«
»Wird man bei einem Knochenbruch denn nicht geröntgt?«
»Normalerweise schon. Ich habe mich schlaugemacht. In der Praxis in Lessebo hatte man damals noch kein Röntgengerät. Sidenvall wurde mit seiner Hand ins Krankenhaus nach Växjö überwiesen, aber diese Anschlussuntersuchung hat nie stattgefunden.«
»Kann sich der Arzt damals womöglich geirrt haben?«
»Sicher. Ärzte können sich irren.«
»Was ist mit den Röntgenaufnahmen der Obduktion?«
»Theorin hat diesbezüglich offenbar ebenfalls geschlampt. Die Todesursache schien ihm so klar, dass er sich nur auf den Oberkörper des Mannes konzentriert hat. Davon gibt es Röntgenbilder und die Schäden, die der Schuss verursacht hat, sind mustergültig dokumentiert. Die Extremitäten, Beine, Arme, Füße und Hände, hat der Professor dagegen ignoriert. Ein klassischer Kunstfehler und eine Abweichung vom Protokoll. Vielleicht meinte er es am Ende einer langen, erfolgreichen Karriere nicht mehr so genau nehmen zu müssen und hat sich zu sehr auf seinen Instinkt und seine Erfahrung verlassen.«
»Aber wie sollen wir dann darüber Gewissheit erlangen, Ann-Vivika? War die Hand nun gebrochen oder nicht? Hier geht es womöglich um einen übersehenen Mord!«
Kimsel lächelte schmal. »Ich fürchte, da gibt es nur einen einzigen Weg.«
Nyström spürte, wie ihr das Blut aus dem Gesicht wich.
»Sag mir bitte, dass ich das hier nur träume.«
»Ich sehe keine andere Möglichkeit, als das Grab zu öffnen, Ingrid.«
»Aber …«
Nyström wollte protestieren, doch ihr fiel wenig ein.
»Was ist denn mit der polizeilichen Ermittlung des Falls?«, fragte sie schließlich. »Zu welchem Schluss sind die damaligen Kollegen gekommen?«
Kimsels Lächeln wurde noch schmaler.
»An der Stelle wird es erst richtig interessant. Ich habe vor zwei Wochen die alten Ermittlungsunterlagen offiziell angefragt. Sie sind nicht aufzufinden. Es gibt ein entsprechendes Aktenzeichen, aber die Akte selbst ist verschwunden, und zwar sowohl die digitalisierte Fassung als auch ihr analoges Pendant.«
»Weißt du, wer die Ermittlung geleitet hat?«
»Theorins Bericht zufolge war Hauptkommissar Gunnar Berg bei der Obduktion anwesend.«
»Gunnar Berg?«
Berg war Nyströms Ausbilder und Mentor gewesen. Von ihm hatte sie alles gelernt, was sie über Polizeiarbeit wusste. Hätte Berg nicht einen schweren Verkehrsunfall erlitten und gesundheitsbedingt in den Vorruhestand gehen müssen, wäre sie niemals so schnell auf ihrem Posten gelandet. Mit dem warmherzigen, klugen Mann verband sie viel.
»Wie gesagt, mit Vorbildern ist das so eine Sache, Ingrid.«
2
»Ich verstehe nicht, was meine Rolle bei diesem Treffen sein soll. Wo ihr doch seit Ewigkeiten miteinander befreundet seid. Oder sehe ich das falsch?«
Stina Forss schob sich ein Hustenbonbon in den Mund. Ihr Hals kratzte und wenn sie sprach, tat es besonders weh. Das Wochenende im Stockholmer Regen hatte ihr eine ausgewachsene Erkältung beschert. Nyström warf ihr vom Fahrersitz aus einen Seitenblick zu, einen sehr distanziert wirkenden Seitenblick, fand Forss, wahrscheinlich war die Chefin noch sauer, weil sie nicht an der dämlichen Geburtstagsfeier teilgenommen hatte.
»Das ist es ja gerade«, insistierte Nyström, »dass Gunnar Berg und ich uns seit Langem kennen und schätzen. Dass er jahrelang mein Kollege war, mein Ausbilder und Mentor. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wozu sich die Sache auswächst, auf die Ann-Vivika da gestoßen ist, wahrscheinlich zu gar nichts, wahrscheinlich verläuft alles wie so oft im Sande, aber wenn doch … Stina – ich möchte einfach, dass der Verdacht von Mauschelei gar nicht erst aufkommt. Alles soll seinen geordneten, richtigen Weg gehen.«
»Ich bin also so eine Art Anstandsdame.«
»Gewissermaßen.«
Nyström setzte den Blinker und bog scharf links ab, in das teure Wohngebiet Öjaby, das nordwestlich der Stadtmitte an einem südlichen Ausläufer des Helgasees lag. Gunnar Berg lebte gemeinsam mit seiner Frau in einem großzügig geschnittenen Einfamilienhaus, die erwachsenen Kinder waren längst ausgezogen, der preisgekrönte Garten war bereits mehrmals in Fachzeitschriften abgebildet worden, lag nun aber größtenteils unter einer Schneedecke verborgen. Obwohl es seit Wochen immer wieder taute, hielt sich hartnäckig eine weiße Kruste auf Häuserdächern und Gärten, Wäldern und Weiden.
Barbro Berg führte die beiden Kommissarinnen ins Wohnzimmer, wo der ehemalige Chef der Kriminalpolizei Kronoberg auf sie wartete. Gunnar Berg saß seit dem schweren Unfall, der seine Karriere beendet hatte, im Rollstuhl. Noch so ein Versehrter, dachte Forss und rückte ihre Augenklappe zurecht, ein nervöser Tick, den sie sich nicht abgewöhnen konnte. Sie war Berg vor einigen Jahren bereits einmal im Zusammenhang mit einem anderen Fall begegnet, auch damals hatte er Nyström und sie bei sich zu Hause empfangen. Er sah inzwischen älter und eingefallener aus, dachte sie, aber er schien seinen kindlichen Sinn für Humor nicht verloren zu haben, jedenfalls deutete sie die Fleecedecke mit Garfield-Motiv dahin gehend, die sich Berg über die Beine gelegt hatte. Wenn sie sich richtig erinnerte, war es bei ihrer letzten Begegnung eine Snoopy-Decke gewesen.
Nyström beugte sich zu Berg hinunter und umarmte ihn herzlich, Forss gab ihm förmlich die Hand.
»Unsere Heldin aus Södertälje!«, wurde sie begrüßt. Solche Sprüche hörte sie dauernd. Sie mochte sie nicht.
»Unter den Blinden ist die Einäugige Königin«, versuchte sie sich an einem Scherz. Bevor es hier zu sentimental wird, dachte sie.
Berg zwinkerte ihr zu.
»Jedenfalls gute Arbeit, es ist mir wichtig, meine Hochachtung vor dieser hervorragenden polizeilichen Leistung persönlich zum Ausdruck zu bringen.«
»Danke.«
Was sollte man auch sonst auf so einen Satz entgegnen? Ihr war das Lob unangenehm, vor allem vor ihrer Chefin.
»Wir sind sehr dankbar, dass wir Stina im Team haben«, sagte Nyström steif.
Barbro Berg brachte ein Tablett mit Kaffee und Gebäck an den Wohnzimmertisch und löste damit die merkwürdig aufgeladene Situation auf.
»Bitte setzt euch doch«, sagte sie. Es gab Kaffee, selbst gebackene Schokoladenkekse und Scones. Sie wünschte einen guten Appetit und entschwebte wieder Richtung Küche. Wie eine gute Fee, dachte Forss, oder eine deutsche Hausfrau vor fünfzig Jahren. Nyström nippte am ausgezeichneten Kaffee, würdigte das Feingebäck und die Fotos von Bergs opulenten Rhododendronbüschen in der Herbstausgabe der Gartenfreude. Forss verdrehte innerlich die Augen. Nach der zweiten Tasse Kaffee gab Berg das Signal, zum ernsten Teil des Gesprächs überzugehen.
»Aber wegen des Rhododendrons seid ihr natürlich nicht hier.«
Seine Augen hatten diesen gewissen Glanz, stellte Forss fest, den sie als Neugier identifizierte. Nyström hatte ihren Besuch telefonisch angekündigt, dabei aber nicht erwähnt, worum es überhaupt ging.
»Was sagt dir der Name Fredrik Sidenvall?«, fragte Nyström.
Berg überlegte einen Moment.
»Da klingelt etwas«, sagte er und nickte bedächtig. »Ende der Achtzigerjahre? Anfang der Neunziger?«
»1992«, präzisierte Forss.
»Richtig«, sagte Berg. »Ein Selbstmord. In Lessebo, wenn ich mich nicht irre. Unschöne Sache. Er hat ein Schrotgewehr benutzt, oder?«
»Ganz genau«, sagte Nyström. »Du hast immer noch ein hervorragendes Gedächtnis, Gunnar.«
»Schmeichlerin«, lächelte er, dann wurde er wieder ernst. »Wie kommt ihr auf diese alte Geschichte?«
Nyström berichtete ausführlich von ihrem Gespräch mit Kimsel. Berg kratzte sich nachdenklich an der Nasenspitze.
»Das ist merkwürdig«, sagte er schließlich, »und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Sache, auf die Ann-Vivika da in dem alten Obduktionsbericht beziehungsweise in den Krankenakten gestoßen ist, erscheint mir durchaus ernst zu nehmend. Mit gebrochenen Fingern kann man keinen Gewehrabzug durchziehen, das könnt ihr mir glauben. Bei der verdammten Kollision mit der Wildsau hat es ja nicht nur meine Beine und Niere erwischt, sondern auch die rechte Hand. In drei Fingern Trümmerbrüche und das Handgelenk hat ebenfalls etwas abbekommen. Das sind Schmerzen, da geht man die Decke hoch. Selbst als die Fixierung weg war: Die kleinste falsche Bewegung und man könnte im Dreieck springen, so weh tut das. Der Umstand, dass Sidenvalls Ermittlungsakte nicht aufzufinden ist, ist natürlich ärgerlich und macht das Ganze nicht unverdächtiger. Es kann natürlich aber auch sein, dass irgendein Depp sie einfach falsch einsortiert oder verlegt hat.« Berg sah von Nyström zu Forss und wieder zurück. Forss musterte den ehemaligen Chefermittler. Nichts deutete darauf hin, dass er ihnen nicht die Wahrheit erzählte. Entweder stimmte, was er sagte, und er hatte nichts mit dem Fehlen der Akte zu tun, oder er war ein sehr guter Lügner.
»Was ist mit dem Verschwinden der digitalen Version?«, fragte sie.
Berg zuckte mit den schmalen Schultern. »Die Umstellung auf EDV steckte damals noch in den Kinderschuhen. Ein schlecht geschulter Mitarbeiter, eine versehentliche Löschung der Daten, eine verlegte Diskette? Möglich ist einiges. Aber das wirklich Seltsame ist, dass es sich bei dem Toten ausgerechnet um Fredrik Sidenvall handelt.« Berg machte eine wirkungsvolle Pause. »Ihr wisst, wer das war, oder?« In beiden Gesichtern Ratlosigkeit. »Mmh, richtig, ihr habt die Akte ja gar nicht, und die Geschichte ist so lange her, damals warst du noch bei den Uniformierten und bist Streife gefahren, Ingrid. Außerdem hat sich das Ganze einige Hundert Kilometer nördlich von hier abgespielt, in Hallsberg, im Zuständigkeitsbereich der Kripo Örebro.«
»Moment mal«, unterbrach Forss, »ich denke, wir reden hier von Lessebo?«
Die Kleinstadt lag 35 Kilometer südöstlich von Växjö.
»Der Selbstmord war in Lessebo, ja. Aber ich spreche von der Exekution sechs Jugendlicher.«
Jetzt waren es Nyström und Forss, die sich ansahen.
»Das Massaker von Hallsberg haben es die Boulevardzeitungen genannt. Nie etwas davon gehört?«
Forss schüttelte ihren Lockenkopf.
»Ich erinnere mich schwach«, sagte Nyström schließlich zögerlich. »Es lief damals in den überregionalen Nachrichten. Aber was haben diese sechs ermordeten jungen Leute mit dem Selbstmord von Sidenvall zu tun?«
»Fredrik Sidenvall«, antwortete Berg und strich die Garfielddecke über seinen Beinen glatt, »war der Hauptverdächtige im Hallsberger Fall. Alles deutete darauf hin, dass er der Täter war. Durch seinen Suizid hat er sich der Verhaftung entzogen.«
3
In der Dienstbesprechung am späten Vormittag packte Lasse Knutsson in Ruhe sein zweites Frühstück aus. Das aktuelle Ernährungskonzept, mit dem er sein beträchtliches Übergewicht in Angriff nehmen wollte, hieß mindfullness, Achtsamkeit. Als er beim zufälligen Blättern in einer der Zeitschriften seiner Frau darauf gestoßen war, hatte es ihm gleich so sehr eingeleuchtet, dass er seine enervierende Low-Carb-Diät auf der Stelle über den Haufen geworfen hatte. Wie naiv war er eigentlich gewesen, dass er wochenlang versucht hatte, systematisch die Kohlenhydrate aus seinem Speiseplan zu verbannen? Kein Mensch hielt es aus, andauernd zu verzichten, andauernd Hunger zu haben! Achtsam zu sein, bedeutete dagegen etwas vollkommen anderes. Es bedeutete, in sich hineinzulauschen, auf seinen Körper zu hören, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und bewusst und wertfrei zu genießen. Allein diese Formulierung machte einem doch schon Lust auf das Leben: bewusst und wertfrei zu genießen. Nichts leichter als das! Also hatte er heute Morgen achtsam in sich hineingehört und die Signale, die ihm sein Körper gesendet hatte, gefielen ihm ungemein: Er verlangte nach einer Doppelscheibe süßem Schwarzbrot mit Frischkäse, gehacktem Schnittlauch und Bresaola alla Valtellinese. Einem Vollkornweizenbrötchen mit gesalzener Butter, altem Cheddar und selbst gemachtem Feigen-Mirabelle-Senf. Einer Tupperdose mit eingelegten Birnen. Dazu aus der Kantine ein dreifacher Espresso mit aufgeschäumter Milch und Karamellsirup. Knutsson breitete seine Schätze auf dem riesigen ovalen Tisch vor sich aus und registrierte mit Genugtuung, wie Hugo Delgado Stielaugen bekam.
»Vielleicht bin ich voreingenommen«, nahm Nyström den Faden wieder auf, den sie durch Knutssons Geraschel mit dem Butterbrotpapier für einen Moment verloren zu haben schien. »Aber ich hatte den Eindruck, dass Gunnar Berg mit dem Verschwinden der Akte Sidenvall nichts zu tun hat.«
»Wieso sollte er so etwas auch machen?«, fragte Knutsson kauend.
»Mit vollem Mund spricht man nicht«, rügte ihn Delgado.
»Es kann viele Gründe geben, Akten verschwinden zu lassen«, zählte Forss auf. »Man möchte jemanden schützen, der in eine Ermittlung verwickelt ist, vielleicht sogar sich selbst. Man will handwerkliche Fehler vertuschen, die man gemacht hat. Man will auf diese Weise Beweise unterschlagen, um einer Ermittlung aus bestimmten Gründen eine andere Richtung zu geben … Aber ich gebe Ingrid recht, ich glaube ebenfalls nicht, dass Berg uns die Unwahrheit erzählt hat.«
»Die Frage bleibt natürlich trotzdem bestehen«, sagte Delgado. »Wie gehen wir mit Ann-Vivikas Hypothese um?«
»Ich sehe kaum eine andere Möglichkeit, als der Sache auf den Grund zu gehen«, antwortete Nyström. »Aber bevor ich ein fünfundzwanzig Jahre altes Grab öffne, um Hand- und Fingerknochen untersuchen zu lassen, möchte ich wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wer war dieser Fredrik Sidenvall? Ganz gleich, ob das Fehlen seiner Akte nun einfach Zufall ist oder ob mehr dahintersteckt, es behindert unsere Arbeit natürlich ungemein. Gunnar Berg hat dankenswerterweise zugesagt, ein Gedächtnisprotokoll über die damaligen Geschehnisse anzufertigen und mit dem mittlerweile ebenfalls pensionierten Kollegen zu reden, der 1992 gemeinsam mit ihm den Fall bearbeitet hat. Mehr verspreche ich mir allerdings von den polizeilichen Unterlagen aus Örebro. In den Ermittlungen um die sechs ermordeten jungen Leute in Hallsberg war Fredrik Sidenvall offenbar die zentrale Figur und der einzige Verdächtige. Der Kommissar, der damals in Örebro mit dem Fall betraut war, ist dort heute noch im Dienst. Stina hat zugesagt, raufzufahren und mit ihm zu sprechen.«
Knutsson signalisierte Forss seine Wertschätzung, indem er ostentativ beide Daumen emporreckte. Seiner Einschätzung nach konnte die Deutschschwedin nach ihrer schweren Verletzung und den so offensichtlich bleibenden Schäden ein paar zusätzliche seelische Streicheleinheiten gebrauchen.
»Hugo, von dir brauche ich eine umfangreiche Recherche zu Sidenvall«, fuhr Nyström fort. »Auch wenn seine Akte nicht aufzufinden ist, muss es ja irgendwo Informationen über ihn geben. Such nach Verwandten, Bekannten, ehemaligen Kollegen. Menschen, die uns etwas über ihn erzählen können. Das Internet wird uns in diesem Fall wohl kaum weiterhelfen, das alles ist schließlich ein Vierteljahrhundert her, aber alte Zeitungsberichte könnten interessant sein.«
»Yes, Ma’am.«
»Danke. Und Lasse?«
»Ja?«
»Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du deine Festmahlzeiten demnächst auf die Pausen verlegst.«
Knutsson dachte einen Augenblick nach, bevor er etwas entgegnete.
»Ich glaube, du hast das Prinzip der Achtsamkeit noch nicht verstanden, Ingrid.«
4
Viel mehr als die biografischen Eckdaten von Fredrik Sidenvalls kurzem Leben konnte Delgado nicht aus den Archiven der Sozialversicherungskasse, des Finanzamts und anderer Behörden herausfiltern. Der junge Mann war am 4. Oktober 1970 als erstes Kind des Ehepaars Stefan und Astrid Sidenvall geboren und starb am 26. November 1992. Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits knapp zwei Jahre tot; die Todesursache Leberzirrhose und mehrere Anzeigen gegen Stefan Sidenvall wegen Trunkenheit und Misshandlung ließen Delgado vermuten, dass der Sohn in problematischen Verhältnissen aufgewachsen war. Fredrik hatte eine drei Jahre jüngere Schwester, Belinda, die mittlerweile verheiratet war und in einer kleinen Ortschaft in Blekinge lebte. Die Mutter war 2009 an den Folgen einer jahrzehntelangen Alkoholkrankheit in einem Pflegeheim in Högsby gestorben. Fredrik Sidenvall hatte nach seinem Schulabschluss 1988 drei Jahre lang als Minenarbeiter in Kiruna gejobbt, 1500 Kilometer von seiner Heimat entfernt. So weit weg von zu Hause wie innerhalb der Landesgrenzen nur möglich, dachte Delgado – bei dem Elternhaus wäre ich wahrscheinlich auch bis über den Polarkreis hinaus abgehauen. Etwa anderthalb Jahre vor seinem Tod hatte Sidenvall die Arbeit in Nordschweden jedoch aufgegeben und war nach Småland zurückgekehrt, wo er für eine Spedition als Lkw-Fahrer arbeitete. Die Firma hatte ihren Sitz in Sidenvalls Heimatort Lessebo und sie existierte heute noch, wie eine schnelle Internetrecherche ergab. Über den jungen Mann selbst fand sich im Netz wenig. Delgado trieb ein Schulfoto des Abschlussjahrgangs auf, das jemand anlässlich eines Jubiläumstreffens hochgeladen hatte. Sidenvall war ein großer, dünner Junge mit ernstem Gesichtsausdruck. Auf einer Website mit archivierten Sportresultaten war Sidenvall als Sieger eines Jugendtischtennisturniers in Växjö 1987 verzeichnet. Der dritte Treffer war Delgados Meinung nach der interessanteste: Der junge Mann hatte sich 1990 in einer kleinen, freikirchlichen Gemeinde in Kiruna taufen lassen. Das Foto zum kurzen Bericht im Online-Archiv der nordschwedischen Lokalzeitung zeigte fünf junge Menschen in weißen Roben, darunter Sidenvall, die gemeinsam in einen Fluss stiegen. Delgado, selbst katholisch erzogen, fiel ein, irgendwo einmal gelesen zu haben, dass die meisten Freikirchen und Pfingstler die Kindstaufe ablehnten und das Sakrament erst mündigen Gläubigen zukommen ließen. In Ewigkeit, Amen, dachte er, druckte die neu gewonnenen Informationen aus und fuhr den Rechner herunter, um Mittagspause zu machen. Der Anblick von Knutssons zweitem Frühstück hatte ihn hungrig gemacht.
5
Erik Edman sah Ingrid Nyström nachdenklich an. Jedenfalls war es der Blick, den ihr Vorgesetzter aufzusetzen pflegte, wenn er besonders gedankenversunken, geistreich oder kritisch wirken wollte. Das Kinn auf Daumen und Mittelfinger abgestützt, den Zeigefinger an die Wange gelehnt, Pokerface und um Blickkontakt bemüht: Erik »Halbvier« Edman – seinen Spitzname verdankte er der Uhrzeit, zu der er normalerweise das Präsidium Richtung Golfplatz verließ – schien in Gestik und Mimik einem Schriftsteller nachzueifern, der für ein Autorenfoto posierte, oder gleich dem jungen Robert Kennedy, was Nyström nicht verwunderte, sagten doch viele dem Polizeichef politische Ambitionen nach.
»Wie wird die Presse darüber berichten?«, fragte er schließlich. »Und …«, er hob den Zeigefinger seiner freien Hand, »ein nicht unerheblicher Gedanke: Was wird die Kirche dazu sagen?«
Nyström stöhnte innerlich auf. Natürlich hatte sie damit gerechnet, dass Edman bei der Aussicht auf eine Graböffnung nicht begeistert sein würde, und selbstverständlich galt seine erste Sorge dabei wie immer der Außendarstellung der polizeilichen Arbeit, sprich seiner eigenen Reputation und seinen weiteren Karriereaussichten. Neu war dagegen, dass ihn die religiösen Implikationen eines dienstlichen Sachverhalts interessierten.
»Ich habe bereits mit der Pressestelle gesprochen. Rosanna Lukasson ist der Auffassung, dass in diesem Fall eine kurze Mitteilung ausreicht, wohlgemerkt nachdem die Exhumierung durchgeführt worden ist. Videoaufnahmen von Baggerarbeiten auf dem Friedhof oder Skelettfotos wollen wir schließlich vermeiden.«
»Um Gottes willen, ja!« Von Kennedy war nun von einem Moment auf den nächsten nichts mehr zu sehen, Edman fuchtelte mit den Armen in der Luft herum. »Nichts wäre unvorteilhafter als das!«
»Sicher«, Nyström nickte beflissen, »wir müssen schließlich auch an die Außendarstellung denken.«
»Meine Rede!«
»Was die Rücksprache mit der Kirche angeht …«
»Dein Mann ist doch Pastor, Ingrid. Kannst du ihn nicht einfach beim Abendessen …«
»Ich habe bereits mit Fredrik Sidenvalls Angehörigen Kontakt aufgenommen, mit seiner Schwester, um genau zu sein. Sidenvall ist nicht kirchlich beerdigt worden, falls dich das beruhigt.«
»Das beruhigt mich ungemein.«
Edman zeigte seine porzellanweißen Zähne. Das sollte wohl ein Lächeln darstellen. Nyström deutete es als ein Signal, endlich aufstehen zu dürfen. Es gab wirklich viele Orte, an denen sie lieber Arbeitszeit verbrachte, als vor Edmans Schreibtisch. Sie hegte den Verdacht, dass ihr Chef mit voller Absicht Besuchersessel mit kurzen Beinen und tiefen Polstern ausgesucht hatte. Typische Politikerpsychologie, man sollte wie ein Dreijähriger zu ihm aufschauen müssen.
»Ich werde also alles in die Wege leiten«, sagte sie, als sie ihren Körper aus dem niedrigen Sessel gestemmt hatte. »Wenn Staatsanwalt Börjlind keine Einwände hat, kann es gleich morgen früh losgehen.«
»Je dunkler es dabei draußen ist, desto besser«, erklärte Edman.
6
Das Präsidium in Örebro war ein postmoderner, kantiger Bau mit weißer Fassade. Stina Forss, die dreieinhalb Stunden ohne Pause durchgefahren war, parkte ihren BMW davor im Halteverbot und legte das Schild Polizei im Einsatz hinter die Windschutzscheibe. Sie musste zu dringend auf die Toilette, um lange nach einem freien Parkplatz zu suchen, außerdem hatte sie Hunger und Kopfschmerzen. Sie ging so schnell ins Gebäude, wie es die hohen Absätze der Schuhe zuließen, und fand zu ihrer Erleichterung schnell, wonach sie suchte. Nachdem
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: