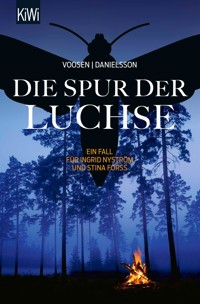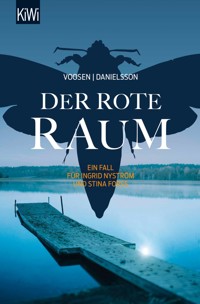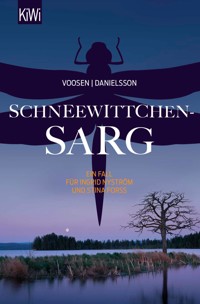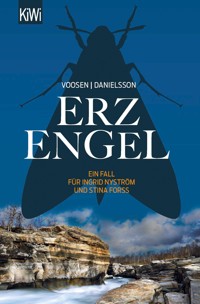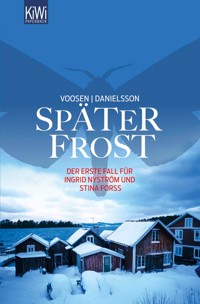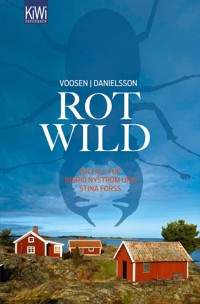9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Südschweden 2005: Ein Orkan verwüstet ganze Landstriche, riegelt Dörfer und Höfe tagelang von der Außenwelt ab und fordert 17 Todesopfer Auch der Bauer des Johansson-Hofs kommt in der Sturmnacht durch einen tragischen Unfall ums Leben. Als zehn Jahre später das Gehöft bis auf die Grundfesten niederbrennt und in den rauchenden Trümmern ein aufgespießter, bis zur Unkenntlichkeit verkohlter Leichnam gefunden wird, nehmen die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss die Ermittlungen auf. Die rätselhafte Spurenlage führt die beiden ungleichen Frauen zu norwegischen Touristen, osteuropäischen Erntehelfern und einem Resozialisierungsprojekt für ehemalige Schwerverbrecher. Doch bald wird deutlich, dass der Mordfall noch eine ganz andere Dimension aufweist: Während Nyström und Forss der Fährte in die Vergangenheit folgen, befindet sich eine junge, verletzte Frau auf der Flucht vor einem gnadenlosen Täter. In den Tiefen des småländischen Walds beginnt eine Jagd auf Leben und Tod, die auch die Ermittlerinnen bis an ihre Grenzen treibt. »Voosen/Danielsson gehören zu den großen Talenten im deutschsprachigen Kriminalroman.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
In stürmischer Nacht
Ein Fall für Ingrid Nyström und Stina Forss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen und Hamburg.
Kerstin Signe Danielsson ist in der Nähe von Växjö/Småland geboren und aufgewachsen. Roman Voosen stammt aus dem emsländischen Papenburg. Sie leben und arbeiten zusammen in Schweden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Südschweden 2005: Ein Orkan verwüstet ganze Landstriche, riegelt Dörfer und Höfe tagelang von der Außenwelt ab und fordert 17 Todesopfer. Auch der Bauer des Johanssonhofs kommt in der Sturmnacht durch einen tragischen Unfall ums Leben. Als zehn Jahre später das Gehöft bis auf die Grundfesten niederbrennt und in den rauchenden Trümmern ein aufgespießter, bis zur Unkenntlichkeit verkohlter Leichnam gefunden wird, nehmen die Kommissarinnen Ingrid Nyström und Stina Forss die Ermittlungen auf.
Die rätselhafte Spurenlage führt die beiden ungleichen Frauen zu norwegischen Touristen, osteuropäischen Erntehelfern und einem Resozialisierungsprojekt für ehemalige Schwerverbrecher. Doch bald wird deutlich, dass der Mordfall noch eine ganz andere Dimension aufweist: Während Nyström und Forss der Fährte in die Vergangenheit folgen, befindet sich eine junge, verletzte Frau auf der Flucht vor einem gnadenlosen Täter. In den Tiefen des småländischen Walds beginnt eine Jagd auf Leben und Tod, die auch die Ermittlerinnen bis an ihre Grenzen treibt.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
Schweden, zehn Jahre später: Montag, 7. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Zehn Jahre zuvor: Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 5.09–5.54 Uhr
Zehn Jahre später, Dienstag, 8. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Zehn Jahre zuvor: Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 6.11–8.43 Uhr
Zehn Jahre später, Mittwoch, der 9. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 14.10–14.48 Uhr
Zehn Jahre später, Donnerstag, der 10. September
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 16.03–16.12 Uhr
Freitag, der 11. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 17.03–20.23 Uhr
Samstag, der 12. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 20.34–22.16 Uhr
Sonntag, der 13. September 2015
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, ab 23.45 Uhr
Epilog
Leseprobe »Tode, die wir sterben«
There’s an east wind coming, Watson. It will be cold and bitter, and a good many of us may wither before its blast. But it’s God’s own wind none the less, and a cleaner, better, stronger land will lie in the sunshine when the storm has cleared.
A. C. Doyle, »His Last Bow«
Prolog
Es waren die Tiere, die zuerst reagierten.
Die Kühe wirkten bereits morgens bei der Fütterung unruhig; sie stießen einander, scharrten im Stroh, schlugen nervös mit den Schwänzen. Der Hund jaulte gegen Mittag ohne ersichtlichen Grund. Die Katze ließ sich gar nicht blicken, ihr Futternapf stand unberührt in der Scheune. Dass sich ein Sturm zusammenbraute, begriff der Bauer erst, als es Abend wurde. Den ganzen Tag über war es beinahe windstill gewesen, die Spitzen der hohen Fichten hatten sich kaum bewegt, und über den Wäldern und Weiden hatte eine unwirkliche Ruhe gelegen. Doch nun wurde der Himmel sehr schnell dunkel und darauf wieder hell, Wolkenfetzen jagten vorbei, dann brach die Dämmerung herein, plötzlicher als sonst in diesem milden Winter. Der Bauer machte Feierabend und zog sich ins Haus zurück. Draußen begann es zuerst zu rauschen, dann zu pfeifen, schließlich heulte es. Eine halbe Stunde später sah er den vor Tagen ausrangierten Weihnachtsbaum am Wohnzimmerfenster vorbeipurzeln, die Scheinwerfer im Hof brachten das Lametta für einen seltsam schönen Augenblick zum Glitzern. Dann ging das Licht aus. Der Strom war weg und der Baum auch.
So fing es an.
Kurz darauf wurde es schlimmer: Die Ziegel auf dem Dach klapperten, zuerst vereinzelt, dann im Tremolo. Woge um Woge drückte der Wind gegen das Haus, griff es, schüttelte es, verschlang es und spie es wieder aus. Der Bauer hörte, wie die Bäume am Waldrand umknickten; die Fichten brachen ächzend und klagend. Da draußen wütete ein Wahnsinniger, ein irrer Riese, eine Urgewalt. Der Himmel regnete Asche und sprühte Funken, atmete Feuer und sprengte Gestein. Jedenfalls hörte es sich drinnen so an. Die ganze Familie versammelte sich in der Küche, zündete Kerzen an und legte neue Batterien ins Radio. Dort war jetzt von einem Orkan die Rede. Etwas klatschte gegen das Fenster, ein Vogel, aber die Scheibe blieb ganz. Als die Böen gegen Mitternacht nachließen, als sie endlich ein wenig nachließen, gingen sie gemeinsam hinaus.
Sie standen in völliger Finsternis. Das Erste, was dem Bauern auffiel, war der Geruch von frisch gerodetem Wald. Der schwere Harzgeruch, der ihn bis dahin auf eine unbestimmte und archaische Art glücklich gemacht hatte, ließ ihn nun das Schlimmste ahnen. Er schaltete eine Taschenlampe ein. Ihr Schein tastete sich bis an den Waldrand vor. Nur, dass es keinen Waldrand mehr gab. Es war, als hätte sich der Horizont verschoben, als wäre er nach unten abgesackt. So weit der Lichtkegel der Lampe reichte, lagen die Bäume am Boden. Siebzig, achtzig Jahre alte Tannen und Fichten, die bereits sein Urgroßvater gepflanzt hatte. Er versuchte, den Schaden zu ermessen; sich vorzustellen, was er verloren hatte. Sein Erbe, sein Leben, seine Existenz? Panik würgte ihn. Die Tiere waren verängstigt, eine entwurzelte Tanne lag in der Hofeinfahrt, und die Straße vor dem Haus war von unzähligen umgekippten Bäumen blockiert. Weitere Taschenlampen warfen hektisch Kegel in die Dunkelheit, alle rannten durcheinander. Beinahe wäre er über den Hund gestolpert. Er sah nach den Kühen und Hühnern. Er zerrte mit dem Traktor die umgefallene Tanne aus der Einfahrt. Er brüllte sinnlose Befehle und gab Kommandos, denen niemand folgte. Die Eiche im Hof stand noch, die gelben Scheinwerfer des Traktors beleuchteten die tote Katze, die mit gebrochenem Rückgrat zwischen zwei Ästen in der Baumkrone eingeklemmt war. Sie hing da wie ein Opferlamm.
Ein Opfer?
Aber wofür?
Er wusste es nicht. Er fühlte überhaupt nichts mehr. Er war wie betäubt. Trotzdem arbeitete er wie eine Maschine. Er begriff bald, dass das Schicksal, dass der Sturm nicht nur ihn getroffen hatte. Ein Orkan über Südschweden, hatte es im Radio geheißen. Deshalb galt es vor allen Dingen, die Straße wieder frei zu bekommen und an ein funktionierendes Telefon zu gelangen. Ein Wettlauf gegen die Zeit: Die Waldbesitzer, die die Forstunternehmen und Sägewerke zuerst erreichten, würden ihr Holz bergen und verkaufen können; die anderen mussten sich hinten anstellen; wochenlang, monatelang, womöglich jahrelang würden die umgeknickten Bäume der Witterung, der Fäulnis, den Schädlingen ausgesetzt sein. Holz ohne Würde, Holz ohne Wert. Also kämpften er und seine Brüder sich im Licht der Traktorscheinwerfer Stunde um Stunde mit der Motorsäge durch die Stämme und Äste, die den Weg blockierten. Seine Arme, sein Kreuz schmerzten. Trotzdem machte er selbst dann noch weiter, als die anderen erschöpft aufgaben. Wieder und wieder fraß sich die Säge in das frische Holz, Mal um Mal füllte er den Tank mit neuem Benzin. Am Nachthimmel blitzte es, ein Gewitter mitten im Januar. Dumpf bebte der Donner hinter der Anhöhe, begleitet vom Geräusch weiterer Motorsägen aus Richtung der Nachbarhöfe. Auch die anderen versuchten sich freizukämpfen. Seine Hände zitterten, aber er nahm es kaum wahr. Es ging nur noch darum, weiterzumachen, immer weiter.
Aus dem Dunkel trat eine bekannte Gestalt. Sie hatte eine brennende Partyfackel in der Hand. Wie auf dem Grillfest im vergangenen Sommer. Auch eine Art, sich zu helfen. Beinahe musste der Bauer lächeln. Aber er tat es nicht. Er tat es nie wieder.
»Du«, rief er über den Lärm der Säge und das Tuckern des Traktors im Leerlauf hinweg. »Steck die Fackel in den Boden und fass mit an!«
Die Gestalt kam näher und tat wie ihr geheißen, steckte die Fackel in die feuchte Erde neben der Straße. Doch dann griff sie nicht die zweite Säge, die in der Traktorschaufel lag, sondern den Benzinkanister, der ein Stück weiter auf dem feucht glänzenden Asphalt stand.
»Nimm dir die andere Säge! Treibstoff brauche ich jetzt nicht!«, rief der Bauer. »Ich habe meine vorhin erst aufgefüllt.« Wie lange war das her? Wirklich erst einige Minuten? Wie seltsam sich die Zeit doch bog und zog in dieser Nacht ohne Ende! Er wandte sich wieder seinem Baumstamm zu und setzte die Säge erneut an. Den großen, kalten Schwall Benzin auf seinem Rücken roch er, bevor er ihn spürte. Verwundert drehte er sich um. Was um alles in der Welt …?
Die zweite und dritte Ladung klatschten ihm auf die Brust und auf den Bauch. Der beißende Geruch nahm ihm den Atem. Sein Arbeitsoverall sog die Flüssigkeit auf wie ein Schwamm.
Warum zum Teufel …?
Die Augen unter der Kapuze musterten ihn kühl. Der Wind zupfte beinahe zärtlich an der blaufransigen Flamme der Fackel. Sein Gehirn verknüpfte die Informationen seines Geruchssinns erst in dem Augenblick mit der kleinen, fauchenden Flamme vor seiner Nase, als es bereits zu spät war.
Die Hand mit der Fackel stieß nach ihm.
Der Bauer fing Feuer.
Er brannte, als wäre er aus Papier.
Jetzt war er die Fackel.
Zuerst schrie er noch, brüllte seinen Schmerz in die letzten Böen hinein, doch bald schon wurden seine Schreie leiser, und auch der Wind ließ allmählich nach. Irgendwo jenseits der Straße, dort, wo einmal ein Wald, wo sein Wald gewesen war, donnerte es noch ein letztes Mal.
Dann folgte die lange Stille.
Schweden, zehn Jahre später: Montag, 7. September 2015
1
Hauptkommissarin Ingrid Nyström schwitzte in dem kühlen, engen Raum, als ginge es um ihr Leben. Und das tat es ja auch. Das Gerät zwängte ihren groß gewachsenen Körper in eine unnatürliche Haltung. Ihr Kopf wurde zur Seite gedreht, so weit, dass es wehtat, ihre Wange klebte an einer Kunststoffplatte, und ihre rechte Brust wurde von einer schraubstockartigen Apparatur zusammengedrückt. Nyström biss sich auf die Unterlippe und presste ihre feuchte Hand auf die freie Brust. Die Maschine brummte, dann klackte es mehrmals. Ein unheimliches Geräusch. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. Endlich war die Krankenschwester bei ihr und befreite sie mit energischen Handgriffen.
»Das wäre geschafft. Du kannst dich jetzt wieder anziehen und im Nebenzimmer Platz nehmen. Die Ärztin ist dann gleich bei dir, und ihr besprecht die Ergebnisse.«
Nyström nickte wortlos. Es war jedes Mal das Gleiche. Nach der Mammografie fühlte sie sich stumm und betäubt. Die Ergebnisse. Das klang so beiläufig. Nach Sportnachrichten im Radio. Nach Eishockey oder Fußball. Dabei ging es doch gar nicht um Eishockey und auch nicht um Fußball. Es ging nicht um Leichtathletik oder den Ausgang eines verdammten Pferderennens! Es ging nicht um ein Ergebnis! Es ging um ein Urteil:
Leben oder Tod.
Sie zog den BH an, das Unterhemd, ihre gute Bluse. Der Gürtel schloss ein Loch weiter als sonst. In den Tagen vor der Nachuntersuchung hatte sie kaum Appetit. Nyström sah in den Spiegel über dem Waschbecken. Ihr Gesicht wirkte schmal. Sie fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Es war noch überwiegend braun, aber es hatte im Lauf der vergangenen Jahre graue Strähnen bekommen. Sie war fünfundfünfzig Jahre alt. Ihre gleichaltrigen Freundinnen hatten Angst vor dem Älterwerden. Nyström hatte Angst vor dem Tod. Davor, dass der Krebs zurückkehrte. Als sie ihre Kurzhaarfrisur zurechtwuschelte, konnte sie ihren eigenen Schweiß riechen. Sie wünschte, dass sie an einen Deoroller gedacht hätte. Aber in solchen Dingen war sie alles andere als gut. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die immer einen passenden Lippenstift in der Handtasche hatten. Ehrlich gesagt hatte sie noch nicht mal eine richtige Handtasche, sondern einen verschlissenen Lederbeutel, den man sich über die Schulter hängen konnte. Etwas Praktisches, in dem sie ihre Akten und Butterbrotdosen transportierte.
Die Stimme der Ärztin riss sie aus ihren Gedanken. Die Frau bat sie in das Besprechungszimmer. Nyström nahm vor dem Schreibtisch Platz. Die Ärztin lächelte. Aber das musste nichts heißen. Im Krankenhaus schienen immer alle zu lächeln. Vielleicht ist das eine natürliche Reaktion, wenn man täglich mit dem Schlimmsten zu tun hat, dachte Nyström. Auf einem Leuchtkasten an der Wand hingen die Röntgenbilder ihrer Brüste. Unwirkliche weiße Schlieren auf schwarzem Grund. Die Aufnahmen erinnerten sie an Fotos eines Weltraumteleskops. Strudelförmige Sternennebel. Unendliche Weiten.
Die Milchstraße.
»Es ist so …«, hob die Ärztin an. Das Metallschildchen auf ihrem mintfarbenen Kittel verriet, dass sie Mona Nordmark hieß. Nyström erinnerte sich, den Namen bereits vor einer halben Stunde während des ersten Teils der Untersuchung gelesen zu haben, als die Ärztin ihre Brüste nach Knoten abgetastet hatte.
»… dass das bildgebende Verfahren den Eindruck bestätigt hat, den ich schon bei der manuellen …«
Sie versuchte den Worten zu folgen, aber es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren.
»… keine Hinweise auf eine Lymphstauung …«
»… jederzeit die Möglichkeit einer Magnetresonanztomografie …«
»… Restrisiko kann nie vollständig ausgeschlossen werden …«
Nyström kannte die Begrifflichkeiten, denn sie hatte sie viele Male gelesen und gehört, aber dennoch drang die Bedeutung der Sätze, die Mona Nordmarks einfühlsame Stimme formulierte, nicht in ihr Bewusstsein. Immer wieder verlor sich ihr Blick im Wust der weißen Schlieren auf den Röntgenbildern an der Wand. Das war sie, die dort zu sehen war. Wie der Blick vorhin in den Spiegel, nur tiefer. Ein Blick in ihr Inneres. Nyström schloss die Augen, ihr Herz klopfte, die Spiralnebel drehten sich. Sie dachte an ihren Mann, Anders. An ihre drei erwachsenen Töchter, Anna, Marie und Sophie. Die fünf Enkel. An ihre alte Mutter …
Nein, entschied sie. Nein. Nicht jetzt. Nicht heute und auch nicht morgen. Es war zu früh. Es war noch viel zu früh, um zu gehen.
Oder?
Sie öffnete die Augen wieder. Mona Nordmark lächelte erneut. Immer dieses Lächeln. Die junge Ärztin streckte ihr über den Schreibtisch hinweg die Hand entgegen.
»… dann sehen wir uns in sechs Monaten bei der nächsten Routinekontrolle.«
Nyström griff Nordmarks Hand und drückte sie kraftlos.
»… und noch etwas, Ingrid.«
»Ja?«
»Vergiss zwischendurch nicht zu leben!«
»Zu leben?«
»Das Leben anzunehmen! Zu genießen!«
Nordmark strahlte, als hoffte sie, Nyström mit ihrem Optimismus anstecken zu können. Sie hätte wunderbar in eine Zahncremewerbung gepasst, dachte Nyström.
»Ich werde mir Mühe geben.«
»Wir bieten hier Selbsthilfegruppen an, weißt du?«
»Danke, ich … aber …«
»Ja?«
»Ich bin bereits in einer Selbsthilfegruppe«, presste sie hervor.
Einerseits stimmte das. Andererseits wusste Nyström, dass es nicht das war, was die Ärztin meinte. Es gab in der Tat eine Therapiegruppe, die Nyström seit einem knappen Jahr besuchte. Besuchen musste. Aber diese regelmäßigen, von einem Psychologen geleiteten Treffen hatten nichts mit ihrer überstandenen Brustkrebserkrankung zu tun, sondern damit, dass sie vor elf Monaten im Einsatz einen Mann erschossen hatte. Eine Selbsthilfegruppe für Polizisten, die im Dienst getötet hatten. Eine zweite Therapiegruppe, die sich mit dem Tod beschäftigte, glaubte sie nicht verkraften zu können.
»Es geht darum, den Weg zurück ins Leben zu finden«, sagte Mona Nordmark. Sie reichte Nyström eine Broschüre.
»Ja, ich weiß«, sagte Nyström und rang sich ein Lächeln ab. In einem Krankenhaus gehörte sich das anscheinend so. »Ich gebe mein Bestes.«
Als sie die langen Flure entlang zum Ausgang ging, hätten ihre Schritte leicht und beschwingt sein sollen. Die Ergebnisse der Nachuntersuchung waren gut, nichts deutete darauf hin, dass die Krankheit zurückgekehrt war. Dennoch waren ihre Beine schwer. Draußen, vor dem Haupteingang, blieb sie stehen. Sie blickte erneut auf die Broschüre in ihrer Hand, dann warf sie sie in einen Mülleimer. Die warme Septembersonne brachte die Oberfläche des Växjösees zum Funkeln. Das Blattwerk der Bäume leuchtete in sattem Gelb und Rot. Die milde Luft roch nach Heu, reifem Obst, Mineralien. Nyström nahm die Schönheit des Augenblicks wahr, aber er berührte sie nicht. Das war traurig, und das spürte sie. Als ihr Handy klingelte und sie auf dem Display sah, dass der Anruf beruflich war, empfand sie unendliche Dankbarkeit.
2
Kommissarin Stina Forss hockte in ihrem Gemüsebeet und drosch mit einem Grubber auf das Unkraut ein. Während der drei Wochen Urlaub, von denen sie zwei auf Mallorca und eine in Berlin verbracht hatte, hatten Quecken, Giersch und Scharfer Hahnenfuß das Beet in einen Miniatururwald verwandelt und den Blattsalat sowie den Spinat unter sich begraben. Die Schnecken waren über den kümmerlichen Rest hergefallen. Das Einzige, was sie noch halbwegs retten konnte, waren eine Handvoll Zwiebeln und eine Reihe Mangold mit schlaff herabhängenden Blättern. Nach einem Sommer voller verkümmertem und wurmstichigem Gemüse waren der Salat und der Spinat, die Zwiebeln und der Mangold ihre letzte Hoffnung gewesen. Sie schleuderte den Grubber quer über den Rasen Richtung Waldrand, wo er irgendwo in den kniehohen Brennnesseln verschwand. Apropos Brennnesseln: Das war noch so ein Problem, dessen sie sich dringend annehmen musste. Bei ihrem ersten Versuch, mit einer Sense zu arbeiten, hatte sie sich einen zwanzig Zentimeter langen Schnitt zugefügt und beinahe ihre Schulter ausgekugelt. Danach hatte sie sich nicht mehr getraut, mit dem unhandlichen Mordsgerät weiterzuarbeiten. Was sie brauchte, war eine dieser elektrischen Sensen aus dem Baumarkt. Allerdings hatte sie dort in den vergangenen Monaten bereits viele Tausend Kronen ausgegeben. Für einen benzinbetriebenen Rasenmäher, Holzschutzfarbe, Gartengeräte. Vielleicht musste sie sich eingestehen, dass sie einfach keinen grünen Daumen besaß. Stadtkind Stina und ihr Traum vom Leben auf dem Land. Dabei war ihr die Idee zu Anfang vollkommen plausibel erschienen. Das Sommerhaus mit Seeblick und dem verwachsenen Garten, das sie im vergangenen Herbst von ihrem verstorbenen Vater geerbt hatte, übte einen sentimentalen Sog auf sie aus. Zudem war die Ferienwohnung im Haus ihrer Cousine, in der sie nach ihrer Ankunft aus Deutschland untergekommen war, alles andere als eine Dauerlösung gewesen. Die Nähe zu anderen Menschen, noch dazu zu Verwandten, hatte sie zu ersticken gedroht. Nach dem Tod ihres Vaters hatte sie ihr ganzes Leben auf den Prüfstand gestellt. Sie hatte vor der Wahl gestanden, ihre alte Stelle bei der Mordkommission in Berlin wieder anzutreten oder das fortzusetzen, was sie sich in zweieinhalb Jahren in Växjö aufgebaut hatte: eine Karriere bei der schwedischen Polizei in einer mittelgroßen Provinzstadt in Småland, im ländlichen Schweden, das so weitläufig war und doch so eng sein konnte, dass ihr mitunter die Luft zum Atmen wegblieb. Dieses Land ihrer Kindheit, das zwar in vielerlei Hinsicht liberal und fortschrittlich daherkam, das ihr aber auch mindestens genauso oft genormt und langweilig, mitunter gar spießig erschien. Sie hatte sich entschieden zu bleiben, und bei dieser Entscheidung hatte das ehemalige Sommerhaus ihres Vaters eine wichtige Rolle gespielt. Wahrscheinlich weil es ihr genau die Geborgenheit und die Nestwärme gab, die sie sich von ihrem Vater immer gewünscht hatte. Um den Zusammenhang zu verstehen, musste sie wirklich keine Psychologin sein.
Vor einem Dreivierteljahr war sie eingezogen. Das Haus lag abgelegen, nicht weit von der kleinen Ortschaft Väckelsång, etwa fünfunddreißig Kilometer südlich von Växjö. Nachbarn gab es keine. Dass ein Haus im Grünen jedoch nicht nur ein reines Idyll war, hatte Forss auf die harte Tour lernen müssen. Der Frost im November hatte bald gezeigt, dass die kleinen elektrischen Heizungen zu leistungsschwach waren, um das Holzhaus im Winter warm zu halten. Für viel Geld hatte sie eine moderne Heizungsanlage einbauen lassen müssen. Im Januar war wegen der Winterstürme und der umgekippten Bäume, die auf die Oberleitungen gefallen waren, mehrmals für einen oder zwei Tage der Strom ausgefallen, woraufhin der Zulauf zur Wasserpumpe eingefroren und geplatzt war. Nach dem Tauwetter im März hatte der Keller unter Wasser gestanden. Wenigstens hatte sie viel gelernt: über Erdwärmeanlagen und Pelletsbrennöfen, über Dieselgeneratoren und Klärgruben, über Grundwasserpumpen und Thermoverglasung. Im April war es warm genug gewesen, um die alten Fenster gegen eine Doppelverglasung auszutauschen. Danach beliefen sich ihre Schulden auf sechshunderttausend Kronen.
Aber es hatte auch die schönen Momente gegeben: Sie hatte von ihrem Schlafzimmerfenster aus eine Elchkuh mit ihren zwei Jungen beobachtet, die im Morgennebel am Seeufer getrunken hatten. Einen Waldkauz entdeckt, der in der toten Espe am Waldrand brütete. Ein Gartenfest mit den Kollegen veranstaltet. Das Haus ihres Vaters war ihr ans Herz gewachsen. Es war ein Vermächtnis, das sie annehmen konnte. Trotz der Narben auf ihrem Hals und des hängenden Augenlids, beides Zeugnisse jener Nacht vor knapp dreißig Jahren, in der ihr Vater seine Selbstkontrolle und Güte verloren hatte.
Sie beschloss, das Gemüsebeet für diese Saison aufzugeben. Drei Wochen Pflegeentzug waren nicht wieder aufzuholen. Einige Zwiebeln und ein Bund Mangold reichten, zusammen mit den Erbsen, die sie noch in der Tiefkühltruhe hatte, für eine einfache Gemüsesuppe zum Mittag. Vorher wollte sie schwimmen gehen. Obwohl es bereits September war, zeigte das alte, rostige Thermometer am Geräteschuppen über zwanzig Grad. Sie trabte über den Rasen zum Steg, streifte sich die verschwitzte Gartenkleidung und die Unterwäsche vom Körper und sprang kopfüber in das dunkle Wasser. Eine Ente beschwerte sich schnatternd. Am anderen Ufer flogen zwei Reiher auf. Das kühle Wasser brachte ihren Kreislauf in Wallung. Alles kribbelte. Ein überaus körperliches Gefühl. Kurz musste sie an Javier denken, den gut aussehenden Kellner aus Santa Margalida. An Henry, den Engländer, den sie in einer Bar in Palma kennengelernt hatte. An Alexander aus dem Technoklub am Spreeufer. Drei Männer in drei Wochen. Mehr als in zweieinhalb Jahren Schweden. Sagte das etwas über dieses Land? Oder über sie? Vermutlich beides. Oder gar nichts. Sie ließ sich auf dem Rücken treiben, eine Hand auf ihrem Geschlecht. Hoch über ihr kreisten die Reiher. Ich bin hier zu Hause, dachte sie, ich bin endlich irgendwo zu Hause. Ihre Gedanken trieben wie ihr Körper mit der leichten Strömung des Sees. Zu Hause. So hatte es sich angefühlt, als sie gestern den Koffer über die Schwelle der Haustür gewuchtet hatte. Der würzige, ein wenig verstaubte Geruch des alten Hauses war ihr vertraut vorgekommen.
Ein Stück neben ihr im Wasser platschte es.
Ein Fisch.
Ein Geräusch.
Ein Déjà-vu?
Die Erinnerung kam unvermittelt. Trotz des innigen Gefühls der Geborgenheit war da gestern etwas gewesen, als sie wieder nach Hause gekommen war, eine leichte Irritation, ein Jucken am Rande ihres Bewusstseins, ein Zucken wie der Schlag einer Schwanzflosse im Wasser. Sie hatte es auf ihre Müdigkeit geschoben, auf die Strapazen der langen Zugfahrt, auf die Nachwirkungen der Ecstasy-Pille, ihren verkaterten Verstand und die durchtanzte und durchliebte Nacht …
Aber warum kehrte die Empfindung jetzt und hier zurück?
Als Echo?
Als Ahnung?
Als machte ihr Gehirn einen Salto rückwärts und dann wieder nach vorn. Sie trieb mit geschlossenen Augen im Wasser und erinnerte sich, sah die Bilder klar und deutlich vor sich: Das Muster des Staubs auf ihrem Nachttisch. Die Anordnung der Sockenpaare in ihrer Kleiderschrankschublade. Die Richtung, in die der Kaffeelöffelstiel gewiesen hatte. Ein Hauch Rasierwasser in der Luft.
Als wäre jemand während ihrer Abwesenheit in ihrem Haus gewesen.
Sofort fröstelte sie, das Wasser erschien mit einem Mal kalt. In der Tasche ihres Jeansrocks, den sie auf einen Gartenstuhl gelegt hatte, klingelte ihr Handy.
3
Hauptkommissarin Ingrid Nyström bog mit ihrem kleinen Toyota von der L23 ab und folgte der einspurigen Straße etwa fünfzehn Kilometer. Sie verlief in engen Kurven zwischen dichten Fichtenwäldern, niedrigen Birkenhainen, Seen und Sümpfen. Ihr Kollege Hugo Delgado hatte ihr den Weg am Telefon beschrieben. An einem umgekippten Jagdstand lenkte sie den Wagen rechts auf einen schmalen Schotterweg. Sie passierte hohe Kiefern, Wälle aus wilden Himbeerbüschen, Tannen und mächtige Steinbrocken, die seit der Eiszeit dort lagen. Die Schotterpiste hob und senkte sich, wand sich in scharfen Kurven, schlug abrupte Haken. Obwohl sie nicht schnell fuhr, kam sie zweimal beinahe von der Straße ab. Kleine Steinchen prasselten an die Kotflügel. Bei Schnee muss es hier gefährlich sein, dachte sie. Noch ein Hügel, noch eine Kurve, dann war sie da.
Ihr erster Eindruck: Es schneite. Aber das konnte natürlich nicht sein. Die Sonne schien, es war Spätsommer. Dann begriff sie: Was da langsam zu Boden rieselte und auf der Windschutzscheibe ihres Autos landete, war kein Schnee, sondern feine weiße Asche. Sie stellte das Auto ab und stieg aus. Vor ihr standen drei mächtige Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, die einen schwarzen, feuchten Trümmerhaufen flankierten, aus dem Rauchfahnen emporstiegen. Daneben hielten ein Streifenwagen der Polizei, der VW-Transporter der Spurensicherung und einige zivile Fahrzeuge. Ein Stück abseits der umhereilenden Feuerwehrmänner entdeckte sie ihre Mitarbeiter Hugo Delgado, Lars »Lasse« Knutsson, Stina Forss und den neuen Kollegen, Kent Vargen, der sich durch seinen schicken Zweiteiler deutlich von allen anderen Anwesenden abhob. Wie sehr sich ihre Abteilung in den vergangenen Jahren doch verändert hatte, dachte sie flüchtig. Sie war Chefermittlerin, seit ihr ehemaliger Vorgesetzter wegen eines Unfalls in Frühpension gegangen war. Nyström hatte seinen Posten übernommen und war zur Hauptkommissarin befördert worden. Kurz danach war Stina Forss zur Gruppe gestoßen. Im vergangenen Monat hatte sich der talentierte Ermittler Göran Lindholm überraschend auf eine Stelle in Nordschweden beworben und um Versetzung gebeten. Wenigstens hatte die Behörde in Stockholm für einen sofortigen Ersatz gesorgt und einen erfahrenen Mitarbeiter aus der Hauptstadt geschickt. Kent Vargen würde bis auf Weiteres ihr Team verstärken. Zeitgleich war Nyströms langjährige Kollegin Anette Hultin in Mutterschutz gegangen. Deswegen hatte die Hauptkommissarin, nachdem sie von dem Verdacht auf ein tödliches Gewaltverbrechen erfahren hatte, Stina Forss kurz entschlossen gebeten, ihren Urlaub um einige Tage zu verkürzen. Offensichtlich hatte Forss alles stehen und liegen lassen und war sogar noch vor ihr am Tatort angekommen. Hugo Delgado wirkte ungeduldig, Kent Vargen konzentriert. Der bärenhafte Lasse Knutsson wurde wie so häufig rot, wenn sie ihn berührte. Nyström fiel auf, dass Stina Forss nasse Haare hatte. Ihre Sommersprossen leuchteten noch stärker als sonst.
»Wie war es auf Ibiza?«, fragte sie die Deutschschwedin.
»Mallorca.«
»Ach ja.«
»Danke, gut. Superwetter.«
»Und hier schneit’s«, versuchte sich Nyström an einem Scherz und zupfte sich eine Ascheflocke aus dem Haar. »Danke, dass du deinen Urlaub so plötzlich abgebrochen hast.«
»Keine Ursache.«
Forss lächelte schief.
»Fertig mit dem Small Talk?«, drängte Delgado. »Ich fürchte nämlich, wir haben einiges zu tun.« Er trat von einem Bein aufs andere, ein sicheres Zeichen dafür, dass er angespannt war. »Heute Nacht gegen 4.30 Uhr haben die Nachbarn den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.«
»Nachbarn? Hier draußen?«
»Die nächsten wohnen etwa zwei-, dreihundert Meter von hier, drüben, hinter der Hügelkuppe.«
»Ein Bauernhof«, warf Kent Vargen ein. Er schaute auf seinen Notizblock. »Die Familie heißt Karmfalk. Sie sind von einem lauten Knall geweckt worden und haben dann den Schein der Flammen gesehen. Das Feuer muss meterhoch gebrannt haben.«
»Über die Zeugen können wir später noch reden«, unterbrach ihn Delgado. »Wichtig ist doch erst einmal, was überhaupt passiert ist.«
»Was ist denn überhaupt passiert?«, beeilte sich Nyström zu fragen. Delgado war seit einiger Zeit auffallend gereizt. Genau genommen seit der Hochzeit und Schwangerschaft ihrer gemeinsamen Kollegin Anette Hultin. Delgado und Hultin waren früher einmal ein Paar gewesen, doch nach mehreren Trennungen, Versöhnungen und erneuten Trennungen hatte Hultin im Frühjahr einen anderen geheiratet. Trotzdem konnte Nyström seine Angespanntheit nur zum Teil nachvollziehen. Sie erinnerte sich, dass er zu einem Grillfest im Sommer ebenfalls mit einer neuen Partnerin erschienen war.
»Ein Mord, das ist passiert!«, schnaufte Lasse Knutsson. Wie so oft war der beleibte, große Mann kurzatmig. Das warme Spätsommerwetter machte ihm sichtlich zu schaffen, sein bärtiges Gesicht glänzte vor Schweiß. »Die Leiche liegt dort drüben zwischen den Trümmern.«
Er stapfte durch das hohe Gras zum Fundort, die anderen folgten ihm. Nyström nahm erst jetzt die Dimensionen der rauchenden Ruine wahr. Das Haus musste eine stattliche Größe gehabt haben. Wie das Herrenhaus eines ehemaligen Gehöfts.
»Warum geht ihr davon aus, dass es sich hier um ein Tötungsdelikt handelt?«, fragte sie. »So ein Brand kann doch viele mögliche Ursachen haben. Was spricht gegen einen Unfall?«
»Schau es dir an«, sagte Delgado.
Sie gingen einige Schritte weiter, dann sah sie, was Delgado meinte.
Der Leichnam hatte kaum noch etwas Menschliches an sich, dennoch war unverkennbar, dass der schwarze, deformierte Körper mit dem fratzenhaften Kopf einmal ein Mensch gewesen war. Nyström musste an die ausgemergelten Skulpturen des Bildhauers Giacometti denken. Nur, dass dies hier kein Kunstwerk war. Im Unterleib des verkohlten Leichnams steckte der dreizinkige Metallaufsatz einer Mistgabel. Die rußigen Zinken steckten tief in dem verbrannten Fleisch, vom Holzschaft war nichts mehr zu sehen, er war verbrannt.
»Oh«, entfuhr es ihr.
»Nicht wahr?«, sagte Delgado trocken.
Knutsson schüttelte wortlos den schweren Kopf.
»Wem gehörte das Haus?«, fragte Nyström.
Vargen blätterte in seinem Block.
»Einem Ehepaar, Leif und Kristina Asker. Norweger.«
»Also war es ein Ferienhaus?«
»Ganz schön groß für ein Ferienhaus, aber die Nachbarn sagen Ja. Die Askers haben den ehemaligen Hof vor etwa anderthalb Jahren gekauft, waren aber wohl nur selten hier.«
»Und gestern?«
Vargen schüttelte den Kopf.
»Bemerkt haben die Karmfalks in den letzten Tagen und Wochen niemanden. Sie sagen, dass sie die Askers zum letzten Mal im Juli gesehen haben.«
»Das muss allerdings nichts heißen«, wandte Forss ein. »Direkten Sichtkontakt gibt es nicht. Und der Karte nach geht der Weg auf der anderen Seite des Hügels weiter und führt in einem Bogen zurück zur Landstraße. Die Karmfalks kommen also aus der Siedlung weg, ohne dass sie am Haus der Askers vorbeimüssen.«
»Und umgekehrt«, bemerkte Delgado.
»Jedenfalls hat hier schon lange niemand mehr den Rasen gemäht«, stellte Knutsson fest und köpfte mit einem Tritt eine wild wachsende Margerite.
»Gibt es noch andere Nachbarn?«, fragte Nyström.
»Der Knecht der Karmfalks wohnt hier in der Nähe. Ola Danlid«, las Vargen aus seinem Notizblock vor. »Wie soll ich sagen … ein sehr wortkarger Kerl.«
Knutsson grinste und drehte zur Bekräftigung eine imaginäre Schraube an seiner Schläfe.
»Ein Einfaltspinsel.«
Nyström sah Knutsson mahnend an, und zu Vargen gewandt sagte sie: »Ich glaube, man sagt heute nicht mehr Knecht, sondern landwirtschaftlicher Betriebshelfer.«
Knutsson grinste noch breiter.
»Jedenfalls wusste der Betriebshelfer von nichts. Die Askers kannte Danlid kaum«, beeilte sich Vargen zu sagen. »Es gibt noch mehrere Häuser in der Umgebung, aber dort haben wir noch niemanden befragt.«
»Danke«, sagte Nyström. »Das war bis hierhin ordentliche Arbeit.«
»Wo warst du überhaupt den ganzen Vormittag?«, fragte Delgado.
»Termine«, antwortete Nyström schnell. Sie schloss die Augen, öffnete sie wieder und spürte den warmen Wind in ihrem Gesicht. Er zupfte an den Blättern der jungen Birken. Es roch nach Asche und Grillfleisch. Ihr Magen tat einen Satz. Sie konnte sich gerade noch umdrehen und drei schnelle Schritte gehen, dann erbrach sie die Reste ihres Frühstücks in einen Hagebuttenbusch.
4
Stina Forss verweilte einen Moment länger als die anderen bei dem Opfer. Sie brauchte das. Sie mochte das. An einem Tatort allein zu sein. Die Umgebung, die Atmosphäre mit allen Sinnen aufzunehmen, zu spüren. Sie kniete sich neben den verbrannten Leichnam. Neben das, was von dem Menschen übrig geblieben war. Forss sog den kaum zu ertragenden Geruch von feuchter Asche und versengtem Fleisch ein. Sie zog einen Gummihandschuh über und legte vorsichtig die Hand auf den Leichnam. Dorthin, wo vor wenigen Stunden noch das Herz eines Menschen geschlagen hatte. Das Herz gab es nicht mehr, genauso wenig den Menschen. Dies hier war nur noch ein großes Stück Kohle mit vagen menschlichen Konturen. Der Leichnam war noch warm, aber es war nicht die Wärme des Lebens, die in ihm steckte, sondern der Atem des Feuers, das ihn verschlungen hatte.
Ein Mensch tötet einen anderen Menschen mit einer Mistgabel, dachte sie. Er spießt ihn auf, durchbohrt ihn. Kraftvoll. Wütend. Hasserfüllt. Danach verbrennt er ihn. Will er ihn nicht mehr sehen? Hält er dem Anblick nicht stand? Oder will er seine Tat verbergen? Aber warum zieht er dann nicht die verräterische Waffe aus dem Körper seines Opfers? Oder möchte er dem Toten eine besondere Ehre erweisen? Eine Art Ritual, eine Feuerbestattung? Verrate es mir, wisperte sie, verrate mir, was dir geschehen ist. Doch natürlich bekam sie keine Antwort. Sie hörte nur das Stimmengewirr der anderen und das Zwitschern der Vögel im nahen Wald. Sie richtete sich aus der Hocke auf. Kurz war ihr schwindelig, und in ihren Ohren rauschte es. Ich bin völlig außer Form, dachte sie. Drei Wochen ohne Joggen und das Boxtraining, das sie im Frühjahr begonnen hatte, stattdessen jeden Urlaubsabend Longdrinks. Der attraktive Kellner aus Mallorca hatte außerdem immer ein bisschen Gras dabeigehabt. Und dann war da ja noch die Technonacht auf Ecstasy gewesen. Definitiv zu viel Chemie in ihrem Körper. Sie betrachtete den Ruß auf ihrem Handschuh. Dies war die Chemie des Todes.
5
Ingrid Nyström hatte sich in einer der Kabinen der Damentoilette im obersten Stock des Präsidiums eingeschlossen. Mit den Handballen massierte sie ihre Schläfen. Kopfschmerzen konnte sie jetzt nicht gebrauchen. Vielleicht hatte sie zu wenig getrunken. Und das wenige wieder erbrochen, peinlicherweise. Zum Glück war ihr Vorgesetzter Edman nicht dabei gewesen. Trotzdem war es ihr sehr unangenehm. Was gab sie als Chefin für ein schlechtes Bild ab! Der neue Kollege, Kent Vargen, hatte sie mit einem merkwürdigen Blick gemustert, das war ihr nicht entgangen. Knutsson war puterrot geworden. Wenigstens hatte Delgado so stoisch weitergemacht, als wäre nichts geschehen. Genau wie Forss. Die Deutschschwedin hatte diese Entrücktheit ausgestrahlt, die sie an Tatorten so oft umhüllte.
Nyström wühlte in den Untiefen ihres Beutels nach einem Bonbon. Sie hatte noch immer einen unangenehmen Geschmack im Rachen. Ein beiläufiger Blick auf das Handy zeigte ihr, dass sie mehrere SMS von ihren Töchtern bekommen hatte. Natürlich wollten sie wissen, wie die Nachuntersuchung gelaufen war. Dennoch spürte Nyström Wut in sich aufsteigen. So etwas fragte man doch nicht per SMS! Sie drückte die Meldungen ungelesen weg und steckte das Handy zurück in den Beutel. Ihre Suchaktion förderte endlich ein klebriges Zitronenbonbon zutage. Dankbar wickelte sie es aus und steckte es sich in den Mund.
6
Als sich alle im Besprechungszimmer des Präsidiums zusammensetzten, war der Nachmittag bereits weit fortgeschritten. Irgendjemand hatte aus der Kantine einen Teller trockener Zimtschnecken mitgebracht, doch bis auf Knutsson, der beherzt zugriff, blieben alle bei Kaffee.
»Mmmh, so gesund!«, ätzte Delgado, aber Knutsson ignorierte den Kommentar und kaute bedächtig weiter.
Anette Hultin hätte ihm Kontra gegeben, dachte Stina Forss, sie hätte wahrscheinlich gleich einen ganzen Vortrag über die wunderbare Backtradition der schwedischen Küche gehalten. Aber Hultin war nicht da, genauso wenig wie Göran Lindholm, den es zu seiner Freundin nach Umeå verschlagen hatte. Was man nicht alles für die Liebe zu tun bereit war. Växjö war in ihren Augen ja schon am Rand der Welt. Aber Umeå …? Schade, sie hatte den lustigen, jungen Kerl mit der Streberbrille immer gemocht. Sein Nachfolger Kent Vargen war etwa vierzig, hatte ein kluges, offenes Gesicht, eine tiefe Stimme und dunkles, struppiges Haar. Für einen Mann war er nicht besonders groß, aber immer noch größer als sie mit Pumps. Was allerdings auch nicht viel heißen mochte, denn sie selbst war gerade mal eins sechzig. Er wirkte freundlich, aber es hatte auch etwas Arrogantes, wie er da in seinem Anzug saß, das Jackett leger geöffnet, das Schulterholster auf amerikanische Art über dem weißen Hemd tragend, weit im Stuhl zurückgelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt. Allein schon die Tatsache, dass er als Polizist einen Anzug trug. Als wären wir hier in einem Kinofilm, dachte sie. Mein lieber Freund, du wirst schon schnell genug dahinterkommen, dass wir hier nicht in New York sind, sondern in Fucking Växjö City.
FVC statt NYPD.
Bo Örkenrud, der Chef der Spurensicherung, sprach als Erster. Er hatte Rußspuren im Gesicht.
»Wie ihr euch denken könnt, ist die Spurenlage am Tatort ein Albtraum. Dem wenigen, was nicht verbrannt ist, haben die Löschmittel der Feuerwehr den Rest gegeben. Das ist zumindest unser erster Eindruck, und ich bin nicht besonders optimistisch, dass sich das noch ändern wird.« Der ehemalige Eishockeyspieler rieb sich die Wange, was den Ruß noch weiter in seinem Gesicht verteilte. »Der einzige konkrete Hinweis auf die näheren Umstände des Verbrechens kommt deshalb auch gar nicht von uns, sondern von der Feuerwehr. Einsatzleiter Wiman ist sich sicher, dass der Brand mit Absicht gelegt worden ist.«
»Brandstiftung?«, fragte Nyström.
Örkenrud nickte.
»Es wurden mehrere ausgebrannte Metallkanister sichergestellt. Außerdem muss an den Wänden des Hauses eine große Menge Brennholz gestapelt gewesen sein. Dreißig Kubikmeter, hat Wiman geschätzt. Er habe so etwas vorher noch nie bei einem Hausbrand gesehen, hat er gesagt. Diese Menge an heller Asche erinnere ihn an den Brand des Holzlagers in der Nähe von Alvesta vor einigen Jahren.«
»Dreißig Kubikmeter?«, fragte Knutsson ungläubig. »Das reicht ja für Jahre zum Heizen.«
»Genau das hat Wiman auch gesagt. Die Hitzeentwicklung war so immens, dass sogar einige Heizkörper geschmolzen sind.«
»Wahnsinn«, sagte Knutsson leise.
»Warum macht man denn so etwas?« Delgado rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum.
Vielleicht weil man seine Spuren verwischen will, dachte Forss.
»Weil man seine Spuren verwischen will«, sagte Vargen.
»Oder es war ein Scheiterhaufen oder so etwas in der Art!«, schlug Knutsson vor.
»Ja klar, Lasse. Die småländische Inquisition, oder was?«, feixte Delgado.
Vargen lachte, Knutsson wurde rot. Zum dritten Mal an diesem Tag. Delgado zwinkerte Vargen zu. Da haben sich ja zwei gefunden, dachte Forss.
»Können wir bitte sachlich bleiben?«, fragte Nyström genervt. Mit einer Handbewegung forderte sie Örkenrud auf, mit seinen Erläuterungen weiterzumachen.
»Wir konnten uns bis jetzt auch noch keinen Reim darauf machen, was die Besitzer mit so einer Riesenmenge Brennholz vorhatten, vor allem, wenn sie das Haus überwiegend im Sommer nutzen wollten. Auf jeden Fall schlägt Wiman vor, Fotos von dem abgebrannten Haus an Experten in den USA zu schicken. Er war vor Kurzem auf einer internationalen Tagung und meinte, dass die Amis uns bei der Brandforensik um Jahre voraus seien. Die hätten eine regelrechte Wissenschaft daraus gemacht. Aber vielleicht ist das Horten von Holzvorräten ja auch bloß eine norwegische Eigenart.«
Jetzt war es Knutsson, der dröhnend lachte.
»Ich kannte mal einen Norweger, der einen Lachs fangen wollte …«, begann er, aber Nyström fiel ihm ins Wort.
»Sag Wiman, er soll das mit den Fotos gern versuchen. Ich bin für alles dankbar, was uns weiterhelfen könnte. Weiß Ann-Vivika schon etwas über die Leiche?«
»Ich habe eben mit der Pathologie telefoniert. Sie arbeitet noch dran. Besonders zuversichtlich klang sie allerdings nicht. So wie der Körper verbrannt war … Wahrscheinlich müssen wir auf die DNA-Ergebnisse aus Linköping warten, um wenigstens das Geschlecht des Toten zu erfahren«, sagte Örkenrud.
»Was ist mit den Zähnen?«, fragte Knutsson, während er von der zweiten oder dritten Zimtschnecke abbiss. »Man kann jemanden doch anhand der Zähne identifizieren. Wie in dem Estonia-Fall im vergangenen Jahr.«
»Ann-Vivika sagt, dass wir damit wahrscheinlich kein Glück haben werden, weil …« Örkenrud zögerte.
»Warum?«, fragte Knutsson mit vollem Mund.
»Nun ja, ab einem bestimmten Hitzegrad gibt es bei Zähnen den sogenannten Popcorneffekt …«
»Danke«, sagte Nyström, »so genau wollten wir es gar nicht wissen.«
»Aber das ist alles wissenschaftlich belegt«, wehrte sich Örkenrud.
Knutsson war blass um die Nase geworden und legte sein angebissenes Gebäckstück zurück auf den Teller. Delgado und Vargen grinsten unisono.
»Was gibt es bis jetzt aus Norwegen?«, fragte Nyström.
»Ich habe mit der Polizei in Gjerdrum telefoniert«, sagte Delgado. »Ein kleiner Ort nicht weit von Oslo. Da sind die Askers gemeldet. Und jetzt passt auf: Vor drei Jahren war die Frau in eine polizeiliche Untersuchung verwickelt und wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Versicherungsbetrug angeklagt. Sie ist dann vor Gericht mit einer Bewährungsstrafe davongekommen.«
»Das ist doch schon mal ein Anfang«, meinte Nyström.
»Die norwegischen Kollegen sind so nett und wollen sich in der Nachbarschaft umhören und uns natürlich auch die Akten vom Gerichtsprozess zukommen lassen.«
»Danke.«
Nyström kratzte sich mit einer Stiftkappe gedankenverloren an der Stirn.Versicherungsbetrug? schrieb sie an das Whiteboard, das ansonsten so gut wie leer war. Brandstiftung stand da noch in Nyströms sauberer Mädchenschrift. Daneben: Leif und Kristina Asker.
»Was seht ihr denn für ein Szenario vor euch?«, fragte sie.
»Ich glaube nicht an einen Versicherungsbetrug. Eher ein Ehedrama«, antwortete Knutsson mit Bestimmtheit.
»Sicher keine Hexenverbrennung?«, frotzelte Delgado.
»Hugo, es reicht jetzt«, ermahnte Nyström ihn.
»Ich glaube ebenfalls, dass es sich bei dem Opfer um einen der Askers handelt«, sagte Vargen. »Eine Beziehungstat liegt auf der Hand. Obwohl das mit dem vielen Brennholz natürlich seltsam ist. Aber Menschen tun manchmal seltsame Dinge. Vor allem nach vielen Ehejahren.«
Delgado lächelte, dann wurde er wieder ernst.
»Wenn jemand ein ganzes Anwesen ansteckt, nur um eine Leiche zu verbrennen, drückt das schon etwas aus, finde ich. Eine Vernichtungsfantasie. Außer Familiendramen gibt es ja noch andere Arten von Hassverbrechen. Ich denke da zum Beispiel an brennende Asylantenheime. Vor einigen Jahren hat doch in …«
»Weiße Norweger mit Ferienhaus sind nicht gerade eine diskriminierte oder verfolgte Minderheit«, sagte Nyström.
»Wer sagt denn, dass sie weiß sind? Ich bin auch nicht weiß«, entgegnete Delgado, dessen Eltern in den Siebzigerjahren als politische Flüchtlinge aus Chile eingewandert waren.
»Du heißt aber auch Hugo Gonzales Delgado und nicht Leif Asker«, sagte Knutsson.
»Gonzales?«, fragte Vargen. »Im Ernst?«
»Mein Zweitname«, sagte Delgado zerknirscht. »Aber so nennt mich niemand.«
Knutsson grinste triumphierend.
»Wenn man sich die Ruine anschaut, könnte man wirklich an eine Hasstat denken«, sagte Örkenrud. »Das mit der Mistgabel im Bauch geht ja auch in diese Richtung.«
»Wir müssen erst einmal mehr über diese Askers erfahren«, stellte Nyström fest. »Was sind das für Leute? Warum hatten sie hier in Schweden ein so großes Haus? Was hatte es mit dieser Betrugssache auf sich? Sind sie in weitere kriminelle Machenschaften verwickelt? Gab es deswegen vielleicht sogar einen Beziehungskonflikt? Oder was denkst du, Stina?«
»Sicher«, antwortete Forss zögernd und zupfte sich an der Unterlippe. »Mehr zu wissen, schadet ja nie.«
»Aber?«, fragte Vargen und stützte sich mit den Ellbogen auf die Tischplatte. Eine herausfordernde Geste, wie Forss fand.
»Nichts. Kein Aber«, sagte sie und ließ ihre Lippe los. »Wir sollten uns ausführlich mit den Kollegen in Oslo unterhalten.«
»In Gjerdrum«, korrigierte Delgado.
»Okay«, sagte Nyström. »Wer kümmert sich darum?«
Forss und Vargen hoben gleichzeitig die Hand.
»Ladies first«, sagte Vargen mit gespielter Galanterie in der Stimme.
Nyström nickte Forss zu.
»Okay, Stina also. Dann möchte ich, dass hier jemand mit dem Makler spricht, der den Askers das Haus verkauft hat. Wer übernimmt das?«
Wieder meldete sich Vargen.
»In Ordnung, Kent. Außerdem möchte ich ausführliche Gespräche mit allen Nachbarn im Umkreis von drei Kilometern führen.«
»Hier im Revier?«, fragte Knutsson und zog eine Augenbraue hoch. Eine Marotte, die er sich vor einigen Monaten angewöhnt hatte. Forss hatte schon häufiger beobachtet, wie Knutsson vor dem Computer saß und seine Augenbrauen verzweifelt Lindy Hop tanzten. »Na, die werden sich bedanken.«
»Nein, natürlich nicht hier im Revier. Vor Ort. Und wir befragen auch alle Anwohner der Zufahrtsstraßen.«
»Das ist ein ziemlicher Haufen«, stellte Knutsson fest.
»Du bist ein ziemlicher Haufen«, sagte Delgado.
Knutsson schnappte sich eine weitere Zimtschnecke und drohte mit einer ausholenden Geste, sie Delgado an den Kopf zu werfen.
»Erbarmen!«, sagte Delgado.
Knutsson grunzte zufrieden.
»Ihr beide macht das morgen als Team«, sagte Nyström, bevor sie aufstand und sich dem Whiteboard zuwandte.
Wie die Kinder, dachte Forss, und vermisste Anette Hultins trockene Art jetzt schon.
7
Als Ingrid Nyström nach Hause in die kleine Ortschaft Ör fuhr, die etwa zwanzig Kilometer nördlich von Växjö am weitläufigen Helgasee lag, war es bereits Abend. Der Sonnenuntergang färbte die wenigen Wolken am Himmel orange, dann rot und schließlich violett. Der See neben der Straße spiegelte das dramatische Farbenspiel. Nyström spürte, dass sie empfänglich für dieses Pathos war. Die Taubheit, die sie am Morgen während der Nachsorgeuntersuchung empfunden hatte, war einer merkwürdigen Empfindsamkeit gewichen.
Sie dachte an ihren Mann Anders. Sie sehnte sich nach ihm. Nach seiner Nähe, seiner Wärme, seinem Geruch. Nach einem Tag wie diesem gab er ihr den Halt, den sie brauchte.
Mit der Brustkrebserkrankung hatte das Fundament, auf dem ihr Leben baute, Risse bekommen. So fühlte es sich zumindest viel zu oft an, und ohne Anders hätte sie nicht gewusst, wie sie die Zeit überstanden hätte.
Überstand.
Überstehen würde.
So oft war die Rede davon, die Krebskrankheit bekämpfen zu müssen, als wäre sie ein Feind und kein Zustand in ihr. Immerzu wurde von ihr verlangt, stark zu sein, nicht aufzugeben und immer weiterzukämpfen. Nie war sie gefragt worden, wer sie war, wenn sie nur schwach sein wollte. Anders war Pfarrer. Vielleicht hatten ihm seine Erfahrung und sein Glaube geholfen, als er zusehen musste, wie sie sich dem Krebs stellte. Selbstverständlich hatte sie sich der schulmedizinischen Behandlung untergezogen, war den Anweisungen der Ärzte aufs Wort gefolgt, hatte alle Medikamente geschluckt und immer brav alles aufgegessen, obwohl ihr selten danach gewesen war. Dennoch gab es immer wieder Momente, in denen sie sich den Tumorzellen hilflos ausgeliefert fühlte. Heute Morgen war so ein Moment gewesen. Sie war das Starksein so leid. Da konnten die Ärzte und Psychologen sagen, was sie wollten. Ihr kluger Mann hatte ihr in den letzten Jahren nicht nur geholfen, stark zu sein. Er hatte ihr erlaubt, schwach zu sein. Hatte sie aufgefangen, damit sie loslassen, den Gefühlen einen Raum geben konnte, die sich in ihr aufgestaut hatten: Trauer, Angst, Schwäche, Wut, Frustration.
Nyström dachte an die Ergebnisse der Nachuntersuchung. Wieder hatte sie Glück gehabt. Ihr Schicksal meinte es noch eine Weile gut mit ihr. Vielleicht ging es im Leben genau darum. Um eine Weile. Den Moment. Das Hier und Jetzt. Auch wenn es wie ein Kalenderspruch klang. Sie musste lächeln, wenn auch nur kurz. Ein Schlager von Helen Sjöholm erklang im Radio, und Nyström summte mit.
Du bist mein Mann …
Jetzt und hier, in diesem Moment, brauchte sie allen Kitsch der Welt, denn jetzt und hier, in diesem Moment, lag die Krankheit hinter ihr. Für eine Weile.
8
Stina Forss räumte die Einkäufe in den Kühlschrank und in die Regale. Dann schob sie eine Tiefkühlpizza in den Ofen. Im Urlaub hatte sie sich vorgenommen, ihre Ernährung umzustellen: mehr Obst und Gemüse, viel frischen Fisch, nur noch Vollkornprodukte und weniger Zucker. Aber das war im Urlaub gewesen. Die Realität sah anders aus. Kein Mensch hatte nach zehn Stunden Arbeit noch die Muße, für sich allein zu kochen, kein normaler Mensch jedenfalls. Außerdem mochte sie Tiefkühlpizza. Mit etwas Großzügigkeit gingen die Zwiebelringe vielleicht als Gemüse durch. Den schlaffen Mangold warf sie in den Müll. Sie schlang die heiße Pizza hinunter. Wie immer, wenn sie Tiefkühlpizza aß, verbrannte sie sich dabei den Gaumen. Forss drückte so lange mit der Zungenspitze auf die Brandblase, bis sie platzte. Der Schmerz ist eine gerechte Strafe für das Fast Food, dachte sie. Dann kam ihr die Erinnerung an das seltsame Gefühl, das sie heute Morgen beim Schwimmen verspürt hatte. Das Gefühl, dass jemand in ihrer Abwesenheit in ihrem Haus gewesen war. Den ganzen Tag über war es immer wieder aufgetaucht. Vielleicht wirst du ja langsam paranoid, dachte sie. Vielleicht tut dir das einsame Wohnen hier draußen gar nicht gut. Ihre Zunge zerrte an den Hautfetzen an ihrem Gaumen. Oder …? Eigentlich betrog sie ihre Intuition selten. Was, wenn wirklich jemand hier gewesen war? Ein unerträglicher Gedanke. Forss brauchte Gewissheit. Sie stand auf und ging in den Keller. Unten machte sie das Licht an. Die Fenster waren sorgfältig verschlossen. Der neue Heizbrenner brummte leise vor sich hin. In der Ecke mit den Streusalzsäcken raschelte es leise, dann war es wieder still. Zogen schon die Wintermäuse ein? Draußen war es doch dafür noch viel zu warm. Auf der Leine hing Wäsche, die sie gestern nach ihrer Ankunft gewaschen hatte. Sie war noch nicht ganz trocken. Forss ging wieder nach oben. Sie wusste nicht, wonach sie überhaupt suchen sollte, trotzdem ging ihr Puls schneller als sonst. Einatmen, hatte ihr der Therapeut beigebracht, einatmen und ausatmen. Wie Wellen am Strand. Sie sah in die Kaffeedose. Der Löffel steckte so wie immer mit dem Stiel nach rechts. Allerdings hatte sie sich am Morgen auch Kaffee gemacht. Sie ging die Treppe hoch ins Obergeschoss, wo sich ihr Schlafzimmer befand, und öffnete die Sockenschublade. Sie erkannte nichts, was ungewöhnlich gewesen wäre. Dort lag nur ein Haufen zusammengerollter Strümpfe. Sie knipste die Nachttischlampe an. Auf dem Nachttisch lag kaum Staub. Sie setzte sich aufs Bett und schloss die Augen. Konzentrierte sich auf ihre Atmung. Einatmen, ausatmen. Durchs offene Fenster hörte sie, wie die Wellen des nahen Sees ans Ufer klatschten. Ein leichter Wind bewegte die Vorhänge. Sie atmete durch die Nase, versuchte Rasierwasser oder ein fremdes Deodorant zu erspüren, aber da waren nur der Eigengeruch des Hauses und das Aroma des Waldes und des Sees. Ihr Puls beruhigte sich, die Atemübung tat ihr gut. Sie hatte sich unnötig Sorgen gemacht, hatte sich Dinge eingebildet, die nicht passiert waren. Sie hatte Gespenster gesehen. Womöglich waren es wirklich Nachwirkungen des Ecstasys. Ein Flashback. Man wusste ja nie genau, was man da eigentlich nahm. Vielleicht war dem MDMA noch etwas Halluzinogenes beigemischt gewesen. Egal. Hauptsache, es ging ihr jetzt gut. Niemand war während ihres Urlaubs im Haus gewesen. Sie zog sich aus und ging unter die Dusche. Seit drei Tagen hatte sie sich die Haare nicht mehr gewaschen. Nun probierte sie ein Algenshampoo, das sie auf Mallorca gekauft hatte. Es roch nach Meer. Gerade als sie den Schaum auswaschen wollte, fiel ihr etwas ein. Ein Ort, an dem sie noch nicht nachgesehen hatte. Schnell duschte sie fertig, trocknete sich ab, schlüpfte in einen Bademantel. Sie suchte nach einer Taschenlampe, eilte in den Flur und angelte mit einem Hakenstock nach der Dachbodenluke. Knarzend öffnete sie sich. Forss klappte die Leiter herunter und stieg vorsichtig hinauf. Wieder pumpte ihr Herz mit hundertzwanzig Schlägen pro Minute. Wie ein Technobeat. Ihr wurde leicht schwindelig. Vielleicht hätte sie die Droge nicht nehmen sollen. Andererseits war es so befreiend gewesen, eine ganze Nacht durchtanzen …
Der Schein der Lampe erfasste den Fußabdruck sofort. Klar und deutlich wie eine Spur im Neuschnee zeichneten sich die Konturen eines Herrenschuhs im Staub ab.
9
Auf Emmas Arm kroch ein Mistkäfer. Sein schwarzer Panzer schimmerte ölig und sah beinahe blau aus im Sonnenlicht, das seinen Weg durch die Baumkronen fand. Es war ein Prachtexemplar, und sie konnte sehen, wie die dünnen Beine auf ihrer Haut nach Halt suchten. Einmal abgerutscht und auf den Rücken gefallen, wäre er trotz seiner Größe und Pracht verloren, unfähig, sich aus eigener Kraft wieder umzudrehen. Emma hob vorsichtig den Kopf. Der Käfer fiel zu Boden, landete auf den Beinen und krabbelte davon.
Über ihr wiegten sich die Kronen der Kiefern langsam hin und her. Zwischen den Ästen sah sie den Himmel. Emma spürte in sich hinein. Sie nahm den unebenen Boden unter ihr wahr, fühlte einen Druck in ihrem Kreuz und dass etwas mit ihrem linken Bein nicht stimmte. Verdammt, dachte sie und schmeckte das metallische Aroma von Blut im Rachen. Sie schluckte, aber der Geschmack blieb. Auf die Ellbogen gestützt, stemmte sie ihren Oberkörper hoch, aber sofort durchfuhr sie ein so wuchtiger Schmerz, dass sie gezwungen war, sich wieder hinzulegen. Sie schloss die Augen und konzentrierte ihre Wahrnehmung auf den pochenden Nachhall der Bewegung. Es war, als würden Blitze in alle Richtungen durch ihren Kopf, ihr Kreuz, ihr linkes Bein springen. Ganz langsam hob sie den rechten Arm und fasste sich an die Stirn. Der warme Druck ihrer Handfläche tat gut. Als würde er die Kraft der Blitze eindämmen. Starr blieb sie so liegen. Eine Minute. Zwei. So fühlte es sich zumindest an. Weder hatte sie eine Uhr, noch zählte sie die Sekunden. Ihr Kopf rauscht und vergebens versuchte sie, ihre Gedanken zu ordnen. Und dann war da der Schmerz. Kräftig und pochend.
Mit geschlossenen Augen tastete sie die Rippen ab, um zu überprüfen, ob etwas gebrochen war. Als sie auf die obersten drückte, strömten Stiche in den Brustkorb, ein Strom aus Schmerzen, vom Kopf über die Brust bis in ihr linkes Bein. Dennoch war sie froh, keine Bruchstellen zu entdecken. Wahrscheinlich war es nur eine Prellung. Wenn etwas gebrochen war, dann wohl ihr Bein. Sie öffnete die Augen und probierte erneut den Kopf zu heben. Diesmal war sie auf den Schmerz gefasst, und als das Pochen stärker wurde, biss sie die Zähne zusammen und presste sich nach oben. Auf beide Arme gestützt, blieb sie in einer aufrechten Haltung sitzen. Vor ihren Augen flimmerte es. Übelkeit packte sie, und kurz dachte sie, sie müsse sich übergeben. Wieder schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf die Schmerzwellen, die in ihr wogten, mal sanft mal heftiger. Um sie herum war es still, nur die Baumkronen flüsterten. Sie ließ das Raunen der Kiefern in sich einströmen, sog die Luft flach und sanft in die Lungen, atmete behutsam aus, hielt inne und sog dann erneut Luft ein. Sie fand einen Rhythmus, atmete gegen die Schmerzen an. Sie öffnete wieder die Augen. Um sie herum standen Bäume, und auf dem Boden breiteten sich Inseln aus schimmerndem Licht aus. Eine Decke aus Moos und Blaubeerbüschen wölbte sich über umgefallene Baumstämme und Steinbrocken. Ihre Finger gruben sich in die weichen Pflanzen hinein, und sie spürte dabei, wie die biegsamen, langen Kiefernnadeln ihre Handflächen piksten. Ganz zart streichelte sie über die Tausende von winzigen Sternen, aus denen das Moos zu bestehen schien.
Frauenhaarmoos.
Emma hielt den Atem an.
Sie kannte den Wald um sich herum.
Oder wenigstens kam er ihr bekannt vor. Die Bäume, die Pflanzen, die gesamte Vegetation. Langsam nahm die Gewissheit Konturen an.
Sie war zu Hause.
Dies war der Wald ihrer Heimat.
Der Geruch des warmen Bodens drang in ihre Nase. Kiefernnadeln und Moos. Und der feuchte, erdige Geruch eines Waldsees. Wie lange lag sie hier schon? Stunden? Minuten? Den ganzen Tag?
Aber was zum Teufel machte sie hier, in Schweden?
Wie war sie von Indonesien aus hierhergekommen?
Warum war sie verletzt?
Vorsichtig drehte Emma den Kopf, und aus den Augenwinkeln erahnte sie einen Hang, der hinter ihr steil nach oben ragte. Sie sah große Steinblöcke mit kantigen, scharfen Umrissen, die sich vor Urzeiten von der Felswand losgerissen hatten. Dazwischen lagen schlanke Birkenstämme am Boden.
Sie war die Anhöhe heruntergestürzt!
Auf der Flucht, im Dunkeln.
Er war hinter ihr her!
Für Bruchteile von Sekunden flackerten Bilder vor ihr auf: sein Gesicht, das Haus, das Blut.
Mit Wucht packte sie die Angst.
Sie musste hier weg.
Zehn Jahre zuvor: Der Tag des Sturms, 8. Januar 2005, 5.09–5.54 Uhr
Am Fenster surrt eine Fliege. Das Geräusch bricht die Stille im Zimmer und dringt in Ola Danlids Wahrnehmung ein, die vom Schlaf noch ganz trunken ist. Es stört ihn. Dann hört das Surren auf. Er dreht sich unruhig um, öffnet die Augen und sieht auf den Wecker. 5.10 Uhr. Die Fliege im Fenster ist schwarz, dick und träge. Jetzt surrt sie doch wieder. Ola erhebt sich, zögert einen Moment, fasst nach dem Griff, dreht ihn und stößt dann das Fenster auf, damit der ungebetene Gast und Quälgeist hinausfindet und im Freien sterben kann. Auch wenn es für die Jahreszeit ungewöhnlich mild ist, wird die Fliege die Winterluft nicht lange überleben. Aber andererseits: Wie lange lebt eine Fliege überhaupt?
In zehn Minuten wird der Wecker klingeln. Ola zieht die Decke über den Kopf in der Hoffnung, wieder einschlafen zu können. Nur ganz kurz. Die Erschöpfung von der harten Arbeit der vergangenen Tage greift nach seinen Muskeln, lässt die Gelenke anschwellen, es kribbelt und zieht. Sein Körper fühlt sich gleichzeitig schwer und leicht an. Er schließt die Augen, aber es ist natürlich zwecklos.
Er steht auf.
Unten in der Küche gießt er sich ein großes Glas Milch ein. Über Nacht hat sich in der Kanne die Sahne auf der Milch abgesetzt und bildet eine dickflockige gelbliche Schicht. Normalerweise versucht er, die Sahne mithilfe eines Löffels zurückzuhalten, und wenn sie mehr als einen halben Zentimeter misst, schöpft er sie ab und sammelt sie in einer anderen Kanne. Heute Morgen überspringt er diese Prozedur, obwohl die Sahneschicht dick genug wäre. Beim Gießen vermischt sich die Sahne mit der Milch in seinem Glas. Er nimmt einen großen Schluck und bereut seine Eile. Statt des frischen Geschmacks, auf den er sich gefreut hat, fließt die cremige Flüssigkeit träge durch seinen Rachen, und auf der Innenseite seiner Wangen bleibt ein schleimiger Belag zurück. Ein fieses Gefühl, das sich mit dem flauen Unwohlsein eines Katers vermischt. Er fühlt sich ausgetrocknet und mürbe, dabei war er gestern wirklich nicht übermütig, nur zwei Fingerbreit Wodka mit Bitter Lemon gemischt. Und ein Bier zum Essen. Dennoch ist der Alkohol eingeschlagen wie eine Bombe, und Ola hat schon beim Trinken gemerkt, dass er ihm nicht bekommt. Es muss wohl an der Müdigkeit gelegen haben. Ich brauche dringend einmal eine Pause, denkt er, ein einziger freier Tag würde schon reichen. Er malt sich aus, wie schön es wäre, ausschlafen zu dürfen, den ganzen Vormittag im Bett zu bleiben und nichts zu tun. Er könnte die DVD gucken, die er von seiner Schwester zu Weihnachten bekommen hat. Der Film müsste sich noch in der Tüte befinden, in der auch die anderen Weihnachtsgeschenke liegen. Es kommt ihm seltsam vor, dass Heiligabend erst zwei Wochen her ist. Es gab seitdem so viel zu tun, und es war so viel geschehen, dass die Zeit nur so verflogen ist.
Die Uhr tickt träge. Er setzt Kaffee auf, und während das Wasser durch den Filter rinnt, schmiert er sich zwei Scheiben Brot mit Leberwurst. Es reicht noch eben gerade. Heute müsste er einkaufen. Außer Knäckebrot und Margarine ist kaum noch etwas da: nur ein paar traurige Salzgurken und eingelegter Hering.
Hoffentlich werde ich heute schnell mit der Arbeit fertig, denkt er und spürt dabei seine Aufgeregtheit, ein unangenehmes Gefühl. Auf dem Hof der Johanssons kennt er sich nicht gut aus. Dort läuft einiges anders, weil es ein Biobetrieb ist.
Biobetrieb: ein anderes Wort für knochenharte Arbeit. Er springt bei den Johanssons nur sporadisch ein, wenn es Engpässe gibt und es zeitlich nicht mit seinen täglichen Verpflichtungen auf dem Karmfalkhof kollidiert, auf dem er seit Jahren angestellt ist. Die Karmfalks sind zum Glück keine Biobauern. Dort ist die Arbeit zwar auch hart, aber er kennt sich mit den Abläufen aus und die Karmfalks sind nett zu ihm. Nils Johansson dagegen ist ein richtiger Stinkstiefel. Wenn seine Frau Helen nicht wäre, dann würde er Nils sagen, dass er zur Hölle fahren soll. Helen dagegen mag er. Sehr sogar. Sie ist der Grund, warum er auf dem Johanssonhof aushilft. Heute kann er dort in zwei Stunden durch sein, überlegt er. Entweder wird Helen da sein, was schön wäre. Oder Nils, was nicht schön wäre. Zu zweit geht es relativ schnell mit dem Ausmisten und Melken. Gegen acht wäre er dann wieder zu Hause und könnte ein paar Stunden schlafen, bevor er zum Einkaufen nach Älmhult fährt.
Während er frühstückt, hört er Radio. In den Nachrichten sprechen sie immer noch vom Seebeben im Indischen Ozean. Vom Tsunami in Thailand, Indonesien und den anderen betroffenen Ländern. Er dreht die Lautstärke auf. Dieselben Meldungen wie gestern und vorgestern und vorvorgestern. Trotzdem hört er genau hin, versucht die Bedeutung und Tragweite des Gesagten zu begreifen. Über zweihunderttausend Tote, etwa fünfhundert von ihnen Touristen aus Schweden, unter ihnen Jan-Åke und Liane, die Eltern von Nils Johansson. Vorgestern erst sind sie beerdigt worden. Ola hat sich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, dass die alten Bauern tot sind. Auf der Beerdigung hat er weinen müssen. Solange er sich erinnern kann, waren Jan-Åke und Liane seine Nachbarn.