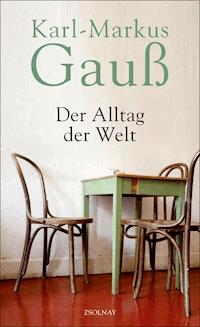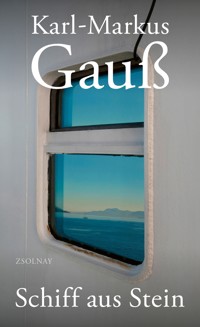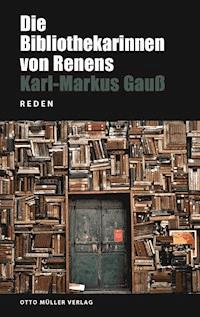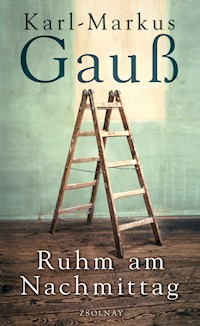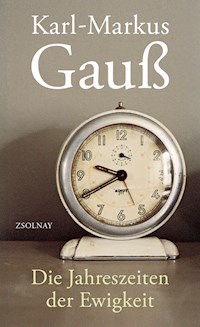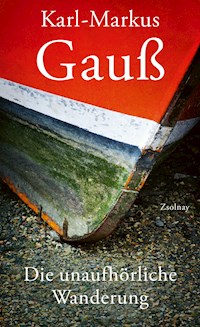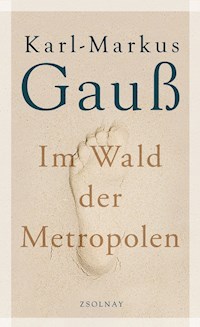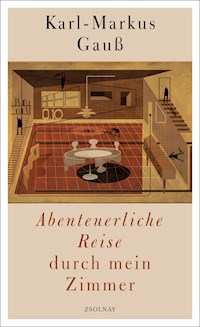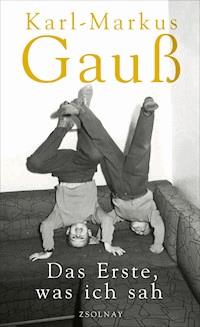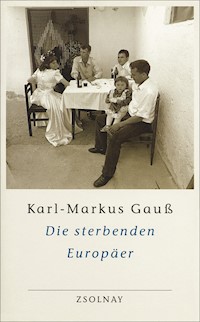
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl-Markus Gauß, dessen Aufmerksamkeit seit langem den randständigen Nationalitäten gilt, ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgebrochen zu jenen kleinen Völkern, denen Europa seine Vielfalt an Kultur verdankt. Seine Reisebilder verbinden Naturbeschreibung, Stadtporträt, Exkurs in unbekanntes Gelände der Kulturgeschichte, politische Skizze und Erzählung von unverwechselbaren Menschen zu einer wunderbaren Form von Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Karl-Markus Gauß, dessen Aufmerksamkeit seit langem den randständigen Nationalitäten gilt, ist in den vergangenen Jahren immer wieder aufgebrochen zu jenen kleinen Völkern, denen Europa seine Vielfalt an Kultur verdankt. Seine Reisebilder verbinden Naturbeschreibung, Stadtporträt, Exkurs in unbekanntes Gelände der Kulturgeschichte, politische Skizze und Erzählung von unverwechselbaren Menschen zu einer wunderbaren Form von Literatur.
Karl-Markus Gauß
Die sterbenden Europäer
Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, Sorben und Aromunen
Mit Photographien von Kurt Kaindl
Paul Zsolnay Verlag
Die Letzten sein — Die Sepharden von Sarajevo
1
Jakob Finci ist ein kleiner, aufgeweckter Mann, der leicht lispelt, fließend Englisch spricht und dabei mit dem riesigen rechten Ohr wackelt. An der holzgetäfelten Wand hinter dem Sessel, in dem er sich kerzengerade hielt, als nehme er eine Parade ab, hingen gerahmte Fotografien, die ihn mit den Großen der Welt zeigten: mit Papst Johannes Paul II. für alle Ewigkeit in ein vertrautes Gespräch versunken; mit dem über ein imaginäres Sarajevo des Krieges hinwegstrahlenden Ehepaar Clinton, bei dem er sich zwanglos untergehakt hatte; und mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, wie sie einander ein melancholisches Lächeln zuwarfen, das um all die Vergeblichkeit irdischen Strebens zu wissen schien. Seit bald einer Stunde wurde Finci nicht müde, auf jede meiner Fragen zu antworten, indem er witzige Anekdoten zum Besten gab oder verblüffende Vergleiche tief zurück in die Geschichte schlug. Schon bald, nachdem wir unsere Unterhaltung im Jüdischen Gemeindezentrum von Sarajevo begonnen hatten, war er dazu übergegangen, meine Fragen zu taxieren, »a good question« sagte er anerkennend, und gelegentlich steigerte er dies zu »a very good question«, womit er zugleich ankündigte, daß er etwas weiter ausholen müsse, um sie zu beantworten.
Das also war der Mann, von dem ich schon so viel gehört hatte und von dem mir all die Tage, die ich in Sarajevo war, etwas anderes erzählt wurde! Nicht jeder schien ihn zu mögen, manchem war es offenbar nicht recht, daß der Vorsteher einer jüdischen Gemeinde, die nur mehr ein paar Hundert Seelen zählte, wie ein Präsident amtierte, dem Staatsmänner und Religionsführer die Reverenz zu erweisen hatten. Und doch, alle, die in den Jahren der Belagerung oder nach dem Krieg gekommen waren, waren auch zu Finci gekommen, in diese große, für die kleine Gemeinde von heute viel zu große Synagoge, die nach der einen Seite auf die Miljacka sieht, den schmalen Fluß, der Sarajevo reißend durchquert, nach der anderen auf die Hügel, die diese Stadt nach allen Seiten hin umschließen. Müßten Generäle für ein Manöver eine Stadt erfinden, an der sich die militärische Einkesselung mit geringer Truppenstärke üben läßt, sie würden zweifellos eine Stadt entwerfen, deren Grundriß dem von Sarajevo ähnelt. Alle waren sie in den letzten Jahren über diese Brücke gekommen, die aus dem Herz der Altstadt in ein unansehnliches Viertel herüberführt, dessen wichtigster Ort die Synagoge mit den Gemeinderäumen, dem Café und Vortragssaal, den Büros und der Bibliothek ist. Und Finci hatte sie empfangen, mit ihnen konferiert und der großen Politik, die in Sarajevo gerade verheerende Folgen zeitigte, lauter kleine Vereinbarungen entgegengesetzt.
Lange Zeit war Sarajevo ein vielbesungenes Zentrum der Sephardim gewesen, jener Juden, die 1492 vom frommen König Ferdinand und seiner tugendhaften Gattin Isabella aus Spanien vertrieben wurden, sich in alle Welt geflüchtet und in namhafter Zahl auch auf dem Balkan angesiedelt hatten. »Yerusalayim chico«, Klein-Jerusalem, wurde die Stadt über die Jahrhunderte von ihren jüdischen Bewohnern genannt, deren Vorväter aus Spanien in das Osmanische Reich, auf die andere Seite des Mittelmeeres, gezogen waren, wo ihnen ein kluger Sultan namens Bajazet II. religiöse Freiheit, rechtliche Sicherheit und wirtschaftliche Perspektiven bot und die Vertriebenen mit dem Satz willkommen hieß: »Kann man einen solchen König klug und weise nennen, der sein Land verarmen läßt und mein Reich bereichert?« Die Sepharden waren nicht die ersten Juden, die es im Osmanenreich gab, fast überall, wo sie sich niederließen, in Sarajevo und Travnik, in Istanbul und Izmir, in Sofia und Rustschuk, trafen sie auf alteingesessene, seit der Antike hier lebende Gemeinden der Romanioten. Doch binnen wenigen Generationen hatten sich die Einheimischen vollständig den Neuankömmlingen assimiliert, und bis ins 20. Jahrhundert herauf bestimmte die sephardische Kultur das jüdische Leben auf dem Balkan, in Griechenland und der Levante.
Die Zuwanderer hatten, als sie ihre Heimat verlassen mußten, nur mit sich nehmen dürfen, was ein jeder von ihnen selber tragen konnte, aber kostbarer als alle irdischen Güter war die Sprache, die sie aus Spanien mitbrachten und die alsbald zur lingua franca der Kaufleute wurde, die entlang der Küsten des Mittelmeeres Handel trieben; es war jene Sprache, die vor der politischen Sprachreform, die das Kastilische zur Norm erklärte und damit zur Grundlage des modernen Spanisch machte, auf der Iberischen Halbinsel in mannigfachen regionalen Färbungen gesprochen wurde. Für diese Sprache, in der später die marokkanischen und griechischen, ägyptischen und dalmatinischen Fernhändler in den Hafenstädten ihre Geschäfte abwickelten, gibt es verschiedene Namen: Ladino ist der verbreitetste, Judeo-Español ein anderer, aber auch Romance oder Ǧudezmo waren und sind gebräuchlich. Jedenfalls sprachen die Juden des Balkans ihre aus Spanien mitgebrachte Sprache nicht nur im Tempel und zu liturgischen Zwecken, sondern auch im Alltag, auf der Straße und im Bazar. Heute gilt das Ladino Dichtern und Sprachforschern als »lebendes Museum des Spanischen«, durch das zu flanieren eine beglückende poetische Erfahrung sein kann. Als der argentinische Dichter Juan Gelman 1980 vor der Diktatur der Obristen flüchten mußte, fand er Zuflucht nicht nur in Mexiko, sondern auch in der Sprache der Ahnen, die einst selbst um ihr Leben hatten flüchten müssen, im Sephardischen, das er sich im Exil anzueignen und in dem er Gedichte zu schreiben begann.
Bis ins 19. Jahrhundert war das Judentum des Balkans mit der sephardischen Kultur nahezu identisch. Erst 1878, als die österreichisch-ungarische Militärmacht die türkische Provinz Bosnien okkupierte und anstelle der alten osmanischen eine eigene Verwaltung einsetzte, sollten neuerlich Juden nach Sarajevo kommen, und diesmal waren es keine gottesfürchtigen Sepharden. Im Troß des österreichischen Heeres befanden sich vielmehr Tausende Beamte, gebildete Akademiker, die in der Tradition eines mitteleuropäischen Judentums standen und als Aschkenazim bezeichnet wurden. Als diese österreichischen Juden 1878 in Sarajevo auftauchten, hätten die Sepharden nicht schlecht gestaunt, erzählte mir Jakob Finci in seinem mit Devotionalien und Dokumenten aus der jüdischen Geschichte des Landes vollgeräumten Büro. Sie hätten sich sehr gewundert, weil das Juden waren, die kein Spanisch konnten, und sich gefragt, ob man überhaupt ein Jude sein konnte, wenn man nicht Spanisch sprach. Die Sepharden wären jedenfalls über den Zuzug so vieler Juden, mit denen man sich nicht einmal unterhalten konnte und die die einfachsten Regeln des Gottesdienstes nicht beherrschten, anfangs nicht sehr begeistert gewesen. Sie waren es nämlich seit 400 Jahren gewohnt, zwar inmitten von Muselmanen und orthodoxen Christen zu leben, im Religiösen aber ganz auf sich und die fast unverändert bewahrten Riten bezogen zu bleiben. Und das waren doch ganz andere Menschen, die jetzt auf den Plätzen und Ämtern zu sehen waren und die sich als Juden bezeichneten, obwohl Sprache, Kleidung und öffentliches Auftreten zu heftigen Zweifeln berechtigten, ob sie es mit Sitte und Anstand so ernst nahmen, wie sich das für Juden gehörte.
2
Der alte jüdische Friedhof, zwischen den im Krieg völlig zerstörten Stadtteilen Kovačići und Grbavica steil hügelan gelegen, war tief verschneit. Das große eiserne Tor ließ sich kaum öffnen, so fest steckte es im Schnee, der über den Winter eine Decke von einem guten Meter gebildet hatte, die jetzt, im Februar, hart gefroren war. Hier war seit Wochen niemand gewesen. Die leicht überschneite Spur eines einzigen Friedhofsgängers, der vor längerer Zeit mit jedem seiner schweren Tritte eingesunken war, zog sich vom Tor zur nahegelegenen Aussegnungshalle, die zerschossen und deren Decke eingestürzt war, so daß man aus ihrem Inneren in den Himmel sah. In der völligen Stille des Vormittags ragten die Grabsteine weiß aus dem Schnee, schräg und wie im Kippen aufgefangen die einen, gerade und dicht aneinandergedrängt die anderen. Da waren die Gräber der Aschkenazim, die Namen trugen, wie sie in der österreichisch-ungarischen Monarchie gebräuchlich waren, Farkas, Brocziner, Prohaska oder Dr. Rothkopf, und bei vielen von ihnen, die um die Jahrhundertwende in Sarajevo starben, war als Geburtsort ein Dorf in Mähren oder eine Kleinstadt in Ungarn angegeben. Weit zahlreicher waren die Grabsteine der Sepharden, mit hebräischen Schriftzügen die älteren, in lateinischer Schrift mit Versen in Ladino die anderen ausgestattet, unter denen die Gebeine der Familien Kampos, Montiljo, Tolentino, Brazil-Levy oder Papo ruhten.
Das Gräberfeld zog sich drei-, vierhundert Meter den Hügel Trebević hinauf, zwischen den Gräbern standen Bäume, deren Äste sich unter der Last des Schnees zur Erde bogen. Der Aufstieg war mühsam, auf steile Eisplatten, die auch mit gutem Schuhwerk kaum zu bewältigen waren, folgten kleine Plateaus, auf denen der Schnee unerwartet stumpf war, sodaß wir kniehoch einbrachen. Man hatte uns gewarnt. Dieser Friedhof war vor dem Krieg fast völlig vergessen gewesen, obwohl er auf seinem Hügel von der halben Stadt aus zu sehen war, zu sehen von den Hügeln gegenüber, auf der anderen Seite der Miljacka, zu sehen von manchem Platz und aus vielen Häusern unten am Fluß. Doch die Bevölkerung Sarajevos hatte ihren alten jüdischen Friedhof so vergessen, daß der muslimische Dichter Abdullah Sidran ihn vor dem Krieg als Inbild der Verlassenheit beschrieb. Den Generationen toter Sepharden, denen in Sarajevo keine neuen mehr folgen würden, hatte er im Gedicht nachgerufen:
»Schlaft, ihr, die ihr auch den letzten Weg
zurückgelegt habt. Schlaft, die Zeit wird vergehen.
Schlaft, es wird keine Zeit mehr geben. Schlaft,
nichts wird es mehr geben, und es wird sein,
als hätte es niemals etwas gegeben.
Schlaft, der Himmel kennt kein Erinnern.«
Dieser Friedhof, den alle, die ihn vergessen hatten, täglich sehen konnten, war im Krieg entdeckt und dem Krieg nutzbar gemacht worden. Wer den Überfall auf eine Stadt plant, sieht sich diese Stadt genau an, er sucht nach Orten, von denen er den Angriff führen, nach Winkeln, in die er sich zurückziehen kann. Der Krieg um Sarajevo begann auf dem jüdischen Friedhof, den vorher kaum jemand mehr bemerkte oder besuchte. Ein paar hundert Meter unterhalb des Friedhofs überquert eine unscheinbare Brücke namens Vrbanja die Miljacka und verbindet die beiden Stadtteile Marindvor im Norden und Kovačići im Süden. Am 5. April 1992 waren viele Sarajevoer auf die Straße gegangen, um gegen die Teilung ihrer Stadt in ethnische Zonen zu demonstrieren. Es ist eine Lüge, daß die Bewohner Sarajevos ihre Stadt selbst zerstört, daß sie ihren ethnischen Zerfall gewollt und aus Eigenem herbeigeführt hatten. Zu Tausenden sind sie Woche für Woche gegen die Barrikaden angerannt, die von der jugoslawischen Volksarmee, die längst zur serbischen Nationaltruppe geworden war, mitten durch die von jeher ethnisch gemischten Viertel gezogen wurden. Ausdauernd hatten die Serben, Kroaten, Muslime, Juden Sarajevos gegen die Teilung ihrer Stadt aufbegehrt, und erst als sie merkten, wie alleingelassen und von allen verraten sie in diesem Kampf waren, kapitulierten nach und nach zumal junge Männer vor dem Ansturm des Nationalismus und machten sich aus den großen Wohnblocks auf, um auf die Hügel, zu den Belagerern zu gelangen, sich den Mördern zuzugesellen und auf die eigene Stadt hinunterzuschießen.
Der Krieg begann an jenem 5. April 1992, als Hunderte vor den Barrikaden angetreten waren, mit denen die Partei des Radovan Karadžić über Nacht das Stadtviertel Grbavica abgeriegelt hatte. Aus einem Haus unweit des jüdischen Friedhofs zielte ein Scharfschütze in den Friedensmarsch, der gerade die Vrbanja-Brücke passierte, und er traf die Medizinstudentin Suada Dilberović. Es war ein böser Zufall, daß gerade sie das erste Todesopfer des Krieges um, des Krieges gegen die Stadt Sarajevo wurde, aber mehrere Leute sagten mir, daß der Zufall sich nicht ganz zufällig ausgerechnet diese junge Frau ausgesucht hatte.
Denn die Familie der Medizinstudentin war aus Dalmatien zugewandert, das Opfer kam also aus Kroatien, war aber keine Katholikin, sondern Muslimin, und sie war zwar Muslimin, aber keine, wie sie die vereinigten christlichen Fundamentalisten am liebsten haben, also nicht verschleiert oder wenigstens mit Kopftuch unterwegs, sondern eine schöne, blonde, selbstbewußte Frau, die Ärztin werden wollte und in allem jenes Sarajevo personifizierte, das den Kriegern der ethnischen Separation verhaßt war: ein Mensch von ungeklärter ethnischer Zugehörigkeit, eine Frau von urbanem Wesen, so wurde Suada Dilberović, die am Sonntag, den 5. April 1992, auf der Vrbanja-Brücke, die heute Brücke-Suada-Dilberović heißt, verblutete, zur ersten Toten des über alle Fernsehstationen der Welt übertragenen Krieges.
Wer seine Stadt vernichten will, braucht Stützpunkte, und der jüdische Friedhof, im Krieg und für den Krieg wiederentdeckt, war ein solcher Stützpunkt. Hinter den uralten Grabsteinen, die auch Monumente der Toleranz und Friedfertigkeit waren, weil sie an Menschen erinnerten, deren Vorfahren von weit her aus der Unfreiheit im Westen gekommen waren, um hier, im Osten, nach ihrer Fasson glücklich zu werden, hinter den uralten Grabsteinen wurden die Geschütze postiert, und aus dem hoch über der Stadt gelegenen oberen Teil des Friedhofs krachten monatelang die Haubitzen in die Stadt hinunter. Man hatte uns gewarnt. Als die Milizen nach über drei Jahren den Friedhof und die umliegenden Stadtteile Kovačići und Grbavica verlassen mußten, haben sie die Häuser Straße um Straße gesprengt und den Friedhof Meter für Meter vermint. Die norwegische Hilfsorganisation »Peoples Aid« brauchte ein halbes Jahr, um ihn mit Suchgeräten von den Tretminen zu befreien, aber vielleicht waren von den Abertausenden, die die Belagerer verstreuten, als sie sich davonmachten, ein paar unentdeckt geblieben? Als wir den Friedhof langsam hinunterstiegen, stießen wir auf einen schönen Grabstein, auf dem eine vor über 160 Jahren gestorbene Mutter, die zeitlebens keine andere Gerechtigkeit als das Verzeihen und als einziges Gesetz die Liebe kannte, von ihren Kindern spaniolisch betrauert wurde: »Madre que non conoce/otra justicia que el perdon/ni mas ley que amor.«
Aus dem Friedhof nach draußen tretend, schauten wir auf den riesigen Schutthaufen, der der Stadtteil Kovačići war. Ein alter, gebeugter Mann zog mühsam die steile, vom Schnee nicht geräumte Gasse herauf. Er trug ein paar schwere Plastiksäcke, und als er unsere Höhe erreicht hatte, hielt er lächelnd an und richtete sein Wort in einem äußerst mangelhaften Französisch an uns, das umso schwerer zu verstehen war, als er nur ein paar Zahnstummel im Mund hatte und die Silben undeutlich vernuschelte. Wir standen ein paar Minuten bei ihm, der sich nach unseren Plänen erkundigte und fragte, wie uns Sarajevo gefalle, dann machte er sich wieder auf den Weg und zog, ein hagerer Greis, mit der mehrfach wiederholten Feststellung, daß er 52 Jahre alt sei, cinquante-deux, den Hügel hinauf, an Ruinen vorbei, irgend einer Ruine entgegen.
3
Als ich zum ersten Mal in das düstere, von Rauchschwaden durchzogene Foyer der Jüdischen Gemeinde trat, saßen auf den Stühlen entlang der Wände vielleicht zehn alte Herren. Von dem großen Raum führten links die Türen zu einer Art Cafeteria und in die Büros der Gemeinde, in denen Jakob Finci residierte, nach rechts aber Treppen zu den höher gelegenen religiösen Räumlichkeiten. Die alten Männer saßen da, tranken Mokka aus kleinen Tassen oder gelblich trüben Schnaps aus Gläsern, rauchten und schwiegen. Sie hatten sich nicht um einen Tisch gruppiert, sondern, wie es in den südlichen Ländern im Freien üblich ist, die Stühle der Wand entlang aufgestellt, sodaß sie sich, da etliche Sessel leer waren, reihum im ganzen Raum verteilt hatten. Da saßen sie, die meisten im aufgeknöpften Mantel und mit Hut oder Mütze auf dem Kopf, als hätten sie nur auf einen Sprung vorbeigeschaut und wären bereit, jeden Moment wieder aufzustehen und zu gehen. So halten sie es immer, vielleicht schon ein paar hundert Jahre lang, sie bleiben, aber sie bleiben wie auf Abruf, und es ist das Unglück ihrer späten Tage, daß in den letzten Jahren die meisten ihrer Freunde und Verwandten abberufen wurden, aufgestanden, hinausgegangen und emigriert sind.
Als ich eintrat, registrierten sie das gleichmütig, fast ein jeder auf dieselbe Weise, mit einem kurzen Blick, nicht gerade mit aufdringlicher Neugier, aber doch aufmerksam. Da ich nach ein paar Schritten hilfesuchend stehenblieb, erhob sich im äußersten Eck ein drahtiger Mann mit festem grauen Haarschopf, eine erloschene filterlose Zigarette in der einen, ein Schnapsglas in der anderen Hand, und trat mit der Frage, ob er helfen könne, zu mir. Ich sagte ihm meinen Namen, daß ich aus Salzburg und gekommen sei, weil ich mich seit längerem für die Sepharden interessiere, und er antwortete, indem er den Bau meines Satzes spöttisch wiederholte: »And my name is Albahari, I come from Sarajevo, and I am also interested in the Sephardim.« Das war mit wohlwollender Ironie gesagt, doch hatte ich etwas, was daraus sofort Sympathie für mich machte; der Name, mit dem sich der Alte vorstellte, erinnerte mich nämlich an einen Schriftsteller aus Belgrad, von dem ich vor Jahren ein Prosastück in meiner Zeitschrift abgedruckt und den ich später als einen Mann von kaltglühender Verzweiflung kennengelernt hatte, als er einen Abend lang einer Runde österreichischer Zuhörer über Jugoslawien berichtete, das gerade zerfallen war, und über die Jüdische Gemeinde von Belgrad, zu deren Gemeindevorsteher er sich damals, als so viele Juden Serbien verließen, aus einer Art aussichtslosen Pflichtgefühls hatte wählen lassen. Als ich ein wenig übertreibend erwähnte, mit einem Schriftsteller gleichen Namens, David Albahari, befreundet zu sein, ließ der alte Mann die Zigarette im selben Moment fallen, damit er mir kräftig und lange die Hand schütteln konnte, rief »my nephew, my nephew David« und ließ vor Begeisterung den Schnaps aus dem Glas schwappen. Obwohl er damals die Emigration als definitive Niederlage bezeichnet hatte, war David Albahari letztlich doch emigriert und ans andere Ende der Welt, in eine kanadische Universitätsstadt, gezogen; dort lebte er, wie er in seiner Erzählung »Tagelanger Schneefall« berichtete, unbehelligt von europäischen Feindschaften und umgeben von freundlichen Studenten und Kollegen, die ihm gerne erklärten, was in Bosnien am Roten Meer alles falsch gelaufen war und warum sich die Leute von Sarajevo um den Zugang zum Wasser so fürchterlich zerstritten hätten.
Sein Onkel, der mir jetzt gegenüberstand, Moshe Albahari, war pensionierter Oberst der jugoslawischen Luftwaffe. 25 Jahre lang hatte er die Piloten einer Armee gegen einen Feind ausgebildet, der nie kam, und als seine Piloten eines Tages doch noch in einem Krieg eingesetzt wurden, da wurde er nicht gegen einen Feind geführt, den es hinter die Grenzen Jugoslawiens zurückzuwerfen galt, sondern gegen die Bundesgenossen, die den gemeinsamen Staat nach alten inneren Grenzen zerfallen ließen. Moshe Albahari war aber auch Konstrukteur gewesen, ein eigenes Kleinstflugzeug, das nur 280 Kilogramm wog, wurde nach seinen Plänen entwickelt, ohne daß die Produktion je in Serie gegangen wäre. Überhaupt sei alles vergebens gewesen, das Flugzeug, die Luftwaffe, die Ausbildung! Wie sein Neffe wäre auch sein eigener Sohn nach Kanada emigriert, sagte Moshe, und fast alle seine Freunde waren tot oder fort. Er deutete auf die Runde alter Männer, die jetzt, als wüßten sie, was er von ihnen erzählte, mit freundlicher Resignation herübernickten — ein Altersheim, verstehen Sie, nichts anderes als ein Altersheim sei die Jüdische Gemeinde von Sarajevo heute. Alle sind sie weg, die Jungen, die es sich zutrauten, anderswo neu anzufangen, die Gebildeten, die in irgendwelchen Colleges in der amerikanischen Provinz Unterschlupf fanden, die Alten, die in Israel Verwandte hatten. Er aber werde bleiben, so wahr er Moshe Albahari heiße, ausharren mit diesen anderen da, die sich Tag für Tag hier trafen, gemeinsam rauchten, tranken — und warteten.
Auf der großen Straße, Zmaja od Bosna
Ich bin kein Israeli, sagte Moshe, warum soll ich nach Israel? Ich bin kein Amerikaner, was soll ich jetzt in Amerika? Früher hätte es ihn interessiert, sich drüben einmal umzuschauen, aber zum Sterben nach Amerika fahren? Von den 1500 Juden, die vor der Belagerung noch in Sarajevo gelebt hatten, wäre über die Hälfte ausgewandert. Als Sarajevo für drei Jahre eingekesselt und kein Entkommen möglich war, hatten die Kriegsparteien sich darauf geeinigt, die Juden ziehen zu lassen. Im großen Konvoi, der unter dem Schutz der Vereinten Nationen stand, wurden sie aus der Stadt gebracht, die ihnen kein kleines Jerusalem mehr war. Vor 500 Jahren waren die Sepharden in äußerster Bedrängnis aus Spanien hierher gezogen, jetzt verließen sie ihr Sarajevo, ihr Bosnien wieder. Es war aber nicht der Antisemitismus, der sie vertrieb, auf diese Klarstellung legte Moshe großen Wert. Durch den Rauch der Zigaretten, den er beim Reden mit rudernden Armbewegungen im Raum verteilte, faßte er mich immer wieder scharf ins Auge: Nein, in Jugoslawien hat es keinen Antisemitismus gegeben, und selbst zuletzt, als sich jeder gegen jeden aufhetzen ließ, waren die Juden davon ausgenommen. Vielleicht, sagte Moshe, hatten die drei großen Volksgruppen in Bosnien einander so fanatisch gehaßt, daß für den Haß auf die Juden einfach keine Zeit und Kraft mehr übrig war. Achtungsvoll sprach vielmehr eine jede nur von »unseren Juden«, und darum gestatteten sie es ihren Juden auch, die Stadt mitten im Krieg zu verlassen. Die Juden gingen, weil es für sie keinen Sinn hatte, dort zu bleiben, wo der Nationalismus regierte. Sobald Bosnien als Staat der vielen Völker zerstört wurde, konnten sie, die kleinste Bevölkerungsgruppe, die auf das friedliche Zusammenleben der anderen angewiesen war, hier keine Zukunft mehr haben. Aber Bosnien wird umgekehrt auch keine Zukunft ohne Juden haben, denn alle sprechen hier nur mehr für die eigene ethnische Gruppe und deren Platz im Land, einzig die Juden mußten, wenn sie von sich selbst und ihrer Gemeinschaft sprachen, zugleich von ganz Bosnien sprechen. Gibt es kein Bosnien mehr, in dem für alle bosnischen Volksgruppen Platz ist, können die Juden nicht mehr in Bosnien bleiben — aber gibt es keine Juden mehr in Bosnien, gibt es in Wahrheit auch dieses Land nicht mehr.
»Sondern was?«
»Irgendwas anderes, das mich nicht interessiert. Irgendeinen Staat mit irgendeiner Fahne.«
Noch während mir Albahari das alles erzählte, wußte ich, daß ich diesen Mann, wenn sonst aus keinem Grund, sicherlich wegen seiner merkwürdigen Art zu lachen in Erinnerung behalten müßte. Er beendete seine Sätze stets mit einem leisen Lachen, das bitter, aber nicht verbittert war, es klang, als würde er allem, was er mitzuteilen hatte, mit diesem kurzen Auflachen einen endgültigen Punkt, einen Schlußpunkt dahintersetzen, und in der Art, wie er diesen Punkt setzte, war nichts Jammervolles, wenngleich die Unabänderlichkeit, die sie betonte, tieftraurig war: Meine Frau ist tot, mein Sohn ist weg, meine Freunde sind ausgewandert, die fünfhundertjährige Geschichte der Juden in Sarajevo geht zu Ende, und dieses Ende, das das Ende einer historischen Periode und das Ende so vieler persönlicher Hoffnungen und Gewohnheiten ist, kommt unabänderlich, ist nicht mehr aufzuhalten, weder durch finanzielle Unterstützung aus dem Ausland noch durch spirituelle Besinnung in Sarajevo selbst.
»Ich bin kein Israeli. Ich bin kein Amerikaner. Jugoslawien gibt es nicht mehr. (Lachen) Bosnien gibt es nur mehr als Einbildung. (Lachen) Ich bin ein sephardischer Jude, der nicht Spanisch kann. (Lachen) Soll ausgerechnet ich nach Spanien zurück?
— Wäre das überhaupt möglich?
— Der spanische König hat angeordnet, wahrscheinlich weil er ein schlechtes Gewissen wegen seinem verrückten Verwandten von damals hat, daß allen bosnischen Sepharden, die nach Spanien möchten, die Einreise ermöglicht werde. Wenn sie in Spanien bleiben wollen, erhalten sie unverzüglich die spanische Staatsbürgerschaft, müssen dafür aber die bosnische zurücklegen.
— Ist das so schlimm?
— Überhaupt nicht, aber wir Juden haben gelernt, immer nach vorne zu schauen. Wenn der Mensch ein Tier wäre, das in der Vergangenheit lebt, dann hätte er seine Augen im Genick, um zurückschauen zu können. (Lachen) Ich schaue nicht zurück, immer vorwärts: And my history goes cemetery.« (Lachen)
4
Die »Provare« ist eine schmale Straße, die an einem kleinen, bereits ziemlich hoch über der Innenstadt, dem Fluß und dem Bazar gelegenen Plätzchen beginnt und in einem leichten Bogen steil den alten Stadtteil Bjelave hinaufzieht. Wie die halbe Stadt war auch diese Straße im kalten Februar für Autos unpassierbar, nicht weil es zu eisig gewesen wäre, sondern weil der Schnee, der im Millenniums-Winter reichlich fiel, von der Stadtverwaltung außerhalb des Zentrums nicht weggeräumt und auch von den Bewohnern nicht aus eigener Initiative beseitigt wurde. Bis auf zwei schmale Streifen entlang der ein- oder zweistöckigen Häuser, auf denen die Fußgänger vorsichtig auf- und abwärts tappten, bestand die Straße jetzt aus einem betonharten, rund einen Meter hohen Haufen, der die Straße vom Plätzchen unten bis zur Kuppe des Hügels hinaufbegleitete und der von dem Schnee herrührte, der in den letzten Monaten irgendwann von den schrägen Dächern gerutscht oder einfach vom Himmel gefallen war. Kinder und jüngere Leute, die sich beim Gehen einen Spaß machen wollten, gingen auf diesem mächtigen Haufen und stiegen so über manches Auto, das von seinem Besitzer zu Beginn des Winters stehengelassen worden war und unter dem harten Schnee überwinterte. Frauen mit Kinderwagen kamen hingegen fast nicht vom Fleck, ältere Leute taten gut daran, in ihrem Viertel zu bleiben, und die zahlreichen Rollstuhlfahrer Sarajevos waren ohnehin von Dezember bis März auf ihre Wohnung oder die Begleitung starker Freunde angewiesen.
Daß die Bewohner Sarajevos so achtlos mit ihrer Stadt umgingen und das Leben denen von ihnen, die nicht stark und tüchtig waren, so schwer machten, war eine Folge der Belagerung und des Krieges, der die alltäglichen Sitten verrohte und das urbane Gleichgewicht auch durch den Ab- und Zuzug großer Bevölkerungsgruppen ins Kippen brachte. Viele geborene Städter verließen ihre Stadt, deren Namen nicht nur in Bosnien als Synonym für die Stadt selbst verwendet wurde, zogen in die neugebildete Republika Srpska oder irgendwo sonsthin, wo man sie als Flüchtlinge oder Gastarbeiter ins Land ließ; vertriebene, zwangsumgesiedelte Leute vom Land wiederum nahmen ihre Stelle ein und veränderten damit drastisch das Bild der Stadt, das Gepräge ganzer Viertel. Eine Metropole hatte ihre Einwohnerschaft gewechselt und vieles, was in einer gut verwalteten Stadt so selbstverständlich funktioniert, daß es einem gar nicht auffällt, klappte in Sarajevo nicht mehr. Selbst im Stadtzentrum, wo die hohen repräsentativen Gebäude stehen und Tausende bei jeder Witterung bis spät in die Nacht flanierten, fühlte sich niemand für das, was um ihn geschah und was seiner eigenen Stadt widerfuhr, verantwortlich. Vier Einwohner wurden im letzten Winter von Eisbrocken erschlagen, die irgendwo in der Maršala Tita oder einem anderen Boulevard von sechs- und mehrstöckigen Häusern niedersausten, und immer wieder hörten wir auch in diesem Winter das eigentümlich sirrende Pfeifen, dem ein explosives Krachen folgte, wenn der Eisbrocken knapp neben oder hinter den mit gleichmütiger Eile ihren Zielen zustrebenden Leuten am Pflaster aufschlug.
Wir waren in einem Haus am unteren Ende der Provare untergebracht, nah bei der kleinen Moschee, die nie jemand besuchte, offenbar gar keine Öffnungszeiten hatte und deren Tor als einziges in der Straße völlig von den Schnee- und Eismassen freigeschaufelt war. Sie schien nicht in Betrieb zu sein, und doch rief zu den vorgeschriebenen Stunden aus ihren elektrischen Lautsprechern ein ferner Muezzin die Gläubigen zum Gebet. Mit ihrem Minarett stand sie in dieser Gegend wie ein Wahrzeichen dafür, daß der Islam gestärkt aus einem Krieg hervorgegangen war, der mit unerhörter Grausamkeit gerade gegen die Muslime gewütet hatte; gestärkt, weil erst die Ethnisierung der Politik viele wieder zu Muslimen machte, die sich vorher nicht zu einer Religionsgemeinschaft, nur zu einer vage islamischen Familientradition bekannt hatten.
Je höher es die Provare hinaufging, umso armseliger wurden die Behausungen, und ganz oben auf der Hügelkuppe stand in der ersten Querstraße, der ulica Selim Kurtočajska, das vorstädtische Wirtshaus Višnjik. Mit Ausnahme der wenigen Gäste, die zum Essen gekommen waren, saßen die Männer auch hier nicht um Tische herum, sondern an den Wänden der Gaststube entlang. Sie tranken, beachteten den Fernseher, der im Eck hoch über ihren Köpfen lief und dessen amerikanischem Film der Ton abgedreht war, nicht weiter, hörten dem leiernden Klagen der bosnischen Volkslieder zu, die beständig aus dem Radio kamen, und diskutierten über den Raum hinweg, durch den die resolute Wirtin, die einzige Frau, flink Bier und Schnaps servierte.
Die Wirtsstube war häßlich und heimelig, von der Decke leuchteten Neonröhren, am Tresen und bei den Fenstern standen Lampen mit roten Samtschirmchen, an jeder Wand hing ein Kalender mit vollbusigen Blondinen, die wenigen Tische waren mit Blumenvasen aus Kunststoff und elfenbeinfarbenen Plastikengeln verziert. Plötzlich wurde es laut, vier, fünf Männer brüllten quer durch den Raum auf einen ungerührten Hünen ein, der sie schreien ließ und wartete, bis sie aufhörten. Dann sagte er ein paar scharfe Worte, und wieder erhob sich ein Tumult, ein paar der Männer hielt es nicht auf ihren Plätzen, drohend näherten sie sich dem gelassenen Biertrinker, ballten im Schreien die Fäuste und blickten einander, da der Hüne sich nicht weiter um sie kümmerte, mitten im Brüllen hilfesuchend an.
Endlich sprang einer vor und drosch so fest auf das Tischchen des schweigsamen Provokateurs, der so sehr wie durch seine Reden mit seinem Schweigen zu provozieren wußte, daß er sich am Aschenbecher eine blutende Wunde holte. Damit war der Bann gebrochen, und alle begannen zu lachen, den Kopf über den tollen Ausbruch zu schütteln, der Große hielt die verletzte Hand des wieder lammfromm gewordenen Mannes fürsorglich in der seinen und drehte sie, den Riß begutachtend, hin und her, die Wirtin, gute zehn Jahre jünger als die meisten Männer, wies die Gäste schimpfend wie ungezogene Schulbuben zurecht, und in der Freude, die unvermittelt alle erfaßt hatte, wandten sich ein paar jetzt uns zu, die wir im Laufe des Abends immer verstohlener in unserer Ecke gesessen waren. Nachdem es lange genug hin- und hergegangen war, mußte ich ihnen doch bekanntgeben, was ich mit meinem Besuch in Sarajevo bezweckte, und als ich die Sepharden und die Jüdische Gemeinde erwähnt hatte, wurden sie merkwürdig ruhig, redeten nicht mehr durcheinander, aber einer nach dem anderen steuerte etwas zu dem Gespräch bei, das uns vielleicht interessieren oder uns weiterhelfen würde; Bjelave selbst, das ganze Viertel, war vor vielleicht hundert Jahren vornehmlich von Juden bewohnt gewesen, sagte der eine, aber das sei schon lange vorbei, und der nächste wollte uns unbedingt mit einem Bekannten zusammenbringen, der jetzt gerade nicht hier wäre, aber alles von der Geschichte der Stadt wisse, was der dritte mit einer verächtlichen Handbewegung als grobe Überschätzung kenntlich machte.
Der Hüne aber sagte einen Satz, der mich erschrecken und sogleich hoffen ließ, ich hätte ihn falsch verstanden und ihn mir nicht richtig zusammengereimt, doch wiederholte er ihn auf meine Nachfrage. »Ja, zu viele sind zuletzt Juden geworden!« Ein paar widersprachen, aber nicht heftig und nicht so, als wäre eben ein Tabu verletzt worden. War ich in dieser Stadt, von der die Juden sagten, sie kenne keinen Antisemitismus, in diesem schäbigen Wirtshaus am Rand eines schäbigen Viertels ausgerechnet dem einzigen Judenfeind begegnet? Als sie meine Unsicherheit bemerkten, redeten nun wieder alle auf mich ein, und was ich verstand, war dies: Weil die Juden, die Sarajevo verlassen wollten, im Konvoi aus der Stadt gebracht wurden und nach Amerika, Kanada, Israel, Spanien auswandern durften, hätten viele in ihrer Familiengeschichte zu suchen begonnen und eine jüdische Urgroßmutter gefunden oder eine andere jüdische Verwandtschaft erfunden. Und die Juden, als sie aus Sarajevo hinausgeschleust wurden, hätten sich vielleicht gewundert, welche Leute, die sie kannten, auf einmal auch Juden sein mochten, aber nichts weiter daran gefunden, daß sie die Stadt zusammen mit ihnen verließen.
Als die Wirtin die ganze Bagage hinauswarf, war es fast Mitternacht. Eben noch waren wir im warmen Wirtshaus eine Gemeinschaft der Zecher gewesen, doch kaum daß wir vor der Tür waren, verschluckte die Nacht die Gäste, die sich umstandslos in alle Richtungen davonmachten und sogleich in der Finsternis verschwunden waren. Die Stadtviertel auf den Hügeln hatten selten Straßenlaternen, und von den wenigen, die es gab, waren die meisten kaputt. Während unten, wenn man über die Maršala Tita in die Ferhadija, die erste Straße der Fußgängerzone, einbog, das städtische Leben selbst im Winter bis in die Nacht pulsierte, herrschte auf den Hügeln jene urplötzlich hereinbrechende ländliche Stille. Die Straßen starrten finster, und auch in den meisten Häusern waren die Lichter längst ausgeschaltet. Als wir die Provare abwärts rutschten, bellten aus den zerfallenen Schuppen und Garagen wütend die Hunde; am unteren Ende der Straße ragte das Minarett schwarz in die Nacht, und ich nahm mir vor, unbedingt Jakob Finci zu fragen, was es mit der Geschichte, die mir gerade erzählt worden war, auf sich hatte.
5
Von den acht Synagogen, die in Sarajevo gebaut wurden, stehen noch vier. Die erste, die auch den meisten Serailli unbekannt war, entdeckten wir vielleicht fünfzig Meter oberhalb der Altstadt in Mejtas, einem Viertel, das von einem der vielen Hügel im Norden zum Zentrum abfällt. In das schmutzige Plätzchen mündeten zwei Straßen und zwei enge Gassen, von denen die noch holprigere dem slowenischen Dichter Ivan Cankar gewidmet war. Das kleine, baufällige Gebäude wurde von Flüchtlingen bewohnt; eine Synagoge war das schon lange nicht mehr, doch erinnerten runde Email-Tafeln, die Davidstern und Menora zeigten, an die Geschichte des Hauses.
Die zweite, bedeutende Synagoge, einen großen grauen Quader fast ohne Fenster, fanden wir am Rande der Baščaršija, des Viertels um den historischen Bazar. Seit Jahrzehnten war in dieser Synagoge das Jüdische Museum untergebracht, von dessen Pracht uns viele Lokalpatrioten vorgeschwärmt hatten, die eigenartigerweise alle nicht wußten, daß das Museum schon im neunten Jahr geschlossen hielt, weil das kriegsbeschädigte bosnische Nationalmuseum es als Depot benutzte und tatsächlich vom Keller bis unter das Dach vollgeräumt hatte.