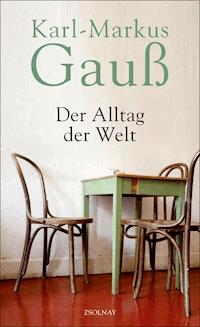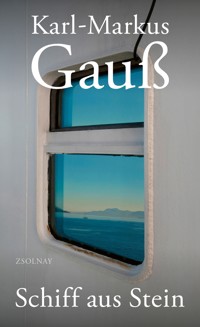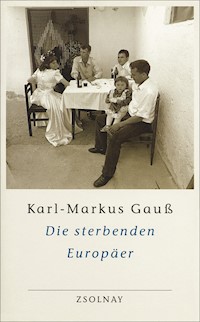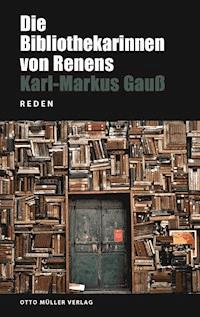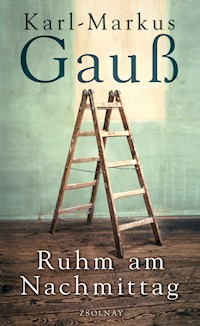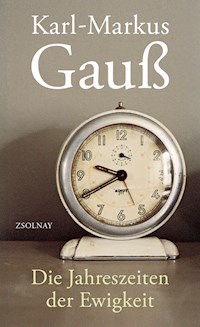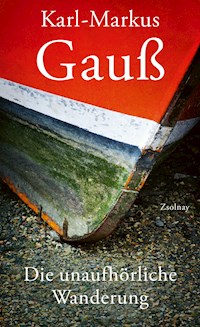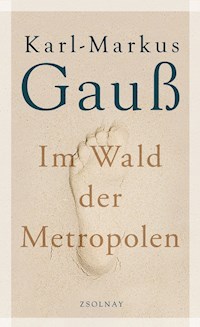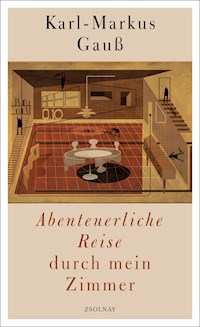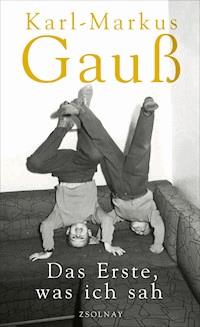Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Worum es in diesem Buch geht? Karl-Markus Gauß schreibt vom Irak-Krieg und von den Illusionen seiner aus der Wojwodina nach Amerika ausgewanderten Verwandten; er berichtet von profitablen Spermabanken und räsoniert über uralte Menschheitsfragen; er forscht seinem Vater nach, der "großen Portalfigur des Scheiterns in meinem Leben"; und die Lektüre berühmter, vergessener oder hierzulande wenig bekannter Autoren gerät ihm immer auch zur existentiellen Selbstprüfung.
Viele literarische Genres stehen diesem Autor zur Verfügung, dem die scheinbaren Nebensachen nicht weniger wichtig sind als die Widrigkeiten der Epoche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Worum es in diesem Buch geht? Karl-Markus Gauß schreibt vom Irak-Krieg und von den Illusionen seiner aus der Wojwodina nach Amerika ausgewanderten Verwandten; er berichtet von profitablen Spermabanken und räsoniert über uralte Menschheitsfragen; er forscht seinem Vater nach, der »großen Portalfigur des Scheiterns in meinem Leben«; und die Lektüre berühmter, vergessener oder hierzulande wenig bekannter Autoren gerät ihm immer auch zur existentiellen Selbstprüfung.Viele literarische Genres stehen diesem Autor zur Verfügung, dem die scheinbaren Nebensachen nicht weniger wichtig sind als die Widrigkeiten der Epoche.
Karl-Markus Gauß
Zu früh, zu spät
Zwei Jahre
Paul Zsolnay Verlag
Wie kann man sich über die Welt freuen,
außer wenn man zu ihr flüchtet?
FRANZ KAFKA
Es klingelte, ich öffnete die Tür, und
die Besucher fragten: Sind wir zu früh?
Nein, zu spät, sagte ich. Aber als sie wieder
gingen, war ich mir nicht sicher,
ob sie recht gehabt hatten oder ich.
CIRIL KOSMAČ
Es wird Krieg
JEDEN SAMSTAG GINGEN wir ins Nonstop-Kino, um nachzuschauen, ob immer noch Krieg war. Das Kino lag in der Innenstadt, am Ferdinand-Hanusch-Platz, und auf dem Weg aus der Salzburger Vorstadt debattierten mein um vier Jahre älterer Bruder Adalbert und ich mit meinem Vater heftig über alles, was wir letzte Woche gesehen hatten und was uns selber seither widerfahren war. Das Programm wechselte wöchentlich und bestand aus einer Abfolge von Weltnachrichten (Rede des Generalsekretärs U-Thant), Sportberichten (Horst Nemec im Länderspiel gegen Schottland wegen Spuckens ausgeschlossen) sowie einem Naturfilm, einer Slapstick-Episode und einem Zeichentrickfilm. Im Saal war ein dauerndes Kommen und Gehen, denn das einstündige Programm hatte keine festen Beginnzeiten; wenn es mit einem Durchlauf zu Ende war, folgte nonstop der nächste, und man hatte den Saal zu verlassen, wenn auf der Leinwand neuerlich die Bilder erschienen, die man beim Betreten als erste gesehen hatte. Wir verbrachten unseren Samstag nachmittag schon so, als ich noch nicht zur Volksschule ging, und hörten ein Jahrzehnt später damit nur auf, weil sich das Fernsehen durchgesetzt hatte, dem Nonstop-Kino die Besucher wegblieben und es geschlossen wurde.
Manchmal schafften mein Bruder und ich es, den Trickfilm zweimal anzuschauen, denn mein Vater, der zwei Berufen nachging, vormittags als Professor eines Mädchen-Gymnasiums, in dem er Deutsch unterrichtete, nachmittags als Chefredakteur der Wochenzeitung Neuland, die sich an die in viele Länder versprengten Donauschwaben richtete, schlief nach den Nachrichten zuverlässig ein. Indem wir auf Tom und Jerry warteten, erfuhren wir, daß in den Straßen von Algier, im Kongo und in Indochina noch immer gekämpft wurde und wer Ben Bella und Ben Barka waren, Lin Piao und Tschiang Kai-schek, Kasavuvu, Tschombé und Mobutu. Im Nonstop-Kino sahen wir, wie Patrice Lumumba, ein schlanker, würdevoller Mann, auf einen Lastwagen gehoben wurde, welcher mit ihm, der einen unvergeßlich traurigen Blick auf uns zurückwarf, und ein paar schwerbewaffneten, grinsenden Soldaten wegfuhr. Was ich vom Krieg wußte, hatte ich aus dem Kino und von dem Gespräch, das auf dem Weg ins Kino und nach Hause niemals abriß.
Das Jahr des Krieges begann mit einem Sturmangriff auf den Wiener Stephansdom. Seit den Nachmittagsstunden kamen die Freiwilligenverbände aus allen Bezirken in die Innere Stadt gezogen, wo sie mit den alliierten Hilfstruppen, die namentlich Italien entsandt hatte, zu straff geführten Bataillonen des Frohsinns vereint wurden. An den Buden und Ständen, die den Silvesterpfad markierten, wurden sie mit Punsch und guter Laune so reichlich verproviantiert, daß bereits Stunden vor Mitternacht die ersten Raketen in den Pulk der Verbündeten abgefeuert wurden und ausgelassen der Haß aller gegen alle hochschoß.
Einmal muß jeder Österreicher das Gefühl der Gemeinschaft erlebt haben, das sich auf dem Platz vor dem Dom zusammenballt, wenn die Massen aus den Gassen weniger quellen als von der namenlosen Gewalt der Nachrückenden hinausgepreßt werden, sodaß an Umkehr, Entrinnen nicht mehr zu denken ist. Wer jetzt nicht niedergestoßen werden möchte, muß seinen Willen dem Wogen ergeben, in dem er von hier nach dort geschaukelt wird. Vergebens richtet er den Blick nach oben, in den von Feuerwerkskörpern durchzuckten Himmel, in dem die Umrisse des Kirchturms mit seiner berühmten Glocke hinter Schwaden von Schwefel nur mehr zu ahnen sind. Dicht über die Stahlhelme, die keiner trägt, sausen heulend die Raketen hinweg, die an der steinernen Fassade der Kirche mit ihren zahllosen Türmchen und Giebeln einschlagen.
Im ganzen Land ist es das Dröhnen der großen Kirchenglocke, der Pummerin, das, in Radio und Fernsehen übertragen, den Beginn des Jahres bestimmt; einzig hier, zu Füßen des Turmes, in dem sie hängt, ist ihr Geläute nicht zu vernehmen, denn der Platz ist von einer viel größeren, eben erst erzeugten Glocke überwölbt, in die nichts von oben oder draußen dringt, sondern die in Hall und Widerhall verstärkt, was in ihrem Inneren abgeschossen, losgetreten, weggeschleudert, hochgeworfen wurde. Nirgends erfährt man daher so spät, daß es die erwartete Stunde endlich geschlagen hat, wie hier: an diesem Ort, den die Masse in ihren Besitz gebracht hat, ausgerechnet indem sie diszipliniert außer sich geraten ist.
Das neue Jahr ist gekommen, und es mehren sich die Anzeichen des Krieges. Seit Monaten sehen wir im Fernsehen gutgelaunte Leute, deren gute Laune es nicht trübt, daß wir sie für Lügner halten. Sie wissen, daß ihnen die Welt nicht glaubt, wenn sie den Krieg gegen den Irak, den sie jedenfalls führen werden, mit der Entwicklung, gar der Existenz von Massenvernichtungswaffen begründen, die den Despoten bald schon ermächtigen könnten, nicht nur die Iraker zu schinden, sondern den Angriff auf jene Demokratien des Westens zu wagen, die den Bluthund erst groß gemacht haben. Jeder Fernsehzuschauer weiß, daß es diesen Krieg geben wird, gleichgültig, was in den nächsten Wochen in New York verhandelt oder im Irak nicht gefunden wird, und jeder weiß, daß weder die Existenz irgendwelcher Waffen den Krieg herbeigeführt haben noch deren Vernichtung sein Ziel gewesen sein wird.
Seit Monaten sickert ein Gift in uns ein, das uns zu lähmen beginnt. Schon halten wir es für unausweichlich, daß wir belogen werden, und zwar von Lügnern, die wissen, daß wir sie dabei ertappen, und die dennoch fortfahren zu wiederholen, woran sie selber nicht glauben. Für unausweichlich, daß wir einer ehrlichen Auseinandersetzung über die wahren Gründe und die zu erwartenden Folgen des Krieges nicht für würdig gehalten werden. Unausweichlich, daß es Krieg geben wird und daß wir alle im privilegierten Status von Zuschauern dabeigewesen sein werden …
Die Unausweichlichkeit ist über uns verhängt, und wir erhalten Nachricht, daß der Mensch der Maschine unterlegen ist. Vier Wochen lang hat Gari Kasparow gegen Deep Junior gekämpft, als gelte es mit einem Sieg über den Computer die Ehre der Menschheit selbst zu verteidigen. Der beste Schachspieler wollte gegen den am höchsten entwickelten Schachcomputer beweisen, daß sich Vernunft und Phantasie gegen die Maschine zu behaupten wissen, die von einem bläßlichen Software-Spezialisten gewartet wird. Nimmt man diesen Kampf zum Maß, dann steht es schlecht um die Sache des Menschen, denn Kasparow konnte das Spiel nur eine Zeitlang unentschieden halten und unterlag schließlich mit den Symptomen körperlicher Erschöpfung, intellektueller Ratlosigkeit und moralischen Zerfalls.
Aber selbst die Nachricht, daß die Maschine über den Menschen gesiegt habe, ist eine Lüge. Sie läßt uns vergessen, daß der Computer von Menschen hergestellt, programmiert und bedient wurde. Die Maschine, in deliranten Kommentaren gepriesen, weil sie die Menschheit retten, oder verteufelt, weil sie diese vernichten werde, ist nicht das Schicksal des Menschen, sondern seine Erfindung. Und zeigen unsere Erfindungen auch die starke Tendenz, uns zu entgleiten, sind es doch wir, die für sie verantwortlich sind und darüber entscheiden, was wir mit ihnen, unseren Talenten und unserer Welt machen.
Tony Blair, dem das Grinsen wie eingewachsen ist und der, jenen gelifteten Frauen ähnlich, die keine Miene verziehen können, gänzlich aus diesem Grinsen zu bestehen scheint, das er nicht mehr aus seinem Gesicht bekommt, hat im englischen Parlament einen denkwürdigen Auftritt. Er weiß, was auch die Agenten des Geheimdienstes wissen, die ihm gefällige Gutachten erstellen: daß die Saddamisten dem Irak zwar ihre aberwitzige Tyrannei aufgezwungen haben, ihr Regime aber, mit seinen Mordapparaten vollauf im eigenen Lande beschäftigt, keineswegs über die Macht verfügt, den Angriff auf die reichsten Staaten der Erde durchzuführen, jene Waffen, oft gesichtet, niemals gefunden, zu entwickeln oder weltweit den Terrorismus zu finanzieren.
Blair scheint zu ahnen, daß ihm die Lüge, die er mit der Leidenschaft eines Schauspielers, der den Erweckungsprediger zu geben hat, im englischen Oberhaus, im amerikanischen Senat, vor der Uno verficht, eines Tages zum Verhängnis werden könnte. Deswegen begründet er den Krieg neuerdings nicht nur mit den vernichtenden Waffen, die der Irak binnen 45 Minuten zum Abschuß gegen die Metropolen des Westens bereitmachen könne, sondern auf originellere Weise: Die Welt, sagt er, und es gelingt ihm, eine persiflierende Kerbe Ernst in sein Grinsen zu zwingen, die Welt könne nicht länger hinnehmen, daß so viele irakische Kinder ihre ersten Jahre nicht überlebten. Als wüßte er nicht, daß Hunderttausende Kinder gestorben sind, weil es im Irak, seitdem Sanktionen gegen den Schurkenstaat mitsamt seinen Schurken und seinen Kindern erlassen wurden, Medikamente nur mehr für die Büttel des Regimes gibt!
Daß es Saddam und seiner Clique an nichts mangelt und daß es sie auch nicht schert, wenn Hunderttausende krepieren, steht außer Frage. Aber im englischen Parlament spricht kein Despot, sondern der Premierminister einer der ältesten Demokratien, und er, der seinen Anteil daran hatte, daß diese Sanktionen in Kraft blieben und Hunderttausende zu einem Sterben verdammten, über das sich die Welt all die Jahre nur mäßig erschüttert zeigte, begehrt jetzt Krieg zu führen, um die irakischen Kinder vor den Folgen der Sanktionen, also seiner eigenen Politik, zu retten! Die Sanktionen sind eine Massenvernichtungswaffe, nach der keiner gesucht hat, weil sie vor den Augen der Welt eingesetzt wurde.
Aufgewachsen in der Wojwodina, einer Region vieler Völker, über der noch der kalte Abendschein der österreichisch-ungarischen Monarchie lag, und ausgebildet am Priesterseminar von Travnik, war mein Vater ein konservativer, katholischer Mann, dessen Konservativismus und Katholizismus schon immer eine anarchische Tönung hatten, von der meine Mutter viele Episoden aus ihren ersten Ehejahren erzählen konnte; eine Tönung, die mit den Jahren so stark wurde, daß sie den Charakter des alternden Mannes selbst auszumachen schien. In der Zeit, da wir samstags im Nonstop-Kino Fidel Castro Basketball spielen, Ben Bella in die Verbannung gehen und Lumumba in den Tod fahren sahen, war dieser anarchistische Zug im Fünfzigjährigen schon stark ausgeprägt, denn mein Vater hielt es unbesehen mit jedem Aufstand gegen die »Weißen«, denen er kollektiv vorwarf, Scheinheilige des Christentums zu sein und die frohe Botschaft zu mißbrauchen, um gute Geschäfte zu machen. Nicht weil er die Rebellen in Afrika, Asien oder Südamerika schätzte — von deren politischen Zielen er vermutlich nicht viel wußte —, sondern weil er die selbstgefällige Christenheit als Lügenpack verachtete, sympathisierte er mit ihnen, gleich ob es sich um Mohammedaner, Hindus, Guerilleros oder Pazifisten handelte.
Den Kommunismus hielt er nicht für eine große Gefahr, sondern für die gerechte Strafe, die den Prassern der Erde zuteil wurde, und fast das schlimmste moralische Urteil, das er über Menschen zu fällen wußte, lautete, daß diese tüchtig seien. Wenn einer kommerziellen Erfolg hatte, hieß ihm das nichts anderes, als daß es sich um einen halben Ganoven und jedenfalls einen ganz langweiligen Kerl handeln mußte. Als er mit 62 Jahren als Chefredakteur der Zeitung, die er selbst gegründet hatte, entlassen wurde, verteidigten die Geschäftsleute, die im Konsortium des Unternehmens saßen und es ihm übelnahmen, daß er ironisch über ihre grandiosen Auftritte bei Landsmannschaftstreffen berichtete, den Rauswurf damit, daß der alte Professor vollends verrückt und Kommunist geworden sei. (Ja, damals war man mit 62 schon ein alter Mann.) Dabei sympathisierte er ideologisch und politisch keineswegs mit dem Kommunismus, ihm waren nur die Kapitalisten der großen Welt, mehr aber noch deren aufgeblasene Epigonen in der Provinz und am allermeisten deren aberwitzige Karikaturen in den Kreisen der Heimatvertriebenen zuwider. Als er, um sein Lebenswerk, die Zeitung, betrogen, in Pension geschickt wurde, stellte sich heraus, daß die Geschäftsleute für ihn 25 Jahre lang viel zu niedrige Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt hatten und daß er nur eine kleine Pension erhielt. Dieser Betrug hat ihn nicht gewundert, sondern erfüllte ihn mit der bitteren Genugtuung, sich in den Tüchtigen der Welt nicht getäuscht zu haben.
Die Ära des Populismus geht zu Ende, natürlich nur bis auf Widerruf. Hatten wir den Populismus nicht mit dem Zerfall der Demokratie selbst verwechselt und ihn im Zeitalter der umfassenden Medialisierung für jene verderbliche Kraft gehalten, die allen politischen Tugenden den Garaus bereitet? Jetzt zeigt sich, der geschmähte Populismus war gar keine Macht, sondern ein wirksames Mittel der Mächtigen, dessen sie sich bei Bedarf bedienen. Niemand will den Krieg, aber es wird ihn geben. Die Spanier lehnen ihn ab, aber ihr Premierminister Aznar läßt sie auf den Straßen niederknüppeln. Die Briten lehnen ihn ab, doch Tony Blair wird die britischen Truppen in den Krieg schicken, auch wenn das halbe Königreich dagegen auf die Straße geht. Warum wagen sie das, die doch alle gewählt wurden und wiedergewählt werden möchten? Sie wissen, daß nichts mehr hält, keine Erinnerung und keine Erkenntnis, und daß in der medialen Gesellschaft Gefühle und Stimmungen so rasant verschlissen werden, wie sie erzeugt wurden.
Was die Kriegsherren beschlossen haben, das machen sie jetzt gegen das Volk, dessen Wankelmut und leicht erregbare Stimmung sie sonst gerne als Ausrede bemühen, wenn sie Sinnvolles unterlassen oder Schädliches tun möchten. Nun aber widerstehen sie dem Populismus, der ihr Metier war, und setzen das Unpopuläre durch. Das könnte eine ermutigende Nachricht sein, sie erreicht uns aber als Botschaft, die eine Niederlage besiegelt. Abermillionen Menschen im Westen wenden sich ja nicht gegen den Krieg, weil sie schwärmerische Pazifisten wären oder schlappe Kostgänger ermüdeter Demokratien, in denen keiner mehr für Freiheit oder Gerechtigkeit einzustehen bereit ist, sondern weil sie die Litanei der Lüge als unerträgliche Propaganda empfinden, die ihre Intelligenz beschämt. Die meisten von ihnen wollen nicht einfach ihren Frieden im machtgeschützten Winkel haben, während anderswo die Menschen unterjocht bleiben mögen; aber immerhin die Wahrheit wollen sie erfahren, warum der Krieg gerade gegen diesen Tyrannen gerade jetzt ins Werk gesetzt wird. Was sie erfahren, ist jedoch, daß gänzlich ohne Belang ist, was sie wissen möchten, was sie denken und was sie verlangen. Die Ohnmacht ist einer jener Schäden, die der Krieg schon anrichtet, ehe er beginnt.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So endeten früher die Märchen, heute enden sie anders. Die California Cryobank ist die größte amerikanische Samenbank. In ihren Tiefkühltruhen schläft die Population einer Großstadt, die noch nicht gegründet ist und die man Death City oder Lifetown nennen wird, je nachdem.
Junge und alte Herren haben ihren Samen in der California Cryobank deponiert, weil sie sich für besonders schön halten, den kommenden Generationen ihre Intelligenz vererben möchten oder weil sie ganz durchschnittlich sind und gerade deswegen glauben, Anspruch auf Ewigkeit zu besitzen. Um 500 Dollar pro Jahr bleibt der Samen, in dem sie alle wesentlichen Eigenschaften ihrer selbst enthalten wähnen, so lange eingefroren, bis sich die dafür vorgesehene oder von der Vorsehung abgeordnete Frau meldet, um ihn sich ganz ohne die unanständigen Regungen sexuellen Begehrens einpflanzen zu lassen.
Es wird Krieg, und jene, die mit dem Tod von Berufs wegen zu tun haben, beginnen den eigenen zu fürchten. Die Soldaten, die sich bereitmachen, um in den Irak zu ziehen, sind jung, und viele von ihnen haben sich noch nicht fortgepflanzt. Jetzt fürchten sie, selber sterben zu müssen. Oder sich im Gefecht eine Verletzung zu holen, die ihre Fertilität auf immer zerstört; oder eine seelische Deformation, die sie, heimgekehrt zur liebenden Gattin, keinerlei sexuelle Wünsche mehr hegen oder gar den Traum vom familiären Glück vergessen läßt. Immerhin sind aus dem ersten Golfkrieg sympathische Boys mit den seltsamsten Macken zurückgekommen. Beim zweiten, der wie unaufhaltsam naht, hat die California Cryobank patriotisch gedacht und allen Soldaten Kriegsrabatt eingeräumt. Die toten Helden von morgen haben nicht mehr zu bezahlen als ihren Anteil an den monatlichen Stromkosten, die anfallen, wenn eine Großstadt der Zukunft ihre Bevölkerung in der Tiefkühltruhe frisch erhalten muß.
Ein paar tausend Soldaten haben, ehe sie auf die großen Schiffe oder in die Transportflugzeuge stiegen, tatsächlich ihren Samen in der Cryobank abgegeben — und brauchen den Tod in der Schlacht nicht mehr zu fürchten. Denn wenn sie erst gestorben sind, leben sie noch weiter; und mancher wird erst zum glücklichen Vater, der sich darüber nur mehr im Grab wird freuen können.
Auch in Österreich geschieht allerhand, mit den Toten und den Lebenden. Fast drei Jahre, also etwas länger als die US-Regierung für die Vorbereitungen des Irak-Krieges, hat die Republik Österreich gebraucht, um zu begründen, warum bei uns keiner dagegen zu protestieren braucht, wenn er von der Polizei erschossen wird. Im Mai 2000 widerfuhren einem Wiener Polizisten zwei Mißgeschicke. Zuerst hielt er einen 42jährigen Autofahrer für einen Drogendealer, dabei hatte er den Mann nur verwechselt. Dann wollte er den irrtümlich für einen Drogendealer gehaltenen Mann aus dem Auto heraus verhaften, wobei sich ihm versehentlich ein Schuß aus der Dienstwaffe löste, der den Drogendealer, der keiner war, in den Rücken traf und tötete.
Die Familie des Drogendealers, der keiner war, aber getötet wurde, wollte sich nicht damit abfinden, daß der Vater zweier Kinder einfach in der Bilanz polizeilicher Irrtümer abgebucht werde und sein Fall im Archiv der versehentlichen Amtshandlungen mit letalen Folgen verschwinde. Muß es, da immerhin ein Mensch von einem Beamten der Exekutive versehentlich erschossen wurde, weil er zuvor verwechselt worden war, nicht irgend jemanden geben, der sich dafür verantwortlich zeigt? Als der Polizist gerichtlich freigesprochen wurde, weil weder seinem Irrtum noch seinem Versehen böse Absicht oder unprofessionelle Arbeit zugrunde gelegen seien, wandte sich die Familie daher an den Unabhängigen Verwaltungssenat von Wien, mit dem Begehren, daß wenigstens der Staat für Irrtum und Versehen seines Beamten einstehe. Man braucht sich nicht zu wundern, daß der Unabhängige Verwaltungssenat sein Urteil über das Pech einer Verwechslung und den Zufall einer Erschießung erst nach so langer Zeit sprach, denn zu so einem Urteil und auf eine solche Begründung kommt selbst ein gewiefter Polizeijurist nicht von heute auf morgen.
So begründete der Richter Peter Fenzl sein Urteil, das den Polizisten ein weiteres Mal freisprach, den Staat aus der Verantwortung für seine schießenden Beamten entließ und dem Getöteten die Schuld an seiner zufälligen Anwesenheit am Ort seiner unbeabsichtigten Erschießung gab: »Es handelte sich bei der Vorgangsweise des Beamten, welche in weiterer Folge zum Tod des Imre B. führte, um eine in keinster Weise rechtwidrige Vorgangsweise, sondern handelte es sich bei dem sich versehentlich gelöst habenden Schuß um einen — wenn auch bedauerlichen — Unfall.« Noch bevor man darüber grübelt, was diese unabhängige amtliche Deutung einer in keinster Weise rechtswidrigen Erschießung für die nächsten sich versehentlich gelöst habenden Schüsse in Österreich bedeuten mag, fragt man sich, ob es künftig noch sinnvoll ist, Sprachschänder von Schreibtischtätern zu unterscheiden. Da sollen die Ausländer, die unter uns arbeiten und leben, verpflichtet werden, die deutsche Sprache in Kursen zu lernen, aber wenn einer nicht Halilović, sondern Fenzl heißt und nicht auf dem Bau, sondern im Unabhängigen Verwaltungssenat arbeitet, braucht er sich in keinster Weise darum zu scheren, was er der deutschen Sprache antut. Oder handelt es sich bei seinen versehentlich stattgefunden habenden Formulierungen in Wahrheit gar nicht um — wenn auch bedauerliche — Unfälle, wie sie sich bei bürokratischer Nutzung der Sprache eben einstellen? Der Verdacht liegt nahe, denn Fenzl steigert sich in seiner Urteilsbegründung in einen Sprachrausch, dem man anmerkt, welches Vergnügen er dem Enthemmten bereitet. »Das Verfahren hat keinerlei Hinweis dafür erkennen lassen«, fährt er fort, »dass das Verwenden der Waffe überschießend gewesen wäre.«
Ich versuche mir vorzustellen, was dieser Richter für ein Gesicht macht, wenn er die subtile Pointe zu Papier bringt, daß der Gebrauch einer Waffe, mit der ein Mensch erschossen wurde, keineswegs überschießend gewesen sei. Ich versuche mir vorzustellen, was die Frau und Kinder des Imre B., dessen Schuld es war, daß er zu einem bestimmten Zeitpunkt dort war, wo der Polizist, der ihn erschießen würde, ohne dabei überschießenden Gebrauch von seiner Waffe zu machen, darauf wartete, ihn zu verwechseln, was die Familie und die Freunde des Imre B. empfinden, wenn sie lesen, wie ein österreichischer Richter seine Amtssprache überschießend gebraucht, um die Angehörigen des Opfers seine Verachtung und ihre Ohnmacht spüren zu lassen. Hier liegt zweifellos ein vorsätzlicher Akt von Sprachschändung vor, und wo er ungeahndet bleibt, dort ist es unausweichlich, daß mitunter Schüsse versehentlich die irrtümlich ausgewählten Ziele treffen. Das Urteil sollte nachträglich eine staatlich exekutierte Gewalttat rechtfertigen; in Wahrheit aber kann es umgekehrt zu solchen gewalttätigen Unfällen nur kommen, weil diesen eine amtliche Verrohung der Sprache vorausgeht, welche Polizisten, die für überschießende Verwechslungen empfänglich sind, ermuntert, sich gegebenenfalls in keinster Weise zurückzuhalten.
Die Erschießung des Imre B. hat den Staat keinen Cent, die Anrufung des Unabhängigen Verwaltungssenats die Familie hingegen einiges gekostet. Für den Bescheid, daß ihr Mann, der am Morgen des Tages, dessen Abend er nicht mehr erleben sollte, noch munteren Sinnes aufgestanden war, im Einklang mit allen Gesetzen, also vollkommen rechtens getötet wurde, sind der Witwe im einzelnen 41 Euro an »Vorlageaufwand«, 203 Euro an »Schriftsatzaufwand« und 254 Euro für »Verhandlungsaufwand« berechnet worden. Denn umsonst ist nur der Tod, das Recht aber gibt es nicht gratis.
Sprachpolitik. Am 28. Februar verliest der österreichische Bundeskanzler die Regierungserklärung, mit der die neue, alte Regierung ihr Amt antritt. Gezählte 29mal verwendet Schüssel ein Wort, das von seinen Vorgängern schon so oft durch die politische Phrasenschleuder gedreht wurde, daß es völlig ausgewaschen war und dringend mit neuer Bedeutung imprägniert werden mußte. 29mal »Reform«, und tatsächlich hat Schüssel kein einziges Mal gemeint, was bisher damit bezeichnet oder immerhin vorgegaukelt zu werden pflegte. Die Reform, mit der einst der Sozialstaat ausgebaut wurde, ist ihm der Schlaghammer, diesen zu demolieren.
In der TV-Sendung »Das Politbarometer« wird der statistische Deutsche danach vermessen, um wie viele Promille bei ihm die Zuneigung für den einen oder die Abneigung gegen den anderen Politiker seit dem letzten Monat gestiegen sei oder welche Eigenschaften er den Parteien zuordne (soferne er unterscheidende Eigenschaften kennt, die er zuzuordnen vermag). Zum ersten Mal konnte ich so erfahren, daß in Deutschland zwei Dinge längst getrennt werden, die in Österreich lange für nahezu identisch galten. Das Politbarometer zeigte nämlich an, daß die meisten Deutschen die SPD für eine »soziale«, die CDU hingegen für eine »fortschrittliche« Partei hielten. Ob sie mit dem einen, dem anderen oder beidem unrecht haben, möchte ich nicht beurteilen, wie mich auch das Geständnis des deutschen Kanzlers Schröder, wonach er keine linke und keine rechte Wirtschaftspolitik mehr kenne, nur eine richtige und eine falsche, durchaus im unklaren darüber beläßt, welcher Partei eigentlich er selber angehöre. Probieren wir es vielleicht am besten auf seine Weise: weder der sozialen noch der fortschrittlichen, sondern (wahlweise anzukreuzen) der falschen beziehungsweise der richtigen.
Als ich Schüssel 29mal Reform sagen hörte und jedes Mal eine Veränderung gemeint war, die sozialen Rückschritt verheißt, begriff ich, daß Österreich einen Kanzler von deutschem Format hat. Er ist unsozial, aber fortschrittlich, ein Modernisierer, der soziale Errungenschaften nur der besseren Zukunft wegen bekämpft und weil es die Sache eben erzwingt.
Der Sachzwang! Die über Menschen und Güter gebieten wollen, pflegen ihn anzurufen, wenn es ihnen gilt, eine Sache zu ihren Gunsten zu wenden. Das erstickende Gefühl der Unausweichlichkeit hat sich breitgemacht, es zu verbreiten, ist eine Technik der Herrschaft.
Im Deutschlandfunk höre ich zu Mittag vom Medikamentenskandal der Firma Bayer. Eine Arznei gegen Bluthochdruck hat etlichen Patienten zu einem so niedrigen Blutdruck verholfen, daß er gar nicht mehr zu messen war und sie folglich von der internen Abteilung in die externe, auf den Friedhof, verlegt werden mußten. Der Ruf von Bayer hat unter den Enthüllungen sehr gelitten, an der Börse notiert die Firma mit schweren Verlusten. Der Reporter, mitfühlend mit den Anlegern, nicht mit den definitiv Abgelegten, schließt: »Und die Zeche werden natürlich wieder die Aktionäre zu zahlen haben.«
Daß mein Vater die »Krämerseelen« so innig verachtete, hatte höchst angenehme Begleiterscheinungen für mich. So schlechte Nachricht konnte ich aus der Schule gar nicht nach Hause bringen, daß er sie nicht mit verächtlicher Gebärde vom Tisch gewischt hätte: Was hatte uns schon zu scheren, ob uns ein beschränkter Kleingeist, der zufällig Chemie unterrichtete, für faul oder frech hielt? Mit Lappalien wie schlechten Noten oder disziplinären Vergehen wollte er wahrlich nicht behelligt werden, und so kann ich mich nicht erinnern, in meinen letzten Schuljahren mit ihm, mit dem ich über so vieles sprach — über Dostojewski, die österreichisch-ungarische Militärgrenze, die Geheimorganisationen der Exilkroaten in Salzburg, die deutschsprachigen Zeitungen von Toronto —, auch nur ein einziges Mal über mein schulisches Fortkommen gesprochen zu haben. Als ich ihm in der achten Klasse des Gymnasiums doch einen Stoß mit Formularen vorlegen mußte, auf denen er mit seiner Unterschrift zu bestätigen hatte, daß die vielen Fehlstunden, auf die ich durch zu spätes Erscheinen in der Schule oder durch vorzeitiges Verlassen derselben aus Gekränktheit oder Langeweile gekommen war, allesamt von Krankheit verursacht waren und mithin zu entschuldigen seien, hat er mich verdrossen gefragt, ob ich eigentlich zu blöde oder nur zu faul sei, endlich zu lernen, wie man seine Unterschrift fälsche.
So wenig er mich für Versäumnisse tadelte, so wenig lobte er mich für schulische Leistungen. Als ich mir schließlich die ersehnte Matura zuzog, hat er es zur Kenntnis genommen, ohne sich erleichtert darüber zu zeigen. Ihm, dem Lehrer, war einfach nicht wichtig, was seine vier Söhne in der Schule leisteten.
Was, wenn meine Enkel mich eines Tages fragen, welche Schlagzeilen damals in den Zeitungen zu lesen waren, als ich, ihr ausgeglichener, zukunftsfroher Opa, noch ein reizbarer Mann von fünfzig Jahren war? Solche: »Herzstich statt Erstickungstod. Ärzte präsentieren in Wien die jüngsten Fortschritte in der pränatalen Medizin.«
Und wenn sie weiterforschen, was sonst noch geschrieben stand, werde ich ihnen gestehen müssen, in derselben Zeitung am selben Tag zum Beispiel gelesen zu haben: »Avantgarde als Befreiung vom Terror des Sinns.«
Dann aber werden sie ungläubig den Kopf schütteln und fragen, warum wir uns damals, als sie noch nicht einmal das pränatale Stadium erreicht hatten, das einzige, das Sicherheit verheißt vor dem Fortschritt des Herzstichs und dem Terror des Sinns — ein Zustand, der aber auch der langweiligste ist, so langweilig, daß er sich gar nicht denken läßt —, warum wir uns damals solche Sachen gefallen ließen? Nun eben, weil wir in einer Ära des Fortschritts lebten und Krieg gegen den Terror geführt wurde. Und dieser Krieg auch in unsere Sprache eingedrungen war, so tief, daß viele gar nicht merkten, wie er aus ihnen sprach, ganz gleich, worüber sie sprachen, über Fortschritte der Medizin oder über die künstlerische Avantgarde.
Und Opa, was ist Avantgarde? Herrliche Zeiten, in denen ich selbst darauf mit ruhiger Stimme werde antworten können! Später, wenn ich zur Ausgeglichenheit gereift sein werde und mich kein gerechter noch ungerechter Zorn mehr reizt, zu sagen, daß die Avantgarde zu meiner Zeit schon lange nicht mehr leichtfüßig trippelte, sondern ordensbehangen am Stock einherschritt und … Ach was, das mit der Avantgarde hebe ich mir wirklich für den Opa auf, der im pränatalen Stadium in mir schlummert. Solange er noch nicht erwacht ist, muß ich mich an Experten wie den Direktor des MOMA von New York halten, der gestern in einer Kultursendung des deutschen Fernsehens (es hätte auch das Wirtschaftsmagazin oder ein Report über den nahenden Krieg sein können) gelassen erklärte, daß Andy Warhol deswegen der größte Künstler der Epoche sei, weil er als erster »Atombomben, Schauspieler und Coladosen künstlerisch gleich behandelt« habe. Der Mann, der das sagte, war ein eleganter älterer Herr, der sich bereits zu jenem gemütvollen Gleichgewicht ausbalanciert hatte, das mir noch abgeht, und auf die soignierte Weise, mit der er sehr für sich einzunehmen wußte, hatte er selbst gar nicht bemerkt, daß sich in seinem aparten Satz nicht weniger als der Untergang der Menschheit ereignete. Ja, Massenvernichtungswaffen, Coladosen und Schauspieler — in der Politik gehören sie auch zusammen, aber nur in der Kunst nennen sie es Avantgarde.
Wer geglaubt hat, der englische Premierminister würde gegenüber der amerikanischen Kriegsregierung europäische Ansichten und Interessen verfechten, sieht sich um seine Illusionen betrogen. Nein, Blair unterwirft sich ohne Wenn und Aber, fast hat man den Eindruck, die amerikanische Öffentlichkeit sei verwundert, daß er nicht wenigstens auf ein paar europäischen Bedenken beharre, sondern von sich aus den gehorsamen Vasallen gibt, den man ihm abzuverlangen gar nicht gewagt hätte. Was drängt ihn dazu? Sind es die alten Bande, die England mit den Vereinigten Staaten verbinden, oder ist es das alte Mißtrauen, das viele Briten gegen Europa hegen? Politik des Sentiments also oder des Ressentiments? Vielleicht beides, aber es kommt noch etwas ganz anderes dazu.
In das Siegen verliebt, hält Blair die USA für die einzige Macht, die im Weltmaßstab auf absehbare Zeit immer siegen wird. Und es ist ihm lieber, mit dieser Macht zu irren, als gegen sie recht zu behalten.
Diese Vorliebe teilt er mit vielen, nicht nur in England; auch der Leiter eines österreichischen Instituts für internationale Politik, ein Sozialdemokrat notabene, ließ kürzlich verlauten, es sei klüger, den USA, die immerhin eine Demokratie seien, auf einem Irrgang zu folgen, als sich mit einer Diktatur gegen sie zu stellen, die doch eine Diktatur bleibe, auch wenn sie zu Unrecht angegriffen werde. Andere wiederum geben gleich ihr Credo quia absurdum ab und leiten die Notwendigkeit, die USA unbesehen zu unterstützen, aus der Illusion ab, nur so mäßigenden Einfluß auf sie ausüben zu können. Das Falsche tun, damit der andere nicht versucht sein könnte, es alleine zu tun und sich womöglich noch wütender in das Falsche zu verbeißen: auf diese Logik muß einer erst kommen!
Dabei ist sie altbekannt. Immerhin war sie stalinistisches Programm. Lieber mit der Partei irren, als gegen sie recht haben, mit dieser Emphase der politischen und moralischen Selbstaufgabe haben Hunderttausende Genossen ihren Zweifel an der KPdSU, an der brüderlichen Vormacht der Sowjetunion, an den gleichgeschalteten kommunistischen Parteien aller Länder immer neu unterdrückt. Diese Selbstpreisgabe hat das Schweigen über unzählige Verbrechen miteingeschlossen, ja viele dazu veranlaßt, diese Verbrechen wider besseres Wissen zu rechtfertigen oder gar an ihnen mitzuwirken. Auf denn! Ins Schlachtfeld, damit der Gute, wenn er das Böse tut, Unterstützung hat.
(Allerdings: »europäische Ansichten und Interessen« — gibt es das überhaupt? Vermutlich eher als Werte, die exklusiv »europäische« wären. So es sich bei diesen tatsächlich um Werte handelt, sind sie in Wahrheit im doppelten Sinne universell: Weder kommt ihnen Gültigkeit exklusiv für Europa zu, sondern für alle Menschen, noch sind sie in Europa selbst ein ungefährdeter, gesicherter Besitzstand. Europa hat nicht nur Werte in die Welt gesetzt, die es verdienten, überall respektiert zu werden, sondern diese immer wieder auch aus eigenem zerstört. Was für die europäische Geschichte gilt — daß die edlen europäischen Werte periodisch außer Kraft gesetzt wurden, um anderen, weniger edlen, aber ebenso europäischen zum Durchbruch zu verhelfen —, gilt heute nicht minder: Welche europäischen Werte wird Berlusconi, der in wenigen Monaten die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernimmt, nicht scheinheilig beschwören und zugleich bekämpfen, außer jene, zugegeben, die sich monetär umrechnen lassen?
(Berlusconi, der Teufelseintreiber Europas.)
Am Morgen des 17. März nehme ich beim Frühstückstee die Neue Zürcher Zeitung zur Hand und sehe auf der ersten Seite drei fesche Herren in ihren besten Jahren um die Wette strahlen. Der eine, in der Mitte, lächelt bubenhaft verschmitzt, als sei ihm gerade Großes gelungen, das ihm keiner zugetraut hätte, und heißt Aznar; der zweite, links von ihm, ein großer, schlanker Mann, bleckt die Zähne in wohlgefälliger Erwartung von irgendwas, das er freundlich zermalmen könnte, und streckt seine Hand zu dem etwas kleineren Mann gegenüber, der den Gruß mit einem tiefen Blick und offenbar mit einem ausgelassenen Zuruf bedankt. Bush, Blair und Aznar haben sich auf den Azoren getroffen, und der Fotograf hat den Moment eingefangen, da sie sich voneinander verabschieden und ihre gute Laune feixend kaum zurückhalten können. Immerhin haben sie gerade beschlossen, daß der Angriff auf den Irak pünktlich zur festgesetzten Stunde erfolgen und in drei Tagen der Krieg beginnen wird, auf den sie es von Anfang an abgesehen hatten und den sie unter Verletzung des Völkerrechts und der Uno-Charta zu führen entschlossen sind.
Auf dem Residenzplatz, der am Märznachmittag im kalten Schatten des Domes liegt, kommt mir R. entgegen. Schon seit dreißig Jahren kennen wir uns so gut, daß wir es vorziehen, nicht miteinander befreundet zu sein, aber immerhin stehenbleiben und ein wenig plaudern, wenn wir uns im Foyer eines Kinos, in einem Geschäft, am Markt oder auf der Straße erblicken. Meist enden unsere zufälligen Treffen damit, daß der eine zum Abschied beteuert, demnächst den anderen anzurufen, um endlich einen Termin im Café auszumachen. Seit dreißig Jahren ruft der eine wie der andere nie an, und auf der Übereinkunft, daß es auch so bleibe, gründet das herzliche Verhältnis, das wir haben.
Heute legt R., der sonst mit umständlicher Ironie zu sprechen beliebt, wüst los. Er ist in erregter Stimmung und schimpft fürchterlich über diesen Idioten Bush und die idiotischen Amerikaner, die ihn gewählt und damit ermächtigt haben, sich mitsamt seinen Getreuen über Recht und Vernunft hinwegzusetzen und die ganze Welt zu behandeln, als sei sie in amerikanischem Privatbesitz, und über diese idiotischen Staaten Osteuropas, von denen nächstes Jahr zehn zur Europäischen Union gehören werden und die jetzt nichts anderes zu tun haben, als Bush zu versichern, daß sie ihn bei seinen wahnwitzigen Kriegsplänen und Welteroberungsabsichten unterstützen werden … Empört zählte R. alles auf, was mich selber empörte, und wie ich ihm zuhörte, hätte ich in seine Tiraden einfallen können, so bekannt waren sie mir von den wütenden Selbstgesprächen, die ich auf dem Weg in die Stadt bereits geführt hatte, als ich, in meinen weltpolitischen Ärger versunken, achtlos an den winterlichen Gärten der Riedenburg vorbeigestapft war.
Es geschah mir in den letzten Jahren nicht selten, daß ich R. anschaute und mir dabei auffiel, wie alt ich selber geworden war, denn an seiner über die Jahre ins Korpulente ausgewachsenen Gestalt und dem vermutlich vom Rotwein etwas aufgedunsenen Gesicht konnte ich, wie es bei zwei Leuten eben ist, die sich seit dreißig Jahren kennen, unschwer das Alter ermessen, in das ich mit ihm geraten war. Nach und nach hatte R. sich heute seinen Zorn von der Seele geredet, und er schloß seine Scheltrede, die ganz die meine war, indem er sich von mir zu entfernen begann und meinte, die Amerikaner würden sich noch sehr wundern und den Tag bereuen, an dem sie den Krieg gegen den Irak begonnen hätten. Dabei klang eine böse Zufriedenheit aus seiner Rede, eine Zufriedenheit im voraus, daß er die Arroganz der jetzt so patriotisch entgeisterten Amerikaner noch selber mit einem langen Krieg, einem gar nicht so einfachen Waffengang, großen Verlusten, beschämenden Niederlagen bestraft sehen werde.
Als ich alleine im Schneetreiben weiterzog, wurde mir die ganze Rede des R., die von mir hätte sein können, mit einem Mal schal. Er, der den Krieg gegen den Irak ablehnt, hofft insgeheim schon, daß es ein langer und blutiger Krieg werde. Weil er gegen ihn ist, soll er denen, die ihn herbeiführen, wenigstens nicht leicht gelingen. Ihn empören die Vorbereitungen des Krieges, aber eher mit Schadenfreude als mit Sorge sieht er voraus, daß es so leicht, wie sich das die amerikanischen Strategen vorstellen, wohl nicht gelingen werde, den Irak zu besiegen und zu befrieden.
Aber, denke ich mir auf dem Heimweg, wenn es schon zum Krieg kommt, gegen den ich bin, muß ich dann nicht hoffen, daß er möglichst schnell zu Ende geht? Und da weder daran zu denken ist noch etwas Gutes daran wäre, daß das irakische Militär den Krieg mit einem großen Schlag gegen die Invasoren gewinne, kann ich da anderes als einen raschen Sieg der alliierten Truppen wünschen? Schließe ich mich damit jenen an, die lieber mit den USA irren als gegen sie recht behalten wollen? Habe auch ich mich also in das Unausweichliche gefügt, das nur unausweichlich ist, eben weil wir uns darein fügen?
Man muß gegen den mit Lügen begründeten, das Völkerrecht verletzenden, die Uno schwächenden, Unsicherheit und neues Unrecht in die Welt setzenden, Tausenden den Tod bringenden Angriff auf den Irak sein, aber man kann dennoch nicht darauf hoffen, daß dieser den Angriff werde zurückschlagen können. Das Regime Saddams soll stürzen, je eher, desto besser, und daß der Krieg kurz währe, der Widerstand der irakischen Truppen rasch erliege, das ist vor allem für die Iraker selbst zu hoffen. Gleichwohl, die amerikanische Politik hat die ganze Welt vor den Zwang einer falschen Alternative gestellt: für diesen verlogenen Krieg, der als gefährliches Exempel einer neuen Weltordnung konzipiert ist, oder für das verkommene Regime Saddams zu sein. Was bleibt, was bleibt mir? Nichts, als aufzuzeigen, daß die Alternative falsch ist und daß, indem wir uns zwischen den beiden Möglichkeiten entscheiden sollen, ein ungeheurer Zwang über die Welt verhängt wird.
Im Winter der schlechten Erwartung wächst in mir die Sehnsucht, mich vom elenden Zwang der Politik, vom Zwang zur politischen Wahrnehmung der Dinge zu befreien. Unruhig gehe ich dann zu Hause die Regale entlang, auf der Suche nach einem Buch, das mich in der Ära des Unvermeidlichen daran erinnert, daß die Dinge im Fluß sind und die Welt noch nicht fertig ist. Schön ist es immer, in einem Buch von Dzˇevad Karahasan zu blättern, der einst als Flüchtling nach Salzburg gekommen ist und mich ein paar Jahre später, unablässig mit der beschwörenden Dringlichkeit sprechend, die ihm eigen ist, durch seine Heimatstadt Sarajevo geführt hat. Jetzt, da wir einander aus den Augen verloren haben und nur aus der Ferne mit Zuneigung verfolgen, was aus dem anderen wird, hat er mir sein »Buch der Gärten« geschickt, das herrlich unzeitgemäß ist und doch ans Herz der Epoche rührt.
Christentum und Islam entstanden in Wüstenregionen. Wahrscheinlich deswegen teilen sie die Vorstellung, daß das Paradies ein Garten ist. Karahasan grübelt über die alte Frage, ob das Paradies vor dem Anfang aller Dinge lag oder sich erst nach dem Ende der Geschichte öffnen wird. Mir ist die eine wie die andere Vorstellung fremd, aber ich bin auch nicht religiös, wie Dzˇevad es auf seine Weise ist, sondern überzeugt, daß die Geschichte kein Ende haben wird, weil sie das Schicksal des Menschen ist, sein Fluch und die Bedingung seiner Freiheit. Es gibt kein Entrinnen aus ihr, einfältig, wer es dennoch versucht, seelenlos, der sich nicht manchmal danach sehnte.
Die Gärten der Welt zeugen Karahasan von der Sehnsucht nach dem Paradies, sei es, daß sie »Erinnerungen unserer Seele« sind oder »Versprechen, mit denen die Erde uns versichert, daß das Paradies möglich sei«. Der Garten ist ihm ein spiritueller Ort, der mit jenem Stück eingezäunter und möblierter Natur, für dessen professionelle Pflege es in den Buchhandlungen eigene Abteilungen mit Garten-Ratgebern gibt, nicht viel zu tun hat. Gleichwohl gilt ihm, dem intellektueller Hochmut abgeht, selbst der bescheidene, spießig gehütete Hausgarten als Abbild des Paradieses, das zu preisen er weder den Theologen noch religiösen Fanatikern überlassen möchte.
In Sarajevo hat er mir damals gezeigt, wie viele Parks es in seiner Stadt gibt, von denen die Bewohner Sarajevos, die Serailli, aber nur einen auch so nennen: den »Park«. Dessen unterer, flacher Teil, durch den wir flanierten, ist eine österreichische Anlage und bietet, was ein mitteleuropäischer Park zu bieten hat: geometrisch angelegte Wege und ornamental geordnete Blumenbeete, einen Springbrunnen in der Mitte, viele Bänke, auf denen, wenn der Winter vorüber ist, die unterschiedlichsten Leute rasten. Den beherrschten Manierismus mitteleuropäischer Parks, diese zur strengen oder verspielten Form gezähmte Natur, bringt Karahasan mit dem »komplizierten multireligiösen, multikulturellen, multiethnischen Kosmos Mitteleuropas« in Verbindung. Die soziale Realität ist in dieser eng besiedelten, von Zuflüssen aus verschiedenen Richtungen gespeisten Region so komplex, daß sie öffentlicher Räume bedarf, in denen die Menschen gehend, schauend, verweilend erkennen, daß alles Wilde, Spontane und Triebhafte auch beherrscht werden kann.
Der andere, hügelan steigende Teil des Parks ist orientalisch, er dient nicht der sozialen Integration, sondern der mystischen Erfahrung. Die Bäume wachsen, wie sie wollen, der Rasen überwuchert die Wege, Bänke sind nirgendwo zu finden. Die Leute, die hier gehen, suchen niemanden, mit dem sie ein wenig tratschen könnten, sondern die Einsamkeit, die Begegnung mit »toten und künftigen Menschen« oder mit sich selbst. Das Besondere an Sarajevo ist nicht nur, daß es den großen Garten des Islam und des Christentums in ein- und derselben Stadt beherbergt, sondern daß es diese beiden grundverschiedenen Formen von Garten in einem einzigen Park vereint.
Vor drei Jahren, im Winter 2000, waren die gewaltigen Schneemassen zementartig erstarrt, sodaß wir in manchen Gassen der Vorstadt tatsächlich auf den Dächern eingeschneiter, zugefrorener Autos gingen, in die Fenster im ersten Stock blickten und in hochmütiger, luftiger Höhe debattierten. Wenn er wort- und gestenreich das verleumdete und bekämpfte Erbe der Vielfalt beschwor, leuchtete in Dzˇevads Blick jedoch ein Glanz der Verzweiflung. Er sprach im Präsens, aber eigentlich war es schon eine Erzählung im Imperfekt, diese Stadtführung, die an jenem Punkt in der Innenstadt begann, von wo man nach den vier Himmelsrichtungen eine Moschee, eine Synagoge, eine orthodoxe und eine katholische Kirche sehen und so ermessen kann, daß in der Topographie Sarajevos einst sinnfällig jene Kreuzung von Christentum, Islam und Judentum angelegt war, die diese Stadt ausgemacht hat. Aber der Krieg hat nicht nur viele tausend Serailli das Leben gekostet, sondern unzählige auch in alle Welt vertrieben, und Sarajevo wird heute von anderen Menschen bewohnt, die mit »der Stadt« (Sarajevo war das bosnische Synonym für die Stadt schlechthin, für das Urbane, Weltläufige) und ihrem Leben wenig verbindet, vertriebene, geflüchtete Leute vom Land, denen die städtische Lebensform mit ihren fließenden Übergängen, ihren Fragwürdigkeiten für fremd, verwirrend, sündhaft gilt. Ich war mir nicht sicher, ob Dzˇevad an die Wiedergeburt Sarajevos glaubte, aber er ist jedenfalls, kurz bevor ich ihn besuchte, nach jahrelanger Wanderschaft dorthin zurückgekehrt.
Zum Jahreswechsel vor drei Monaten waren wir mit unserer Tochter nach Wien gereist, weil sie Silvester auch einmal auf dem Stephansplatz erleben wollte. Ich stand inmitten von Tausenden, und was mich anfaßte, war nicht wohlfei-ler Hochmut gewesen, der sich über das Vergnügen der Tobsucht, über diese schlagbereite Verbrüderung erhaben wähnt, und auch nicht Angst, die einem im Lärm, Geschrei, im Knallen und Blitzen rundum nach einiger Zeit doch erstirbt, sondern das Gefühl der Verlassenheit. Daß immerhin dieses Gefühl nicht nur mein eigenes war, sondern mich mit Unzähligen verband, die verbissen jubelten, davon möchte ich überzeugt bleiben. Und wäre es auch ein Mißverständnis, daß es so sei, schützte es mich doch vor dem Dünkel der Überlegenheit, der gemeiner ist als der Gemeine, gegen den er die Kultur, die Zivilisation, den Humanismus, weiß der Teufel was schützen zu müssen glaubt.
»Dünkel der Überlegenheit«, das ist eine der Wendungen, die ich von meinem Vater geerbt habe. Er hat sie oft verwendet, auch in manchen seiner Artikel, in denen er die großdeutsche Verblendung vieler Heimatvertrieber, nein, ihrer politischen Vertreter, der Heimatvertriebenen von Berufs wegen, geißelte. Er hatte, in Palanka in der Batschka geboren, in Zagreb und im südungarischen Szeged studiert, dann an der Deutschen Lehrerbildungsanstalt von Werbaß unterrichtet und ist gewiß das geworden, was auf kroatisch mit einem Lehnwort aus dem Deutschen, das es im Deutschen gar nicht gibt, »Luftinspector« heißt: ein Mensch, der sich vornehmlich nicht zu ebener Erde, sondern in den oberen Etagen seiner eigenen Welt aufhielt. In seiner außergewöhnlichen Bildung, die er uns in mäandernden Vorträgen darlegte, war er so lebensfremd, daß es mir, selbst als ich mich mit sechzehn, siebzehn Jahren von den Eltern zu entfernen begann, einfach unmöglich war, nicht wenigstens einmal täglich auf ihn stolz zu sein.
Jänner—März 2003
Ob’s zusammengehört?
CHARLES-LOUIS DE SECONDAT war ein Titan der Gelehrsamkeit, der ein Leben lang nach der richtigen Methode suchte, den Überblick über das, was er gelesen, gedacht, entdeckt, gesammelt hatte, nicht zu verlieren. An den Manuskripten, die sich in seinem Nachlaß fanden, lassen sich nicht weniger als neunzehn verschiedene Handschriften nachweisen, so viele Sekretäre hatte er im Laufe der Jahre angestellt. Zeitweise dienten ihm sechs Vorleser, die aus den Büchern, welche sie ihm vortrugen, Exzerpte anzulegen hatten, während er selber unentwegt weitere Sammlungen anfertigte, denen er seine Gedanken über Gelese-nes und Gehörtes anvertraute. Unermüdlich arbeitete er so daran, auf seinem Landsitz in La Brède bei Bordeaux eine Bibliothek aufzubauen, die vollständig auf seine eigenen schriftstellerischen Pläne ausgerichtet war. Denn er hatte nichts anderes im Sinn, als Bücher zu schreiben, in die alles einfließen sollte, was er jemals an Erzählenswertem gehört und an Bedenkenswertem gedacht hatte.
Stetig legte er neue Zusammenfassungen an, Extrakte aus seinen bald schon ins Unüberschaubare gewachsenen Aufzeichnungen, die er mit Titeln wie »Spicilège« (Ährenlese) versah oder unter der Bezeichnung »Exzerpte meiner Exzerpte« archivierte. Die gewaltigste, die Sammlung aller Sammlungen, über dreißig Jahre erweitert und verändert, hat er schlicht »Mes pensées« genannt.
Der Versuch, sein gesamtes Wissen, das Wissen seiner Epoche so zu verwalten, daß es ihm jederzeit verfügbar war, mußte scheitern. Dieses Scheitern ist das Hauptwerk des Barons de la Brède et Montesquieu; es ist ein glorioses Scheitern, in dem sich am Beginn der Moderne schon deren Fluch zeigt: Sie vermehrt das Wissen von der Welt so sehr, daß diese selbst nicht mehr als Einheit erfaßt, nur als fremde Übermacht erlebt werden kann.
Montesquieu wird heute einzig mit der monumentalen Abhandlung »De l’esprit des lois« (»Über den Geist der Gesetze«) identifiziert. Mit dieser Schrift, die nach John Lockes Vorarbeiten die Teilung der staatlichen Funktionen und Institutionen, die sogenannte Gewaltenteilung, als Prinzip des modernen Staates begründete, wurde der Aristokrat, fromme Christ und treue Untertan seines Königs zum Wegbereiter der bürgerlichen Revolution und zum von der Kirche gebannten Ketzer. Gerade das wollte Montesquieu keineswegs sein, doch war seine Sache die »bewegliche Vernunft«, wie sie sein Biograph Jean Starobinski bezeichnet hat, und weil sie beweglich war, konnte diese Vernunft nicht anders, als gegen die Prinzipien des staatlich verordneten Immobilismus zu verstoßen, das Dogma der Glaubenswächter zu attackieren und erstarrtes Denken aufzubrechen. Fast gegen seinen Willen, jedenfalls ohne Vorsatz und frei von den stolzen Anwandlungen des Rebellen, hat Montesquieu die Welt, der er entstammte und sich verpflichtet fühlte, einer so unbestechlichen Prüfung unterzogen, daß andere, die dem französischen Königtum, der katholischen Kirche, der aristokratischen Kultur weniger verbunden waren als der Baron, ihre revolutionären Schlüsse daraus ziehen konnten. Die »bewegliche Vernunft« reagiert biegsam und mit »prompitude« auf das, was die Zeit ihr an Neuigkeiten, Zumutungen, Reichtümern, Versuchungen zu bieten hat, und gerade damals, am Beginn des 18. Jahrhunderts, boten naturwissenschaftliche Erkenntnisse, technische Erfindungen und die Entdeckungen unbekannter Kontinente sehr viel Neues, bei dem sich die Vernunft als beweglich erweisen konnte.
»Es handelt sich um Einfälle, die ich nicht weiter ver-tieft habe und die ich aufbewahre, um bei Gelegenheit über sie nachzudenken«, schreibt Montesquieu am Beginn der »Pensées«. Am Ende, nach 35 Jahren, in denen er zahllose Einfälle für spätere Zeiten notiert und andere wieder ausgeschieden hatte, waren es 2251 dieser Betrachtungen, Merkwürdigkeiten, Reflexionen, über die er bei Gelegenheit wiederum nachdenken wollte. In einem solchen Buch der Bücher, das sich der beständigen Lektüre verdankt und überhaupt nur geschrieben wurde, damit aus ihm neue Bücher entstehen mögen, geht es natürlich um Gott und die Welt; nicht zuletzt macht das Sprunghafte, Ungeordnete, das den Geist beim Flanieren durch vielerlei Reviere zeigt, den Reiz solcher Aufzeichnungen aus.
Man sieht in den »Pensées« einen erzählenden Philosophen unentwegt Dinge aufnehmen, von denen er selbst noch nicht weiß, was sie ihm einmal bedeuten werden, und unermüdlich Gedanken notieren, bei denen er sich im unklaren ist, wohin sie ihn dereinst führen könnten. Als bestünde zwischen den Dingen ein geheimer Zusammenhang, der sich schon irgendwann enthüllen werde, hat Montesquieu unverdrossen aufgeschrieben, festgehalten; tatsächlich griff er vieles davon erst Jahrzehnte später wieder auf, wenn er einen solchen unerwarteten, ihn selbst überraschenden Zusammenhang unvermittelt entdeckte.
Das muß man aber erst zuwege bringen: warten können, daß die Dinge von sich aus noch einmal zu sprechen beginnen; erwarten, daß die Gedanken, so prompt fixiert, noch selber zeigen werden, was sie miteinander zu tun haben. In Montesquieu, dem obsessiven Sammler seiner eigenen Gedanken, steckte ein Bürokrat, der hoffte, die Welt selbst archivieren zu können; aber in dem Bürokraten steckte auch ein Mystiker, der wußte, daß alles zusammenhängt, und darauf vertraut, daß sich dieser Zusammenhang endlich dem erschließen werde, der Geduld mit sich selber hat.
Neunzehn Sekretäre, sechs Vorleser … Nur ich soll wieder alles alleine machen.
Wenn ich meine alte Mutter besuche, die seit dem Tod meines Vaters vor über zwanzig Jahren alleine in der Wohnung lebt, in der wir einst zu sechst gelebt haben, begegne ich häufig S., dem Schrecken meiner Kindheit. Von seiner Wohnung im Erdgeschoß aus hat er, der mediokre Angestellte, ein rätselhaftes Regiment entfaltet, das auf der rigiden Überwachung der »Hausordnung« gründete, die sich die achtzehn Parteien des Hauses, als sie 1956 in den Neubau einzogen, selbst gegeben hatten, ohne zu ahnen, daß einer aus ihrer Mitte sich als Hüter dieser Ordnung über sie erheben würde. Niemand mochte S., jeder scheute es, ihn im Stiegenhaus oder auf der Straße zu treffen, und selbst die Bewohner, die in der beruflichen Hierarchie über ihm standen, fürchteten ihn. Versperrte jemand im Winter nicht, wie vorgeschrieben, um neunzehn Uhr das Haustor, lugte er sogleich aus seiner Wohnung heraus, um den pflichtvergessen von der Arbeit Heimkehrenden unverzüglich des Verstoßes gegen die Hausordnung zu überführen; nicht allein ungebührlich war es, das Haustor nur einfach ins Schloß fallen zu lassen, ohne dieses zu versperren, sondern das Versagen jedes einzelnen mochte der Allgemeinheit großen Schaden zufügen, wenn es sich erst beim Gesindel der Gegend herumzusprechen begänne, daß die Herrschaften von der Radetzkystraße 7 zu fein waren, auf ihr Eigentum zu achten.
Für gewöhnlich sprach S. leise, auch wenn seine Anklage triftig, das Vergehen schwerwiegend war — und es war immer ein schwerwiegendes, etwa daß eine Hausfrau das Licht im Keller brennen ließ, nachdem sie aus ihrem Abteil ein paar Winteräpfel geholt hatte. Er sprach leise, aber scharf, was er sagte, war nicht zu bestreiten, sondern offenkundig, S. diskutierte nicht, er stellte den Sachverhalt fest und zugleich die Anklage vor. Er war ein kleiner, drahtiger Mann, dessen Haar früh ergraute, und hielt den Kopf sowohl gesenkt als auch seitlich geneigt, sodaß sein erboster Blick stets wie von schräg unten auf den Missetäter traf, was diesem Blick etwas hundeartig Unterwürfiges und Gefährliches zugleich gab.
Bot sich S. kein Anlaß, einen Strafantrag zu stellen, schwieg er sich aus, selbst den Gruß erwiderte er nur mürrisch. Die Leute lebten bereits zehn, zwölf Jahre in diesem Haus zusammen — dessen Roman ich, der ich keine Romane schreibe, zu schreiben hätte —, bis die von ihm gemaßregelten Hausfrauen und Mütter, sie als erste, erkannten, welch gedrücktes, gehemmtes Kind in dem Tyrannen eingepanzert war. In der freien Rede vom einen zum anderen war das böse Kind so befangen, daß es über kurzem ins Stammeln geriet und aufgeregt Worte aneinanderreihte, deren Zusammenhang nur zu erraten war. Als die Leute ihm hinter dieses Tyrannen-Geheimnis kamen, war es, nicht auf einen Schlag, aber in einem von S. nicht mehr aufzuhaltenden Prozeß um seine Herrschaft geschehen. Er fuhr noch dreißig Jahre lang fort, den Leuten mit der Hausordnung auf die Nerven zu fallen, aber sie beachteten seine Vorwürfe nicht mehr, sie lachten über ihn und hörten endlich sogar auf, über ihn zu lachen.
Wenn ich meine Mutter besuche, die, seitdem sie von ihrer zum Tode führenden Erkrankung weiß, alle Energie des Lebens darauf richtet, die Geschichte ihrer Kindheit und Jugend in der Batschka für die Enkel aufzuschreiben, steht S. oft vor dem Haus. Meist räumt er den Papierbehälter aus, in dem das Altpapier gesammelt wird, er streift die achtlos weggeworfenen Zeitungen einzeln glatt, er zerreißt die unzerkleinert im Behälter verstauten Kartons, um sie platzsparend zu schlichten, er liest, auf der Suche nach Beweismitteln, ungeniert alle Briefe, die er findet, die Ansichtskar-ten, Bankauszüge … Schon seit langem grüßt er niemanden mehr, und als ich ihn gestern dennoch namentlich ansprach, schaute er mit schräg geneigtem Kopf von unten mit grenzenloser Verachtung auf, ehe er sich wieder seiner Arbeit für die verhaßte Gemeinschaft zuwandte.
Die meisten Männer und Frauen, die vor fast fünfzig Jahren in dieses Haus eingezogen waren, sind längst gestorben, und ihre Kinder, die hier mit mir und meinen Brüdern aufwuchsen, haben die ererbten Wohnungen verkauft. Eine neue Generation junger Familien hat das Haus in Besitz genommen, und über sie hat der giftige Greis, der nur mehr für sich selbst als unbeirrter Hüter der Ordnung amtiert, erst recht keine Macht mehr. Die bloße Anwesenheit so vieler, die nicht gleich ihm von Anfang an dabei waren und trotzdem nicht auf ihn hören, kränkt ihn. Vielleicht träumt er von seiner goldenen Zeit, als er die Verstöße gegen die Hausordnung noch ahnden konnte, während er sich heute, indem er unausgesetzt vor sich hinschimpft, nur selber davon überzeugen kann, daß es noch genügend zu ahnden gäbe. Bis ich durch das verbotenerweise sperrangelweit offenstehende Tor im Stiegenhaus verschwunden war, hörte ich ihn in leise zischendem Haß geifern und Anklage vor dem Publikum seines imaginären Gerichtshofes gegen all die »Schmarotzer und Huren« führen, die seine Nachbarn sind.
Ich blättere in meinem Journal »Mit mir, ohne mich« und sehe, wie ich mir vor vier Jahren die ersten Folgen von »Big Brother« erklärte, bei denen das mittlerweile darüber abgestumpfte Fernsehpublikum noch staunte, daß sich eine Schar von Versuchspersonen um die Freuden der Überwachung stritt. Eine Gesellschaft, die zerfällt, muß die zahllosen Vereinzelten besser überwachen, widrigenfalls sich immer mehr Vandalen auszutoben beginnen, die abends, nach dem verdienten Bier, nicht nur die üblichen Mistkübel umkippen, sondern auch die Fensterscheiben von Juwelieren einschlagen, teure Autos in Brand stecken, spaßeshalber Jagd machen auf irgendwen und das Ihre dazu beitragen, daß der alltägliche Bürgerkrieg immer wieder aufflammt. Überwacht zu werden, und sei es auch, daß wir glauben, wir würden es zu unserem eigenen Schutz — nicht zu sagen: zum Schutz vor uns selber —, haben wir bisher jedoch als Einschränkung unserer Freiheit empfunden und als Zumutung der Obrigkeit abgelehnt. Die Tele-Überwachung der Gesellschaft benötigt Überwachte, die gelernt haben, erst zufrieden zu sein, wenn sie wissen, daß sie überwacht werden. Die fortwährende Ausspionierung des Alltags mittels Kameras und Mikrophonen nicht länger als unangenehm zu erleben, wird eine ganze Generation in den Container wie in eine Erziehungsanstalt geschickt, auf daß sie vor der Kamera und für die Übertragung existieren lerne. Eben dafür werden nach ihren durchschnittlichen Fähigkeiten ausgewählte, also gerade wegen ihrer Austauschbarkeit aus der Masse der Bewerber herausgegriffene Geschöpfe in den Container gesteckt, an deren Beispiel die Zahllosen, die ihnen zusehen, in die Lust der Kontrolle eingeschult werden.
Die Vandalen. Der Kunsthistoriker Alexander Demandt hat in seinem monumentalen Buch über den Vandalismus diesen als »Gewalt gegen Kultur« begriffen und sein Wesen nicht in der blinden Zerstörungswut entdeckt, mit der er identifiziert zu werden pflegt, sondern im »Versuch, Erinnerung zu beseitigen«. Nicht die jäh hochschießende Lust an der Zerstörung mache den Vandalismus aus, sondern vielmehr der Vorsatz, die Denk- und Grabmäler des Fein-des zu zerstören und zu diesem Zweck die eigenen Solda-ten, die Meucheltrupps der Freiwilligen zu ermuntern, auftragsgemäß enthemmt dreinzuhauen. Solcher Vandalismus nimmt sich kulturell wertvolle Objekte vor, in denen der besiegte Feind seine Religion, seine kulturelle Identität zu Skulptur, Fries, Totem, Denkmal, Weihestätte hat werden lassen und die nun demoliert werden müssen, auf daß er sein kulturelles Gedächtnis verliere: Nichts mehr soll zeugen von dem, woran er früher glaubte oder worin er bisher seine Idole, Götter, Herren erblickte.
Insoferne waren die Vandalen (wie alle heidnischen Reitervölker) nur zahme Vandalen, während die römischen Heerführer und die christlichen Prediger die Massen ungleich wütender darauf einschworen, zu schänden, was zu errichten die unbotmäßigen oder sündigen Völker die Stirn hatten. Der christliche Vandalismus führt von der Verbrennung der arianischen Schriften nach dem Konzil von Nicäa im vierten Jahrhundert über die Zerstörung zahlloser heidnischer Kultstätten zur Vernichtung der kirchlichen Bildwerke durch die Wiedertäufer und von dort bis zu Zwingli und Calvin und erst recht zu den Missionaren, die den Völkern der Erde die frohe Botschaft brandschatzend überbrachten. Kein Zweifel, mit den Dingen, die zerstört wurden, sollten die Menschen getroffen werden, denen diese Dinge teuer waren, mitunter teurer als das eigene Leben — Heiligtümer, vor denen sie erschauernd standen und deren Schändung sie nicht so sehr zu Haß aufstachelte als vielmehr in die Resignation drückte: Was geschändet werden kann, hat seine Machtlosigkeit erwiesen — einen anderen Gott laßt uns preisen, einem stärkeren Herrn uns unterwerfen!
An dem anderen Vandalismus, der nicht bedeutende Werke der Kunst zerstört, sondern Gegenstände des öffentlichen Raumes demoliert, ist der Kunsthistoriker Demandt nicht interessiert, sei es, daß ihm derlei Dinge zu profan sind oder daß er sich akademisch nicht zuständig für sie hält. Doch die Tele-Überwachung der Städte wird gerade mit den ungeheuren Schäden begründet, die die vandalistische Zerstörung von Objekten des öffentlichen Raumes verursacht. Der alltägliche und allnächtliche Angriff richtet sich gegen die öffentlichen Verkehrsmittel und ihre Orte, die U-Bahnen und U-Bahn-Stationen, Züge und Bahnhöfe — also gegen die urbane Organisierung der Mobilität; weiters gegen das städtische Mobiliar, das von Mülltonnen bis zu Straßenlaternen und Bänken in der Fußgängerzone reicht — gegen die Aufrüstung der Gemütlichkeit; und schließlich gegen Anlagen, die gewiß nicht der Vergnügung privilegierter Schichten dienen, wie Kinderspielplätze und städtische Parks. Die Wut, die sich hier austobt, entzündet sich nicht am Eigentum einer verhaßten Klasse, sondern an den Gerätschaften, die jene, die sie zerstören, alle Tage selber nutzen, und an Orten, die auch sie frequentieren. Der Vandalismus mutet so rätselhaft an, daß Stadtplaner, Sozialarbeiter, Juristen, Politiker schon aufgegeben haben, ihn zu ergründen; stattdessen suchen sie Strategien, wie er, gleich einer Naturgewalt, immerhin eingedämmt werden könne und sich das Schlimmste, das immer nur das Schlimmere des vorangegangenenen Tages ist, verhüten ließe.
Das Phänomen, daß Bewohner einer Stadt gewohnheitsmäßig jene Sachen beschädigen, mit denen sie selber alle Tage Umgang haben, ist merkwürdig. Zu fragen wäre, ob den Vandalen der Zusammenhang zwischen ihrer eigenen Existenz und dem öffentlichen Eigentum nicht bekannt ist oder ob sie ihn umgekehrt nur zu gut kennen. Erleben sie den öffentlichen Raum als etwas Fremdes, in dem sie nur befristet geduldet sind, oder vielmehr geradezu als intimen Ort ihrer existentiellen Niederlagen? Ist der Vandalismus also eine ziellose Revolte oder eher orgiastischer Selbsthaß? Zerstöre ich, was mir nicht gehört, oder zerstöre ich, was mir gehört, und zerstöre ich es vielleicht deswegen, weil ich mich in ihm nur auf eine Weise wiederentdecken kann, die mich ergrimmt, erbittert, erzürnt? Die die Telefonhäuschen anzünden, Sitze in der U-Bahn aufschlitzen, Straßenlaternen zerdeppern, Kinderschaukeln aus der Verankerung reißen, den Rasen, auf dem sie zu rasten pflegen, mit den Scherben ihrer zerschlagenen Bierflaschen überziehen — gegen wen wüten sie? Gegen ihre Chefs, denen sie nicht ankönnen, den Staat, den sie nicht zu fassen kriegen, die große ökonomische Maschinerie, der sie als kleine Schräubchen eingebaut sind — oder gegen die große Kränkung, die das Leben für sie bedeutet? Nein, das sind keine abgelenkten Sozialrevolutionäre; eher Selbstmordattentäter, die die Religion noch nicht gefunden haben, die ihnen den großen Anschlag mit dem Paradies vergütet.
Die Kränkung. Der Landsergeneration, der Ausharren und Durchhalten als höchste Tugenden galten, war es verboten, Gefühle zu zeigen (zu haben?). Die Enkelkinder der Landser bilden hingegen eine narzißtische Generation, und wer ihr angehört, entblößt sein Seelenleid gerne öffentlich, ist aber auch dauernd versucht, den ganzen Krempel, der seine Lebensaufgabe und sein Lebensziel ist, gekränkt hinzuwerfen. Bestimmte Eigenschaften finden sich bei vielen Angehörigen dieser Generation, gleich welche politischen Überzeugungen und persönlichen Vorlieben einer haben mag. Oskar Lafontaine und Jörg Haider gleichen sich darin, daß sie fortwährend in der Gefahr stehen, aus dem Beifall, an dem sie sich berauschen, in die Zerknirschung abzustürzen und in einem großen Abgang gekränkt Reißaus zu nehmen. Natürlich kommen sie bald wieder, denn ein anderes Elixier des Lebens haben sie ja nicht als diesen Beifall, der, haben sie sich an ihm reichlich besoffen, unweigerlich zu schwerem Katzenjammer und, wird er verweigert, zu Entzugserscheinungen führt.
Häufig bekommen wir es mit einem Narziß zu tun, der berechnend und unberechenbar, gemütskalt und wehleidig zugleich ist: Verliebt in die Macht, ist er doch zu sehr in sich und die eigenen Obsessionen vernarrt, als daß er jene stets kühl im Auge behalten könnte. Durch seine wesenhafte Skrupellosigkeit zum Verleumder begabt, leidet er gleichwohl darunter, nicht richtig verstanden und jedenfalls nicht für das geliebt zu werden, wofür er selber sich am meisten liebt — für seine offenkundigen Schwächen und seine geheimen Laster. So kühl er den Erfolg anstrebt und das Erreichte verwaltet, bleibt in ihm immer ein unberechenbarer Rest, der, wird er gereizt, jäh den ganzen Menschen auszumachen scheint. Dann legt der Gekränkte seine Ämter im Zorn zurück, um sich erst morgen wieder überreden zu lassen, sie neuerdings zu übernehmen.
Geheimnis der Beschämung: die Zugehörigkeit zu einer Generation. Man findet doch mehr von ihr in sich, als einem lieb ist. Ihr den Prozeß zu machen ist leicht, aber das Urteil müßte man immer gegen sich selber sprechen.