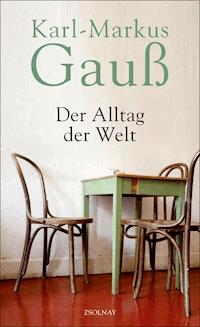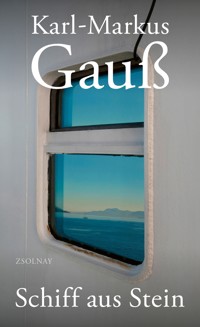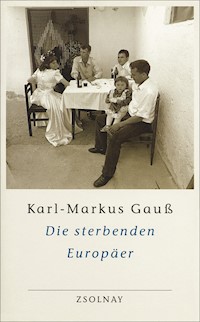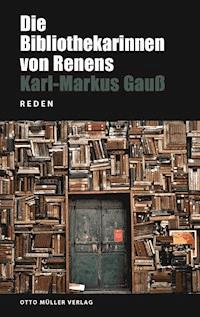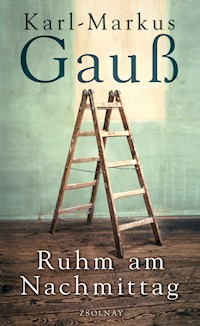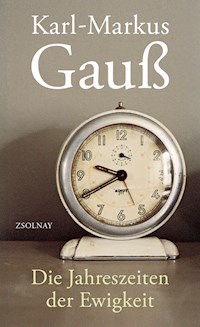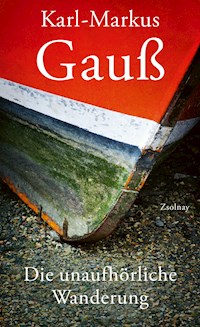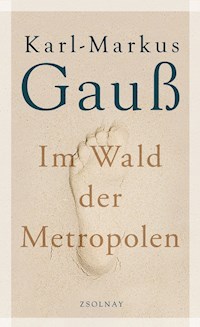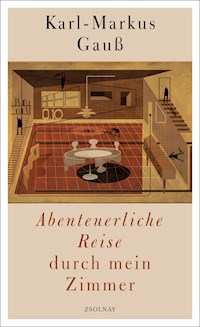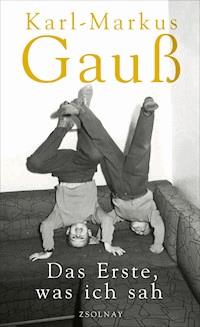Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl-Markus Gauß ist wieder auf Reisen gegangen, in Osteuropa und auf dem Balkan. In Moldawien, dem ärmsten Staat des Kontinents, hat er sich mit der „moldawischen Sehnsucht“ infiziert, der Sympathie für Land und Leute. In Bulgarien erkundet er ein anderes Land als jenes, von dem uns immer wieder schlechte politische Nachrichten erreichen. Und in Zagreb entdeckt er das Wechselspiel von Erinnern und Vergessen, das die nationale Kultur von Kroatien prägt. In der Vojvodina schließlich, einst ein Europa im Kleinen, begibt er sich auf die Spur seiner donauschwäbischen Mutter. Kenntnisreich vereint Gauß Reportage, Geschichte und Autobiographie zu Reiseliteratur, wie sie kein anderer zu schreiben weiß.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Karl-Markus Gauß ist wieder auf Reisen gegangen. In der Republik Moldau, dem ärmsten Staat des Kontinents, hat er sich mit der »moldawischen Sehnsucht« infiziert, der Sympathie für Land und Leute. In Bulgarien unterwegs durch bekannte und abgelegene Regionen, erkundet er ein anderes Land als jenes, von dem uns immer wieder schlechte politische Nachrichten erreichen. Und auf den Straßen und Plätzen von Zagreb entdeckt er das Wechselspiel von Erinnern und Vergessen, das die nationale Kultur Kroatiens prägt. In der Wojwodina schließlich, einst ein Europa im Kleinen, begibt er sich auf die Spur seiner donauschwäbischen Mutter.
Kenntnisreich, was die Geschichte und Gegenwart dieser Länder betrifft, vereint Gauß Reportage, Kulturgeschichte, Autobiographie – spannende, zu Herzen gehende Reiseliteratur, wie sie kein anderer zu schreiben weiß.
Zsolnay E-Book
Karl-Markus Gauß
Zwanzig Lewa oder tot
Vier Reisen
Paul Zsolnay Verlag
ISBN 978-3-552-05852-1
Alle Rechte vorbehalten
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2017
Umschlag: Anzinger und Rasp, München
Motiv: © Mark Power / Magnum Photos
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»Öffne die Augen und du wirst sehen:
Hier bist du daheim.«
Slavko Mihalić
Inhalt
Meine moldawische Sehnsucht
Die toten Mädchen von Futog
Die Augen von Zagreb
Bulgarien, im Museum der ausrangierten Zukunft
Danksagung und Hinweise
Meine moldawische Sehnsucht
1
Seitdem ich wieder zuhause war, gingen mir die Helden und Gespenster von Chișinău nicht aus dem Kopf. Fast widerwillig war ich in diese Stadt gefahren, an der mich nur reizte, dass niemand, den ich kannte, schon dort gewesen war; doch ungern hatte ich sie wieder verlassen, als wäre ich mit ihr, die mich so herzlich aufgenommen hatte, noch lange nicht fertig. Jetzt wuchs etwas in mir, das ich meine moldawische Sehnsucht nannte.
In der südlichen Altstadt, einem Viertel mit brüchigen, doch schnurgeraden Straßen, die einander in rechtem Winkel schnitten, stand an der Strada Kogălniceanu ein großes Haus, in dem die Fakultät für fremde Sprachen und Literaturen untergebracht war. Hier hatte ich einen Vormittag lang auf der Tagung der Deutschlehrer Moldawiens gesprochen, über mich und die paar Texte, die ich ihnen vorgelesen hatte, und über sie, ihre Stadt und die wenigen Ansprüche, die sie sich noch nicht hatten austreiben lassen. Schräg gegenüber befand sich in einem eingezäunten Garten die weißrussische Botschaft, die von einem strammstehenden Soldaten bewacht wurde. Als ich morgens nach der Fakultät Ausschau hielt, fragte ich ihn, einen Bauernburschen, den man in Uniform gesteckt und das reglose Stehen gelehrt hatte, wo sich die Universität befände. Mit unmerklichem Heben der Augenbrauen hatte er mir die Richtung gewiesen und gelächelt, als ich aus meinem kleinen, nur für diese Reise angelegten Vorrat an rumänischen Wendungen ein paar Dankesworte herausholte, gelächelt auf die kaum wahrnehmbare Weise eines Menschen, dem das Lächeln dienstlich verboten und das ungerührte Starren befohlen war.
Die Deutschlehrer Moldawiens erwiesen sich ausnahmslos als Deutschlehrerinnen, weil der schlechtbezahlte Beruf des Lehrers auch in Moldawien Frauensache geworden war und sich die Männer, die ihn einst ergriffen hatten, längst auf nach Deutschland, Österreich oder sonst wohin gemacht hatten. Die fünfzig, sechzig Frauen, die auf Schultischen im Halbkreis vor mir saßen, kamen nach den ersten, pflichtgemäß fachlichen Fragen bald auf lebenspraktische Themen und wollten wissen, ob ich Kinder hatte und meiner Frau bei der Erziehung und Hausarbeit half, ob ich trank oder regelmäßig arbeitete, wann ich morgens aufstand und abends nachhause kam, ob ich an Gott glaubte.
Mit unserem Gespräch ging die dreitägige Veranstaltung zu Ende, und die Teilnehmerinnen mussten sich mit ihren zur Lesung bereits mitgebrachten Koffern noch zum Busbahnhof in der Nähe des Piața Centrală begeben, eines riesigen, dichtgedrängten Marktes, von wo die Busse sie nachhause bringen würden, nach Bălți oder Soroca im Norden oder südwärts nach Comrat, Basarabeasca, Cahul. Die Hauptstadt liegt beiläufig in der Mitte des kleinen, schmalen Landes, das zu durchqueren viel länger dauerte, als es die Land- und Straßenkarten vermuten ließen, sodass einige der Frauen noch Stunden unterwegs sein würden.
Vier waren sogar aus dem abtrünnigen Transnistrien angereist, jenem Streifen Landes jenseits des Flusses Dnister, den der moldawische Staat noch als sein Territorium betrachtete, während es, auch nach dem Willen seiner meisten Bewohner, doch längst eine russische Exklave geworden war. Aber sogar dorthin fuhren die großen Überlandbusse, die im ganzen Land unterwegs waren, wie auch die in die Tausenden gehenden Kleinbusse für vierzehn, sechzehn Leute, die keinen geregelten Fahrplan hatten, keine fixen Haltestellen, und von denen doch jeder wusste, wo sie per Handzeichen angehalten werden konnten und wohin sie einen brachten. Diejenigen, die Russisch sprachen, nannten sie Marschrutka, die Rumänisch sprachen, nannten sie Rutiera, aber sie alle, Russen und Rumänen und wer sonst noch, der in diesem Land lebte, Bulgaren, Gagausen, Roma, Ukrainer, brauchten diese Kleinbusse, die günstige Tarife hatten und selbst die abgelegenen Dörfer anfuhren.
Müde vom Reden und von der Verabschiedung, bei der mir nacheinander alle Frauen die Hand schüttelten, ihren Namen, ihre Funktion und die Stadt nannten, in der sie lebten und unterrichteten, verließ ich gegen 14 Uhr die Fakultät, und mein Blick fiel auf den Soldaten, der auf der anderen Straßenseite immer noch reglos seinen Wachdienst versah. Als ich an ihm vorbeiging, gewärtig, ihn meinerseits nur mit einem angedeuteten Nicken zu grüßen, sah ich, dass ich ausgerechnet hier, in Chișinău, in der holprigen, von einstöckigen Häusern gesäumten Strada Kogălniceanu, die nach einem mutig die Menschenrechte verfechtenden Gelehrten des 19. Jahrhunderts benannt war, ein Weltwunder bestaunen durfte. Was ich sah, konnte es gar nicht geben, und doch stand ich davor: vor einem Menschen, der im Stehen schlief. Mediziner sagen, dass beim schlafenden Menschen die Muskeln erschlaffen, sodass, wer steht und einschliefe, hinfallen würde; selbst die Pferde, Elefanten und Kühe, von denen man lange annahm, sie würden stehend schlafen, dösen in Wahrheit vor sich hin, um wirklich zu schlafen, müssen auch sie sich niederlegen. Nur die Eule und ein paar andere Vögel schlafen tatsächlich im Stehen, der Flamingo kann es sogar auf einem Bein. Dieser Soldat aber schlief, zweifellos, er hatte die Augen geschlossen, atmete langsam und tief und hielt doch vorschriftsmäßig das Gewehr schräg vor der Brust, er schlief fest und stand fest auf zwei Beinen, und fallen würde er nur, wenn ihn jetzt jemand anredete oder stupste.
Er war einer meiner namenlosen Helden von Chișinău, auf die ich in jenem April 2015 traf, als ich zum ersten Mal nach Moldawien kam. Eingeladen, ein paar Vorträge und Lesungen zu halten, blieb ich dann zwei Wochen, um mich in der Stadt und auf dem Land umzuschauen. Der Namen des Landes, »Republica Moldova«, wird gewohnheitsmäßig falsch übersetzt, wenn man daraus jenes Moldawien macht, das sprachlich auf die Zeit zurückgeht, da es noch die »Moldavsjka Sovetskaja Socialističeskaja Republica« als Teil der Sowjetunion gegeben hat. Im Deutschen freilich ist die Moldau bereits als Fluss in Böhmen bekannt, sodass es dauern wird, bis wir uns vom alten Moldawien auf jene Moldau eingehört haben werden, die heute als offizielle Übersetzung des Staatsnamens gilt.
Wie die meisten Städte erkundet man auch Chișinău am besten zu Fuß, aber es strengte mich an, weil ich dauernd auf den Boden achten musste, so rissig und uneben waren die mit tiefen Löchern durchsetzten Gehsteige. Als ich einmal nicht mehr weiterkonnte, fragte ich einen vierschrötigen Herrn, der außerhalb des Zentrums an seinem kotbespritzten grünen Taxi lehnte, ob ich ihn für eine kleine Stadtrundfahrt verpflichten könnte. Er wirkte verblüfft und blickte mich zweifelnd an, als erwartete er, dass ich mein Ansinnen gleich selbst als Scherz kenntlich machen würde, aber dann war er mit Begeisterung bei der Sache. Er war ein paar Jahre älter als ich, seine Gesichtshaut war großporig, und die fleischige Nase wucherte offenbar schon seit Jahren schorfig entzündet dahin. Viel zu schnell fuhr er über die Boulevards, deutete nach links und rechts und erklärte in einem Deutsch, von dem er sagte, dass er es als Bauarbeiter in Holland erlernt habe, was es mit den Gebäuden auf sich hatte, an denen wir vorbeibrausten.
Auf das Zentrum von Chișinău führen aus allen Richtungen mehrspurige Boulevards zu, die die Innere Stadt mit den großen Wohnsiedlungen verbinden, welche ringsum auf die Hügel gebaut sind und zwischen denen sich ausgedehnte Parks erstrecken. Diese großzügige Struktur verdankt Chișinău, das als »schönste Stadt des Stalinismus« gerühmt wurde, dem planvollen Wiederaufbau nach 1945, als fast drei Viertel aller Gebäude durch den Zweiten Weltkrieg zerstört waren. Mein Fahrer, der Gefallen an seinem Auftrag fand und dem vielleicht gerade in den Sinn kam, dass er einen begabten Stadtführer abgeben würde, redete in einem fort, und bei jedem Wort, das er sprach, entwich seinem Mund ein fauliges Wölkchen, sodass sich im Wagen bald ein Dunst der Fäulnis ausgebreitet hatte. Als wir beim Gefängnis vorbeifuhren, rief er, dass alle Oligarchen und ihre Lakaien hierhergehörten. Holland sei ein normales Land, Moldawien hingegen wäre absolut nicht normal, weil hier die Verbrecher 50.000 Lei zahlten, freikämen und vom Gericht oder Gefängnis gleich direkt als Abgeordnete ins Parlament übersiedeln würden. Dafür sei aber selbst das schöne Holland bei weitem nicht so schön wie Moldawien, ein Superland mit Supermenschen, aber mit Scheißpolitikern und Scheißoligarchen. Stoßweise pulsierten die Schwaden der Empörung und ekligen Geruchs in dem Wagen, in dem mich ein enthusiastischer Patriot seiner Stadt durch Chișinău chauffierte, der sich am Ende weigerte, zu der für mich lächerlich geringen Summe, die sein Taxameter anzeigte, noch ein Trinkgeld anzunehmen.
Wenn ich müde wurde, bestieg ich oft einen der O-Busse, von denen viele kreuz und quer in der Stadt unterwegs und die auch für Einheimische so billig waren, dass es bei Jung und Alt als Schande galt, beim Schwarzfahren ertappt zu werden. Die bunten, oft arg ramponierten O-Busse waren überfüllt, aber nie erlebte ich es, dass die Stimmung gereizt gewesen oder Unmut laut geworden wäre. Durch das Gedränge schob sich eine Schaffnerin unablässig von hinten nach vorne und wieder zurück, ohne sich je an einem Griff oder einer Stange anzuhalten. In der einen Hand hielt sie eine Rolle, von der sie die Fahrkarten abriss, in der anderen drei Bündel mit Scheinen von ein, zwei und fünf Lei, aus denen sie das Wechselgeld mit dem Daumen gleichsam herauswischte.
Die Geldscheine Moldawiens waren alle gleich groß und zeigten das gleiche Bildnis eines Mannes mit finsterem Blick und langen Haaren, auf die eine Krone gesetzt war. Der Wojwode Ștefan cel Mare, Stefan der Große, formte im 15. Jahrhundert aus dem Fürstentum Moldau einen Staat, der sich gegen die beutegierigen Großmächte Polen, Ungarn und das Osmanische Reich zu behaupten wusste. Sein Land erstreckte sich außer auf das Territorium der Moldau auch auf weite Gebiete, die heute zu Rumänien und zur Ukraine gehören. In einer jener Fernsehshows, in der das nationale Gedächtnis für das Erstellen beliebiger Rankings verwendet wird, wurde er 2006 in Rumänien und Moldawien zum »größten Rumänen aller Zeiten« gekürt. Bald nach seinem Tod begann, was für die Region ein über die Jahrhunderte sich immer wieder erneuerndes Verhängnis war, die Herrschaft fremder Mächte, die sich gegenseitig die Gebiete zwischen den Flüssen Pruth im Westen und Dnister im Osten abzujagen und aus der ansässigen Bevölkerung gefügige Untertanen zu machen versuchten.
Es fiel mir schwer, die Geldscheine auseinanderzuhalten, denn von dem hellbraunen 1 Leu bis zu den orangen 200 Lei waren sie alle nur durch Farbnuancen und durch die klein gesetzte Zahl zu unterscheiden, darum irrte ich mich oft, wollte größere Summen mit Scheinen von zu geringem Wert bezahlen oder reichte für einen niederen Preis einen Schein von viel zu hohem Wert, worauf ich meist aufgeregt auf meinen Irrtum aufmerksam gemacht wurde. Ich bin mir sicher, in Moldawien kein einziges Mal übervorteilt worden zu sein. Aber die Menschen, die hier lebten, waren so arm, dass sie den Europäern des Wohlstands verdächtig sein mussten, und darum haben diese so viele Gerüchte über Entführungen und Überfälle weitererzählt, bis sie sich selbst vor den Moldawiern zu fürchten begannen.
Es gab alte Schaffnerinnen, die schon Jahrzehnte in ihren O-Bussen zugebracht haben mochten, und ganz junge, manche waren voluminös und schienen die Fahrgäste geradezu mit Bauch und Busen auseinanderzuschieben, andere wirkten in ihrer Magerkeit erschöpft, aber eine jede wurde respektiert. Auch die junge Frau mit dicken Brillen, mit der ich mit dem Bus Nummer 22 Richtung Flughafen fuhr und beim »Tor von Kišinëv« ausstieg. Kišinëv ist der russische Name für Chișinău, seitdem der russische Zar die Osthälfte des Fürstentums Moldau 1812 unter seine Herrschaft brachte und entschlossen daranging, das Land zu modernisieren und die Bevölkerung zu russifizieren. In dieser Gegend wurden seit jeher viele Sprachen gesprochen, Rumänisch vor allem und Jiddisch, aber auch Russisch, Bulgarisch, Polnisch, Ukrainisch, Griechisch, Gagausisch und durch die späte Zuwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen aus Süddeutschland seit dem 19. Jahrhundert sogar Deutsch.
Fährt man vom Flughafen Richtung Stadt, hat man den Eindruck, sich einem überdimensionalen, schon von weitem sichtbaren weißen Stadttor zu nähern, es sind die hellen Blöcke einer vielgeschoßigen Plattenbausiedlung, die sich über dem Bulevardul Dacia, der durch sie hindurchführt, zusammenzuschließen scheinen. Aus der Ferne entfaltete dieses illusionistisch erzeugte »Tor von Kišinëv« enorme Wirkung, aus der Nähe erkannte ich, wie schadhaft die einzelnen Blöcke waren. Im Bus, mit dem ich hinausfuhr, erstand ich die Fahrkarte bei jener bleichen jungen Frau, die krank aussah, aber gleichmütig lächelnd ihrer schlechten Verfassung trotzte und, weil ich der Letzte ohne Ticket war, bis zur nächsten Station neben mir stehen blieb. In ihren Ohren sah ich, was ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, nämlich einen harten Stöpsel aus zusammengedrückter Watte, wie ihn zu meiner Kinderzeit stets einer der Spielgefährten in seine schmerzenden Ohren gestopft hatte. Ich ging vielleicht eine Stunde in der Gegend beim Tor der Stadt herum, bis der Bus, der vom Flughafen zurück in die Stadt fuhr, wieder vorbeikam und ich neuerlich die Schaffnerin bei ihrer Arbeit beobachten konnte, die so viel Geschick verlangte.
Am Wochenende lud mich ein Dozent, den ich kennengelernt hatte, zu einer Fahrt aufs Land ein. Bald nach Chișinău wurden aus asphaltierten Schnellstraßen sandige Lehmpisten mit riesigen Schlaglöchern, sodass wir für dreißig, vierzig Kilometer fast zwei Stunden brauchten. Wir kamen an zahllosen, anmutig in die Landschaft gesetzten Teichen vorbei, auf denen der kalte Frühlingswind Wellen trieb, und an weiten Feldern, deren Erde um diese Jahreszeit noch von schwerem, nassem Braun war. Ohne Ziel unterwegs, verließen wir die Landstraße und erreichten ein Dorf von starrender Hässlichkeit. Viele Dörfer des Landes waren in der sowjetischen Zeit zu agroindustriellen Zentren aufgerüstet und demoliert worden, dort, wo früher die Dorfmitte mit Kirche, Schule, Geschäft war, wurde der stets gleiche Paradeplatz herausgeschlagen und mit einem Kulturhaus oder Volksheim an der Stirnseite, einem Denkmal für die Rote Armee auf der gegenüberliegenden Seite ausgestattet. Das Kulturhaus, ein düsterer Betonklotz, den abzureißen zu aufwendig wäre, witterte seit dem Ende der kommunistischen Ära ungenutzt vor sich hin, das Glas war längst aus den Fenstern gefallen, auf deren Bänken zerzauste, magere Katzen schliefen, und durch den Asphalt auf dem menschenleeren Platz davor brachen Disteln und zähe Sträucher.
Ein Stück außerhalb des Dorfes stießen wir auf den Friedhof, der nach Art vieler anderer im Lande von einem niederen, blau gestrichenen Metallzaun begrenzt wurde. Wir versuchten die verblassten, meist cyrillischen Schriftzüge auf den schwarzen Grabtafeln zu entziffern, als sich uns eine alte Frau mit kräftigem, kohlrabenschwarzem Haar näherte, die in einem Kleid steckte, so bunt, wie früher die Schürzen der Landfrauen bei uns gewesen waren. Sie sprach uns von weitem an und zog uns dann zu einem Grab ganz am Rand des Friedhofs, im Unterschied zu den meisten ringsum, die von Unkraut überwuchert waren, wurde es liebevoll gepflegt, und in seiner Erde steckte eine kühn gedrehte Vase mit Plastikblumen. Auf der Tafel des metallenen Grabkreuzes stand der Name Ivan Rosca zu lesen, die Frau sprach ihn mehrmals mit heftiger innerer Bewegung aus und deutete dabei auf das Grab und auf sich und dann auf uns: Für uns erzählte sie die Geschichte, von uns wollte sie hören, dass wir sie verstanden hatten!
Der Dozent übersetzte nicht nur für mich, sondern musste es auch für sich tun, denn die alte Frau sprach ihr Russisch mit so starkem Dialekt, dass er ihr kaum zu folgen vermochte. Was wir erfuhren: dass hier die Gebeine ihres Vaters lagen, der 1941 als Erster aus dem Dorf erschossen wurde, als die Wehrmacht und in deren Gefolge die berüchtigten Sondereinheiten vorbeizogen, mordend und brandschatzend auf dem Weg in den noch weiteren Osten. Ja, nickte die Frau, ihr Vater war der Erste, der erschossen wurde, vor 64 Jahren, da sei sie noch ein Kind gewesen, und dann weinte sie, um den ermordeten Vater und um das Kind, das in so furchtbarer Zeit hatte aufwachsen müssen, und sie weinte, weil die Großen der Welt ihren Krieg und ihre Verbrechen bis in ihr kleines, abgeschiedenes Dorf getrieben hatten. Wir standen eine Zeitlang beisammen, in irgendeinem Dorf in diesem fremden Land, das mit einem alles verwüstenden Krieg überzogen worden war, und als wir gingen, verabschiedete sich die Frau von mir mit übersprudelnden Dankesworten. Sie tätschelte meine Hand und dankte mir, dass ich so großherzig war, ihr zuzuhören, als sie von der Ermordung ihres Vaters durch eine Truppe erzählte, zu der auch Soldaten aus meinem Land gehört haben mochten.
2
Im nördlichen Stadtteil Liefering zweigt in Salzburg von der Ausfallstraße, die zur Westautobahn hinaus- und nach Bayern hinüberführt, eine Straße ab, die in den fünfziger und sechziger Jahren, in denen ich aufwuchs, etwas Anrüchiges hatte und noch heute nicht in bestem Rufe steht. Jugendliche, die sich damals um eine Anstellung in einem der angesehenen Geschäfte der Altstadt bewarben, wurden von ihren Eltern amtlich bei einem Verwandten, der in einer besseren Wohngegend zuhause war, angemeldet, damit aus ihrem Bewerbungsschreiben nicht ersichtlich werde, dass sie in der »Bessarabierstraße« aufgewachsen waren.
Bessarabien, das war und ist der Name für eine historische Landschaft, deren Geschichte so kompliziert und reich an Eroberungen, Rückeroberungen, Grenzverschiebungen und territorialen Korrekturen, an wechselnden Herrschern, Staatsgewalten, politischen Systemen war, dass selbst Fachleute den Überblick leicht verlieren. Ich hatte mich in einigen Büchern kundig gemacht, wie aus dem alten Bessarabien das spätere Moldawien wurde, aber was ich von etlichen Reisen wusste, die mich zu den kleinen Sprachgruppen und kleinsten Nationalitäten Europas geführt hatten, das fand ich hier zu unüberbietbarer Konsequenz verdichtet: dass nämlich die Geschichte der kleinen, von mehreren Nationalitäten bewohnten Staaten oft viel komplizierter ist als die der großen, die sich nach einer gewissen historischen Folgerichtigkeit entwickeln, während bei jenen die verheerende Unwägbarkeit hinzukommt, dass ihre Existenz von mächtigeren Nachbarn stetig beeinflusst und periodisch sogar in Frage gestellt wird. Zu meinem Glück war es Horea Balomiri, der mich nach Chișinău eingeladen hatte, denn er, ein Mensch von natürlicher Noblesse, fühlte sich nun dafür verantwortlich, dass ich nicht verwirrter, als ich angekommen war, wieder nachhause würde zurückkehren müssen.
Horea, der in Siebenbürgen geboren wurde und in Bukarest aufwuchs, repräsentierte bereits im dritten Jahr die österreichische Kultur in der Moldau. Er leitete die Österreich-Bibliothek in Chișinău, unterrichtete an der Universität deutsche Sprache und versuchte, so gut es mit den jämmerlich geringen Summen ging, die er dafür erhielt, etwas wie österreichische Kulturpolitik zu betreiben und Lesungen, Vorträge, Seminare zu organisieren. Als er mich am Flughafen abholte, trat mir ein großer, schlanker Mann Mitte dreißig entgegen, mit einem kantigen, jedoch fein geschnittenen Gesicht und einer wohltönenden Stimme. Er sprach ein Deutsch, das keine regionalen Tönungen verriet, hatte er es doch zu gleichen Teilen von seinen siebenbürgischen Großeltern, auf deutschen Gymnasien und beim Studium in Wien erlernt. Seit einigen Jahren steckte er in seiner Wiener Dissertation über Kant fest, und der Österreichische Austauschdienst setzte ihn in der Moldau als Lektor ein, weil sich kein einziger österreichischer Bewerber finden ließ, der sich nach Chișinău schicken lassen wollte. Viele Abende debattierten wir in seiner Kammer an der Universität oder in einem Café über das, was diesem Land, dieser Stadt im Laufe der Jahrhunderte widerfahren war und wie es mit ihnen weitergehen konnte.
Wie er die strenge Logik der Kant’schen Philosophie liebte, verfügte er selbst über die Gabe, das Unwesentliche vom Wesentlichen zu trennen und die unüberschaubare Wirrnis der bessarabischen Geschichte für mich in eine übersichtliche Ordnung zu bringen. Allein in den dreihundert Jahren zwischen dem Tod des Königs Ștefan cel Mare und der Eingliederung Bessarabiens ins Zarenreich hatten einander 131 Herrscher, abwechselnd mit den osmanischen, russischen, großrumänischen Mächten sympathisierend oder gegen sie opponierend, in rascher Folge abgelöst. Die Ausdehnung der Republica Moldova deckt sich ungefähr, aber nicht exakt mit dem Territorium des alten Bessarabien, das 1812 dem größeren Fürstentum Moldau entrissen und vom russischen Reich annektiert worden war.
Westwärts, nach Bessarabien, verbannten die Zaren im 19. Jahrhundert jene verdächtigen russischen Untertanen, die ihnen zu schade waren, dass sie in Sibirien vor die Hunde gingen, und bei denen sie mit Läuterung und Rückkehr rechneten, wie den Dichter Alexander S. Puškin, der angewiderte Briefe aus dem rückständigen Kišinëv an seine Freunde in St. Petersburg schickte. Siedler aus Deutschland wurden von den Zaren hingegen regelrecht angeworben, damit sie nach Bessarabien zogen und das Land kultivierten. Sie kamen ab 1820 aus verschiedenen Regionen und gründeten Dörfer mit sprechenden Namen wie Gnadental, Gutheim, Hoffnungsfeld, aber auch Straßburg, Neu-Paris oder Halle. Und nach Bessarabien waren Generationen von Juden gezogen, die es in Deutschland oder Polen nicht aushielten, aus der österreichischen Bukowina weiterwanderten, aus Russlands Zentren an die Peripherie abgedrängt wurden. Selbst griechische und walachische, heute würde man sagen: rumänische Patrioten schlugen sich nach Bessarabien durch, um von hier auf Feldzüge gegen die osmanischen Militärstützpunkte in ihrer Heimat zu gehen.
Um 1900 waren 45 Prozent der Bewohner von Kišinëv Juden, und kaum sonst wo auf der Welt war die jiddische Sprache so weit verbreitet wie in Bessarabien. 1903 fiel, zum orthodoxen Osterfest, der aufgehetzte Mob über die Juden her, was vielen von ihnen das Leben kostete und Abertausende dazu brachte, nach Palästina und in die USA auszuwandern. Der Mann, der den antisemitischen Exzess stoppte, den Juden beistand, seine Stadt, um die er sich so verdient gemacht hatte, anprangerte, war der deutsche Bürgermeister Karl Schmidt, der den Pogrom als Kriminalfall behandelte und aufdeckte, welche politischen Kräfte im Geheimen darauf hingearbeitet hatten, dass endlich ein spontaner Pogrom wie bestellt verübt wurde.
Jene Juden, die nicht resignierten, sondern im Lande blieben, wurden 1918, als Russland Bessarabien wieder aufgeben musste, Bürger des neu gebildeten großrumänischen Staates, der ihre staatsbürgerlichen Rechte alsbald einzuschränken trachtete, es aber zuließ, dass jiddische Tageszeitungen wie Unzer Zeyt erschienen, und die Juden noch nicht mit Enteignung und Mord bedrohte. Das geschah erst, als Rumänien im Zweiten Weltkrieg an der Seite Deutschlands in den Krieg eintrat und die Juden auch in Bessarabien systematisch verfolgt wurden. In kaum einem anderen Land ist die Verfolgung der Juden so lückenhaft dokumentiert wie in Bessarabien, das während des Kriegs die staatliche Zugehörigkeit mehrfach wechselte. 1940 war das Land, gemäß dem geheimen Pakt von Hitler und Stalin, von der Roten Armee besetzt worden, die die wohlhabenden und gebildeten städtischen Juden als Repräsentanten der Bourgeoisie ächtete und ins Innere der Sowjetunion deportierte. Zugleich mussten die knapp 100.000 Deutschen das Land verlassen und in ein Reich heimkehren, das nie das ihre gewesen war. Mit Schiffen, die vom Donauhafen Reni ablegten, verließen bis November 1940 binnen acht Wochen 93.318 Menschen das Land ihrer Vorfahren und wurden über das ganze deutsche Reich verteilt.
Die Wohnblöcke der Salzburger Bessarabierstraße wurden damals errichtet, um etliche hundert dieser Hunderttausend aufzunehmen, aber anders als die 1945 vertriebenen Volksdeutschen, die Siebenbürger Sachsen, Sudetendeutschen oder Donauschwaben, erschienen sie, wo immer sie strandeten, als Fremde, in denen die Einheimischen kaum die ausgesiedelten Volksgenossen erkennen mochten. Das hing auch damit zusammen, dass die Bessarabiendeutschen eine nach völkischen Kriterien bereits stark vermischte Gruppe darstellten, der durch Heirat viele Menschen zugehörten, die ukrainische, rumänische, bulgarische Wurzeln hatten. Dass sie Fremde waren, wirkt in ihrer Straße im Grunde bis heute nach, da kaum mehr Nachfahren von ihnen dort wohnen. Aber der Name klingt noch immer nach städtischer Problemzone, wiewohl die Höfe und Gemeindebauten der Gegend einen geradezu wohlgewarteten Eindruck machen. Als es mich vor einigen Jahren wieder in die Bessarabierstraße verschlug, traf ich auf Alteingesessene und Zugereiste, die ausnahmslos weder wussten noch wissen wollten, was es mit dem Namen ihrer Straße auf sich hatte.
Die Bessarabiendeutschen, die in die alte Heimat zurückkehrten, aber in die Fremde gerieten, entrannen immerhin einem Gebiet, in dem der Krieg vier Jahre verheerend wütete. Stets waren hier Armeen auf dem Vormarsch oder dem Rückzug, und die Front verlief immer irgendwo durch das Land, das darüber zerstört wurde. In all dem Chaos blieben Zeit und planende Energie, die bessarabischen Juden in die Konzentrationslager Transnistriens zu deportieren, wo sie auf ihre Leidensgefährten aus der Bukowina und aus dem rumänischen Kernland trafen, deren Schicksal sie zu Hunderttausenden teilten.
Mit den Moldawiern, zumal den Chișinăuern kam ich leicht ins Gespräch, freundlich wollten sie, wenn ich sie um den Weg fragte, von mir wissen, was mich zu ihnen geführt hatte und wie mir ihr Land gefiel. Doch verstörte mich, dass so wenige von ihnen etwas von den Juden wussten, die in ihrer Stadt vor hundert Jahren doch fast die Hälfte der Einwohnerschaft ausgemacht hatten, dass sie kaum etwas von deren furchtbarem Ende wissen wollten und schließlich, dass sie sich zwar nicht feindselig, aber ahnungslos zeigten, wenn ich Auskunft über die jüdische Gemeinde von heute begehrte. Selbst dass es einen großen jüdischen Friedhof gab, wussten weder die Leute an der Rezeption meines Hotels noch der Taxifahrer, dem ich an einem wolkentrüben Tag als Ziel den Cimitirul Evreiesc angab. Ich selbst musste ihm, den Stadtplan auf den Knien, zeigen, wo er am Ende des Bulevardul Ștefan cel Mare abzubiegen hatte, um in der Strada Milano eine Mauer entlangzufahren und endlich vor einem alten Tor haltzumachen.
Gleich hinter dem Friedhofstor saß vor einem Häuschen mit hellblauen Fensterrahmen eine steinalte Frau auf einem Stuhl. Sie betrachtete mich misstrauisch, als wollte sie sich davon überzeugen, dass ich nichts Böses im Schilde führte, wovon ich sie mit der dummen Frage überzeugte, ob ich mich hier tatsächlich auf dem israelitischen Friedhof befände. Das bejahte sie, sogleich freundlich, nein, zutraulich zu dem offenbar arglosen, wenn nicht einfältigen Fremden geworden, sodass sie sich ächzend erhob und mich mit ihren krummen Beinen, die in schwarzen Gummistiefeln steckten, ein Stückchen den schmalen, geteerten Weg hügelan begleitete. Nach vielleicht zweihundert Metern erreichten wir die Kuppe des Hügels, dort wies sie auf die Gräberfelder ringsum, die allesamt wie unter einer einzigen Dornenhecke verschwunden schienen. 30.000 Gräber befänden sich hier, erzählte sie, verborgen hinter wilden Sträuchern, die die Wege versperrten, überwachsen mit Gesträuch, bedeckt von abgebrochenen Ästen der Bäume. An mancher Grabreihe wurde offensichtlich gearbeitet, die Wildhecken waren teilweise gerodet, die Grabsteine wiederaufgerichtet und die Einfriedungen aus Metall, die so viele Gräber umgaben, neu gestrichen. Andere waren nahezu unzugänglich, so dicht wucherte das Gestrüpp. Außer mir und der Alten schien sich kein Mensch auf dem Weg durch das riesige unübersichtliche Gelände zu befinden. Hoch im Himmel zogen unhörbar die Flugzeuge ihre Bahn, fünfzig Meter über uns kurvten die kreischenden Formationen der Krähen, und unten, zwischen Tausenden umgestürzter und Hunderten wiederaufgerichteter Grabsteine, war nichts zu hören als das Hecheln der zwanzig, dreißig räudigen Hunde, die unablässig im Friedhof herumliefen. Anfangs fürchtete ich mich vor ihnen, bis ich sah, wie sie sich vor der Alten, die zu ihrem klapprigen Stuhl und ihrem Häuschen zurückgekehrt war, im Staub wälzten und von ihr gestreichelt zu werden wünschten.
Die meisten Gräber waren mit cyrillischen oder hebräischen Zeichen beschrieben und bargen die Knochen von Menschen, die zwischen 1950 und 1975 gestorben waren. Als ich über faulende Äste gestiegen war und dornige Heckenzweige zur Seite geschoben hatte, fand ich mich nach vierzig Metern auf einer kleinen Lichtung, zu der sich das Dickicht wundersam öffnete. Umgeben von Aberdutzenden umgestürzter Grabsteine stand hier einer auf einem kleinen Flecken gerodeter Wildnis kerzengerade, von blau gestrichenem Gestänge eingefriedet, und die Schrift auf ihm musste vor kurzem nachgezogen worden sein. Herz Berger ruhte hier, der 1918 geboren wurde und 1968 starb, und auf dem ovalen, am Stein befestigten Foto, das der Regen sepiabraun gewaschen hatte, war ein attraktiver Mann zu sehen, mit einem schmalen Bärtchen, wie es Errol Flynn berühmt gemacht hatte, und ernsten Augen, die direkt in die Kamera gerichtet waren. Irgendwen musste dieser Herz Berger, der den ihm zugedachten Tod in der Shoah um 23 Jahre überlebte, noch unter den Lebenden haben, der sich an ihn erinnerte und wünschte, dass ihm unter so vielen Toten, die vergessen waren, ein Ehrenplatz bewahrt werde, auf dieser, seiner eigenen Lichtung, die nur Eingeweihte oder Ortsfremde, die sich ins Dickicht schlugen, finden konnten.
3
Ljudmila Firstman legte ihre Hand auf meinen Arm und sagte, dass sie in Chișinău geboren und vor 25 Jahren nach Wuppertal übersiedelt sei, ihre Eltern in Israel begraben lägen und ihre Tochter gerade daranginge, einen deutschen Guido zu heiraten. Sie war eine kleine füllige Frau, deren enges Kleid mit den schwarzweißen Querstreifen ihre Figur betonte und in deren rundlichem Gesicht zwei dunkle Augen vor unverhohlener Freude blitzten, dass sie endlich einem Fremden erklären konnte, wie es um die jüdischen Dinge von Chișinău stand.
Ich hatte die Gleizer Shil, die 1898 errichtete Synagoge der Chassiden, ein paarmal gesucht, aber die schmale Strada Habad Liubaveci immer verfehlt. An diesem Nachmittag hatte ich mir den Stadtteil zwischen dem Bulevardul Ștefan cel Mare, an dem sich fast alle repräsentativen Amtsgebäude des Staates reihten, und dem Bîc vorgenommen, einem Rinnsal, das die Altstadt von dem bevölkerungsreichen Bezirk Rîșcani im Norden und von Ciocana im Osten trennte. Ohne es beabsichtigt zu haben, war ich im alten, längst zur Unkenntlichkeit verbauten Viertel der Armenier auf die armenische Kirche gestoßen und nicht weit davon entfernt auf einen wie aus der Zeit gefallenen Dorfplatz mitten im Zentrum geraten, auf dem eine Art Wehrkirche thronte. Dies war die Măzărache-Kirche, das älteste Gotteshaus der Stadt, das seit langem die spirituelle Heimstatt der »Altgläubigen« oder »Altorthodoxen« war, einer Abspaltung der russisch-orthodoxen Kirche, deren Anhänger bereit waren, Vertreibung und Tod auf sich zu nehmen, um einige Traditionen des Ritus unverfälscht von jeder Reform zu erhalten.
Die ganze Gegend schien sich entschieden zu haben, Großstadt und Dorf zugleich zu sein. In der einen Straße stauten sich Autos und Busse, in der nächsten saßen die Alten vor ihren Häusern und schauten den Kindern zu, wie sie auf der Straße spielten; hier ragten neue Hochhäuser aus Glas und Protz auf, dort hörte man hinter dem Gartentor die Hühner gackern. Ganz Chișinău war von dieser Gleichzeitigkeit von Metropole und bäuerlicher Tradition geprägt, nirgendwo sonst in Europa war ich in eine Stadt von fast 700.000 Einwohnern geraten, in deren Zentrum intensive Gartenbewirtschaftung und Kleintierzucht betrieben wurde. Einmal hatte ich das Gefühl, auf dem Anger eines stillen Dorfes zu stehen, aber nur wenige Schritte weiter, in der Strada Alexandru Hideju, stieß ich auf einen massiven städtischen Wohnblock. Eine Tafel belehrte mich, dass hier der Dichter Liviu Damian gelebt hatte und 1986 im Alter von 51 Jahren gestorben war.
Damian war ein empfindsamer Poet, der zugleich als Sekretär des Schriftstellerverbands in der Moldawischen Sozialistischen Sowjetrepublik amtierte, ein Dichter, aus dessen Muttersprache, dem Rumänischen, damals staatsoffiziell gerade die von der sowjetischen Obrigkeit erfundene Sprache Moldawisch werden sollte. Die Zaren hatten, als sie Bessarabien dem Osmanischen Reich zu Beginn des 19. Jahrhunderts abjagten, das Rumänische zurückzudrängen und das Russische nicht nur als Amts-, sondern auch als Umgangssprache durchzusetzen versucht. Im großrumänischen Reich ging es ab 1918 wieder in die andere Richtung, also darum, die Oberhoheit im Lande auch sprachlich für das Rumänentum zu gewinnen. 1944 schließlich, als die Rote Armee die faschistischen Truppen besiegte und Moldawien zur sowjetischen Republik wurde, trafen die neuen Herrn eine bizarre sprachpolitische Entscheidung: Das Rumänische, die Sprache der meisten Bürger des neuen Staates, hatte statt mit lateinischen künftig mit cyrillischen Buchstaben geschrieben zu werden und Moldawisch zu heißen.