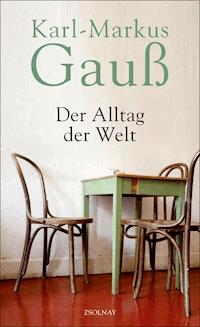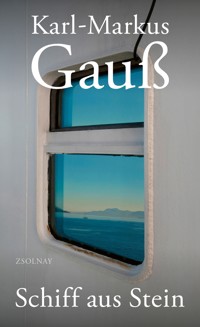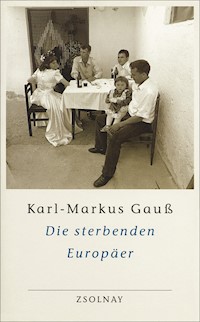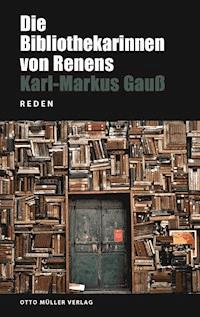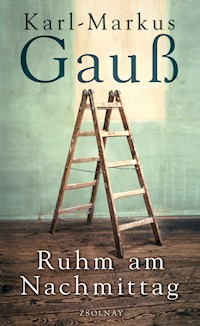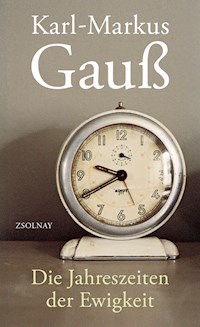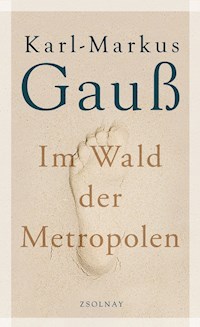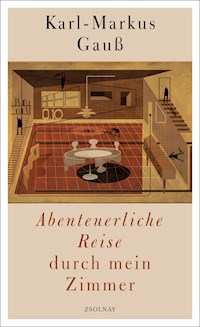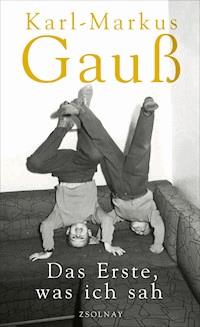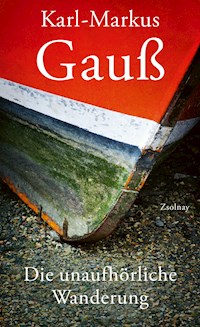
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karl-Markus Gauß ist „Spezialist fürs Entlegene“ (NZZ). Nach „Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer“ erzählt er nun feinfühlige Geschichten von besonderen Orten und Menschen in Europa
Was man immer schon von Karl-Markus Gauß lesen wollte: Ob er über einen muslimischen Sommelier im albanischen Berat berichtet oder die verblüffende Geschichte des größten Truppenübungsplatzes Mitteleuropas erzählt, ob er den Reichtum der europäischen Sprachen preist oder die sensationshungrigen Gaffer von heute mit den Besuchern der Gladiatorenkämpfe von einst kurzschließt, immer folgen wir den Spuren eines feinfühligen Flaneurs, der aus Einzelheiten ein welthaltiges Ganzes formt.
In seinem neuen Buch besticht der „Spezialist fürs Entlegene“ (NZZ) als eigensinniger Aufklärer, als Meister vieler Genres und eleganter Stilist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Karl-Markus Gauß ist »Spezialist fürs Entlegene« (NZZ). Nach »Abenteuerliche Reise durch mein Zimmer« erzählt er nun feinfühlige Geschichten von besonderen Orten und Menschen in EuropaWas man immer schon von Karl-Markus Gauß lesen wollte: Ob er über einen muslimischen Sommelier im albanischen Berat berichtet oder die verblüffende Geschichte des größten Truppenübungsplatzes Mitteleuropas erzählt, ob er den Reichtum der europäischen Sprachen preist oder die sensationshungrigen Gaffer von heute mit den Besuchern der Gladiatorenkämpfe von einst kurzschließt, immer folgen wir den Spuren eines feinfühligen Flaneurs, der aus Einzelheiten ein welthaltiges Ganzes formt.In seinem neuen Buch besticht der »Spezialist fürs Entlegene« (NZZ) als eigensinniger Aufklärer, als Meister vieler Genres und eleganter Stilist.
Karl-Markus Gauß
Die unaufhörliche Wanderung
Paul Zsolnay Verlag
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Karl-Markus Gauß
Impressum
Inhalt
1
Ort und Zeit
2
Zu ebener Erde und darunter
3
Voraus, zurück
4
Lesen und Schreiben
Quellenverzeichnis
1
Ort und Zeit
Der Sommelier von Berat
Einen wie Isuf hatte ich noch nicht getroffen, aber ich war vorher auch nie bis Berat gekommen. Wir hatten Durrës in der Früh mit dem Wagen verlassen und waren nach einigen Kilometern an einer neu errichteten, auffallend hässlichen Moschee vorbeigefahren; ihre vier Minarette ragten spitz gegen den grauen Himmel, als hätten sie diesem die Nachricht einzuritzen, dass das Leben hier, im Niemandsland von Straßenkreuzungen und Gewerbezonen, traurig und aussichtslos sei. Hinter Lushnja, das wir nach einer Stunde passierten, wuchsen zwischen den Olivenbäumen Tausende steinerne Maulwurfshügel aus der Erde, Bunker aus massivem Beton, mit denen in der stalinistischen Ära das Land so brachial bestückt wurde, dass es bis heute wie versehrt wirkt. Berat liegt im Landesinneren Albaniens, 160 Kilometer südlich von Tirana, in einem Tal, das der Fluss Osum ins Kalkgebirge geschnitten hat. Als wir uns der Stadt näherten, die mir Freunde als die schönste ganz Albaniens angepriesen hatten, sahen wir hoch über der Stadt die auf einen senkrecht abfallenden Felsen gebaute Festung, um die ein Meer weißer Häuser brandete.
Die Straße zur Festung war mit spiegelglatten Steinen gepflastert, doch all die albanischen Besucher, die einmal die schönste Stadt ihres Landes und deren Festung besichtigen wollten, fuhren nicht bequem im Auto, sondern zogen in der stechenden Sommerhitze wie Pilger den blank polierten Weg hinauf. Ihnen taten wir es gleich, und als wir oben angelangt waren, keuchend und verschwitzt, staunten wir, dass hinter dem Steintor eine eigene Stadt lag, mit winkeligen Gassen, aus Steinen gefügten Häusern und ein paar ausgedehnten, mit verdorrtem Gras bedeckten Wiesen, die sich zwischen dem zerfallenden Mauerwerk der alten Befestigungsanlagen erstreckten.
Bei der einzigen Imbissbude tranken wir flaschenweise Mineralwasser und verzehrten kleine, vor Honig triefende Köstlichkeiten, und als wir dafür so wenig zu zahlen hatten, dass wir dachten, die alte, vom jahrelangen Schmerz ihres Rückens verkrümmte Wirtin habe sich verrechnet, klärte sie uns auf: Die Albaner, sagte sie, die bis nach Berat und hier herauf kamen, waren oft arm und hatten doch das Anrecht, bei ihr Rast einzulegen und sich zu erfrischen, und da sie von ihnen nicht viel Geld verlangen könne, dürfe sie es auch nicht von uns, den Touristen, wo kämen wir sonst hin!
Wir hatten ein bescheidenes Hotel in Mangalem bezogen, dem dicht gedrängten Viertel, das sich an den Felsen der Festung und halb um diesen herum schmiegt. Traten wir aus dem Gewirr der Gassen, in denen man aufpassen musste, auf dem unebenen Boden nicht zu straucheln, fanden wir uns stets vor einer der alten Moscheen und Kirchlein, in denen über die Jahrhunderte die muslimischen und die christlichen Nachbarn gebetet hatten. Im Zweiten Weltkrieg, als nach den Italienern die Sondereinheiten der Wehrmacht die Stadt besetzten, haben sie gemeinsam alle sechshundert Juden von Berat gerettet, indem sie diese in ihre Häuser aufnahmen und als ihre muslimischen oder christlichen Verwandten ausgaben.
Abends gingen wir zum Fluss hinunter, dem eine breite Promenade vorgelagert war, auf der sich ein Café an das nächste reihte und sich die ganze Stadt zum Corso versammelt zu haben schien. Ein paar Jahre später erzählte ich Gonila, einer albanischen Freundin, dass mich das südlich, mediterran, italienisch anmutende Lebensgefühl des abendlichen Berat bezaubert habe, worauf sie mich zurechtwies, dass dieses Lebensgefühl weder mediterran noch italienisch, sondern eben typisch albanisch sei. Wir saßen im Café, beobachteten die wogende Masse der Flanierenden und den Hund, der im Gedränge hinkend hin- und herlief und seine Besitzer nicht fand. Auf der gegenüberliegenden Seite des Osum gingen in der Dämmerung die Lichter von Gorica an, dem anderen Teil des alten Berat, zu dem eine steinerne Brücke mit sieben Bögen hinüberführte.
Es war schon finster, als wir von der großzügigen Promenade in die engen Gassen von Mangalem zurückkehrten und, ohne es gesucht zu haben, ein Gasthaus fanden, von dessen Loggia im ersten Stock das Scheppern von Geschirr und die Stimmen vieler Gäste zu hören waren. Der Kellner wackelte bedauernd mit dem Kopf, wir wären zu spät dran, um noch etwas zu essen zu bekommen, aber der eine Tisch im Eck mit der besten Sicht über die Stadt sei gerade frei geworden, sodass wir Platz nehmen könnten und uns beim Trinken auch nicht beeilen müssten.
Isuf war ein magerer Mann, der bedächtig immer nur ein paar Gläser oder Teller trug und sich dabei mit lässig tänzelnder Eleganz bewegte. Er hatte ein auffällig schmales Gesicht, auf den Seiten militärisch kurz geschorenes Haar — und Segelohren, so groß, dass man vermuten hätte können, er steuere damit seine Bewegungen. Er sprach Deutsch, weil er außer in Istanbul auch in der Schweiz gearbeitet hatte, in verschiedenen Berufen, nicht nur in der Gastronomie. Wir fragten, welchen Wein der Region er uns empfehlen könne und hatten uns damit seine Zuneigung erworben. Er wies nach Osten, wo wir tagsüber einen blauen Gebirgsstock gesehen hatten, den legendären Tomorri, den heiligen Berg der Bektashi, des sufistischen Derwischordens, der eine ekstatische und mystische Frömmigkeit pflegt. Die Bektashi von Berat pilgern zwischen dem 20. und 25. August zum Tomorri, ihrem Olymp, auf dem sie ein symbolisches Grabmal und zwei Schreine aufsuchen, die Abbas ibn Ali gewidmet sind, der im Jahr 680 in Mesopotamien den Märtyrertod starb; die Christen ziehen auf den Berg in einer Prozession fünf Tage vorher, zu Maria Himmelfahrt. Dort oben, sagte Isuf, wachse auf steilen Hängen in tausend Metern Seehöhe eine Traube, die viel Sonnenlicht empfange, aber auch viel Wind abbekomme und deren Geschmack gerade deswegen einzigartig sei.
Er verließ uns und kehrte aus der Küche mit zwei Tellern zurück, auf denen Käse, Oliven, Scheiben von Gurken und gegrillte Melanzani lagen. Dann ging er noch einmal, brachte uns eine Flasche vom roten und eine vom weißen Pulsi i Beratit an den Tisch und geriet ins Psalmodieren über diesen Wein, in dem für ihn Albanien selbst konzentriert war — denn was war Albanien anderes als Stein, Licht, Wind? Und Wein! Er entkorkte die Flaschen, roch an den Korken, schenkte von beiden Flaschen nur wenig in zwei Gläser, die er gegen das Licht der Laterne hielt, und ließ den Wein in den Gläsern kreisen, in die er dann seine lange Nase steckte. Als er den Kopf hob, hatte sein Blick etwas Entrücktes, der Wein war, wie er ihn liebte. Nun erst schenkte er uns ein, erwartungsvoll schaute er zu, wie wir seinen Wein, den Wein Albaniens kosteten. Er selbst, sagte er später, nachdem die meisten Gäste gegangen waren und er eine weitere Flasche vom Roten gebracht, geöffnet, geprüft, ausgeschenkt hatte, er selbst habe in seinem Leben noch keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Um den Wein zu beurteilen, genüge es ihm, ihn zu sehen und zu riechen, seine Herkunft und Geschichte zu kennen. Das erzählte uns Isuf, der muslimische Sommelier von Berat.
Eine Kreuzung von Welt
Verlässt man die Altstadt von Salzburg durch das Neutor, sieht man rechts eine Straße abzweigen, die sich entlang des Mönchsbergs mit sachte schwingenden Kurven achthundert Meter stadtauswärts zieht. Dort mündet die einspurige Reichenhaller Straße, die längst nicht mehr nach Bad Reichenhall führt, in eine breite, fast schnurgerade Straße, die nach rund zwei Kilometern die nordwestlichen Viertel der Stadt erreicht. Fast am Beginn dieser Straße, die im ersten Streckenabschnitt Aiglhofstraße und im zweiten Rudolf-Biebl-Straße heißt, ist sie zu finden, jene Kreuzung, die Eiligen und Unachtsamen wenig zu bieten hat und doch die unerkannte Mitte einer Welt ist.
Die Kreuzung hieß damals, als mein Reich der Kindheit hier endete, nach dem auffälligsten Gebäude und dem Betrieb, der sich darin befand, die Bäcker-Bacher-Kreuzung. Auf der einen Seite stand ein großes, von fern an die Bauhaus-Architektur erinnerndes Haus, das über und über mit Efeu bewachsen und eine Art von Märchenschloss war, dem betörende Wohlgerüche entströmten. Für die Schulkinder, die alle Tage hier vorbeizogen, war der Geruch von frischem Gebäck, der aus der Bäckerei nach draußen drang, eine immerwährende Versuchung, der zu widerstehen schwer war, auch wenn es hier regelmäßig beschämende Niederlagen einzustecken galt. Die Salzstangerl, Mohnweckerl, Semmerl kosteten damals 62 Groschen das Stück, und wer die Unverfrorenheit besaß, mit unschuldiger Miene nur die sechzig Groschen auf die Verkaufsbudel zu legen, die er zusammenkratzen konnte, der wurde von der erbosten Frau Bacher mit höhnischen Worten aus dem Geschäft gescheucht, als habe sie in dem schulpflichtigen Knirps schon den ausgewachsenen Betrüger entdeckt.
Die Kreuzung wird von den alteingesessenen Leuten heute noch Bäcker-Bacher-Kreuzung genannt, obwohl es diese Bäckerei seit bald vierzig Jahren nicht mehr gibt. Die Besitzerin, übrigens, fand in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts ein schreckliches Ende; sie hatte im Alter das Geschäft an einen jungen Meister verpachtet und wurde, als er die enorme Summe, die er monatlich zu entrichten hatte, nicht mehr bezahlen konnte, von diesem in dem nahe gelegenen Altersheim, in dem sie ihren Lebensabend verbrachte, aufgesucht, inständig um Nachlass oder Aufschub angefleht und, als sie beides verweigerte, erstochen. In dem Gebäude, das vor einigen Jahren saniert und von seinem immergrünen, dichten Bewuchs befreit wurde, ist inzwischen ein Fachgeschäft mit Utensilien für die grillende Bevölkerung untergebracht, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass es den Schulkindern von heute als lockendes wie gefährliches Märchenschloss erscheinen mag.
Hätte sie einen Hang zur Eitelkeit, könnte die Bäcker-Bacher-Kreuzung damit renommieren, dass sie nach vier Richtungen vier Welten trennt und vereint. Westlich der Kreuzung liegt die planmäßig angelegte Siedlung, in der ich aufwuchs und meine rasch größer werdenden Kreise zog, die Aiglhofsiedlung, die während des Zweiten Weltkrieges für jene Südtiroler errichtet wurde, die ihre Heimat nach dem Pakt zwischen Mussolini und Hitler, die beide dem Wahn ethnisch homogener Gebiete verfallen waren, verließen und als sogenannte »Optanten« nach Salzburg kamen. Später wurde hier auch das Strandgut aus anderen Regionen des Krieges angespült — Schlesier, Sudetendeutsche, Siebenbürger Sachsen — und mit dem Herrn Kohn, vor dem Krieg und nach dem Krieg Mitglied der Blasmusikkapelle, auch ein Jude, der 1938 ums Leben aus Salzburg hatte flüchten müssen und den es dabei bis nach Shanghai verschlug. Die Aiglhofsiedlung besteht aus einer Anzahl von Höfen, die von einstöckigen Häusern umschlossen sind, und wurde und wird von städtischen Angestellten, von Krankenschwestern und Busfahrern, Magistratsbediensteten, Lehrern, Gewerbetreibenden bewohnt. Es ist eine Welt für sich, die ihre Existenz in gewissem Sinne der unaufhörlichen europäischen Wanderung verdankt; keine proletarische Großfeldsiedlung, sondern eine belebte Wohngegend kleiner Leute, die keine Kleinbürger sein, und zugezogener Akademiker, die nicht unbedingt in gesellschaftlichem Dünkel promoviert haben müssen.
An der gegenüberliegenden Seite, ostwärts der Kreuzung, beginnt der Stadtteil Mülln, der sich über ein paar Gassen zum Hügel hinzieht, an dessen Kuppe mit ihrem weithin sichtbaren Turm die Müllner Kirche thront, von der es weiter hinauf auf den Mönchsberg und hinunter zur Salzach geht. Das Viertel liegt einer geistlichen Herrschaft zu Füßen, zu der außer der Kirche auch die von den Mönchen aus Michaelbeuern betriebene Brauerei und das in jedem Reiseführer erwähnte Augustinerbräu mit seinem großen, mit alten Kastanien bestückten Gastgarten gehört. Obwohl die Müllner Hauptstraße auf ein Nadelöhr des städtischen Verkehrs zuführt, bringt das Viertel selbst es zuwege, noch immer ein wenig verschlafen zu wirken, als befände es sich in einem angenehmen wie glaubensfrommen Dämmer, den Gott sei Dank manchmal eine Horde heimwärts lärmender Schulkinder stört.
Ganz anders ist es, wenn man sich von der Kreuzung der Bäckerei auf der schnurgeraden Straße nach Norden bewegt, in den Stadtteil Lehen, der einer der größten der Stadt und sicher der am dichtesten verbaute ist. Im proletarischen Lehen mit seinen Betonburgen, den alten und neuen, ist das Leben rauer, der Verkehrslärm hört bis spät in die Nacht nicht auf zu rauschen, die Migranten geben sich noch als solche zu erkennen und haben einzelne Straßenzüge in ihren Besitz genommen. Als Jugendlicher kam mir manchmal vor, mein gut aufgeräumter Aiglhof wäre nahe daran, in wohlanständiger Langeweile zu ersterben, und dann zog es mich hinaus zu den Freunden nach Lehen, wo es auf den Plätzen und Gstätten, den innerstädtischen Brachen, weniger gesittet zuging und ich den Eindruck hatte, ich befände mich hier, nur zehn Minuten von zu Hause entfernt, in einer anderen Stadt mit ihrer eigenen alltäglichen Kultur.
Im Süden und Osten der Kreuzung, also dort, wo die Reichenhallerstraße aus der Innenstadt herauszieht, liegt der vierte jener Bezirke, die sich um die wenig spektakuläre Bäcker-Bacher-Kreuzung gruppieren. Früher mutete mich die Riedenburg bürgerlich verschmockt an, hier lebten nicht die städtischen Angestellten, sondern die hohen Beamten, und in den stillen Seitengassen standen nicht bloß neue Reihenhäuser, sondern auch alte Villen. Später, als ich selbst hierherzog, entdeckte ich, dass das alles stimmte, aber auch wieder nicht, denn die Riedenburg ist in Wahrheit ein gemischter Bezirk, mit kleinem Gewerbe, mit Geschäften, die nicht zu den internationalen Handelsketten gehören, mit gutbürgerlichen Bewohnern, die ihrem Viertel mit Achtsamkeit zugetan sind. Die Gefahr, die der Riedenburg droht, sind nicht die wirklichen Hofräte, sondern die in einer Sphäre der virtuellen Geldvermehrung lebenden Yuppies, die manch neues Haus ins alte Viertel setzen lassen, um dort vom Laptop aus Leiharbeiter zu verschieben und als Berater für wer weiß was ihr aufklärungsresistentes Leben zu führen.
In mancher fremden Stadt, die ich besuchte, habe ich weit gehen müssen, um zu finden, was ich in der meinen von einer einzigen unscheinbaren Kreuzung aus erkunden kann: die soziale und kulturelle Vielgestalt des urbanen Lebens.
Třebíč, Stadt ohne Juden
Wer ein tschechischer Surrealist werden wollte, tat gut daran, das Gymnasium von Třebíč zu besuchen. In diese Schule, im 19. Jahrhundert eine Kampfstätte der deutschen und tschechischen Nationalisten, gingen auch die Genies beider Nationen wie Vítĕzslav Nezval, der um 1930 von den Pariser Surrealisten als Dichter erträumter Wirklichkeiten entdeckt und gefeiert wurde, im Alter aber nicht die französische Metropole, sondern den Ort im mährischen Hügelland als »Stadt der Städte« pries. Ladislav Novák wiederum, der Dichter und Zeichner, der zwei Generationen später den tschechischen Surrealismus repräsentierte, liebte seine Schulstadt, weil sie das Kunststück zuwege brachte, Peripherie und Zentrum zugleich zu sein. »Viele glänzende Möglichkeiten habe ich vertan, / aber die bei weitem beste von allen / ist diese Existenz hier wie inkognito / in Trebitsch in der Metropole Südmährens / Irgendwo am Rande der Milchstraße.«
Als ich in Třebíč eintraf, schien die Stadt gerade wieder zu erproben, ob das Traumgebilde als fester Grund ihrer urbanen Existenz taugte. Am Hauptplatz, der für eine Stadt von 30.000 Einwohnern verblüffend groß angelegt war, fügten sich die Häuser, einige darunter aus der Renaissance, andere keine hundert Jahre alt, zu einer geschlossenen Zeile. Ich suchte den Durchgang, der aus dieser Weite in die gedrängte Welt dahinter führte. Dort schob die Jihlava, ein schmales Flüsschen, träge ihr fast metallisch dunkles Wasser zwischen grünen Böschungen durch die Stadt. Auf ihrer anderen Seite lag das Židovská čtvrt’, das Judenviertel, das hier seit dem 14. Jahrhundert zwischen dem Fluss, dem Bergrücken des Hrádek und der mächtigen romanischen Basilika des heiligen Prokop eingekesselt war. Ich ging die zwei Straßen, die parallel zum Fluss und zum Berg führten, hinauf und hinunter, in die 14 verwinkelten Quergässchen hinein und wieder heraus. Alles hier war eng, zusammengedrängt, verschachtelt, und die Struktur des Häuserhaufens erschloss sich kaum, waren viele Gebäude doch geradezu ineinander verkeilt.
Weil die jüdische Gemeinde wuchs, aber das Ghetto selbst wegen seiner Lage nicht wachsen konnte, wurde es über die Generationen immer enger in ihm, jedes Gärtlein musste bebaut, jedes Haus überbaut werden. Viele der 123 Häuser waren erst kürzlich restauriert worden, aber so, dass sie alt erschienen, von anderen bröckelte hingegen der Putz, aber so, dass der Verfall malerisch wirkte. Die Pflasterungen waren neu, die zahllosen Treppen und Stufen uralt, uralt wie das Armenhospital, ein Gebäude mit mehreren, abenteuerlich aufeinandergesetzten Ebenen, dessen einstmals rosarote Fassade wie auftragsgemäß abblätterte. Nur ein paar Schritte weiter war in einem proper hergerichteten Haus ein Souvenirgeschäft untergebracht, in dessen Auslage außer allerlei Tand, der für traditionell jüdisch zu gelten hatte, eine Auswahl an Palästinensertüchern angeboten wurde, so jüdisch ging es hier zu.
In der Pokorného, der Straße, die zur neuen, der so genannten Hinteren Synagoge führte, trat ich in die Vinárna Ráchel, ein als »koscher« ausgewiesenes Caférestaurant, doch wenn dort irgendwer in Küche und Service wusste, was koscher bedeutete, konnte sich das nur einem echten Třebíčer Mysterium verdanken. In einem grünen Zahnputzbecher bekam ich Kaffee serviert, der abscheulich schmeckte, aber von der Kellnerin mit so bezwingender Fröhlichkeit gereicht wurde, dass ich ihn, um sie nicht zu kränken, indem ich ihn stehen ließ, heimlich in den großen Blumenstock zur linken Seite meines Tisches leerte, worauf sich die Blätter des Gummibaums augenblicklich verfärbten und grau wie die Ohren müder Elefanten herabhingen.
Ein paar hundert Meter von der sonnenlosen Enge des jüdischen Viertels entfernt, erstreckte sich der alte jüdische Friedhof zwischen Bäumen und Gestrüpp einen Hügel hinauf. Hier endlich, am Ort der Toten, war zu ahnen, was das Leben in dieser Stadt, die so schmuck restauriert worden war, dass selbst das Elend von früher putzig wirkte, bedeutet haben mochte. Der älteste der rund dreitausend Grabsteine datierte von 1631, der letzte wurde errichtet, kurz bevor die Wehrmacht das Land überfiel und die Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden. Die Juden von Třebíč, das verrieten ihre Namen auf den Grabsteinen, gehörten fast alle der deutschen Volksgruppe an, wenn diese sie denn als ihr zugehörig anerkannt haben würde. In einer Folgerichtigkeit, die sie niemals erahnten, haben die Nationalsozialisten, indem sie das Judentum in Mittel- und Südosteuropa vernichteten, auch die jahrhundertelange Anwesenheit deutscher Volksgruppen in diesen Raum auf immer beendet.
Nah beim Eingang wurden auf einem Denkmal, das den gefallenen Helden gewidmet war, all die Juden aufgeführt, die im Ersten Weltkrieg in der k. u. k. Armee gedient hatten und von denen die meisten schon nach wenigen Tagen ums Leben kamen. Wie der Leutnant der Reserve Isidor Grünberger, der am 10. September 1914 in Ruma fiel, jener Stadt in Syrmien, aus der einige donauschwäbische Vorfahren von mir stammten, einer Stadt, in der die Wehrmacht, als sie im nächsten Krieg den Balkan eroberte, sogleich die Synagoge plünderte und dann in Schutt und Asche legte; oder Alois Bäck, der bei den Gebirgsjägern auf der Hochebene von Asiago fiel, wo ich vor zehn Jahren die letzten Zimbern besucht hatte; oder Emil Ornstein, dessen Namensvetter in Salzburg ein legendäres Kaufhaus besaßen und eine Villa, auf die ich aus dem Fenster meines Wohnzimmers schauen könnte, wäre sie nicht, 1938 arisiert, seither bis zur Unkenntlichkeit umgebaut worden. Natürlich war es vermessen, an diesem Ort an meine eigene Geschichte zu denken und die Schicksale dieser Menschen auf mich selbst zu beziehen, und doch ist gerade dies eine häufig erneuerte Erfahrung meines Lebens: dass es fast nichts gibt auf der weiten Welt, das sich nicht mit meiner Existenz verbinden ließe, zu dem ich nicht in einer persönlichen Verbindung stünde, die ich nur zu erkennen, nein, aufzudecken hatte.
Es ist der Ruhm von Třebíč, das größte europäische Ensemble eines alten Ghettos so ehrgeizig restauriert zu haben, dass sich über die Häuser, verwinkelten Gassen, die zwei Synagogen ein Freilichtmuseum wölbt, welches die Unesco prompt zum Weltkulturerbe erklärte. Man bewegt sich hier in einer ganz heutigen Welt von vorgestern, deren pittoreske Schönheit sich keinem architektonischen Gestaltungswillen, sondern einzig Zwang und Gewalt verdankt. Das Viertel entstand, weil die katholische Obrigkeit die Juden in ein eigenes Ghetto verwies, und es hat seine einzigartige Gestalt ausgeformt, weil es sich räumlich nicht weiter ausdehnen konnte, aber immer mehr Menschen aufzunehmen hatte. Das alltägliche Leben im übervölkerten Ghetto muss arm, anstrengend, ungesund gewesen sein, darum übersiedelte, wer immer konnte, ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als den Juden die staatsbürgerliche Gleichberechtigung gewährt wurde, nach Prag, Brünn, Wien — oder wenigstens in einen anderen Bezirk der Stadt, und wenn er wohlhabend war, gar auf deren berühmten Hauptplatz. 1939 lebten nur mehr 281 Juden in Třebíč, wo sie um 1800 mehr als die Hälfte der Bevölkerung gestellt hatten, sie wurden allesamt in die Vernichtungslager deportiert, in denen nur zehn den Tod, der ihnen zugedacht war, überlebten. Keiner von diesen kehrte zurück nach Třebíč, gestern die mährische Metropole des Surrealismus, heute eine Stadt ohne Juden mit dem schönsten jüdischen Viertel Europas.
Die Wirklichkeit des Albums
Venedig in Schwarzweiß
So viel hatte ich von Venedig schon gesehen und gelesen, dass ich zweifelte, ob es die Stadt wirklich gab. Als ich zum ersten Mal nachschaute, erging es mir nicht anders als den Millionen, denen der Atem stockte, sobald sie den Bahnhof Santa Lucia verlassen hatten. Dabei ist der Bahnhof, wie Thomas Mann im »Tod in Venedig« schrieb, nur der Hintereingang, das Tor, durch das die Dienstboten den Palast betreten, während der standesgemäße Einzug vom Meer her mit dem Schiff zu erfolgen hat. Ist man durch den Hintereingang hereingekommen, findet man alles, wie es tausendfach beschrieben und abgebildet wurde, und sieht zugleich, dass es doch anders ist, als zu erwarten war. Venedig ist eine Stadt aus Papier, zahllos sind die Beschreibungen, Hymnen, Lobreden, die gelehrten Studien und emphatischen Bekenntnisse, die ihr über die Jahrhunderte gewidmet wurden. In den Stoßzeiten des Tourismus kommen täglich zwei oder wohl eher zwanzig Millionen Fotografien hinzu, die am Canal Grande, in den Gassen, auf den Plätzen gemacht werden. Wie sollte es da ein wirkliches Venedig geben? Die Stadt muss doch vollauf damit beschäftigt sein, dem Bild zu entsprechen, das längst ein jeder von ihr hat, und den Worten gerecht zu werden, auf die sie schon tausendfach gebracht wurde. Wer sich Venedig nähert, fürchtet zu Recht, dass es hinter Wörtern verschwunden, von den Bildern zugedeckt, in der Wirklichkeit womöglich nicht mehr aufzufinden ist.
Tatsächlich ertappt sich der Besucher dabei, dass er in der Stadt lauter Bilder entdeckt, die sich ihm bereits eingeprägt haben, noch ehe er hier gewesen wäre, und dass er in Wirklichkeit auf der Suche nach dem Abbild unterwegs ist, das er für jene zu halten gelernt hat. Im Vaporetto drängeln sich die Touristen, um all der Gebäude ansichtig zu werden, die sie von Fotoserien, Büchern und Filmen her kennen, und wenn sie eines davon identifizieren, reißen sie die Kameras in die Höhe, um es endlich auf einem selbstgefertigten Bild festzuhalten. Als ich das zum ersten Mal beobachtete, eingezwängt zwischen einem entkräfteten Spanier, dem die Ehefrau mit einem Klaps auf die Schultern bedeutete, dass er die Kamera mechanisch heben und knipsen sollte, und einem Amerikaner, der auf sein lebensfrohes »Oh« des Erkennens sogleich ein Bild des Wiedererkennens schoss, fragte ich mich, was der Grund für dieses merkwürdige Verhalten war. Warum fotografieren sie just das, was sie schon auf unzähligen Bildern gesehen haben, wieso wurde ihre Aufmerksamkeit gerade vom dem geweckt, was ihnen bekannt war?
Es hängt sicher mit der Unwirklichkeit zusammen, die einen in Venedig umfängt, nicht so sehr, weil dies eine unmögliche Stadt ist, gebaut auf Wasser und Papier, Materialien, aus denen Träume, aber nicht Häuser und Kirchen zu errichten sind, sondern weil Venedig jedem immer schon vertraut ist. Bewegt man sich dann in der Stadt, ist man in einer Erinnerung unterwegs, die nicht auf eigenem Erleben gründet, und das senkt den Zweifel in uns, ob wir nicht statt in eine Stadt in ein Album geraten sind, das fremde Erfahrungen als unsere eigenen Gefühle gebannt hält. Indem wir selber fotografieren, was vor uns schon so viele aufgenommen haben, versuchen wir uns auf paradoxe, hilflose Weise der Realität jener Fiktionen zu versichern, die auf uns übergekommen sind.
Wie oft man auch dort gewesen sein mag, Venedig überrascht einen, sobald man gewahr wird, dass es eine Stadt außerhalb des Albums gibt. Diese Erschütterung verspüren keineswegs nur die Bildungsreisenden, es ist keine elitäre Erfahrung, in der der Connaisseur sich seines Wissens und seiner Kultur erfreute. Auf seine Weise ergeht es jedem so, dem Massentouristen, der zum ersten Mal nach Venedig kommt und von den Trampelpfaden kaum abzuweichen wagt, wie dem Liebhaber, der regelmäßig zurückkehrt und sich über Architektur, Geschichte, Kunst, mitunter sogar über die sozialen Verhältnisse kundig gemacht hat.
Die Verachtung des Massentouristen, nirgends ist sie so naheliegend und zugleich so billig wie in Venedig. Um 1500, als Venedig an seine historische Wende kam und nach Jahrhunderten des Aufstiegs zur Serenissima, der beherrschenden See- und Handelsmacht, unaufhaltsam der Niedergang einsetzte, lebten fast 200.000 Menschen dort, wo heute keine 60.000 Einwohner geblieben sind. Natürlich wird diese Stadt, die ihren eigenen Untergang überlebt hat und heute mit der Schönheit des Verfalls, dem morbiden Glanz identifiziert wird, als hätte es vor dem Verfall keinen Aufstieg, vor dem Niedergang nicht Jahrhunderte imperialer Macht gegeben, vom Massentourismus malträtiert. Täglich schleust sich ein Vielfaches der Einwohnerschaft durch die Gassen und über die Brücken, denen darüber selbst das Seufzen vergangen sein mag. Aber von den Einheimischen, die immer weniger werden, abgesehen, ist hier jeder ein Massentourist, der Kunstsinnige, der die Nase über den aus Jesolo her verfrachteten Badeurlauber rümpft, nicht weniger als dieser. Anders, als dass man sich in den Status des Massentouristen fügte, ist Venedig nicht zu haben, es sei denn, man würde die Stadt schließen und als Museum wieder eröffnen, was freilich eine nicht minder unangenehme Spielart des Fremdenverkehrs, den Museumstourismus, favorisieren und im Übrigen nicht viel ändern würde.