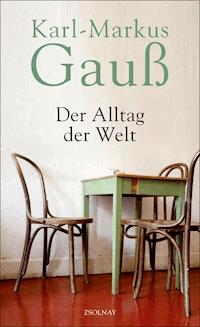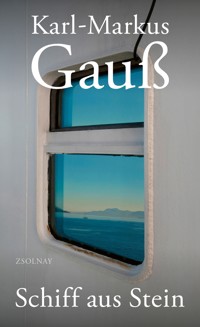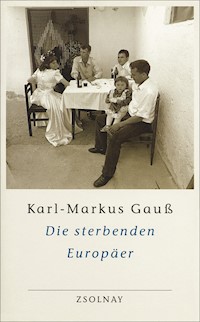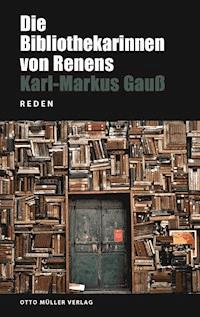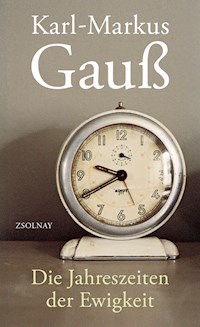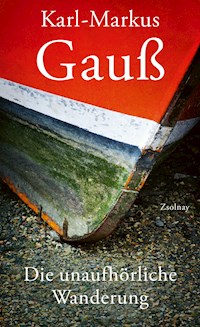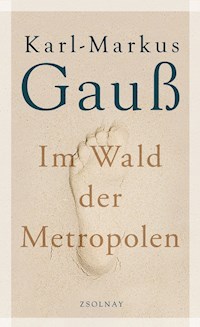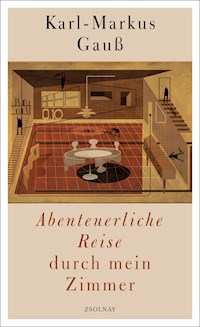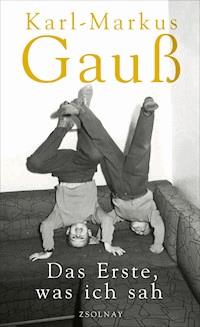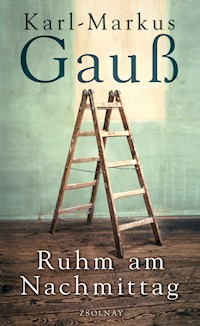
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der deutschen Provinz erschießt ein schüchterner Schüler Lehrer und Klassenkameraden; waggonweise wird im Jahr der Finanzkrise Geld verbrannt, das bereits vorher nicht existiert hat; Lieblinge der Medien und Günstlinge der Politik halten ihren Vorteil für die einzige Wahrheit, der sie sich verpflichtet fühlen. In seinen Texten verwandelt Gauß die Dinge des Lebens: Im Marginalisierten zeigt er das Bedeutsame, im Unscheinbaren Schönheit, Würde, Renitenz. Von Leben und Tod erzählt dieser Grenzgänger der Epochen, Länder und Genres aus Österreich. Und zuletzt geht es um die Frage, wie man gegen die Anfechtungen der Zeit ein richtiges Leben führen kann und dabei den Anspruch auf das Glück nicht preisgibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
In der deutschen Provinz erschießt ein schüchterner Schüler Lehrer und Klassenkameraden; waggonweise wird im Jahr der Finanzkrise Geld verbrannt, das bereits vorher nicht existiert hat; Lieblinge der Medien und Günstlinge der Politik halten ihren Vorteil für die einzige Wahrheit, der sie sich verpflichtet fühlen. In seinen Texten verwandelt Gauß die Dinge des Lebens: Im Marginalisierten zeigt er das Bedeutsame, im Unscheinbaren Schönheit, Würde, Renitenz. Von Leben und Tod erzählt dieser Grenzgänger der Epochen, Länder und Genres aus Österreich. Und zuletzt geht es um die Frage, wie man gegen die Anfechtungen der Zeit ein richtiges Leben führen kann und dabei den Anspruch auf das Glück nicht preisgibt.
Karl-Markus Gauß
Ruhm am Nachmittag
Paul Zsolnay Verlag
»Denn du selbst bist die Zeit.«
Angelus Silesius
Teil 1
Die Beteiligten und die Unbeteiligten
Unablässig schneite es weiche weiße Flocken, bis die nächtliche Straße zu glitzern begann. Ihre Freude, als sie im selben Moment merkten, wie unter den Schuhen der Schnee ihrer Kindheit knirschte. So gingen sie zu Silvester vom alten ins neue Jahr zurück.
Ein klarer, eisiger Winternachmittag; auf der hügelan führenden Augustinergasse, kurz vor der Müllner Kirche, kommt mir ein alter Mann entgegen. Er setzt seine Schritte, als würde ihn das Knie oder der Rücken schmerzen. Er hat das, was man früher eine Stoppelglatze genannt hat, mattblonde Haare, die stachelartig aufgestellt sind. Seine Gesichtshaut ist gerötet, er sieht müde aus, in sich gekehrt und traurig. Als er nur mehr ein paar Meter entfernt ist, holt er im Gehen einen silbernen Taschenkamm aus der Jacke und fährt sich mechanisch von vorne nach hinten durch das Haar. Mein Gott, das hat er auch früher, das hat er schon immer getan. Es ist Manni E., der fünf, höchstens sieben Jahre älter ist als ich und den ich, als er ein Bäckerlehrling und ich ein Volksschüler war, so bewunderte wie sonst keinen aus der Siedlung. Er war ein kräftiger, hilfsbereiter Bursche, im Sommer spielte er mit uns Jüngeren, die Schulferien hatten, bis sieben Uhr abends im Hof Fußball, dann rief ihn sein Vater, und er lief die zwanzig Meter bis zum Haus und kletterte durch das geöffnete Fenster in die Wohnung im Parterre. Er musste bald schlafen gehen, denn als Bäckerlehrling hieß es früh, kaum dass die Sonne aufging, aus dem Bett. Er trug schon damals immer einen Kamm bei sich und hat jede Stunde sein Haar zurückgekämmt, dass es sich steil aufstellte. So macht er es heute noch. Mehr als vierzig Jahre habe ich ihn nicht gesehen, jetzt bin ich ihm dankbar, dass er seinen Blick nicht von dem eisigen Weg hebt, der Held meiner Kindheit.
Kleine Mathematik des Jahreswechsels: Selbst wenn er 81 Jahre alt wird, hat er jetzt schon zwei Drittel seines Lebens hinter sich. Und wenn er es immerhin auf 72 bringt und damit auf drei mehr als sein Vater, auf dreizehn mehr als dessen Vater, dann wird er nur mehr ein Viertel vom Ganzen vor sich haben. Was er früher von den Alten, die ihm damals richtig alt erschienen, zu hören bekam, aber nicht wirklich aufnahm mit Herz und Verstand, die Klage nämlich, dass die Jahre erschütternd schnell vergangen waren, bald wird es auch die seine.
Im April 1943 wird der ungarische Erzähler, Dramatiker und Journalist Sándor Márai 43 Jahre alt. Seit zehn Jahren ist er der populärste Schriftsteller seines Landes, alle seine Romane werden Bestseller, und um ihn als Mitarbeiter zu halten, zahlt ihm die Zeitung Pesti Hírlap für sein sonntägliches Feuilleton den dreifachen Monatslohn eines Arbeiters. Im Haushalt glänzt seine Frau Lola, die ihn später über alle Stationen des Exils mit seinen materiellen und existentiellen Krisen begleiten wird, als elegante Gastgeberin, standesgemäß unterstützt von Köchin und Haushälterin. Das bürgerliche Glück eines Schriftstellers, der das Bürgertum welthistorisch für berufen hielt, die Menschheit kulturell zu veredeln, scheint vollkommen; aber es mehren sich, auf allen Ebenen des privaten, beruflichen, nationalen Lebens, die Zeichen des Untergangs.
Vier Jahre vorher war das einzige Kind des Ehepaars bald nach der Geburt gestorben. In seinen Tagebüchern spricht Sándor Márai nur selten und meist in lapidaren Worten von diesem Sohn, kühler als von seinen geliebten Hunden, aber je länger der Tod zurückliegt, umso deutlicher wird ihm: »Mein größter Schmerz: der Tod des kleinen Kindes. Nicht sofort; später, Jahre später.« Im Winter dieses Jahres 1943 wirft ihn, den robusten Vielarbeiter, eine schmerzhafte Nervenentzündung nieder, drei Monate muss er das Bett hüten. Und wovon er lange Zeit wenig Kenntnis nehmen wollte, dass sich Ungarn nämlich im Krieg befindet und noch dazu auf der Seite von Nazi-Deutschland, das dringt mit düsteren Meldungen von der Front und erschreckenden Beobachtungen, die er in den Straßen von Budapest macht, immer störender in seinen Alltag; in den Alltag eines Mannes, der bisher penibel getrachtet hatte, sein Leben ganz auf die Arbeit auszurichten: »Ein Leben nach Stundenplan. Die Unterordnung des Gemeinschaftslebens, des Essens, ja des Geschlechtslebens unter das Schreiben.«
Jetzt, da ihm der tote Sohn in den Sinn kommt, sein eigener Körper sich als anfällig erweist, rundum die Sekurität des großbürgerlichen Lebens brüchig wird und der Krieg, in fremde Länder getragen, in das eigene zurückkehrt, geht in Márai eine erstaunliche Veränderung vor. Es ist eine Veränderung, die seine ganze Existenz erfasst und eine bedeutende literarische Wirkung zeitigt. Der Erfolgsautor, der mit stupender Schnelligkeit Buch um Buch, Artikel um Artikel publizierte, verliert nämlich die Freude an dieser Art von schriftstellerischer Existenz. Ein fundamentaler Zweifel fasst ihn an, für den er zunächst einen simplen Namen findet: Alter.
Aber es ist mehr als die Wahrnehmung, dass die Jugend dahin ist und eine Zeit kommt, in der manches, was er sich bisher wie selbstverständlich zumuten konnte, seinen Tribut verlangt, etwa die tägliche Vergiftung mit Nikotin. Auf der Höhe seines Ruhmes gerät der erfolgreiche Autor vielmehr in die »erste große Krise meines Lebens, die Krise des verlorenen Glaubens, des Glaubens an meine Arbeit«. Das hat weniger damit zu tun, dass er das Zutrauen in seine schöpferischen Kräfte verloren hätte, als mit dem Zerfall jener Schicht, auf die er als Autor zeitlebens bezogen war, auf das ungarische, das mitteleuropäische Bürgertum.
Die Helden der Finanzwelt werden nacheinander als Hochstapler und Betrüger oder arrogante Versager enttarnt. Unvorstellbar ist die Schadenssumme, die der amerikanische Investmentbanker Bernard Madoff angehäuft hat, sofern man Gelder, die am Ende fehlen, anhäufen kann, in Form von Türmen des Verlusts gewissermaßen, auf die auch viele wissenschaftliche und karitative Institutionen gesetzt haben, etwa die Harvard University oder der Elie-Wiesel-Fonds.
Ein ähnlicher Bernard hat es in meiner Jugend zur Berühmtheit gebracht, der legendäre Hochstapler Bernie Cornfeld, ein Amerikaner, der die Deutschen an seinem betrügerischen Wesen von ihrem Wohlstand genesen ließ, indem er sie in den sechziger Jahren zu Anlageformen überredete, die ihrer Gier entsprachen und ihnen, anstatt sagenhafte Gewinne zu bescheren, schwer, aber redlich verdiente Verluste sicherten. Als er im Gefängnis landete, wurde bekannt, dass Cornfeld in jüngeren Jahren auf Jahrmärkten als »Alters- und Gewichtsschätzer« aufgetreten war, er wettete, wie alt und schwer jemand war und hatte ein untrügliches Gespür dafür. Die vereinten Bernies aller Alters- und Gewichtsklassen wetten heute darauf, ob Firmen, Konzerne, Volkswirtschaften untergehen oder überleben werden, und ob sie gewinnen oder verlieren, hängt weniger von diesen ab als von ihnen, wie viele sie sind und wie viel sie in das Spiel um den Niedergang, der ihr Gewinn ist, zu investieren bereit sind.
An der Universität wird die Finanzwirtschaft als Wissenschaft gelehrt, deren Gesetzen nachgerade naturwissenschaftliche Gültigkeit zukommt. Statt sie mit fragwürdigen Theorien zu verwirren, sollte man die Studenten mit bewährten Hochstaplern zusammenbringen, damit sie begreifen, wie diese denken, nach welchem Rhythmus sie ticken und wie sie die Leute, die betrogen zu werden wünschen, zu betrügen wissen. Zu jedem Betrugsfall gehören nämlich zwei, der Betrüger ist nichts ohne den, der betrogen werden will. Was man Neoliberalismus nennt, ist ein System, das beider bedarf, des Spekulanten, der Geld mit nichts als Geld schafft und dem alles, was es auf der Welt gibt und selbst das, was es nicht gibt, zum Geld wird — und jener, die ihn dafür bewundern, die ihm nachfolgen, von ihm reich gemacht werden möchten. (Und, natürlich, gehören zum Neoliberalismus auch die Ungezählten, die ihm schon zum Opfer fallen, solange für die Börsianer, die Groß- und die Kleinanleger, die Profiteure der großen Verbrechen und die Erbsenzähler des kleinen Vorteils die Welt der Spekulationen noch ganz in Ordnung ist.)
Es stimmt aber gar nicht, dass dem Spekulanten alles zum Geld wird. Er bemisst zwar alles in Geld, und er handelt mit ihm. Was er auf diese Weise vermehrt, ist aber Papier, und zwar nicht in der Weise, wie jedes Geld Papier oder Münze ist. Kein Finanzwissenschaftler weiß dem ratlosen Publikum aus betrogenen Betrügern zu sagen, wo die ungeheuren Summen von Geld, die in den vergangenen Wochen vernichtet wurden, vorher waren und wohin sie jetzt verschwunden sind. Es gab dieses Geld vorher in keinem Banktresor, und es wurde jetzt von keinem Zug mit ein paar Tausend Waggons zur Geldverbrennungsanlage gefahren. Dass es das Geld, das die einen reich, die anderen arm machte, gar nicht gab, ändert nichts daran, dass die einen damit reich, die anderen arm wurden und ausgerechnet jenen, die das Geld, das gar nicht da war, verspielt haben, nun mit den Steuern derer ausgeholfen wird, die zu wenig davon hatten, um sich damit am großen Spiel mit dem Geld zu beteiligen.
Im letzten Herbst, als ich zu einer Lesung ins kalte, regnerische Brüssel musste, sah ich dort einige Obdachlose in Schlafsäcken unter einer Arkade liegen. Sie lagerten gegenüber der Börse, mit der ihr Unheil irgendwie verbunden war, auf eine verschlungene, komplizierte, doch unsäglich triviale Weise, und vielleicht hatten sie diesen Platz ausgesucht, weil sie das ahnten und der Welt zeigen wollten, dass es zusammengehörte, ihr Elend und diese Börse. Die hier lagen, mit struppigen Bärten, schorfigen Gesichtern, waren aber, leider, noch nicht die Börsianer selbst, die von der Stätte ihres Wirkens ausgespuckt worden wären, um gleich in deren Nähe kleben zu bleiben, mit einem Mal selbst zum Auswurf geronnen, zu dem sie über sekundenschnelle Transaktionen, mit denen sie Firmen aufkauften, ausweideten und auf den Misthaufen warfen, täglich Zahllose machten; Menschen, die sie nie gesehen hatten und über die sie, würden sie ihrer in der Nähe ihres Arbeitsplatzes, der ehrwürdigen Börse von Brüssel, ansichtig werden, achtlos hinwegstiegen, weil sie niemals gestehen würden, nicht einmal sich selbst, dass diese Gestürzten überhaupt etwas mit ihnen und ihrer Arbeit zu tun hatten.
Als ich den Fernseher aufdrehte, wandte sich ein renommierter Banker meiner Stadt gerade beschwörend an die verstreute Gemeinde der kleinen Sparer. Eben noch hatten die Nachrichten vermeldet, dass die Banken einander weltweit nicht mehr trauten und sich gegenseitig kein Geld borgten. Jetzt erklärte der Banker, dass wir es in Wahrheit gar nicht mit einer Krise des aufgeblähten Finanzwesens zu tun hatten; dass an der Krise auch nicht die Spekulanten Schuld trügen, die auf fallende oder steigende Kurse gesetzt hatten und am Verlust eines Konzerns mitunter mehr verdienten als an dessen Gewinn; und dass wir auch nicht über die übel beleumundeten Manager der Hedge-Fonds klagen sollten, die nur tun, was eben getan werden muss, damit eine Maschine, die läuft, auch wenn sie in die falsche Richtung läuft, nicht zu tuckern und zu stottern anfängt. Nein, sagte der Banker, die Mutter aller Krisen, die zur Finanz- und Kreditkrise geführt habe, sei die Glaubens- und Vertrauenskrise, mit der wir, die wir vom Welt- als Bankvertrauen abgefallen waren, unseren eigenen Wohlstand gefährdeten. Und darum sei es die religiöse Pflicht jedes Staatsbürgers, gefälligst wieder jenen Banken zu vertrauen, die einander nicht trauten, denn einzig unser Vertrauen könne unsere Sparbücher und Einlagen noch retten und irgendwann, vielleicht, dazu führen, dass sogar die Banken wieder Vertrauen zueinander fassten.
Es ist zwar zu verstehen, dass keine Bank überlebt, wenn alle Kunden auf einmal ihr Geld beheben wollen; trotzdem empfinde ich, seitdem der Banker dazu aufrief, einem Stand zu vertrauen, der sich selbst nicht traut, den heftigen Wunsch, das Vermögen, das ich nicht habe, unverzüglich als Zeichen des Protestes abzuheben und zuhause im Kopfpolster zu verstecken. Denn was mir gerade als Lebensmaxime empfohlen wurde, lautet ja: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. So lernt man begreifen, dass die Sicherheit unserer Finanzökonomie nicht von schnöden Dingen abhängt wie der Sicherung der Geldinstitute durch Eigenkapital. Oder davon, dass die Finanzwirtschaft, die mit fiktiven Posten reale Gewinne in unwirklich schneller Zeit erschafft, mit dem verkoppelt bleibt, was man einmal Realwirtschaft genannt hat; also mit jener ökonomischen Sphäre, in der Dinge auch noch produziert werden, bevor das, was sie möglicherweise an Gewinn einbringen könnten, über die Kanäle des World Wide Web dreimal innerhalb einer Stunde um die Erde gejagt wird. Nein, die Sicherheit unseres Systems beruht — es war ein Banker, der mich das lehrte — auf einem immateriellen Wert, einer kollektiven Stimmung: auf dem Vertrauen, dem Glauben. Sobald wir das erzwungene Vertrauen, den verpflichtenden Glauben verlieren, kracht alles zusammen.
Die feste Basis des Finanzwesens ist also seine Fiktionalität. Kein Schriftsteller, der von Berufs wegen mit Phantasien, Erfindungen, mit Obsessionen, Träumen und Ideen zu tun hat, kann darin mit den Menschen aus der Bankwelt konkurrieren, von denen man annahm, sie wären kühle Rechner, Charaktere mit buchhalterischen Talenten. Dabei sind sie Händler mit Träumen, Spieler mit Vermutungen, haltlose Gambler, die Realitäten schaffen und zertrümmern und, während sie ihren Platz vor dem Bildschirm gar nicht verlassen, weltweit tätig sind.
»Dienstleistungsgesellschaft«: Sie verdient ihren Namen, weil sie uns nötigt, immer mehr Dienste für Unternehmen zu leisten, die sich an uns und den Diensten, die wir für sie verrichten, bereichern. Womit sie uns gewinnen, das ist der günstige Preis, die Unterbietung des Angebots, mit dem die konkurrierende Firma wirbt, um ein paar lumpige Cent. Es billig haben zu wollen kommt dem Kunden teuer. Auf den Preis dressiert, wie er ist, übernimmt er bereitwillig die Arbeit der Firma, seine eigene Arbeitszeit berechnet er nicht, sie ist ihm nichts wert, weil er sich selbst nichts wert ist. Stundenlang studiert er Prospekte, um dahinterzukommen, welche Handyfirma gerade das günstigste Angebot für ihn hat, folgsam fädelt er sich in die Warteschlangen der Callcenter ein, um für das Angebot, das er als das günstigste ausgemacht zu haben glaubt, vorstellig zu werden, ungelenk bemüht er sich, über das Internet den Vertrag, den er mit einem Anbieter geschlossen hat, zu ändern, und wenn er sich auf den Weg macht, um seine Causa in einem Handy-Shop persönlich zu betreiben, wird er sein Wunder erleben: so viel Geld die miteinander auf Profit und Untergang konkurrierenden Firmen darauf verwenden, alle paar Wochen neue, teuer hergestellte Prospekte flächendeckend über die Republik zu verstreuen, so wenig erübrigen sie für sachkundiges Personal, das den Kunden zu beraten fähig wäre … Zum Fachmann muss jeder werden, um kompetent für jene Firma tätig sein zu können, die ihm zwar ihre Waren verkauft, aber seine Dienstleistung unentgeltlich abnimmt.
Ich musste für drei Tage nach Ljubljana. Als ich, statt wie früher telefonisch Auskunft zu erhalten, im Internet selbst nach den Zugverbindungen suchte, stieß ich auf die Warnung: Reservierung für diesen Zug dringend empfohlen! Nach einer halben, mit lauter Fehlversuchen hingebrachten Stunde erhielt ich die elektronische Belehrung: Für Züge ins Ausland keine Reservierung über das Internet möglich! Also machte ich mich auf den Weg zum Bahnhof, um einen Tag vor der Reise die Karte zu erwerben und einen Platz zu reservieren. »Den Weg hätten Sie sich ersparen können«, sagte der freundliche Mann am Schalter, »den Zug kriegen wir nie voll.« Aber im Internet steht doch …? »Ah, da schreiben sie viel hinein, die Trotteln.« Ich war den Österreichischen Bundesbahnen also nicht nur unentgeltlich zu Diensten, sondern auch umsonst, denn anderntags fuhr ich auf reserviertem Platz in einem leeren Zug Richtung Süden.
Umsonst. Ein deutscher Autor namens Jochen Schmidt hat vor drei Jahren täglich zwanzig Seiten von Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« gelesen und sein Tagebuch, das er an und mit dieser Lektüre entwickelte, täglich ins Internet gestellt. Was schreibt dieser Schmidt, der sich als Schriftsteller neuen Typs, als vernetzten Online-Autor, präsentiert und dessen öffentliches Diarium von der täglichen Auseinandersetzung mit einem der am feinsten nuancierten Romane der Weltliteratur bestimmt wird? »In den Achtzigern, wo ich ständig im Theater war, wäre Kritiker mein Traumberuf gewesen, weil ich damals das Privileg, umsonst eine Karte zu bekommen, wohl stark überschätzt habe.« Wer die achtziger Jahre für einen Ort hält, »wo« er sich aufhalten kann, dem ist auch zuzutrauen, dass er Theaterkarten nicht nur gratis haben möchte, sondern sie auch wirklich umsonst erhält. Als ich sein Tagebuch als fortgesetzte Chronik der Sprachlosigkeit im Internet las, dachte ich mir, dieser Autor habe es gewiss im Sinn, aus seinen online gestellten Betrachtungen eines Tages ein richtiges Buch mit bedruckten Seiten und ordentlichem Einband zu machen. So kam es, dass ich mittlerweile auch auf Papier überprüfen kann, was ich mir bei der Lektüre am Computer dachte: Dieser Schmidt schlägt seinen sprachlichen Hammer völlig umsonst auf Proust nieder, es sprüht nicht ein Funken von Geist dabei auf.
Bisher konnte man annehmen, Sándor Márai sei aus der Bahn geworfen worden, weil die kommunistische Staatsmacht das Bürgertum nach 1945 seiner nationalen Bedeutung beraubte. Seine Tagebücher zeigen aber, dass er schon Jahre vorher entsetzt gesehen hat, wie sich jene Schicht, deren kulturstiftende Kraft er stets gerühmt hatte, vor seinen Augen zersetzte: wie sie sich gemein machte mit den Antisemiten um den autoritären Reichsverweser Horthy, wie sie sich schließlich der deutschen Besatzungsmacht ergab und endlich abdankte, um die Nation den »Pfeilkreuzlern«, den rabiaten Schlächtern, die 1944 die Macht im Staat übernahmen und Jagd auf die Juden machten, zu überlassen. »Ich habe das ungarische Bürgertum, die Klasse, in die ich hineingeboren wurde, gesehen, kennengelernt, in all seinen Aspekten bis zu den Wurzeln untersucht; und nun bin ich Zeuge seines völligen Zerfalls … Und wie das Ganze in einen wilden Raubzug und den völligen Untergang mündete.« Der fundamentale Zweifel am eigenen Werk und die sich langsam und quälend öffnende Einsicht in den Zerfall des Bürgertums, das nicht erst von außen zerschlagen werden musste, sondern an innerer Schwäche, an Opportunismus, Klassendünkel, Niedertracht zugrunde geht, gehören zusammen.
In dieser krisenhaften Situation beginnt Márai sein Tagebuch zu schreiben. Er wird damit 46 Jahre lang nicht mehr aufhören, bis zu jenem 15. Januar 1989, an dem er die letzte Eintragung macht: »Ich erwarte die Abberufung, ich dränge nicht, aber ich zögere auch nicht. Es ist soweit.« Einen Monat später hat er sich, krank, verwitwet, außer in seinen Tagebüchern als Autor verstummt, in San Diego erschossen.
Israel führt im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas, die es für ihr heiliges Recht hält, Raketen gegen Israel abzufeuern, weil sie das gesamte israelische Territorium für geraubtes islamisches Land hält. Nicht nur die israelische Regierung hatte in den letzten Wochen die Hamas dringlich aufgefordert, den täglichen Beschuss mit bis zu achtzig Raketen einzustellen. Natürlich hat die Hamas sich geweigert, mit der Bombardierung innezuhalten, täte sie es, wäre sie nicht die Hamas, und sie hat auch den inständigen Rat arabischer Nachbarstaaten ausgeschlagen, den Waffenstillstand, den Israel und die Hamas geschlossen hatten und beide gewohnheitsmäßig brachen, einzuhalten. Nun bombardiert Israel mit seiner gewaltigen Militärmaschinerie die Stellungen der Hamas, die sie einst selbst als Konkurrenten der PLO großgezogen hat, und trifft entgegen der Propaganda natürlich keineswegs nur militärische Objekte. Gleich in den ersten Tagen sterben Hunderte Zivilisten. Über der in alle Welt übertragenen Bildberichterstattung vom Krieg ist weltweit neuerlich der Hass auf Israel aufgeflammt, ein Hass, der sich vorgeblich aus dem Mitgefühl, der Solidarität mit den geschundenen Palästinensern speist und sich somit als nachgerade humanitärer Hass gefällt. Täglich werden wir übers Fernsehen vom Massenmorden in Darfur, vom regierungsamtlich verfügten Massaker in vielen Ländern Asiens und Afrikas, vom unaufhörlichen Bombenkrieg islamistischer Gruppen gegeneinander informiert — aber das ist keine Mahnwache und keine Demonstration wert. Was zählt, ist immer nur der Krieg in Palästina. Aber nicht, weil Palästinenser ihm zum Opfer fallen, sondern weil es Juden sind, die man als Täter verantwortlich machen kann.
Sie fahren für ein paar Tage nach Wien und steigen in einem Hotel in der Josefstadt ab, in der Lange Gasse, wo sie jedes Mal neue Hinweise auf die literarische und soziale Geschichte des Viertels entdecken. Einmal ist es die Tafel, die an einem Haus in der Lange Gasse an Hugo Bettauer erinnert, den Autor, der Aufklärung ausgerechnet mit Sensation, Sex und Kolportage unter die Leute bringen wollte. Und der das mit dem Tod und einem anhaltend schlechten Ruf in der Literaturgeschichte bezahlte. Er war ein Schnellschreiber, der fünf Romane im Jahr veröffentlichte, eine sexualreformerische Zeitschrift herausgab und den Wiener Antisemiten in dem Roman »Stadt ohne Juden« das schwarze Zukunftsbild einer Metropole vor Augen hielt, aus der, wenn nur erst die verhassten Juden sie tatsächlich kollektiv verlassen haben, wieder Provinz geworden sein wird. Bettauer war so populär, dass Christlichsoziale und Deutschnationale einander darin übertrafen, gegen den »räudigen Talmudjuden« zu hetzen, bis er 1925 geradezu auftragsgemäß von einem illegalen Nationalsozialisten ermordet wurde.
Dann wieder stoßen sie, in der Florianigasse, auf eine Tafel, die daran erinnert, dass hier ein Jahr lang Lazar Zamenhof gelebt hat, der jüdische Arzt und Gelehrte aus Byałistok, einer Stadt, deren Einwohner sich in vier Sprachen unterhalten konnten, auf Deutsch, Polnisch, Jiddisch und Russisch, und die einander trotzdem nicht verstehen wollten. Deswegen war es die krause wie grandiose Hoffnung Zamenhofs, sie würden in einer fünften Sprache zueinander finden, im Esperanto, das er erfand und mit dem er seiner Stadt, Mitteleuropa, der Menschheit selbst eine Lingua franca zu geben hoffte, niemandes Muttersprache, aber die Bildungs- und Herzenssprache aller wohlmeinenden Menschen. Den Nationalsozialisten galt das Esperanto als Judensprache, deren Gebrauch verboten war, die Stalinisten in der Sowjetunion hielten es anders, sie rühmten das Esperanto als Versuch, den friedlichen Austausch zwischen den Völkern zu befördern, und brachten dafür alle bekannten Esperantologen um.
Das kleine Café Strozzi unweit von ihrem Hotel hat auf die reizvolle Art vieler Wiener Kaffeehäuser ein sozial gemischtes Publikum, sodass Junge und Alte, Alteingesessene und Zuwanderer, Alleinsitzer und Stammtischbrüder, die Hofratswitwe und der Student mit den Dreadlocks nebeneinander sitzen. Eine Frau von einigen dreißig Jahren, mit mächtigem brünettem Haarschopf und attraktiv geschnittenem Gesicht, betritt gegen 22 Uhr das Café, wirft ihren beim Eintreten bereits halb ausgezogenen Mantel auf die Bank, setzt sich krachend daneben an das freie Tischchen und beginnt sofort wie wild in der Zeitschrift zu blättern, die sie bei sich hat, auf keiner Seite verweilt sie länger, nach zwei Minuten ist sie in reißender Jagd der Finger durch die ganze Zeitschrift gehetzt. Bei der rundlichen Kellnerin, die eine unstörbare Ruhe ausstrahlt, bestellt sie etwas, sie macht sich inzwischen über zwei Zeitungen her und hustet gelegentlich rasselnd auf. Die Palatschinken, die ihr serviert werden, vertilgt sie in großen Bissen, wenig später findet sich auf dem Teller nur mehr die Spur der zerronnenen Schokolade. Sogleich springt sie auf, greift sich den Wintermantel, eilt, diesen anziehend, zur Theke, wirft der Kellnerin ein paar Münzen hin und donnert in die sternenklare Nacht hinaus: herrische Besitzerin von Furien, mit denen sie abends Parade hält.
Spät nachts geraten sie unversehens in eine Schar von Ravern, die sich offenbar stundenlang und nicht ohne Erfolg um den Verstand zu tanzen versucht hatten, plötzlich waren sie von zuckenden, hüpfenden Kindern mit erloschenen Augen umgeben, man musste sich nicht vor ihnen, sondern höchstens um sie fürchten. Da gab es kein Entkommen, es war wie damals in Krakau, als er am Abend des ersten Todestags von Papst Johannes Paul II. auf dem Rynek stand, dem großen Platz um die Tuchlauben, und zuerst staunend beobachtete, wie Tausende und Abertausende aus den Seitengassen auf den Platz strömten, und dann zu spät bemerkte, dass sich die Menge binnen weniger Minuten so verdichtet hatte, dass er von ihr verschluckt und auf die Prozession, die dreimal um den Platz herumführte, mitgenommen wurde. Er war von lauter inbrünstig Betenden umgeben, die auf die von den Priestern mit Lautsprechern vorgesprochenen Gebete in einem fort mit Bittformeln antworteten, in ihrem weichen, zischenden Polnisch, und trottete mit ihnen, umfangen von diesem riesenhaften Körper der Frömmigkeit, bis er eine fremde Stimme bemerkte, die aus ihm selber in einem zischend nachgeahmten Kirchenpolnisch sprach.
Der Rave hat eine sakrale Note (er hat ja nicht viele Noten und nur einen einzigen Rhythmus), das fiel ihm inmitten von ichverlorenen Ekstatikern des Tanzes auf, die ihn an die ichverlorenen Ekstatiker der Prozession erinnerten: die litaneienhafte Wiederholung im katholischen Ritus, die wummernde Wiederholung im Rave. Anders als in der Messe und bei der Prozession gibt es in dieser Musik kein Davor und kein Danach, keine Ouvertüre, die die Motive vorwegnimmt, und kein Finale, das sie noch einmal steigern und bündeln würde, die einzelnen Nummern haben keinen Anfang und kein Ende, sie stampfen im ewig gleichen Rhythmus dahin, bis endlich einer entkräftet zusammensackt oder ein Samariter den Stecker aus der Dose zieht. Die Rave-Kultur suggeriert reine Präsenz und Unmittelbarkeit und ermöglicht das glückliche Eintauchen in die zuckende und stampfende Masse, die ein riesenhafter Körper geworden ist, seiner selbst nur vegetativ gewiss. Keine Ahnung ist in dieser Masse, dass sie nicht nur eine rhythmische Einheit bilden, sondern auch politische Kraft entfalten könnte.
Was die Raver suchen, ist die Seligkeit des Selbstverlusts und der Selbstvergessenheit; in einer Welt des Kalküls und der Berechnung sind sie der Trotz ohne Aufbegehren.
Dass er mit dem Tagebuch jene literarische Form gefunden hatte, die seinen Talenten und Ambitionen völlig gemäß war, wird Márai, als er sich 1943 erstmals daran machte, eines zu führen, selbst noch gar nicht ermessen haben. Heute aber, da diese Tagebücher nach seinen Romanen, von denen die meisten auch in ihrer deutschen Übersetzung Bestseller wurden, aufgelegt werden, erweist es sich zweifelsfrei: Sándor Márais Beitrag zur Weltliteratur sind nicht seine Romane, nicht diese perfekt gebauten, immer ein wenig allzu gedrechselten Romane, in denen vornehm der Staub aus kakanischen Kulissen rieselt — Márais bedeutendstes Werk ist sein monumentales, über fast ein halbes Jahrhundert fortgeschriebenes Tagebuch.
Von Anfang an hat er das Tagebuch nicht als Ort der privaten Selbstaussprache betrachtet und das diaristische Schreiben auch nicht als jene pietistische Gewissensbefragung betrieben, die für die Ausbildung des europäischen Tagebuchs als literarischer Gattung so wichtig war. Es ist auch kein Arbeitsjournal, das er führte und in dem er die Einfälle festhielte, die ihn später womöglich für seine Romane nützlich werden könnten. Und noch etwas ist sein Tagebuch nicht, eine zuverlässige politische Chronik, denn er verzichtet fast gänzlich auf Datierungen, sodass man nur indirekt erschließen kann, wann er welche Betrachtung, Erinnerung, Reflexion festgehalten hat.
Was ist das Tagebuch dann für ihn, wenn es schon so viele Aufgaben nicht erfüllt, die Tagebüchern gemeinhin zufallen? An einer unauffälligen Stelle seiner Aufzeichnungen verbirgt er einen poetologischen Selbstkommentar: »Das, was ich schreibe, erschafft mich, nicht umgekehrt.« Er schreibt also nicht, um der Welt Kenntnis zu geben von dem, wovon er selbst Kenntnis bereits gewonnen hat, sondern um sich in der täglichen Arbeit des Schreibens zu erschaffen, um diaristisch jenes Ich zu entwerfen, das er sein möchte und als das er sich, der Bürger, dem seine Welt verloren geht, behaupten will.
Bewundernswert, mit welcher Radikalität es Márai angeht, der doch an den Luxus, die Anerkennung gewöhnt war. Ihm ist sofort klar, dass er, der bestbezahlte Journalist, nur mehr ausnahmsweise für Zeitungen schreiben wird, nicht nur, weil es ihm unstatthaft erscheint, in zensurierten Organen zu veröffentlichen, sondern auch, weil das Tagebuch ihm künftig die Öffentlichkeit ersetzen soll. Seine rastlose Publizistik, die ihn berühmt und wohlhabend gemacht hat, stellt er fast vollkommen ein; dafür wächst sein Tagebuch schon in den Jahren von 1943 bis 1945 auf achthundert Seiten.
Er ist sich des Zusammenhangs bewusst, und er gibt auch hier eine kleine poetologische Seitenbemerkung: Ereignisse, sagt er, sind »die Beute des Journalisten«, sein ureigenes Lebenselement als Schriftsteller aber sei der »Erlebniswert eines Ereignisses«. Folglich lesen wir in seinen Tagebüchern weniger von Ereignissen als davon, wie sie sich in seiner Seele und seinem Denken niederschlugen, und es ist vermutlich genau dieses selbstreflexive Moment, das den Romancier und Journalisten Márai überhaupt auf das Tagebuch gebracht hat. Was nämlich beiden verboten ist, dem Erzähler wie dem Reporter, gerade das ist dem Diaristen erlaubt: sich fortwährend ins Wort zu fallen, sich zu widersprechen, die Dinge, die gerade plastisch dargelegt wurden, selbst zu kommentieren, kurz: die Genres in einem fort zu wechseln, die Haltung zu den Dingen stetig neu zu erproben und sich gewissermaßen dabei zu beobachten, wie sich der Abdruck der Dinge und Ereignisse im eigenen Ich, wie sich damit dieses selbst verändert.
Auf der Heimfahrt von Wien, kurz vor Salzburg, sehen wir weiß die Festung über der Stadt stehen. Thronen. Als der Künstler Dieter Huber mir vor Jahren eine von ihm auf dem Computer bearbeitete Ansichtskarte Salzburgs zeigte, auf der er Festung und Kirchtürme wegretuschiert hatte, habe ich meine Stadt nicht erkannt. Die Festung gehört zu dem Bild, das ich von ihr seit Kindertagen habe, ihr Anblick, der sich mit den Jahres- und Tageszeiten ändert und sie manchmal einer riesenhaften Kinderburg aus Pappkarton ähneln lässt, ist mir vertraut und auch lieb. Aber sie ist als Trutzburg der fürsterzbischöflichen Leuteschinder errichtet worden, nicht späteren Generationen zum Wohlgefallen; um auf die Bauern, sollten sie sich vermessen, gegen die Stadt zu ziehen mit ihren Hellebarden und Mistgabeln, hinunterzuschießen und die Stadtbürger alle Tage daran zu gemahnen, dass sich ihr Herr, wenn sie frech würden, hoch über sie in eine uneinnehmbare Burg zurückziehen und sie von dort maßregeln könne nach seinem christlichen Gutdünken, deswegen wurde sie errichtet. Eine Festung verliert ihren Schrecken mit der Entwicklung neuer Waffen und der Entfaltung einer anderen, bürgerlichen Herrschaftsform. Ab wann ist es statthaft, einen Ort, der den Vorangegangenen ein Inbild des Schreckens, ein Symbol der allgegenwärtigen Macht war, als schön wahrzunehmen?
In seinem Buch »Der Wandler der Welt« erzählt Drago Jančar die wahre Lebensgeschichte seines slowenischen Landsmannes Pavel Areh, der nacheinander idealistischer Schwärmer, kommunistischer Widerstandskämpfer, geachteter Architekt und geächteter Häftling ist. Schon als Jüngling zeichnet er unablässig Pläne von großzügigen Kindergärten, Schulen und Wohnsiedlungen, später, als es im Zweiten Weltkrieg gilt, sein Land von den nazistischen Besatzern zu befreien, schließt er sich unerschrocken den Partisanen an. Nach 1945 stellt Pavel allen persönlichen Ehrgeiz zurück, um der großen Sache zu dienen — der neuen Gesellschaft, in der der Mensch nicht mehr des Menschen Wolf sein wird.
Aber es erweist sich: Auch die neue Gesellschaft braucht Gefängnisse, und sie braucht Baumeister, die die Pläne dafür entwerfen. Und Pavel, der von der Gemeinschaft freier Menschen träumt, wird beauftragt, ein Gefängnis zu bauen, in dem jene verwahrt werden sollen, die sich unbelehrbar der frohen Botschaft von Freiheit und Gleichheit verweigern. Den Feinden hat er mutig widerstanden; dass falsch sei, was seine Freunde von ihm verlangen, wagt er hingegen nicht einmal zu denken. Darum wendet er sein gestalterisches Können, die Phantasie des Architekten auf, das perfekte Gefängnis zu errichten, so konstruiert, dass die Häftlinge einander niemals zu sehen bekommen und selbst der Austausch mittels Klopfzeichen zwischen ihnen unmöglich ist: Völlig unbeeinflusst von Zuspruch, Ermutigung oder schlechtem Einfluss verschwörerischer Mitgefangener soll jeder Häftling ganz für sich alleine bleiben und die Lehre von der brüderlichen Gemeinschaft begreifen lernen. Wie gut er gebaut hat, kann der Baumeister erst ermessen, als er eines Tages von seinen Genossen als vermeintlicher Verräter selbst ins Gefängnis gesteckt wird.
Der verzweifelte Baumeister, gefangen in seinem Werk, zweifelt nicht daran, dass er recht getan und gute Arbeit für die gerechte Sache geleistet hat. Sein eigener Fall — nur ein Irrtum. Aber er zerbricht in seiner Zelle über der Einsicht, dass er bald schon ganz vergessen sein wird, denn niemand kennt sie, die Erbauer von Zuchthäusern und Strafanstalten, und selbst die Namen derer, die die berühmtesten Gefängnisse der Welt erbaut haben, sind nicht überliefert.
Was aber ist mit denen, die heute keine Gefängnisse bauen, sondern die prächtigsten Bauwerke der Epoche errichten — freilich in Ländern, die man, wenn nicht als große Gefängnisse, jedenfalls als Autokratien bezeichnen muss? Ihre Namen kennt jeder, der sich mit moderner Architektur beschäftigt. Im Bauwunderland Dubai entstehen gerade das luxuriöseste Hotel und die teuerste Shopping Mall der Welt. Die Freiheit des Baumeisters, sich selbst zu verwirklichen, zum eigenen Ruhm und zu jenem seines Bauherrn, wird dort durch keine Gewerkschaft und keine lästigen Anrainer beschränkt; denn im Eldorado der größenwahnsinnigen Baumeister zählt nichts als der Wille des Autokraten und seines Architekten.
Einmal so frei bauen zu können, wie es einem nur die Diktatur erlaubt, das muss für geniale Architekten eine gewaltige Verführung sein, mit der Gewalt zu paktieren. In Dubai schuften Zehntausende Arbeiter aus Pakistan, Indonesien, Palästina auf den Rohbauten der Wolkenkratzer, sie sind in Siedlungen untergebracht, die Straflagern ähneln, rechtlose Arbeitssklaven, an deren Schicksal die weltberühmten Architekten aus der Schweiz, aus Holland, Großbritannien, Norwegen nicht schuld zu sein begehren: Mein Gott, wir bauen ja nur! Und was für kühne, noch nie gesehene Meisterwerke!
Am Schicksal, das den palästinensischen Arbeitssklaven in den Scheichtümern am Golf beschieden ist, hat noch keiner etwas auszusetzen gehabt, der Israel wegen des Unrechts, das es den Palästinensern durch Vertreibung und Besatzung zugefügt hat und weiterhin zufügt, anzuklagen pflegt. Der Scheich von Dubai mag viele Fehler haben, den einzigen, der unverzeihlich wäre, nämlich die Palästinenser auszubeuten, ohne als gottesfürchtiger Muslim dazu ermächtigt zu sein, hat er nicht.
Überall in Europa werden Mahnwachen für die Palästinenser abgehalten, und das mit gutem Grund. Unter den Mahnenden und Wachenden finden sich allerdings Humanisten, die fein abwägen, gegen welches Unrecht sie aufstehen und für welches sie einstehen. Angesprochen darauf, dass es in islamischen Staaten ihren Geschlechtsgenossinnen bei strenger Strafe verboten sei, Juden oder Christen — von Atheisten gar nicht zu reden — zu ehelichen, bemerkt die österreichische Sprecherin einer Organisation namens »Frauen in Schwarz« schnippisch, dass es auch Katholiken nicht gerne sähen, wenn ihre Kinder keine Katholiken heirateten. Etwas nicht gerne sehen und etwas als Verbrechen ahnden ist für sie dasselbe. Ihre Dummheit ist nicht nur ihre private Leidenschaft, sie hat vielmehr Methode. Worin sie sich übt, das ist die methodische Selbstaufgabe zivilisatorischer Errungenschaften (einst war es auch für katholische Mädchen gefährlich, sich in den Mann mit dem falschen religiösen Bekenntnis zu verlieben). Diese Errungenschaften werden entweder für nichtig erklärt oder dem Fetisch geopfert, der kulturelle Differenz heißt: Wenn die Menschenrechte verletzt werden, ist das nicht länger die Schuld jener, die sie verletzen, sondern derer, die sie erfanden und für universell auszugeben den europäischen Hochmut hatten.
Ach, der europäische Hochmut, gegen ihn habe ich in den letzten zwanzig Jahren weiß Gott genug gewettert! Manchmal verspüre ich die Versuchung, ihn gegen die niederträchtige Bescheidenheit zu verteidigen, mit der Europa des schlechten Gewissens und der guten Geschäfte wegen den verstockten Finsterlingen der Welt begegnet, die nicht an so imperialistischen Werten wie den Menschenrechten gemessen werden wollen.
In Dubai entsteht die Stadt der Zukunft, sie ist, wiewohl aus islamischem Boden wachsend, vollständig globalisiert und einzig dem Vergnügen gewidmet. Das Vergnügen allerdings ist rigide eingeschränkt, denn in der futuristischen Stadt, die keinen alten Stadtkern hat und keine Agora, auf der sich die Bewohner träfen, um ihre Dinge zu verhandeln, gibt es nur eine einzige öffentliche Unterhaltungsmöglichkeit, das Shoppen. In den Shopping Malls, Wunderwerken der globalisierten Architektur, von denen ein jedes simuliert, eine eigene, prächtige Stadt für sich zu sein, die jedes urbane Bedürfnis stillen kann, und zwar indem sie es zu einem Kaufakt führt, finden sich jene Boulevards und Plätze, die die Stadt draußen nicht hat. Hier flanieren die Leute, hier begegnen sie ihresgleichen, allerdings nur ihresgleichen, denn die Malls sind digitalisierte Wehrburgen des Konsums, die mit privaten Armeen und ausgeklügelter Technologie der Überwachung hochgerüstet wurden, nicht nur um Anschläge von Terroristen, Überfälle von Räuberbanden, sondern auch den Zustrom Unbefugter zu verhindern, die sich die Dinge, die hier angeboten werden, nicht leisten können und deren Anblick jenen, die sie sich leisten können, womöglich die gute Laune des Kaufens verderben würde. Wie in den Shopping Malls internationale Luxusketten ihre schönsten Dependancen haben, so ziehen sie ein internationales, aus der ganzen Welt zusammengeklaubtes Publikum an, einen Tourismus, der für das touristische Angebot die höchsten Preise zu zahlen bereit ist, doch kein anderes sucht und vorfindet als jenes, das in bewachten Malls, umgitterten Hotelanlagen, auf künstlichen Inseln bereitgestellt werden kann: Außerhalb von diesen ist auch nichts. Oder fast nichts. Jedenfalls nichts, das ihnen die Erkundung lohnte.
Nirgendwo wird dermaßen viel Geld in den Aufbau einer Wunderstadt gesteckt, die keine Stadt mehr ist, sondern die Simulation einer Stadt, die auch keine Einwohner mehr hat, sondern Besucher, die Urlaub nicht in einer Stadt machen, sondern in einem Einkaufszentrum. Die Bewohner von Dubai haben entweder den Status der reichen Besucher und bringen ihre Tage ähnlich herum wie diese, nur sind sie dazu alle Tage des Jahres, nicht nur jene gezählten des Urlaubs verdammt, oder sie haben den Status von Arbeitern, die das siebentorige Theben erbauen müssen, dann sind sie in die Pferchsiedlungen außerhalb der Stadt verbannt, auch sie eine globalisierte Masse Mensch, die aus allen Weltrichtungen hierher gelockt wurde.
Weil ich nicht recht wusste, was ich mit ihr reden sollte, habe ich der Bekannten, einer Architektin, die ich unterwegs traf, ganz gegen meine Gewohnheit erzählt, was ich ein paar Stunden vorher in meinen Aufzeichnungen notiert hatte, dass nämlich die Architekten von Gefängnissen namenlos blieben. Sie widersprach mir, in Leoben habe vor einigen Jahren ein österreichischer Architekt namens Hohensinn eine Strafanstalt errichtet, die wie jede dieser Einrichtungen dem Zweck dient, dass verurteilte Straftäter sie nicht aus eigenen Stücken verlassen können, wann es ihnen beliebt, und die sich dennoch architektonisch an den Bedürfnissen der Insassen orientiert. Obwohl das »Justizzentrum Leoben« natürlich kein Wellnesshotel, sondern ein reguläres Gefängnis ist, haben sich die Politiker der steirischen FPÖ darin überboten, die Bevölkerung mit Berichten über eine Dreisternehotellerie, in der sich die Kriminellen in Kuschelzellen vergnügen, aufzuhetzen und schließlich gar behauptet, auf georgischen Websites sei das Gefängnis als Urlaubsort angepriesen worden, an dem es sich angenehmer leben ließe als anderswo in Freiheit. Zuhause habe ich nachgesehen, ob im Internet mehr über den Architekten und sein Gefängnis zu erfahren war. Auch Wikipedia erzählt von georgischen Websites, allerdings so, als wären diese nicht eine Erfindung von Steirern, die Propaganda für die Pferch- und Verwahranstalten alten Typs machen wollten. In der Enzyklopädie des Internet werden Gerüchte, aus politischer Ranküne ausgestreut, rasch zu Gewissheiten.
Gefangene der Grazer Haftanstalten Karlau und Jakomini haben sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Die schweren Burschen führen bittere Klage, dass sie im Auftrag eines privaten Unternehmens und mit Duldung des österreichischen Justizministeriums fortgesetzten Betrug zu verüben haben. Sie wollen nicht mehr für ein Callcenter, an das sie die Strafanstalten verschachern, tätig sein. Ja, für eines dieser Callcenter, von denen man entweder angerufen und mit Informationen über Waren, Geschäfte, Transaktionen belästigt wird, um die man gar nicht angefragt hat, oder zu denen man telefonisch weitergeleitet wird, wenn man sich eigentlich bei einem Unternehmen wegen eines fehlerhaften Produkts, einer überfälligen Dienstleistung beschweren wollte. Im Callcenter, das erfahren täglich Zehntausende, wird man das Anliegen, das man hat, niemals los, und man weiß natürlich, dass der Zorn, der dann in einem hochschießt, mit der Dame, die in ihrer Höflichkeit am Telefon unerschütterlich bleibt, die falsche trifft. Sie ist vermutlich eine gestresste Mutter, die nach ein paar Jahren Karenz in ihrem erlernten Beruf keine Stelle mehr gefunden hat und sich jetzt von empörten Kunden eines Unternehmens beschimpfen lassen muss, das ihresgleichen nur Hungerlöhne zahlt, weil die Aktionäre am Jahresende ordentliche Rendite sehen sollen.
Genau so ist es mittlerweile, und das möchten einzig jene nicht mehr hinnehmen, die für kriminell gelten, aber im Unterschied zu den Ganoven aus Wirtschaft und Politik noch soziale Empfindungen haben. Sie wollen nicht länger für eine reputierliche Firma Telefondienst versehen, denn die Lockangebote, die sie anzupreisen haben, sind falsch, die Namen, mit denen sie sich melden, ebenso, und dass es ihnen verboten ist, sich wahrheitsgemäß mit den Worten vorzustellen, »Grüß Gott, ich rufe sie aus der Justizvollzugsanstalt Karlau an«, versteht sich von selbst. 40.000 Euro Reingewinn im Jahr möchten sich die beiden Gefängnisse jedoch nicht entgehen lassen, und darum müssen die ehrlichen Verbrecher weiter in Staatsdiensten lügen und für die freie Wirtschaft betrügen.
Die Gefängniswärter in Frankreich streiken. Die seit Jahren verfallenden Haftanstalten sind heillos überbelegt, die Gefangenen, in ihre Zellen gepfercht, dem Gewaltregiment ranghoher Krimineller und ihrer Gangs ausgeliefert, jederzeit kann die Gewalt hochschießen, und dem staatlichen Personal bleibt nicht viel anderes, als zu bewachen und zu verwahren und darauf zu achten, nicht selbst hinterrücks niedergestreckt zu werden. Einen Tag lang haben sie gestreikt, dann hat ihnen der ehemalige Innenminister und jetzige Präsident Sarkozy den Kärcher geschickt, mit dem er einst nur die Vorstädte von den randalierenden Immigranten, nicht die Straßen von den protestierenden Staatsdienern säubern wollte. Und die Welt bekommt das seltsame und seltene Spektakel zu sehen, dass Gefängniswärter demonstrieren und von Polizisten niedergeknüppelt werden.
Die Spekulationen, mit denen einige Jahre lang ein jeder reich werden wollte, gründeten auf nichts als dem Vertrauen von Aktionären, dass die Aktien, die sie erstanden, nachgerade wie von selbst immer höhere Kurse erreichen würden. Wie dieser Kurs erreicht wird, das ist dem großen Börsianer und dem Kleinanleger nicht nur gleichgültig, sondern es ist in der Regel auch ihrer Anschauung entzogen. Seine Rechtfertigung bezieht der Aktienhändler aus der Tatsache, dass er investiert und jenen, die ihm ihr Geld anvertrauen, Gewinne beschert, von denen diese wiederum nicht zu wissen brauchen, womit sie erkauft und bezahlt wurden.
Aktien, die jahrelang geboomt und an denen sich auch zahllose Kleinanleger erfreut haben, sind aber oft deswegen so erfolgreich gewesen, weil irgendwo Tausende Arbeiter von Unternehmungen, von denen die Erbsenzähler ihrer Aktiengewinne gar nicht wussten, dass sie existierten, in Ländern, von denen sie im Atlas hätten nachschauen müssen, wo sie liegen, entlassen oder in ihrem Lohn gedrückt wurden. Von der realen Verelendung, aus der ihr Gewinn wächst, haben der kleine wie der große Spekulant nichts wissen müssen, weil sie auf dem Weg durch ihre Stadt nicht über Hungernde, die auf den Straßen niedergesunken waren, stiegen; die verkamen irgendwo anders, sehr weit weg und doch nur 0,04 Sekunden einer verhängnisvollen Datenübertragung entfernt, mit der Anteile gekauft und verkauft wurden.
Abermillionen von Kleinaktionären, die sich darum rissen, auf das große Abenteuer der rätselhaften Geldvermehrung mitgenommen zu werden, klagen nun bitter über die Anlageberater, an die sie sich angehängt hatten; sie jammern, weil sie sich um ihr Geld, dessen wundersame Vermehrung sie nicht für faulen Zauber, sondern ihr Menschenrecht hielten, gebracht fühlen. Was sie vorher, als Anleger, und nachher, als betrogene Betrüger, prägt, ist ihr Autismus: Sie interessieren sich nicht für die Welt, nicht dafür, was mit ihrem Geld gemacht wird, noch darum, woher es kommt, und dass es sich so lange hübsch vermehrte, schien ihnen ein Naturgesetz oder der gerechte Lohn für ihren Fleiß und ihre Voraussicht zu sein. Um ihren Traum, den sie für schön hielten, obwohl er schon schmutzig war, solange sie ihn noch träumen durften, haben sie reale und virtuelle Mauern gezogen, auf dass unsichtbar bleibe, wovon der schöne Schein seinen Glanz bezog.
In den europäischen Städten werden die Elendsviertel an die Ränder, ins unbesiedelte Gelände hinaus verlegt und mit hohen Mauern umgeben. Das Elend, das man nicht sieht, existiert nicht mehr, und den Armen, der uns daran erinnert, dass der Reichtum eine befristete Angelegenheit sein kann und der schöne Schein gesellschaftlich womöglich mit unschönen Dingen zu tun haben könnte, müssen wir unsichtbar machen, auf dass wir glauben, die Armut selber würde nicht mehr existieren. Der Hass, der überall in Europa, besonders ungehemmt aber dort, wo der Wohlstand am größten ist, gegen die Bettler mobil macht, obwohl alle Bettler des Kontinents in einem Jahr nicht den Bruchteil jener Summe erwirtschaften, den ein Hedge-Fonds-Manager an einem einzigen Tag vernichten kann, dieser Hass hat mit der Sichtbarkeit zu tun: Die Welt muss unsichtbar werden, damit ihr Schein gewahrt bleibe, der unsere ökonomische Basis, unser persönliches Lebensglück und die Heimat des globalisierten Menschen ist.
Darum müssen Menschen aus unserem Sichtfeld verschwinden, aber auch viele Dinge wie das Geld selbst. Es regiert zwar die Welt, aber es ist nicht sichtbar. Der Reiche wedelt nicht mehr protzig mit den Geldscheinen, die Unsummen seines Geldes sind vielmehr auf kleinen digitalen Karten gebündelt. Das Geld verschwindet aber nicht nur materiell aus dem realen Raum, sondern verflüchtigt sich auch im virtuellen. Als die Börsen an einem einzigen Tag Billionen Dollar an Verlust einfuhren, wurde ein Finanzwissenschaftler gefragt, wohin das Geld verschwunden sei. »Das Geheimnis ist«, sagte er, »dass niemand weiß, wo es ist, weil es vermutlich schon vorher gar nicht vorhanden war.« Es wurde also etwas vernichtet, was es gar nicht gegeben hatte. Vernichtet wurde nicht das Geld, sondern die Fiktion, es gebe dieses Geld tatsächlich außerhalb des Reiches der Spekulationen.