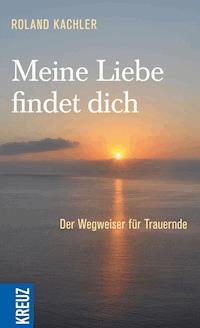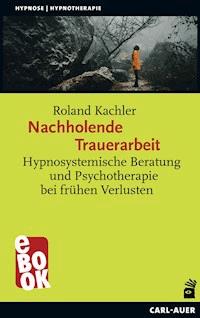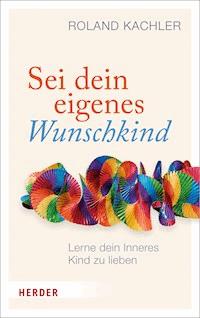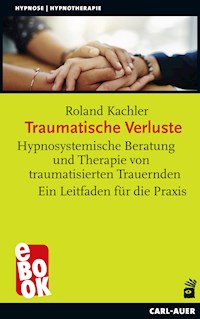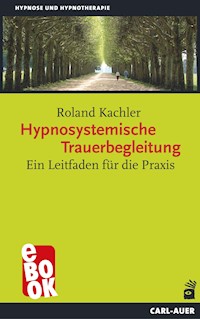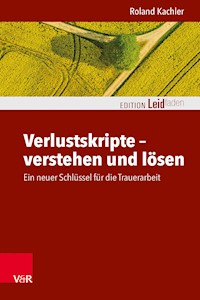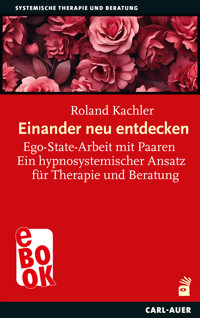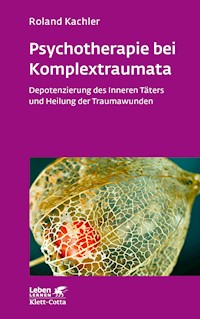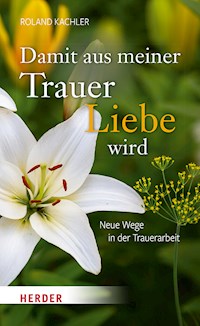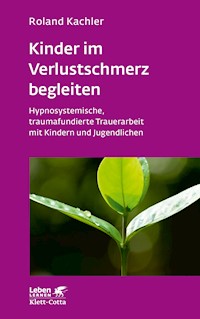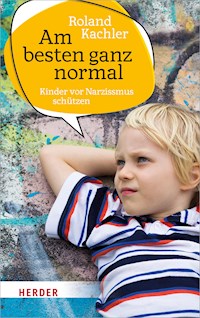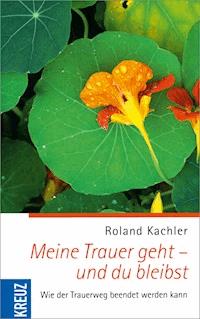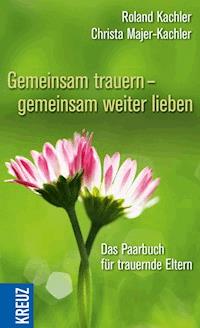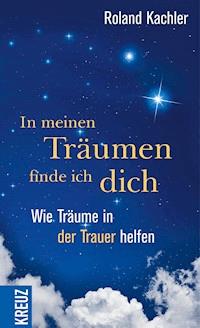34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das umfassende Kompendium der Inneren-Kind-Arbeit: unentbehrlich für die Praxis - Das Handbuch für erfahrene Praktiker und Einsteiger - Erster vollständiger Überblick über die verschiedenen Ansätze der Inneren-Kind-Arbeit - Führt systematisch und schrittweise in die Methoden der Inneren-Kind-Arbeit ein - Mit vielen Fall- und Gesprächsbeispielen und rasch umsetzbaren Interventionen Die Innere-Kind-Arbeit integriert eine Vielzahl von Ansätzen und lässt sich in ganz verschiedenen Beratungs- und Therapiesituationen anwenden. Mit ihr können viele Probleme und Störungen, von Lebenskrisen über Bindungsstörungen bis hin zu Traumafolgestörungen, gelöst werden. In diesem Buch werden die verschiedenen wissenschaftlichen, neurobiologischen und therapeutischen Konzepte des Inneren Kindes systematisiert und in ihrer praktischen Anwendung vorgestellt. Der Autor zeigt auf, wie sich die belasteten und traumatisierten Kind-Ego-States durch die Innere-Kind-Arbeit schützen und versorgen, aber auch bergen, befreien und heilen lassen. Die PatientInnen lernen, wieder Zugang zu ihrem Inneren Kind zu finden und liebevoll mit sich und anderen umzugehen. Die therapeutische Arbeit mit dem Inneren Kind kann sofort und unmittelbar in der alltäglichen Beratungs- und Therapiepraxis angewandt werden. Dieses Buch richtet sich an: - PsychotherapeutInnen aller Fachrichtungen, z.B. TraumatherapeutInnen und Systemische TherapeutInnen - BeraterInnen und MitarbeiterInnen in Beratungsstellen, besonders Paar- und FamilientherapeutInnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roland Kachler
Die Therapie des Inneren Kindes
Konzepte und Methoden für Beratung und Psychotherapie
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: produktsicherheit@klett-cotta.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © photocase/Manja
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Kempten
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96432-5
E-Book: ISBN 978-3-608-12046-2
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20451-3
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Das Innere Kind heilen?
Kapitel 1
Was ist das Innere Kind?
Die Ego-States des Inneren Kindes
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung I
Kind-Ego-States agieren unbewusst
Kind-Ego-States reagieren körperlich und unwillkürlich
Kind-Ego-States reagieren affektiv
Kind-Ego-States werden von ihren Bedürfnissen motiviert
Kind-Ego-States reagieren und agieren aus dem Wunsch nach Überleben
Kind-Ego-States sehnen sich nach Linderung und Heilung
Kind-Ego-States sehnen sich nach nachholender Erfüllung der Bedürfnisse
Vertiefung und Weiterführung II
Vertiefung und Weiterführung III
Der Erwachsenen-Ego-State – aktuelles Steuerungssystem und Gegenüber zu den Kind-Ego-States und den internalisierten Ego-States
Das Ich einer Person – Ein Metakonzept
Das Selbst einer Person – der sich selbst organisierende Prozess der eigenen Identität
10 grundlegende Interventionen
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Anfänge des Ego-State-Ansatzes bei Federn und Weiss
Eric Berne – Erste Formulierung des Konzeptes eines Kind-Ego-States
Weiterführung zur Ego-State-Therapie durch Watkins & Watkins und Nachfolger – Kind-Ego-State als Bewältigungsreaktion
Systemische und Hypnosystemische Ego-State-Ansätze
Schematherapie – Kind-Modus statt Kind-Ego-State
Die IRRT – Adaption der Inneren-Kind-Arbeit in die Verhaltenstherapie
Inneres-Kind-Retten nach Kahn – Traumatherapie mit dem traumatisierten Inneren Kind
Carl Gustav Jung – Inneres Kind als Symbol und Archetyp
Neurobiologische Modelle – Das Innere Kind als neuronales Netzwerk
Kapitel 2
Wie entsteht das Innere Kind?
Die normale und gestörte Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Kind-Ego-States
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Offenes Interview zu den Kind-Ego-States
Erinnerungsarbeit mit Fotografien vom Kind
Gestalten einer biografischen Timeline auf dem Fußboden
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung I
Entwicklung des Bindungssystems
Entwicklung des Kommunikationssystems
Entwicklung des Affekt-, Emotions- und Bedürfnissystems
Entwicklung des Autonomiesystems
Entwicklung der Sexualität
Entwicklung des Körperselbst
Entwicklung der Geschlechtsidentität
Entwicklung des Sprach- und Denksystems
Entwicklung des Ichs und des kindlichen Selbst
Entwicklung eines sozialen Selbst
Entwicklung eines regulierenden Erwachsenen-Ichs und eines integrierenden Selbst
Vertiefung und Weiterführung II
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Die Entstehung des neuronalen Netzwerkes eines Kind-Ego-States
Kapitel 3
Wie das bindungsgestörte Innere Kind entsteht
Wenn Kinder und Jugendliche in ihren Bindungen gestört und verletzt werden
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung I
Die abhängig gebundenen Kind-Ego-States
Die unsicher gebundenen Kind-Ego-States
Die trauernd gebundenen Kind-Ego-States
Die unsicher-desorganisiert gebundenen Kind-Ego-States
Vertiefung und Weiterführung II
Imaginationen aus dem Abstand heraus
Imaginationen in der Identifikation mit den Kind-Ego-States
Erinnerung an das Einzelbild eines Kind-Ego-States
Erinnerung an erlebte biografische Szenen
Imagination von vorgestellten potentiellen Szenen
Imagination der hilfreichen und heilsamen Veränderung der Szenen
Imagination der Veränderung der internalisierten Ego-States und der internalisierten Familie auf der Inneren Bühne
Imagination von sicheren und heilenden Orten
Imagination von hilfreichen und heilenden Ressourcen-Ego-States
Imagination von heilsamen Prozessen beim Kind-Ego-State
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Kapitel 4
Wie das neurotisierte Innere Kind entsteht
Wenn Kinder und Jugendliche eingeengt, überfordert, kritisiert und abgewertet werden
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Klienten sprechen selbst mit ihren Kind-Ego-States
Die Therapeutin spricht direkt mit den Kind-Ego-States
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Dialoge auf der Inneren Bühne oder am Inneren Begegnungsort
Dialoge per Briefschreiben
Dialoge über die Stuhlarbeit
Vertiefung und Weiterführung I
Erlaubnis und Ermutigung, die Gefühle von Schmerz und Leid wahrzunehmen
Erlaubnis und Ermutigung, sich vor Kritik und Abwertung zu schützen
Empowerment der neurotisierten Kind-Ego-States
Erlaubnis von Groll und Wut als angemessene Reaktionen der Kind-Ego-States
Erlaubnis und Ermutigung, eigene Bedürfnisse zu spüren
Erlaubnis und Ermutigung, Beengungen zu lösen und Eigenes zu leben
Erlaubnis und Ermutigung, ein freies Kind zu sein
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung II
Theoretische Hintergründe und Neurobiologie
Kapitel 5
Wie das traumatisierte und dissoziierte Innere Kind entsteht
Wenn Kinder und Jugendliche Schreckliches erleben
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Sicherer, schützender Ort
Ort des Wohlbefindens und heilsamer Ort
Entwicklungsort und Ort der Identität
Vertiefung und Weiterführung I
Dissoziation beginnt mit dem Schock und Freezing
Dissoziation von Körperempfindungen und Gefühlen
Dissoziation als Fragmentierung
Dissoziation von Erinnerung
Dissoziation als Aufspaltung in mehrere traumatisierte Kind-Ego-States
Dissoziation als Abspaltung von traumatisierten Kind-Ego-States
Dissoziation als letzte verbleibende, zugleich bestmögliche Reaktion
Dissoziation als Überlebensschutz
Dissoziation hat einen hohen Preis
Dissoziation ist nicht vollständig und nicht ganz sicher
Dissoziation wird weiter fortgesetzt
Theoretischer Hintergrund und Neurobiologie
Traumatisierungen wirken auf die subkortikale Ebene des Gehirns
Traumatischer Stress aktiviert die Amygdala
Aktivierung der Stressachse über Hypothalamus, Hypophyse und Nebennierenrinde
Cortisol schädigt kindliches Gehirn
Evolutionsbiologisch vorbereiteter Totstellreflex
Ausschüttung von körpereigenen Opiaten
Freezing, Numbing und Erschlaffung
Blockierung des sozialen Sicherheitssystems führt zu Verlassenheitsgefühlen
Blockierung des Hippocampus und einer biografischen Integration des Traumageschehens
Blockierung des präfrontalen Cortex und der kognitiven Fähigkeiten
Deaktivierung der Sprachproduktion und Sprachlosigkeit
Dauerhafte Sensitivierung der Amygdala
Bleibendes Traumanetzwerk und Retraumatisierungen
Kapitel 6
Wie das Innere Kind belastet, abgewertet, verletzt oder traumatisiert wird
Die Entstehung von internalisierten Ego-States und Täter- und Täterinnen-Introjekten
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung I
Kind-Ego-States und internalisierte Ego-States bilden Systemeinheiten
Systemeinheiten von Kind-Ego-States und internalisierten Ego-States sind durch Interaktionsmuster verbunden
Frühe Systemeinheiten sind eng verbunden
Destruktive Systemeinheiten sind eng verbunden
Vertiefung und Weiterführung II
Bindungsstörende und neurotisierende Ego-States sind machtvoll
Bindungsstörende Ego-States agieren weiter mit den damaligen Kommunikationsmustern
Leicht bis mittelschwer bindungsstörende Ego-States sind veränderungsfähig
Schwer bindungsstörende Ego-States wirken weiter traumatisierend
Neurotisierende Ego-States hemmen und blockieren die Selbstentfaltung
Neurotisierende Ego-States vermitteln weiter negative Botschaften
Neurotisierende Ego-States vermitteln Antreiber als Scheinlösungen
Neurotisierende Ego-States sind begrenzt, aber veränderungsfähig
Schwer neurotisierende Eltern-Ego-States wirken traumatisierend
Vertiefung und Weiterführung III
Der Mechanismus und die Funktion der Introjektion der Täter und Täterinnen
Der Mechanismus der Grenzverletzung, Intrusion und Innenbesetzung
Die weiter traumatisierende Wirkung der Täter- und Täterinnen-Introjekte
Der dauerhafte Verbleib der Täter- und Täterinnen-Introjekte im Person-System
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Das Bindungssystem bindet auch an Täter und Täterinnen
Evolutionsbiologisch vorgeprägte Fähigkeit zur Gesichts- und Personwahrnehmung
Kapitel 7
Wie wirkt das gestörte Innere Kind heute?
Wie Kind-Ego-States und internalisierte Ego-States aktuelle Probleme machen
10 Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Vertiefung und Weiterführung I
Angststörungen
Depressive Störungen
Burn-out-Syndrom
Vertiefung und Weiterführung II
Allgemeine leichte bis mittlere Beziehungsprobleme
Angststörungen und depressive Störungen als Bindungsstörung
Anorexie
Sexuelle Störungen
Vertiefung und Weiterführung III
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Komplexe Traumafolgestörung oder Borderline-Störung?
Komplexe Traumafolgestörungen und die beteiligten Ego-States
Borderline-Persönlichkeitsstörungen
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Psychotherapeutische Ansätze und ihre Ätiologiemodelle
Multifaktorielles Entstehungsmodell psychischer Störungen
Kapitel 8
Wie das Innere Kind versorgt und genährt wird
Beelterungsarbeit als Basis der Inneren-Kind-Arbeit
Grundinformationen
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
10 grundlegende Interventionen
Vertiefung und Weiterführung I
Imagination der körperlichen Nähe durch den Erwachsenen-Ego-State oder einen Ressourcen-Ego-State
Haltegeste formen lassen
Wechselseitige Berührung spüren lassen
Körperliche Wärme spüren und spüren lassen
Synchronisation von Herz- und Atemrhythmus
Haltende Selbstberührung als Halten des Kind-Ego-States
Haltende Berührung durch Therapeutin
Guten Körperort für die Kind-Ego-States finden
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Vertiefung und Weiterführung II
Psychoedukation zu den unzugänglichen Kind-Ego-States
Auseinandersetzung und Begrenzung der Täter-Introjekte
Würdigen der Schutzfunktion des Nichtauftauchens
Zusage von Schutz und Sicherheit
Erklären der Beelterungsarbeit und der weiteren therapeutischen Schritte
Verborgener sicherer Ort als Zwischenstation
Offenes Fragen und Einladen in das Person-System
Behutsame und achtsame Annäherung des Kind-Ego-States
Erlaubnis an die Kind-Ego-States, sich jederzeit zurückzuziehen
Erlaubnis an die Kind-Ego-States, nicht aufzutauchen
Liebevolle Botschaften an die in der Verdrängung oder Dissoziation verbleibenden Kind-Ego-States
Abschluss mit Impuls zur Achtsamkeit für spontan auftauchende Kind-Ego-States
Kapitel 9
Was hält und trägt das bindungsgestörte Innere Kind?
Die Arbeit mit den Bindungsstörungen des Inneren Kindes
Grundinformationen
Vertiefung und Weiterführung I
Aktualisierung und Visualisierung einer typischen Bindungsszene
Wahrnehmung des Kind-Ego-States und Hilfeimpuls des Erwachsenen-Ego-States
Würdigender Kontakt mit den bindenden internalisierten Ego-States
Auseinandersetzung mit den bindenden internalisierten Ego-States
Impuls zum Freigeben des gebundenen Kind-Ego-States
Impuls zur Ablösung des Kind-Ego-States
Abschied des Kind-Ego-States von bisheriger Einengung und Position
Abschied und bleibende, aber freie Beziehung zum internalisierten Ego-State
Garten der Autonomie oder Berggipfel der Freiheit
Vertiefung und Weiterführung II
Imagination einer typischen verunsichernden Bindungsszene
Nachholende Bindungsarbeit durch Erwachsenen-Ego-State oder Ressourcen-Ego-State
Konfrontation des bindungsstörenden internalisierten Ego-States
Beendigung der destruktiven Bindung
Übernahme der konstruktiven Eltern-Position durch den Erwachsenen-Ego-State
Symbol für eine dauerhaft sichere Bindung
Ort einer dauerhaft sicheren Bindung und neue Bindungserfahrungen
Vertiefung und Weiterführung III
Realisierung des Todes und der bleibenden Abwesenheit des Verstorbenen
Zulassen, Containen und Abfließenlassen der Trauergefühle
Erlauben einer inneren Beziehung der Kind-Ego-States zu den Ego-States des Verstorbenen
Installation eines sicheren Ortes für den Ego-State des Verstorbenen
Erleben einer inneren Beziehung an einem Begegnungsort
Ego-State des Verstorbenen als nahen oder fernen Begleiter installieren
Klärung der inneren Beziehung zum Ego-State des Verstorbenen
Einladung der Kind-Ego-States in die Lebendigkeit und ins Leben
Vertiefung und Weiterführung IV
Arbeit mit den Borderline-Kommunikationsmustern
Eindeutige Regeln für die Zusammenarbeit
Beziehungsstörungen als Beziehungstests
Einladung zur Verstrickung zurückweisen
Mit Idealisierung und Entwertung umgehen
In Beziehungsschwierigkeiten Muster und Sehnsüchte herausarbeiten
Bei dissoziativem Erleben eine Reorientierung durchführen
Strukturierung und Containing von Affekten
Selbstdestruktives Verhalten begrenzen und verstehen
Funktion des selbstdestruktiven Verhaltens verstehen lernen
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Das Bindungssystem nach
Bowlby
Das Panik- und Fürsorgesystem bei
Panksepp
Die Polyvagal-Theorie nach
Porges
Kapitel 10
Wer liebt das Innere Kind bedingungslos?
Veränderung der neurotisierenden Ego-States für das Innere Kind
Grundinformationen
Vertiefung und Weiterführung I
Innere Bühne als Verhandlungsbühne imaginieren
Einladung eines neurotisierenden Ego-States auf die Innere Bühne
Bei massiven neurotisierenden Ego-States brauchen wir eine andere Bühnenarbeit
Begrüßung, Kontakt und Bitte um Mitarbeit
Respekt gegenüber den neurotisierenden Ego-States und deren Geschichte
Konfrontation der neurotisierenden internalisierten Ego-States mit ihrem zentralen destruktiven Verhalten
Konfrontation mit den Gefühlen der Kind-Ego-States und den Konsequenzen für das Innere Kind bis heute
Rückgabe des destruktiven Verhaltens und der destruktiven Botschaften
Reaktion und Veränderung der neurotisierenden Ego-States wahrnehmen
Wirkung auf neurotisierten Kind-Ego-State wahrnehmen und verankern
Spontanes Bedauern der internalisierten Ego-States
Dank an die neurotisierenden Ego-States und der Abschied von ihnen
Vertiefung und Weiterführung II
Verständnis für den Widerstand des neurotisierenden Ego-States und gute Gründe hierfür herausarbeiten
Gute Absichten für das neurotisierende Verhalten herausarbeiten und würdigen
Mitgefühl für die Schwierigkeiten und Grenzen der neurotisierenden Ego-States
Preis der guten Absichten und des Verhaltens benennen
Gute Absichten heute anders umsetzen und neue Akzente setzen
Neues Verhalten erproben lassen
Biografische Hintergründe für das Verhalten der neurotisierenden Ego-States
Arbeit mit dem Kind-Ego-State des neurotisierenden Ego-States
Vertiefung und Weiterführung III
Benennen der Unrechtmäßigkeit der Abwertungen und Verletzungen
Die Gefühle der Kind-Ego-States validieren
Tabuisierte Gefühle benennen und erlauben
Kind-Ego-State haltend trösten
Gefühle und deren Abfließen ermutigen und ermöglichen
Unerfüllte Bedürfnisse der Kind-Ego-States nachholen
Nicht mehr erfüllbare Bedürfnisse der Kind-Ego-States betrauern
Einladung zum Versöhnen und zum bedingungslosen Lieben
Methodik der Inneren-Kind-Arbeit
Rituelle Sätze vorschlagen und aussprechen lassen
Rituale anleiten und umsetzen lassen
Theoretische und neurobiologische Hintergründe
Kapitel 11
Was rettet das Innere Kind?
Die Traumatransformation durch die Bergearbeit für traumatisierte und dissoziierte Innere Kinder
Grundinformationen
10 grundlegende Interventionen
Vertiefung und Weiterführung I
Sicherer Ort für den beobachtenden Erwachsenen-Ego-State und schützender, heilsamer Ort für die zu bergenden Kind-Ego-States
Psychoedukation zur Differenzierung von Introjekten und realem Täter
Einrichten eines Bildschirms oder Imagination eines Gerichtssaals
Einrichtung eines »Verwahrortes« für die auftauchenden Täter- oder Täterinnen-Introjekte
Aktivieren der depotenzierenden Ressourcen-Ego-States
Imagination des Täter-Introjekts auf Bildschirm oder in Gerichtsverhandlung
Konfrontation des Täter-Introjekts und Benennen der Strafbarkeit seines Verhaltens
Täterloyale oder täteridentifizierte traumatisierte Kind-Ego-States berücksichtigen
Juristische Konsequenzen für das Täter- und Täterinnen-Introjekt benennen
Depotenzierung des Täter- und Täterinnen-Introjekts durch Verweisen in die Vergangenheit
Depotenzierung der Täter-Introjekte durch Minimieren
Depotenzierung der Täter-Introjekte durch Distanzierung und Verweisung an den Verwahrort
Vertiefung und Weiterführung II
Beginn des Bergens mit bekannten traumatisierten Kind-Ego-States
Imagination der erinnerten Traumaszene auf Bildschirm
Beauftragung des bergenden Ressourcen-Ego-States
Berge-Gestalt geht in Traumaszene und verweist das Täter-Introjekt aus der Traumaszene
Berge-Gestalt birgt den Kind-Ego-State
Kind-Ego-State wird zum sicheren und heilsamen Bergeort gebracht
Beginnende Heilung am sicheren, heilsamen Bergeort
Zusicherung des Bergens an weiterhin dissoziierte Kind-Ego-States
Berge-Ego-State geht auf die Suche nach unentdeckten Kind-Ego-States
Dissoziierte Kind-Ego-States über deren Körpersignale auffinden
Bergeaktion durch das Unbewusste anregen
Vertiefung und Weiterführung III
Anleitung zur genauen Wahrnehmung der Körperempfindungen
Genaue Wahrnehmung von sichtbaren Körperreaktionen
Spüren lassen, intensivieren und verlangsamen
Begleitendes Verbalisieren der Körperempfindungen und Körperreaktionen
Abwehrreaktionen des Körpers schützend und stützend halten
Impulse in Körperreaktionen vollenden lassen und dabei halten
Im Freezing erstarrte Körperenergie lösen lassen
Zur Ruhe kommen und Erschöpfung spüren lassen
Imagination des zum Körper gehörenden Kind-Ego-States
Theoretische Hintergründe und Neurobiologie
Traumatransformation aktiviert Traumanetzwerk im Toleranzfenster
Traumanetzwerk wird mit sozialem Kontaktsystem verbunden
Stärkung der Top-Down-Regulation durch Cortex
Neuformation der neuronalen Traumanetzwerke
Einordnung in das autobiografische Gedächtnis
Entstehung von neuen neuronalen Netzwerken
Veränderung der epigenetischen Ebene
Kapitel 12
Welche neue Familie braucht das Innere Kind?
Nachholende Familientherapie am Herkunftssystem des Inneren Kindes und am inneren Gesamtsystem der Klienten
Grundinformationen
Vertiefung und Weiterführung I
Eng bindende, bindungsschwache und chaotisch bindende Familiensysteme
Neurotisierende Familiensysteme überfordern und parentifizieren
Vorbereitung der imaginativen Transformation der inneren Familie
Imagination des internalisierten Familiensystems auf der Inneren Bühne
Wahrnehmung des Familiensystems in Distanz oder Identifikation
Der Erwachsenen-Ego-State als Familienaufsteller für den Kind-Ego-State
Veränderung und Neustrukturierung des inneren Familiensystems
Wirkung des gelösten, integrierten Familiensystems spüren lassen
Betrauern des Unveränderbaren des internalisierten Familiensystems
Verabschieden des Kind-Ego-States vom internalisierten Familiensystem hinein in das eigene Leben
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Transformationsarbeit des Gesamtsystems der Person
Vertiefung und Weiterführung II
In traumatisierenden Familiensystemen gibt es massive Grenzüberschreitungen
In traumatisierenden Familiensystemen gibt es massive Dissoziation und Spaltungen
In traumatisierenden Familiensystemen herrscht das System des Schweigens und des Verrats
Vorbereitung der Arbeit mit schwer bindungsgestörten und traumatisierenden Familiensystemen
Projektion des schwer bindungsgestörten und traumatisierenden Familiensystems auf einen Bildschirm oder auf die Innere Bühne
Depotenzierung durch die machtvolle Ressourcengestalt
Bergen der traumatisierten und dissoziierten Kind-Ego-States und der Geschwister-Ego-States aus dem Familiensystem
Bannen und Verwahren des zurückbleibenden depotenzierten Familiensystems
Transformation des traumatisierenden Gesamtsystems der Person
Kapitel 13
Was erlöst und heilt das Innere Kind?
Die Lösung des Lebensskriptes und die Heilungsarbeit für das verletzte Innere Kind
Grundinformationen
Vertiefung und Weiterführung I
Lebensskripte von bindungsgestörten und neurotisierten Kind-Ego-States
Lebensskripte der traumatisierten Kind-Ego-States
Lebensskripte der dissoziierten Kind-Ego-States
Lebensskripte der täterangepassten, täterloyalen und täteridentifizierten Kind-Ego-States
Einladung der Kind-Ego-States zur Lösung des Skriptes
Erklären der Überlebensreaktion und des Lebensskriptes
Formulieren und Würdigen des Skriptes
Dank für das Skript und Benennung seiner Begrenztheit
Lösen der Überlebensreaktion über den Körper
Beenden, Lösen und Verabschieden des Lebensskriptes
Formulierung einer neuen stärkenden Lebensüberschrift
Spüren und Internalisieren der neuen Lebensüberschrift
Konkretes Symbol für die neue Lebensüberschrift
Vertiefung und Weiterführung II
Ausgestaltung des heilsamen Ortes für die verwundeten und verletzten Kind-Ego-States
Beschreibung und Würdigung der Wunden und Verletzungen
Symbolisierung der Wunden und Verletzungen
Lindern und Versorgen der Wunden und Verletzungen
Heilungsprozesse geschehen und spüren lassen
Beschämung und Scham lösen
Mit bleibenden Narben leben lernen
Vertiefung und Weiterführung III
Abschied von Trauer und Wut über ungelebtes Leben
Abschied vom Problem und vom Symptom
Erlaubnis und Einladung zum Leben und zum Lebendigsein
Blockierte Entwicklungsthemen aufgreifen und nachholend entwickeln
In die Entwicklung hineinleben mit einer Timeline
Vorbereiten von Rückfällen und des Umgangs mit ihnen
Statt eines Schlusswortes
Das Innere Kind heilen!
Literaturverzeichnis
Vorwort
Das Innere Kind heilen?
Das Innere Kind therapieren, gar heilen? Ist das nicht ein grandioser Anspruch, ein falsches Versprechen? Ein Versprechen an die Klientinnen und Klienten darf es nicht sein, wohl aber ein Anspruch an jede therapeutische Arbeit und damit an uns. Es ist der fachliche Anspruch, den Menschen bestmöglich zu helfen, mithin zu heilen. So ist es auch ein Ziel der Inneren-Kind-Arbeit, die verstörten, gestörten und leidenden Inneren Kinder zu heilen.
Dabei heißt Heilung nicht, dass alle Symptome einfach weg wären, dass alles einfach nur gut wäre. Das wäre ein falsches Versprechen für die Klienten und Klientinnen, das nicht nur unerfüllbar, sondern zu schweren Enttäuschungen führen würde. Heilung heißt dagegen, dass wir Menschen und ihre Inneren Kinder wieder zu sich selbst und zu ihren ursprünglichen Potentialen führen. Natürlich müssen wir dazu auch die Störungen, Verwundungen und Verletzungen lösen, soweit das möglich ist und soweit das für ein in sich stimmiges, autonomes Leben nötig ist. Es werden auch Narben bleiben, die sich immer wieder schmerzlich bemerkbar machen, aber das Leben kann und darf bei allen bleibenden Schwierigkeiten wieder lebendig und lebenswert sein.
Die Innere-Kind-Arbeit ermöglicht es, in diesem Sinne die Heilung als ein Ziel der beraterischen und psychotherapeutischen Prozesse in den Blick zu nehmen. Sie ist ein integrativer Ansatz, der verschiedene psychotherapeutische Schulen zusammenbringt und so das Beste dieser Ansätze fruchtbar macht. Fokus und Brennpunkt ist das Konzept des Inneren Kindes, das die biografische Arbeit mit der Lösung von aktuellen Problemen und Störungen verbindet.
In den ersten beiden Kapiteln werde ich mit Ihnen die theoretischen Grundlagen der Inneren-Kind-Arbeit entdecken, um dann wie in jedem Kapitel sehr direkt mit der Anamnese der Inneren Kinder und dem Erstgespräch mit ihnen in die Praxis der Inneren-Kind-Arbeit einzusteigen.
In den Kapiteln 3 bis 5 beschreibe ich, wie die bindungsgestörten, neurotisierten, traumatisierten und traumatisiert-dissoziierten Kind-Ego-States entstehen, wie diese fühlen, denken und handeln. Zur inneren Dynamik einer Person gehören aber auch die in Kapitel 6 dargestellten destruktiven internalisierten Ego-States, insbesondere die Täter- und Täterinnen-Introjekte. Aus dem komplexen Zusammenwirken zwischen den Kind-Ego-States und den internalisierten Ego-States verstehen wir dann in Kapitel 7, wie die konkreten Probleme, Störungen und psychischen Erkrankungen unserer Klientinnen und Klienten entstehen. In den Kapiteln 8 bis 13 werden dann die verschiedenen Prozessschritte der Inneren-Kind-Arbeit vorgestellt, die zur Heilung der Kind-Ego-States führen.
Ich möchte Sie einladen, diese spannenden Schritte und Wege zur Therapie des Inneren Kindes mitzudenken, mitzufühlen und mitzugehen.
Roland Kachler
Remseck bei Stuttgart
Kapitel 1
Was ist das Innere Kind?
Die Ego-States des Inneren Kindes
Fallbeispiel 1
Die zwanzigjährige Klientin beginnt rasch zu weinen, wenn sie auf ihre Großmutter zu sprechen kommt, die siebzigjährig starb, als sie selbst acht Jahre alt war. Beim Weinen wirkt die Klientin klein und hilflos. Als ich sie frage, was sie jetzt spüre, antwortet sie: »Ich denke an den schweren Krebstod meiner Oma.« Meine Frage: »Wie alt waren Sie als Kind damals, als Ihre Großmutter an Krebs erkrankte und dann starb?« Die Klientin: »Ich war sechs Jahre, als meine Oma den Krebs bekam. Da war ich so hilflos und habe mit meiner Oma gelitten.« Nach dem Tod der Großmutter war das Mädchen mit ihren Trauergefühlen sehr allein, weil die hinterbliebene Familie ebenfalls mit der eigenen Trauer beschäftigt war.
Die Klientin hat die Therapie aufgesucht, weil sie immer wieder in depressive Phasen mit einer ausgeprägten Antriebsschwäche und Traurigkeit gerät.
Die Klientin ist in ihrem Erleben offensichtlich zurückversetzt in die Zeit, als sie sechs Jahre alt war und sie die Erkrankung und schließlich das Sterben ihrer Großmutter miterleben musste. In ihren Gefühlen, in ihrer Körperhaltung und in ihrem Erleben ist sie nicht mehr die erwachsene Frau von heute, sondern sie ist wieder das Kind von damals. In der Sprache der Inneren-Kind-Arbeit befindet sie sich in dem Kind-Ich-Zustand von damals. Nun sind das Innere Kind aus der Krankheitszeit ihrer Großmutter und das trauernde Kind nach deren Tod aktiviert. Es ist für die Klientin unmittelbar zugänglich und einsichtig, dass sie sich in ihrem Erleben wieder in der für das damalige Kind schlimmen Zeit befindet.
Grundinformationen
10 zentrale Basics zum Konzept des Inneren Kindes und der Kind-Ego-States
An diesem Fallbeispiel wird die unmittelbare Plausibilität des Konzeptes des Inneren Kindes für Beratung und Therapie deutlich. Sehr rasch können wir einen Zusammenhang zwischen einem aktuellen Problem oder Symptom mit einer bestimmten biografischen Erfahrung herstellen. Für die Beratung oder Therapie ist dann das Konzept des Inneren Kindes sowohl für Therapeutinnen als auch Klienten eine wesentliche Basis, um die Interventionen zu planen und durchzuführen. Eine Schlüsselfrage hierfür lautet, was das Kind damals gebraucht hätte und was diesem Inneren Kind von damals heute gegeben werden muss, damit es ihm wieder besser gehen kann. Die Heilung einer heutigen belastenden Thematik oder Symptomatik setzt also am heute aktualisierten Inneren Kind von damals an.
Soweit eine intuitive Einführung in das Konzept des Inneren Kindes, das wir dann später auch theoretisch fundieren und begründen. Zunächst aber will ich Sie in die konkrete Innere-Kind-Arbeit einführen und Ihnen – wie auch in den folgenden Kapiteln dieses Buches – zehn Basics und zehn Grundinterventionen vorstellen, mit denen Sie in die Innere-Kind-Arbeit unmittelbar einsteigen können. Sie haben dann eine erste solide Basis für die konkrete beraterische und therapeutische Arbeit mit dem Inneren Kind. Die Abschnitte »Vertiefung und Weiterführung« begleiten Sie dann tiefer in die Innere-Kind-Arbeit und in komplexere Dimensionen; die Abschnitte »Theoretische und neurobiologische Hintergründe« begründen das Beschriebene aus der Theorie des sogenannten Ego-State-Ansatzes und aus anderen, insbesondere neurobiologischen Grundlagen. Jedes Kapitel schreitet also von der einfachen zur komplexeren Arbeit mit dem Inneren Kind bis zuletzt zu den theoretischen Grundlagen voran.
Das Innere Kind – ein Subsystem der Persönlichkeit
Der Begriff des Inneren Kindes beschreibt einen Teil des gesamten Persönlichkeitssystems eines Menschen, der wie eine eigene Persönlichkeit fühlt, denkt und agiert, allerdings eben als Person eines Kindes in einem bestimmten Alter. Das Innere Kind, das in einem bestimmten Zeitpunkt entstanden ist, ist ein zusammenhängendes System, das sich von anderen Teilsystemen einer Person deutlich unterscheidet und sich im Erleben von anderen Erlebenszuständen abgrenzen lässt. Eine genauere Bezeichnung findet sich in den Begriffen »Inneres Kind«, »Kind-Ich-Zustand« oder »Kind-Ego-State«. Der Begriff »Inneres Kind« ist die metaphorische, für Klienten leicht zugängliche Beschreibung eines Kind-Ego-States oder Kind-Ich-Zustandes. Ich werde diese drei Begriffe hier gleichbedeutend gebrauchen.
Das Innere Kind – neurobiologisch ein neuronales Netzwerk
Neurobiologisch verstanden ist dieses Teilsystem einer Persönlichkeit, also der Kind-Ego-State als ein eigenes neuronales Netzwerk im Gehirn, insbesondere im biografischen und impliziten Gedächtnis gespeichert (Peichl, 2018). Die Neuronen, die zu diesem abgrenzbaren Netzwerk gehören, sind durch die synaptische Koppelung zwischen ihnen miteinander verbunden und bilden so dieses Netzwerk. Wird dieses neuronale Netzwerk aktiviert, werden die in den verschiedenen Gehirnteilen befindlichen Neuronen und so das dazugehörige Erleben aktiviert.
Das Innere Kind – ein komplexes System aus Kognitionen, Erleben und Gefühlen
Ein Kind-Ego-State ist also zu verstehen als ein aus der Kindheit und Jugend stammendes kohärentes Erlebens- und Verhaltenssystem, das um ein emotionales und motivationales Zentrum organisiert ist (Watkins & Watkins, 2003). Dieses kohärente System eines Kind-Ego-States besteht aus Erinnerungen, Gedanken und Kognitionen, Gefühlen und Körperempfindungen, die zu einer bestimmten Entwicklungsphase oder zu einer das Kind oder den Jugendlichen damals prägenden Situation gehören.
Das Innere Kind – im Kern ein energetisierendes Bedürfnis
Die Gefühle eines Kind-Ego-States wie Schmerz, Trauer, Ohnmacht oder Wut zeigen, dass im Zentrum eines Kind-Ego-States ein zentrales kindliches Bedürfnis steht, das enttäuscht, abgewertet oder verletzt wurde. Dieses im Zentrum eines Kind-Ego-States liegende Bedürfnis ist der motivierende Kern von jedem Kind-Ego-State. Natürlich gibt es auch Kind-Ego-States, die lustvolle Gefühle wie Liebesgefühle, Freude, Glück, Wohlbefinden und Lust speichern. Diese Gefühle zeigen die grundlegenden Bedürfnisse der Kind-Ego-States, zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung oder liebevoller Zuwendung.
Das Innere Kind – das Erleben, das aus der Biografie stammt
In jedem Kind-Ego-State sind Erfahrungen eines Menschen gesammelt und verdichtet, die aus seiner biografischen Vergangenheit aus einer bestimmten Zeit oder von einem bestimmten Ereignis stammen wie zum Beispiel eine Verlusterfahrung des Kindes. Ego-States entstehen in den wichtigen entwicklungspsychologischen Phasen in bestimmten interaktionellen, familiären und situativen Kontexten. Die am Leiden der obigen Klientin beteiligten Ego-States sind in der Phase der mittleren Kindheit im Kontext der Erkrankung, des Sterbens und des Todes der Großmutter entstanden. Natürlich gibt es bei dieser Klientin auch Kind-Ego-States, die im Kleinkindalter oder in der Pubertät mit ersten Kontakten zu Jungen entstanden sind. Streng genommen ist auch der abgespeicherte Erlebenszustand eines Fünfunddreißigjährigen damals bei seiner Kündigung aus der heutigen Sicht des Vierzigjährigen ein Kind-Ego-State.
Das Innere Kind – von der Schwangerschaft bis zum jungen Erwachsenen
Aus pragmatischen Gründen werden für die Innere-Kind-Arbeit hier Kind-Ego-States behandelt, die im Laufe der Biografie von der Zeugung an über das uterine Erleben, die Geburt, die frühe und spätere Kindheit, die Pubertät und das frühe Erwachsenenalter (bis zu etwa fünfundzwanzig Jahren) entstanden sind.
Bitte beachten!
Wenn wir vom Kind von damals sprechen, ist damit auch der Jugendliche oder junge Erwachsene von damals in einem bestimmten Alter in seiner Entwicklungsphase, zum Beispiel der Pubertät, gemeint. Ich werde summarisch oft von »Kind und Jugendlichem«, oft aber auch abgekürzt vom »Kind« sprechen.
Das Innere Kind – heute nicht ganz passend
Ein heute erlebter Kind-Ego-State zeichnet sich zunächst intuitiv dadurch aus, dass das Erleben in diesem Zustand, also insbesondere die jetzt aktualisierten damaligen Gefühle und das dazugehörige Verhalten, augenscheinlich nicht in eine gegenwärtige Situation mit ihren Anforderungen von heute passen. Vielmehr hat das jetzige Fühlen und Erleben eine andere Quelle und eine größere Intensität, die nicht aus der gegenwärtigen Situation eines erwachsenen Menschen heraus erklärbar und einsichtig sind, sondern auf einen Kind-Ego-State aus der Kindheit oder Jugend verweisen.
Nicht ein Inneres Kind – sondern viele!
Entsprechend der zahlreich abgespeicherten kindlichen und jugendlichen in sich zusammenhängenden Erlebenszustände, die im Laufe der Kindheit und Jugend entstehen, gibt es zahlreiche Kind-Ego-States, wie zum Beispiel die Kind-Ego-States der Sechsjährigen beim Beginn der Erkrankung der Großmutter, der Siebenjährigen, die die fortschreitende Erkrankung ihrer Großmutter erlebt, der Achtjährigen, die die Bestattung ihrer Großmutter erlebt, und der Neunjährigen, die mit ihrer Trauer und ihrer inneren Beziehung zu ihrer Großmutter allein ist. Darüber hinaus gibt es auch einen Kind-Ego-State des Mädchens, das unter der emotionalen Abwesenheit ihrer trauernden Mutter leidet. In der Inneren-Kind-Arbeit arbeiten wir mit verschiedenen Kind-Ego-States dieses Mädchens, um die gesamte biografische Erfahrung des Verlustes der Großmutter zu erfassen.
Das Innere Kind – das heutige Erleben und Handeln dominierend
Menschen können ganz »im« Inneren Kind sein, so dass dieser Kind-Ego-State jetzt ganz vorherrschend ist. Sie sind jetzt mit diesem Kind-Ego-State identifiziert. Der Betroffene hat keinen Zugang mehr zu seinen erwachsenen Fähigkeiten. Er ist dann ganz das Kind von damals.
Meistens aber wirken ein oder mehrere Kind-Ego-States unbewusst auf das Erleben des in der jetzigen Gegenwart befindlichen Erwachsenen, wodurch die Funktion des Erwachsenen eingeschränkt oder getrübt ist. Sein Denken, Fühlen und Wollen ist maßgeblich von jetzt relevanten, aber meist nicht bewussten Kind-Ego-States beeinflusst.
Das Innere Kind – am heutigen Problem oder Symptom beteiligt
Verschiedene Kind-Ego-States sind – neben anderen Ego-States – in einer komplexen Weise an dem von den Klientinnen beklagten und eingebrachten Problem oder der zu behandelnden Symptomatik beteiligt. Über das Symptom können die beteiligten Kind-Ego-States eruiert werden und umgekehrt wird aus den beteiligten Kind-Ego-States das Problem oder Symptom verständlich und erklärbar. Über die Arbeit mit den beteiligten Kind-Ego-States, also über die Innere-Kind-Arbeit können wir das Problem oder die Symptomatik der Klientinnen lösen.
Kurz gefasst und im Überblick
Wir verstehen unter dem Ego-State eines Inneren Kindes den jetzt aktualisierten Erlebenszustand, den die Betroffenen damals in ihrer Biografie als Kind oder Jugendliche erlebt haben. Der Kind-Ego-State wird als ein in sich relativ geschlossenes Teilsystem der Persönlichkeit verstanden, in dessen Zentrum die Bedürfnisse des Kindes und Jugendlichen von damals beziehungsweise deren Verletzungen auch heute noch wirksam sind.
10 grundlegende Interventionen
Die Vorbereitung und die Vertragsarbeit für die Innere-Kind-Arbeit
Wir beginnen mit den ersten Interventionen im Erstgespräch einer Beratung oder Therapie, mit denen die Innere-Kind-Arbeit vorbereitet und in einen größeren Kontext eingebettet wird:
Klärung des Beratungs- oder Therapieanliegens
Wir fragen die Klientin nach den üblichen Eingangsformeln wie der Begrüßung nach deren Anliegen oder Wunsch für die Beratung oder Therapie. Dabei greifen wir die Problembeschreibung und das Klagen über das bisherige Leiden am Problem oder Symptom einfühlsam und würdigend auf. Dann suchen wir gemeinsam mit der Klientin oder dem Klienten lösungsorientiert nach einem ersten, noch offenen Ziel der gemeinsamen Zusammenarbeit.
Klärung der Arbeits- und Behandlungsmotivation
Wir klären mit den Klientinnen, was sie zu der Beratung oder Therapie motiviert. Hier können wir schon den Ego-States-Ansatz einführen, indem wir fragen, welche inneren Anteile die Beratung oder Therapie wünschen und welche sie fürchten. Wir erläutern, dass sich hier Kind-Ego-States zeigen und wir mit deren Befürchtungen einfühlsam und akzeptierend umgehen.
Klärung des Settings und des übergeordneten Verfahrens
Nun müssen wir mit den Klienten klären, ob eine Beratung oder eine Psychotherapie gewünscht wird. Beratung wird hier definiert als ein Veränderungsverfahren bis zu fünfundzwanzig Sitzungen mit dem Fokus auf ein ausgewähltes Problem wie zum Beispiel die Arbeit an einem Verlust oder an einer Partnerschaftsthematik. Psychotherapie wird verstanden als ein längeres Verfahren zur Veränderung umfassenderer, meist tiefgreifender Störungen wie zum Beispiel eine Komplextraumatisierung in der Kindheit.
Bei einer Psychotherapie im Rahmen des Kassenverfahrens muss der verhaltenstherapeutische, tiefenpsychologische oder psychoanalytische, neuerdings auch systemische Ansatz benannt und dann der entsprechende Antrag gestellt werden. Die Innere-Kind-Arbeit ist dann integrierter Teil eines kassenzugelassenen Verfahrens.
Bitte beachten!
Die Innere-Kind-Arbeit kann in Beratung und Therapie genutzt und eingebettet werden. Deshalb spreche ich zunächst immer von Beratung und Therapie. Aber bei schwereren Störungen, die meist auf Traumatisierungen, insbesondere Komplextraumatisierungen zurückzuführen sind, braucht es eine Psychotherapie. In den entsprechenden Kapiteln zu den traumatisierten und dissoziierten Kind-Ego-States sowie den Täter- und Täterinnen-Introjekten spreche ich deshalb nur noch von Therapie.
Gesprächsbeispiel der Inneren-Kind-Arbeit
Das Vertragsgespräch
Dieser und die im Buch folgenden Dialoge zeigen exemplarisch das Vorgehen in der Inneren-Kind-Arbeit. Natürlich gibt es in jeder Gesprächssituation sehr viele Varianten, die hier nicht berücksichtigt werden können. Ebenso sind die Formulierungen als Beispiel zu verstehen, die Sie entsprechend Ihrem eigenen Sprachduktus formulieren sollten.
Therapeut: »Darf ich fragen, für welches Thema Sie sich in unserer Zusammenarbeit eine Lösung wünschen?«
Klientin: »Ich bin immer wieder so depressiv und niedergeschlagen …«
Der Klientin treten Tränen in die Augen.
Therapeut: »Das ist wohl immer wieder sehr belastend.«
Klientin nickt: »Und das will ich endlich in den Griff bekommen.«
Therapeut: »Ja, gut zu verstehen. Wie soll es Ihnen dann gehen, wenn Sie diese Thematik hier in der Beratung lösen können?«
Klientin: »Ich will wieder Energie haben und … (zögert) wieder mehr lachen können.«
Therapeut: »Ja, das wäre doch schön. Das heißt aber auch, dass Sie oft traurig sind?«
Klientin schluckt, erneut steigen Tränen auf: »Ja, diese blöde Traurigkeit blockiert mich immer wieder.«
Therapeut: »Ja, die Traurigkeit kommt Ihnen in die Quere. Haben Sie eine Idee, wo und wie sie denn entstanden ist?«
Klientin: »Damals, als meine Großmutter starb, war ich sehr traurig, im Grunde bis heute.«
Therapeut: »Das traurige Mädchen von damals scheint immer noch wirksam zu sein. Das wäre auch eine Möglichkeit, nämlich mit diesem traurigen Mädchen zu arbeiten, damit sich seine und damit Ihre Trauer lösen können. Wie denken Sie darüber?«
Hier werden die Gefühle der Trauer und deren heutige Wirkung einfühlsam aufgegriffen. Daraus wird der Lösungswunsch für die Zusammenarbeit abgeleitet und zugleich die Möglichkeit der Inneren-Kind-Arbeit mit einem Vertragsangebot verbunden.
Vertiefung und Weiterführung I
Die Dynamik der Kind-Ego-States – Wie Kind-Ego-States denken, fühlen und agieren
Wir schauen uns nun die innere Dynamik und das Agieren eines Kind-Ego-States genauer an:
Kind-Ego-States agieren unbewusst
Die Kind-Ego-States sind für das aktuelle Erleben der Klientinnen zum großen Teil unbewusst. Klienten erleben nur die Auswirkungen, wenn ein Kind-Ego-State im inneren System agiert. Die Klientin im obigen Fallbeispiel 1 spürt ihre Traurigkeit und Energielosigkeit als Symptom, zu dem beteiligten Kind-Ego-State des achtjährigen Mädchen hat sie keinen Zugang, obwohl sie weiß, dass ihre Problemzustände mit dem Verlust der Großmutter in der Kindheit zusammenhängen. Eine neunzehnjährige Klientin, die sich beim Beziehungsstress mit ihrem Freund ritzt, hat keinerlei Zugang zu dem siebenjährigen Mädchen, das von ihrem deutlich älteren Bruder sexuell missbraucht wurde.
Kind-Ego-States reagieren körperlich und unwillkürlich
Schon im Entstehen sind die Kind-Ego-States im Körper des Kindes oder Jugendlichen und im unwillkürlichen Nervensystem verankert, weil gerade Kinder und Jugendliche sehr körpernah leben und erleben. Kinder reagieren immer mit ihrem ganzen Körper und Körpererleben, insbesondere auf massive und destruktive Erfahrungen. Deshalb sind die Aktivierung und Reaktion der Kind-Ego-States unwillkürlich auf der Körperebene des sympathischen und parasympathischen Nervensystems angesiedelt. Sie und ihre Aktivierung sind deshalb zunächst der bewussten Kontrolle entzogen.
Kind-Ego-States reagieren affektiv
Kinder und Jugendliche sind nicht nur körpernahe, sondern auch affektive Organismen, die mit basalen Affekten und Emotionen reagieren. Zunächst sind hier Schmerz und Wohlbefinden, Lust und Unlust, Ohnmacht und Selbstwirksamkeit, Wut und Liebesgefühle, Trauer und Bindungsgefühle, Enttäuschung und Freude zu nennen, später kommen dann weitere Gefühle wie Scham, Schuld, Selbstempfinden, Hoffnung und Glücksgefühle dazu.
Kind-Ego-States werden von ihren Bedürfnissen motiviert
Der innerste, sozusagen heiße Kern jeden Kind-Ego-States sind die grundlegenden Bedürfnisse des Kindes, die bei unseren Klienten meist unerfüllt, enttäuscht, abgewertet, verletzt oder zerstört wurden. Dies ist auch der innerste Kern des Leidens der Kind-Ego-States und damit der Klienten und Klientinnen. Auch die Probleme und die Symptome der Klienten müssen von den enttäuschten, abgewerteten, verletzten Bedürfnissen der Kind-Ego-States her verstanden werden.
Kind-Ego-States reagieren und agieren aus dem Wunsch nach Überleben
Mit der Bedrohung oder Verletzung der fundamentalen Grundbedürfnisse des Kindes und Jugendlichen fühlen sich diese auf Grund ihrer existentiellen Verletzbarkeit meist auch in ihrer Existenz und in ihrem Überleben bedroht und verletzt. Deshalb reagieren Kinder und Jugendliche und später die Kind-Ego-States auf Bedrohungen, Verletzungen und Abwertungen auf einer existentiellen Ebene mit einer Überlebensreaktion. Diese Überlebensreaktion bestimmt sehr häufig das automatische, unwillkürliche und unbewusste Verhalten der Kind-Ego-States. Später können wir die Überlebensreaktion als Lebensskript in einzelnen Sätzen formulieren (vgl. Kapitel 13).
Kind-Ego-States sehnen sich nach Linderung und Heilung
Die erlebten destruktiven Erfahrungen hinterlassen in den betroffenen Kind-Ego-States Einengungen, Blockaden, Verletzungen und tiefe Wunden. Der Schmerz dieser Verletzungen drängt die Kind-Ego-States nach Linderung und Heilung. Weil die Kind-Ego-States dieses auf kindliche Weise selbst versuchen, erreichen sie meist keine Linderung oder Heilung, sondern sie wiederholen auf tragische Weise die Einschränkungen und Verletzungen.
Kind-Ego-States sehnen sich nach nachholender Erfüllung der Bedürfnisse
Die in der Kindheit nicht erfüllten, abgewerteten oder verletzten Bedürfnisse wie der Wunsch nach Bindung und Nähe oder nach Anerkennung drängen die Kind-Ego-States, diese nachholend doch noch erfüllt zu bekommen. Auch dies führt oft in tragischer Weise zum Gegenteil, nämlich zur Wiederholung der alten Enttäuschungen und Verletzungen.
Bitte beachten!
Das Konzept des »Inneren Kindes« ist ein für Klientinnen sehr eingängiges und für die Beratung und Therapie sehr hilfreiches Konzept. Allerdings besteht die Gefahr, dass wir und die Klienten das Konzept für die Realität halten. Daraus entstehen manchmal irreführende Konsequenzen, die dann nicht mehr heilsam sind. So sind Kind-Ego-States eben »nur« neuronale Netzwerke, die anders und leichter verändert werden können als scheinbar »ganz reale« Innere Kinder.
Vertiefung und Weiterführung II
Welche Kind-Ich-Zustände können herausgearbeitet werden?
Natürlich gibt es keine feststehende oder gar eine Art natürlicher Kategorisierung der Kind-Ich-Zustände, auch wenn das zum Beispiel in der Transaktionsanalyse mit angepasstem, rebellischem und freiem Kind (Berne, 2002; Berne, 2006) oder in der Schematherapie mit dem verletzlichen, wütenden oder verwöhnten Kind-Modus (Roediger, 2016) versucht wird. In der Beratung und Therapie arbeiten wir zielorientiert mit den Kind-Ego-States, die für eine Heilung der von den Klienten vorgebrachten Symptomatik und für eine Lösung der Probleme und Symptome zieldienlich sind. Aus dieser systemisch-konstruktivistischen Sicht werden die Kind-Ego-States allererst in der Inneren-Kind-Arbeit für die Bearbeitung der eingebrachten Problematik oder Symptomatik konstituiert.
Dennoch sollten wir wissen, welche Kind-Ich-Zustände in aller Regel für die Innere-Kind-Arbeit wichtig sind, gerade weil in der Inneren-Kind-Arbeit sehr häufig unbewusste und abgespaltene, also dem Erleben zunächst nicht zugängliche Kind-Ego-States relevant sind.
Wir können für die Beratung und Therapie die Kind-Ego-States aktivieren und organisieren nach den Kriterien von
Alter und Entwicklungsphase des Kind-Ego-States:
Die einfachste Kategorie des Kind-Ego-States entsteht mit der Frage: »Wie alt fühlen Sie sich in dieser Situation?« oder »Wie alt ist das Kind, das so traurig ist?« Wir können dann von dem sechs- oder achtjährigen Mädchen reden, das jetzt die Erkrankung der Großmutter erlebt. Wir können aber auch nach Kind-Ego-States in entwicklungspsychologisch relevanten Phasen fragen: »Wie hat sich der vierzehnjährige Junge in der Pubertät erlebt?« Dann fokussieren wir auf die Kind-Ego-States in einer bestimmten Entwicklungsphase mit ihren dazugehörigen Themen und Schwierigkeiten.
Affekten, Emotionen und Gefühlen des Kind-Ego-States:
Wir können die Kind-Ego-States nach ihrem vorherrschenden Gefühl kategorisieren, so dass wir vom sich verlassen fühlenden, vom verzweifelten, ohnmächtigen oder wütenden und vom sich glücklich, lebendig oder zuversichtlich fühlenden Kind-Ego-State sprechen können. Dies ermöglicht uns in der Inneren-Kind-Arbeit einen empathischen und direkten Zugang zu dem jeweiligen Kind-Ego-State. Zugleich zeigen die Gefühle uns und dem erwachsenen Klienten, was das Innere Kind jetzt in seinem Gefühlszustand braucht, nämlich zu allererst Empathie, Akzeptanz und ein Verständnis dieser Gefühle.
Bedürfnissen, Wünschen und Sehnsüchten des Kind-Ego-States:
Im Zentrum von Kind-Ego-States befinden wir uns, wenn wir von den bedürftigen Kind-Ego-States sprechen, also zum Beispiel vom lebenshungrigen oder bindungsbedürftigen Kind. Klientinnen wissen dann oft intuitiv, was das bindungsbedürftige Innere Kind jetzt braucht. Es ist dann Aufgabe der Therapeuten, die Klienten darin zu unterstützen, dem Kind-Ego-State jetzt die Erfüllung der Bedürftigkeit zu ermöglichen.
Schweregrad der Belastung des Inneren Kindes – Leidende Kind-Ego-States:
Wir können die Kind-Ego-States in ihren destruktiven Erfahrungen und damit in ihrem Leid und Leiden ansprechen. Wir werden sehr ausführlich die unterschiedlichen destruktiven Belastungen der bindungsgestörten, neurotisierten und traumatisierten Kind-Ego-States kennen lernen, um dann mit ihnen an ihrer Grundthematik zu arbeiten.
Überlebensreaktion und Lebensskript:
Die Kinder und Jugendlichen reagieren auf destruktive Erfahrungen mit einer Überlebensreaktion, die dann die Kind-Ego-States in ihren Aktionen dominiert und die wir als Lebensskript formulieren können (Näheres dazu in Kapitel 13). So haben wir beispielsweise sehr angepasste Kind-Ego-States, die so von den Eltern doch noch geliebt werden wollen.
Grad der Unbewusstheit des Kind-Ego-States:
Viele Kind-Ego-States sind zum Beispiel durch Erinnerung leicht dem Bewusstsein zugänglich. Es genügen einzelne Erinnerungsbilder oder Gefühle, die dann die dazu passenden Kind-Ego-States ins Bewusstsein bringen. Bei schwereren Symptomatiken aber ist ein Großteil der betroffenen Kind-Ego-States dem Bewusstsein nur sehr schwer oder zunächst gar nicht zugänglich. Sie unterliegen entweder dem Mechanismus der Verdrängung bei der Neurotisierung oder der Dissoziation durch eine schwere Bindungsstörung oder Traumatisierung. Ein Kind-Ego-State kann verdrängt sein, weil seine kindlichen sexuellen Impulse von den Eltern mit Beschämung oder Abwertung besetzt waren. Bei schweren Bindungsstörungen und Traumatisierungen ist immer ein Teil der betroffenen Kind-Ego-States dissoziiert.
Ressourcen-Kind-Ego-States und Archetypus des Inneren Kindes:
Nicht zuletzt besitzt jeder Mensch immer auch selbstwirksame, kompetente Kind-Ego-States mit positiven Gefühlen. In der Transaktionsanalyse gibt es das Konzept des freien Kindes, das in uns angelegt ist und trotz allen Beschädigungen erhalten bleibt. Carl Gustav Jung hat in seinem Ansatz der Analytischen Psychologie den Archetyp des Kindes und des göttlichen Kindes herausgearbeitet (Jung, 1976; Asper, 1994; Seifert, 2003). Sowohl das freie Kind als auch der Archetypus des Kindes sind überindividuelle Grundfähigkeiten in jedem Kind, die wir in der Inneren-Kind-Arbeit reaktivieren können.
In der Inneren-Kind-Arbeit steht zunächst meist ein Aspekt im Vordergrund, der uns den Zugang zu den relevanten Kind-Ego-States ermöglicht. Dann sollten wir allerdings zum leidenden, emotionalen und bedürftigen Inneren Kind gelangen, um mit diesen Kind-Ego-States heilsam und heilend arbeiten zu können.
Vertiefung und Weiterführung III
Das Gegenüber und das Umfassende der Kind-Ego-States – Der Erwachsenen-Ego-State und das Selbst
Kind-Ego-States sind Teilsysteme des Gesamtsystems einer Person. Für das Verständnis und die Arbeit mit den Inneren Kindern brauchen wir auch die anderen Teilsysteme einer Person und das Gesamtsystem eines Menschen, in dem er sich als individuelle Person erlebt, versteht und beschreibt. In dieses Gesamtsystem sind im besten Falle die Kind-Ego-States gut integriert und bilden einen Teil des biografischen Selbst. Wenn uns Klienten aufsuchen, dann haben wir es mit enttäuschten, abgewerteten, bedrohten und verletzten Kind-Ego-States zu tun, die zugleich im Persönlichkeitssystem meist nicht gut integriert sind. Deshalb müssen wir immer auch mit einen systemischen Blick die Kind-Ego-States und das sie umfassende Persönlichkeitssystem berücksichtigen (Schmidt, 2019; Peichl, 2018). Wir können die weiteren wesentlichen Persönlichkeitssysteme beschreiben als
Systeme, die den Kind-Ego-States gegenüberstehen:
Hier sind das Erwachsenen-Ich oder der Erwachsenen-Ego-State, das Ich und die von außen übernommenen Ego-States, also die internalisierten Ego-States, zum Beispiel die Ego-States der internalisierten Eltern zu nennen.
System, das als Gesamtsystem der Person fungiert:
Menschen erleben und fühlen sich als integrierte und zusammenhängende Einheit, die die Funktionseinheit des Gesamtsystems der Person darstellt. Wir können diese Einheit als Selbst bezeichnen. Das Selbst kann als das Umfassende und als das Gesamt einer Person verstanden werden, das mehr ist als die Summe aller Ego-States.
Über beide Systeme gibt es in der Psychotherapie- und Psychologiegeschichte lange Debatten und Auseinandersetzungen, besonders seit mit Freud das Ich eine prominente Rolle spielte und dann mit Kohut in der Entwicklung der Narzissmustheorie der Selbstbegriff zentral wurde (Peichl, 2012; Peichl, 2013). Ich versuche hier in der gebotenen Kürze, die für die Innere-Kind-Arbeit wesentlichen Aspekte zusammenzuführen.
Der Erwachsenen-Ego-State – aktuelles Steuerungssystem und Gegenüber zu den Kind-Ego-States und den internalisierten Ego-States
Mit dem Erwachsenen-Ego-State des Klienten wird der Erlebenszustand einer Person beschrieben, der sich in der Jetztzeit und im Kontakt mit der Jetzt-Realität befindet. Man könnte den Erwachsenen-Ego-State auch Präsenz-Ego-State – bei Eric Berne als Neo-Psyche bezeichnet (Berne, 2002; Berne, 2006) – nennen. Der Erwachsenen-Ego-State entsteht aus dem Gesamtsystem der Person in Reaktion auf seine jetzt erlebte Innen- und Außenwelt. Der Erwachsenen-Ego-State aktualisiert also das Gesamtsystem einer Person im Hier und Jetzt.
Die aktuellen Funktionen des Erwachsenen-Ego-States bestehen nach außen im angemessenen Fühlen, im Reflektieren, im Distanzieren und in der Realitätsprüfung. Nach innen reguliert der Erwachsenen-Ego-State jetzt die Emotionen, Körperbedürfnisse und psychischen Bedürfnisse. Es sei noch einmal betont, dass die Klienten auch im Erwachsenen-Ego-State Gefühle haben, nämlich als angemessene psychische Reaktion auf eine Außensituation. So kommt die Trauer des erwachsenen Partners um seine soeben verstorbene Ehefrau aus dem Gesamtsystem seiner Person und wird jetzt und hier bei der Bestattungsfeier im Erwachsenen-Ich gelebt und ausgedrückt.
Das Ich einer Person – Ein Metakonzept
Ich will nur ganz kurz auf den Begriff des Ichs hier eingehen, zumal es zum Begriff des Erwachsenen-Ego-States viele Überschneidungen gibt (Peichl, 2012). Bei Freud und in der Psychoanalyse ist das Ich eher ein Metakonzept im Strukturmodell, während in der Ego-State-Psychologie das Erwachsenen-Ich als jetzt konkret erlebbarer, auch für das Gegenüber spürbarer Zustand konzeptualisiert wird.
Man kann den Erwachsenen-Ego-State als Teil und als gegenwärtige Aktualisierung des Ichs verstehen, das die größere Einheit darstellt, die die verschiedenen Erwachsenen-Ego-States umfasst. Das Konzept des Ichs steht also zwischen seiner aktualisierten Form des Erwachsenen-Ego-States und dem Selbst, also dem größeren, übergreifenden und integrierenden Background des Gesamtsystems einer Person.
Das Selbst einer Person – der sich selbst organisierende Prozess der eigenen Identität
Menschen erleben sich als Einheit, die sich trotz allen inneren Widersprüchen in einem umfassenden Gefühl der Identität zeigt. Dieses existentielle Gefühl der Einheit beschreiben wir mit dem Begriff des Selbst. Dabei ist das Selbst keine Substanz und hat keinen festen Ort im Gehirn, vielmehr entsteht es in einem ständigen Prozess der Selbstwerdung. Das Selbst stellt also einen sich selbst ständig organisierenden, sich über das gesamte Gehirn erstreckenden Prozess dar.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: