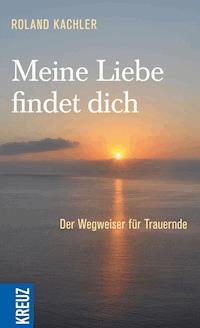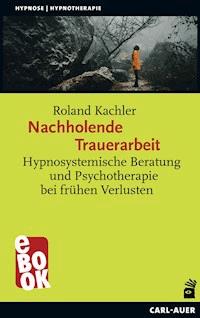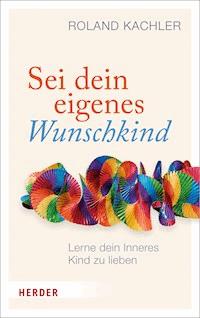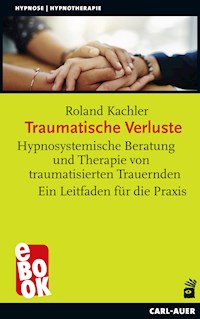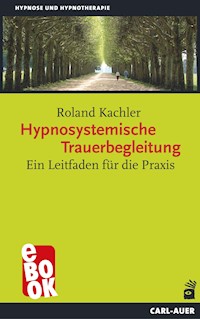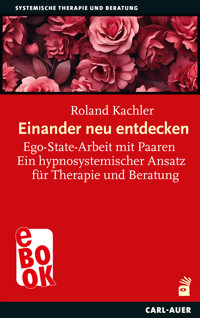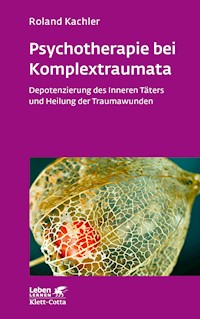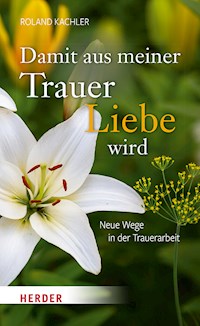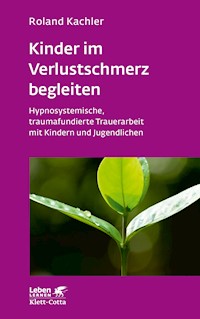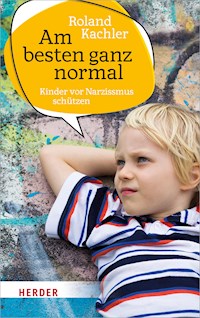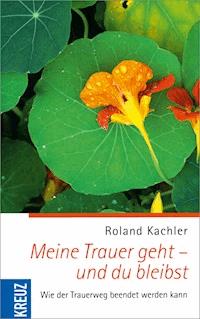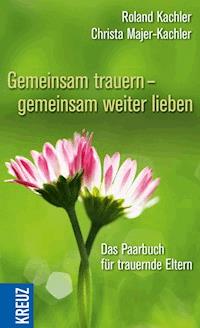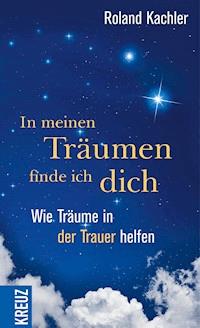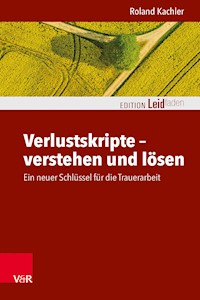
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Edition Leidfaden – Begleiten bei Krisen, Leid, Trauer
- Sprache: Deutsch
Der Tod eines nahen Menschen aktiviert unbewusste Einstellungen gegenüber Verlusterfahrungen, die wir in der Trauerbegleitung als Verlustskripte herausarbeiten können. Ein schwerer Verlust bereitet den Boden für Verlustskripte, die einerseits aus der Biografie und Herkunftsfamilie, andererseits aus der konkreten schweren Verlusterfahrung eines Menschen stammen. Ein Skriptsatz kann beispielsweise lauten: "Ohne meinen Mann kann ich nicht weiterleben." Solche Verlustskripte können den Trauerprozess hemmen und verzögern. Der systemische Berater, Trauerbegleiter und Hypnotherapeut Roland Kachler zeigt konkrete Wege und praxisnahe Methoden für die Trauerbegleitung, die zum Verständnis und zur Lösung von Verlustskripten und damit von blockierter Trauer führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EDITION Leidfaden
Hrsg. von Monika Müller, Petra Rechenberg-Winter, Katharina Kautzsch, Michael Clausing
Die Buchreihe Edition Leidfaden – Begleiten bei Krisen, Leid, Trauer ist Teil des Programmschwerpunkts »Trauerbegleitung« bei Vandenhoeck & Ruprecht, in dessen Zentrum seit 2012 die Zeitschrift »Leidfaden – Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer« steht. Die Edition bietet Grundlagen zu wichtigen Einzelthemen und Fragestellungen für Tätige in der Begleitung, Beratung und Therapie von Menschen in Krisen, Leid und Trauer.
Roland Kachler
Verlustskripte –verstehen und lösen
Ein neuer Schlüssel für die Trauerarbeit
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: Stephan Kelle/photocase.de
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2198-2856
ISBN 978-3-647-99393-5
Inhalt
Vorwort
I Was Verlustskripte sind – und wie wir sie entdecken können
1 Lebensskripte und Verlustskripte – ähnlich und doch unterschiedlich!
2 Was ist ein Verlustskript? – Das Besondere von Verlustskripten
3 Worauf beziehen sich Verlustskripte? – Die Inhalte der Verlustskripte
4 Weibliche und männliche Verlustskripte
5 Wie sich Verlustskripte zeigen – Die Diagnose der Verlustskripte
II Wie Verlustskripte im Verlust entstehen – und wie wir sie durch Trauerbegleitung verhindern können
1 Verlustskripte entstehen aus dem Verlusttrauma
2 Verlustskripte entstehen aus der Angst vor Schmerz und Trauer
3 Verlustskripte entstehen aus der Abwehr oder Überbetonung der inneren Beziehung zum Verstorbenen
4 Verlustskripte entstehen aus einer ungeklärten Beziehung zum Verstorbenen
5 Verlustskripte entstehen aus einem Lebensverzicht
III Wie Verlustskripte aus der Biografie entstehen – und wie wir sie in der Trauerbegleitung berücksichtigen müssen
1 Wie die Biografie auf einen schweren Verlust vorbereitet
2 Allgemeine Lebensskripte aus der Biografie – durch den Verlust aktiviert
3 Verlustskripte aus unbewältigten Verlusten in der Kindheit und Jugend
4 Familiäre Verlustskripte – Die Familie gibt Verlustskripte transgenerational weiter
5 Gesellschaftlich geprägte Verlustskripte – Kultur und Gesellschaft schreiben Verlustskripte vor
IV Wie Verlustskripte wirken – und welche Störungen daraus entstehen können
1 Wie Verlustskripte Befindlichkeitsstörungen verursachen
2 Wie Verlustskripte körperliche Störungen verursachen – Die Somatisierung als Folge von Verlustskripten
3 Wie Verlustskripte depressive Symptome verursachen – Die Depression als Stillstand der trauernden Seele
4 Wie wir mit psychosomatischen und depressiven Verlust-Folgestörungen arbeiten
V Wie wir Verlustskripte lösen und transformieren können
1 Die Transformation der im Verlust entstandenen Verlustskripte
2 Die Transformation der durch den Verlust aktualisierten allgemeinen Lebensskripte
3 Die Transformation der durch einen frühen Verlust entstandenen Verlustskripte
4 Die Transformation der familiären Familienskripte
5 Die Distanzierung gegenüber gesellschaftlich geprägten Verlustskripten
Statt eines Schlusswortes
Literatur
Vorwort
Sie kennen Verlustskripte noch nicht? Dann sind Sie damit nicht allein. Dieser Begriff und das Konzept sind ganz neu. Und doch sind Verlustskripte für das Verständnis des Trauerprozesses und für die Trauerbegleitung fundamental wichtig und hilfreich.
Ich habe das Konzept des Verlustskriptes in Anlehnung an das Konzept des Lebensskriptes aus meiner eigenen Trauererfahrung und aus meinen vielen Trauerbegleitungen und Trauertherapien heraus entwickelt. Wurden Trauernde bisher vorwiegend unter dem Aspekt ihres akuten Verlustes gesehen und verstanden, so ermöglichen nun die Verlustskripte einen Blick auf die Trauernden als individuelle Personen mit ihren eigenen Lebensgeschichten, die in das Erleben und Bewältigen einer Verlustsituation einfließen. Das Konzept der Verlustskripte als neuer Schlüssel für die Trauerarbeit öffnet also eine neue Tür zu den Trauernden und zu deren ganz individuellem Erleben eines schweren Verlustes.
Ich möchte Sie einladen, sich diesen neuen Schlüssel mit diesem Buch anzueignen und sich damit einen neuen Zugang zu der Person von Trauernden und so zur Trauerarbeit zu erschließen. Herzlich willkommen!
Roland Kachler
I Was Verlustskripte sind – und wie wir sie entdecken können
1 Lebensskripte und Verlustskripte – ähnlich und doch unterschiedlich!
Fallbeispiel 1: Immer wieder schwierige Partnerschaften
Eine dreißigjährige Frau gerät immer wieder in schwierige Partnerschaften. Sosehr sie bei der Partnerwahl bewusst darauf achtet, dass sie einen für sie passenden Partner findet, sosehr gerät sie immer wieder an den Falschen. Sie denkt sich: »Ich werde nie den Richtigen finden, der mich liebt.« Dabei spürt sie Verzweiflung und Resignation.
Fallbeispiel 2: Ich bin ein Versager
Ein vierzigjähriger, sehr aktiver, kompetenter Manager gerät in ein massives Burn-out, das zunächst einen Klinikaufenthalt nötig macht. Er kann sich sein Burn-out nicht erklären, wertet es als persönliches Versagen und macht sich selbst Vorwürfe, die ihn noch mehr antreiben. Er hat ein Minderwertigkeitsgefühl und denkt: »Ich bin ein Versager. Das hat mir schon mein Vater gesagt.«
Was sind Lebensskripte?
Um zu verstehen, was ein Verlustskript ist, müssen wir uns zunächst den Begriff des Skriptes oder Lebensskriptes anschauen. Dieser Begriff kommt aus der Transaktionsanalyse und wurde aus der Sphäre des Theaters übernommen (Berne, 2002; Schmale-Riedel, 2016; Kachler, 2018b; Kachler, 2021c). Dabei ist das Skript wie ein Drehbuch oder ein Rollenbuch, das einem Theaterstück oder einer Oper zugrunde liegt. Das Skript, das ein Mensch hat, schreibt ihm unbewusst vor, wie er sich in seinem Leben wie in einem Theaterstück zu verhalten hat, welche Rollen er dabei einnimmt und welche Mitspieler er sich sucht. Dabei gibt es wie bei einer Oper ein Grundthema, zum Beispiel »Ich darf nicht glücklich sein«, das sich dann im Leben eines Menschen zunehmend realisiert und erfüllt.
Lebensskripte sind unbewusste Lebenshaltungen, die das Leben eines Menschen mehr oder weniger stark und dabei meist destruktiv prägen.
Bei den beiden Fallbeispielen zeigt erst eine genaue Prüfung der Muster, die hier eine Rolle spielen, welches Lebensskript Regie führt. Wenn wir das zugrunde liegende Thema dieses Musters formulieren, dann haben wir das Lebensskript erfasst, das hinter einem immer wiederkehrenden Lebensproblem steht.
Die Frau in Fallbeispiel 1 hat das Grundgefühl, dass sie sich nicht wirklich geliebt fühlt. Sie kann aus diesem Grundgefühl heraus erst durch Nachfragen und Impulse ihr Lebensskript als Skriptsatz formulieren: »Ich wurde nie geliebt und bin nicht liebenswert.« Sie zieht aus diesem Skript nun eine Schlussfolgerung: »Ich nehme auch Partner, die nicht ganz zu mir passen. Hauptsache, dieser Mann zeigt mir auf andere Weise als meine Eltern seine Liebe.« Im Ergebnis achtet sie bei der Partnerwahl nicht auf ihre eigentlichen Wünsche und nicht auf ihre warnende innere Stimme und gerät so an Männer, die keine langfristige Paarbeziehung, sondern ein kurzes Abenteuer mit ihr suchen. Durch jede Enttäuschung wird sie in ihrem Lebensskript »Ich bin nicht liebenswert« bestätigt. Erneut geht sie – zunehmend verzweifelt – wieder auf Partnersuche, die entweder scheitert oder wieder zu einem nicht passenden Partner führt. Sie hat das Gefühl, dass sich bei ihr diese Muster wie magisch vorbestimmt wiederholen und dass sie nicht aus dieser »Falle« herauskann.
Beim zweiten Fallbeispiel wird in der Aufarbeitung deutlich, dass das Burn-out durch den unbewussten Leitsatz des Managers, also durch sein Lebensskript bedingt ist. Sein Vater war sehr anspruchsvoll, weil er »das Beste« aus seinem Sohn machen wollte. Der sollte wie er selbst beruflich sehr erfolgreich sein. Dabei hat er seinen Sohn immer wieder kritisiert und abgewertet, mit der Hoffnung, ihn dadurch zu motivieren. Der Sohn dagegen hatte das Gefühl, dass er seinem Vater nicht genügt und ein Versager ist, obwohl er in der Schule und im Sport durchaus Erfolg hatte. Aus dem Skriptgefühl und Skriptsatz »Ich bin ein Versager« zog er den Schluss, dass er es seinem Vater zeigen werde und noch erfolgreicher als dieser werden wollte. So setzte er sich mit dem Antreiber »Streng dich an und sei besser als dein Vater!« massiv unter Druck. Anfangs schien dieses Skript mit diesem Antreiber durchaus Erfolg zu haben, doch er beutete sich und seinen Körper bis zur Erschöpfung aus, was schließlich zum Burn-out führte.
Ein Lebensskript ist also eine unbewusste Lebensüberschrift, die dann zu einer Lebensvorschrift wird. Das Lebensskript spiegelt zum einen entsprechende negative Erfahrungen in der Kindheit, zum anderen ist es ein Versuch, mit diesen schwierigen Kindheitserfahrungen zurechtzukommen. Wir werden sehen, dass Verlustskripte aus einer schweren Verlusterfahrung, wie zum Beispiel beim Tod eines Kindes, heraus entstehen. Sie sind also Reaktionen auf einen schweren Verlust und versuchen zugleich, einen Umgang damit zu ermöglichen. Allerdings sind diese Lösungsversuche – ähnlich wie bei den Lebensskripten – nicht immer hilfreich, sondern häufig destruktiv und blockierend.
Woraus bestehen Lebensskripte?
Wenn wir nun die Lebensskripte der beiden vorangegangenen Beispiele genauer analysieren, dann können wir bei ihnen – und den meisten Lebensskripten – verschiedene, wiederkehrende Bestandteile und Strukturen herausarbeiten. Demnach besteht ein Lebensskript aus folgenden Teilen, auch wenn das im Einzelfall immer ein wenig anders aussehen kann:
Skriptgefühl als Basis
Das Skriptgefühl ist ein existenzielles Grundgefühl des Kindes oder Jugendlichen, das die Basis des konkret formulierbaren Skriptes bildet. Das Skriptgefühl entsteht in einer bestimmten Familienkonstellation, in einer problematischen Beziehung zu einem Elternteil oder in einer schwierigen Kindheitssituation wie bei der Erkrankung oder Behinderung eines Kindes. Das Kind erlebt sich in solchen Situationen mit seinen Gefühlen selbst, aber es nimmt auch die Reaktionen der Familie, besonders der Eltern auf. Weil Kinder sehr feinfühlig sind, nehmen sie Reaktionen und Botschaften wahr und beziehen diese auf sich selbst.
Das Mädchen in Fallbeispiel 1 fühlt sich von seinen Eltern nicht geliebt, weil diese in ihrem eigenen Ladengeschäft sehr beschäftigt sind. Der Junge in Fallbeispiel 2 fühlt sich nicht anerkannt, sondern abgewertet oder kritisiert. In anderen Situationen fühlt sich beispielsweise ein Kind mit Lernproblemen unfähig. Ein anderes Kind erlebt sich in der Familie gegenüber den älteren Geschwistern benachteiligt oder ungerecht behandelt. Diese Grundgefühle brennen sich ein und werden zur Basis eines Lebensskriptes, das wir dann später als konkreten Skriptsatz formulieren können, zum Beispiel »Ich bin nicht geliebt«, »Ich bin nichts wert«, »Ich schaffe das nicht«, »Ich bin ungenügend« oder »Ich gehöre nicht dazu«.
Skriptsatz als unbewusster Leitsatz
Das grundlegende Lebensgefühl, also das Skriptgefühl, wird nun von dem betroffenen Kind oder Jugendlichen als so bestimmend erlebt, dass es zu einem inneren Leitsatz wird. Dies geschieht meist nicht bewusst. Man kann deshalb diesen inneren Leitsatz eines Kindes erst im Nachhinein, meist erst als Erwachsener, herausarbeiten und dann formulieren.
Der Skriptsatz bezieht sich zunächst auf das Kind selbst, also zum Beispiel »Mein Papa mag mich nicht« oder »Meinen Eltern ist die Arbeit wichtig, nicht ich«. Dann wird der Skriptsatz allmählich verallgemeinert und generalisiert, sodass dieser schließlich als Leitsatz über dem weitergehenden Leben steht: »Ich bin nicht geliebt«, oft noch allgemeiner: »Ich bin nicht liebenswert« oder »Ich bin nicht wichtig«.
Daraus werden weitere Skriptsätze über die anderen Menschen, über die Welt oder das Leben abgeleitet: »Kein Mensch liebt mich«, oder noch allgemeiner: »Menschen lieben andere nicht.« Bezogen auf das Leben oder die Welt lautet dann der Skriptsatz: »Das Leben ist lieblos« oder »Die Welt ist hart«. Solche generellen Lebensskripte scheinen nun immer zu passen und sind für Heranwachsende ganz und gar richtige und unumstößliche Überzeugungen, von denen sie sich nicht mehr distanzieren können.
Skriptfolgerungen als Handlungsanweisungen
Aus dem Skriptgefühl und dem Skriptsatz ergeben sich dann scheinbar ganz schlüssig konkrete Handlungsanweisungen für die Betroffenen und deren Leben. Der Manager schließt aus den Abwertungen und Antreibern des Vaters, dass er sich sehr anstrengen und in einen Wettbewerb mit seinem Vater treten muss. Die Schlussfolgerungen sind dann vom Kind selbst entwickelte sogenannte Antreiber wie »Streng dich an«, »Sei hart« oder »Sei perfekt«. Diese Antreiber sind zum Teil durchaus positiv, weil sie die Betroffenen motivieren und oft zu besonderen Leistungen antreiben. Allerdings setzen die Antreiber die Betroffenen auch massiv unter Druck, überfordern sie und führen wie in Fallbeispiel 2 zu übermäßigen Belastungen. Manchmal gibt es weitere, oft konkrete Handlungsanweisungen wie »Werde besser als dein Vater« oder »Suche dir später einen Mann, der dich besser lieben kann als deine Eltern«.
Skriptprophezeiung
Bei manchen schweren Lebensskripten gibt es auch eine Vorhersage, was aus diesem Menschen mit seinem Skript werden wird. Bei dem Manager heißt die Prophezeiung zum Beispiel »Du kannst dich noch so sehr anstrengen, du wirst es nie so weit bringen wie dein Vater« oder bei der Frau aus Fallbeispiel 1 »Du wirst nie den richtigen Mann finden, der dich wirklich liebt«.
Lebensskripte können unterschiedlich schwerwiegend und destruktiv sein. Skripte leichterer Art prägen unser Leben wenig und zeigen sich oft nur in kleinen Marotten oder persönlichen Eigenheiten, die aber nicht weiter stören. Skripte mittlerer Schwere beeinträchtigen Menschen durchaus und bewirken viele psychische Probleme wie Beziehungsprobleme oder Arbeits- und Leistungsprobleme, unter denen die Betroffenen immer wieder leiden und für die sie selbst keine wirklich hilfreichen Lösungen finden. Massive, generalisierte destruktive Skripte führen zu schwerwiegenden psychischen Problemen, oft auch zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Ängsten. Hier heißen die Lebensskripte oft »Ich darf nicht leben«, »Ich bin an allem schuld«, »Ich bin nicht geliebt« oder »Ich gehöre nirgends dazu«.
Wie entstehen nun solche Lebensskripte?
Die Lebensskripte entstehen in der Kindheit und Jugendzeit und werden vom Kind in einer schwierigen Lebens- und Familiensituation entwickelt. Zudem hängen sie von den Elternbotschaften ab wie zum Beispiel der Satz des Vaters »Du bist nicht gut genug« oder der Mutter »Du bist nicht hübsch genug«. Dieses Verhalten der Eltern bestimmt das grundlegende Lebensgefühl, in dem die betreffenden Kinder aufwachsen. In diesem Lebensgefühl entwickelt sich nun das Lebensskript, das das Gefühl formuliert, festlegt und generalisiert: »Ich bin nicht liebenswert« oder »Ich bin ein Versager«.
Dazu kommen einseitige und überfordernde Verhaltensanweisungen der Eltern wie »Sei perfekt« oder »Streng dich an«, die wir Eltern-Antreiber nennen. Oft machen sich Kinder diese Eltern-Antreiber zu eigen oder entwickeln eigene, kindliche Antreiber, um es den Eltern recht zu machen. Der Junge übernimmt einerseits den Antreiber des Vaters »Streng dich immer noch mehr an, damit du gut bist«. Und andererseits treibt er sich auch selbst an mit dem kindlichen Antreiber »Ich strenge mich so an, damit ich noch besser werde als mein Vater«.
Doch nicht nur das Verhalten eines oder beider Elternteile kann zur Grundlage für Lebensskripte werden. Schicksale wie frühe Verluste, Unfälle, chronische Erkrankungen, die Scheidung oder Trennung der Eltern sind ebenfalls oft Hintergründe für Lebensskripte. Kinder und Jugendliche versuchen mit ihren kindlichen Mitteln, ein sie überforderndes Lebensereignis oder eine schwierige Familiensituation nicht nur zu überleben, sondern mit ihnen zu leben. So kann ein Kind mit einer behindernden Erkrankung das Skript entwickeln »Ich bin krank und werde es immer sein. Deshalb habe ich es schwer im Leben« oder aber ein gegenteiliges Skript wie »Ich bin zwar krank, aber ich werde kämpfen und damit zurechtkommen«. Das letztere Skript ist ein bewältigungsorientierter Lebensplan, das erstere ist ein destruktiveres Skript, das in schwierigen Situationen von Kindern sehr viel häufiger vorkommt. Kinder erleben solche Situationen aus kindlicher Sicht und wenden bei der Bewältigung kindliche Methoden an. Deshalb sind die Überlebenslösungen eines Lebensskriptes meist nur eingeschränkt hilfreich, nicht selten auch destruktiv.
Positive und konstruktive Lebenspläne – Ausdruck der Resilienz
Wir haben bisher nur destruktiv wirkende Lebensskripte beschrieben. Von der Entstehung dieses Konzeptes her war und ist der Begriff Lebensskript zunächst auf schädigende, blockierende unbewusste Lebenspläne bezogen und wird in der Transaktionsanalyse und in der Psychotherapie auch weiterhin in diesem Sinne gebraucht. Aber auch konstruktive unbewusste Lebenspläne sind Lebensskripte, also unbewusste Lebenshaltungen, die aber nun förderlich und stärkend wirken.
Auch sie stammen aus der Kindheit und Jugendzeit und lauten zum Beispiel »Ich bin toll, und deshalb kriege ich fast alles hin«, »Ich bin geliebt, und deshalb komme ich bei allen gut an« oder »Nicht schlimm, wenn was schiefläuft, dann mach ich etwas anderes«. Solche positiven Lebenspläne stärken Kinder und Jugendliche und öffnen ihnen viele Zugänge ins Leben, so wie umgekehrt destruktive Lebensskripte viele Türen im Leben zuschlagen und verschließen.
Positive Lebenserfahrungen und Erfolge stärken Kinder und machen sie resilient. Sie erleben sich als selbstwirksam, kompetent und selbstbewusst. Auch diese Erfahrungen schlagen sich in unbewussten Lebenshaltungen nieder, zum Beispiel: »Jetzt komme ich. Mir steht die Welt offen.«
Wie wirken Lebensskripte?
In den beiden Fallbeispielen wird deutlich, dass ein Lebensskript sich wie ein sich selbst erfüllender Lebensplan verwirklicht und die Skriptprophezeiung Realität wird. In aller Regel scheinen sich durch die Lebenserfahrungen das Skriptgefühl und der Skriptsatz zu bestätigen. Zunächst begeben sich die Betroffenen aus ihrem Lebensskript heraus immer wieder in die gleichen schwierigen Lebenssituationen, wie die Frau im Fallbeispiel 1 in ihrer Partnersuche. Genau dabei realisiert sich das Lebensskript in einem erneuten Scheitern. Das Skript verstärkt sich zirkulär: Es führt in schwierige Situationen, und in diesen Situationen führt das Lebensskript zum vorhergesagten Scheitern. Auch Versuche, sich aus dem Scheitern zu befreien, führen oft geradewegs wieder zum Scheitern.
Manchmal allerdings gibt es glückliche Umstände im Leben eines Menschen, sodass die Heranwachsenden oder später die Erwachsenen nicht in ihr vorgegebenes Lebensskript gehen müssen, sondern sich daraus lösen können. Manchmal treffen sie mit ihren Lebensskripten auf verständnisvolle, freundliche Menschen wie eine zugewandte Lehrerin oder später auf einen Partner mit einer großen Liebesfähigkeit, sodass sich das Lebensskript allmählich abschwächt und sich weitgehend lösen kann.
Nun haben wir Lebensskripte kennengelernt und können uns im Folgenden unserem eigentlichen Thema, den Verlustskripten, zuwenden, die aus ganz unterschiedlichen Gründen heraus entstehen können. Dabei haben sie eine ganz ähnliche Struktur und Wirkungsweise wie die besprochenen Lebensskripte.
2 Was ist ein Verlustskript? –Das Besondere von Verlustskripten
Verlustskripte drücken keine allgemeine Lebenshaltung aus, sondern unsere unbewusste Haltung und Einstellung gegenüber Verlusterfahrungen, gegenüber dem Tod eines nahen Menschen, gegenüber der eigenen Trauer und der weitergehenden inneren Beziehung zum verstorbenen nahen Menschen (Kachler, 2017a; 2019). Verlustskripte entstehen einerseits aus der Biografie der Trauernden und andererseits aus der konkreten schweren Verlusterfahrung. Sie wirken sich dann hemmend, blockierend oder destruktiv auf den weiteren Verlauf eines Trauerprozesses aus.
Verlustskripte drücken die unbewusste Haltung und Einstellung gegenüber Verlusterfahrungen, gegenüber dem Tod eines nahen Menschen und den Verlustgefühlen aus. Dazu gehört auch die Einstellung gegenüber einer inneren Beziehung zum Verstorbenen und zu seiner Person.
Verlustskripte sind ganz ähnlich wie die Lebensskripte unbewusste Überschriften, die in diesem Fall eine blockierende und destruktive Einstellung zum Tod eines nahen Menschen und zu einer inneren Beziehung zu ihm dauerhaft festschreiben. Damit werden diese Überschriften auch zu Vorschriften, wie eine Betroffene mit dem Tod des nahen Menschen umgehen kann und soll. Auch hier ist der Ausgang ein Gefühl, nun aber ein Verlustgefühl, zum Beispiel der Schock über den unerwarteten Suizid eines nahen Menschen oder der große Schmerz über den Tod des langjährigen Ehepartners. Ausgangspunkt eines Verlustskriptes ist aber ebenso das Verbundenheitsgefühl gegenüber dem Verstorbenen, die Sehnsucht nach ihm, die Liebe zu ihm, manchmal auch die Wut auf ihn.
Die daraus entstehenden Verlustskripte können wir wieder in Skriptsätze fassen und formulieren, zum Beispiel »Schmerz und Trauer sind so überwältigend. Deshalb vermeide ich sie gleich ganz« oder »Ohne meinen Mann kann ich nicht weiterleben«. Im Blick auf die innere Beziehung zum Verstorbenen kann ein Verlustskript lauten: »Ich lebe ganz mit meinem verstorbenen Mann. Ich ziehe mich ganz mit ihm zurück« oder »Ich bin so wütend auf meinen Sohn, dass er sich umgebracht hat. Deshalb will ich nichts von ihm wissen«.
Zunächst sind Verlustskripte in der Trauersituation Versuche, mit einem schweren Verlust umzugehen und ihn zu bewältigen. Sie sind also Lösungsversuche in einer an sich unlösbaren Verlustsituation. Langfristig aber können sie sich hemmend, blockierend oder auch destruktiv auf den Trauerprozess auswirken, zu dem – wie ich zeigen werde – zugleich immer die innere Beziehung zum Verstorbenen gehört. Deshalb ist der Trauerprozess stets auch ein Beziehungsprozess (Kachler, 2017a; 2019). Und schließlich gibt es im Blick auf das weitergehende Leben nach dem Tod eines nahen Menschen ebenfalls Verlustskripte, zum Beispiel: »Das Leben ohne meine Frau ist sinnlos und grau.«
Ich gebe nun einen ersten Überblick über das Entstehen, die Struktur und die verschiedenen Formen von Verlustskripten:
Verlustskripte – aus einem aktuellen Verlust entstehend
Fallbeispiel 3: Ohne meine verstorbene Tochter bin ich nichts
Die fünfzehnjährige Tochter einer alleinerziehenden Mutter verunglückt tödlich. Die Mutter hatte ihr ganzes Leben auf ihre Tochter und deren Erziehung ausgerichtet. Jetzt muss sie nicht nur den schrecklichen Tod ihrer Tochter aushalten, sondern mit ihrem Alleinsein und ihrer Leere leben. Diese Erfahrung und Gefühle drängen sich als innerer Satz immer wieder auf: »Ohne sie bin ich nichts. Jetzt ist alles aus. Mein Leben ist vernichtet.«
Dieser emotional erlebte Satz der Mutter ist zunächst sehr angemessen und passend, weil er die Gefühle und Empfindungen nach dem Tod ihrer Tochter in Worte fasst. Zu einem Verlustskript wird der Satz dann, wenn die Trauernde in ihm gefangen bleibt und sie ihn – meist unbewusst – zu einer dauerhaften Überschrift über den Tod ihrer Tochter und ihr weitergehendes Leben macht. Bei solch einem schweren Verlust ist wie bei allen schweren Verlusten das Risiko sehr hoch, dass sich die zunächst angemessene Beschreibung der eigenen Trauersituation zu einem bleibenden Verlustskript ausbildet.
Diese unmittelbaren, also aus dem Verlust entstehenden Skripte entstehen aus der übermächtigen Verlusterfahrung wie dem Schock, dem Verlustschmerz und der Trauer. Die Erfahrung einer Ehefrau, dass sie den plötzlichen Herztod und die bleibende Abwesenheit ihres Mannes nicht wahrhaben kann, formuliert sie als Skriptsatz: »Der Tod meines Mannes ist nicht wahr.« Dabei verfestigen sich diese Erfahrungen zu Leitsätzen, also zu neuen, meist destruktiven Skripten, eben den Verlustskripten. Aus den akuten und spontanen, ganz normalen Verlustreaktionen werden dann eingefahrene, scheinbar unveränderbare Haltungen gegenüber dem Verlust und den Verlusterfahrungen.