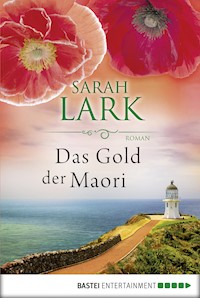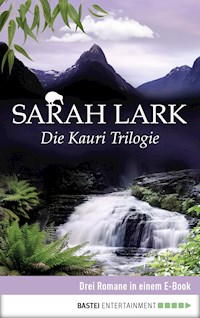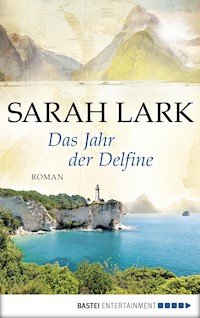9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tierärztin-Saga
- Sprache: Deutsch
Australien, 1955: Daphne hat ihr Tiermedizinstudium beendet. Nun könnte sie im Zoo von Perth arbeiten, den ihre Eltern Maria und Bernhard leiten. Aber Daphne entscheidet sich, eine Forschungsstelle anzunehmen, was sie schließlich in den Kongo führen wird. Doch die belgische Kolonie ist im Umbruch und bald ist Daphne dort nicht mehr sicher ...
Paris: Völlig unerwartet verstirbt Grits Vater bei einer gemeinsamen Konzertprobe. Im Gedenken an ihn führt sie dennoch die Tournee zu Ende. Als sie aber feststellt, dass sie von dem Cellisten Vincent schwanger ist, nimmt sie das nächste Schiff nach Neuseeland zu ihrer Mutter, der Tierärztin Nellie. Dort taucht die berühmte Pianistin ein in eine völlig andere Welt und muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, bevor sie an die Zukunft denken kann.
Neuseeland: Helena sieht ihre Träume von der Übernahme des Gestüts zerplatzen, nachdem ihr Großvater auf einen männlichen Nachfolger zu setzen scheint. Als dann auch noch ihre Mutter anreist, zu der sie bisher kaum Kontakt hatte, steht Helenas Welt kopf ...
Das fesselnde Finale der großen Familiengeschichte
Der in sich abgeschlossene dritte Band der erfolgreichen Tierärztin-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Australien, 1955: Daphne hat ihr Tiermedizinstudium beendet. Nun könnte sie im Zoo von Perth arbeiten, den ihre Eltern Maria und Bernhard leiten. Aber Daphne entscheidet sich, eine Forschungsstelle anzunehmen, was sie schließlich in den Kongo führen wird. Doch die belgische Kolonie ist im Umbruch und bald ist Daphne dort nicht mehr sicher …
Paris: Völlig unerwartet verstirbt Grits Vater bei einer gemeinsamen Konzertprobe. Im Gedenken an ihn führt sie dennoch die Tournee zu Ende. Als sie aber feststellt, dass sie von dem Cellisten Vincent schwanger ist, nimmt sie das nächste Schiff nach Neuseeland zu ihrer Mutter, der Tierärztin Nellie. Dort taucht die berühmte Pianistin ein in eine völlig andere Welt und muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, bevor sie an die Zukunft denken kann.
Neuseeland: Helena sieht ihre Träume von der Übernahme des Gestüts zerplatzen, nachdem ihr Großvater auf einen männlichen Nachfolger zu setzen scheint. Als dann auch noch ihre Mutter anreist, zu der sie bisher kaum Kontakt hatte, steht Helenas Welt Kopf …
Der in sich abgeschlossene dritte Band der erfolgreichen TIERÄRZTIN-Saga
ÜBER DIE AUTORIN
Sarah Lark, geboren 1958, wurde mit ihren fesselnden Neuseeland- und Karibikromanen zur Bestsellerautorin, die auch ein großes internationales Lesepublikum erreicht. Nach ihren fulminanten Auswanderersagas überzeugt sie inzwischen auch mit mitreißenden Romanen über Liebe, Lebensträume und Familiengeheimnisse im Neuseeland der Gegenwart. Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin, die in Spanien lebt.
SARAH LARK
DIETIERÄRZTIN
Mutige Wege
ROMAN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Copyright © 2023/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Vor- und Nachsatzgestaltung: © Kirstin Osenau, unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Miguel Sobreira/Trevillion.com; © David Steele/adobe.stock.com; Steve Lovegrove/stock.adobe.com; Enrico Della Pietra/stock.adobe.com; Christian Offenberg/stock.adobe.com; © Mila Petkova/Shutterstock, Andrey_Kuzmin/Shutterstock, Epifantsev/Shutterstock, Vector Tradition/Shutterstock, Alexander_P/Shutterstock, ShustrikS/Shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2843-0
luebbe.de
lesejury.de
ELTERN UND KINDER
Neuseeland – Epona Station, Ellerslie
Australien – Perth
Amerika – Boston, Wisconsin
1955 – 1957
KAPITEL 1
Schön wie der Frühling …
Nellie summte die Melodie aus dem Hammerstein-Musical vor sich hin, während sie von der Straße, die in die Kleinstadt Onehunga bei Auckland führte, in die Zufahrt von Epona Station einbog. Sie war völlig unmusikalisch, doch ihrem Wolfshundmischling Jamie, der ausgestreckt die gesamte Rückbank ihres Geländewagens einnahm, war das gleichgültig. Hauptsache, sein Mensch war guter Dinge, und das traf an diesem Frühlingstag auf Nellie zu. Der Sonnenschein, der das kleine Stück Regenwald, durch das der Weg anfänglich führte, wie ein Märchenland wirken ließ, indem er die Flechten und Farne unwirklich beleuchtete, trug dazu bei.
Noch mehr erfreute sich Nellie jedoch an den Pferden auf den Weiden hinter dem Waldstück. Das Gras war gewachsen, und die ersten Stuten hatten abgefohlt. Mit den wärmenden Sonnenstrahlen hatten die von Gerstorfs, die Besitzer des Gestüts, sie herausgelassen, und nun fraßen edle Voll- und Warmblutstuten gierig das frische Gras, während ihre langbeinigen Kinder neugierig zu ihr herüberblickten. Nellie versuchte, die Stuten zu erkennen – sie kannte praktisch jedes Pferd auf Epona Station – und zu erraten, von welchem der prachtvollen Hengste die Fohlen stammten. Auf den Weg musste sie nicht sonderlich achten. Er war ihr mehr als vertraut, schließlich war sie ihn Hunderte von Malen gefahren, als sie nach ihrer Auswanderung nach Neuseeland zunächst hier gewohnt und eine Tierarztpraxis in New Lynn betrieben hatte. Inzwischen lebte sie in Ellerslie in einer Villa am Rande der Pferderennbahn, der ihr Mann Walter als Rennbahnleiter vorstand. Sie betreute die Rennpferde tierärztlich, nach Epona Station kam sie nur noch als Besucherin. April von Gerstorf hatte einige Jahre zuvor den jungen Tierarzt Alex Rawlings geheiratet – es gab also einen Veterinär vor Ort. Am Tag zuvor hatte Alex Nellie allerdings angerufen und um eine zweite Meinung zu zwei Pferden des Gestüts gebeten, und nun freute sie sich darauf, ihre Freunde wiederzusehen.
Ihr erster Blick beim Erreichen der Anlage fiel auf den gepflegten Dressurplatz, auf dem Julius von Gerstorf eben eine junge Reiterin und einen Reiter unterrichtete. Julius war nicht mehr jung, doch er hielt sich aufrecht und gerade wie der preußische Offizier, der er einst gewesen war. Er hatte das Militärreitinstitut Hannover besucht und gab das dort Gelernte nun an seine Enkel weiter. Auf einer eleganten schwarzen Stute erkannte Nellie Aprils Adoptivtochter Henny, eine zierliche Fast-Dreizehnjährige, die ihr langes, schwarzes Haar zum Reiten zu einem Zopf geflochten hatte. Wehende Locken waren auf dem Reitplatz nicht erwünscht. Nellie betrachtete Henny liebevoll – sie war ihre Enkelin, das leibliche Kind ihrer Tochter Grit, die sich selbst nie sonderlich für Pferde und das Reiten interessiert hatte.
Henny saß vorbildlich aufrecht und entspannt auf der jungen Stute Melora und führte die Zügel mit sanfter Hand – ein schöner Anblick. Der Reiter, er musste dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein, fesselte Nellies Blick ebenso. Sie hatte ihn lange nicht gesehen, doch auch wenn sie nicht gewusst hätte, dass es sich um Julius’ und Mia von Gerstorfs Enkelsohn Noah handelte, wäre ihr die Ähnlichkeit mit Julius aufgefallen. Auch Noah hatte dunkelblondes Haar, wobei sich in das von Julius schon sehr viel Weiß mischte, und ein klar geschnittenes Gesicht. Noah war groß und kräftig, und er ritt mit selbstverständlicher Leichtigkeit. Genauso hatte Julius von Gerstorf einst auf dem Pferd gesessen und ebenso Walter von Prednitz, Nellies Ehemann. Auch Walter war Offizier gewesen und hatte im Ersten Weltkrieg gedient.
Noah war das Kind von Julius’ und Mias Sohn Jonathan, der in Australien lebte und mit dem Noah wenig gemeinsam hatte. Als Junge war Jonathan ein verträumter Bücherwurm gewesen, der sich weit mehr an seinem Großvater, einem hochgebildeten Kommerzienrat und Privatbankier, orientiert hatte als an seinen eher praktisch veranlagten Eltern. Julius hatte das sehr getroffen, er hatte sich einen Nachfolger für die Gestütsleitung gewünscht, doch Jonathan war vor den Pferden geflohen, wann immer es ihm möglich gewesen war. Mit dem Erbe seines Großvaters war er schon sehr jung nach Australien gegangen, hatte sich an der Bank seines Großonkels beteiligt und war dort offenbar glücklich. Seiner Ehe mit einer Großkusine waren zwei Söhne entsprossen, von denen der ältere, Ira, ganz nach seinem Vater schlug, während Noah nie etwas anderes gewollt hatte, als zu reiten. Nach vielen Auseinandersetzungen mit seinen Eltern war er schließlich mit dem Segen seiner Familie nach Epona Station gekommen. Er besuchte die Highschool in Auckland und studierte die Reitkunst, statt wie sein etwas älterer Bruder Ira ein Universitätsstudium anzustreben.
Nellie winkte kurz zu Julius und seinen Schülern hinüber, die kaum Notiz von ihr nahmen. Schließlich war er ein strenger Lehrer und verlangte völlige Konzentration auf die Pferde.
Sie fuhr also weiter, am Haus vorbei zu den Ställen, wo sie April vermutete. Tatsächlich war sie am Anbindeplatz mit einem Shetlandpony und ihrem kleinen Sohn beschäftigt. Nicholas war gerade erst sechs Jahre alt geworden, doch er putzte schon eifrig sein Fuchspony und machte Anstalten, ihm sogar die Hufe zu heben. Das Pferdchen – es war kaum größer als Jamie, der Wolfshundmischling – hielt dabei engelhaft still. April schob ihm ab und zu eine Möhre ins Maul.
»Nellie!« April, eine kleine schlanke Frau in Reithosen und Stiefeln, strahlte und umarmte Nellie zur Begrüßung. Jamie versuchte, an ihr hochzuspringen, was Nellie ihm verbot. April beugte sich zu ihm hinunter und streichelte ihn. »Was haben wir uns lange nicht gesehen! Aber nun beginnt ja die Rennsaison, dann kommen wir öfter nach Ellerslie.«
Nellie nickte und begrüßte nun auch Nicholas. Der kleine Kerl hatte Aprils rotes Haar geerbt und sah mit seinen wirren Locken aus wie ein niedlicher kleiner Kobold. Seine Gesichtszüge erinnerten allerdings eher an seinen Vater Alex und dessen Mutter Wilhelmina, eine sehr schöne Frau. Er würde einmal ein gutaussehender Mann werden.
»Da will aber jemand ein Reiter werden!«, bemerkte Nellie und lächelte anerkennend, als sie Nicholas’ Bemühungen, den dicken Schweif seines Ponys zu bürsten, sah.
April nickte stolz. »Ja. Manchmal scheint es tatsächlich eine Generation zu überspringen, wie Mami immer sagt«, sie wies mit dem Kinn in Richtung Reitplatz. »Aber wir haben wohl Glück mit unseren Kindern. Sofern man es als Glück bezeichnen kann, wenn ein Mensch nur Pferde im Kopf hat. Manche sehen das wohl anders … Was ist mit deinen Jungs? Kommen die noch oft zum Reiten?«
Bis sie die Schule beendet und ein Studium begonnen hatten, hatten Nellies Söhne Peter und Martin Pferde aus Epona Station auf Turnieren vorgestellt.
Nellie schüttelte den Kopf. »Viel zu selten. Peter geht ganz im Ingenieurswesen auf, und Marty will nächstes Jahr nach Europa. Ich kann das verstehen. Wer Sprachen studiert hat, will die Länder kennenlernen, in denen sie gesprochen werden.«
April lächelte. »Auch in Europa gibt es Pferde …«
»Sie reden bloß nicht so viel.« Nellie lachte. »Ich glaube, er denkt mehr an Mädchen.«
»Ich will jetzt reiten …«, quengelte Nicholas. »Jetzt ist doch Stunde!«
April hatte seinen kleinen Wallach inzwischen gesattelt und hob die Schultern. »Du hörst es, er möchte an der Reitstunde teilnehmen«, sagte sie. »Das ist ihm ganz wichtig, obwohl er dazu noch zu klein ist. Wir gehen aber auf den kleinen Platz neben dem Viereck, und manchmal ruft Pa ihm ein Kommando zu. Dann ist er immer ganz stolz.«
Sie führte das Pony zum Reitviereck, neben dem ein kleinerer Sandplatz zum Warmreiten der Pferde zur Verfügung stand. Jamie folgte ihnen und legte sich am Reitplatzrand nieder. Nellie lobte ihn, und April strich ihm über den Kopf.
Während sie ihrem Sohn aufs Pferd half, schaute Nellie zu den Reitern hinüber. Julius kritisierte eben Hennys Ausführung einer Übung, und das Mädchen beherrschte sich eisern, weder zu widersprechen noch zu weinen. Nellie wunderte das. Sie kannte Henny nicht derart empfindlich.
April bemerkte die Szene ebenfalls. »Henny hat zurzeit ein bisschen nah am Wasser gebaut«, bemerkte sie. »Und sie explodiert bei jeder Gelegenheit. Mami meint, das sei das Alter …«
»Und was meinst du?«, fragte Nellie.
»Gerade sitzen, Absätze tief, Kopf hoch!«, forderte April Nicholas auf, der sich um einen lehrbuchgerechten Sitz im Sattel bemühte. Dann beantwortete sie Nellies Frage. »Ich denke, es liegt an Noah. Sie findet, Pa zieht ihn vor.«
Nellie runzelte die Stirn. »Meinst du? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Mit euch war er immer streng, aber gerecht.«
Sie hatte vielen Reitstunden zugesehen, die Julius April, ihrem Halbbruder Jonathan und ihren eigenen Söhnen gegeben hatte.
»Mir ist da auch nichts aufgefallen«, pflichtete April ihr bei. »Vielleicht widmet er ihm ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, schließlich unterrichtet er ihn erst seit ein paar Wochen. Er muss ihm noch viel erklären, während er Henny zwiebelt, seit sie sieben oder acht ist. Wenn sie Fehler macht, obwohl sie es besser wissen sollte, rügt er sie …«
»Kann es sein, dass sie … eifersüchtig ist?«, fragte Nellie.
April seufzte. »Henny versteht durchaus, dass sich die Situation mit Noahs Ankunft hier geändert hat, sie redet davon, das Gestüt zu erben und zu leiten, seit sie ein kleines Mädchen ist. Julius hat sie oft genug seine Nachfolgerin genannt. Scherzhaft natürlich, Nicholas ist ja auch noch da, und erst mal sind Alex und ich an der Reihe. Bis Henny in eine leitende Position kommen könnte, kann sie sich noch zehnmal anders orientieren. Aber Noah … ist eben blutsverwandt mit Julius …«
April war zwar ein eheliches Kind der von Gerstorfs, doch ihr Erzeuger war ein englischer Offizier gewesen, der ihre Mutter im Ersten Weltkrieg vergewaltigt hatte. Lange Zeit hatte das keine Rolle gespielt, Jonathan war schließlich eher eine Enttäuschung für Julius gewesen – doch Nellie verstand schon, dass er nun große Freude an einem leiblichen Enkel hatte, der ihm obendrein ähnelte und seine Interessen teilte.
»Wie ist er denn so?«, erkundigte sie sich. »Also Noah …«
April lobte ihren kleinen Sohn, der sein Pony schon ganz selbstständig über den Platz lenkte. »Nett«, sagte sie dann. »Gut erzogen, sehr höflich, ungemein glücklich, dass er hier sein kann. Er gibt Henny nicht den geringsten Grund, ihn nicht zu mögen, aber sie ist ihm gegenüber so grantig, dass es schon an Beleidigung grenzt. Zum Rest der Welt ist sie auch grantig. Mami hat wohl recht mit dem schwierigen Alter.«
»Soll ich mal mit ihr reden?«, fragte Nellie. Sie war stets sehr vorsichtig, April sollte nicht glauben, dass sie sich in Hennys Erziehung einmischen wollte. Ganz zu Anfang, als sie noch gehofft hatte, ihre Tochter Grit könnte sich vielleicht für die Kleine erwärmen, war es ihr nicht immer recht gewesen, dass April sich so viel um das Kind gekümmert hatte. Sie selbst – und auch Aprils Mutter Mia – hatten geglaubt, dass April es Grit zu leicht machte, sich ihrer Verantwortung für das Kind zu entziehen. Grit hatte jedoch nie Interesse an Henny gezeigt, und als sie wieder begonnen hatte, als Konzertpianistin aufzutreten und ihre Karriere erfolgreich fortzusetzen, hatte sie einer Adoption durch April und Alex geradezu erleichtert zugestimmt. April hätte ihr natürlich zugestanden, Henny jederzeit zu besuchen und an ihrem Leben teilzuhaben, aber Grit schickte allenfalls eine Postkarte, wenn ihr gerade mal wieder einfiel, dass sie eine Tochter hatte.
»Bitte, gern«, meinte April. »Vielleicht hört sie ja auf dich. Wir sind im Moment nur ein rotes Tuch für sie … Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in dem Alter so schwierig gewesen wäre.«
Nellie, die sich an die dreizehnjährige April noch gut erinnern konnte, musste lachen. »Dazu hätte ich einiges anzumerken«, meinte sie. »Aber vielleicht gucke ich mir erst mal die Pferde an, die Alex mir zeigen wollte. Eine eventuelle Zwillingsträchtigkeit? Und eine ungewöhnliche Lahmheit?« Nach ein paar weiteren Minuten, in denen Nicholas auf seinem Pony auch einmal traben durfte, beendete April die Reitstunde mit ihrem Jüngsten und zeigte Nellie die beiden Patienten. Die Tastuntersuchung der hübschen Stute Elvira fiel zur Erleichterung der Frauen erfreulich aus: Nellie konnte nur ein Fohlen erspüren, was gut war, denn Zwillinge stellten bei Pferden fast immer ein Problem dar. Was die Lahmheit des jungen Hengstes Eagle betraf, konnte sie Alex nicht weiterhelfen. »Ihr müsst ihn auf die Rennbahn bringen, da kann ich ihn röntgen«, riet sie.
Ein Röntgengerät für Pferde war ihre letzte Neuerwerbung für ihre Praxis auf der Rennbahn, und sie war sehr stolz darauf. Transportabel war das Gerät allerdings nicht.
Als sie mit beiden Patienten fertig war, beendete Julius gerade die Reitstunde. Er besprach noch etwas mit Noah, während Henny ihr Pferd bereits in den Stall führte.
»Dann versuch ich mal mein Glück«, meinte Nellie, stellte ihre Tasche ins Auto und folgte ihrer Enkelin. »Würde mich nicht wundern, wenn sie eine Schulter zum Ausweinen sucht.«
Tatsächlich fand sie Henny schluchzend im Stall. Sie hatte ihrem Pferd die Arme um den Hals geschlungen und weinte in Meloras Mähne. Die Stute war nicht mal abgesattelt, sie musste wirklich in Tränen ausgebrochen sein, sobald sie außer Sicht von Julius und Noah gewesen war. Ihr wuschelhaariger, uralter Mischlingshund Flokati, der während der Reitstunde brav neben dem Platz auf sie gewartet hatte, winselte mit.
»Ach, Henny …«, sagte Nellie und strich ihr übers Haar. »Ist die Welt so schlecht?«
Henny wandte sich um, und über ihr verweintes Gesicht zog ein Anflug von Wut. »Die Welt nicht, aber Opa Julius! Er ist so gemein! Immer heißt es nur noch Noah, Noah, Noah. Nicholas existiert gar nicht mehr für ihn, und auf mir hackt er dauernd rum.«
Nellie beschloss, das nicht zu kommentieren, sondern zog das Mädchen nur an sich. Auch ihr war aufgefallen, dass Julius Nicholas auf dem Reitplatz neben der Bahn nicht beachtet hatte, obwohl er doch wusste, dass der Kleine sich über seine Korrekturen freute. Nun konnte das tausend Gründe haben, wahrscheinlich hatte er sich nur sehr auf seine Schüler konzentriert.
»Und Mami sagt, das stimmt gar nicht, aber ich lüge doch nicht, ich …« Henny schluchzte an Nellies Schulter weiter. »Glaubst du mir wenigstens?«, fragte sie hoffnungsvoll.
»Ich glaube nicht, dass du lügst«, erklärte Nellie. »Manchmal versteht man Dinge nur einfach falsch. Noah ist noch Anfänger, da muss Opa sich mehr kümmern. Vielleicht sollte er euch nicht zusammen unterrichten.«
»Noah kriegt außerdem immer die besten Pferde. Mit Early Bird würde ich auch nichts falsch machen, ich …«
Early Bird war ein hervorragend ausgebildetes Pferd, Melora dagegen war noch jung und brauchte selbst Ausbildung. Ein halbes Jahr zuvor war Henny noch stolz darauf gewesen, dass Julius sie ihr anvertraut hatte …
Möglicherweise erinnerte sie sich jetzt daran, denn sie sprach nicht weiter, als Nellie auch zu dieser Anschuldigung nichts sagte, sondern wechselte kurzerhand das Thema.
»Wie ist sie eigentlich so, Grandma Nellie? Also Grit, meine ich. Meine richtige Mutter …«
»Deine leibliche Mutter«, berichtigte Nellie. »Und sie ist ein wundervoller Mensch, sehr begabt, sehr mutig und hübsch. Du siehst ihr allerdings nicht ähnlich, du kommst wohl mehr nach deinem Vater. Na ja, du hast Grit ja auf Fotos gesehen. Aber sie ist völlig anders als du und ich. Ich glaube nicht, dass du bei ihr glücklicher wärest als hier.«
»Wie willst du das wissen?«, fragte Henny und löste jetzt endlich den Sattelgurt. »Weil sie nicht reitet? Also ich verliere auch langsam die Lust drauf …«
Nellie musste lachen. »Davon wirst du aber nicht musikalischer, Henny. Du hast immer geschrien, wenn Grit auf dem Klavier spielte. Und hast du dir mal die Schallplatten angehört, die sie uns manchmal schickt?«
Henny biss sich auf die Lippen. Tatsächlich konnte sie mit klassischer Musik nicht das Geringste anfangen.
»Grit ist mehr wie ihr Vater Philipp, mein erster Mann«, sprach Nellie weiter. Es war seltsam, dieses Gespräch mit ihrer Enkelin erst jetzt zu führen. Sie hatte eigentlich damit gerechnet, dass Henny viel früher nach ihrer Mutter fragen würde. »Für beide steht die Musik an allererster Stelle. Er ist Geiger, sie ist Pianistin, und ihrer Musik ist alles andere untergeordnet …«
»Wie bei uns den Pferden«, bemerkte Henny.
Nellie lächelte. »So ähnlich. Pferde sind auch eine Leidenschaft, eine, die Oma Mia und Opa Julius und April und Alex und ich teilen. Und Noah und du …«
Henny begann erneut zu schluchzen. »Und jetzt kriegt Noah sie alle, alle Pferde von Epona Station«, sagte sie. »Opa Julius hat ihn lieber als mich und Nicholas. Weil er sein richtiger Enkel ist … Nicholas ist immerhin Oma Mias Enkel. Nur ich … ich bin gar nichts …«
Nellie hielt das unglückliche Mädchen im Arm, bis es sich beruhigte. Es gab nichts, was sie sonst für Henny hätte tun können, sie würde auf keinen Trost hören, den sie ihr bieten konnte. Dabei war Nellie überzeugt davon, dass Mia und Julius das Mädchen liebten, und April und Alex erst recht. Sie hatten nie einen Unterschied zwischen ihrer Adoptivtochter und ihrem Sohn gemacht. Aber Henny sah zurzeit alles nur schwarz.
Schließlich war es Melora, der es gelang, Henny wieder zum Lächeln zu bringen. Die Stute blies sanft in ihr Haar, nahm dann ihren Zopf zwischen die Lippen und zupfte daran, als wollte sie Henny an ihre Anwesenheit erinnern. Auch Jamie stupste das Mädchen jetzt an. Er war Nellie hinterhergelaufen. Henny streichelte ihn, sattelte Melora ab und gab ihr endlich ihren nach der Reitstunde wohlverdienten Apfel.
Nellie küsste ihre Enkelin auf die Stirn. »Die Tiere wissen, wer du bist«, sagte sie sanft. »Und ich weiß es auch. Nur du weißt es noch nicht so genau. Aber das wird sich ändern, Henny. Es braucht nur seine Zeit.«
KAPITEL 2
Das Gespräch mit ihrer Enkelin ließ Nellie lange nicht los, es beschäftigte sie auch noch, als sie sich am Abend mit einer tiermedizinischen Fachzeitschrift und einem Glas Rotwein auf dem Sofa entspannte. Sie legte das Blatt beiseite, als sie ihren Mann Walter nach Hause kommen hörte. Er hatte eine Besprechung mit den Trainern der Rennpferde hinter sich und danach sicher noch im Stall nach dem Rechten gesehen. Als er schließlich ins Wohnzimmer kam, war sein dunkles Haar feucht – draußen schien es mal wieder zu regnen. Seine freundlichen blauen Augen leuchteten auf, als er Nellie entdeckte.
»Du bist ja schon da«, sagte er erfreut. »Wolltest du nicht zu den von Gerstorfs?«
Nellie nickte und erzählte von Henny.
Walter, der pubertäre Nöte von Mädchen grundsätzlich nicht ernst nahm – er hatte lange genug als Reitlehrer gearbeitet, um sich nur zu gut auszukennen –, lachte. »Vielleicht sollte sie darüber nachdenken, Noah zu heiraten. Wäre doch eine großartige Verbindung. Jedenfalls, was das Gestüt angeht.«
Nellie verzog das Gesicht. »Wenn du eine Explosion willst, kannst du ihr das ja mal vorschlagen«, bemerkte sie. »Sie kann ihn nicht ausstehen. Und er würde vielleicht auch gern dazu gehört werden.«
Walter ließ sich in einen Sessel fallen und nahm einen Schluck von ihrem Wein. »Was sollte er dagegen haben? Sie ist doch ein bildschönes, kluges Mädchen, nur noch etwas unreif. Ich finde, sie sieht dir deutlich ähnlicher als ihrer Mutter. Abgesehen von dem schwarzen Haar natürlich. Sie wird unwiderstehlich sein, wenn sie erwachsen ist.« Er lächelte ihr zu.
»Du findest mich also unwiderstehlich?«, fragte Nellie geschmeichelt. »Ich bin über sechzig! Und Henny ähnelt doch wohl eher ihrem Vater, oder?«
Im Gegensatz zu ihr hatte Walter Leonidas Fotakis persönlich gekannt.
Walter wechselte aufs Sofa und legte den Arm um sie. »Für mich bleibst du die Allerschönste. Und Henny … Ja, sie wächst sich zweifellos zum Typ griechische Göttin aus. Aber das Näschen …«, er tippte auf Nellies kleine, mit Sommersprossen übersäte Nase, »… hat sie zweifellos von dir. Und die schönen hellbraunen Augen. Leonidas’ waren dunkler. Von Grietje und Philipp hat sie eigentlich nur die Locken, wobei ich rotgoldenes, glattes Haar sehr viel schöner finde.« Er fuhr über Nellies praktische, kinnlange Frisur. Sie erhielt die rotblonde Tönung, indem sie ihr Haar regelmäßig färben ließ.
Nellie lachte. »Du bist ein Charmeur, Walter von Prednitz! Aber ich höre das gern … Zurück zu Henny. Hab ich erzählt, dass sie mich über Grietje ausgefragt hat?« Nellie und Walter waren die Einzigen, die Grit, Nellies Tochter aus ihrer Beziehung mit Philipp De Groot, noch Grietje nannten. Das Mädchen – nach seiner Großmutter auf den Namen Margarete getauft – wollte Grit gerufen werden, seit es mit seinem Vater nach Amerika gezogen war. »Henny hat vorher noch nie nach ihrer Mutter gefragt. Und ich dummes Ding musste ihr dann gleich ihren Mangel an Musikalität vorwerfen. Wo sie im Moment doch sowieso glaubt, dass sie zu nichts nütze ist.«
»Besser, als wenn sie jetzt plötzlich versuchen würde, Klavierspielen zu lernen«, meinte Walter. »Zumindest für die Ohren von Julius und Mia. April ist ja wohl genauso unmusikalisch wie Henny, und Alex … der hat von Grit und ihrem Geklimper lebenslänglich genug.«
Nellie sah ihn strafend an. »Grit ist eine weltbekannte Konzertpianistin. Sie klimpert nicht …«
Dabei hatte sie in den letzten Monaten, die Grit in Neuseeland verbracht hatte, genauso unter ihren stundenlangen Klavierübungen gelitten wie Walter – und was Alex anging, so war seine einstige Liebe zu Grit über ihrem grenzenlosen Ehrgeiz gestorben. Er hatte sich dann zur allseitigen Zufriedenheit April zugewandt. Walter antwortete denn auch nicht, sondern verzog nur vielsagend das Gesicht.
»Henny wird sich schon wieder beruhigen«, meinte er schließlich. »Und Noah ist ein netter Junge. Ich glaube nicht, dass er sie wissentlich provoziert, im Gegenteil. Warte einfach ab. April und Alex waren in dem Alter auch wie Hund und Katze. Das wird sich schon alles beruhigen. Was hältst du von Abendessen? Oder soll ich mir gleich ein Glas Wein einschenken und dir weiter erzählen, wie schön du bist?«
Nellie schmiegte sich in Walters Arme und vergaß ihre Sorge um Henny unter seinen Küssen. Sie waren beide nicht mehr jung – Walter wurde langsam grau und hatte ein paar Kilo zugenommen, seit er selbst keine Pferde mehr trainierte. Aber trotz vieler stürmischer Jahre führten sie eine glückliche Ehe.
Nellie und Walter lagen im Tiefschlaf, als gegen drei Uhr morgens das Telefon klingelte. Ein Apparat stand immer noch auf Nellies Nachttisch, obwohl sie in den letzten Jahren selten nachts zu einem kranken Tier gerufen wurde. Wenn nicht gerade ein Pferd auf der Rennbahn betroffen war, übernahm Alex Großtiernotfälle in der Region, Kleintiere behandelte Nellies ehemalige Kollegin Justynka, die ihre Praxis in New Lynn übernommen hatte.
Nun tastete Nellie verwirrt nach dem Hörer und murmelte ein unwilliges »Ja?«, woraufhin sie eine hellwache, geschäftsmäßig klingende Stimme vernahm.
»Sie erhalten einen Anruf aus Übersee. Möglicherweise entstehen dadurch zusätzliche Kosten. Wollen Sie ihn annehmen?«
Übersee? Nellies Überraschung wich Besorgnis. Ihre Freunde Maria und Bernhard lebten in Australien – und Grit und ihr Vater befanden sich mit den Bostoner Symphonikern auf Europatournee. Ein Anruf um diese Zeit konnte nichts Gutes bedeuten.
»Ja, selbstverständlich, stellen Sie durch!«, forderte sie ungeduldig und hörte gleich darauf jemanden weinen.
»Mami …« Nellie setzte sich auf, als sie Grits Stimme zwischen zwei Schluchzern vernahm. »Mami …« Grit weinte weiter, sie schien kein weiteres Wort herauszubekommen. Bevor Nellie nachfragen konnte, kam sie dann doch mit ihrer Nachricht heraus. »Mami … Papa … Papa ist tot …«
»Was?« Nellie erschrak bis ins Mark. Philipp … Phipps, wie sie ihn immer genannt hatte, war lediglich zwei Jahre älter als sie selbst. Wie konnte er …?
»Wir … wir hatten Probe … und er spielte sein Solo …« Grit brachte die Worte nur mühsam heraus, immer wieder von einem verzweifelten Weinen unterbrochen. »Und dann …« Sie wimmerte.
»Was war dann, Grietje?«, fragte Nellie. »Gab es einen Unfall?«
»Nein, nein, er …« Grit brach zusammen.
»Mrs. De Groot? Hier ist Vincent …«, hörte sie dann eine gefasste Männerstimme. »Ich weiß nicht, ob Philipp mal von mir gesprochen hat …«
Phipps hatte das tatsächlich, und Nellie hatte sogar ein Bild des jungen Mannes vor Augen. Grit hatte ihr schließlich immer wieder Fotos geschickt, die sie mit anderen Musikern und Freunden zeigten. Vincent Langdon war ein schlanker, etwas verträumt wirkender Mann mit freundlichen Gesichtszügen und glattem, blondem Haar. Er war Cellist bei den Bostoner Symphonikern. Phipps hatte ihn sehr geschätzt und nie die Hoffnung verloren, dass seine Tochter sich ihm irgendwann in Liebe zuwenden würde. Grit war von ihrer Kriegsbeziehung zu Leonidas Fotakis jedoch zu traumatisiert und zu sehr getrieben von ihrer Angst, noch einmal ein Kind zu empfangen und ihre Karriere dann womöglich aufgeben zu müssen, um sich zu einer neuen Verbindung bereit zu fühlen. Phipps hatte das mit großer Sorge betrachtet und diese brieflich oft mit Nellie geteilt.
»Mrs. von Prednitz«, korrigierte sie mechanisch und bejahte dann. »Ich … Grit … vielleicht können Sie …«
Die Nachricht von Phipps’ Tod drang nur langsam zu ihr durch. Sie fühlte Kälte in sich aufsteigen, aber sie konnte es nicht glauben, bevor jemand sie über die Umstände informierte.
»Wo … wo sind Sie überhaupt zurzeit?« Das Unglück musste irgendwo in Europa geschehen sein.
»In Paris«, antwortete Vincent Langdon. »Wir hätten heute Abend in der Oper hier spielen sollen, um elf hatten wir Probe. Und Philipp spielte eben sein Solo, als er plötzlich die Geige sinken ließ, sich ungläubig umsah und dann … einfach zusammenbrach.«
Grit schluchzte hysterisch.
»Er brach zusammen und starb?«, fragte Nellie ungläubig.
»Fast sofort. Wir haben versucht, ihn wiederzubeleben. Es kam auch sehr schnell ein Arzt … Aber es war nichts zu machen. Ein Herzanfall, meinte der Mediziner, oder ein geplatztes A…«
»Aneurysma«, ergänzte Nellie mechanisch.
»Genau«, sagte Vincent. »Er … er hat nicht gelitten, sagt der Arzt. So was geht ganz … ganz schnell.«
Nellie nickte. »Ja«, sagte sie leise. »Und man kann nichts tun …«
Sie hatte Tränen in den Augen. Walter setzte sich auf und versuchte, ihren Worten zu entnehmen, worum es ging.
Grit weinte haltlos. Die Frage, wie sie Phipps’ plötzlichen Tod aufgenommen hatte, stellte sich nicht.
»Was geschieht jetzt?«, fragte Nellie leise. »Grit …«
Vincent räusperte sich. »Die Vorstellung heute Abend wurde abgesagt. Aber die Tournee muss natürlich weitergehen … Philipp … wir sind übereingekommen, dass er nach Boston überführt werden soll. Da hatte er Freunde, seine Anhänger … Es wird ein großes Begräbnis werden …«
Phipps’ Begräbnis interessierte Nellie eher weniger. Wichtiger war, wie es Grit ging. Nach Leonidas’ Tod hatte sie sich schuldig gefühlt und mit Rückzug reagiert. Sie war monatelang nicht sie selbst gewesen, bis Phipps schließlich von einer Tournee zurückkehrt war und sie aus der Melancholie gerissen hatte. Wenn das nun noch einmal passierte …
»Was geschieht mit Grit?«, fragte sie noch einmal. »Ich finde, sie … sie sollte zu mir kommen. Ein paar Wochen Ruhe finden und Abstand …«
In Grits verzweifeltes Weinen im Hintergrund des Gesprächs mischte sich ein trotziges »Nein!«.
»Das hab ich ihr auch vorgeschlagen, Mrs. De Groot«, erklärte Vincent. Nellie verzichtete diesmal darauf, ihren Namen richtigzustellen. »Ich würde sogar versuchen, mich freistellen zu lassen, um sie nach Neuseeland zu begleiten. Doch das möchte sie nicht, sie will …«
»Papa hätte das nicht gutgeheißen«, schluchzte Grit. »Dass ich weglaufe. Er sagte immer, ein Engagement ist eine Verpflichtung … und nun … wenn ich auch noch ausfalle …«
»Grit, das würde jeder verstehen …«
Nellie und Vincent wählten die gleichen Worte, um sie zu beschwichtigen, doch Grit schien sich jetzt zu fassen und wiederholte ihre Entscheidung.
»Ich mache die Tournee bis ans Ende mit!«, hörte Nellie Grit sagen. »Und danach kehre ich nach Boston zurück. Ich … ich werde für Papa sein Werk fortführen, ich …« Sie weinte wieder.
Nellie seufzte. »Geben Sie mir doch bitte meine Tochter, Vincent. Ich denke, sie muss sich jetzt erst mal beruhigen. Morgen sieht vielleicht alles schon anders aus. Wo sind Sie? Noch in der Oper?«
Vincent verneinte. Er hatte Grit in ihr Hotel begleitet und war nun mit ihr in der Suite, die sie mit ihrem Vater geteilt hatte.
»Gut«, sagte Nellie. »Können Sie bei ihr bleiben? Sie sollte jetzt nicht allein sein. Und findet sich in der Reiseapotheke der beiden vielleicht etwas Valium? Oder eine Packung Schlaftabletten? Bei den ständigen Wechseln zwischen verschiedenen Zeitzonen sind Schlafstörungen doch häufig. Wenn ja, lassen Sie ihr einen stark gesüßten Tee bringen, lösen Sie eine Tablette darin auf, und sorgen Sie dafür, dass sie ihn trinkt. Damit sie zur Ruhe kommt.«
Vincent versicherte ihr, dass er in der Suite bleiben und über Grits Schlaf wachen werde. Er machte sich direkt auf die Suche nach einem Beruhigungsmittel und sagte Nellie, dass er tatsächlich fündig geworden sei.
Grit weinte sich schließlich in den Schlaf, während Nellie beruhigende Worte ins Telefon raunte.
Walter war inzwischen aufgestanden und brachte nun auch Nellie einen Tee. Sie nickte ihm dankend zu, als sie das Telefonat beendete.
»Wir sprechen morgen wieder miteinander, Vincent. Vorerst vielen Dank!«
Walter sah sie an. »Phipps?«, fragte er.
Sie nickte.
»Das tut mir leid«, sagte er leise.
»Mir tut es auch leid, so sehr«, flüsterte Nellie und wischte sich die Tränen von den Wangen. »Ich … ich war niemals wirklich seine Frau, aber …«
Walter nahm sie in die Arme. »Nellie, dafür brauchst du dich doch nicht zu entschuldigen. Ich würde dir niemals übelnehmen, dass du um ihn trauerst … Er war der Vater deiner Tochter.«
»Er war vor allem mein Freund«, erwiderte Nellie weinend. »Mein bester Freund, solange ich denken konnte. Und ich verdanke ihm alles … Ohne Phipps …«
Nellie war von Kindheit an entschlossen gewesen, Tierärztin zu werden, doch damals war der Studiengang Frauen noch verwehrt gewesen. Nur indem Phipps sie an seinen Studien teilhaben ließ, konnte sie das nötige Wissen erwerben, Tiere zu behandeln. Erst sehr viel später hatte sie an einer deutschen Universität den Doktortitel erworben.
»Ich weiß«, sagte Walter.
»Es ist so traurig …«, schluchzte Nellie.
Erst nachdem er und Nellie ihre Ehe beendet hatten, war Philipp klar geworden, wie sehr er sie tatsächlich geliebt hatte. Es hatte nie eine andere Frau in seinem Leben gegeben. Außer seiner Tochter Grit.
»Was wird sie ohne ihn machen?«, fragte Walter.
Er richtete die Frage nicht an Nellie, er wusste schließlich, dass sie sich die gleiche stellte. Und er sah unweigerlich Komplikationen auf sich und seine Familie zukommen.
Nellie telefonierte am nächsten Abend noch einmal mit Vincent Langdon. Der Zeitunterschied zwischen Neuseeland und Paris betrug zwölf Stunden, sodass es für ihn der Morgen nach Phipps’ plötzlichem Tod war. Grit, so berichtete er, habe tief geschlafen und sei nun dabei, sich anzuziehen. Sie weine immer wieder und wolle auch nichts essen, doch sie habe darauf bestanden, ihn, den Dirigenten und einen von der Oper gestellten Übersetzer zum Bestattungsinstitut zu begleiten, um das weitere Vorgehen zu besprechen – und danach der Probe beizuwohnen.
»Sie will heute Abend auftreten?«, fragte Nellie fassungslos.
»Unbedingt«, meinte Vincent. »Ich mache mir auch Sorgen, ebenso alle anderen. Sie ist jedoch fest entschlossen. Und es wird natürlich ein Publikumsmagnet. Die Zeitungen hier sind voll mit Geschichten über die Tragödie. Wenn Grit nun gleich wieder auftritt …«
»… und vor Publikum zusammenbricht?«, fragte Nellie verärgert. »Wie könnt ihr das zulassen?«
»Sie ist erwachsen«, sagte Vincent. Er wirkte wie ein gescholtenes Kind.
Nellie entschuldigte sich. Der junge Cellist konnte sicher nichts dafür, Grit würde sich von ihm kaum etwas sagen lassen. Allenfalls der Dirigent hätte ihr den Auftritt verbieten können, und der hatte am Tag zuvor schon das Konzert absagen müssen – er hatte sicher großes Interesse daran, die Veranstalter zufriedenzustellen.
Nellie seufzte. »Sagen Sie mir, wie es war«, bat sie. »Wir bleiben in Verbindung.«
KAPITEL 3
Vincent Langdon liebte Grit De Groot seit Jahren. Gleich als er das Engagement in Boston angetreten hatte, war er von ihr fasziniert gewesen. Ihr Ausdruck bezauberte ihn, die völlige Hingabe an die Musik, wenn sie am Flügel saß, ihre schlanke und doch frauliche Gestalt, das leicht lockige, blonde Haar, das fast unmerklich ins Rötliche spielte und das sie entgegen jedem Modetrend lang trug, nur jeweils eine Strähne rechts und links ihrer Schläfen nach hinten gebunden oder geflochten. Ihre Züge waren weich, durch den Mittelscheitel wirkte ihr Gesicht madonnenhaft. Vincent hätte Stunden damit zubringen können, sie zu betrachten.
Es hatte Tage gebraucht, bis er es gewagt hatte, sie anzusprechen, zumal sie damals schon ein Star gewesen war, ebenso ihr Vater. Die ganze Welt kannte Philipp De Groot. Dann waren sie jedoch über sein Cello ins Gespräch gekommen, wie Philipps Geige ein Meisterstück der berühmten Geigenbauerfamilie Guarneri. Zu Vincents großer Freude hatten beide keine Allüren gezeigt, sondern waren ihm aufgeschlossen und freundlich entgegengetreten.
Anfänglich hatte es sogar so ausgesehen, als könnte Grit seine Zuneigung erwidern. Sie war mehrmals mit ihm ausgegangen, ihr Vater hatte die aufkeimende Beziehung unterstützt. Er hatte Vincent zum gemeinsamen Musizieren eingeladen, die Unterhaltung war lebhaft gewesen – alles hatte vielversprechend ausgesehen, bis Vincent eines Abends versucht hatte, Grit zu küssen. Sie hatte sich ihm sofort entzogen und eine Art Entschuldigung gemurmelt, danach war ihr Verhältnis zusehends abgekühlt. Philipp De Groot hatte sich bemüht zu vermitteln und mit ihm über Grits Kriegserfahrungen auf Kreta gesprochen.
Sie war als Pianistin bei der Truppenbetreuung dort gewesen und hatte sich mit einem griechischen Musiker – Leonidas Fotakis – angefreundet. Am Tag der deutschen Invasion der Insel hatte sie ihn in sein Dorf im Hinterland begleitet und keine Möglichkeit erhalten, zurück zu den Alliierten zu finden, die ihre Künstlerkollegen sofort evakuiert hatten. Später war ihr klar geworden, dass Leonidas sie bewusst zurückgehalten hatte. In der Dorfgemeinschaft, so hatte er argumentiert, sei sie sicherer als im Hauptquartier der Engländer – vor allem hatte er gehofft, ihr Herz zu gewinnen. Grit hatte sich zunächst zwar nicht auf ihn eingelassen, sich jedoch am Partisanenkampf der Kreter beteiligt. In einer Nacht der Schwäche nach einem gefährlichen Einsatz hatte sie aus purem Lebenshunger mit ihm geschlafen und dabei ihre Tochter Helena, genannt Henny, empfangen. Für Leonidas und seine Familie war damit klar gewesen, dass sie ihn heiraten und bleiben würde, doch als sich die Gelegenheit für sie bot, mit einem englischen Kommando zu fliehen, hatte sie ihn verlassen. In derselben Nacht war er bei einem Einsatz erschossen worden. Grit, die sich die Schuld dafür gab, war in eine tiefe Depression gefallen.
»Sie braucht wohl einfach noch etwas Zeit, damit fertigzuwerden«, hatte Philipp erklärt. »Geben Sie nicht so schnell auf, Vincent. Warten Sie, bis sie den Anfang macht.«
Seitdem hatte sich Vincent zurückgehalten, wobei er die Rolle eines Freundes der Familie einnahm. Tatsächlich schien Grit mehr und mehr Vertrauen zu ihm gefasst zu haben – sie hatte ihn nicht mehr gemieden wie in der ersten Zeit nach seinem Versuch, ihr näherzukommen, sondern ihn wieder allein zu Vernissagen oder Konzerten oder zu Besichtigungstouren in Städte begleitet, in denen sie regelmäßig auftraten. Die Beziehung war jedoch platonisch geblieben. Vincent hatte gewartet, mitunter mit dem Gefühl, als stünde die außergewöhnliche Nähe, die zwischen Grit und ihrem Vater geherrscht hatte, ihm zusätzlich im Weg. Die junge Frau hatte sich nicht von ihrem Vater lösen können.
Philipps Tod betrauerte er ehrlich, doch er sah ihn auch als eine Chance, Grit endlich für sich zu gewinnen. Natürlich war es ein schmaler Grat, auf dem er wandelte, um ihr ein Freund zu sein, ohne zu versuchen, ihr den Vater zu ersetzen. Vincent wollte keine Abhängigkeit, er wollte Liebe, also bemühte er sich weiterhin um Geduld und Verständnis.
In den Tagen nach Philipps Tod erwartete er ständig, dass Grit zusammenbrach, während sie sich eisern bemühte, ihre musikalischen Verpflichtungen zu erfüllen. Sie spielte ihre Konzerte, auch wenn ihr dabei oft Tränen die Wangen hinunterliefen, und wenn sie sich anschließend verbeugte, ergriff sie den Blumenstrauß oder Kranz, den das Orchester allabendlich auf den leeren Platz des Ersten Geigers legte, und hielt ihn vor sich wie einen Schild. Im Alltag befand sie sich wie in Trance, ließ sich von Vincent dazu nötigen, Kleinigkeiten zu essen und zu trinken, und tat, als merkte sie es nicht, dass er ihr jeden Abend eine von Philipps Schlaftabletten in einen Schlummertrunk rührte, damit sie in der Nacht zur Ruhe kam.
Nach den Konzerten in Paris standen noch zwei weitere Stationen auf dem Programm der Tournee, Rom und Athen. Vincent hoffte, dass der Aufenthalt in Griechenland sie dazu bringen würde, von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen, doch sie schien gar nicht zu bemerken, wo sie war. Wenn sie nicht probte oder auftrat, verbrachte sie die Zeit in ihrem Hotelzimmer. Vincent hoffte, dass sie es nicht als zu aufdringlich empfand, dass er die Buchung einer Suite für sie und ihren Vater beibehielt, er selbst nächtigte in dem für Philipp vorgesehenen Zimmer. Nach wie vor hatte er Angst, sie länger allein zu lassen.
Schließlich endete die Tournee, und das Orchester flog zurück nach Boston. Philipps Urne war bereits dorthin überführt worden. Die Konzertagentur, die Philipp und Grit jahrelang betreut hatte, kümmerte sich um die Organisation einer Begräbnisfeier. Zu Vincents Überraschung beteiligte Grit sich sehr aktiv an den Planungen, am Musikprogramm und an der Auswahl der Ehrengäste. Es war, als wäre ein letzter Auftritt zu inszenieren – Philipps Stern sollte noch einmal leuchten.
»Werden Sie kommen?«, erkundigte sich Vincent bei Nellie. »Ich … äh … ich glaube, es würde Grit viel bedeuten.«
Tatsächlich glaubte er das nicht. Grit hatte in ihrer ersten Verzweiflung nach Philipps Tod zweimal mit ihrer Mutter telefoniert, doch schon beim zweiten Mal schien sie sich in ihre Blase der einsamen Trauer zurückgezogen zu haben und hatte nur einsilbig auf Nellies Fragen geantwortet. Jetzt erwähnte sie ihre Mutter nicht mehr.
Nellie schien das intuitiv zu erfassen. »Sie hat keine Einladung geschickt«, sagte sie. »Weder an mich allein noch an mich und meine Familie. Ich glaube, wir … wir wären nur Eindringlinge … Sie will in ihrer Welt bleiben, wenn sie sich verabschiedet …«
»Es hätte aber vielleicht Philipp etwas bedeutet, wenn du da sein würdest«, meinte schließlich Wilhelmina Rawlings. »Für ihn warst du wichtig.«
Die Rennsaison hatte begonnen, und Nellie traf die Gestütsbesitzerin in der VIP-Lounge, zwei Wochen nach Philipps Tod. Wilhelmina hatte im Krieg mit Nellie zusammengearbeitet, während sowohl Grit als auch Wilhelminas Sohn Alex auf Kreta vermisst gewesen waren. Mit vereinten Kräften hatten die beiden eine Such- und Rettungsaktion durchgesetzt. Wilhelmina hatte damals Phipps kennengelernt und Einblick in die schwierige Beziehung zwischen ihm und Nellie gewonnen.
Nellie seufzte. »Ach, Willie, es ist kompliziert«, murmelte sie. »Ich will Walter nicht vor den Kopf stoßen, und ich will nicht, dass die Presse sich auf mich stürzt. Über Phipps’ Tod wurde weltweit berichtet, in jeder besseren Zeitung erschienen Nachrufe. Wenn ich da jetzt als seine Witwe auftauche …«
»Du würdest Grit die Schau stehlen«, bemerkte Willie.
Sie hatte immer einen Sinn für Intrigen, Auftritte und Manipulationen gehabt – und sich damit zeitlebens Feinde geschaffen. Immerhin hielt ihr Mann Edward zu ihr. Nach Jahren einer von einem Spiel um Macht und Verachtung geprägten Ehe hatten sie zu einer ruhigen, harmonischen Beziehung gefunden.
Nellie runzelte die Stirn. »Wie meinst du denn das?«, fragte sie unwillig.
»Wie ich es sage«, erklärte Willie offen. »Deine Tochter inszeniert sich als Frau an seiner Seite. Sie allein will Philipps Erbe antreten.«
»Es gibt keinen Streit um sein Erbe«, meinte Nellie. »Sein Vermögen geht an seine Stiftung zur Förderung musikalisch hochbegabter Kinder. Grit erbt nur das Haus in Boston und die Geige, nehme ich an, die ist ja wohl ein paar Millionen Pfund wert. Sonst verdient sie genügend eigenes Geld.«
»Es gibt ein künstlerisches Erbe«, beharrte Willie. »Eine Art Deutungshoheit. Was die Welt über Philipp De Groot erfährt, welches Andenken mit ihm verbunden sein wird, das bestimmt allein deine Tochter Grit. Es wäre ihr nicht recht, wenn du neben ihr am Grab stündest. Vielleicht deine Geschichte von ihm erzählten würdest …«
»Es gibt nichts Schlechtes über ihn zu sagen«, sagte Nellie steif.
Wilhelmina zuckte mit den Schultern. »Dann flieg hin«, meinte sie. »Aber ich sage es dir gleich: Du wirst dich mit diesem Vincent Langdon in der letzten Reihe der Trauergäste wiederfinden.«
Nellie flog nicht nach Boston, sondern ließ lediglich ein großes Blumengebinde zur Trauerfeier schicken. In Freundschaft, Liebe und Dankbarkeit – Cornelia, stand auf dem Trauerflor.
Ihr Plan, eine solche Beschriftung würde das Interesse der Presse nicht wecken, ging auf. Die Berichte über die Beerdigung wurden beherrscht von den Bildern Grits, die ganz allein am Grab stand, Philipps Geige in der Hand. Wie Willie vorausgesagt hatte, duldete sie nicht mal Vincent Langdon in der ersten Reihe.
KAPITEL 4
Daphne Lemberger saß im Zug von Sydney nach Perth und fühlte sich alles andere als wohl. Dabei hätte sie eigentlich jeden Grund gehabt, gut gelaunt zu sein. Schließlich hatte sie wenige Tage zuvor ihre Promotionsurkunde abgeholt und konnte sich nun Doktorin der Veterinärmedizin nennen – da einer ihrer Doktorväter in Sydney lehrte, hatte sie den letzten Schritt der Promotion, die mündliche Prüfung, dort abgelegt. Zudem war sie mit den beiden Männern zusammen, die ihr – von ihrem Vater abgesehen – auf dieser Welt am meisten bedeuteten. Allerdings war die Stimmung zwischen ihrem Zwillingsbruder David und ihrem Freund Stephen Pentecost so angespannt, dass sie kaum noch wusste, auf welches Thema sie das Gespräch bringen sollte. Dabei hatte sie David eben noch erfreut von ihren Zukunftsplänen erzählt. Sie würde gemeinsam mit Stephen in die Vereinigten Staaten gehen und dort im Labor des berühmten Primatenforschers Harry Harlow arbeiten.
»Das Labor in Wisconsin ist extra für Harlows Forschungen angelegt, und wir sind ganz aufgeregt, dass wir dort arbeiten können«, hatte sie begeistert gesagt.
»Du hast Tiermedizin studiert, um Affen zu vergiften und dann zu sezieren?«, hatte David verwirrt gefragt.
Daphne liebte Tiere und hatte eine ebenso besondere Beziehung zu ihnen wie er selbst und ihre Eltern. Auch ihr Vater Bernhard und ihre Mutter Maria waren Tierärzte. Sie leiteten gemeinsam den Zoo in Perth, wo Daphne schwerpunktmäßig studiert hatte.
Sie hatte ihn ausgelacht. »Natürlich nicht! Es geht nicht um Tierversuche zwecks medizinischer Forschung. Es geht um Psychologie, Verhaltensforschung. Harlow arbeitet mit Rhesusäffchen und macht Versuche, um ihre Lernfähigkeit und ihr Erinnerungsvermögen zu testen. Du weißt doch, Primaten sind mein Steckenpferd!«
Daphne hatte bezüglich ihrer Studienwahl von Anfang an ein wenig geschwankt. Einerseits wünschte sie sich, Tierärztin zu sein und in einem Zoo zu arbeiten wie ihre Mutter, andererseits interessierte sie die Entwicklung des Menschen, vor allem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Der Fachbereich der Anthropologie hatte sie deshalb ebenso gereizt, und schließlich hatte sie beides kombiniert. Sie hatte ihre Doktorarbeit über den Aufbau der Gehirne verschiedener Primaten geschrieben – und ihre Professoren damit schockiert, dass sie den Menschen bei der vergleichenden Studie eingeschlossen hatte. Dabei hatte sie größten Wert darauf gelegt, die Binsenweisheit zu widerlegen, das größere Gehirn zeige auch die höchste Leistungsfähigkeit. Während sie an ihrer Promotion gearbeitet und Kurse im Bereich der Anthropologie belegt hatte, war sie durch ihr Interesse und ihre Intelligenz aufgefallen und schließlich als Studentische Hilfskraft für einen bekannten Anthropologen eingestellt worden, der die Gehirne diverser Frühmenschen untersuchte. In ihrer Arbeit hatte sie einige bemerkenswerte Thesen zur Bedeutung verschiedener Hirnareale aufgestellt und diese erfolgreich gegenüber Professoren der Tiermedizin und der Anthropologie verteidigt. Übereinstimmend war sie mit einem Summa cum laude belohnt worden, was sie überaus stolz machte.
»Und wozu braucht Professor Harlow dazu eine Tierärztin?«, hatte sich David erkundigt – nicht provokativ, sondern lediglich freundlich interessiert – und erstaunt registriert, dass Daphne sich bei der Frage auf die Lippen biss.
»Stephen wird bei ihm promovieren«, bemerkte sie, »und ich … Na ja, ich wollte einfach dabei sein. Ich hab mich beworben, und Professor Harlow hat mir den Job einer Laborassistentin angeboten.«
»Er hat was?« Davids Stimme war lauter geworden. Er war an sich ein gelassener, ruhiger Mensch, längst nicht so lebhaft und aufgeschlossen wie seine Schwester. »Daphne, dafür bist du überqualifiziert! Eine Laborassistentin in der Primatenforschung ist mit ziemlicher Sicherheit eine bessere Tierpflegerin!«
Daphne hatte mit ihrer Handtasche gespielt. »Na ja, aber ich hab Tiere doch gern. Und ich möchte mit Stephen zusammen sein.«
»Daphne war bis jetzt auch als Hilfskraft tätig«, hatte Stephen, der sich bis dahin über die Begrüßung hinaus noch nicht geäußert hatte, bemerkt. »In der Anthropologie. Dabei haben wir uns kennengelernt.«
Daphne hatte ihm zugelächelt. »Stephen geht es ganz ähnlich wie mir«, hatte sie erklärt. »Er ist ursprünglich Biologe und hat Anthropologie als Aufbaustudium gewählt. Und jetzt will er die beiden Fachgebiete in seiner Doktorarbeit verbinden.«
David hatte genickt und angemerkt: »Das ist ja auch sehr schön. Für ihn. Und sicher interessant. Aber du bist Tierärztin mit einem Doktortitel. Ich finde es unglaublich, dass dieser Harlow es gewagt hat, dir eine so untergeordnete Stellung anzubieten.«
Daphne hatte ihr dunkles Haar zurückgeworfen. »Komm, David«, hatte sie ihren Bruder zu begütigen versucht. »Ich hab den Job gewollt. Ich freu mich auf die Äffchen …«
Das Leuchten in ihren Augen, wenn sie den Blick über Stephen gleiten ließ, verriet David sofort, dass es mehr die Zusammenarbeit mit ihm war, auf die seine Schwester sich freute, und sicherlich auch das Zusammenleben. Bislang hatte sie keine Heiratsabsichten geäußert, doch sie brachte Stephen Pentecost eindeutig mit zum Sommerfest im Zoo von Perth, um ihn ihrer Familie vorzustellen. David versuchte, die Faszination, die Stephen auf seine Schwester ausübte, nachzuvollziehen, was ihm allerdings nicht gelang. Der junge Mann war zweifellos gutaussehend. Er wirkte sportlich, sein Gesicht war kantig genug, um sehr maskulin zu erscheinen, doch fein geschnitten, und er war ausreichend sensibel, um Frauen anzusprechen. Sein blondes Haar war modisch geschnitten, wie er überhaupt nach neuester Herrenmode gekleidet war. Er trug einen hellen Sommeranzug, der passende Hut dazu lag auf der Ablage. Seine Lippen schienen ständig ein angedeutetes Lächeln zu zeigen – als nähme er die Welt, vor allem sein Gegenüber, nicht sonderlich ernst.
»Was tun Sie denn eigentlich beruflich?«, fragte er jetzt herausfordernd in Davids Richtung.
David wechselte ungern das Thema. »Ich bin Landschaftsarchitekt«, gab er Auskunft. »Mit abgeschlossenem Studium. Allerdings will ich noch einige Praktika ableisten, bevor ich mich selbstständig mache. Ich gedenke, mich auf die Gestaltung von Zoos und Tiergärten zu spezialisieren. Offene, große Gehege, in denen die Tiere sich wohlfühlen und den Menschen das Gefühl geben, sich frei unter ihnen zu bewegen …«
»Dem Tiger sozusagen auf Augenhöhe begegnen?«, spottete Stephen. »Wie soll das gehen?«
David rang sich kein Lächeln ab. Er war ein ernsthafter junger Mann, seiner Mutter Maria ähnlicher als seine lebhaftere Zwillingsschwester Daphne. Sonst hatte er mit ihr jedoch viel gemeinsam. Nicht nur das dunkle Haar, sondern auch die freundlichen blauen Augen und das schmale, herzförmige Gesicht. Dazu dachten sie meist in die gleiche Richtung. Mitunter neigten sie zwar zu spielerischen Kabbeleien, doch ernsthafte Meinungsverschiedenheiten gab es selten zwischen den Dadas, wie ihre Eltern sie liebevoll nannten.
Auch jetzt ließ Daphne keinen Zweifel daran, dass sie die Arbeit ihres Bruders schätzte. »Zum Beispiel, indem man Wassergräben anlegt, statt Zäune zu bauen«, erklärte sie. »Tiger schwimmen im Allgemeinen nicht, ebenso wenig wie Affen.«
»Affen kann man sehr gut auf künstlichen Inseln halten«, fügte David hinzu. »Dann fühlen sie sich nicht eingesperrt. Einen Schimpansen hinter Gitter empfinde ich dagegen als einen traurigen Anblick …«
Stephens Lächeln wurde herablassend. »Ich sehe schon, Sie neigen zum Anthropomorphismus. Dabei dachte ich, das wäre eher eine weibliche Schwäche.« Er streifte Daphne mit einem zärtlich nachlässigen Blick.
»Stephen hat man beigebracht, dass Tiere nicht denken und fühlen«, bemerkte Daphne. »Behaviorismus … Thorndike und Watson vertreten die Theorie, neuerdings Skinner. Jedes Verhalten wird nur mit Reiz und Reaktion erklärt, Gefühle spielen keine Rolle. Tiere, so glaubt er, hätten gar keine. Ich denke, Kali und Lakshmi werden ihn gleich vom Gegenteil überzeugen …« Beim Gedanken an ihre Elefanten leuchteten ihre Augen fast so sehr auf wie beim Blick auf Stephen.
»Sie können auch gern meine Tiger kennenlernen«, fügte David hinzu, jetzt seinerseits etwas spöttisch. »Und meine Katzen. Mit Tigern auf Augenhöhe haben Sie ja wohl Ihre Schwierigkeiten.«
»David hat Katzen dressiert, als er noch ein Junge war«, erzählte Daphne. »Und ich hab Elefanten vorgeführt und behauptet, ich sei eine indische Prinzessin. Unsere Eltern haben einige Zeit als Zirkustierärzte gearbeitet, bevor sie die Leitung des Zoos in Perth übernahmen. Unsere Mutter ist Spezialistin für Exoten. Und sehr talentiert dafür, sich in Tiere hineinzuversetzen. Für uns ist es ganz normal, dass sie denken und fühlen.«
Stephen lächelte jetzt wieder verbindlicher. »Es steht außer Frage, dass man sie dressieren kann«, erklärte er. »Mit Futter oder mit Schlägen, Reiz und Reaktion. Letztlich kommt es immer aufs Gleiche raus. Aber ich sehe mir deine Elefanten natürlich gern an, Daphne, und Ihre Tiger, David, sofern die nicht gerade hungrig sind. Auf den Stimulus ›Hunger‹ kann nämlich durchaus die Reaktion ›Überspringen eines Wassergrabens‹ folgen.«
David suchte kurz den etwas verschämten Blick seiner Schwester. Dann wechselte er das Thema. Bei ihm hatte Stephen Pentecost nicht punkten können – und er glaubte auch nicht, dass seine Eltern begeistert von Daphnes Wahl sein würden.
Bernhard Lemberger holte seine Kinder und Stephen vom Bahnhof ab. Er war in Denim-Hosen und offenem Hemd, also leger, gekleidet – schließlich hatte er die Arbeit im Zoo nur kurz unterbrochen und sich dafür nicht umziehen wollen. Einen Tag vor dem Sommerfest gab es viel zu tun, und er war sich nicht zu schade dazu, selbst mit anzupacken. Bernhard war für die geschäftlichen Belange des Zoos zuständig, wozu auch gehörte, Werbeveranstaltungen wie Tage der offenen Tür zu planen. Er tat das gern, war Menschen und Tieren gleichermaßen zugewandt und sehr beliebt bei den Angestellten.
Maria, seiner Frau, lag der Umgang mit Menschen weniger. Sie war hochintelligent, hatte jedoch Probleme, das Gefühlsleben anderer einzuschätzen, ihre Mienen zu deuten oder bei ihren Äußerungen zwischen den Zeilen zu lesen. Metaphern waren ihr ebenso fremd wie Ironie. Für Tiere hatte sie dagegen eine Art sechsten Sinn. Ob es eine Giftschlange war oder ein Kragenbär – Maria versuchte zu erspüren, was sie dachten und fühlten. Ihre Freundin Nellie hatte sie einmal eher scherzhaft gefragt, ob sie das je mit Männern versucht habe, es würde einer Frau doch einiges ersparen, wenn sie ihre Gedanken und Gefühle erraten könnte. Menschen zu berühren, wie sie es nannte, war Maria aber zu anstrengend und zu belastend. »Menschen denken zu laut«, war ihre Erklärung dafür, dass sie sich nicht gern mit zu vielen in einem Raum aufhielt und ihr Schlafzimmer nur mit einigen wenigen Vertrauten teilen konnte. Sie berührte Menschen auch ungern körperlich. Bernhard hatte damit nicht die geringsten Schwierigkeiten. Er umarmte die Zwillinge zur Begrüßung und lachte über das ganze Gesicht. Seine blonden Locken hätten eines Haarschnitts bedurft. Bei all der Arbeit mit den Festvorbereitungen war er wohl nicht zum Friseur gekommen.
Stephen musterte ihn etwas befremdet. Daphne erwiderte seine Umarmung herzlich, David eher etwas ungelenk.
»Papa, darf ich dir Stephen Pentecost vorstellen?«, fragte Daphne nach der Begrüßung förmlich. »Er ist mein Freund. Wir werden gemeinsam in Amerika arbeiten.«
Bernhards Miene umwölkte sich bei der Erwähnung von Daphnes Arbeit in Amerika.
»In diesem Forschungslabor, nicht?«, fragte er dennoch freundlich und gab Stephen die Hand. »Professor Harlow hat ja einen hervorragenden Ruf, allerdings fragen meine Frau und ich uns schon, weshalb er da eine Tierärztin braucht. Nun ja, darüber können wir später noch reden. Jetzt kommen Sie erst mal mit, Stephen, ich muss zurück in den Zoo. Wir sind noch nicht mal ganz mit dem Programm fertig. Kannst du Kali und Lakshmi vielleicht überreden, ein paar Kinder durch den Zoo zu tragen, Daphne? Ihr Pfleger ist sich da nicht so sicher. Eure Mutter sagt, sie nehmen ihn nicht ernst.«
Daphne lachte vergnügt. »Aber ja, Papa! Hättest du nur früher was gesagt, hätte ich einen Sari besorgt. So eine indische Prinzessin …«
»… trägt die Haare nicht so kurz«, neckte Bernhard sie und wies auf Daphnes etwas verwegen wirkenden Haarschnitt. »Steht dir aber gut, Süße. Du brauchst sicher keine Verkleidung, um Herzen zu brechen.«
Er zwinkerte Stephen zu, der seltsam betreten blickte. Ihm war anzusehen, dass er die Familie seiner Freundin befremdlich fand. Beim Anblick des alten Land Rover mit dem Aufdruck ZOO OF PERTH, in dem Bernhard gekommen war, verstärkte sich das noch. Auf der Ladefläche türmten sich Transportkäfige, aber auch Girlanden, die als Festschmuck dienen sollten, und im Inneren roch es streng. Das Auto diente auch mal zum Transport von Tieren.
»Sind sonst alle in Ordnung?«, fragte David. »Sally …«
»Sie ist immer noch trächtig und wird bald ein reizendes Baby zur Welt bringen.« Bernhard lächelte. »Oder zwei. Deine Katzen hat Maria allerdings kastriert. So nett sie sind, wir befürchteten eine Bevölkerungsexplosion. Sie schleichen übrigens schon den ganzen Tag um das Haus herum, als ob sie ahnen würden, dass du kommst.«
KAPITEL 5
Die Lembergers lebten in einem repräsentativen, nicht allzu großen Haus auf dem Gelände des Zoos. Es war schon für den Gründer des Tiergartens gebaut worden und besaß den Charme viktorianischer Gebäude. Die Auffahrt war großzügig gestaltet, Bernhard parkte das Auto vor dem Eingang und wollte seine Mitfahrer eigentlich nur hinauslassen, um sich dann wieder seinen Pflichten zu widmen.
Da hatte er allerdings nicht mit Daphne gerechnet. Während David bereitwillig ausstieg und gleich von einer roten und einer schwarzen Katze begrüßt wurde, die anscheinend wirklich auf ihn gewartet hatten, konnte Daphne sich nicht gedulden, in den Zoo zu kommen.
Bernhard sah sie prüfend an. »Ich weiß nicht, Liebes. Bist du dafür denn angezogen?«
Daphne trug eine helle Leinenhose und eine bunte Sommerbluse. Sie hatte sich für die Reise mit Stephen ganz klar hübsch gemacht – während David sich in einfachen Denim-Hosen und verwaschenem Hemd auf den Weg gemacht hatte. Genau die richtige Kleidung, um sich auf die Treppe vor dem Eingang zu setzen und die Suche seiner Katzen nach Nähe zu genießen. Inzwischen waren zwei schwarz-weiß gescheckte aufgetaucht, und auch sie schnurrten und maunzten und konnten David gar nicht nah genug kommen.
»Insgesamt sind es sechs«, verriet Daphne ihrem Freund und wandte sich dann unbekümmert an ihren Vater. »Im Elefantenhaus findet sich bestimmt ein Overall«, meinte sie. »Oder zwei …« Sie blickte auf Stephens hellen Sommeranzug. »Du hast doch Lust, mitzukommen, oder?«, fragte sie Stephen.
»Entscheidet euch!«, drängte Bernhard. »Mama ist auch im Zoo. Also wenn Sie mitkommen, Stephen, können Sie gleich meine Frau kennenlernen.«
Stephen konnte natürlich nicht Nein sagen. Er blieb also neben Daphne sitzen und ließ sich durch die Anlagen des Zoos kutschieren. Sie waren, gerade jetzt im Frühsommer, wunderschön und gepflegt – die Gehege der Tiere eingebettet in Parkanlagen, die einem Botanischen Garten glichen.
»Wir haben hier schon einiges umgebaut«, erklärte Bernhard. »Auf Davids Ratschläge hin, der hat schon als Kind Bücher über die Gestaltung von Zoos verschlungen. Carl Hagenbeck hat in Hamburg Maßstäbe gesetzt, was die Tierhaltung angeht. Schauen Sie, hier ist unsere Affeninsel!«
Er wies auf eine von einem Wassergraben umgebene und einem künstlichen Felsen beherrschte Insel, auf der sich eine Gruppe von Pavianen tummelte. Es gab Höhlen als Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere, Klettermöglichkeiten, Büsche und Bäume.
»Hat Harlow nicht auch mal mit Pavianen gearbeitet?«, fragte Daphne ihren Freund.
Stephen nickte. »Ja, in seinem ersten Labor, noch in den Dreißigerjahren. Da haben sie alle Affen genommen, derer sie habhaft werden konnten. Die Paviane waren jedoch nicht sehr brauchbar. Teilweise haben sie sich auf einen Pfleger fixiert und wollten mit den Forschern nichts zu tun haben. Ihre kognitiven Fähigkeiten scheinen zudem sehr begrenzt …«
Bernhard runzelte die Stirn. »Ja? Also uns erscheinen die Kerlchen ganz schön pfiffig. Ständig rauben sie den Pflegern etwas und geben es nur gegen Bananen wieder her, und sie haben ein recht kompliziertes Familienleben. Man kann das hier sehr schön beobachten. Allerdings werden sie angriffslustig, wenn man sie verärgert. In Afrika gelten sie als Plagegeister, die in Häuser einbrechen oder Wanderer überfallen und belagern, um ihren Proviant zu stehlen. Dumm sind sie jedenfalls nicht!«
Stephen lächelte überlegen. »Was sich dem Beobachter als Intelligenzleistung darstellt und was sich dann unter Laborbedingungen nachweisen lässt, differiert leider oft. Man neigt dazu, eigene Gefühle und Motivationen in das Verhalten der Tiere hineinzuinterpretieren …«
»Was machen denn die Schimpansen?«, unterbrach ihn Daphne, bevor Bernhard sich dazu äußern konnte. »Hat sich da was gebessert?«
Bernhard schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich. Sie sind ein bisschen aufgeschlossener, ihre Pfleger scheinen sie zu mögen, da laufen sie nicht sofort weg, aber vor Publikum haben sie nach wie vor Angst …«
»Toby und Eddy haben wir aus dem Zirkus gerettet«, erklärte Daphne. »Sie waren total verstört. Ihr Dompteur hat sie gezwungen, in Menschenkleidung aufzutreten, Purzelbäume zu schlagen und Rad zu fahren … Jetzt sind sie schon so lange hier, aber sie trauen Menschen immer noch nicht. Wir können die Besucher nicht zu nah an sie heranlassen, sonst sitzen sie nur Arm in Arm in einer Ecke und jammern. David tüftelt an einer Anlage, die es den Besuchern ermöglicht, sie zu beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Das könnte sogar ganz spannend sein, besonders für Kinder. Wenn sie sich anschleichen und leise sein müssen, um die Affen nicht zu stören.«
»Sie … äh … nehmen hier große Rücksicht auf die angenommenen Befindlichkeiten der Tiere«, bemerkte Stephen. »Verstehen Sie mich richtig, Sie folgen da sicher einem interessanten Konstrukt, aber die allgemeine Lehrmeinung ist doch die, dass das Verhalten der Tiere durch Instinkte bestimmt wird sowie natürlich durch Hunger, Durst, Schmerz, sexuelle Bedürfnisse …«
Bernhard sah ihn gelassen an. »Ist das bei Menschen anders?«, fragte er. »In der amerikanischen Verfassung gehört das Streben nach Glück zu den Grundrechten. Wir werden durch das Streben nach Glück getrieben. Und das besagt doch wohl, dass wir unsere Grundbedürfnisse zu allseitiger Befriedigung erfüllt haben möchten.«
»Die natürliche Reaktion auf äußere und innere Stimuli ist das Streben nach Glück?«, fragte Stephen verwirrt. »Aber ein Tier kann … Tiere denken und fühlen nicht. Und einen Willen haben sie erst recht nicht, sie …«